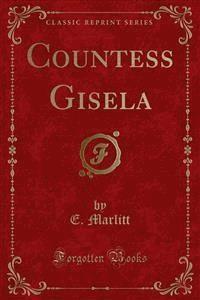1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
In E. Marlitts Roman "Die zwölf Apostel" entfaltet sich eine fesselnde Erzählung, die sich zwischen romantischen Sehnsüchten und sozialer Realität bewegt. Durch lebendige Charaktere und einen klaren, bildhaften Schreibstil wird das Leben und die umgebende Landschaft der kleinen Gemeinde von K., deren Schicksalsfäden eng miteinander verwoben sind, eindrucksvoll skizziert. Marlitt gelingt es, die inneren Konflikte ihrer Protagonisten mit einer feinen psychologischen Nuancierung darzustellen, was den Leser nicht nur in die Handlung hineinzieht, sondern auch zum Nachdenken über menschliche Beziehungen und die Herausforderungen des Lebens anregt. Das Werk bindet sich in die Tradition des deutschen Realismus ein und bietet gleichzeitig romantisch-idealisierte Perspektiven auf das ländliche Leben des 19. Jahrhunderts. E. Marlitt, geboren 1825 in der Nähe von Weimar, zählt zu den herausragenden Frauen der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Ihre Erziehung und der frühe Einfluss literarischer Klassiker prägten ihren Schreibstil, während ihre eigenen Erfahrungen als Frau in einer von Männern dominierten Gesellschaft ihr tiefes empathisches Verständnis für die Herausforderungen ihrer Figuren verstärkten. Marlitts Werke, oft durch persönliche Erfahrungen inspiriert, spiegeln die gesellschaftlichen Umwälzungen ihrer Zeit wider und geben einem breiten Publikum Einblicke in die Seelenwelt ihrer Protagonisten. Dieses Buch ist eine Entdeckung wert für Leser, die sich für zeitgenössische gesellschaftliche Fragestellungen interessieren und die Feinheiten menschlicher Beziehungen erkunden möchten. Marlitts kluge Kombination aus tiefgründigen Themen und fesselndem Erzählstil macht "Die zwölf Apostel" zu einem faszinierenden Literaturschatz, der auch heute noch berührt und zum Nachdenken anregt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die zwölf Apostel
Inhaltsverzeichnis
Die zwölf Apostel.
Am äußersten Ende einer kleinen mitteldeutschen Stadt, da, wo die letzten Gäßchen steil den Berg hinaufklettern, lag das alte Nonnenkloster. Es war ein unheimliches Gebäude mit seinen eingesunkenen Fenstern, seinen kreischenden Wetterfahnen und den unaufhörlich um den First kreisenden Dohlenschwärmen. Aus dem Mauergefüge quollen dicke Grasbüschel und zwischen den zerbröckelten Steinzierrathen über dem gewölbten Thorweg nickte ein kleiner Wald von Baumschößlingen. Wie zwei altersschwache Cameraden, deren einer den anderen stützt, lehnten sich der Bau und ein uraltes Stück Stadtmauer aneinander, und das war vortheilhaft für das Kloster, denn die Mauer war sehr dick; man hatte ihren breiten Rücken mit Erde belastet, und nun sproßte und blühte es da droben so üppig, als gäbe es keine Mauersteine unter der Erdschicht. Freilich war das Ganze nur ein längliches Blumenbeet, von einem kaum fußbreiten Weg durchschnitten; dafür war es aber auch sauber gehalten wie ein Schmuckkästchen. An den Wegrändern blühte ein Kranz weißer Zedernelken; Lilien und Nachtviolen standen auf dem Beet, und die glührothen Früchte der Erdbeeren, sammt ihren breiten gezackten Blättern, mischten sich mit dem wilden Thymian, der, am Mauerrand hinabkletternd, seine feinen Zweige behutsam in die Steinritzen legte. Hinter der Mauer lag der ehemalige Klostergarten; jetzt ein wüster, ungepflegter Grasfleck, auf dem die wenigen Ziegen der Klosterbewohner ihr karges Futter suchen durften. Aber an der Mauer selbst stand eine ganze Wildniß von Syringen und Haselstauden; die bildeten droben am Gärtchen eine grüne undurchdringliche Wand. Die Syringen hingen im Frühjahr ihre blauen und weißen Blüthentrauben über das einzige hölzerne Bänkchen des kleinen Gartens, und ein alter Kastanienbaum breitete seine Aeste weit über die Mauer bis in die Straße hinein, deren armselige Häuserreihe hier mündete und von dem letzten Haus nur die Rückwand ohne Fenster sehen ließ.
Es würde wohl nie ein fremder Fuß diesen entlegenen, sehr wenig einladenden Stadttheil betreten haben, wenn nicht das alte Kloster ein Juwel neben sich gehabt hätte, ein köstliches Denkmal längst versunkener Zeiten, die Liebfrauenkirche, um deren zwei schlanke Thürme eine ganze reiche Sagenwelt webte und blühte. Die Kirche stand unbenutzt und verschlossen und nie mehr seit dem letzten Miserere der Nonnen hatten heilige Klänge durch die mächtigen Säulengänge gerauscht. Die ewige Lampe war verlöscht; die Orgel lag zertrümmert am Boden; um den verlassenen Hochaltar flatterten Schwalben und Fledermäuse, und die prächtigen, anspruchsvollen Grabmonumente alter untergegangener Geschlechter ruhten unter dichten Staubschichten. Nur die Glocken, deren wundervolles harmonisches Zusammenklingen in der ganzen Gegend berühmt war, schwangen sich noch allsonntäglich über den verwaisten Hallen, aber ihr wehmüthiger klang vermochte nicht die Gläubigen dahin zurückzuführen.
Daß man neben diesem Prachtbau mit seinen granitnen Mauern und Säulen das hinfällige Kloster stehen ließ, hatte seinen Grund in der weisen Oekonomie der löblichen Stadtbehörde. Es hatte längst seine eigentliche Bestimmung verloren. Luther’s gewaltiges Wort hatte auch hier die Riegel gesprengt. Die zur neuen Lehre bekehrte Stadt duldete die gottgeweihten Jungfrauen, bis die letzte derselben eines seligen Totes verblichen war; dann aber fiel das Klostergebäude der Stadt-Verwaltung anheim, die es einem Theil der Armen als Asyl einräumte. Seit der Zeit sah man hinter den vergitterten Fenstern statt der bleichen Nonnengesichter bärtige Züge, oder den Kopf einer emsig stickenden und keifenden Hausmutter, während auf den ausgewaschenen Steinplatten des Hofes, welche früher nur die leise Sohle und die klösterliche Schleppe der frommen Schwestern berührt hatten, eine Schaar wilder, zerlumpter Kinder sich tummelte. Außer dem blühenden Gärtchen auf der Mauer aber hatte das alte Haus noch eine freundliche Seite, auf welcher der Blick ausruhen konnte, wenn er all das hier zusammengedrängte menschliche Elend gesehen hatte. Die Ecke, an welche die Stadtmauer stieß, zeigte vier sauber gewaschene Fenster mit weißen Vorhängen, von denen das letzte so auf das Gärtchen mündete, daß es bequem als Thür benutzt werden konnte, was jedenfalls auch geschah, denn an gewissen Tagen in der Woche war es weit geöffnet. Ein Seil voll feiner Wäsche zog sich von da bis zum Kastanienbaum, und man konnte sehen, wie eine weibliche Gestalt, die aufgesteckte Schürze voll Klammern, geschäftig aus- und einstieg. Das war die alte Jungfer Hartmann. Sie hieß eigentlich Suschen, wurde aber in der ganzen Stadt schon so lange „die Seejungfer“ (Libelle) genannt, daß viele Leute ihren eigentlichen Namen gar nicht mehr wußten. Und das kam von ihrem absonderlichen Aeußern, nicht etwa um ihrer flüchtigen Grazie oder Farbenschönheit willen – die haben mit dem sechszigsten Lebensjahre selten mehr etwas gemein – es geschah vielmehr des seltsam huschenden, scheuen Ganges wegen, mit dem diese lange, gestreckte Gestalt durch die Straßen eilte. Im Uebrigen glich sie viel eher einer Fledermaus, vermöge ihrer scharf gebogenen, fast durchsichtig mageren Nase, ihrer aschfarbenen Haut und der großen glanzlosen Augen, welche sich meist schüchtern unter den äußerst dünnen Augendeckeln verbargen. Dieser Eindruck wurde durch das schwarze Bürgerhäubchen vervollständigt, das, knapp anschließend, kein Haar auf der Stirn sehen ließ und zu beiden Seiten abstehende Spitzengarnirungen hatte. Die Seejungfer war das Kind eines sehr armen Schusters, der sie und ihren etwas älteren Bruder Leberecht streng und gottesfürchtig erzogen hatte und für beide Kinder keine kühneren Wünsche hegte, als daß Suschen später im Dienst ihr redliches Brod erwerbe und sein Erstgeborner ihm dereinst auf dem Dreibein gegenüber sitzen und das einsame Schusterhandwerk betreiben werde. Das stille, sanfte Suschen, für dessen Ideenkreis die engen Wände der Schusterstube vollkommen genügten, war ganz mit dem Lebensziel einverstanden, das der Vater ihr vorgesteckt. Dem jungen Leberecht jedoch wuchsen die Flügel um ein Beträchtliches länger, ja, sie reichten sogar bis zur Gottesgelahrtheit hinan. Er besaß glänzende geistige Fähigkeiten, welche ein eiserner Fleiß unterstützte, und so gelang es ihm denn auch, mittelst eines Stipendiums, Theologie zu studiren. Er hatte bereits sein Examen ausgezeichnet bestanden und einige Mal bei großem Zudrang in seiner Vaterstadt vortrefflich gepredigt, als er infolge seiner rastlosen geistigen Thätigkeit auf das Krankenlager sank, um sich nie wieder zu erheben – er starb an der Lungenschwindsucht.
Suschen, die den Bruder wie ein höheres Wesen verehrt hatte, erlag fast ihrem Schmerz, aber sie hatte ein halbverwaistes Kind zu pflegen und zu erziehen; deshalb mußte sie sich aufraffen, was sie auch redlich that. Mit dem Kind hatte es folgende Bewandtniß. Einmal, als bereits der junge Leberecht täglich nach Prima wanderte und Suschen schon seit längerer Zeit von den ehrbaren Bürgersfrauen mit „Jungfer“ titulirt wurde, geschah es, daß sich der Storch „sehr verspäteter und unnöthiger Weise“, wie sich der entsetzte Schuster ausdrückte, auf dessen Dach abermals niederließ; seit dem letzten Kind, das er todt gebracht hatte, war er neun Jahre ausgeblieben. Mit schwerem Herzen und sorgenvoller Stirn zog die Meistersfrau die wurmstichige Wiege aus dem dunkelsten Bodenwinkel, verjagte die erschrockenen Spinnen aus dem kleinen Bett, fuhr mit einem nassen Tuch über dessen schmale Seitenwände, worauf alsbald großgemalte Engelsköpfe mit brennendrothen Backen und himmelblauen Augen triumphirend erschienen, und stellte es sacht neben ihr Bett, unweit des alten Dreibeins, auf welchem der Schuster mit wahrer Wuth eine unglückliche Stiefelsohle behämmerte.