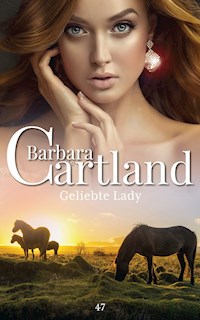Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Barbara Cartland Ebooks Ltd
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die zeitlose Romansammlung von Barbara Cartland
- Sprache: Deutsch
Trydon Raven, nun Herzog von Westacre muss sich aus in einer Nacht- und Nebelaktion kurzerhand aus dem Haus seiner Patin flüchten, um einer Intrige einer heiratswütigen jungen Dame und deren Mutter zu entgehen, die ihn in eine prekäre Lage bringen könnte. Auf seiner Flucht trifft er auf Georgia, die mit einer Gruppe von Männern Schmugglerware über den Ärmelkanal transportiert. Die Stiefmutter erpresst die junge Georgia und die Männer, die auf dem Besitz arbeiten, auf gemeinste Weise, dieses gefährliche Unterfangen immer wieder durchzuführen, um ihren teuren Lebensstil in London zu finanzieren. Um nicht ins Schussfeuer zu geraten, gibt sich der Herzog als ein vermeintlicher Handlanger aus und hilft beim Abladen der Schmugglerware. Bald findet sich der Herzog inkognito auf Four Winds, das Georgias Familie gehört, da er sich verletzt hatte. Er erfährt, dass sich Georgia in einer brenzligen Situation befindet und die Stiefmutter seit dem Tode des Vaters sie immer mehr ins Verderben bringen will.
Kann er Georgia helfen, um dem Teufelskreis zu entfliehen – und nicht noch weiter in Schmuggelei und Spionage verwickelt zu werden? Kann er sie davon überzeugen, dass nicht jedes Mitglied der „feinen Gesellschaft“ hinterhältig ist? Können der Herzog und Georgia, Georgias jüngeren Bruder Charles aus seiner misslichen Lage helfen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieb Des Herzens
Barbara Cartland
Barbara Cartland E-Books Ltd.
Vorliegende Ausgabe ©2024
Copyright Cartland Promotions 1968
Gestaltung M-Y Books
www.m-ybooks.co.uk
Hörbücher
Hören Sie sich alle Ihre Lieblings-Hörbücher von Barbara Cartland kostenlos auf Spotify an, richten Sie einfach die Kamera Ihres Handys auf diesen Code oder klicken Sie hier.
1
»Hol's der Teufel, du hast schon wieder gewonnen!« Der Herzog von Westacre stand von dem mit grünem Flanellstoff bezogenen Tisch auf und warf die Karten durch das Zimmer. Sie flogen über den Teppich, die eleganten, eingelegten Möbel und landeten auf einem Damast bezogenen, spindelbeinigen Sofa.
Sein Freund schob den Stuhl vom Tisch zurück und lachte.
»Du entwickelst dich allmählich zu einem schlechten Verlierer, Trydon.«
»Das ist schon der dritte Abend, an dem du mich beim Ecarte besiegst«, antwortete der Herzog. »Und ich habe mir schon geschworen, nie mehr mit dir Pharo zu spielen.«
»Du kennst doch das Sprichwort, nicht wahr?« fragte Captain Pereguine Carrington.
»Nein«, antwortete der Herzog ungnädig, »und ich bin sicher, dass es mich nicht interessiert.«
Pereguine Carrington lachte wieder.
»Ich will es dir trotzdem sagen«, erklärte er. »Pech im Spiel, Glück in der Liebe.«
Der Herzog warf ihm einen ärgerlichen Blick zu, ging durch den Salon und öffnete zum Garten hin eines der hohen französischen Fenster. Er empfand die Nachtluft, während er dastand und hinausblickte, als frisch und wohltuend. Ein paar Stunden zuvor waren die Blumenbeete, die den Wasserlilienteich umgaben und die Wege hinunter zum künstlichen See säumten, verschwenderisch mit Kerzen beleuchtet gewesen. Aber sie waren jetzt niedergebrannt, und nun schaukelten nur noch einige Lampions im Wind und erinnerten daran, dass der Garten vorher ein Ort der Festlichkeit und des Frohsinns gewesen war.
»Einverstanden?« fragte Pereguine Carrington vom Spieltisch herüber.
»Einverstanden, womit?« fragte der Herzog, und seine Stimme klang immer noch ungnädig. »Glaubst du etwa, ich habe diesen Abend genossen? Guter Gott, Pereguine, ich kam mir vor wie ein Hase! Nun weiß ich, was es heißt, gejagt zu werden. Ja, gejagt von diesen verdammten heiratswütigen Mamas und ihren zimperlichen, unreifen Sprösslingen, die noch grün hinter den Ohren sind.«
»Sie sind jetzt alle weg«, sagte Pereguine tröstend. »Die gnädige Frau hat vor ungefähr zwei Stunden verstohlen hereingeschaut. Ich vermute, dass sie dir eine gute Nacht wünschen wollte. Aber als sie sah, wie sehr du mit den Karten beschäftigt warst und mit einem finsteren Gesicht die Stirn runzeltest, zog sie sich zurück und winkte mir nur kurz mit der Hand zu.«
Der Herzog drehte sich zu seinem Freund um und besaß den Anstand, beschämt auszusehen.
»Ich nehme an, ich sollte meiner Taufpatin dankbar dafür sein, dass sie sich überhaupt für mich interessiert«, sagte er. »Aber hol's der Teufel, ich will eben nicht verheiratet werden, und damit basta. Dieses ganze Gerede von einer Herrin im Schloss und einer Gastgeberin in London! Ich muss mit der Frau leben, nicht meine Patin! Und nicht diese verdammten Treuhänder, die mir mein Leben zur Hölle machen mit ihrem unaufhörlichen Gerede darüber, was man von mir erwartet.«
»Nun, du bist ein Herzog«, sagte Pereguine fröhlich. »Mit anderen Worten, du kannst nicht die süßen Früchte genießen, ohne dafür zu bezahlen.«
»Ich wollte nie Herzog werden; ich habe nie damit gerechnet! Wenn überhaupt irgendetwas in mir den Wunsch, allein gegen die ganze napoleonische Armee zu kämpfen, wecken könnte, dann die Tatsache, dass er meinen Cousin getötet hat.«
»Übertreibst du da nicht ein wenig, Trydon?« fragte Pereguine gleichmütig. »Die meisten Burschen würden ihren rechten Arm für deine Stellung hergeben.«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte der Herzog gereizt. »Ich bin undankbar das denkst du doch, nicht wahr? Natürlich schätze ich es, nun eine bedeutende soziale Stellung einzunehmen, nachdem ich so viele Jahre lang nur als ein armer Verwandter galt. Natürlich genieße ich mein Vermögen, meine Stellung bei Hof und die Tatsache, dass die Leute sich respektvoll meine Meinung anhören.«
»Du redest wie Methusalem das alte Schnattermaul, von dem wir in Eton gehört haben«, sagte Pereguine lachend.
»Und ich komme mir genauso vor«, fauchte der Herzog. »Ich war vollkommen glücklich, bis man mit diesem Gerede über eine Heirat begann. ‚Du musst eine Herzogin haben!‘ ,Eine Frau ist in deiner Position unentbehrlich!‘ ‚Du musst Gäste empfangen, und ein Junggeselle kann das nicht!‘ Sie quälen mich die ganze Zeit damit - morgens, mittags und abends!
Und nun dieser grässliche Ball mit den Mädchen, die sich vor mir präsentieren, als wäre ich ein Sultan, der eine Konkubine sucht.«
»Nein, nein!« sagte Pereguine hastig. »Das ist ein falscher Vergleich, alter Junge. Wir haben heute Abend keine einzige Frau gesehen, die dem Typ der Konkubine entspricht!«
»Wahrhaftig nicht!«
Plötzlich gewann der Herzog seinen Humor wieder, warf den Kopf zurück und lachte so herzlich wie sein Freund.
»Hast du dieses junge Ding mit der weißen Rose im Haar gesehen?« fragte er. »Ich habe noch niemals ein so nichtssagendes Gesicht gesehen. Sie sah aus, als wäre sie mondsüchtig. Und doch glaubt meine Patin tatsächlich, dass sie für mich eine perfekte Frau abgeben würde. ‚Ihr passt vorzüglich zusammen‘ sagte sie. ‚Das Besitztum ihres Vaters grenzt im Norden an Westacre.‘«
»Oh! Aber du kannst sie unmöglich in Erwägung ziehen!« protestierte Pereguine.
»Keineswegs«, antwortete der Herzog. »Aber sie benahmen sich alle gleich und fraßen mich mit gierigen Augen auf, wenn ich mit ihnen tanzte. Ich wusste, dass jede von ihnen nur daran dachte, wie attraktiv sie mit den Westacre-Diamanten aussehen würde.«
»Das Problem bei dir ist, dass du dich allmählich zu wichtig nimmst.«
»Eigentlich nicht«, antwortete der Herzog. »In Wahrheit beginne ich nach zwei Jahren Pomp und diesem ganzen Theater ein wenig zu rebellieren. Kannst du dir vorstellen, wo ich jetzt am liebsten wäre?«
Er stand wieder auf und ging zum Fenster hinüber.
»Nein, wo?« fragte Pereguine neugierig.
»Mit dem ganzen Rest des Regiments auf der Pyrenäischen Halbinsel. Ich habe Prinny gefragt, ob ich zurückkehren darf.«
»Und was hat Seine Königliche Hoheit geantwortet?« fragte Pereguine.
»Er wurde sehr ärgerlich«, antwortete der Herzog. »Wenn es nach ihm ginge, würde er am liebsten nach den vielen Verlusten und Opfern die ganze verdammte Armee nach Hause holen. Er will verhindern, dass seine Herzöge beachte bitte, seine Herzöge! gefangengenommen oder wie der übrige Pöbel niedergeschossen werden und Napoleon einen weiteren Sieg für sich verbuchen könnte! Das Thema brachte ihn derartig in Rage, dass ich mich rasch von ihm zurückzog.«
»Du weißt, Prinny hasst den Krieg«, sagte Pereguine.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Spaß daran hat«, antwortete der Herzog. »Es scheint, als wäre Napoleon so mächtig wie nie zuvor. Er hat ganz Europa unter seiner Knute und würde alles tun, um uns zu vernichten.«
»Solange Collingwood dort ist, kann er das nicht«, antwortete Pereguine. »Wie viele Schiffe haben wir jetzt unter Segeln ... achthundertfünfzig? Napoleon wird es sich zweimal überlegen, ehe er uns angreift.«
»Meiner Meinung nach müssen wir ihn attackieren!« rief der Herzog.« Aber ich habe damit nichts mehr zu tun. Anstatt an Schlachten zu denken, muss ich mich einer Heirat erwehren!«
»Das bedeutet manchmal das gleiche«, erwiderte Pereguine lächelnd.
»Wenn du anfängst prosaisch zu werden, bist du ein Langweiler. Komm, gehen wir schlafen. Ich hoffe, es lauert uns keine von diesen einfältig lächelnden Damen im Korridor auf.«
Pereguine erhob sich langsam und sammelte einen ansehnlichen Stapel Goldguineen ein, die immer noch auf dem Kartentisch lagen. Er musste sie tragen, denn in seinen enganliegenden Hosen und seinem elegant geschnittenen Gehrock, der nicht eine Falte warf, hätte er keine einzige von ihnen untergebracht. Auf dem Weg zur Tür blieb er stehen und drehte sich zu seinem Freund um, der langsam, mit gerunzelter Stirn, durch das Zimmer ging.
»Weißt du was?« sagte er. »Du erwartest zu viel.«
»In welcher Hinsicht?« fragte der Herzog.
Pereguine sah ihn nachdenklich an.
»Eine stattliche Visage«, sagte er, »ein Salonlöwe ohnegleichen; ein begnadeter Reiter; ein gefährlicher Duellant; reich wie Krösus; ein Herzog und jetzt erwartest du noch, dich zu verlieben!«
»Sprich es nicht aus! Sei still«, unterbrach ihn der Herzog. »Mir wird schlecht von all dem. Ich wünsche mir von den Frauen nichts anderes, als dass sie mich in Ruhe lassen.«
»Das ist nicht gerade das, was du in London praktizierst«, sagte Pereguine. »Dein kleines Täubchen könnte dir eine andere Geschichte erzählen.«
»Ah, Janita!« rief der Herzog. »Sie ist anders, das weißt du sehr gut. Wenn es je eine kleine Bajadere gab, die es fertigbrachte, dass sich ein Bursche völlig entspannt und ihre Gesellschaft genießt, dann ist es Janita.«
»Sie ist zu teuer für mich«, antwortete Pereguine. »Die Braunen, die du ihr geschenkt hast, sind der Neid des Parks.«
»Sie liebt sie, weil sie zu ihrem Haar passen«, antwortete der Herzog gleichgültig, öffnete die Tür und trat vor seinem Freund in die Halle.
Ein schläfriger Lakai reichte den Herren zwei brennende Kerzenhalter. Sie waren im Grunde nicht nötig, denn die Kerzen in den silbernen Wandleuchtern flackerten immer noch, auch wenn sie schon heruntergebrannt, waren.
»Gute Nacht, schlaf gut«, sagte Pereguine voller Wärme, als sie den Treppenabsatz erreichten. »Morgen früh sieht vielleicht alles schon freundlicher aus.«
»Daran zweifle ich«, sagte der Herzog grimmig. »So wie ich meine Patin kenne, wird sie mich über diese unerfahrenen Gören ins Kreuzverhör nehmen, kaum dass ich die Augen aufgemacht habe.«
»Gott sei Dank bin ich ein Bürgerlicher«, sagte Pereguine lachend und ging zu seinem Zimmer, das am anderen Ende des Korridors lag.
Mit einem Seufzer drückte der Herzog die Klinke seiner Zimmertür. Er hätte sich gern noch weiter unterhalten, so müde er auch war. Zu seiner Überraschung war es im Zimmer dunkel. Einen Augenblick dachte er, er habe sich im Schlafzimmer geirrt. Sein Diener hätte auf ihn warten sollen, denn gleichgültig, wie spät er zu Bett ging, die Kerzen wurden immer erneuert, und wenn es in der Nacht kühl war, wurde das Feuer im Kamin geschürt.
Dass er nun über jeglichen Komfort verfügte, war einer der Vorteile, Herzog zu sein, dachte er. Es waren in der Tat Hunderte von Leuten nur dafür beschäftigt.
»Ich muss mich in der Tür geirrt haben«, dachte er und hob den Leuchter. Als das Kerzenlicht das Zimmer erhellte, verharrte er plötzlich. Nur eine Sekunde lang stand er unbeweglich da, dann entfernte er sich mit einer Geschwindigkeit, die bewies, das hinter seinem trägen Äußeren eine Wachsamkeit schlummerte, die von seinem Training in der Armee herrührte. Er schloss die Tür von außen hinter sich und rannte den Korridor hinab in das Schlafzimmer von Pereguine Carrington, der gerade seinen Satinabendrock auszog und sich überrascht zu ihm umdrehte.
»Hallo, Trydon!« rief er. »Ich dachte, du wolltest zu Bett gehen.«
Der Herzog schloss die Tür hinter sich.
»Kein Kammerdiener?« fragte er misstrauisch.
Pereguine sah ihn erstaunt an.
»Ich habe dem Burschen gesagt, er soll zu Bett gehen«, sagte er. »Er ist schon sehr betagt. Er diente vor mir meinem Vater, und es wäre ein wenig zu viel verlangt, ihn jede Nacht aufbleiben zu lassen.«
»Ich interessiere mich nicht für die Gründe, ob du einen Kammerdiener bei dir hast oder nicht«, sagte der Herzog gereizt. »Pereguine, ich muss hier weg!«
»Was willst du damit sagen?« fragte sein Freund.
»Es ist mein Ernst«, erwiderte der Herzog und stellte den Leuchter auf den Tisch. »Andernfalls sitze ich in der Falle.«
»Über was zum Teufel sprichst du?« fragte Pereguine.
Der Herzog setzte sich auf die Bettkante.
»Wer, glaubst du wohl, war eben in meinem Schlafzimmer, als ich es betreten wollte?«
»Der alte Hardy, vermute ich, oder wie immer auch deine anderen Diener heißen. Wen hast du dort zu finden erwartet?«
Der Herzog atmete tief ein.
»Hardy war nicht dort«, sagte er langsam. »Das Zimmer war dunkel, als ich die Tür öffnete, aber beim Licht der Kerze konnte ich sehen, wer in meinem Bett lag.«
»Guter Gott!« rief Pereguine. »Und wer lag in deinem Bett?«
»Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube«, sagte der Herzog, »dass es das blonde Ding ist, mit dem ich zu Beginn des Abends und gleich nach dem Dinner getanzt habe.«
»Das ist Isobel Dalguish«, sagte Pereguine. »Sie sieht nicht übel aus, aber ihre Mutter ist ein Drachen, der die Tochter unbedingt verkuppeln will. Freddy Meilington erzählte mir, dass sie in der letzten Saison hinter ihm her war, und er hatte alle Mühe, sie loszuwerden. Er musste sogar damit drohen, London zu verlassen. Sie stürzte sich auf ihn, wo immer er auftauchte.«
»Offenbar nehme ich nun Freddy Meilingtons Stelle ein«, grollte der Herzog.
»Verdammt schwierige Lage«, bemerkte Pereguine.
»Ich habe dir gesagt, ich gehe weg«, sagte der Herzog energisch. »Jetzt, sofort!«
»Lieber Himmel, ist das vernünftig?« fragte Pereguine.
»Du bist blind, wenn du die Folgen nicht siehst, falls ich hierbleibe«, erwiderte der Herzog. »Ich gehe jede Wette ein, dass ihre Mama irgendwo im Korridor lauert und nur darauf wartet, dass ich sicher in meinem Schlafzimmer bin. Dann stürzt sie herein und führt eine Schmierenkomödie auf.«
»Guter Gott, daran habe ich noch nicht gedacht«, warf Pereguine ein.
»Aber ich«, sagte der Herzog grimmig. »Ich bin nicht so ein Grünschnabel. Mir ist völlig bewusst, dass mir unter diesen Umständen nichts anderes übrigbliebe, als um die Hand des Mädchens anzuhalten.«
»Angenommen, du gehst nicht in dein Zimmer zurück und verbringst die Nacht hier bei mir?« schlug Pereguine vor.
»Was für Gründe auch immer ich vorbringen würde«, erwiderte der Herzog, »mein Wort stünde gegen das ihre, ich hätte sie darum gebeten, in mein Schlafzimmer zu kommen. Es würde natürlich außerordentlich verworfen erscheinen, eine solche Einladung angenommen zu haben. Aber zweifellos würde der irreparable Schaden, den ihr Ruf dadurch nähme, mehr als ausreichend durch die Genugtuung ausgeglichen, dass sie immerhin die Herzogin von Westacre würde.«
»Ich muss sagen, du bist ganz schön clever, wenn die Gefahr des Ehejochs droht«, bemerkte Pereguine. »Wenn ich nur wüsste, was wir tun sollen!«
»Besäßest du auch nur ein bisschen Verstand, dann hättest du schon längst das getan, was ich jetzt machen werde«, entgegnete der Herzog. »Du leihst mir deine Kleider. Glücklicherweise haben wir die gleiche Größe. Schon in Oxford habe ich mir deine Sachen ausgeliehen, weil es dir besser ging als mir und du dir einen teureren Schneider leisten konntest.«
Pereguine deutete mit der Hand auf seinen Kleiderschrank.
»Alles, was mir gehört, gehört auch dir«, sagte er theatralisch.
Der Herzog vergeudete keine Zeit. Er zog Pereguines Reithosen an, band sich mit geübter Hand eine steife, weiße Binde um den Hals und schlüpfte in den dunkelgrauen Kordreitrock, der nur von Meisterhand geschneidert worden sein konnte.
»Gott sei Dank haben wir auch die gleiche Schuhgröße«, sagte der Herzog, als er ein Paar Schaftstiefel anzog, die mit Champagner auf Hochglanz poliert worden waren.
»He, nicht so schnell, alter Junge!« protestierte Pereguine. »Das ist mein neuestes Paar. Ich habe sie erst ein einziges Mal getragen.«
»Kaufe dir auf meine Rechnung ein Paar neue«, erwiderte der Herzog.
»Das werde ich ganz gewiss tun«, antwortete Pereguine. »Und würdest du nun bitte so freundlich sein und mir sagen, was ich Ihrer Gnaden morgen früh erzählen soll? Sie sah uns zusammensitzen, ehe sie zu Bett ging, und wenn du nicht gefunden wirst, werde ich der erste sein, den sie ins Kreuzverhör nimmt.«
»Du kannst meiner Patin erzählen, ich hätte eine Nachricht erhalten, in der man mir mitteilt, ich würde dringend in militärischen Angelegenheiten gebraucht.«
»Soll ich das deiner Patin erzählen?« fragte Pereguine boshaft.
»Nein, das soll sie selbst merken. Aber dass du es weißt, niemand mehr wird mich zu einer Ehe zwingen können. Niemand wird mich mehr belästigen! Ich habe genug davon! Ich bleibe Junggeselle, da kannst du sicher sein, und die Westacre-Diamanten können von mir aus so lange im Safe liegenbleiben, bis sie schwarz werden.«
Pereguine lachte. Er lachte immer noch, als der Herzog das Zimmer verließ und die Tür ungewöhnlich leise hinter sich schloss. Die Vorstellung, dass Seine Gnaden auf Zehenspitzen den Korridor entlangschlich, um nicht gehört zu werden, brachte Pereguine derartig zum Lachen, dass es einiger Zeit bedurfte, bis er sich beruhigt hatte und sich nun vollends für die Nacht auszog.
In der Zwischenzeit erreichte der Herzog unbehelligt die Stallungen, weckte einen Burschen auf, der einen Knecht wach rüttelte, der wiederum den Stallmeister Seiner Gnaden aus dem Schlaf riss. Nach einiger Zeit, die dem Herzog wie eine äußerst lästige Verzögerung vorkam, war sein bester schwarzer Zuchthengst gesattelt, und nachdem er Anweisungen gegeben hatte, seine übrigen Pferde und den Zweispänner nach London zu bringen, machte sich der Herzog über die Downs auf den Weg.
Eine unbändige Erleichterung überkam ihn, als das große Haus und die ehelichen Gefahren hinter ihm lagen, und er ließ seinem Pferd die Zügel frei. So ritt er über eine Stunde, als sich die Morgendämmerung ankündigte. Dichter Nebel verhüllte die Landschaft, und er bemerkte, wie das Land abfiel. Zu seiner Linken hörte er immer noch das Rauschen des Meeres. Aber sein Pferd begann zu ermüden, und sie hatten es auch beide nicht mehr so eilig wie zu Beginn ihres Ritts.
Vorsichtig suchten sie sich einen Weg durch Stechginsterbüsche und über unebene, steinige Pfade, wo sie leicht hätten stürzen können. Der Herzog beugte sich vor und tätschelte seinem Pferd den Hals. Er erkannte jetzt, dass es tadelnswert leichtsinnig gewesen war, in der Dunkelheit zu galoppieren. Schon ein Kaninchenloch hätte ein verstauchtes Fußgelenk bewirken können oder, was ihn anbetraf, ein gebrochenes Genick.
Er war ein zu guter Reiter, um die Gefahren nicht zu kennen. Nun, als der nasse Nebel sie einhüllte, ritt er vorsichtig weiter und suchte rechts und links nach einem Orientierungspunkt, der ihm sagte, wo er sein konnte. Er war als Junge oft genug über die Downs geritten, aber nun stellte er fest, dass er sich verirrt hatte, obwohl er wusste, dass die allgemeine Richtung, die er gewählt hatte, immer noch stimmte. Das Land fiel weiterhin ab, und er nahm an, er würde bald eine der vielen Buchten, die die Südküste säumten, erreichen.
Plötzlich glaubte er nicht weit entfernte Stimmen zu hören. Instinktiv zügelte er sein Pferd und saß ruhig und still da. Er lauschte auf ein weiteres Geräusch. Dann hob der Wind plötzlich die Nebeldecke, und er hörte jemanden rau flüstern: »Da ist einer.«
»Soll ich ihm eine Kugel durch den Kopf jagen?«
Der Herzog hatte immer ein gutes Gehör, aber nun hielt er doch den Atem an und fragte sich, ob er richtig gehört habe, als eine dritte Stimme, und erstaunlicherweise war es die einer Frau, sagte: »Dummköpfe! Wollt ihr uns die Küstenwache auf den Hals hetzen? Das wird der Bootsmann sein, den Philip uns schicken wollte.«
»Ah ja, da ist er«, sagte einer der Männer.
Plötzlich und unmittelbar sah der Herzog den Mann vor sich, der eben gesprochen hatte. Es war ein Fischer mit hohen Watstiefeln und einer Mütze, die er tief in die Stirn gezogen hatte. Er sah nicht gewalttätig aus, obwohl er in seiner Hand eine geladene und auf ihn gerichtete Pistole hielt. Dennoch hatte der Herzog das Gefühl, dass der Mann nicht zögern würde, sie zu benutzen, was immer die Frau auch sagen mochte.
»Wer bist du?« fragte der Mann scharf.
Ohne nachzudenken, gab der Herzog die richtige Antwort.
»Philip schickt mich!«
Wenn der Mann darüber erleichtert war, zeigte er es nicht.
»Komm mit, du hast dich verspätet!«
Der Herzog folgte ihm. Sein Pferd suchte sich vorsichtig einen Weg über den rauen, steinigen Strand, der nun das Gras der Downs abgelöst hatte. Sie kamen in eine Bucht. Als der Nebel sich hob und der Wind ihn in Schwaden über den Weg blies, wurde es dem Herzog einen Augenblick lang unbehaglich zumute. Die Bucht war schmal und ausgewaschen, vielleicht von einem vor langer Zeit ausgetrockneten Fluss. Zu beiden Seiten stieg das Ufer steil an, so dass er glaubte, in einen schmalen Tunnel zu reiten, während er dem Mann mit der Laterne folgte.
Und plötzlich tauchten wie durch Zauberhand weitere Männer vor ihm auf, vielleicht ein Dutzend, alles Fischer, die ein Boot auf den steinigen Strand zogen. Nun wusste der Herzog, warum sie sich vor ihm gefürchtet hatten und warum sie die Küstenwache nicht auf sich aufmerksam machen durften. Diese hätte nur die Fässer zu sehen brauchen, die im Heck des Schiffes lagen, oder die Warenpakete, die sich hoch im Bug türmten, um zu wissen, dass es Schmuggler waren. Es waren gefährliche Männer, dachte der Herzog, die nicht zögern würden, ihm die Kehle durchzuschneiden und ihn ins Meer zu werfen, wenn sie Verdacht gegen ihn schöpften.
»Ihr habt euch verspätet.«
Es war die Frau, die vorher schon einmal gesprochen hatte. Ihre Stimme klang kultiviert, und der Herzog sah sie erstaunt an. Sie trug die gleichen hohen Watstiefel wie die Fischer, und er stellte erschrocken fest, dass sie eine Hose anhatte. Ihr schäbiger, altmodischer, langer Mantel war vielleicht Ende des Jahrhunderts in Mode gewesen. Ein schwarzes Tuch bedeckte ihr Haar.
»Los, beeilt euch!« sagte sie ungeduldig. »Die Männer sind müde und können die Fracht nicht allein ausladen.«
»Nein, sicher nicht«, stimmte ihr der Herzog zu. Sie blickte misstrauisch zu ihm auf, aber weil es noch zu dunkel und zu neblig war, konnte sie sein Gesicht nicht sehen. Als er vom Pferd stieg, gab sie den Männern Befehle.
»Ladet zuerst die Fässer aus, sie sind am schwersten.«
Der Herzog war nicht ganz sicher, wie es geschah, aber plötzlich hatte er ein Fass Weinbrand auf den Schultern, und dann folgte er den anderen Männern in eine niedrige Höhle, die sie zwang, sich tief zu bücken, einen winkeligen Gang entlang, der durch die Felsen führte, dann einige gebrechliche Stufen hinauf und durch einen weiteren Gang, der anstieg und immer weiter anstieg. Schließlich wurde eine schwere Tür aufgestoßen, und er befand sich in einem langen, dunklen Keller, wie er es erwartet hatte. Er hatte keine Ahnung, ob es der Keller eines Privathauses oder die Krypta einer Kirche war.
Als er mit den anderen Männern den Weg zurückging, die gebrechlichen Stufen hinab, wobei er feststellte, dass sie mit Seilen zusammengehalten waren, versuchte er sich daran zu erinnern, was er schon alles über Schmuggler gehört hatte.
Es gab an der Süd- und der Ostküste Englands kein Dorf und keinen Weiler, der nicht in Verdacht stand, ein Schmugglernest zu sein. Die Dorfbewohner und Bauern waren viel zu eingeschüchtert, um jemanden zu verraten, und was noch wesentlicher war, die meisten von ihnen waren auf die eine oder andere Art und Weise selbst in den Schmuggel verwickelt.
Ein weiteres Fass wurde dem Herzog auf die Schultern geladen. Diesmal erschien es ihm unglaublich schwer. Er sagte sich im Stillen, wenn ich das nächste Mal Branntwein trinke, werde ich mich hieran erinnern und ihn noch mehr schätzen, als ich es bisher schon getan habe.
Wieder ging es die Stufen hinauf, den steinigen Gang entlang in den Keller. Beim dritten Mal war es ihm eine Qual, den Rücken krümmen zu müssen, während er durch die Höhle zurück zum Meer lief. Die Männer arbeiteten schweigend, sie legten keine Pause ein und konzentrierten sich nur darauf, die Fracht in Sicherheit zu bringen. Es war ihm fast unmöglich, die Gesichter der anderen zu erkennen, denn nur gelegentlich beleuchtete eine flackernde Laterne den Weg. Aber nun hatte sich der Nebel gelichtet, und die ersten Sonnenstrahlen glitzerten auf dem ruhigen Meer.
Als der Herzog ein schweres Warenpaket vom Bug des Schiffes hochheben wollte, glitt er auf den mit Tang bedeckten Steinen aus. Er stürzte und verletzte sich die Hand an einem Stück Draht, welches sich von einem der Warenpakete gelöst hatte. Ungewollt stieß er einen lauten Fluch aus, und sofort stand die Frau, die er während der Arbeit nicht bemerkt hatte, neben ihm.
»Pst! Keinen Laut!« befahl sie, und dann fragte sie in einem veränderten Tonfall. »Habt Ihr euch verletzt?«
»Nicht sehr«, sagte der Herzog kläglich und sah, wie das Blut von seiner Hand tropfte. Er stellte fest, dass Pereguines Schaftstiefel nicht das passende Schuhwerk waren, um damit über nasse Steine zu laufen, aber das war nicht der rechte Augenblick, um darüber zu sprechen.
»Ihr habt euch die Hand aufgerissen«, bemerkte die Frau. »Das ist eure letzte Fracht, danach werde ich mir eure Hand ansehen.«
Er hob den Warenballen an und trug ihn durch den langen, beschwerlichen Gang in den Keller. Dort setzte er ihn ab, und als er sich umblickte, stellte er fest, dass die Güter auf dem Fußboden sehr wertvoll waren. Irgendwer würde eine Menge Geld verdienen, dachte er, als er auf dem Weg zum Boot zurück das Blut aus seinem verletzten Daumen saugte.
Vielleicht war er langsamer gewesen als die anderen Männer, denn als er den Ausgang der Höhle erreichte, waren sie so plötzlich verschwunden, wie sie aufgetaucht waren. Als er zum Schiff hinüberblickte, das jetzt wie ein ganz gewöhnliches Fischerboot aussah mit den Netzen, die zum Trocknen aushingen, glaubte er fast, er habe die ganze Geschichte nur geträumt. Aber da war dieser verletzte Daumen und die Frau in ihren hohen Watstiefeln und dem altmodischen Mantel, was ihm nur zu deutlich bewies, dass es kein Fantasiegebilde von ihm war.
Als er sich ihr näherte, sagte sie: »Zeigt mir eure Hand. Das ist eine hässliche Wunde, und sie ist schmutzig. Sie muss gesäubert werden, sonst entzündet sie sich.«
»Ich komme schon allein zurecht«, sagte der Herzog. »Gibt es hier in der Nähe ein Gasthaus?«
Sie sah zu ihm auf, und zum ersten Mal bemerkte er, wie jung sie war. Ihr Gesicht war schmutzverschmiert, aber lange, schwarze Wimpern beschatteten ihre großen Augen.
»Ihr dürft kein Gasthaus betreten«, sagte sie. »Das sollte euch doch klar sein. Die Küstenwache stellt überall Fragen und schnüffelt herum.«
»Schön, dann werde ich die Küste entlangreiten«, sagte der Herzog.
»Aber zuerst muss ich eure Hand verbinden«, sagte sie wie zu sich selbst. »Kommt mit! Hoffen wir, dass uns niemand sieht.«
Sie drehte sich um und ging voraus, als wäre es selbstverständlich, dass er ihr folgte. Weil er neugierig war, protestierte er nicht und tat wie ihm befohlen.
Er wäre lieber geritten, aber weil sie zu Fuß ging, nahm er sein Pferd am Zügel und folgte ihr. Nun spürte er seinen schmerzenden Rücken und wie benommen er von der anstrengenden Arbeit und der schlaflosen Nacht war.
Pereguine hätte sich bestimmt köstlich amüsiert, dachte der Herzog, wenn er gesehen hätte, wie er Weinbrandfässer schmuggelte.
Als sie die Bucht verließen, sah der Herzog, was er zu sehen erwartet hatte. Hoch oben am Rande der Bucht stand hinter einer Baumgruppe, vor dem Wind des Meeres geschützt, ein Haus.
Es war ein anheimelndes Gebäude und stammte zweifellos aus elisabethanischer Zeit, denn seine warmen, roten Backsteine waren altersgebleicht. Mit seinen ummauerten Gärten auf der einen und den alten Stallungen auf der anderen Seite war es weder vom Meer noch vom Land aus einzusehen. Ein perfektes Versteck für Schmuggler, dachte der Herzog, ob mit oder ohne Wissen der Besitzer!
Die Frau hatte die Stallungen erreicht. Sie blieb dort einen Augenblick stehen und rief nach jemandem, und als der Herzog sie einholte, kam ein sehr alter, magerer, faltiger Diener aus einer der offenen Boxen geschlurft.
»Sorge für das Pferd, Ned, und reibe es ab«, sagte die Frau. »Es wird bald wieder gebraucht.«
Der Diener erwiderte nichts darauf, aber der Herzog hatte den Eindruck, dass er ihn feindselig ansah.
»Kommt mit!« befahl sie.
Der Herzog folgte ihr durch die Stallungen, hinüber zum Haus. Er bemerkte, dass sie den Haupteingang mied und ihn, wie er annahm, zur Küchentür führte. Sie gingen durch einen mit Fliesen ausgelegten Korridor und dann durch einen Vorhang aus grünem Flanellstoff. Ihre Schritte hallten unnatürlich laut, und der Herzog stellte fest, dass es im Haus außergewöhnlich still war.
Die Frau öffnete eine Tür auf der rechten Seite des Korridors und führte ihn in ein kleines Zimmer.
»Wartet hier!«
Es war ein Befehl, keine Bitte.
Sie wandte sich um, ging aus dem Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Zum großen Erstaunen des Herzogs hörte er, wie der Schlüssel im Schloss herumgedreht wurde.
2
Der Herzog starrte die verschlossene Tür mit Gesichtsausdruck an, der allen, die mit ihm in der Armee gedient hatten, verraten hätte, dass er Gefahr witterte. Dann ging er zu einem Armsessel, setzte sich hin und streckte die Beine aus. Seine Schultern schmerzten dort, wo die Fässer aufgelegen hatten, und er überlegte, wobei er seine Gedanken über seine gegenwärtige Lage beiseite schob, dass ein volles Fass wohl ungefähr sechsundfünfzig Pfund wiegen musste.
Er dachte daran, dass ein Mitglied des Parlaments kürzlich gesagt hatte, die Verluste der Steuereinnahmen durch die Schmuggeltätigkeit an den Küsten Britanniens würden sich auf nahezu sechzigtausend Pfund im Jahr belaufen. Er versuchte zu berechnen, wie hoch der Profit der Schmuggler in diesem speziellen Fall wohl sein mochte. Dann sagte er sich, dass die Männer, die er im Nebel und der Dunkelheit der Bucht und der Gänge nur undeutlich gesehen hatte, Leute vom Land zu sein und nicht zu jener rauen Art zu gehören schienen, von denen er bisher geglaubt hatte, sie seien die üblichen, gefährlichen und aggressiven Schmuggler.
Aber wer in aller Welt hatte jemals von einer Schmuggelbande gehört, die von einer Frau angeführt wurde?
Der Herzog blickte sich im Zimmer um. ‚Was für eine Frau ließ sich in das Schmuggelgeschäft ein und hatte gleichzeitig Zugang zu einem solchen Haus wie diesem?‘ fragte er sich. Das Küchenquartier schien nicht benutzt zu werden, und er nahm an, dass der Besitzer des Hauses abwesend war, vielleicht nicht einmal die leiseste Ahnung davon hatte, dass sein Anwesen für so schändliche Zwecke missbraucht wurde.
Der Herzog lehnte sich im Sessel zurück. Sollte er sich in einer gefährlichen Lage befinden, so konnte er momentan nichts dagegen tun. Seine Hand pochte, sein Rücken schmerzte. Er schloss die Augen und war halb eingeschlafen, als er hörte, wie der Schlüssel wieder im Schloss herumgedreht wurde. Sofort war er hellwach und auf der Hut, obwohl er seine Position im Sessel nicht veränderte. Die Tür wurde heftig aufgestoßen, und eine kleine, korpulente, rotwangige Frau trat geschäftig mit einer Waschschüssel ins Zimmer.
»Ich habe euch schon so oft gesagt, dass ich euch Lumpenkerle nicht im Haus dulde«, sagte sie mit zänkischer Stimme. »Unverschämt! Ihr drängt euch einfach hier herein. Wie ich es euch schon immer gesagt habe, und wie ich es wieder sage ...«
Sie stellte die Waschschüssel auf dem Tisch ab und sah den Herzog zum ersten Mal an, und die Worte erstarben ihr auf den Lippen. Sie starrte ihn an, und als er nicht sprach, sagte sie mit einer veränderten Stimme: »Ich habe gehört, Ihr habt euch die Hand verletzt Sir.«
Der Herzog stand langsam auf.
»Ja, in der Tat«, sagte er. »Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sie mir verbinden würden.«
Als er sie betrachtete, kam er zu dem Schluss, dass sie eindeutig entweder die Haushälterin oder die Kinderfrau der Familie war. Sie war ein Typ, den er leicht genug erkannte. Er streckte seine Hand zur Waschschüssel hin. Er hatte um seinen verletzten Daumen ein Taschentuch gebunden, das jetzt blutgetränkt war. Einen Augenblick überlegte er, ob es sein eigenes, feines Batisttaschentuch mit seinem Monogramm und seiner Krone war oder ob es Pereguine gehörte.
Als die alte Frau es vorsichtig von seinem Finger wickelte, sah er erleichtert, dass es schlicht und unbestickt und somit nicht sein eigenes war.
»Das ist eine hässliche Wunde, Sir«, sagte die Frau. »Und schmutzig noch dazu. Vorsichtshalber sollten wir einen Schuss Weinbrand darüber gießen. Man hat mir erzählt, dass Admiral Nelson selbst dies seinen Seeleuten geraten hat, um die Wunden zu desinfizieren.«
Sie wartete seine Antwort nicht ab, sondern eilte geschäftig aus dem Zimmer, während der Herzog seine Hand über die Schüssel hielt und zusah, wie das Blut langsam in das Wasser tropfte.
Als sie ein paar Augenblicke später wiederkam, hatte sie eine Kristallkaraffe in der Hand und ein kleines elegant ziseliertes Weinglas.
»Ich glaube, der Kognak wird mir innen besser bekommen als außen«, sagte der Herzog lächelnd.
»Ich gebe in diesem Haus keinem Schmuggler etwas zu trinken«, sagte die alte Frau energisch.
Sie blickte ängstlich über die Schulter zurück, als wenn sie über das, was sie gesagt hatte, erschrocken wäre. Dann begann sie, den Schmutz aus der Wunde zu waschen. Es schmerzte so sehr, dass der Herzog einen Moment lang glaubte, er würde ohnmächtig.
»Still gehalten!« befahl sie grimmig und goss den Kognak über seine Wunde.
Einen Augenblick war der Schmerz unerträglich. Der Herzog biss die Zähne zusammen, sagte aber nichts. Eine Lage sauberes, weißes Leinen kam auf die Wunde, und dann legte sie einen Verband aus feinstem Batist, das ordentlich in lange Streifen gerissen worden war, an und band es am Handgelenk fest.
»Schmerzt es noch?« fragte die Frau und hob zum ersten Mal, seit sie ihre Arbeit begonnen hatte, den Kopf.
»Es ist besser als vorher, danke«, sagte der Herzog und spürte, wie der starke Alkohol in seiner aufgerissenen Wunde brannte.
»Die Verletzung ist nicht sehr tief«, sagte sie. »Aber Sie werden sie trotzdem ein paar Tage lang spüren. Und nun fort mit Ihnen! Sie hätten niemals hierherkommen dürfen!«
»Es wurde mir befohlen«, verteidigte sich der Herzog. »Und ich brauche Ihnen sicher nicht zu sagen, dass ich schon halb verhungert bin nach dieser schweren Arbeit auf nüchternen Magen.«
»Hungrig?« fragte die alte Frau. »Es ist nicht meine Art, einen hungrigen Mann von meiner Türschwelle zu schicken. Setzen Sie sich. Ich werde Ihnen etwas zum Essen holen, obwohl es gegen die Regeln ist.«
Der Herzog hatte das Gefühl, dass sie sich strenger gab, als sie in Wirklichkeit war. Sie sah ihn freundlich an, und er hatte nicht ihr erstes, zögerndes ‚Sir‘ vergessen, das ihr über die Lippen gekommen war, als sie ihn sah.
Sie ging geschäftig aus dem Zimmer, schloss die Tür hinter sich, und er bemerkte, dass sie den Schlüssel nicht im Schloss herumdrehte.
Er ging zum Fenster und blickte in einen elegant angelegten Rosengarten, in dessen Mitte eine Statue stand. Der Garten war von einer Eibenholzhecke umgeben, und dahinter standen Büsche und Bäume und hüllten das Haus wie in einen grünen Mantel ein.
Er fragte sich, wie das Mädchen hierher passte. Weil sie sich nicht mehr hatte sehen lassen, wurde er neugierig. Er versuchte, sich daran zu erinnern, wie sie ausgesehen hatte, aber er sah im Geist nur noch das schwarze Tuch, das sie über ihrem Haar trug, das kleine schmutzverschmierte Gesicht, den absurden, altmodischen, langen Mantel und die hohen Watstiefel. Wahrlich eine junge Amazone, die mutig die gefährliche Reise zwischen England und dem Kontinent wagte und der sich ständig steigernden Wachsamkeit der Küstenwache und Zöllner trotzte.
Als er in den Raum geführt worden war, hatte er geglaubt, es sei ihr Zimmer, aber nun zweifelte er daran. Neben dem Armsessel stand ein mit Intarsien eingelegter Sekretär und davor ein mit Kanevasstickerei bezogener Stuhl, den geschickte Hände hergestellt haben mussten. Auf einem kleinen, polierten Tisch stand eine Vase mit Blumen, geschmackvoll gesteckt, die ersten duftenden Rosen dieses Sommers, vermischt mit blauen Vergissmeinnicht. Es war ein Bild von Farbe und Schönheit, wie es nur eine Frau arrangiert haben konnte.
Die Tür wurde wieder aufgestoßen vorsichtig diesmal und die alte Frau kam mit einem Tablett herein.
»Hier sind Eier und Schinken«, sagte sie, »denn ich habe für etwas anderes keine Zeit. Wenn Sie ein Herrenessen mit Fleisch und gebratenen Tauben erwartet haben, muss ich Sie enttäuschen.«
»Ich bin Ihnen für die Eier und den Schinken außerordentlich dankbar«, sagte der Herzog lächelnd.
Er setzte sich an den Tisch, während er sprach, und ganz natürlich, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, bediente ihn die Frau. Die Eier, es waren drei Stück, und die dicken Scheiben hausgeräucherten Schinken waren köstlicher als alles, was der Herzog seit langer Zeit gegessen hatte. Er schlang es fast hinunter.
»Und was möchten Sie trinken?« fragte sie augenzwinkernd. »Ich kann nicht sagen, dass ich es billige, wenn Leute wie Sie Kognak trinken, aber ausnahmsweise, wenn Sie welchen wünschen ...«
»Wie wäre es mit Tee?« fragte der Herzog. »Ich wette, es gibt eine Menge davon in diesem Haus.«
Er erlebte die Befriedigung, sie erröten zu sehen, und ihre rosigen Wangen wurden noch rosiger.
»Wenn Sie Tee wünschen, hole ich welchen für Sie«, sagte sie. »Und keine Unverschämtheiten, bitte!«
Der Herzog kam sich vor, als säße er wieder in seinem Kinderzimmer.
»Also gut, Nana, ich würde sehr gern etwas Tee trinken«, sagte er.
»Wer hat Ihnen erlaubt, mich Nana zu nennen?« fragte die alte Frau streng. »Ich bin für das Dorf Mrs. Wheeldon, und Mrs. Wheeldon bin ich auch für Sie. Nana, nein, wirklich. Was soll nur aus der Welt den, das möchte ich gern wissen.«
Ihre gestärkte Schürze knisterte, als sie aus Zimmer stürmte, und der Herzog warf den Kopf zurück und lachte. Er hatte richtig geraten. Sie war die Kinderfrau und nach wie vor die Autoritätsperson der Kinderstube. Und sie hatte ihm etwas zum Essen gebracht, weil sie keinen ihrer Schützlinge hungrig sehen konnte, selbst wenn er sich schlecht benommen hatte.
Er schnitt sich eine Scheibe vom selbstgebackenen Brot ab, von dem er wusste, dass es erst vor kurze aus dem Backofen gekommen war, bestrich es dick mit goldgelber Butter und biss in die knusprige Kruste und es gab keinen Zweifel, dass schwere körperliche Arbeit den Appetit eines Mannes steigerte.
Er dachte mit einem Gefühl der Wärme an das Frühstück, welches Pereguine etwas später an diesem Morgen zu sich nehmen würde: ein Glas Weinbrand, um die Folgen des Alkohols, den er in der Nacht zuvor zu sich genommen hatte, hinunterzuspülen; dann würde er lustlos an einem Hühnchenflügel herumkauen, an einem Stück Hammelfleisch oder vielleicht an einem gekochten Kapaun, aber nach ein paar Bissen würde er den Teller von sich schieben, beinahe angeekelt bei dem Gedanken an irgendwelche Speisen.
»Das ist der Unterschied zwischen einem gesunden Leben und der besseren Gesellschaft«, sagte der Herzog laut, als spräche er mit Pereguine.
Die Tür ging wieder auf, und der Herzog blickte hinüber in der Erwartung, Nana mit einer Kanne aufgebrühtem Tee zu sehen. Aber es war nicht sie die eintrat, die Tür heftig hinter sich zuschlug und mit dem Rücken davor stehenblieb. Es war ein Mädchen, ein Mädchen, von dem der Herzog glaubte, es noch nie zuvor gesehen zu haben. Dann jedoch entdeckte er zu seinem Erstaunen, dass es die Schmuggler-Amazone war.