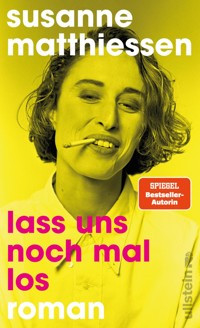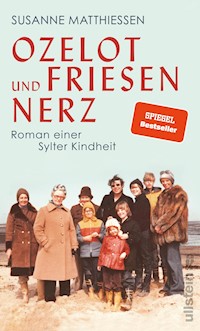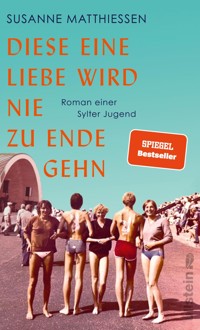
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich kenne jeden Halm und jedes Sandkorn, doch das ist ein Trugschluss. Diese Insel ist für mich neu und unbekannt." Sylt - verlassen und menschenleer. Susanne Matthiessen ist überwältigt, als sie ihre Heimatinsel im Lockdown zum ersten Mal ohne Touristen erlebt. Auf einmal ist es wieder die Natur, die den Rhythmus des Insellebens bestimmt, das vertraute, dörfliche Miteinander vergangener Zeiten lebt noch einmal auf. Susanne fühlt sich in ihre Kindheit zurückversetzt. Während sie zusammen mit ihrer Freundin die einsame Insel erkundet, bleibt "ihr Sehnsuchtsort" für Hunderttausende andere Deutsche Sperrgebiet. Die Krise ruft bei Susanne alte Gefühle wach, als Sylt in den 80er Jahren schon einmal Schauplatz gleich drei großer Katastrophen war, Westerland – ausgerechnet – zum Epizentrum der deutschen Punkszene aufstieg. Damals brachen sie und ihre Freunde von der magischen Insel auf. Fast alle schafften den Absprung, doch nicht alle ein Leben auf der Sonnenseite. Mit viel Humor und klug beobachtend erzählt Matthiessen von einer sehr deutschen Insel und ihren Einwohnern, denen man bis heute anmerkt, dass sie von Strandräubern und Walfängern abstammen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn
Die Autorin
Susanne Matthiessen, Jahrgang 1963, ist gebürtige Sylterin. Als Journalistin verarbeitet sie gesellschaftspolitische Entwicklungen zu Programmideen für Radio, Fernsehen und Internet. 15 Jahre lang war sie Kolumnenschreiberin für die Sylter Rundschau. Ihr Debüt Ozelot und Friesennerz. Roman einer Sylter Kindheit wurde auf Anhieb ein Bestseller. Susanne Matthiessen lebt gern in Berlin, lebt aber nur am Meer richtig auf.
Das Buch
»Wir stecken mitten in der dritten Welle. Eine Art Dorfleben hat sich etabliert, so wie es früher mal eins gegeben haben muss. Neuigkeiten erfährt man vermehrt per Mundpropaganda beim Einkaufen und weniger aus der Zeitung. Aber was heißt schon Neuigkeiten? Es passiert ja nichts. Es fühlt sich an, als sei unser Mutterschiff ohne uns zur Erde zurückgeflogen. Als hätte man uns hier vergessen. Oder auf einer Insel mitten in den unendlichen Weiten des Ozeans ausgesetzt. Zuerst senden wir noch Lichtzeichen, stehen mit Taschenlampen am Wasser und machen auf uns aufmerksam. Die Gastronomen stellen Tische und Stühle an den Strand, dekorieren alles wie in ihrem Restaurant. Machen Fotos, schicken sie in die Welt hinaus. Am Hochhaus am Strand wird nachts ein riesiges Herz illuminiert. Wir senden Liebessignale übers Meer an unsere fehlenden Gäste. Irgendwann hören wir damit auf. Und fangen an, die Insel wieder in Besitz zu nehmen. Sie zu erkunden. Sie zu erleben. Sie zu genießen.«
Susanne Matthiessen
Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn
Roman einer Sylter Jugend
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
»Westerland« aus dem Album »Das ist nicht dieganze Wahrheit«, Single-Release 8. April 1988, CBS,Produzenten: Uwe Hoffmann und Die Ärzte,Text und Musik: Farin Urlaub© 2022 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: © Cornelia NiereUmschlagabbildung: © privatAutorinnenfoto: © Jörg MüllerE-Book-Konvertierung powered by PepyrusAlle Rechte vorbehalten.ISBN 978-3-8437-2719-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
DANKSAGUNG
Mein ganz persönlicher Sylt-VereinAhoi, ihr Weggefährtinnen und -gefährten
Mein ganz persönlicher Sylt-VereinFaarwel, ihr treuen Seelen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
KAPITEL 1
Widmung
Dieser Roman basiert auf wahren Begebenheiten, erhebt jedoch keinen Wahrheitsanspruch. Die dargestellten Ereignisse werden nicht zitatgetreu wiedergegeben. Manche Erzählsituationen stehen nicht in direkter Verbindung zu den genannten Personen. »Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehn« als Titel dieses Romans führt die Handlung in die Achtzigerjahre, als die Punkband »Die Ärzte« ihr Abschlusskonzert im Neuen Kursaal in Westerland gaben. Nach ihrem legendären Auftritt am 9. Juli 1988 löste sich die Band auf, gründete sich 1993 neu. Die Textzeile ist dem Song »Westerland« entnommen.
Motto
Lewwer duad üs Slaav
KAPITEL 1
»Wer nicht deichen will, muss weichen.«
Sprichwort an der norddeutschen Küste
Wenn es denn stimmt, dass jede Heimsuchung auch eine Lehre fürs Leben ist, dann wüsste ich ganz gerne, woran man das jetzt merken soll. Auf dieser Insel. Hoch oben in der Nordsee. Nachdem dieser perfekte Sturm über uns hinweggezogen ist. Wenn es denn stimmt, dass dieser Sturm so groß gewesen ist, wüsste ich gern, warum wir einfach weitermachen, als wäre nichts geschehen. Alles funktioniert. Die Urlaubssaison läuft. Wir schreiben das Jahr 2021. Die Sonne scheint. Es ist Sommer. Es gilt, die schiere Masse an Urlaubern zu kanalisieren und zu beherrschen, die nach dem Ende der Bundesnotbremse, nach der dritten Welle, diese Insel im wahrsten Sinne des Wortes geflutet haben. Es geht um Effizienz und Perfektion. Die Sylter müssen eine Tourismusmaschine am Laufen halten, deren Treibstoff immer häufiger überläuft, und um davon nichts zu verlieren, muss der Motor immer schneller und reibungsloser laufen. Jeder Handgriff sitzt.
Wenn es denn stimmt, dass jede Heimsuchung auch eine Lehre fürs Leben ist, dann lassen sich die Insulaner nichts anmerken. Die Erschütterung haben sie erstaunlich gut weggesteckt. »Och Mönsch«, sagt meine Freundin Korne vom Hotel Wünschmann, »bin ja dankbar. Nach sieben Monaten Totentanz endlich wieder Gäste. Bin vollkommen ausgebucht.« Nirgends gibt es noch ein freies Bett. Von List bis Hörnum ist alles dicht. Die Pandemie ist vorbei. Endlich. Jedenfalls fühlt es sich so an. Jetzt wird alles nachgeholt. Und das muss gefeiert werden. »Die Leute sind ausgehungert«, sagt Samoa-Jan, »die fallen auf die Knie und weinen, wenn sie das Meer sehen. Manche haben regelrechte Heulkrämpfe.«
Es war ein langer, trüber, quälender Coronawinter, allein unterbrochen von gebetsmühlenartigen Durchhalteparolen regierender Politiker. Deutschland war im Lockdown, ausgerechnet Weihnachten lagen so viele Menschen auf den Intensivstationen wie nie zuvor. »Verreisen Sie nicht!«, verkündete das Robert-Koch-Institut in Dauerschleife. Die Herbstferien waren schon ausgefallen. Weihnachten fiel auch noch flach. Danach mussten die Winterferien abgesagt werden. Und dann fiel der Kanzlerin auch noch die Osterruhe ein. Also kurz gesagt: Deutschland hätte gern mal Urlaub gemacht. Das ging aber nicht. Niemand durfte zu uns ans Meer. Sie nannten es Beherbergungsverbot. Die Sylter sagten »Berufsverbot«. Es war gespenstisch.
»Das war ein Hammer«, sagt mein Schulfreund Markus Gieppner, der Musiker ist und monatelang nicht auftreten konnte. Stattdessen hat er sich um seine Facebookgruppe »Sylt« gekümmert, und zwar derartig intensiv, dass sie gerade die Hunderttausend-Mitglieder-Marke durchschlägt. Ohne Corona wäre das nicht passiert. »Fanatisch«, nennt Markus diese intensive Liebe zu Sylt, die so viele Menschen wie ein Fieber befallen hat. Je länger die erzwungene Abstinenz, desto höher steigt die Temperatur. Sehnsucht ist auch eine Sucht. »Beängstigend«, sagt Birgit Hoppe, die jeden Tag in einem Geschäft in Westerland Wohn-Accessoires verkauft. »Ich hatte neulich ein Ehepaar aus Sindelfingen im Laden, die sind eifersüchtig, dass ich hier geboren bin. Die wollten sogar ein Foto von mir machen. Das nimmt langsam Formen an.« Wir echten Sylter sind zu bestaunten Exoten geworden. Weil es immer weniger von uns gibt. Wer noch auf der Insel wohnt, befindet sich in direkter Konkurrenz mit Gästen und Zweitwohnungsbesitzern um die einzig wahre »Syltliebe«. Wer hat die echteren Gefühle? Wer tut der Insel wirklich Gutes? Und wer will sie nur ausbeuten? »Das ist schon schlimm, wie es hier aussieht«, sagt eine Webdesignerin aus Düsseldorf, mit der ich in einer Fünfzig-Meter-Schlange bei Bäcker Raffelhüschen für Brötchen anstehe. »Alles zugebaut. Was habt ihr nur mit dieser wunderbaren Insel gemacht? Ihr solltet euch schämen!« Ja. Seit Corona hört man das häufiger. Die Pandemie schärft den Blick auf die Missstände. Und die Menschen halten sich mit ihren Kommentaren weniger zurück. Man ist direkter. Und rücksichtsloser. Neuerdings zählt jede Minute. Wir haben nicht mehr endlos Zeit. Für mich fühlt es sich an, als strebe der Ausverkauf der Insel, den ich als Jugendliche in den Achtzigern das erste Mal wahrgenommen habe, seinem großen Finale zu.
Dass es diesmal um alles gehen wird, hat sich schon früh angedeutet. Gleich am Anfang der Pandemie, als Sylt Mitte März 2020 in den ersten Shutdown gehen musste und komplett abgeriegelt war. Nur wer seinen Erstwohnsitz auf der Insel hatte, durfte noch rauf, alle anderen mussten auf dem Festland bleiben.
In unserer Heimatzeitung, der Sylter Rundschau, konnte man damals nachlesen, was sich die fanatischen Syltfans haben einfallen lassen, um das Betretungsverbot zu umgehen und irgendwie doch auf die Insel zu gelangen. Als Handwerker verkleidet, mit dem Motorboot übers Wattenmeer, zu Fuß über den Hindenburgdamm, im Laderaum von Lieferfahrzeugen und auch mit gefälschten Ausweisen. Einigen ist es gelungen, und sie sind durchs Netz geschlüpft, um die Insel Sylt in ihrer Abgeschiedenheit ganz pur zu erleben, ein epochales Erlebnis, das eigentlich nur den Insulanern selbst vorbehalten war. Eine Teestunde mit dem Dalai Lama hätte kaum exklusiver sein können. Nur hat das von uns kaum einer überrissen.
Ich weiß noch, wie der ständige Zustrom von Menschen und Autos über den Hindenburgdamm plötzlich versiegte und es ganz einsam wurde und wir plötzlich allein waren mit uns und unserer Insel.
Die Bundesregierung mahnte, die Leute sollten zu Hause bleiben. Noch war es als Bitte formuliert, nicht als Verbot. »Zu Hause bleiben können wir auch auf Sylt«, sagten sich viele und warfen im Fluchtreflex vor der tödlichen Bedrohung Kind und Kegel in ihre Autos. Ab an die Nordsee. Raus an die Luft. Es folgte ein Ansturm, den man im Februar so auf Sylt noch nie gesehen hatte. Aus der ganzen Republik flüchteten Menschen in den Norden, die Staus an der Autoverladung in Niebüll sprengten jede Vorstellungskraft. Jetzt bekamen wir es mit der Angst zu tun. Als mir klar wurde, dass das alles jetzt wirklich passiert, dass das kein Film war, dass es so was wie eine bitterernste innerdeutsche Fluchtwelle gab und dass Sylt jetzt dasselbe war wie »GER-MA-NY!« für große Teile der Welt, klappte ich zusammen und verlor das Bewusstsein. Meine Mutter sagte: »Hoppla!«, und klatschte mir ein nasses Handtuch an den Kopf. Es war mir peinlich. So ist es wohl, wenn man zum ersten Mal echte Angst hat. Vor dem Tod. Vor einer Invasion. Vor dem Kontrollverlust. Meine Mutter kannte dieses Gefühl schon. Von ganz früher. Als sie mit ihrer liebsten Puppe im Luftschutzkeller saß. Und sagte nur: »Verrückte Welt.«
Kurz darauf beschloss die Landesregierung für die Inseln ein Betretungsverbot und gab den Geflüchteten drei Tage Zeit, Sylt zu verlassen. Danach wurde es still. Sehr still.
Eben noch der große Trubel, dann gespenstische Ruhe. Wir tasten uns vor. Es ist eine Welt, die wir nicht kennen. Science-Fiction. Leere Straßen. Leere Supermärkte. Leere Strände. Und Tausende leere Häuser und Wohnungen. Kaum dass überhaupt ein Mensch zu sehen ist. In manchen Orten wie Kampen oder Rantum scheint überhaupt niemand mehr zu wohnen. Seltsam. Alles wird langsamer und langsamer. Wir richten uns ein in einem Leben, das wir nicht kennen. Anfänglich ist da noch diese Beklemmung, auf einer Art Gefängnisinsel eingesperrt zu sein, und das Furcht einflößende Gefühl, mit jedem Tag dem wirtschaftlichen Ruin einen Schritt näher zu kommen. Beides wird nach und nach verdrängt von einem Glücksgefühl, das tief greifend ist und lang anhaltend. Die verlassene Insel ist ein seltenes Geschenk. Nur dass es das Geschenk im November 2020 mit dem zweiten Lockdown und dem Beherbergungsverbot gleich noch einmal gab.
In der Einsamkeit fühlen sich die Stürme anders an. Härter. Direkter. Man lauscht auf den Wind und hört Lieder. Man studiert Wolkenformationen, möchte innerlich »Klick« machen wie bei einem Handyfoto, um das Überwältigende in sich einzuschließen. Ich hätte nichts dagegen, wenn es immer so bliebe. Und da bin ich nicht die Einzige. Ob wir eine Lehre daraus ziehen werden und welche, ist ungewiss. Silvester, normalerweise Hochsaison, verbringen die Sylter in aller Stille. Nur mit dem Geld wird es langsam sehr, sehr knapp. Geschäftsleute schreiben Brandbriefe an die Landesregierung nach Kiel, dass es nicht so weitergehen kann, dass die Insel Gäste braucht, um wirtschaftlich zu überleben. Pandemie hin oder her. Die Rückmeldungen sind entmutigend. Die Infektionszahlen steigen bundesweit. Wir stecken mitten in der dritten Welle. In den Monaten dieses ersten Coronawinters hat sich eine Art Dorfleben etabliert, so wie es früher mal eins gegeben haben muss. Neuigkeiten erfährt man vermehrt per Mundpropaganda beim Einkaufen und weniger aus der Zeitung. Aber was sind schon Neuigkeiten? Es passiert ja nichts. Es fühlt sich an, als wäre unser Mutterschiff ohne uns zur Erde zurückgeflogen. Als hätte man uns hier vergessen. Oder auf einer Insel mitten in den unendlichen Weiten des Ozeans ausgesetzt.
Zuerst senden wir noch Lichtzeichen, stehen mit Taschenlampen am Wasser und machen auf uns aufmerksam. Die Gastronomen stellen Tische und Stühle an den Strand, dekorieren alles wie in ihrem Restaurant. Machen Fotos, schicken sie in die Welt hinaus. Am Hochhaus am Strand wird nachts ein riesiges Herz illuminiert. Wir senden Liebessignale übers Meer an unsere fehlenden Gäste. Irgendwann hören wir damit auf. Und fangen an, die Insel wieder in Besitz zu nehmen. Sie zu erkunden. Sie zu erleben. Sie zu genießen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich kenne jeden Halm und jedes Sandkorn, doch das ist ein Trugschluss. Diese Insel ist für mich neu und unbekannt.
Zum Beispiel hat Sylt eine neue Barrikade. Ein Riesending. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Vor der Westerländer Promenade wurde im Sommer 2020 damit begonnen, eine massive Stahlbetonwand aus Fertigteilen zu installieren. Die ursprüngliche Mauer aus rotem Klinker, die dem Hauptstrand rund um die Musikmuschel diesen gemütlichen, nostalgischen Charakter verpasst hatte, hält den Fluten nicht mehr stand. Ein Bollwerk musste her.
»Jetzt sind wir also endgültig im Krieg mit der Nordsee«, sagt Pfuschi an diesem kalten Tag im Februar 2021. Ich bin zu Besuch aus Berlin, seit Wochen schon, wir sind zum Spaziergang verabredet, was man eben so macht in diesen nicht enden wollenden Lockdownzeiten. Pfuschi lässt sich am Fuß der neuen Mauer in den nassen Sand fallen. Über ihr ragt die Betonkonstruktion wie ein hässliches sowjetisches Ehrenmal in den Himmel. Manche Kunstwerke sind so groß geraten, dass sie mit einem eigenen Ausstellungsort ausgeliefert werden müssen. Auf 610 Meter Gesamtlänge soll dieses Ungeheuer in mehreren Bauabschnitten noch durchgezogen werden. Schön sieht das nicht gerade aus. Sein zur See hin geneigter Kopf überragt wie Godzilla die Kante der Flaniermeile, unserer Kurpromenade, um einen knappen Meter. Es ist quasi unmöglich, darüber hinwegzusehen. Und dieses Trumm ist ein sichtbarer Beweis, dass sich die Insel fürchtet. Und das ganz zu Recht. Sie wird irgendwann kommen, die verheerende Flut. Wir müssen uns rüsten gegen den steigenden Meeresspiegel. Wegen dieser Mega-Mauer verflüchtigt sich auch noch das letzte bisschen Seebad-Charme, den die Brüstung aus weiß gestrichenem Holz noch versprühte, bevor diese Betonteile eingerammt wurden. »Brutalismus, ganz klar«, sagt Pfuschi, die sich schon immer als Architektur-Sachverständige ausgegeben hat. Klare Formen sind ihr Ding.
Sie lässt sich von ihrer Mutter immer noch den gleichen Norwegerpullover stricken wie schon damals in den Achtzigern. Ungefähr alle fünf Jahre kommt er neu, immer dasselbe Muster, sandfarbene Klötzchen auf grauem Grund, obwohl Pfuschis Mutter kaum noch die Stricknadeln halten kann und auch nur noch wenig sieht. Tante Lorenzen ist mittlerweile über achtzig und arbeitet wie eine lebendige Strickmaschine. Ohne hinzusehen. Wie nebenbei. Wir hatten zu Schulzeiten alle diese kratzigen Norwegerpullover an, die am Anfang so hart waren wie ein Brett. Und eigentlich nie richtig gut gepasst haben. Ausgeleiert an den Ellenbogen, wegen der eingestrickten Muster über der Brust zu stramm und am Hals ein Sandpapier-Inferno.
Pfuschi ist die Einzige, die diesem Outfit treu geblieben ist. Sie trägt auch immer noch die »Adidas Allround« aus weißem Leder, knöchelhoch, mit schwarzen Streifen und dazu diese mit eigener Nähmaschine eng »auf Bein genähten« Jeans. Klamottentechnisch ist sie in den Achtzigern stehen geblieben. Keinesfalls sollte man Pfuschis Hosen mit der zurzeit aktuellen Variante »Jeggings« verwechseln, auch wenn sie genauso aussehen. Pfuschi und ihr ständig neu aufgelegter Hautnahjeans-Style haben vierzig Jahre durchgehalten. Konsequent. Dass sie wieder in den aktuellen Modetrend hineingerutscht ist, ficht sie nicht an. Hat sie noch gar nicht gemerkt.
Dass wir uns heute auf der Promenade treffen, ist die absolute Ausnahme. Pfuschi hat sich grundsätzlich abgewöhnt, nach Westerland zu fahren. Es ist ihr einfach zu voll. Man kann nirgends parken. Überall Stau. Pfuschi macht um Westerland prinzipiell einen großen Bogen. Weil immer alles verstopft ist. In der Vor-, Nach- und in der Hauptsaison. Dass Westerland sich in Lockdownzeiten in ein verschlafenes Nest verwandelt hat, in dem alle Läden geschlossen sind, macht sich in ihren täglichen Abläufen noch nicht bemerkbar.
Sylt liegt im Dornröschenschlaf. Das eben noch Unvorstellbare ist nach dem kurzen wilden Sommer gleich zum zweiten Mal eingetreten: Den Gästebetrieb gibt es nicht mehr. Sylt ist nicht mehr Sylt. Wir befinden uns jetzt im Kaff der guten Hoffnung. Irgendwann wird wieder aufgemacht werden. Irgendwann in ein paar Wochen. Oder in ein paar Monaten. Man wagt keine Prognosen mehr. Wenn eins sicher ist, dann ist es die Unsicherheit. Wird es wieder wie früher? Wird es wieder normal? Niemand kann sich im Moment vorstellen, in diesen Tourismus-Wahnsinn zurückzukehren. Sechzigtausend Betten sind leer. Wir sind unter uns. Und daran muss man sich immer noch gewöhnen.
Es fühlt sich total fremd an, überall nur Bekannte zu treffen. Das war schon im ersten Lockdown wie in einem beklemmenden Traum und ist es jetzt wieder. Das gewohnte Bild ist weg. Wir sind immer noch am selben Ort. Und doch erscheint er mir auf seltsame Weise unbekannt. Es sind dieselben Häuser und Straßen, und sie sind es dann doch wieder nicht. »Ich fühle mich wie Marty McFly in ›Zurück in die Zukunft‹«, sagt Pfuschi, »als hätte ich mit dem DeLorean so richtig Gas gegeben, bis der Fluxkompensator explodiert. Und jetzt bin ich einfach zackbumm in einer anderen Zeit gelandet.« Wir sind immer noch in Westerland. Aber das ist nicht mehr Westerland. Alle Gebäude stehen noch, aber man fühlt sich trotzdem wie in einer künstlichen Welt.
Aus unserem Leben, wie wir es kannten, wurden wir vertrieben. Hinein in eine Stadt, die nur noch so aussieht, als wäre sie eine Stadt. Tausende Ferienwohnungen verwaist. Jeden Tag Sonntag. »Das stresst mich voll«, sagt Pfuschi und lacht, »ich wollte gar nicht auswandern. Aber ich könnte jetzt bei ›Goodbye Deutschland‹ mitmachen. Von zu Hause aus. Alles wegen Corona.« Wir kennen das Vorher und fürchten uns vor dem Nachher. Irgendwann. Und jetzt sind wir im Dazwischen. Wie auf hoher See. Welle auf Welle.
Auch das Wetter kann sich nicht entscheiden. Schwarz oder blau. Zuerst fliegen vom Wind aufgepumpte Regenwolken heran, so gefährlich tief, dass man sie greifen möchte, im nächsten Moment sind sie schon wieder weg, und es sieht aus, als würde das Meer selbst wie mit einem Staubsauger in den Himmel gezogen, und die grelle Sonne blendet brutal von der Seite. Sie steht so tief. Es ist kalt. Und in diesem Februar 2021 scheint die Zeit auf seltsame Weise zugleich stillzustehen und zu rasen. Aber wie man hört, ist das nicht nur auf Sylt so.
Wir schlendern auf der menschenleeren Promenade an der Musikmuschel vorbei. Die offene, leere Bühne gähnt vor sich hin. »Manchmal ist hier grünes Neonlicht«, sagt Pfuschi, »damit es noch leerer und noch kälter aussieht, als es sowieso schon ist.« Um die Ecke hängt ein ausgeblichenes Transparent, das erklärt, wie man sich die Hände wäscht. Es ist schon halb abgerissen und flattert im Wind. Man gibt sich hier keine Mühe mehr. Die Holzstege sind vom Sand zugeweht und teilweise unpassierbar. Wie schnell es geht, dass sich die Natur die Insel zurückerobert. Es ist faszinierend. Die Kurverwaltung ist in Kurzarbeit. Die Fensterscheiben vom Haferflockenladen sind dick vom Salz verklebt, fast blind. Man kann kaum noch hineinsehen. Hier ist schon seit Monaten niemand mehr gewesen. Daneben der Biomaris-Shop, der normalerweise Algenkosmetik anbietet und in dem es auch diesen kleinen Zapfhahn gibt, aus dem das berühmte aufbereitete Meerwasser sprudelte. Die Westerländer Trinkkurhalle mit ihrem »Tiefenwasser«. Ein Relikt. Verlassen. Tot.
Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, das könnte jetzt alles vorbei sein. Am besten baut man diesen ganzen Laden mit seiner Trinkquelle hier ab und schafft ihn nach Kassel zur documenta fifteen, der weltweit bedeutendsten Kunstausstellung, die schon immer die großen Linien im Strom der Zeit festgehalten hat. Niederlagen, Zweifel und Skandale, die Umbrüche und Kurswechsel. Man müsste ganz Sylt zur documenta tragen und diese verlassene Insel als Gesamtkunstwerk betrachten, stellvertretend für die tiefe Zäsur, die alles verändert, was uns mal wichtig war. Denn auf Sylt hat sich all das, was dieses Land in den letzten siebzig Jahren an Schlechtem, aber auch an Gutem hervorgebracht hat – seine Wunder und Enttäuschungen, sein Zauber und auch die Ernüchterung –, Schicht für Schicht abgelegt wie Sedimente am Meeresboden. Zum ersten Mal in Ruhe betrachtet von uns selbst, den sogenannten Insulanern, die dafür in den zurückliegenden Jahrzehnten keine Zeit fanden. Abgelenkt waren. Den Zirkus am Laufen hielten. Oder einfach nicht hinsehen wollten.
Jetzt müssen wir.
Pfuschi hat in einer Thermoskanne Tee mit Rum mitgebracht. Wir setzen uns auf den Mauervorsprung unterhalb des Hotels Miramar neben den Berliner Meilenstein. Auf dem steht, dass es 516 Kilometer sind von hier bis in die Hauptstadt. »Stimmt nicht«, sagt Pfuschi, »von diesem Strandübergang bis zur Gedächtniskirche in Berlin sind es sogar 543 Kilometer. Habe ich bei Google Maps nachgeguckt.«
Wofür man auf einmal Zeit hat.
Auch ich bin an diesem Berliner Meilenstein bestimmt schon tausendmal vorbeigelaufen, ohne ihn jemals bewusst wahrgenommen zu haben. In die Oberfläche ist ein putziger Berliner Bär eingemeißelt. »Den hat Renée Sintenis entworfen«, sagt Pfuschi. »Sie war eine Pionierin der Bildhauerei. Sie hat den Berlinale-Bär geschaffen. Sie war eine unabhängige Frau. Und sie war erfolgreich. Und das zu ihrer Zeit. Prost!« Mit geübtem Schwung gießt sie eine Tasse Tee über den Stein. »Auf die Erinnerung! Auf Berlin! Wann gehst du in die Stadt zurück?«
»Was soll ich in der Stadt?«, frage ich zurück. »Alles, was an der Stadt interessant ist, gibt es nicht mehr. Die meisten sind wie ich wieder nach Hause gegangen. Für Homeoffice muss man nicht in einer toten Stadt sitzen.«
»Danke, Corona«, sagt Pfuschi und küsst den Meilenstein der Berliner Bildhauerin und streichelt den eingemeißelten Bären.
Auch ich bin froh, nicht in der Stadt sein zu müssen. Die Perspektive gewechselt zu haben. Berlin ist wie in meiner Jugend wieder zu einem vagen Versprechen geworden, etwas Abenteuerliches, Gefährliches, aber auf eine ganz andere Art. Den Wagemut von früher spüre ich nicht mehr. Es ist viel interessanter, meine Heimatinsel zu erforschen. Ich hatte keine Ahnung, dass von diesen Sintenis-Meilensteinen mehr als hundert Stück über die ganze Bundesrepublik verteilt worden sind. Dieser hier steht schon seit 1956 an dieser Stelle am Fuß vom Miramar. Er sollte die Erinnerung an die geteilte Stadt wachhalten. Die Idee hatte der ZEIT-Verleger und Politiker Gerd Bucerius, der nach dem Arbeiteraufstand 1953 in Ostberlin ein Zeichen setzen wollte. An den Ursprung erinnert sich kaum noch jemand. Auch die Schöpferin des kleinen Bären ist weitgehend vergessen.
Renée Sintenis hat viele Sommer in Kampen verbracht, war mit der Sylterin Anita Warncke befreundet, die in dem sogenannten »Weißen Haus« in Kampen eine kleine Pension betrieb. Schon in den 1930er-Jahren. Die Kampener erzählen, das »Weiße Haus« sei im Dritten Reich ein »Widerstandsnest« gewesen. Das ist wahrscheinlich übertrieben. Was aber stimmt: Die Pension von Anita Warncke war ein offenes Haus, in dem sich vor allem diejenigen wohlgefühlt haben, die mit der Blut-und-Boden-Ideologie nicht viel am Hut hatten. »Im Ganzen erscheint mir die Insel als die einzige Oase in jeder, auch in geistiger Beziehung. Es balanciert da alles aus, trotz der äußeren Stürme und Verwahrlosung«, schrieb Renée Sintenis an Anita. Und auch: »Gestern habe ich das im Kriegsschlaf stehende Wägelchen besucht, es ist kaum auszudenken, dass ich noch diesen Sommer damit nach Kampen gefahren bin, was für eine Ewigkeit liegt wieder dazwischen, und wie und wann werde ich da mal wieder hinkommen, jetzt wo auch das Eisenbahnfahren zu den gewagtesten Unternehmungen gehört?«
Dass dieser Gedenkstein hier auf der Promenade und nicht wie alle anderen an Autobahnen und Landstraßen steht, sei, wie Pfuschi erklärt, der Wunsch der Künstlerin gewesen. Die übrigens in Kampen depressiv geworden ist. Weil ihr die Nordsee so zu schaffen machte. »Sie konnte sich nicht abgrenzen. Sie fühlte sich von der Unendlichkeit der Nordsee einfach überfordert«, sagt Pfuschi. Es gibt schon echt komische Leute. Manchmal frage ich mich, ob sich meine Freundin das alles nur ausdenkt.
Der Rum schießt mir in die Glieder. Mir wird heiß. »Ich glaube, wir dürfen hier in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken«, fällt mir auf einmal ein. »Nee, ich glaube, trinken darf man öffentlich. Aber ausschenken darf man nicht. Oder andersrum«, sagt Pfuschi. Keine von uns kennt den aktuellen Stand der im Moment gültigen Infektionsschutzverordnung. »Wenigstens dürfen wir uns hier aufhalten. Hinsetzen war doch auch mal eine Zeit lang verboten. Oder ist es noch?« Pfuschi lacht. Ganz wie früher. Lautlos. Mit aufgerissenem Mund. Dafür schüttelt sich ihr ganzer Körper, sodass ihr der Tee aus der Tasse springt und über ihre Finger läuft.
»Hinsetzen ist immer noch verboten. Steh gefälligst auf!«, lacht sie und erzählt mir diesen ollen Witz, den mir gestern schon Birgit Hoppe per WhatsApp geschickt hat und den sich mein Vater heute Morgen beim Frühstück auch nicht verkneifen konnte: »Treffen sich zwei Friesen. Sagt der eine: ›Ich bin froh, wenn hoffentlich bald die Ein-Meter-fünfzig-Abstandsregel wieder aufgehoben wird.‹ Sagt der andere: ›Dann können wir endlich wieder auf unsere gewohnten vier Meter zurück.‹« Und Pfuschi schmeißt sich weg in ihrem lautlosen Lachen, während ich mir gerade mal ein gequältes Lächeln abringen kann. Das war schon immer so. Wir sind zwar die besten Freundinnen, aber ihr Humor war noch niemals meiner. Selbst meine Mutter kannte Pfuschis Witz bereits. Hatte ihr schon vor zwei Wochen Maren Kress bei Famila erzählt. Weil man sonst auch nichts mehr zu bereden hat. Worüber soll man sprechen? Es passiert einfach nichts. Trostlos. Außer Corona gibt es kein ergiebiges Thema. Wie hoch sind die Zahlen? Wie ist die Inzidenz?
Im Klinikum Nordfriesland in Husum sind 133 Leute infiziert, Personal und Patienten. 2200 Menschen sind in Quarantäne. Was bedeutet das für die Insel, für den Tourismus, für die Zukunft Sylts? Wie lange dauert das noch? Jetzt muss man sich auch noch vor neuen Mutanten gruseln. Man ist erschöpft von täglich neuen Hiobsbotschaften. Aber das, was für die Leute hier wirklich wichtig wäre, wird nicht veröffentlicht. Niemand weiß, wie viele Menschen hier auf Sylt aktuell krank oder in Quarantäne sind. Die Zahlen werden für die Inseln nicht einzeln ausgewiesen. Bei insgesamt 39 Infizierten derzeit ist nicht klar, wie viele davon auf Sylt betroffen sind und wie viele auf Föhr oder Amrum.
Der Landrat Florian Lorenzen aus Husum verweigert seit einem Jahr konsequent die für Sylt aussagekräftigen Zahlen mit der Begründung, man wolle Stigmatisierung und Spießrutenlaufen der Betroffenen vermeiden. Da schießen natürlich die Gerüchte erst recht ins Kraut. Das lässt sich doch gar nicht verhindern. Sylt ist ein Dorf. Jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, der Corona hat. Oder jemand hat jemanden bei Rossmann am Bahnhof getroffen, der eigentlich in Quarantäne sein müsste. Pfuschi kennt einen Arzt, der wiederum einen Kontakt hat zur Nordseeklinik und dort in Erfahrung bringt, ob da Leute mit Covid stationär behandelt werden. Was die Intensivstation betrifft, da kenne ich einen Pfleger, Frank, mit dem habe ich früher als Kind immer auf dem Fußballplatz an der Nordseeklinik gespielt. Der wiederum sagt, dass es natürlich nicht stimmt, dass Sylt keine schweren Fälle hat. Sogar einige. Aber dann sagt er doch wieder nichts Genaues.
Es riecht nach Verheimlichung. Klingt nach Entmündigung. Fühlt sich an wie »Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern«. Soll das eine Art Fürsorge sein? Seit der damalige Innenminister Thomas de Maizière diesen bedeutungsschweren Satz auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise zur Absage eines Fußball-Länderspiels gesprochen hat, bin ich misstrauisch geworden. Jede Insel will wissen, wie es konkret um sie steht. Als könnten wir hier oben die Wahrheit nicht vertragen. Diese merkwürdige Geheimnistuerei weckt Zweifel, löst Verunsicherung aus, die Reihen schließen sich gegen alles, was von außen kommt. Das fühlt sich gerade nicht gut an.
Worüber ich in dieser ganzen verordneten Verlassenheit nachdenke? Über Eberhard. Den Lebenskünstler. Den guten alten Freund unserer Familie. Eberhard Krämer, der ehemalige Kellner aus dem Restaurant »Fisch-Fiete« in Keitum, den ich so verehre, weil er für mich wie kein Zweiter das alte Sylt verkörpert, die »goldenen Jahre« im boomenden Fremdenverkehr der Siebziger. Er hat seinen Job geliebt. Beliebtester Kellner im besten Fischrestaurant der Insel. Er kannte sie alle, bediente, servierte, plauderte und empfahl die Spezialitäten des Hauses. »Besser als im Adlon«, schrieb Curd Jürgens in Eberhards Gästebuch, und Romy Schneider fügte an: »Es hat mal wieder fietig geschmeckt.«
Eberhard bleibt für mich immer dieser schmale, große Mann in unauffälliger Eleganz mit lockigem, kurz geschnittenem Haar und einem feinen Schnurrbart, wie man ihn damals trug, wenn man seit seiner Jugend Errol Flynn zum Vorbild hatte. Vorbei die Zeiten. Das alte Friesenhaus, in dem das »Fisch-Fiete« Jahrzehnte beheimatet war, wird gerade entkernt. Frau Sievers hat verkauft. Nur noch die Außenmauern stehen. Aber auch nur, weil es von der Gemeinde so verfügt worden ist. Was bleibt, ist lediglich die Fassade. Ein Investor baut hier neu. Sein Name ist geheim. Aber klar ist schon: Es wird exklusiver. Größer. Es heißt endgültig Abschied nehmen vom »Fisch-Fiete«. Von der guten alten Zeit.
Eberhard trifft das hart. Es ist, als würde man sein Leben auf den Müll werfen. Man fand ihn kurz vor Weihnachten nur ein paar Kilometer von seiner Wohnung entfernt in einem Wassergraben. Die Polizei sagt, er muss dort eine Nacht lang in der Kälte bei Wind und Wetter gelegen haben. Er war voller Matsch, seine Jacke war weg, seine Hose hing auf halb acht. Bauer Deters hat die Polizei geholt. Als ihn die Beamten ansprachen, soll er gesagt haben: »Lassen Sie mich, bitte.« Im Graben abgesoffen, aber unverdrossen mit dieser feierlichen Attitüde, mit der er schon zur Welt gekommen sein muss. Meine Mutter war seine erste und einzige Liebe. Da war er acht und sie zwölf Jahre alt. Danach kamen nur noch Männer. Für sie und ihn.
Man muss nicht an Covid erkranken, um von dieser Seuche zerstört zu werden. Manche sitzen wie Eberhard einfach nur allein zu Hause und lösen sich langsam auf. Er hat auf Abstand geachtet, hat aus Angst niemanden mehr getroffen. Da kann auch ein Telefon nicht helfen. Eberhard weiß nicht mehr, wer er ist. Man hat ihn kurz im Krankenhaus aufgewärmt, durchgecheckt und dann in ein Pflegeheim nach Lunden gebracht. Da war was frei. Lunden liegt zwischen Heide und Husum an der Westküste in Schleswig-Holstein. Der Ort hat 1 700 Einwohner. Mit dem Auto fährt man von Sylt aus knapp zwei Stunden inklusive Autozug. Ich kenne niemanden in Lunden. Er auch nicht. Ich kann ihn nicht besuchen. Es ist nicht erlaubt. Die Pflegeheime sind jetzt Festungen. Für die Insassen gilt eine Art Schutzhaft. Trotzdem wütet das Virus hinter den Mauern. Und ich kann nicht rein.
Am Telefon bekomme ich keine Auskunft. Da hilft auch keine Engelszunge. Der Datenschutz. Nur Angehörige bekommen Informationen. Eberhard hat aber keine Angehörigen. Nur noch eine Cousine zweiten Grades, die nicht auf der Insel lebt. Eberhards Familie sind seine Freunde. Wenn man ihm wenigstens sein Klavier ins Heim bringen könnte. Wenn er spielt, dann lebt er. Ich stelle mir vor, wie er im Pflegeheim liegt und wartet. Umgeben von Menschen, denen er nichts bedeutet. Gestern noch puppenlustig, heute versteht er die Welt nicht mehr. Ganz ehrlich? Man fasst es alles nicht. Es geht so schnell. Es sind so viele. Es gibt Hunderte, Tausende, Hunderttausende. So viele Schicksale. Diese Coronazeit ist vollgestopft mit Frust, Angst und Überforderung. Dass Eberhard im Heim gestorben ist, erfahren wir erst, als er schon beerdigt ist. Wo denn? Wann ist er genau gestorben? Das darf mir die Bestatterin alles nicht sagen. Datenschutz. Wir wissen, dass er tot ist und gleichzeitig auf eine neue Art verschollen. »Das darf doch alles nicht wahr sein«, sagt meine Mutter.
Mein Onkel ist dieses Jahr gestorben. Meine Tante ist gestorben. Beide mit sich allein im Krankenhaus. Wie so viele. Man möchte es am liebsten vergessen, aber die Umstände werden auf ewig am Gedenken kleben. Die Toten werden noch im Krankenhaus in Plastiksäcke luftdicht verpackt, darauf kommen rote Warnhinweise: »Achtung, Infektionsgefahr«. In einigen Bundesländern ist es nicht erlaubt, die Toten schön anzuziehen, sie müssen nackt bleiben. In anderen Bundesländern verzichten die Bestatter aus Selbstschutz sowieso schon darauf, die Toten zu berühren. Wenn die Körper bewegt werden, könnte Luft aus der Lunge entweichen, in der die Viren schweben. In manchen Bundesländern ist Aufbahren erlaubt, in anderen nicht. Darf man seine Angehörigen noch mal sehen, bevor es endgültig wird? Mit Abstand. Die Hand halten darf man aber nicht. Infektionsschutz. Als meine Tante mitten im Coronawahnsinn starb, fand die Trauerfeier direkt auf dem Friedhof statt, an ihrem Grab unter freiem Himmel, damit die Aerosole schnell weiterfliegen. Es regnete. Nicht alle hatten einen Schirm dabei. Es ist ein mieses Jahr zum Sterben. Die Rituale, die die Lebenden mit dem Tod versöhnen sollen, werden durch die Seuche demoliert.