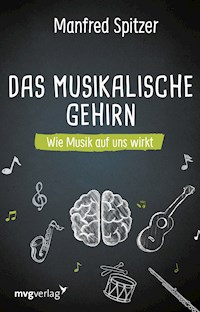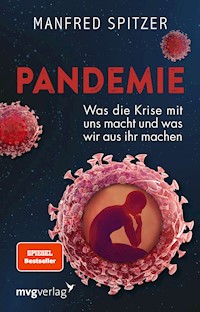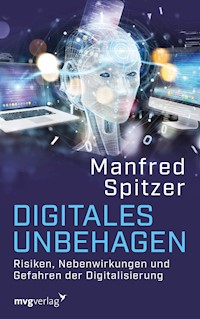
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mvg Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kann Fernsehen zu Demenz führen? Warum reduziert ein Smartphone unser Denkvermögen? Wie nutzen Kriminelle das Internet für ihre Machenschaften? Und was hat die digitale Infrastruktur mit den weltweiten Treibhausemissionen zu tun? Deutschlands bekanntester Hirnforscher Manfred Spitzer deckt die Gefahren von Handys, Gaming und Social Media auf und erklärt dabei gewohnt verständlich, welche Auswirkung das digitale Leben auf uns hat. Ein beeindruckender Blick in unsere Zukunft und ein Augenöffner, der zeigt, wie wichtig ein bewusster Umgang mit den neuen Medien ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Manfred Spitzer
DIGITALESUNBEHAGEN
Manfred Spitzer
DIGITALESUNBEHAGEN
Risiken, Nebenwirkungen und Gefahren der Digi talisierung
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
2. Auflage 2020
© 2020 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Petra Holzmann
Umschlaggestaltung: Manuela Amode
Umschlagabbildung: shutterstock.com/sdecoret
Satz: ZeroSoft, Timisoara
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN Print 978-3-7474-0224-5
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96121-580-5
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96121-581-2
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
INHALT
Vorwort
1 Smartphones beim Essen
2 Auslagern? Gehirne machen keine Downloads
3 Vernetzte Dinge – bequem, aber gefährlich?
4 Der digitale Energieverbrauch
5 Vom Rendezvous zum Tinder-Date
6 Digitale Seitensprünge
7 Von Facebook-Untreue bis Twitter-Scheidung
8 Computerspiele – Ausbeutung und Gesundheitsschäden
9 Computerspiele zwischen Gaming und Gambling
10 E-Sport ist kein Sport
11 Smartphone-Verbot für Kinder
12 Smartphones an Schulen: verschenken oder verbieten?
13 Der Digitalpakt – ein Skandal
14 Fake News durch Twitter
15 Radikalisierung durch YouTube
16 Kein Kinderschutz bei YouTube
17 Dement durch Fernsehen?
18 Morbus Google
19 Was ist Medienkompetenz?
20 Supercomputer und Katzenvideos
21 Phantomvibrationen
22 Digitalisierte Babys: Verwanzt, monetarisiert und zur App verkommen
23 Hasssprache bewirkt Hasskriminalität
24 Verbrechen vorhersagen und verhindern?
25 Filmen statt helfen: Empathie im Sturzflug
26 Digitale Vertrauenskrisen
27 Schwarmdummheit
28 Schmerzen durch Smartphones
29 Sind Sie ein Mensch oder ein Roboter?
30 Online versus privat und sicher
31 Wie viel sind (uns) unsere Daten wert?
32 Jugend und Smartphones im Land der Smartphones
Dank
Über den Autor
Anmerkungen
Literatur
VORWORT
Von Februar bis September 2019 schrieb ich wöchentlich für die Südwestpresse in Ulm eine Kolumne zum Thema Digitales Unbehagen und berichtete über die Risiken und Nebenwirkungen digitaler Informationstechnik. Und weil das Smartphone nun einmal das weltweit am meisten verbreitete und von jedem Nutzer am meisten genutzte digitale Endgerät ist, handeln eine ganze Reihe der Beiträge auch von diesem kleinen Apparat.
Angeregt wurde das Ganze nicht von mir, sondern von meiner ältesten Tochter Ulla in einem Gespräch mit dem Chefredakteur der Südwestpresse; von ihm wurde es nach gut einem halben Jahr auch wieder beendet: genug des Unbehagens. Das wöchentliche Abliefern eines Textes war für mich nicht immer einfach, denn ich wollte so nahe wie möglich am Zeitgeschehen sein und schrieb daher nicht »auf Vorrat«. Aber die vielen kleinen Ermunterungen, die ich von Lesern per Mail oder bei zufälligen Begegnungen auf dem Ulmer Wochenmarkt bekam, machten mir die Arbeit leicht. Und als sie dann beendet war, war ich auch froh darüber, denn es war eben doch – Arbeit!
Irgendwann kam dann die Idee auf, die Beiträge zu überarbeiten, zu ergänzen und in einem Buch gesammelt zu veröffentlichen. Die Münchner Verlagsgruppe nahm diese Idee gerne auf und das Ergebnis ist dieses Buch. Man kann es lesen, wie viele Menschen die Bibel lesen: einfach irgendwo aufschlagen und sehen, was da geschrieben steht. Denn alle 32 Beiträge sind aus sich heraus verständlich und in sich abgeschlossen.
Seit einigen Wochen (Stand: Ostern 2020) ist die Welt eine andere geworden: Wer hätte noch vor wenigen Wochen gedacht, dass die Forderungen von Greta Thunberg und der Fridays-for-Future-Bewegung innerhalb weniger Wochen übererfüllt werden würden? Fluggesellschaften weltweit haben 80 bis 95 Prozent aller Flüge eingestellt, die weltweite Ölförderung wurde deutlich verringert, der Kohleverbrauch auch, weswegen in China, Indien und auch in Europa die Qualität der Luft deutlich besser wurde. Die Weltwirtschaft schrumpft. Ein winziges Viruspartikel, das uns Menschen eine Lungenkrankheit pandemischen Ausmaßes beschert hat, verschafft dem Erdball gerade eine Verschnaufpause. Die »Nebenwirkungen« dieser globalen Rosskur für uns Menschen sind dramatisch und werden nicht nur Tote, sondern auch viel Leid (auch durch die wirtschaftlichen Schäden) mit sich bringen.
Schon jetzt ist klar, dass vor allem junge Menschen durch die Krise stark beeinträchtigt sind. Ich meine dabei nicht den Verzicht auf Partys und Kontakte, sondern die Schließung von Bildungseinrichtungen, von Kindertagesstätten und Schulen bis hin zu den Universitäten. Diese geht mit dem massiven Einsatz digitaler Medien einher, von dem sich jetzt, nach etwa 35 Jahren PC und 20 Jahren Internet, überdeutlich herausstellt, wie schlecht damit Bildung gelingt. Sogar Schüler wünschen sich wieder die Öffnung der Schulen und den Unterricht durch Lehrer. Denn der ist durch keinen noch so guten Computer mit noch so schnellem Internetanschluss zu ersetzen! Das zeigt sich vor allem bei den schwachen Schülern. Ein guter Schüler kann allein für sich aus einem Buch lernen – das war schon immer so. Aber je schwächer ein Schüler ist, desto mehr Anleitung, Ermunterung und Strukturierung seiner Lernerfahrungen braucht er durch einen Lehrer. Aus sehr vielen Studien weiß man schon lange, dass digitale Medien die Kluft zwischen starken und schwachen Schülern nicht verkleinern, wie oft behauptet wird, sondern vergrößern. Ich kenne tatsächlich keine einzige Studie, die das Gegenteil – »Die Schwachen profitieren besonders« – aufgezeigt hätte. Die Kluft zwischen den guten und schwachen Schülern nimmt daher gerade jetzt in der Krise stark zu.
Ganz allgemein gilt zudem: Krisen bringen extreme menschliche Verhaltensweisen hervor, extrem gute und extrem schlechte. Welche hervorgebracht werden, hängt davon ab, was schon im Menschen drinsteckt, denn »hervorbringen« bedeutet ja nicht »neu schaffen«, sondern »ans Tageslicht bringen, was schon da ist«. Daraus folgt: Ob wir aus der Krise lernen und an ihr wachsen, hängt nicht vom Virus ab, sondern von uns. Wir haben es in der Hand. Das gilt für alle Krisen – Corona- und Klimakrise! Es wird höchste Zeit, dass wir lernen, die Krisen zu nutzen, um Veränderungen, die notwendig sind, auch durchzuführen. Und bei manchem, was nun gegen Corona getan wird, sollte bedacht werden, welchen Effekt es auf das Klima hat. Vielleicht hat so die eine Krise eine positive Wirkung auf die andere Krise.
Meine zweite Tochter Anja bekommt gerade ihr drittes Kind und macht sich nicht nur über das Corona-Virus Sorgen, sondern vor allem auch über die Zukunft ihrer Kinder und die Klima-Krise. Und meine jüngste Tochter Anna macht sich mit elf Jahren schon zuweilen Sorgen darum, dass manchen ihrer Mitschüler das Smartphone wichtiger zu sein scheint als ihre Freunde.
Dieses Buch ist meinen drei Töchtern – Ulla, Anja und Anna – gewidmet.
Ulm, an Ostern 2020Manfred Spitzer
1SMARTPHONES BEIM ESSEN
Man kann es täglich und überall beobachten: Eltern und Kinder sind zwar beisammen, aber nicht beieinander, weil Mama oder Papa auf ihr Smartphone schauen.
»So ist das eben heute«, mag der Leser etwas frustriert kommentieren, »da kann man nichts machen, die Zeiten ändern sich.« Man kann sich bei solchen Beobachtungen jedoch des Eindrucks nicht erwehren, dass hier etwas schiefläuft. Die Eltern sind abwesend und die Kinder wollen deren Aufmerksamkeit. Das nervt die Eltern und sie wenden sich erst recht ab. Die Kinder quengeln noch heftiger. Wenn jetzt nicht eine Ablenkung von außen passiert oder einer (vielleicht der Klügere?) nachgibt, kann die Sache eskalieren. Oder die Kinder wenden sich auch ab und es geschieht – nichts.
Besonders leicht lässt sich das in Schnellrestaurants beobachten. Alle haben Hunger, sind etwas genervt, und jeder schaut auf sein Smartphone. Hat das Auswirkungen und, wenn ja, welche?
Glücklicherweise hat sich auch eine US-amerikanische Kinderärztin mit dieser Frage beschäftigt. Sie hat nicht nur in Boston und Umgebung zunächst bei McDonald‘s, Burger King, Kentucky Fried Chicken und anderen Fast-Food-Restaurants ihre Beobachtungen gemacht und publiziert.1 Sie hat danach auch im psychologischen »Labor« bei insgesamt 225 Müttern mit ihren sechsjährigen Kindern untersucht, was passiert, wenn die Mutter ihr Smartphone beim Essen zückt.2
Der Mutter und dem Kind wurde zuerst jeweils erklärt, dass beide nun eine gemeinsame Mahlzeit bekommen und dabei gefilmt werden. Man wolle nachsehen, wie Mutter und Kind gemeinsam essen. In zufälliger Reihenfolge wurden dann vier unterschiedliche Speisen (auf zwei Tellern, jeweils einen für Mutter und Kind) serviert, die sich in ihrer Bekanntheit unterschieden, also zum Beispiel grüne Bohnen (bekannt) oder Halva, eine in der westlichen Welt recht unbekannte Süßspeise.
Die Auswertung ergab zunächst, dass knapp ein Viertel der Mütter beim Essen ihr Smartphone aus der Tasche holte. Die gemeinsame Mahlzeit fand in diesen Fällen also mit Smartphone statt. Man konnte die aufgenommenen Videos daher nun dahingehend analysieren, was geschieht, wenn eine Mutter mit ihrem Kind gemeinsam eine Mahlzeit zu sich nimmt – mit oder ohne Smartphone.
Was kam heraus? Wurde das Smartphone beim gemeinsamen Essen verwendet, sprachen Mutter und Kind 20 Prozent weniger miteinander. Die nicht verbale Kommunikation (Gesten, Blicke, Körpersprache) ging sogar um 39 Prozent zurück. Drittens wurden die Kinder 28 Prozent seltener von ihrer Mutter zum Essen ermuntert.
Diese Auswirkungen waren besonders deutlich, wenn eine unbekannte Speise zum Essen gereicht wurde. Man redete in diesen Fällen 33 Prozent weniger miteinander, die nonverbale Kommunikation nahm um 58 Prozent ab und die Ermunterungen zum Essen erfolgten um 72 Prozent seltener (vgl. Abb. 1).
Smartphones beim Essen verhindern also, dass Mütter mit ihren Kindern reden. Auch wird weniger mit Mimik und Gestik kommuniziert, und die Kinder werden seltener zum Essen ermuntert. Ganz besonders bedeutsam ist, dass dieser Effekt dann besonders extrem ausfällt, wenn es etwas zu lernen gegeben hätte. Wenn es etwas Unbekanntes zum Essen gab, das heißt, wenn Mutter und Kind neue Erfahrungen hätten machen können, wurde besonders wenig miteinander kommuniziert, und auch die Ermunterungen der Mutter nahmen besonders stark ab. Also genau dann, wenn das Kind hätte etwas lernen können, nahm das mütterliche Engagement ab.
Abb. 1: Prozentuale Verminderungen des sprachlichen Austauschs zwischen Mutter und Kind sowie der Ermunterungen des Kindes zum Probieren durch die Mutter bei allen Speisen und bei einer wenig bekannten Speise.3
Weil jedes Kind beim Lernen neuer Erfahrungen die Unterstützung der Eltern braucht, ist die Smartphone-Nutzung der Eltern beim Essen also besonders problematisch, denn ausbleibende Lernprozesse schaden der kindlichen Entwicklung. Bedenkt man nun noch, dass weltweit mehrere Milliarden Smartphones in Gebrauch sind und gemeinsame Mahlzeiten häufig Anlässe für familiäre Kommunikation und damit auch für kindliches Lernen sind, dann ahnt man die Bedeutung dieser Erkenntnisse aus der Wissenschaft.
Wenn Sie also beim nächsten Besuch im Restaurant beim Anblick einer Familie mit Kindern, die während des Essens ein Smartphone gebraucht, ein gewisses Unbehagen erleben, dann liegen Sie – rein wissenschaftlich betrachtet – richtig. Und wenn Sie gar Verantwortung für kleine Kinder haben – egal ob als Mutter, Vater, Großmutter oder Großvater, Onkel, Tante oder Freund bzw. Freundin der Familie –, dann nehmen Sie diese Verantwortung ernst und das Smartphone bei gemeinsamen Aktivitäten nicht in die Hand.
2AUSLAGERN? GEHIRNE MACHEN KEINE DOWNLOADS
Warum selbst denken, wenn man diese Arbeit auslagern kann? Diese Frage wird ernsthaft gestellt, oft mit Bezug auf die »Digital Natives«, die weder Telefonnummern noch das kleine Einmaleins auswendig wissen, weder die Hauptstädte Europas noch die Geburtstage ihrer Freunde richtig nennen können und sich weder in Physik, Chemie, Biologie oder Englisch noch an ihrem Wohnort besonders gut auskennen. »Das brauchen sie auch gar nicht! Sie können ja alles googeln. Und zweitens haben sie durch das Auslagern all dieses Wissens viel mehr Platz für anderes Wissen und andere Fähigkeiten (von denen man ja als älterer Uneingeweihter ohnehin keine Ahnung hat). Man braucht sich nur einmal ansehen, wie flink die jungen Leute auf ihrem Smartphone oder ihrem Laptop Texte verfassen oder mit anderen kommunizieren …«
Das Argument scheint zunächst sehr plausibel: Wenn weniger drinnen ist, passt mehr rein; wenn ich also geistige Inhalte nicht mehr im Kopf, sondern auf meinem digitalen Endgerät mit mir herumtrage, dann habe ich im Kopf mehr Platz.
Dieses Argument wird gegenwärtig so oft wiederholt, dass man meinen könnte, es könne gar nicht falsch sein. Und doch ist es vollkommen falsch, wie im Folgenden kurz erläutert wird.
Menschen lernen im Laufe ihres Lebens sehr viel: Laufen, Sprechen, alles, was es in der Welt gibt und wie man es benennt – durch viele einzelne Erfahrungen. Wie wir aus der Gehirnforschung wissen, hinterlässt jegliche geistige Aktivität – Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Planen, Wollen etc. – Spuren im Gehirn. Denn geistige Aktivität geht mit der Aktivität von Nervenzellen einher, die miteinander in Kontakt sind und sich elektrische Impulse wechselseitig zuspielen. Diese elektrische Aktivität ist die neuronale Informationsverarbeitung, die bei einem Computer in dessen Central Processing Unit (CPU), also in einem Chip, abläuft. Im Computer gibt es neben dieser Funktionseinheit, die Informationen verarbeitet, auch noch eine »Festplatte« (oder einen weiteren Chip), die Informationen speichert. Einen solchen Speicher gibt es im Gehirn nicht. Dort ändern sich vielmehr die Verbindungen zwischen Nervenzellen immer dann, wenn sie benutzt werden, also dann, wenn über diese Verbindungen Informationen in Form elektrischer Impulse fließen und dadurch verarbeitet werden. Und diese Verstärkung der Verbindungen zwischen Nervenzellen nennen wir Lernen. Gehirne machen also keine Downloads, sondern ändern sich immer dann, wenn sie Informationen verarbeiten. Und diese andauernden Änderungen der Verbindungen zwischen den Nervenzellen sind der Speicher. Im Gegensatz zum Computer, in dem die Verarbeitung und die Speicherung von Informationen funktionell und räumlich getrennt sind, gibt es im Gehirn diese Trennung also nicht: Verarbeitung und Speicherung erfolgen in den gleichen Neuronen(vgl. hierzu auch Kap. 19).
Die erste unmittelbare Folge ist: Je mehr das Gehirn verarbeitet, desto mehr speichert es auch. Und die zweite lautet: Je mehr das Gehirn gespeichert hat, desto besser kann es verarbeiten.
Nehmen wir ein Beispiel: Wer in China aufwächst, trainiert seine Sprachzentren mit chinesischem Input, weswegen diese irgendwann Chinesisch »draufhaben«, weil zwischen einigen Milliarden Nervenzellen ganz bestimmte Verbindungen entstanden sind, welche das Verstehen und die Produktion chinesischer Sprache ermöglichen. Wer hierzulande aufgewachsen ist, dessen Sprachzentren haben meist Deutsch »drauf«, und seit der Schulzeit zusätzlich mindestens auch Englisch.
By the way: Die Sprachzentren eines erwachsenen Menschen funktionieren grundsätzlich viel besser als zu der Zeit seiner Geburt, als sie noch fast nichts konnten. Die Verbindungen wurden sukzessive aufgebaut.
Zwischenfrage: Zwei Deutsche im Alter von 40 Jahren wollen eine neue Sprache lernen, der eine von beiden kann nur Deutsch, der andere hingegen kann Deutsch und noch vier andere Sprachen. Nun lernen beide eine neue Sprache. Wer lernt diese neue Sprache schneller und besser? »Na derjenige, der schon Deutsch und vier weitere Sprachen kann«, antworten nahezu alle Menschen, denen man diese Frage gestellt hat. Und sie haben recht, denn die Wissenschaft hat längst gezeigt, dass es umso leichter ist, eine neue Sprache zu lernen, je mehr Sprachen man schon beherrscht. Die Sprachzentren sind dann gewissermaßen vortrainiert und lernen eine weitere Sprache wegen dieses häufigen Sprachtrainings schneller und besser.
Wie würden Sie reagieren, wenn Ihnen jemand erzählte: »Ich kann fünf Sprachen und denke, dass meine Sprachzentren so langsam voll sind.« Wahrscheinlich würden Sie lachen. Warum? Weil Ihnen intuitiv klar ist, dass dies nicht sein kann, denn wenn einer schon fünf Sprachen spricht, dann fällt es ihm leichter – und nicht etwa schwerer –, eine weitere Sprache zu lernen.
Und wenn jemand in jungen Jahren Englisch in der Schule weglässt, damit er im Alter von 20 Jahren besser Chinesisch lernen kann, weil dann »in seinen Sprachzentren noch mehr Platz frei ist«, dann würden Sie ihn belächeln.
Was für die Sprachen gilt, trifft auch für das Erlernen des Gebrauchs von Werkzeugen, Musikinstrumenten, oder für Mathematik, das Fußballspielen oder das Briefmarkensammeln zu: Je mehr einer schon weiß und kann, desto einfacher ist es, noch etwas dazuzulernen. Dies gilt für jegliches Lernen beim Menschen. Man spricht auch vom hermeneutischen Zirkel (vgl. Kapitel 18).
Unser Gehirn wird also nicht »voll« in dem Sinne, wie eine Festplatte voll wird. Dies liegt daran, dass es in unserem Gehirn keine Festplatte gibt – und auch nichts, was dieser irgendwie vergleichbar wäre. Denn unser Gehirn ändert sich mit jeder Benutzung, lernt