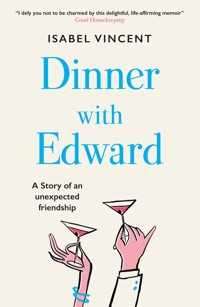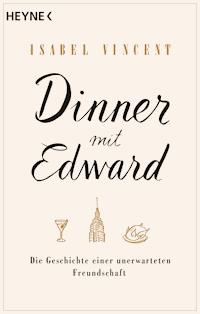
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Jeder sollte einen Edward haben.« Toronto Star
Zu ihrem ersten Dinner mit Edward erscheint Isabel mit einer Flasche Wein, aber ohne große Erwartungen. Eigentlich ist sie nur hier, weil ihre Freundin sie um den Gefallen gebeten hat, bei ihrem alten Vater nach dem Rechten zu sehen. Doch der Mann, der jetzt in der Küche steht und Hühnchenbrust und luftiges Aprikosen-Soufflé für sie zubereitet, steckt voller Überraschungen. Isabels Besuch ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe von unvergesslichen Abenden, in deren Verlauf Edward zu ihrem teuren Freund und Ratgeber wird. Mit seiner Hilfe gelingt es ihr, das Leben neu zu betrachten und frische Wege einzuschlagen.
"Dinner mit Edward" ist ein inspirierendes Lieblingsbuch und das perfekte Gastgeschenk für jede Dinnereinladung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
»Ich weiß nicht, ob die Aussicht auf ein Abendessen mich reizte, oder ob ich mich so einsam fühlte, dass mir sogar ein Rendezvous mit einem Neunzigjährigen attraktiv erschien. Wahrscheinlich war es eine Kombination aus Freundschaft zu Valerie und der Neugier auf ihren Vater, die mich einige Monate später dazu brachte, Edward einen Besuch abzustatten. Was auch immer die Gründe waren, ich hätte niemals gedacht, dass das Zusammentreffen mit diesem alten Mann mein Leben verändern würde.
Zu unserem ersten Dinner à deux kam ich in einem schwarzen Hemdkleid aus Leinen und Sandalen. Ich klopfte leise an seine Tür und drückte dann den Klingelknopf. Eine Sekunde später riss ein großer, älterer Herr abrupt die Tür auf. Er lächelte mich an, gab mir die Hand und küsste mich auf beide Wangen.
›Darling!‹, sagte er. ›Ich habe dich schon erwartet.‹«
Die Autorin
Isabel Vincent ist in Toronto aufgewachsen und arbeitet heute als Reporterin für die New York Post. Ihre Texte wurden in Zeitschriften und Magazinen in aller Welt publiziert. Für ihre Sachbücher wurde sie mehrfach ausgezeichnet.
ISABEL VINCENT
Dinner
mit
Edward
Die Geschichte einer unerwarteten Freundschaft
Die amerikanische OriginalausgabeDinner with Edward: A story of an unexpected friendship erschien 2016 bei Algonquin Books of Chapel Hill, a division of Workman Publishing Company, Inc., New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2016 by Isabel Vincent Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Loel Zwecker Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, nach der Originalgestaltung von Ploy Siripant Hand Lettering: Joel Holland Satz und E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-22527-8V001www.heyne.de
Für Hannah
Es war eine der besten Mahlzeiten, die wir je aßen – und die Tatsache, dass wir uns so wunderbar klar daran erinnern, heißt wohl, dass sie aus anderen Gründen bedeutsam war. Ich vermute, so etwas passiert jedem Menschen wenigstens einmal im Leben. Will ich jedenfalls hoffen.
– M. F. K. Fisher
The Gastronomical Me
Dinner am Heiligabend
Von dem Versprechen, das Edward seiner sterbenden Ehefrau gab, hatte ich schon gehört, lange bevor ich ihn kennenlernte.
Edwards Tochter Valerie, mit der ich schon seit ewigen Zeiten befreundet war, erzählte mir gleich nach dem Tod ihrer Mutter davon. Paula war kurz vor ihrem fünfundneunzigsten Geburtstag bettlägerig und apathisch geworden und war ständig zwischen Wach- und Schlafphasen hin und her gedriftet. Doch einmal hatte sie sich plötzlich aufgerichtet und ihren geliebten Ehemann ganz direkt angesprochen.
»Hör mir bitte zu, Eddie«, sagte sie aufgeregt und sehr entschieden. »Du kannst jetzt nicht mit mir kommen. Es würde das Ende unserer kleinen Familie bedeuten.«
Paula wusste, dass Edward lieber sterben wollte, als ohne sie weiterzuleben. Das sei falsch, sagte sie, und ermahnte ihn dringlich, sich nicht aufzugeben. Als er schließlich zustimmte, brachte sie dem Mann, mit dem sie neunundsechzig Jahre verheiratet war, ein Ständchen. Sie begann mit »My Funny Valentine« und ging dann über zu allerlei Broadway-Melodien, deren Texte sie nur noch bruchstückhaft im Kopf hatte. Sie sang Lieder und Balladen, die in den 1940er- und 1950er-Jahren ganz oben in den Hitparaden gestanden hatten, damals, als sie noch jung gewesen waren und von einer Karriere im Showbusiness geträumt hatten. Paula sang sie mit klarer Stimme, trotz des Lungenödems, das seit Tagen schon in ihrem Brustkorb gurgelte und sie am Sprechen hinderte. Sie endete mit »All of You«, dessen Text sie nur noch mühsam hervorbrachte: »I love the north of you, the east, the west, and the south of you, but best of all I love all of you.«
Vierundzwanzig Stunden später starb sie. Das war im Oktober 2009. In den Tagen und Wochen nach ihrem Tod war Edward so am Boden zerstört, dass es ihm beinahe unmöglich erschien, das Versprechen zu halten, das er Paula gegeben hatte. Einsam und unglücklich saß er in seiner stillen Wohnung am Esstisch, wo so viele lebhafte Dinner stattgefunden hatten. Schließlich fuhr er zum Lenox Hill Hospital und ließ sich von den Ärzten durchchecken. Sie konnten keine Erkrankung feststellen und schickten ihn am nächsten Tag wieder nach Hause.
»Ich fürchte, er gibt sich auf«, sagte Valerie, als sie sich im Wartezimmer des Krankenhauses neben mich setzte. Es war Heiligabend, und wir hatten uns zum Abendessen verabredet. Valerie schlug ein Restaurant in der Nähe vor.
Wir gingen in ein unscheinbares Bistro an der Third Avenue, setzten uns an einen Tisch und stocherten lustlos in unserem Essen herum – einem langweilig zubereiteten Red Snapper – und brachen beide in Tränen aus. Es war der Tag vor Paulas Geburtstag, und Valerie war noch immer nicht über ihren Tod hinweggekommen. Und nun musste sie sich auch noch große Sorgen wegen ihres Vaters machen, dessen Lebenswille mehr und mehr zu schwinden schien. Ich weiß nicht genau, warum ich weinte, als Valerie von dem kleinen Ständchen erzählte, das Paula ihrem Mann gebracht hatte. Ich kannte Edward ja gar nicht, und selbst wenn es ein ziemlich bewegender Moment gewesen war, kommt es mir so vor, als hätte mir diese Szene meine eigene unglückliche Situation vor Augen geführt. Ich war damals gerade erst nach New York gezogen, um als Journalistin bei einer Zeitung zu arbeiten, und hatte über die Weihnachtstage Bereitschaftsdienst. Meine Ehe ging den Bach hinunter, und es half überhaupt nicht, die ganze Zeit so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung. Darüber hinaus machte ich mir große Sorgen, welche Auswirkungen das auf unsere kleine Tochter haben könnte. Als ich kurz andeutete, in welcher schwierigen Situation ich mich befand – ich wollte Valerie ja nicht mit meinen eigenen Problemen belasten, jetzt wo es ihrem Vater so schlecht ging –, schlug sie vor, ich sollte mich doch von Edward zum Abendessen einladen lassen.
»Er ist ein großartiger Koch«, sagte sie mit Tränen in den Augen. Vielleicht hoffte sie, auf diese Weise meine Neugier zu wecken, ja, mir das Angebot zu entlocken, mich um Edward zu kümmern, wenn sie wieder nach Kanada zurück musste. Ihre Schwester Laura, eine Künstlerin, lebte mit ihrem Mann in Griechenland.
Ich weiß nicht, ob die Aussicht auf ein Abendessen mich reizte, oder ob ich mich so einsam fühlte, dass mir sogar ein Rendezvous mit einem Neunzigjährigen attraktiv erschien. Wahrscheinlich war es eine Kombination aus Freundschaft zu Valerie und der Neugier auf ihren Vater, die mich einige Monate später dazu brachte, Edward einen Besuch abzustatten. Was auch immer die Gründe waren, ich hätte niemals gedacht, dass das Zusammentreffen mit diesem alten Mann mein Leben verändern würde.
Zu unserem ersten Dinner à deux kam ich in einem schwarzen Hemdkleid aus Leinen und Sandalen. Ich klopfte leise an seine Tür und drückte dann den Klingelknopf. Eine Sekunde später riss ein großer, älterer Herr abrupt die Tür auf. Er lächelte mich an, gab mir die Hand und küsste mich auf beide Wangen.
»Darling!«, sagte er. »Ich habe dich schon erwartet.«
1
Gegrilltes Sirloin-Steak, Sauce bourguignonne Frühkartoffeln Schokoladen-Soufflé Malbec
Zu Anfang hatte ich immer eine Flasche Wein dabei, wenn ich Edward besuchte. »Du musst wirklich nichts mitbringen, Darling«, sagte er, aber ich ignorierte diesen Hinweis häufig, weil es mir unangenehm war, mit leeren Händen zu einem Abendessen zu erscheinen.
Es sei auch überhaupt nicht nötig, anzuklopfen oder zu klingeln, erklärte er mir. Er wusste immer ganz genau, wann ich vor der Tür stand, denn der Portier rief ihn sofort an, nachdem ich das Haus betreten hatte. Abgesehen davon ließ er seine Wohnungstür immer unabgeschlossen. Dennoch bestand er, schon kurz nachdem wir uns angefreundet hatten, darauf, mir einen eigenen Schlüssel zu überlassen, nur für den Fall, dass die Tür ausnahmsweise einmal verschlossen sein sollte oder ich vorbeikommen wollte, während er sein morgendliches oder nachmittägliches Nickerchen auf dem Sofa machte. Er gab mir den Schlüssel, der an einem violetten Plastikanhänger befestigt war. Sein Vorname und seine Telefonnummer standen in großen Druckbuchstaben auf dem weißen Schildchen, das in den Schlüsselring eingefasst war. Wir wussten beide, dass ich den Schlüssel niemals benutzen würde, um sein Apartment zu betreten, aber ich nahm ihn dankbar entgegen – es war eine Geste der Freundschaft und eine tägliche Erinnerung daran, dass Edward nun Teil meines Lebens geworden war.
Wenn ich Wein mitbrachte, schrieb er jedes Mal meinen Namen auf das Etikett und legte die Flasche in seinen provisorischen Weinkeller in einem Schrank im Flur, in dem er auch seine Wintermäntel aufbewahrte. Bei meiner Ankunft hatte er die Weine für die Mahlzeit längst ausgesucht und hob meine Mitbringsel für eine passendere Gelegenheit auf.
Bei einem der ersten Abendessen beging ich den Fehler, ihm ein paar von den salzigen Kabeljau-Kroketten mitzubringen, die ich nach einem Rezept meiner Mutter zubereitet hatte. Es war völlig abwegig gewesen zu erwarten, dass er sie zusammen mit seinen Speisen servieren würde. Ich überraschte ihn ohne Vorwarnung damit. Das war noch zu Anfang unserer Freundschaft, als ich nicht ahnte, welchen Aufwand an Überlegungen und Vorbereitungen Edward für ein einziges Dinner betrieb. Ich erkannte meinen Fauxpas im selben Moment, als ich ihm das klobige, in Alufolie verpackte Päckchen mit den Kroketten überreichte, und bemerkte seinen verwirrten Gesichtsausdruck. Aber er nahm mein Geschenk dankend entgegen und lud mich zu einem weiteren Abendessen noch in derselben Woche ein, bei dem wir sie zusammen verspeisten.
Edward war weder ein Snob noch ein übertriebener Feinschmecker. Er liebte es einfach, aus allem das Beste zu machen, und kümmerte sich hingebungsvoll um jedes Ding, das er herstellte – sei es nun ein Möbelstück für sein Wohnzimmer oder ein literarischer Text. Tatsächlich hatte er alle seine Möbel selbst getischlert und aufgepolstert und verfasste Gedichte und Kurzgeschichten, die er handschriftlich und sehr geduldig immer wieder neu auf unlinierten Seiten notierte, bis er das Gefühl hatte, dass sie gut genug waren, um von einer seiner Töchter abgetippt zu werden. Beim Kochen ging er ebenso sorgfältig vor, obwohl er damit erst spät in seinem Leben angefangen hatte, nämlich als er die Siebzig schon überschritten hatte. »Paula hat zweiundfünfzig Jahre lang gekocht, und eines Tages sagte ich ihr, sie hätte genug gearbeitet und ich sei nun damit an der Reihe«, erklärte er.
Schon als junger Mensch hatte Edward gutes Essen zu schätzen gelernt. Nachdem er mit vierzehn in der Schule sitzen geblieben war, schickten seine Eltern ihn von Nashville nach New Orleans, um dort den Sommer bei seiner Tante und seinem Onkel zu verbringen, die sehr wohlhabend waren. Seine Tante Eleanor war Lehrerin. Sie war sehr auf Disziplin bedacht und versuchte, ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen. Gleichzeitig war sie sehr daran interessiert, ihm die Grundlagen der französischen Küche zu vermitteln.
»Ich wurde in eine Welt eingeführt, von der ich gar nicht gewusst hatte, dass sie existiert«, sagte er, als er sich daran erinnerte, wie er 1934 ins legendäre Restaurant Antoine’s im French Quarter eingeladen worden war. »Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal Butterkrebse auf dem Teller hatte. Sie waren in dünnem Teig ausgebacken und wurden mit geschmolzener Butter serviert. Einfach köstlich.«
Als er mit dem Kochen anfing, orientierte er sich zunächst an der Speisekarte der französisch-kreolischen Küche des Antoine’s, aber er wusste auch die ganz einfachen Dinge zu schätzen. Einmal erzählte er mir, wie er als kleiner Junge gekochten Kohl gegessen hatte, mit »einem Klacks Butter oben drauf, der das Ganze in den siebten Himmel katapultierte«! Und er ließ sich von allen Seiten inspirieren: So behauptete er einmal, einen besonderen Trick beim Zubereiten von Rührei vom Heiligen Johannes mitgeteilt bekommen zu haben.
Der Heilige Johannes? St. John?
Das war ein Koch bei Amtrak gewesen, den Edward und Paula während einer zehnstündigen Bahnreise kennengelernt hatten. »Sein ganzes Leben lang hatten ihn alle immer nur ›Boy‹ genannt«, erzählte Edward. »Aber als er sich den Baptisten anschloss und eine Köchin namens Emma ihn unter ihre Fittiche nahm, wurde er auf einmal St. John the Baptist genannt.«
»Johannes der Täufer« wusste, wie man mit Eiern umgehen muss. Als Edward ihn nach dem Geheimnis seines Rühreis fragte, erklärte St. John ihm, dass er niemals alle Eier zugleich garte, sondern sie in zwei Schritten briet. Diesen Trick brachte Edward umgehend seiner Frau Paula bei. Und nun bestand er darauf, ihn mir zu demonstrieren. Er schlug ganz frische Eier mit leuchtend orangefarbenem Dotter in eine Schüssel, gab einen Spritzer Milch oder Sahne dazu, außerdem Salz und Pfeffer. Dann schmolz er Süßrahm-Butter in einer heißen Pfanne und gab die Hälfte der verschlagenen Eier hinein und zwar in dem Moment, in dem die Butter sich braun verfärbte.
»Niemals alles gleichzeitig reinschütten«, wiederholte er. »Rührei muss man in zwei Schritten zubereiten.«
Als die erste Hälfte zu brutzeln und zu blubbern begann, löste er die Masse vorsichtig mit dem Löffel, reduzierte die Hitze und fügte den Rest hinzu, um die glibberige, blassgelbe Mixtur so lange zu braten, bis sie locker, luftig und ganz mit Butter überzogen war.
Die entbehrungsreichen Jahre seiner Jugend im Süden hatten Edward gelehrt, sorgsam mit seinen Vorräten umzugehen. Frische Kräuter hob er in verschließbaren Plastiktüten im Gefrierfach auf. Sein Schweineschmalz, das er in großen Blöcken bei seinem Schlachter in Queens kaufte, packte er sorgfältig in Wachspapier ein, um es im Kühlschrank aufzubewahren. Edward liebte es, in speziellen Lebensmittelgeschäften wie Citarella oder der Gourmet Garage einzukaufen, aber er ging auch gern in den Supermarkt um die Ecke. Er besaß keine ausgefallenen Küchenutensilien, und die wenigen Kochbücher, die ich bei ihm sah und die er so gut wie nie aufschlug, waren Geschenke von wohlmeinenden Freunden.
»Ich koche einfach, Darling«, sagte er, als ich ihn fragte, warum er keine Kochbücher benutzte. »Ich denke nicht mal darüber nach, wie ein Rezept sein könnte. Ich möchte mich nicht mit irgendwelchen Vorschriften herumschlagen. Für mich hat das nichts mit Kochen zu tun – man klebt doch bloß an einem Stück Papier.« Seine alten, aber makellos polierten Kochtöpfe und Pfannen hängte er in der Küche an eine mit Alufolie überzogene Gerätewand aus Pressspan.
Ich bewunderte seinen Einfallsreichtum, wusste aber auch, dass er einen sehr erlesenen Geschmack besaß. Er verwendete nur Hendricks Gin fürs Mixen seiner Martinis oder um Lachs zu beizen, und behauptete steif und fest, nur mit Gurkensud könne man das zarte Aroma aus dem geräucherten Lachs richtig herauskitzeln. Um einen Martini zuzubereiten, goss er Hendricks Gin und sehr trockenen Vermouth in einen normalen Messbecher, und kühlte diese Mischung zusammen mit den Gläsern im Gefrierfach, bis die Gäste erschienen. Edwards Martinis wurden weder gerührt noch geschüttelt – er goss einfach nur Gin und Vermouth extra dry in einen Messbecher und stellte ihn kalt. Jedes Glas garnierte er mit einer dünnen Gurkenscheibe, die er ebenfalls gefroren hatte.
Immer wenn seine ältere Tochter Laura, die sich in Griechenland selbst einige kulinarische Vorlieben zu eigen gemacht hatte, ihn in New York besuchte und die Qualitäten von Olivenöl im Pastetenteig lobte, zuckte er zusammen. Und sie hatte den Verdacht, dass er die goldfarbenen, mit Olivenöl gebackenen Pfirsich-Pies, die sie extra für ihn zubereitet hatte, lieber weiterverschenkte. »Wenn es ums Kochen oder Backen geht«, sagte sie, »ist er wirklich sehr eigen.«
Aber die Steaks, die Edward an diesem Abend in seiner heißen gusseisernen Grillpfanne briet, kamen ganz schlicht aus der Kühltruhe des Lebensmittelgeschäfts. Er hatte das Fleisch in Balsamico-Essig mariniert und briet es nun scharf an, um die Steaks anschließend auf zwei Teller zu legen, die er im Ofen vorgewärmt hatte. Der Fleischsaft breitete sich über den ganzen Teller aus und mischte sich mit den wenigen Frühkartoffeln, die er mit Schale gekocht hatte. Über die Kartoffeln kamen nur noch ein paar Butterflöckchen, dazu gehackte Petersilie. Dann goss er eine samtige braune Sauce über das Fleisch und trug die Teller zum Tisch.
Die Steaks waren wunderbar zart und schmeckten, als hätte er sie beim besten Schlachter von Manhattan besorgt und nicht bei Gristedes. Die Sauce war buttrig und gehaltvoll. Als ich ihn fragte, wie er sie gemacht hatte, verfiel er in eine längere Erklärung, während der er zwei Mal in die Küche lief, um mir die demi-glace zu präsentieren, die ihm als Grundlage für die meisten seiner Saucen diente.
»Eine demi-glace herzustellen dauert sehr lange«, dozierte er, während er eine kleine Plastikdose aus dem Kühlschrank zog. Darin bewahrte er die Sauce auf, die er aus angerösteten Kalbsknochen und verschiedenen Gemüsesorten gekocht hatte. Die entstandene Flüssigkeit hatte er um drei Viertel reduziert, bis sie dick und sirupartig geworden war. Wie viele französische Köche benutzte auch Edward die demi-glace – beziehungsweise »glaze« wie er es aussprach – als Grundlage für Saucen und zur Anreicherung von Suppen.
»Man kann sie sich nicht mal eben herbeiwünschen«, fuhr er fort und bezog sich damit auf die lange Zubereitungszeit. »Das funktioniert nicht. Man muss sie tagelang kochen, damit sie immer konzentrierter wird.«
Ich nickte verständig und lobte mit gedämpfter Stimme den wunderbaren Geschmack von allem. Nicht, um ihm zu schmeicheln, sondern weil es wirklich ehrfurchteinflößend war. Für Edward ging es beim Kochen nicht um das schlichte Stillen von Hunger. Für ihn war Kochen eine Leidenschaft, manchmal sogar eine Kunstform, deren Geheimnisse man nur mit wenigen Eingeweihten teilen durfte. Er weigerte sich, Leuten Tipps zu geben oder ihnen Rezepte aufzuschreiben, wenn er bei ihnen den Bezug zum Kochen vermisste. Als er uns von dem Malbec einschenkte, erzählte er mir von einer Frau, die er einmal zum Abendessen eingeladen hatte und die über sein paillard vom Hähnchen in Verzückung geraten war.
Oh, Edward, du musst mir das Rezept dafür geben!
Aber Edward hatte nicht das geringste Interesse gehabt, ihr seine Geheimnisse bezüglich paillards zu offenbaren. »Wirkliche Kochkunst erfordert Hingabe«, erklärte er. »Und ich konnte sehen, dass die bei ihr nicht vorhanden war.«
Ich habe sehr viel über das Kochen von Edward gelernt. Er hat mir beigebracht, wie man das allerfeinste Brathühnchen mit Hilfe einer Papiertüte und einer Handvoll Kräutern zubereitet, wie man den perfekten Kuchenteig macht (»Butter und ein kleines bisschen Schweineschmalz müssen in den Teig, Darling.«), und dass man Balsamico-Essig über die Pasta sprüht, damit die Sauce sich besser anschmiegt. Schon zu Beginn unserer Bekanntschaft wusste ich instinktiv, dass seine kulinarischen Kenntnisse weit über die Zubereitung von Essen hinausgingen. Er brachte mir die Kunst des Geduldigseins bei, lehrte mich, den Luxus der Langsamkeit zu schätzen, und erklärte mir, dass man sich stets genug Zeit nehmen muss, um alles, was man tun will, vorher genau zu durchdenken.
Als ich ihn bat, mir zu zeigen, wie man ein Huhn entbeint, um eine Gelantine zuzubereiten, wusste ich, es würde auf etwas wesentlich Schwerwiegenderes hinauslaufen als nur das Zerteilen von Geflügel. Sein Hintergedanke war – das weiß ich jetzt –, mein Leben zu dekonstruieren, es komplett vom Knochen zu lösen und das Innere zu analysieren, egal wie schmutzig es werden würde.
Edward lebte auf Roosevelt Island in einer genossenschaftlichen Wohnanlage mit breiten Terrassen, viel Beton, einem ausgedienten Swimmingpool und großen Panoramafenstern, durch die man über den East River schauen konnte.
Ich war gerade erst auf diese Insel gezogen, weil mein Ehemann in einem allerletzten Versuch, unsere Ehe zu retten, darauf bestanden hatte. Im Gegensatz zu Edward lebte ich also nicht ganz freiwillig dort. Ein Jahr zuvor waren wir mit unserer kleinen Tochter von Toronto nach Manhattan umgezogen, damit ich eine Stelle als Reporterin bei der New York Post antreten konnte. Wir wohnten ein paar Blocks entfernt von Hannahs Schule in der Upper East Side, und es verging kein Tag, ohne dass mein Mann über die Enge des Viertels klagte, die Menschenmassen in der U-Bahn, die müllübersäten Spielplätze in der Nachbarschaft und die zweimal pro Woche wechselnden Parkzonen am Straßenrand – eine Tortur, deren Ausmaß nur Autobesitzer in New York nachvollziehen können.
In dieser Stadt ein Auto zu besitzen ist ein logistischer Albtraum. Wenn man seinen Wagen am Straßenrand abstellt, was viele Bürger tun, weil sie die vierhundert oder mehr Dollar monatlicher Garagenmiete nicht aufbringen können, muss man ihn zweimal pro Woche bewegen, um den Straßenreinigern den Weg freizumachen. Da Parkplätze eine echte Rarität sind, fahren die meisten ihre Autos auf die andere Seite und warten in zweiter Reihe eineinhalb Stunden lang, bis die Straßenreinigungsfahrzeuge ihre Arbeit getan haben. Dann parken sie schnell wieder am alten Platz ein.
Für mich war dieser Zwang zum Parkplatzwechsel nur eine der vielen bizarren und leider unvermeidlichen Schikanen des Großstadtlebens. Allerdings war ich auch nicht diejenige, die anderthalb Stunden im Auto sitzen musste, bis die Straßenreinigung vorbeigefahren war. Aber es gab auch noch andere Unannehmlichkeiten, zum Beispiel das Transportieren schwerer Einkaufstüten in der U-Bahn, die exorbitanten Lebenshaltungskosten in Manhattan, das Anrennen gegen den Passantenstrom während der Rushhour, wenn man noch einen Auftrag zu erledigen hatte oder Hannah von der Schule abholen musste. All das kam mir relativ harmlos vor, zumal ja alle Menschen um mich herum das Gleiche durchmachten – wir alle waren Mitglieder dieser exklusiven Bruderschaft des gemeinsamen Frustes, den der Alltag in New York City mit sich bringt.
Da ich den größten Teil meines bisherigen Berufslebens aus Entwicklungsländern berichtet hatte, liebte ich das New Yorker Chaos sogar. Diese Stadt mit ihrem dröhnenden Verkehr, den überquellenden Mülltonnen, den korrupten Politikern und den Ratten, die über dunkle Straßen und U-Bahn-Gleise huschen, hat etwas von einem Dritte-Welt-Land. An schwülen Sommertagen öffnete ich gern die Fenster unseres Apartments und erfreute mich am Lärm des Verkehrs und der vielen Baustellen.
»Du bist ja verrückt«, sagte Melissa, meine Kollegin und neue Freundin bei der Post. Sie war eine gebürtige New Yorkerin und sehnte sich ständig nach Ruhe und Frieden.
In den ersten Monaten in dieser Stadt fühlte ich mich dennoch ziemlich überfordert. Ich erinnere mich noch an einen Tag, als ich während der Rushhour auf die Linie 6 wartete. Ich war in Midtown und wollte rasch zurück, um Hannah in Uptown abzuholen. Der Bahnsteig war total überfüllt und die hereinfahrende U-Bahn ebenfalls. Ich wandte mich an eine gut gekleidete und zerbrechlich wirkende ältere Dame neben mir.
»Oha, ich glaube nicht, dass wir es in diesen Zug schaffen«, sagte ich und warf einen demonstrativen Blick auf die Menschenmassen um uns.
Sie schaute mich mit einer Mischung aus Mitleid und Verachtung an und fragte: »Wo kommen Sie denn her?«
»Kanada«, antwortete ich verlegen.
»Dann werden Sie es garantiert nicht in diesen Zug schaffen«, sagte sie lächelnd.
Kurz darauf war ich Zeugin, wie diese kultivierte Dame ihre glänzende Lederhandtasche an sich drückte und sich sanft, aber mit Nachdruck in den vollgepackten Wagen drängelte. Sie musste niemanden schubsen oder beiseiteschieben, um hineinzukommen. Mit Eleganz und Anmut gelang es ihr, sich gerade noch rechtzeitig hineinzumogeln, bevor der Schaffner die Türen zuknallen ließ.
Ich musste auf den nächsten Zug warten. Er war ebenfalls überfüllt, aber in dem Sekundenbruchteil, in dem die Türen sich öffneten, wurde ich zur New Yorkerin. Ohne Ansage, ohne »Entschuldigung« oder »tut mir leid« zu murmeln, schloss ich mich der Menge an und schlüpfte in den Wagen.
Mein Ehemann wollte sich den örtlichen Gepflogenheiten nicht anpassen. So gut wie jede Woche bekam ich zu hören, dass unsere Zeit an diesem, seiner Ansicht nach schlimmsten Ort der Welt bald enden würde. »Noch ein Jahr, und dann reicht es«, sagte er immer wieder. Aber es lag nicht nur an dem Umzug nach New York, dass unsere Ehe zu scheitern drohte. Wir hatten unsere widerstreitenden Gefühle im Gepäck über zwei Kontinente geschleppt. Wir waren immer in Bewegung gewesen, hatten ständig Kisten gepackt und ausgepackt, Wohnungen in den verschiedensten Häusern eingerichtet, endlose Behörden-Formulare ausgefüllt, um Visa für so unterschiedliche Länder wie Kosovo oder Brasilien zu beantragen. All das hatte uns davon abgehalten, uns mit unserer zerbröckelnden Beziehung zu beschäftigen. Immer dann, wenn Enttäuschung und Verbitterung überhandnahmen, hatten wir uns eine neue Umgebung gesucht. Als wir irgendwann total frustriert in einer engen Wohnung in der Upper East Side gelandet waren, fassten wir den Entschluss, es mit einem anderen Teil der Stadt zu versuchen. Dabei wussten wir beide nur zu gut, dass ein Ortswechsel unsere kaputte Ehe auch nicht mehr retten konnte.
Zu der Wohnung auf Roosevelt Island gehörte immerhin eine bezahlbare Garage, auch wenn das Gebäude schon etwas baufällig war, es durchs Dach regnete und der Aufzug nur selten funktionierte. Die rund zwei Meilen lange Insel schien ein angenehmer Rückzugsort vor dem Chaos in Manhattan zu sein und war dennoch mit Tram und Subway gut zu erreichen. Im Frühling war die Promenade mit Blick auf Manhattan überfüllt mit Müttern und Vätern, die Kinderwagen herumschoben, mit Joggern und händchenhaltenden Paaren. An Sommerabenden lag der Geruch von gebratenem Fleisch in der Luft, wenn die Anwohner sich um die Grillstellen am nördlichen Ende der Insel versammelten. Es gab dort ein Café am Flussufer mit einem tollen Blick auf das Gebäude der Vereinten Nationen, und man sah Schlepper, die unter der Queensboro Bridge hin und her tuckerten.
Und so wohnte ich, wenige Monate nachdem ich am Heiligabend mit Valerie in dem Restaurant in der Upper East Side zu Abend gegessen hatte, in diesem Haus, das nur wenige Blocks von Edwards Wohnung entfernt lag. Unsere gemeinsamen Mahlzeiten fanden bald regelmäßig mindestens einmal pro Woche statt, und ich wusste, dass er sich ebenso sehr darauf freute wie ich. Edward brachte Stunden damit zu, Rezepte für mich aufzuschreiben, und äußerte recht freimütig seine Ansichten darüber, wie ich lebte. Er trauerte noch immer um seine geliebte Paula, und mir wurde nach und nach klar, was für eine unglückliche Ehe ich führte.
Aber was auch immer in der Welt außerhalb von Edwards Apartment auf Roosevelt Island stattfand, die Abendessen waren stets magische Zwischenspiele. Wir tranken Cocktails, leerten Weinflaschen und aßen das, was Edward frisch zubereitet hatte. Ella Fitzgerald, Billie Holiday und Ute Lemper sangen im Hintergrund, aber manchmal herrschte auch eine angenehme Stille, und der Wind pfiff draußen vor den Fenstern des vierzehnten Stockwerks.
2
Flunder, in Vermouth pochiert, Sauce fumet Pommes de terre sarladaises Babyspinat Avocado-Salat mit hausgemachtem Blue-Cheese-Dressing Aprikosensoufflée Martinis, Vouvray
Ich kam kurz vor Sonnenuntergang in Edwards Apartment an, nachdem ich von meiner Wohnung aus über die Promenade am East River Richtung Queensboro Bridge gelaufen war. Unterwegs musste ich zahlreichen Kinderwagen ausweichen und Fahrradfahrern, die über den Uferweg rasten. Es war Frühling, und die Kirschbäume entlang des Flusses explodierten geradezu mit ihren zahllosen weißen und roten Blüten. Allen, die auf der anderen Seite des Flusses in Manhattan wohnten, musste Roosevelt Island wie eine Postkarten-Idylle erscheinen.
Edward wurde von seinem Portier alarmiert und goss schon einen Martini für mich ein, als ich in den Aufzug stieg, um in den vierzehnten Stock zu fahren. Das Glas war kalt und der Cocktail mit einer hauchdünnen Eisschicht überzogen. Ich setzte mich an den Küchentresen aus Resopal, neben ein Plastikschälchen mit Gänseschmalz, mit dem Edward in Scheiben geschnittene Kartoffeln braten wollte. Er hatte mir das schon mal vorgeführt – er schälte die kleinen, leicht schrumpeligen Knollen, schnitt sie so dünn wie nur möglich und verwandelte sie in Pommes de terres sarladaise