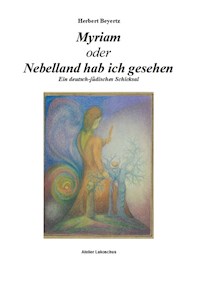9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Europa Edizioni
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Holger Ley nach vielen Jahren das Haus seiner Kindheit noch einmal aufsucht, trifft er Annie Labalue. Annie war eins von 200.000 Kindern französischer Mütter, der Vater deutscher Besatzungssoldat im Zweiten Weltkrieg. Zeitgleich Holgers Suche nach zwei Musikern der legendären Roaring-Harts-Truppe, Samuel Tempes und Ronald van Helmont. Sam und Ronnie waren nach ihrem letzten Konzert in Düsseldorf spurlos verschwunden – das war im Herbst des Jahres 77, dem Jahr der „Schläfer von Stammheim“.
Der Dritte der „Röhrenden Hirsche“, Adam Symons van Porst, Reederssohn amerikanisch-niederländischer Abstammung, sein Vater Ezra viele Jahre Jagdgenosse in Eifel- und Ardennen-Revieren von Holger Leys Vater.
Nachdem Adam Soledad Salinas, Holgers spanische Freundin, „auf die Rückseite des Mondes“ geschossen hatte, verbanden sich Annie Labalue, eine Ethnologin, und Holger Ley zur Suche nach den Ursprüngen eines „noch nicht ganz verschütteten Pompei, namens Europa“...
Der Roman setzt ein mit dem Jahr, in dem Diana Princess of Wales in einem Pariser Tunnel um‘s Leben kam, und er endet mit dem ersten Jahr der Masken.
Herbert Beyertz, Atelier Lakoschus. Jahre in Frankreich und Italien, danach in Berlin, jetzt in der Eifel. Erster Roman Die Boje, 2007, Oldenburg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Herbert Beyertz
DOLPHIN SONG
Eine Reise zu den Wurzeln
ROMAN
© 2023 Europa Buch | Berlin
www.europabuch.com | [email protected]
Gedruckt für Italien von Rotomail Italia
Finito di stampare presso Rotomail Italia S.p.A. - Vignate (MI)
DOLPHIN SONG
P r o l o g
La città poi di Vineta – wunderbares Venedig im Untergang! Im Palazzo der Bildermacher große Vernissage, in hohen dämmrigen Räumen die Werke der Auserwählten eines Jahrhunderts.
Einige Künstler scheinen noch nicht rechtzeitig fertig geworden zu sein und versuchen, während die Besucher sich schon drängeln, ihren bereits hängenden Bildern mit raschem Stift oder Pinsel noch etwas Glanz zu geben. Unter den Ehrengästen aber Glänzendes genug: schöne Damen, je reifer das Alter, um so reicher das Geglitzer an edlem Halse.
Bei meinem Betreten des nächsten Saals fühle ich mich seltsam angesprochen. Ein Ehepaar – ich vermute New Yorker mit Penthouse am Central Park – steht raunend vor dem ersten der Doppelportraits nord- und südländischer Künstler. Bei einigen muss ich raten oder mit Hilfe der Pappschildchen die Köpfe identifizieren. So finde ich Eleonora Duse neben Kainz, Marino Marini neben Kubin, Ingrid Bergman neben Ingmar, Jackson Pollock neben ... Auch dieser Künstler ist noch zugange in einem Halbkreis, der immer dichter wird. „Aufsehen erregst du aber genug!“, denke ich.
Ein Schwergewicht, schwitzend vor Anstrengung. Stift um Stift wechselt von seiner linken Hand in die rechte und – ausgedient – wieder zurück. Die Spannung in diesem Saal möchte man eine elektrische nennen, und das bevor noch die Ausstellung offiziell eröffnet ist. Was sich Offizieller weiß, schaut denn auch einigermaßen betreten von den Tischen der Eingangshalle herüber, nestelt an seinen Fliegen oder grinst gereizt. Und dass sich gerade mit surrender Kamera einer vor den Herren aufbaut, ließe sich spielend als leise surrende Verhöhnung deuten.
Hier aber gibt es wahrhaftig genug zu sehen, wenn auch nicht zu fassen! Weiße Blätter, die der Künstler mit zwei Heftzwecken an die Täfelung gepinnt, auf die er nur flüchtige Umrisse wirft – jetzt zurücktritt, jetzt mit dem Daumen schnippt, und aufscheint die Flusslandschaft einer schier paradiesischen Urwelt. Ausrufe dezenter Verblüffung begleiten diesen Akt. Als wir beim nächsten Blatt wieder auf das Schnippen gespannt sind, kommt es anders, ganz anders.
Sein Zurücktreten war in Wahrheit ein Anlaufnehmen. Plötzlich wirft er seine Stifte in die Luft, rast mit Sätzen, die ihm keiner zugetraut, auf die Wand zu, schnippt noch einmal, und mit einem Sprung – gerade spät genug, dass Bild sich in Raum verwandle – verschwindet er in diesen neuen Raum. –
Irre Schreie, Panik, Fensterklirren und lustig platschende Lagunen gaben das frühzeitige „Aus!“ dieser denkwürdigen Vernissage, Horst Janssen in memoriam.
E R S T E S B U C H
I
Der Rhein am Abend. Möwen umflattern das Heck eines Ausflugsdampfers mit niederländischer Flagge, es ist die „Moeder de Gans“. An Deck, das sonst völlig leer scheint, zwei Menschen an der Reling steuerbord: Adam Symons van Porst, ein robuster, hochgewachsener Mann von zweiundfünfzig Jahren, seine Mutter am Arm, eine neben diesem Sohn umso gebrechlicher wirkende kleine Frau.
Sommer 97, zwischen Unkel und Remagen, in dem Jahr, als Diana, Princess of Wales, in einem Pariser Tunnel ums Leben kam und man den neuen Kometen durch viele Wochen am nordwestlichen Himmel über den Rheinbergen stehen sah.
„Sind das Angler auf den Steinen?“
„Ja, Mutter.“
Huberdina, zögernd, bedenklich:
„Ist doch schon Abend. Werkelijk, die Berge haben für mich etwas Bedrückendes – haben es immer gehabt. Ja, und so große Fische da, früher sah man die doch nie.“
„Wo, Mutter?“
Mit der freien Hand deutet Huberdina mehrmals von Stromab nach Stromauf: „Da – und da – und …“
„Aber Mutter!“ Adam wirft einen besorgten Blick auf die kleine Frau an seinem Arm, während ein Frachtboot, hochbordig ohne Ladung, an ihnen vorüberrauscht. „Das sind Schatten von Bugwellen, was du da siehst! Hier kommt die Jason.“
„Unser Schiff?“
Seinem gedämpften „Noch“ folgt nach einer Weile: „Seine letzte Fahrt – auf meine Kosten.“
„Ebbes, und ist nur ein Frachtboot … Ninon hätte etwas Besseres verdient als so einen Appelkahn.“
„Der Appelkahn heißt Jason, Mutter – lies doch, groß und deutlich am Heck: Jason, nicht Ninon.“
Huberdina, als hätte sie’s überhört:
„Armes Kind. Nie verstand ich, wo ihr doch so glücklich schient mit den beiden Jungs. Wollt ihr nicht noch einen Versuch machen? Jan, glaube ich, hat es am schwersten getroffen.“
Adam, obschon genervt, in guter Beherrschung:
„Das glaube ich nicht. Aber wir telefonieren manchmal wieder. Merkwürdig, wie gern sie von dir spricht.“
„Adam, ich möchte wieder nach Holland. Kannst du das nicht machen? Oder haben wir das Haus im Haag nicht mehr?“
„Mutter, du weißt, es geht nicht. Du brauchst Hilfe, die ich dir dort schwer sichern kann. Sobald die Villa am Turm renoviert ist – glaube mir, nirgendwo wirst du es besser finden. Und Katzen kannst du so viele halten, wie du willst.“
„Ich weiß nicht, Adam. Dort in den Ardennen, die vielen Soldaten …“
„Wieso?! Außer zu den Herbstmanövern gibt es da keine Soldaten.“
„Du verstehst nicht. Die Gefallenen, die Gräberfelder, all die …“
„Nicht im Umkreis von zehn Meilen! Ich bitte dich … Aber es wird kühl, Mutter, gehen wir wieder unter Deck.“
Auf halbem Weg wendet sich Huberdina noch einmal zum Wasser:
„Diese großen Fische da … Lieve God.“
Die „Moeder de Gans“ ankerte vor Andernach, gerade als die Laternen angingen. Holger Ley machte, wie meist nach langer Zugfahrt, noch einen Spaziergang am Rhein, bevor er seinen bei der Bastion abgestellten Wagen aufsuchte. Der Abend war lau, zwei Angler saßen noch auf den Steinen. Eine Weile sah er dem hellerleuchteten Schiff zu, setzte sich auf eine Bank. Niemand ging von Bord, ein Gast nur stand neben dem festmachenden Matrosen und spähte mit verdeckter Hand zum Ufer.
Auf einmal sein Ruf: „Pieter!“ Antwort bekommt er nicht.
Er rief noch zweimal, dieser Mann mittleren Alters. Vier Jahre später, von Leslie Kaper am Turm vorgestellt, würde Holger ihn nicht wiedererkennen. Obwohl – diese Stimme, ihr besonderer Tonfall, schon da hätte sie ihn erinnern müssen! Er war es – und er war es nicht. Die durch Adams Ruf nach seinem Sohn in ihm geweckte Stimme jedoch – nun, nach nochmals vier Jahren war er sich ganz sicher, dass er sie von weit, weit früher her kannte.
Ein fünfjähriger Junge an der Hand seines Vaters Ezra – Jagdfreund von Holgers Vater –, eines Amerikaners mit der Stimme wie aus einem alten Radio.
„Kilroy was here!“, sagte Holger Leys Vater mit nicht mehr ganz sicherer Zunge nach fünf oder sechs gemeinsam geleerten Moseltraminern, nachdem er seinen späten Gast zum Gartentörchen geleitet hatte.
Gedämpftes Gelächter folgte stets dem letzten Gruß, wenn der Jeep mit seinem schwarzen Fahrer die schlecht beleuchtete Dorfstraße davonfuhr. „Hat er nicht eine eigenartige Stimme?“, mochte dann Vater Jacques die Mutter fragen, worauf Elsa immer nur das eine zu erwidern wusste, indem sie den mitternächtigen Pegel ihres Mannes zu taxieren versuchte: „Er ist eben Amerikaner.“ –
Der Farmerssohn aus Wisconsin (mit bayrischen Vorfahren) hatte eine Reederstochter von Holland an dem Tag geehelicht, als ein deutscher Admiral die bedingungslose Kapitulation des Großdeutschen Reiches unterzeichnete. Somit feierte der Leutnant der US Air Force einen doppelten Sieg. Ein Kind war bereits unterwegs, die Heirat schien (wenn auch nicht unbedingt für ihn) zwingend, Adam wurde das Kind getauft.
Wo hat er Holgers Vater kennengelernt? Kilroys wirklichen Namen vernahm der Junge erst, als Vater Jacques an einem Sonntag nach dem Mittagessen (bei Elsas und Holgers Pudding, bei seinem Glas Wein) ins Erzählen kam ... ,,Also, deine Mutter wird es Wort für Wort bestätigen – nicht wahr, Elsa?“
Mutters Augen gingen zur Decke, während Vaters Zeigefinger ans Glas schnippte, was, je nachdem wie voll es war, einen eigenen schönen Klang ergab. Wie oft hat er seine Geschichten so begonnen!
„Es war auf unserer ersten Fahrt nach Oberammergau, eine Fahrt mit Hindernissen, kann man wohl sagen, als Mutter ihre goldene Armbanduhr, weil sie mal dringend musste, zwischen Heilbronn und Stuttgart verlor. Zwei Wochen später, auf der Rückfahrt, haben wir das gute Stück an genau derselben Stelle wiedergefunden. Und das war – na, mein Junge?“
„Ein gutes Omen!“, rief Holger glücklich.
„Ja, und am Morgen vor Beginn der Passionsspiele machten Mutter und ich einen Ausflug zur Hochplatte. Wir sahen München am Horizont und Hohenschwangau in den Alpen an diesem herrlichen Tag – nächstes Mal fährst du mit.“
„Darf Myriam dann auch mit?“
Er stutzte, sein Blick wanderte zu Elsa. Sie lächelte erst verlegen, sagte aber mit ruhiger Gewissheit:
„Natürlich, sobald sie wieder ganz gesund ist.“
Nun eine kleine Pause, in der Vaters Auge einer Fliege überm Tischtuch folgte. Mit einem ganz raschen Klaps seiner eingerollten Serviette erlegte er sie – selten, dass ihm eine entging. Nicht mal ein Blutfleckchen sah man an der Waffe des Meisterschützen, mit der er die Fliege vom Tisch kehrte.
„Ein ziemliches Gedränge da oben, auf dem Plafond waren die meisten wohl wie wir Besucher der Passion, die Aussicht ist ja auch phänomenal. Mutter hatte die Kamera mit und dein Vater stellte sich in Richtung Burg an das Geländer. Von einer Bank neben Mutter erhob sich ein Mann, wartete noch zwei Knipser ab und kam dann lächelnd auf mich zu: ‚You are Pilatus?‘
Ein Amerikaner, dachte ich gleich, die Engländer sind nicht so neugierig. ‚Yes, yes‘, sagte ich, ‚I am Pilatus.‘ Leider lachte Mutter, und der Ami brauchte jetzt eine andere Antwort. So kamen wir ins Gespräch. Er stellte seine Frau vor, eine Holländerin … Was für eine feine Dame, nicht wahr, Elsa?“
Elsa warf kopfnickend einen Blick auf ihre goldene Uhr und nahm, was noch auf dem Tisch stand, an sich. Sofort meldete Jacques Protest an:
„Bitte, meine Liebe, diesen Rest in der Flasche, wo mich jede zehn Deutsche Mark kostet, wirst du nicht wegschütten!?“
„Oh verzeih, ich konnte es nicht sehen bei dem dunklen Glas.“ Und lächelnd, ihrem Jaques über die Glatze streichend, sagte sie noch (da musste es ihr schon richtig gut gehen, der es oft nicht gut ging):
„Ich bin ja auch nicht so ein Lurjäger.“
Nachdem Vater den Rest seinem Glas zugegossen, einen Schluck getan, fuhr er fort:
„Ezra Symons, der war’s! Jetzt weißt du, wie mein amerikanischer Freund heißt und bringst mich nicht mehr in Verlegenheit.“ –
Dieser Ezra Symons van Porst (den Namen seines Schwiegervaters übernahm er gleich mit der Tochter) wurde von dem Moment an, also noch auf der Hohen Platte, des Vaters Freund, als sie über Jagd und Jagdgebräuche bei uns und in Übersee zu sprechen kamen. Zwei Jäger vor dem Herrn hatten sich gefunden.
„Mein Englisch ist zwar nicht so gut wie mein Französisch, aber – schließlich haben wir Albion nicht erobert.“
„Warum nicht, Vater?“
„Das war der Morphinist. Der wurde immer fetter und unser Material immer magerer. Die – Luftherrschaft, mein Junge, die entscheidet jeden Krieg … Hast du dazu das Material, oder hast du es nicht. Wenn ich das Gold damals nicht gerettet hätte (und Holger denkt: auf einer Insel im Hariksee), wo wären wir geblieben! In den harten Jahren, wir hätten sonntags nicht einmal ein Huhn im Topf gehabt.“
Auf ihrer letzten gemeinsamen Jagd, die sie noch einmal in Wassenberg zusammenführte – ausgerichtet von Adam, ohne den schon nichts mehr lief –, verlor Jacques durch den Fehlschuss seines Freundes seinen besten Hund.
Es passierte auf einer Treibjagd. Ezra war gerade am Star operiert worden und die vielgerühmte Sicherheit dem Dreiundachtzigjährigen nur noch in Andeutungen geblieben. Hubert, ein Freund seit Jugendtagen, war als erster der Stammgenossen im Jahr zuvor ausgeschieden. Von ihm hier nur so viel, dass sein Grab in Wellmahr ein Hirsch in Bronze ziert, zwar nicht in Naturgröße, mehr wie eine kräftige Dogge: Hubertushirsch, dem zwischen seinen Stangen ein Kreuz gewachsen ist. Hubert war früh aus der Kirche ausgetreten, hatte unter Deutscher Eiche seine Ehe geschlossen, doch scheint das Kreuz im Geweih des Hirschleins die Rückkehr zum Glauben seiner Kindheit zu bezeugen. Drei Jäger mit ihren Hörnern bliesen diesem Jäger vor dem Herrn das letzte Halali, so wie es auch Holgers Vater vier Jahre später geblasen wurde.
Wanda, Jacques Hündin, war ein phänomenaler Stöberhund und noch im hohen Alter allen jüngeren um die berühmte Nasenlänge voraus. Das aber bereitete ihr das Ende: Zu früh kehrte sie mit einem Hasen im Maul zurück, als noch ein Häschen an ihr vorbei stob und Ezra schoss, ohne Wanda rechtzeitig wahrzunehmen.
Später, im Burgrestaurant, bei Hirschragout und Ahrweinen bester Lage, wurde auch dieser Fehlschuss begossen und vergessen. Jacques soll da eine Rede gehalten haben, auf die arme Wanda und den Meisterschützen Ezra, die ein göttliches Gelächter beschloss.
Keiner von beiden ging noch einmal auf die Jagd.
Vogelzüge vor den Raunächten. Woher kommen sie, wohin gehen sie?
„Die Horlegänse ziehn!“, rufen die Kinder im Bergland. Ihren sonderbaren Lauten, die doch keine Wildgänse sind, verdanken sie aber ihren Namen – harschen Wehmutsrufen nach fernen Meeren!
Seit Sankt Martin wieder im Eifelhaus, wecken sie in Holger Ley die Erinnerung noch an eine Zeit, als er Externer eines Internats rheinüber war. Und im Briefkasten hatte er die Woche zuvor die Einladung zu einer Ausstellung über Menschen des Grenzlandes gefunden: für einen Grenzlandsassen „seit den vier Haimonskindern“, wie sein Vater von den Leys einmal behauptete, ein weiterer Grund sich zu erinnern!
Da erlebt er nun etwas von tristen Busfahrten über kurvenreiche Vorortsstraßen, die bisweilen, zumal vor Zeugnissen oder Klassenarbeiten, nahezu Seekrankheit bewirken konnten. Der Fußweg durchs Neandertal aber endete in einem Provisorium von Schule, deren schöne Urigkeit noch den widerspenstigsten Leistungsverweigerer länger als irgend sonst zu tragen gesonnen schien.
„Holger Ley, deine Schrift ist so schlecht, als hättest du deinen Aufsatz mit einem Pinsel geschrieben.“
Zum Gekicher von zwanzig Jungen und Mädchen erhielt er ihn zurück: „Ungenügend“. –
Zweihundert Meter talauf die berühmte Höhle, in der man im 19. Jahrhundert die Spuren des Vormenschen entdeckt hatte. Das war aber noch nicht der Maler gewaltiger Friese, der shaman artiste Altamiras und Lascaux’, dessen Überreste dort geborgen wurden. Ausgestorben mit einer der Sintfluten (Hopis wie Mayas wissen von drei), gab es für den Neandertaler, für diesen finsteren Burschen, weder Arche noch Lied.
Es war nach seinem unrühmlichen Abgang vom Internat und Holger sich erstmals in Geschichten versuchte, wunderlich bedingungslos sich nur die tragischsten Schlüsse ausmalend: Was nicht fürchterlich endete, war gewissermaßen „ungenügend“. Aber dass in der Schwärze der Nacht – wie am Ende eines langen Höhlengangs – ein wunderbar farbiges Leuchten nur darauf wartete, entdeckt zu werden, dazu fehlte ihm der Glaube.
Stiefbruder Frank, zehn Jahre älter, dem eine dieser Geschichten in die Hände fiel, las sie am Küchentisch der Mutter mit theatralischem Pathos vor. Elsa aber seufzte nur, beim Entfädeln der Bohnen: „Lass das, Frank, Holger soll sich nicht schämen müssen.“
Nachdem der große Bruder verschwunden und sie sein Motorrad die Straße herunter donnern hörten, sagte die Mutter:
„Warum nimmst du deine Geige so wenig vor? Tante Isgard meint ...“ Sie stockte, schaute bekümmert nach den Papieren, die Holger mit rotem Gesicht vom Küchentisch raffte. „Du hast doch so schön angefangen.“ –
Neben seinem Bücherregal hatte er vier Zeichnungen Kubins zu den Prosadichtungen Georg Trakls geheftet. Diese Zeichnungen waren in den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs entstanden. Als „das graue Antlitz des Schreckens“ sah man gleichnishaft ein Jahrhundert konterfeit, das so unwirtlich schien und nur in seltenen, herausgehobenen Stunden – etwa beim Erleben Beethovenscher Musik – Menschen noch von Erlösbarkeit zu sprechen vermochten. Gewiss nur ahnungsweise, wie Kranichrufe in einer Raunacht, tönte dann auch ihm der wortlose Wechselgesang eines Tauben: als der unauslöschliche Beweis, den Leonhard Bernstein „Gottesbeweis“ genannt hat. Mit Beethovens Musik gäbe es etwas, „das richtig ist, das stimmt und stetig nur seinem ureigensten Gesetz folgt, dem wir vertrauen können und das uns niemals im Stich lässt.“
Bei Isgard, der älteren Schwester der Mutter, seiner Geigenlehrerin, hing in ihrem Studio zwischen einem Gustav-Mahler-Portrait und der Lebendmaske Beethovens von 1812 ein Spruch, den er immer wieder las, mit der Geige neben dem Flügel stehend. Nach etwa einem Jahr fragte Isgard, indem sie ihre, für eine Frau ungewöhnlich großen, wenn auch schmalen Hände auf einem angeschlagenen Akkord lange ruhen ließ:
„Verstehst du das?“
Natürlich verstand der Vierzehnjährige das nicht. Da sagte sie:
„Beethoven hing dieser Spruch über seinem Schreibtisch in Wien, im Schwarzspanierhaus. Wenn wir in Bonn das Beethovenhaus wieder einmal besuchen, kommst du mit. Im Tempel der Göttin Isis war das zu lesen. Auch mir bleibt der Spruch ein großes Rätsel, obwohl er doch schon so lange hier hängt.“
Sie lachte ein bisschen, zwei Goldzähne blitzten aus einem liebevollen Juffergesicht. „Ja, genau seit dem Jahr deiner Geburt. Es war der erste Ausflug deiner Mutter mit mir nach dem Kriege. Nächstes Mal fährst du mit, willst du?“
„Was hat es mit Musik zu tun – hat es?“ Eine Beklommenheit erfasste Holger, vielleicht weniger der Rätselworte, eher wegen seines dürftigen Geigenspiels, das er soeben wieder bei der leichten Haydn-Sonate bewiesen hatte. Und wohl auch vor den beiden Köpfen rechts und links. Isgard erhob sich, fast traurig blickte sie nun, obwohl sie lächelte, und beschloss ihren Unterricht mit den Worten:
„Die Musik ist so ein tönender Schleier. Doch wir Menschen schlafen noch – oder wir erinnern uns nicht tief genug, wie sollten wir ihn heben! Wir sind nur wie Wandhorcher an einer Höhlenwand ... Ein Wort übrigens von Ernst Barlach.“ Sie zeigte nach dem Bücherbord zwischen den beiden Fenstern, auf dem neun Fotos in einem gemeinsamen Passepartout standen.
„Sie stammen von einem nicht vollendeten Beethoven-Denkmal dieses großen Künstlers: Fries derLauschenden. Wunderbar wie drüben der Spruch! Wenn wir doch so zu lauschen verstünden, wie Barlach es gemeint hat! Zwischen dem Denkmal, das nicht errichtet werden durfte, und dem Tempel, wie viele Jahrhunderte liegen dazwischen! ... Ja, woher kommen wir, wohin gehen wir? Das frage ich mich oft.“
Der Spruch der Göttin von Sais auf Beethovens Schreibtisch:
Ich bin, was da ist,
Ich bin Alles, was ist, was
war, und was seyn wird.
Kein sterblicher Mensch
hat meinen Schleyer aufgehoben.
Isgard wurde wie ihre Schwester steinalt. Dass Holger Ley in den Krisenstunden seines Lebens zu fragen vermochte wie Isgard – „Woher komme ich? Wohin gehe ich?“ –, das ging ihm nicht verloren, wie ihm sein Geigenspiel und seine Geige verlorengingen.
II Waldverschlagen
Fing sie die Sprache?
Trägt sie Musik der Delphine? –
Gertrud Kolmar
Winterabend. Ich höre die Glocke der Dorfkapelle, es ist einer Achtzigjährigen Totengeläut und ruft zum Gebet an diesem windigen Tag, der auch wieder Schneefall bringt. Eine Weile lausche ich dem Windzug im Ofenrohr und letzten Vogellauten um den Futterplatz herum. Ab und an das Gebraus der Bundesstraße, mir genügend entfernt, selbst bei diesem Lastzug bergauf ... Helle Trübnis, Schneeflocken – hell! –
Das Wiesel, schneeweiß, huschte bachentlang in rieselnder Dämmerung. Eine alte Frau hatte sich mit einem wundersamen Lächeln von ihren Lieben verabschiedet: „Ich weiß, ihr habt es immer gut gemeint.“ Vor drei Tagen ihr letzter Traum, ein Albtraum, es muss auch ihr letztes Ringen gewesen sein ...
Ein Geschwader von Kampfmaschinen umkreiste den Hochberg, verschwand hinter Wäldern, um kurz hernach in doppelter Anzahl wiederzukehren. Nun jedoch fand sie die Worte nur noch mühsam, von schwerem Emphysem beengt. Denn auf einmal sieht sie die Flieger auf Haus und Hof zujagen, wo sie allein bei den Sonnenblumen im Vorgärtchen steht. Weiter folgen konnte ich ihrem Bericht nicht, er ging mir unter im Eifeldialekt, in den sie erst jetzt und nur noch flüsternd fiel. Fünfte Raunacht.
In diesen Tagnächten soll es in einer Anstalt am Niederrhein zu einer schweren Randale gekommen sein, erzählte Nachbar Jost beim Kaffee nach der Beerdigung der alten Frau. „Ley, wie heißt doch gleich die Stadt ...“ Ich hob meine Schultern in Unwissenheit und war ganz Ohr.
Die mit Tranquilizern ruhig gestellten Bewohner eines geschlossenen Hauses wurden auf einmal lebendig, aus Apfelsaft und Weißbrot hatten sie sich einen Schnaps gebraut. Nach einer wundervoll durchzechten Nacht (Karneval auf fünf Kanälen) „kam das Ende natürlich ganz schnell: Schlägerei, Großalarm, verletzte Wächter ...“ Aber einer sei entflohn und konnte bis zur Stunde nicht eingefangen werden.
Waldverschlagen. Das Vöglein, das ihm eine Viertelstunde sang ... Und als er zurück in die großen Städte seiner Jugend kehren wollte, war ein Vierteljahrhundert vergangen. –
Herbst und Frühjahr, mitunter auch schon an Wintertagen, ziehen die Kraniche (hier nennt man sie, wie gesagt, Horlegänse) über die Hocheifel, Grus Grus ihr ornithologischer Name. Gestern, da war ein breiter Zug in Unordnung geraten, und es dauerte lange, bis sie ihre schöne Keilform wiedererlangten.
Windkrafträder am Horizont schienen mir nicht die Urheber der Verwirrung. Ob sie noch fliegen, wenn von den Rädern nur noch der Wind, der sie einmal hat drehen lassen, geblieben ist? –
Waldverschlagen auch Gertrud Kolmar. Ihr Bildnis, eine Ikone verlorener Jahre, hat hier wieder ihre Nische gefunden. Die beiden Nachbarinnen rechts und links sind ihr nicht Unbekannte, und zwar von niederrheinischen und Berliner Behausungen her: Zenta Maurina (ein Foto der Dreißigjährigen aus Lettlands Zeit) zur Linken, Eleonora Duse (als Die Frau vom Meer in Ibsens Drama am Vorabend des Ersten Weltkriegs) zur Rechten ... Ikonen in Dreisamkeit!
Hier, im alten Grenzland Römischer Herrschaft, gab es den Kult der Drei Göttinnen an Quellen und Flüssen. Auch unterm Bonner Münster wurden zahlreiche Weihesteine der Aufanischen Matronen geborgen. Wie viele tauchten erst aus den Trümmern zerbombter Städte auf! Schützende, nährende Göttinnen der Erde, in der Mitte stets die Jüngste, das Mädchen mit einem Korb voll Früchten auf seinen Knien.
Junge Menschen im Nachkriegs-Deutschland. Mit jeder Halbgeneration wurden es mehr: Fremdlinge im eigenen Land, die auf eine nach amerikanischem Vorbild getrimmte Gesellschaft wie mit Indianeraugen starrten und noch bevor sie ihre Haare wachsen ließen wie die Indianer, beim Signal, das von England ausging.
„Die uralte musikalische Kultur, wo eine bezaubernde Musik durch die ganzen europäischen Gegenden ging“, sie lebte wieder auf und erfasste eine ganze Generation. Tausende Bands schossen als Pilze aus Europas altem Boden. Samuel Tempes, ein von Mutterseite her Verwandter aus Holland, Halbjude und Student in Leiden, wechselte nach Aachen und gründete bald darauf eine Band. Sie spielten in Kellerkneipen und Turnhallen, ein paarmal auch bei uns in Wellmahr. Ich dachte: „Role over Beethoven“ röhren die nicht schlechter als Chuck Berry oder die Rolling Stones. Als Samuel durch meine Mutter von meiner Geige hörte, die ich kaum noch aus ihrem schwarzen Kasten hervorholte, zeigte er lachend seinen später so berühmten Goldzahn und schlug mir auf die Schulter:
„Lass die Geige in ihrem Sarg, Holger, besorg dir eine Gitarre. Sobald du vernünftig Akkorde schlagen kannst, machst du mit.“
Elsa schien der Vorschlag ihres Neffen gar nicht so übel, sie meinte sogar: „Wenn deine Begeisterung ihn ansteckt, Samuel, geht ihm auch seine Geige nicht verloren.“
Die Gitarre habe ich mir gekauft. Noch im selben Jahr lernte ich bei ihrem zweiten Wellmahrer Konzert, in der Turnhalle meines alten Gymnasiums, Soledad Salinas kennen. Sie war Schülerin in der Musikschule in Neuss, der Leiter ein alter Studienfreund Isgards. Soledad war weder mit Samuel noch Ronald verbunden, aber da war ein Adam im Hintergrund, von dem ich lange Zeit nur durch Samuel gerüchtweise hörte, nachdem Soledad zu diesem boyfriend, einem Reederssohn, gezogen war.
Obwohl es zu einer „Elektrischen“ schon gelangt hätte, bin ich stattdessen mit dem Fahrrad und meiner Gitarre einen Herbst lang durch die Grenzländer von Maas und Mosel gestromert. Ich übernachtete in Jugendherbergen oder schlief in Wäldern in einem winzigen Zelt. Das gefiel mir so gut, dass ich auch im folgenden Jahr zu Samuel keinen Kontakt suchte. So blieben Samuel, Ronald und Manni (mir ein fast Unbekannter, der noch im selben Jahr mit Suizid abging) allein. Meistens spielten sie in den Niederlanden, seltener in Belgien, in Wellmahr meines Wissens nicht mehr. Adam muss damals, nach Mannis Tod, hinzugestoßen sein. Das war im Sommer der ersten Mondlandung, als Adam seine spanische Geliebte auf die Rückseite desselben Mondes schoss, wo auch ich einmal gelandet war: im Mare Crisium wie Soledad, nur zu einer anderen Zeit.
Hin und wieder hörte ich später durch Soledad von Ronnie und Sam, als sie einige Jahre, fast am Ende, in Kanada lebten, aber wiederkehrten zu ihrem großen kurzen Comeback. Und plötzlich waren sie verschwunden, verschwunden wie Höhlenmenschen, deren Höhle durch ein mittelschweres Erdbeben versiegelt wurde.
Eine Single, Dolphin Song, Soledad gewidmet, begleitete von nun an unseren gemeinsamen Weg.
Oh when I can say
you had crossed the sea,
you are really free ...
Es war ein Aufstand der Jugend der Welt. Nichts auf dem blauen Planeten, der von ihren Liedern widerhallte, gab es, was sie nichts anging, allen Outlaws wussten sie sich Milchbruder oder -schwester. Die Napalm-verbrannten Kinder Vietnams waren ihre Kinder, das Schiff Cap Anamur fuhr unter ihrer Flagge. Und eben darin erwies sich der „von Sternen gewollte“ Wandel am nachhaltigsten, dass er auch in den Jahren, die mit den Suiziden von Stammheim ihren Mitternachtspunkt erreichten, nicht mit starb. Die – unsichtbare – Staffel verlor ihre Fackel nicht: Über Nacht konnten hunderttausend Händepaare sich zusammenschließen. Jederzeit, aus der Tiefe der Zeit, „konnten Kräfte in Erscheinung treten, die alle Ordnung umgestalten, um uns von den knechtenden Mächten zu befreien.“
Aber die von Studentenschaften vieler Hochschulen ausgehende Provokation, ihr doktrinäres Gehabe, zog am Ende nur Gräben verschiedener Breite und Unversöhnlichkeit durch eine Nation. Man wollte eine „fleischfressende Pflanze“ in eine honigspendende Blume verwandeln? Stattdessen machte Protest aus Faule-Eier-Werfern Bombenbastler oder versandete in Resignation. Die Droge nahm ihren Siegeslauf.
Underground-Blätter gaben zuweilen die Parolen aus für sich fanatisierende Gruppen und verschwanden mit diesen. Was zunächst noch so frenetisch tönte: „Der Orgasmus der Revolution ist antizipierbar!“, das lautete wenig später bei demselben Revoluzzer – klammheimlich natürlich: „Füttere deinen Affen, aber lass mich in Ruh.“
Vermahlen und verstreut vom Mahlstrom ihres Jahrhunderts, sei’s in Anarchie, sei’s in Sekten, sei’s im sogenannten Gang durch die Institutionen: so bald ernüchtert, so bald schon selber „Institution“. –
Stammheim-Schläfer. Ein letzter Song auf einem ihrer Plattenspieler: „Live don’t seem worth living ...“ Ein französischer Journalist schrieb von einer Nibelungentragödie. Sie töteten sich selbst, nachdem beide Versuche, sie freizupressen, gescheitert waren: Entführung eines Mannes der Öffentlichkeit und die eines Flugzeugs mit Hilfe arabischer Freunde, in Mogadischu gestellt.
Das ganze Land war über viele Monate in eine Atmosphäre getaucht, schneidender als Novembernebel. Aufgestanden war das Gespenst eines Volkes, dessen Geschichte wie kein anderes von Verrat und Selbstverrat gezeichnet ist. Und so wie Friedrich Hebbel 1848 „bis in den von Bären bevölkerten deutschen Urwald blickte (und ihn zu seinem Nibelungen-Drama inspirieren sollte), so blickte man in ein „Deutschland im Herbst“. –
Nach diesem Herbst, und nach einem Heimataufenthalt Soledads am Guadalquivir, machten wir uns auf die Suche nach den so rätselhaft im Vorjahr Verschollenen. Ich hatte ein Motorrad geleast, ein etwas geräumigeres Zelt mit Schlafsäcken auf einem Düsseldorfer Flohmarkt erstanden. Unbehelmt (Helme waren damals noch nicht pflichtig) klapperten wir nun dasselbe Land zwischen Maas und Erft, wie zuvor ich allein, ab. Wir wechselten die Campingplätze wie später die unmöblierten Zimmer. In keiner Amtsstube und in keiner Dorfschenke erfuhren wir irgendetwas, das Sinn machte, über ihr Verschwinden. Ein pensionierter Postbeamter an einer Theke Kalterherbergs schüttelte nicht als letzter den Kopf:
„Wenn die nu mal keine Sympathisanten gewesen sind, wen kümmern die noch! Zwei Musiker aus Kanada, du lieber Gott.“ –
Nebel und Graupelschauer tagegelang. An unserm letzten Zeltabend sagte Soledad – und bei ihrem vorletzten Joint:
„Basta! Die zwei sind längst über den großen Teich.“
„Meinst du? Wenn deine Delphine bloß keine Lemminge gewesen sind! Lass doch den Joint, Soli, Liebes, pennen wir.“
„Bitte, erst noch mein kleiner Joint. Dann amor...“ –
Soledad verließ endgültig Deutschland, als ich, in ihre Heimat ihr zu folgen, mich nicht entschließen konnte. Stand aber wenig später im Hegau, im tiefsten Nebelland, vor einem Bildstock und las dem halb verwitterten Stein einen uralten Wallfahrerspruch ab. Und kam mir endlich selbst als so ein Pilger auf dem langen Weg nach Santiago de Compostela vor, und zum Meer von Cabo de Finisterre.
Nachmittags zogen übers Hegau die Gewitter. Der Polizist auf Urlaub – Bernd Kuzevow, Berliner Streife – hatte alle vom Naturfreundehaus eingeladen, die Höhle des Urmenschen zu besuchen. Die Jugendgruppe aus Charlottenburg war mehr auf Schaffhausens Discos eingestimmt (man fand das einfach uriger), und gut die Hälfte von ihr verlor sich schon zwischen Rheinfall und City. Vor Rayingen gab es Aufenthalt und Umleitungen, und wieder war einer verschwunden.
„Das geht hier zu wie mit den zehn nackten Negerlein“, lachte Wachtmeister Kuzevow, seinen Kleinbus vergnügt über eine immer holprigere Straße steuernd. Da waren es nur noch wir drei: der Fahrer, seine kleine Freundin und ich. Und als wir endlich zwischen Riesenpfützen im Schatten alter Ulmen parkten, passierte es mir dann.
Ich war etwas hinter den beiden zurückgeblieben, hatte mich zum Pinkeln ans Gebüsch gestellt. Eine eigentümlich gespannte Ruhe herrschte – wie vor Gewittern, anstatt danach wie jetzt. Kein Vogellaut ließ sich vernehmen, kein Windhauch regte einen Wipfel. Und da, wieder auf dem Pfad, aber noch einmal innehaltend, um einen Schuhriemen fester zu binden, sah ich aufblickend ihn.
Er stand zwischen zwei Weißdornbüschen, ein deutlich unter mittelgroßer, doch außerordentlich kräftiger Mann, gekleidet in etwas wie Bärenfell. Das breite Gesicht schuppig ziegelrot, die Stirn mächtig mit seltsamen Höckern. Tiefschwarzes dichtes Haar sträubte sich nach allen Seiten wie dunkle Flammenzungen: Seine Augen, klein und tiefliegend, rollten wild in einem tragischen Antlitz. Der Mann schien mit verzweifelten Blicken den Himmel über uns abzusuchen, nahm nur ganz flüchtig, wenn auch beharrlich wiederkehrend, Kenntnis von mir, der ich kaum fünf Meter vor ihm stand. Noch halb gebückt, stand ich gebannt – und dennoch furchtlos! Denn ich wusste (und erinnerte): eine solche Trauer, in welcher ich nur einmal, das war in T, einen Menschen angetroffen, lässt einen nicht um sich selbst fürchten.
Plötzlich war er weggetaucht. Man rief mich, Bernd Kuzevow, unser Führer zum Kessler Loch, winkte: „Wir sind gleich da!“
Benommen, stolpernd, müde wie nach kilometerlangem Marsch, machte ich mich auf ihre Spur. –
Am Hohentwiel, wieder im Naturfreundehaus, erreichte mich die Nachricht von meines Vaters schwerer Krankheit. Isgard, die mir schrieb:
„Schlafend fanden sie ihn, als Frank mit seiner Tochter ihn besuchen wollte. Schlafend brachte man ihn ins Krankenhaus. Ob er noch einmal aufwacht? Die Ärzte halten es für möglich ...“
Zu Fuß allein in der beginnenden Nacht, bergan geht meine Straße. Vor mir der Asphalt der Chaussee voller Schlaglöcher, Regenlachen so blank, dass ich sie bis zur Kammhöhe zählen kann. Von oben ein Wagen: langsam, schwankend und ohne Scheinwerfer kommt er zehn Schritte vor mir in einer Pfütze zum Stehen. Zögernd nähere ich mich, gewahre das linke Vorderrad schief zur Achse, die Kotstange dieses Oldsmobiles abgerissen wie nach einer Karambolage, auch Beulen genug, aber hinterm Lenkrad niemanden. Bloß auf dem Rücksitz etwas Geducktes, Zusammengekauertes ... Mein Schreck lässt mich kaum richtig hinsehen – gleich mach ich, dass ich weiterkomme. Kannte ich nicht das alte Männchen?
Völlige Finsternis ist hereingebrochen – alle meine Sinne nun gespannt auf die Haltestelle der Straßenbahn, die hier unbedingt folgen muss, sobald das Trottoire beginnt. Die Linie Neun fuhr hier stets noch bis Mitternacht. Und indem ich nichts mehr erkennen kann, außer Schatten von Gärten und Häusern mit wenig Licht, weiß ich erst wirklich, wo ich bin.
III Das Erbe
Das Geländer war verschwunden und die Basalttreppe, die zur Haustür steigt, nicht mehr gleich in ihren Stufen. In Flur und Diele sah es aber noch recht ordentlich aus. Nur die Treppe hinauf zur Wohnung wieder so demoliert: weggebrochen zum Teil die Holzsäulchen des einst schönen Geländers und von der Tapete nur noch Fetzen.
Im mittleren Wohnzimmer treffe ich einen, auf den ich gefasst und nicht gefasst war. In dunkelblauem Gabardine über seinem Pyjama, liegt er halb in einem der tiefen Polster, leise klagend auf diese eigensinnige, ein ganzes langes Leben hindurch bewährte Weise.
Ob er mich erkannt hat? Ich zweifle, gebranntes Kind, fühle nur eine traurige Scheu, Vater zu sagen und rufe, wie Mutter und Stiefbruder ihn zu rufen pflegten: „Na, Jacques, geht es schon wieder besser?“ Meinen Satz aber begleitet wie eine Orgelfuge nur der eine Gedanke: Was magst du wieder im Schilde führen?
Hier einen weiteren Zeugen seines Elends zu finden, belebt seine Züge unübersehbar. „Weißt du, weißt du …“ Sätze folgen, die ich in keinen Zusammenhang bringen und weniges nur deshalb verstehen kann, weil ich es von niemand sonst je gehört habe. Auch werde ich von dem Paar abgelenkt, das vom Bücherschrank her mich mit dezenter Neugier betrachtet: eine Dame, o ganz Dame! und ein jüngerer Mann mit Schnauzbart.
„Kalterherberg – weißt du, Ezra, mein amerikanischer Freund, da gab es die richtigen Hirschbutterbrote … Hubert und Karl, auch Isgard, die Muhme war mit, weißt du, weißt du …“
Die Dame tritt jetzt mit einem Kopfnicken näher, um auf dem Rundtisch vor Jacques unter allerlei Fläschchen und ärztlichem Besteck etwas Ordnung zu schaffen. Der junge Mann stellt nach einem ähnlichen Kopfnicken, das wie abgeschaut wirkt, ein Buch in den Schrank zurück und schiebt die Glastüre vor. Ich nicke wortlos ebenfalls, ein gewissermaßen von beiden übernommenes Kopfnicken.
Jacques in unsrer Mitte – er scheint halb erblindet, zumindest bleibt sein rechtes Auge wie von einer Lähmung geschlossen. Wie peinvoll der heillose Zustand meines Vaters mich auch trifft, ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen. An die Dame gewandt, die ich als Ärztin ansehe, lege ich Lässigkeit in meine Frage:
„Ja was hat er denn, Frau Doktor?“
Frau Doktor schaut mich an, als hätte sie von mir eine so törichte Frage nicht erwartet. Ein dunkles Augenpaar, prüfend ein ernster Blick … Dann, nach einer wohldosierten Weile, die es erst auszukosten gilt, gestattet sie sich ebenfalls eine Frage. Warum, seit jener verblichen (sagte sie „verblichen“? Verwirrend ihre französische Aussprache), hier nicht mehr gesäubert worden sei. „Und fasset beide einmal an, ich möchte ihn doch lieber in der Küche versorgen.“
„Wassenberg ... In mare veritas, weißt du ... Heiliges Lourdeswasser!“ Der wirft ja alles durcheinander.
Nun aber überrascht, wie kinderleicht der Greis in unsern Armen liegt – nur so ein Jüngelchen! Die Ärztin, Beruhigendes murmelnd, findet sogar Zeit (dabei fällt mir Jacques listig zwinkerndes linkes Auge auf), ihm zärtlich über die Glatze zu streichen.
Da poltert jemand auf eine Weise die Treppe hoch, die mir bekannt vorkommt. Und so ist es: Onkel Karl, Vaters jüngster Bruder, immerhin ein vertrautes Gesicht.
„Ha, ihr Leute – bin ich richtig zum großen Schmausen? Fisch gibt’s, Scholle auf Schorle, was wünscht man mehr.“
Der alte Poltergeist! Sein Frauchen gluckst uns aus der Küche entgegen: Tante Kathrin ist also die Köchin dieses Nachtmahls, meinen Appetit regt das nicht unbedingt an. Was haben die beiden wohl ausgeheckt? Pass auf, Holger, die hauen dich in die Pfanne, als wärst du der Fisch.
Kathrin, kinderlos – nicht Karl –, so schmal wie er gewichtig, mit einer mädchenhaft hellen Stimme, die erst vom Tag ihrer Silbernen Hochzeit an etwas Krächzenhaftes hinzugewonnen haben muss. Von ihrer völlig unauffälligen Brust hatte Vater Jacques einmal behauptet, sie wäre ein Brett, in das man zwei Dachnägel geschlagen hat.
„Lecker, lecker …“ Wo Onkel Karl sich niederlässt, da geht es stets zur Sache. Selbst unser Held strahlt und wirkt auf einmal fast seinem Gewicht entsprechend verjüngt. Zwischen ihm und seinem dicken Bruder finde ich am großen Küchentisch eben noch ein Plätzchen. Die giftgrüne Kapsel nimmt Jacques mit Lust von Damenhand zwischen seine dünnen Lippen, schluckt sie mit Schorle, die ich ihm reichen darf. Der Südfranzose entwickelt einen ähnlich bemerkenswerten Appetit wie Karl, indes seine Chefin nur leicht an ihrem Glase nippt, ein Stückchen Fisch probiert.
Es wird lebhaft, da Onkel Karl Gelegenheit findet, sich über die gesammelten Vorzüge des Hauses und der Praxis parterre auszulassen. Und scheint es zunächst nur die Komödie zur Täuschung eines sogenannten Verblichenen (oder vielleicht noch mehr seines Sohnes?), so nimmt gutes Einvernehmen über einen notwendigen Wandel mit jedem Schluck und Bissen zu. Dass aber Jacques noch zum Spielverderber werden könnte – aber nein: schon wie er ohne meine Hilfe seinen Becher in die Hände nimmt! Zwar verschüttet er die Hälfte über das Wachstuch des halben Tisches, doch lächelt er dabei so nett entschuldigend, dass jeder es sofort verstanden hat: Er wollte uns doch nur zeigen, wie gut er sich schon allein zu helfen weiß.
Abgeräumt ist der Tisch, nur Becher und Pokale noch, dem Franzosen steht eine Flasche Beaujolais vor dem seinen. Die Ärztin hat ein Notizbuch neben ihrem Glas liegen, sie schaut gedankenverloren, diesem ihr sicher obskuren Ort um einiges entrückt. Kostbares (ich schätze Granate) vollendet als Ohrgehänge ein edles Haupt.
Onkel Karl versucht sich im Französischen. Sein „à votre santé!“ tönt zwar mehr wie Altfränkisch, hingegen sein „Fisch muss schwimmen!“ (wenn auch nur in Schorle, wegen seiner weichen Leber), das kommt so fröhlich heraus, als wäre Apfelschorle noch das gute alte Hochprozentige.
Die fremde Dame (würde doch ihr Name endlich fallen!) schlägt ihr Notizbuch auf, murmelt ein paar Zahlen, darauf einen Namen, der allen vertraut ist: „Johannes Hinrich“. Ihr goldener Federhalter verzeichnet ihn erkennbar. Für den Franzosen ein Signal:
„Isch war doort. Abber, noch nicht im Haus. ÜÜrlaub – sagte die Tochter. A la côte Dalmatie, ils partent mercredi.“
Man weiß, der Architekt und Klubfreund meines Vaters. Verdanke ich ihm nicht meine Notgeburt, die hochschwangere Elsa aus einem brennenden Auto rettend auf dem Weg zum Hospital? Johannes Hinrich schien immer genau dann zur Stelle, wenn es bei uns brannte oder gebrannt hatte. Und es brannte hin und wieder. Auch das seltsame Zwischengeschoss war sein Werk – nach einer Brandbombe, die das Haus im Weltkrieg traf. Hinrich würde auch jetzt Rat wissen und dieses ruinöse Anwesen für den Richtigen in eine schmucke Villa zurückverwandeln. Was jedoch meine Anwesenheit so notwendig erscheinen ließ, während Bruder Frank keine Probleme hatte fernzubleiben – eine Antwort auf diese nur gedachte Frage kommt postwendend von der Spüle, von Onkel Karls besserer Rippe. Als könnte sie Gedanken lesen!
„Die Schlüsselchen, Holger. Was hat sich dein Väterchen bloß dabei gedacht! Frank war doch auch noch da.“
Ja, Frank, naturalisierter Amerikaner, hatte Lohnenswerteres im Fadenkreuz als diese Bruchbude. Dass ausgerechnet dem unmöglichen Neffen hier die Schlüssel anvertraut waren, das bekümmert Tante Kathrin wie eine Todsünde – so deute ich wenigstens die Querfalte ihrer Stirn. Und ergreife das Wort, spreche möglichst langsam, gebe gewissermaßen zu Protokoll, ausschließlich der Fremden zugewandt.
„Mein Vater, verehrte Dame, war ein Jäger vor dem Herrn. Alle Freunde seines Klubs – vor dem Herrn. Aber irgendetwas, zu Anfang des Krieges, eine außergewöhnliche Erfahrung, und zwar gemeinsam, müssen sie gehabt haben, diese gestandenen Männer, wohlsituierten Familienväter allemal.“
Onkel Karl blickt mich von der Seite an wie beleidigt. Jedoch der Beleidiger, wenn es denn einen gibt, der sitzt zu meiner Rechten. Eine Ruhe kehrt ein zwischen hochgekachelten Wänden, nur von der Feder in gepflegter Hand ein Geräusch – eine so schmale wie große Hand: eine ideale Klavierhand, denke ich. Entspannter fahre ich fort.
„Ich vermute natürlich auf einer ihrer Jagden, wahrscheinlich in den Ardennen. Frankreich war gerade besetzt bis zu den Pyrenäen, die Eingezogenen, darunter mein Vater, auf Urlaub mit französischen Flinten (vielleicht aus Loire- und anderen Schlössern requiriert nach altem Siegerbrauch) auf ihrer letzten gemeinsamen Jagd.
Der hier zu meiner Rechten hat niemals ein Sterbenswort darüber verlauten lassen, weder im Streit, noch im Wein, und Wein wusste er wie ein Gaskogner zu schätzen.“
Der Gaskogner schräg vor mir blickt jetzt etwas feurig. Doch davon unberührt bleibt meine Rede, Momente des Stockens überbrücke ich mit sparsamem Schlucken.
„Ich kann Ihnen daher, verehrte Dame, nicht viel mehr als gewisse Folgen benennen, dieses Haus betreffend, sowie, nach dem Urteil meiner Mutter, das auffällig veränderte Wesen meines Vaters.
Sie entdeckte eine niemals vermutete Frömmigkeit an ihrem Gatten. Der inzwischen nicht mehr notwendige Luftschutzkeller erlaubte etwas wie ein Zwischengeschoss einzuziehen. Johannes Hinrich, der Architekt, er ist der Bruder des Notars und Testamentsvollstrecker, hat dieses knappe, nur ein Kind aufrecht stehenlassende Gewölbe allerdings mit einer Panzertür versehen.“
Ohne meinen Blick schweifen zu lassen, spüre ich die Erregung meines Onkels. Tante Kathrin, an den Gasherd gelehnt, entfährt ein Seufzer, der beinah ein Schluchzer ist.
„Die – Schlüsselchen hat er mir zubestimmt. Ob auch den Inhalt der hauseigenen Höhle, das wird uns der Notar verraten. Oft und oft habe ich mit dem Alten diesen später sichten und ordnen dürfen – nun ja, und natürlich auf seine Funktionstüchtigkeit prüfen. Für einen Dreikäsehoch war’s jedes Mal eine Erleuchtung.“
Der Franzose schaut plötzlich finster drein, der Patriot wittert alte deutsche Schandtat.
„Mein Äärr! çasuffit. Weshalb Sie meinen, wir sind iiier? Eh bien: Sie haben Schlüssel, und diese Dame hat – wenig Zeit, n’est-ce-pas, Madame?“ Das letzte bringt er recht unsicher, fast bittend hervor. Und die Dame aufblickend, lächelt in die Runde und sagt so ruhig als hätte sie sehr viel Zeit, wobei sie ihre Augen zuletzt auf mir ruhen lässt:
„Lachen Sie bitte nicht, lieber Holguèr, oder – weinen Sie nicht (charmanter kann man nicht erschossen werden!), aber die Alleinerbin von jenem dort (und nach einem seltsam ernsten Blick, coupd’oeil auf Jacques), das bin ich.“
Onkel Karl stöhnt auf, Tante Kathrin wird unruhig wie eine Junghenne vor ihrem ersten Ei, und der Gaskogner ergreift seinen Pokal, glitzernd von Rotspon. Doch der Blick seiner Herrin lässt ihn den Pokal sogleich wieder absetzen.
„Eine solche Ruine, mon cher Claude, wie aus einem chinesischen Film – glauben Sie, das wäre etwas zum Anstoßen?“
„Pardonnez-moi, mais seulement … Vous entendez …“
„Hélas! Es wird wahrhaftig Zeit. Es wandelt bereits auf Mitternacht zu, und der morgige Tag – man erwartet erneut Orkane von Frankreich.“ Nun wieder an mich gewandt, sehr heiter, indes sie ihr Notizbuch zuklappt: „Den ersten Termin hat Holguèr versäumt, wird er diesmal erscheinen?“
„Aber ja“, rufe ich erschrocken, „morgen früh, halber neun … Werd’s nicht verschwitzen!“
Jetzt aber bäumt sich Onkel Karl auf. „Also, Bursche!“ Seine Pranke landet auf meiner Linken so kraftvoll, dass ich ein „Aua!“ nicht unterdrücken kann. Er hält sie fest, sein Speichel sprüht Kaskaden über das Wachstuch und erreicht sogar das Notizbuch der Erbin, das zum Glück geschlossen liegt.
„Was – is – drin!“
Über seinen feuchten Ausfall selbst erschrocken, fügt er mit einem komischen Schwanken in der Stimme auf Altfränkisch hinzu:
„Grannt Exüsses, Madame Labalöh! Mäh – sett gamenn là …”
Da aber kommt – kaum vernehmbar, nur zu hören wegen der plötzlichen Stille, und weil er es noch zweimal wiederholt, kommt von Jacques:
„Alle geweiht …“
Und Onkel Karl explodiert:
„Was? Was quatscht der da? Doch nicht Kerzen – einfach Kerzen?! ... Himmelkreuzdonnerwetter! Kerzen! ... Dieser Idiot.“
Und Jacques noch einmal – leiser noch, sich von uns immer weiter entfernend, schon jenseits schier:
„Alle geweiht.“
Kaum waren sie aus dem Haus, kam Sturm auf. Hinter immer dichteren Wolkenpacken verzog sich der Vollmond, frei gab er die Bahn dem angekündigten Orkan. Stärke neun sei nur der Beginn, hatte Doktor Labalue noch gesagt: Mit Stärken über zwölf und der Gewalt von Hurrikans würden selbst die Deiche der Niederlande keine Sicherheit mehr bedeuten. Sie hatte es lächelnd, ja in einem Ton gesagt, dem etwas Verheißungsvolles mitzuschwingen schien. „Im Übrigen, liegt dieses Holland nicht seit Charlemagne unter Normalnull?“
Der Morgen danach (oder war es der nächste? Gar der übernächste?) so ruhig, wie von einem Frieden, den „himmlisch“ zu nennen das äußere Chaos allerdings verbot. Nun lockte es die Menschen, sofern sie nicht Orkangeschädigte waren, in Scharen auf die Straße. Die Schwalmener Allee war zum Flussbett verwandelt. Führerlos treibende Autos, schwimmende Koffer und Kisten, sowie Plastik in jeder Form und Farbe sah man treiben in brauner Flut. Die hangwärts erhöhten Fußwege waren aber frei und von Spaziergängern und Radfahrern belebt. Eine Neugier, die kaum noch von einer viele Stunden durchlebten Panik zu wissen schien, fast eine Feiertagsstimmung hatte sich verbreitet. Ich selbst stand ja auch hier, fasziniert von dem über Nacht entstandenen Strom durch die Stadt. Meinen Termin bei Notar Hinrich habe ich natürlich nicht einhalten können. Die beiden Schlüssel werde ich seinem Bruder übergeben, den zu besuchen mir jetzt umso notwendiger scheint. Autos blieben bereits liegen, sperrige Teile wurden immer seltener, nur Zeitungspacken nahmen aus unerklärbaren Gründen zu. Und immer ausgelassener das Geklingel der Radfahrer – schulfrei fröhliches Geklingel! ... Nur dieses kleine Mädchen dort an der Hand seiner Großmutter, was macht es für ein bekümmertes Gesicht! An einen Alleebaum gelehnt, höre ich die Kleine, mit furchtsamem Blick auf den strudelnden Strom, wieder und wieder die Frage stellen: „Nicht wahr, Omi, nur alte Leute sterben?“
Omi, im langsamem Vorüberschreiten mit gleicher Bedachtsamkeit Mal um Mal: „Ja, Röschen, nur alte Leute sterben.“
Telefonzelle, Münzengeklapper, doch nicht eine meiner Zahl-und-Adler will der Apparat annehmen.
Unterwegs in die nördliche Villenvorstadt, hätte ich mich gern beim Architekten angemeldet, schleppe ich doch zwei Ölgemälde für den Verehrten mit mir. Am Bahnhof flattern Tauben vor drei bärtigen Gestalten auf, denen das Unwetter zu einer sagenhaften Beute verholfen hat. Bierflaschen in Kästen füllen hochgestapelt die Nischen zu beiden Seiten des Hauptportals. Es am Bahnhof an einem anderen Apparat zu versuchen, wäre der nächste Weg, aber die Kumpels gucken so bös gespannt, dass ich wieder und wieder meine Münzen einwerfe.
Meine Gemälde, Erbstücke, die ich nirgends zu lassen, wahrhaft nur zu schenken wüsste, und Johannes Hinrich, dieser unerschütterliche Freund der Familie … Nanu! eine Stimme aus der Muschel.
Hinrichs Nummer habe ich doch noch gar nicht wählen können?
„Roger, Roger –“ mehr kann ich bei dem starken Rauschen nicht verstehen, wurde vielleicht auch nicht gesprochen. Es knackte, und die Stimme war wieder weg. Wie die eines Bordfunkers aus dem Weltall, so hörte sich der Sprecher an. Nun tippe ich die Nummer einfach in die Box – und:
„Bei Hinrich“, eine Mädchenstimme. Ich nenne meinen Namen. „Einen Augenblick, ich rufe meinen Onkel.“ Ich atme auf.
Nach Hinrichs herzlicher Einladung wieder auf dem Weg, hätte ich, wäre ich mit den Bildern nicht beschwert, singen können, so sonnig sonntäglich fühle ich mich auf der blank gewaschenen Straße.
Der Orkan hat unendlich viel Überflüssiges an Papier, Blech und Plastik aus der Stadt gespült. Eine sonderbare Genugtuung beflügelt zwar nicht meinen Schritt, denn es geht bergan, aber die Amseln sind wieder da! Sie hüpfen über die Rasen der Vorgärten, spazieren ohne Scheu über die Straße, auch für mich kann es jetzt nur noch ein Amselsprung sein! Da rutschen, um einem Häufchen Hundekot auszuweichen, mir meine Kostbarkeiten zu Boden. Entsetzt fasse ich nach, wenigstens nicht in die Scheiße! Ein Schwarzvogel schießt mit höhnischem Geklacke über meinen Kopf hinweg, nahebei in einem Fenster bewegt sich eine Gardine.
Wenn ich jetzt nur die Hausnummer erinnerte! Eure Dreizehn war’s jedenfalls nicht, ihr Leute, da könnt ihr euch ruhig die Augen wischen.
Nachdem ich aber „Fischerboote am Morgen“ und „Burg Nideggen am Abend“ wieder unter Kontrolle habe, fällt mir die Hinrichsche Nummer ein. Ich brauche nur die Straße zu überqueren, eine wer weiß wie lange schon winkende Hand. Nummer vierzehn … So freundlich, so leise, niemand kennt sie anders: Herr Hinrich, Frau Hinrich.
„Holger, Holger, was sollen wir dazu sagen.“
„B-Bitte nicht, Sie verstehen …“
„Hm??“
Nun sitzen wir unter alten Pergolen in Hinrichs Garten. „Alles sieht noch schrecklich zerzaust aus“, lächelt Yvonne Hinrich, „aber wir haben Glück gehabt. Von fast allen meinen Rosen sind Knospen geblieben.“
„Sie ist eine Expertin, meine Frau.“ Mit diesem Satz nimmt Johannes Hinrich in seinem Korbsessel Platz, im Flur schlägt eine Standuhr dreimal. „Ich nehme einen Mocca, Yvonne – und Sie, Holger?“
„O einfach“, und nach der weißgetünchten Ziegelmauer blickend. „Blüht es da nicht?“
„Ja“, sagt Yvonne Hinrich, „das sind meine Unermüdlichen! Gloria Dei ist ihr Name, seit vierzig Jahren hält sie uns die Treue. Und dabei zählten wir zu den allerfrühsten Besitzern dieser prächtigen Rose.“
„Obwohl sie damals schon vier Namen, offiziell, hatte“, ergänzt der Architekt, während Susanne, die Nichte, erwartungsvoll die Augen auf ihre Großtante richtet.
„Ihre Heimat ist eigentlich Frankreich. Anfang des Krieges, nachdem die Deutschen das Land meiner Ahnen besetzt hatten – und Hans war ja Soldat, Besatzungssoldat …“
„Zu jeder Reparation bereit, wenn er dich schon gekannt hätte.“
Sie lacht, diese zu Jahren gekommene Schönheit hugenottischer Vorfahren, und erzählt folgende Geschichte:
„Ein Gartenkünstler namens Antoine Meilland war es, der diese gelbe Rose gezüchtet hatte. Sie wurde sein goldener Wurf, mit allen Eigenschaften einer lebenskräftigen, reich gefüllten und zugleich anspruchslosen Buschrose. Er widmete sie zunächst seiner Mutter, doch ihren Namen erhielt sie im Gedenken an seine früh verstorbene Frau: Madame Antoine Meilland.
Noch im Kriege, auf welchen Wegen immer, gelangten Sämlinge seiner Züchtung nach Italien (Sohn Francis hatte eine Tochter des italienischen Floristen Paolino geheiratet), nach Deutschland und, über England, sogar nach Amerika. Der Krieg aber ließ unter den Floristen eine Verbindung kaum mehr zu, so dass am Ende des Weltkriegs es drei weitere verbriefte Namen für dieselbe Rose gab. In Italien hieß sie ‚Goia‘, also ‚Freude‘, in Amerika ‚Peace‘, und in Deutschland ‚Gloria Dei‘.“
Yvonne: „Hans hat sie als Gloria Dei in Stuttgart kennengelernt, als er dort sein Studium wieder aufnahm und nebenher in einer Rosenschule seinen Unterhalt verbesserte.“
„Und im Topf trug ich sie von Stuttgart nach Krefeld, als es galt, eine schöne Krefelderin zu freien.“
Endlich bot sich mir die Gelegenheit für eine Frage, die mich seit dem Nachtmahl bei Scholle und Schorle bewegt, ich blickte prüfend auf Hans.
„Herr Hinrich, diese Madame – Labalöh, nicht? ...“
Der Architekt, der meine nicht einmal ausformulierte Frage längst erwartet zu haben schien, zeigte sich verlegen. Mit einer gewissen Umständlichkeit brachte der sonst so Gewandte nicht mehr als Andeutungen hervor. Auch verstand ich bald, dass hier mindestens noch einer zu schonen war.
„Sie wissen, die Leys stammen aus den Ardennen, alte Grenzland-Sassen, kann man sagen … Machst du mir noch einen Mocca, Yvonne? Und die – Labalue, mein Gott, da wäre wahrscheinlich nur mein Vater, der erste Notar, für Sie die richtige Auskunftei gewesen. Schon der Erste Weltkrieg hat ein solches, wie soll ich sagen, Durcheinander geschaffen …“ Erstaunt werfe ich ein: „Wir sind verwandt?“
„Danke, meine Liebe. Es ist noch etwas früh, um sozusagen frei von der Leber – aber haben Sie Geduld, es wird sich alles rundum aufklären ... Ist was, Yvonne?“
„Vor deinem dritten Mocca rufe ich deinen Arzt, Hans.“
Ein Weilchen schwenkt er die Tasse mit einem schelmischen Augenaufschlag, „und ich unseren Notar“, dann fährt er fort:
„Mein lieber Freund. Es ist, wie gesagt, noch etwas früh. Mein Vater sprach nie gern von der Sache, und zu seinen Söhnen nur mit einem ausgesprochenen Schweigeverbot. Natürlich, Christoph, sein Nachfolger, kennt die Geschichte aus dem Effeff. Er ist ja jetzt noch eingeschaltet, und der Schriftverkehr mit Belgien hört so schnell nicht auf. Denken sie an das Vertrauensverhältnis, in das Notare unter Umständen gezogen werden, mit Arzt oder Priester lässt sich das durchaus vergleichen. Und dass über das Ableben unseres Freundes hinaus – und bitte verstehen Sie, nicht nur für Christoph, sondern auch für mich Verpflichtungen geblieben sind, vermuten Sie mit Recht.“
Yvonne Hinrich unterbricht ihn erneut, und ich frage mich, ob sie es nicht in der Absicht tut, um – mein Vater würde sagen, ihrem Hans aus der Bredouille zu helfen.
„Ingried müsste längst vorgefahren sein, ich dachte schon eben bei dem Hupen, dass sie’s wäre ... Ach ja, Holger, Sie fahren doch mit?“
Johannes Hinrich erhebt sich mit sichtbarer Erleichterung, er hat nicht einmal seinen Mocca angerührt:
„Wir gebrechlichen Alten bleiben natürlich am Ort. Aber Susanne – wo steckt denn das Mädchen wieder!“
„Ich auch, Onkel Hans, ich muss doch auf den Kleinen aufpassen“, tönt es vom Vestibül her mit heller Stimme, und ganz kurz zeigt sich ihr sommersprossiges Köpfchen im Türrahmen. Elf Jahre, verspätetes Schwesterkind, fast von Geburt an Waise.
„Meinst du wirklich?“ Johannes zieht ein zweifelhaftes Gesicht, dessen Schalk niemand übersehen kann. Als sein Blick wieder auf mein fragendes Selbst fällt, erläutert er schmunzelnd:
„Der Kleine gehört immer dazu, der lässt sich keine Bootsfahrt entgehn – auf dem Hariksee. Aber Sie, Holger, waren da auch nicht anders.“
Nun bin ehrlich verblüfft: „Auf dem Hariksee kann man wieder Boot fahren?“ Ungläubig lange ich nach meiner Tasse, empfinde dabei selbst etwas Ungehöriges, als einziger noch an seinem Sitz zu kleben.
Doch während Yvonne Hinrich sich an den Rosenranken der Pergola zu schaffen macht, befiehlt ihr Mann, halb im Weggehn, mit seinem fröhlichsten Bariton:
„Schütt ihm nach, Susanne, sein Kaffee ist kalt. Und sobald es hupt, ab mit euch! ... Und ich überlege, wo wir die beiden wunderschönen Geschenke unseres Freundes platzieren könnten.“
Er bewegt sich gemächlich auf die offene Schiebetür links zu, murmelt etwas, das wie ein Spruch klingt (so viel verstehe ich, er handelt von Tier und Mensch) und wendet sich noch einmal um und blickt, eine gebeugte hohe Gestalt von fünfundsiebzig Jahren, mit ungemildertem Ernst auf mich, der noch einsam am Gartentisch hockt.
„Wissen Sie, dieses Erbe, das Ihnen da entgeht, ihr Vaterhaus, in Wahrheit handelt es sich um eine Wiedergutmachung.“ Darauf, mit einem wie bedenklichen Zögern, ein Kopfschütteln andeutend: „Und die beiden Schlüssel der Panzertür wurden einfach verwechselt?“
„Es ist mir sehr peinlich. Ich war in einem Haus in Baden am Kaiserstuhl, man nennt das eine Bildungsstätte. Plötzlich brach ein Brand aus im Kaminsaal. Kinder und Frauen fanden durch Rauch und Trümmer nicht zum Ausgang, ich versuchte mit andern zu retten was zu retten war. Eine junge Dame, bereits brandverletzt, konnte ich heraustragen, meinen Rock hatte ich über sie geworfen. Und mit diesem Rock wurde sie vom Notfallwagen ins Freiburger Krankenhaus verbracht. Die Verwechslung mit zwei anderen Schlüsseln, fast identischen, musste geschehen sein, bevor ich am übernächsten Tag meinen Rock wiedererhielt. Die junge Frau ist Stewardess … Magaloun Angelov.“
Susanne nähert sich vom Serviertischchen mit der Kaffeekanne, ich murmele „danke, Susanne, keinen Schluck mehr“, und lasse meine Augen, vorbei an Frau Hinrich, über ihren so arg zerzausten Garten schweifen.
Auf einmal fesselt mich etwas, das sich auf dem Hügel zwischen zwei Rhododendren oder Azaleen abspielt, unmittelbar vor einer dort naturbelassenen Sandsteinmauer. Als brannte es da! Im selben Moment ertönt ein Hupen, ein Hornsignal von der Straße. Yvonne, die meinem Blick gefolgt war, verlässt ihre Ranken und tritt zu mir an den Tisch. Ein nahezu andächtiger Ton in ihrer Stimme:
„Das ist der Diptam. Er übersteht alle Stürme. Zuweilen entflammt sein Duft, wenn die Sonne lange genug auf ihn geschienen hat. Sehen Sie? Der Diptam …“
Die Fahrt aus der Stadt an diesem Sonntag, ganz wie es Johannes Hinrich versprochen, ging durch ein reingewaschenes Land zu den Seen des Grenzlandes. Die Bewohner abgelegener Güter, die vermutlich sämtlich evakuiert worden waren, schienen alle wieder ihre wohl noch recht feuchten Häuser bezogen zu haben. Weiden und Äcker erinnerten jetzt über weite Strecken stark an Marschen. Eine vorzeiten aufgegebene Air Base der britischen Luftwaffe hätte man sich durchaus als Geest in Nordfriesland denken können. Und was vor vielen Generationen hier einmal Heide war, das könnte … Doch nein, alte deutsche Gründlichkeit würde schnell ein ordentliches Landschaftsbild wiederherstellen. Müll, der noch wie Streifen Tang und Strandgut überall zu sehen war, würde in die passenden Container verschwinden und die teils villenartigen Orte bald wieder so schmuck wie in Holland anzuschauen sein. Wie sich allerdings das augenblickliche Holland „in seiner Not“ ausnahm, das konnte wahrscheinlich nur einen Holländer nicht entmutigen.
Nur einmal wurden wir um ein Dorf herumgeleitet wegen der Sommerkirmes mit einem Riesenrad über allen Dächern, höher als der Kirchturm. Susanne, neben mir mit dem Kleinen auf dem Schoß, entlockte es die Frage: „Warum halten wir hier nicht, Tante Ingried?“ Um gleich darauf fortzufahren, weil Tante Ingried zu antworten zögert: „Ach, am Hariksee ist es doch viel schöner.“
Und so sind wir angekommen am See, haben den Wagen abgestellt zwischen Pfützen, die ohne Stiefel nicht angenehm zu durchwaten wären. –
Auf dem See: Außer uns im entliehenen Ruderboot nur ein paar Paddler, sonst schöne Stille, belebte Stille rings – Wellengeplätscher, vereinzelte Vogellaute.
Die Nachmittagssonne wirft zwischen weißen Wölkchen goldene Strahlen und wärmt noch durch Rock und Mantel. Eben war ich der Ruderer, vorüber jenem schilfumwachsenen Inselchen, das einer traumverlorenen Kindheit Schatzinsel gewesen war. Nun halte ich Hinrichs zweijährigen Enkel im Arm, den mir seine junge Mutter anvertraute, um selbst eine Weile zu rudern, „bis zu der Brücke da!“ Susanne im Heck lächelt mit geschlossenen Augen in den weißblauen Himmel, während sie die Fingerspitzen beider Hände durchs Wasser gleiten lässt.
Hier der Kleine scheint mir ein äußerst aufgeweckter Knabe! Seine Händchen spielen so flink an meinem Kinn, als wüsste er bereits Klavier zu spielen. Und so eigentümlich sprechend sein Mienenspiel, etwas überaus Bewusstes darin, ich denke es schon befremdet und flüstre: „Du bist mir aber ein Heller.“ Da klatscht das Mädchen in die feuchten Hände und ruft begeistert: „Ach, das Jaköble!“
Ich aber habe meine liebe Mühe mit diesem Jaköble. Als es das Köpfchen einmal steuerbord wendet, bemerke ich seine linke Schläfe stark gerötet. Ist es verletzt, eine Entzündung? Doch dann lächelt man nicht so. Wem mag es ähneln? Auf meine Frage, an die rudernde Mutter gerichtet, antwortet indes nicht Ingried, sondern das Jaköble selbst in einem richtigen Doppelsatz und mit einer so klaren wie klingenden Stimme, dass ich an die Spieldose denke, worin meine Mutter ihre Patience-Karten aufzubewahren pflegte:
„Offen wie die Ebene ist das Tier, heimlich wie eine Höhle ist der Mensch!“
„Sehr verehrte Madame Labalue“,
so steht es in einem Brief, zusammen mit einer Bildpostkarte (ein Keil ziehender Horlegänse über dem Laacher See), zu lesen in Montmorency eine Woche später: