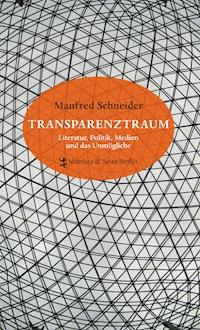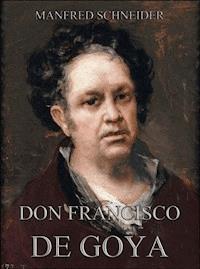
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Francisco José de Goya war ein spanischer Maler und Grafiker. In dieser Romanbiografie widmet sich Schneider dessen Leben unter Künstlern und Königen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Don Francisco de Goya - Ein Leben unter Künstlern und Königen
Manfred Schneider
Inhalt:
Don Francisco de Goya y Lucientes
Don Francisco de Goya - Ein Leben unter Künstlern und Königen
Vorspiel
1
2
3
4
5
Erster Teil. Die Herzogin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zweiter Teil. Dämonen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dritter Teil. Sieg
1
2
3
4
Don Francisco de Goya, Manfred Schneider
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849635503
www.jazzybee-verlag.de
Don Francisco de Goya y Lucientes
Span. Maler, geb. 30. März 1746 zu Fuente de Todes in Aragonien, gest. 16. April 1828 in Bordeaux, bildete sich auf der Akademie von Saragossa, ging dann nach Madrid und von da, durch abenteuerliche Streiche fortgetrieben, nach Rom. 1774 kehrte er nach Madrid zurück, wo er zuerst Kirchenbilder unter der Leitung und dem Einfluss des damals in Madrid anwesenden Mengs malte. In sein eigentliches Fahrwasser lenkte G. erst ein, als er farbige Kartons für die königliche Gobelinsmanufaktur ausführte, auf denen er lebhaft bewegte Szenen aus dem Volksleben darstellte (jetzt zum großen Teil im Pradomuseum in Madrid). Sie fanden durch ihre Naturwahrheit solchen Beifall, daß er eine ganze Menge von derartigen Genrebildern, allerdings in sehr flüchtiger und skizzenhafter, aber doch geistvoller Behandlung, schuf, die sich meist in spanischem Privatbesitz befinden. In seinen höchst lebensvollen Porträten (Reiterbildnis Karls IV. und Karl IV. und seine Familie im Museum zu Madrid, Donna Isabel Cobos de Poroel in der Nationalgalerie zu London) schloss er sich äußerlich an Velazquez an. 1795 wurde er Direktor der Akademie von San Fernando, 1799 erster Maler des Königs. Das letzte Jahrzehnt seines Lebens brachte G. in Bordeaux zu. Seine Geschicklichkeit in der Fresko- und Tempera-Malerei bekunden die Malereien in San Antonio de la Florida und in den beiden kleinen Kuppeln der Kirche Nuestra Sennora del Pilar in Saragossa. In seine letzten Jahre fallen die Werke: der heil. Joseph von Casalanz in der Kirche von San Antonio Abad in Madrid, eine heilige Familie für den Herzog von Noblejas, Santa Yusta und Santa Rufina in der Kathedralkirche von Sevilla, und ein Gemälde, in dem er sich selbst und den Arzt Arieta darstellte, wie dieser ihm eine Arznei reicht. Der Schwerpunkt seiner künstlerischen Bedeutung beruht jedoch in seinen Radierungen, die ebenso sehr durch geistvolle Technik wie durch lebendige Auffassung fesseln. In diesen Radierungen ist er ein bitterer Satiriker der politischen, kirchlichen und gesellschaftlichen Zustände seiner Zeit. Eine 1793–98 entstandene Sammlung ist unter dem Namen »Caprichos« (Einfälle) bekannt, eine andre trägt den Titel: »Los desastres de la guerra« (das Unglück des Krieges), eine dritte »Tauromaquia« (Stiergefechte). G., dessen Werke als Vorläufer des modernen Realismus erst in neuerer Zeit zur richtigen Würdigung gelangt sind, besaß eine bewundernswerte Geschicklichkeit, mit wenigen Pinselstrichen ein Individuum auf das treffendste zu charakterisieren; aber durch zu sichtbar hervortretendes Streben nach Effekt und eine nicht selten an Nachlässigkeit grenzende Kühnheit gerieten seine Schöpfungen oft in Manier. Ein echter Spanier, wusste er vor allen seinen Werken ein nationales, volkstümliches Gepräge zu geben. Die Mehrzahl seiner Gemälde befindet sich im Pradomuseum und in der Akademie von San Fernando in Madrid, die unter anderem drei seiner Hauptwerke, die bekleidete und die unbekleidete Maja und das Narrenhaus, besitzt.Vgl. Yriarte, G., sa biographie, etc. (Par. 1867); Lefort, Francisco G., étude biographique et critique (das. 1877); De la Viñaza, Goya y Lucientes (Madr. 1887); v. Loga, Francisco de G. (Berl. 1903).
Don Francisco de Goya - Ein Leben unter Künstlern und Königen
Selbstbildnis Goyas (1815) Madrid, Prado
Der tapfersten Mitkämpferin
Vorspiel
1
Am Rand des Madrider Vorstadtviertels Lavapiés, da wo sich die Gassen ins freie Land öffneten, wogte ein nächtliches Volksfest. Der Mond beschien flanierende Jugend, Tänzer, Musikanten, Spießbürger, Weintrinker, Gaffer, verschlungene Paare, Abenteuerlustige, Fruchtverkäufer, Marktschreier, Bettler, Lachende, Rufende, Singende. Sein Licht dämpfte die Farben bis zur Unkenntlichkeit, nur wenn sie in den Schein einer Glas- oder Papierlaterne gerieten, blühten sie auf wie Fetzen von Tag, die eine Riesenhand spielerisch mitten in die Nacht gestreut hat.
Auf einem freien Platz wurde die aragonische Jota getanzt. Ausgelassene junge Künstler führten sie an, die ihre langen, faltigen Mäntel und die breitrandigen Filzhüte über eine Steinbank geworfen hatten – nicht ohne die zwei unter einem Mauerbogen stehenden Polizeisoldaten mit einem spöttischen Blick zu bedenken. Denn das Tragen solcher Kleidungsstücke war eigentlich verboten.
Seit ein paar Jahren ging das so hin und her zwischen König und Bürgern: Irgendein Minister, wichtigtuerischer Nachäffer der Franzosen, hatte dem Spanier seine weiträumige, jede beliebige Heimlichkeit verhüllende Capa zusammenschneiden und ihm dazu den Dreispitz aufsetzen wollen anstatt des Krempenhutes, der die Gesichter im Halbdunkel so schön beschattete. Das Volk schäumte, und der Reformator wurde verbannt. Aber Minister wachsen nach, und nun war schon wieder einer im Amt, der sich um die Kleider der Untertanen kümmerte, weil er sie sonst mit nichts zu schikanieren wußte. Noch wagte er nicht scharf zuzugreifen, und darum konnte es nur nützlich sein, der Polizei zu zeigen, wie man zu Recht und Freiheit stand.
Mit unbehinderten Gliedern also führten drei von den Malern eine Kette von Burschen an, die sich gegen eine weibliche Kette bewegte, während ihre beiden Kameraden mit der Gitarre am Boden hockten und eine in ihren ewigen Wiederholungen unentrinnbar eindringliche Musik anschlugen. Zwei Dutzend Zuschauer klatschten mit den Händen den Rhythmus. Die von hohen Schmuckkämmen herabhängenden Schleiermantillas der Tänzerinnen kamen beim Vor- und Zurückschreiten ein wenig ins Wehen, die Fächer staken im Mieder oder zwischen den verketteten Fingern. Von Zeit zu Zeit brachte das Spiel die Paare zum Rundtanz zusammen, doch immer nur für wenige Takte, dann begannen Getrenntsein und Lockung von neuem.
Die Musik wurde rascher, heftiger. Die drei Anführer, die auch noch den Stutzerdegen abgeworfen hatten, suchten mehr Gewinn aus der Nähe der Mädchen zu ziehen, indem sie sie länger, als die Regel erlaubte, festhielten und an sich preßten. Francisco, ein wenig bäurisch von Ansehen, faßte eine Tänzerin hitzig um die Hüften und riß sie aus der Reihe heraus beiseite, wo er einen dunklen Gartenweg winken sah. Doch sie entwand sich.
"In jedem Nonnenkloster hätte man mehr Spaß als hier!" rief er seinen Freunden zu, nahm Capa, Hut und Degen an sich und schlug sich ins Gedränge, um bald darauf im Eingang einer Gasse zu verschwinden, die man die Flohgasse hieß. Dann bog er in eine noch engere, die kaum der Breite eines einzelnen Menschen Raum bot und den Namen führte "Komm heraus, wenn du kannst", überschritt einen kleinen Platz, stand vor einer Haustür still, hüllte sich in den Mantel, zog den Hut übers Gesicht und pfiff eine Melodie.
Er wurde eingelassen, die Tür rasch hinter ihm geschlossen. Er küßte die Frau noch im Hausgang. "Tadea, hier bin ich. José ist auf dem Fest, ich habe ihn trinken sehen, er wird uns nicht stören!"
"Du bist zu frech, Francho, geh wieder, ich hab' Angst." Ein Öllämpchen beschien ihr schönes, lebensdurstiges Gesicht und ihre volle gesunde Gestalt.
"Sogleich geh' ich – in deine Kammer", lachte Francisco.
"Nein, nein – heute nicht. José wird zurückkommen. Ich bitte dich, geh. Gleich schließ' ich dir die Tür auf."
"Warum hast du mich denn eingelassen, wenn du nichts als Faxen machen wolltest?" Er zog sie mit Gewalt in ein Zimmer.
"Bei der allerheiligsten Jungfrau – es war dumm, daß ich geöffnet habe. Aber muß auf jede Dummheit eine zweite folgen? Ich bitte dich, sei heut abend vernünftig. Dem Alter soll man gehorchen – ich bin bald ein Jahrzehnt älter als du, nächstens könnt' ich deine Mutter sein. Gehorch mir!"
Mit den Augen und der Bewegung der Glieder sprach sie das Gegenteil. Francisco gehorchte auch nicht. Sie begann zu lachen und war im Begriff, ihren Widerstand aufzugeben, als sie ganz plötzlich Stille heischte und scharf lauschte. "Da ist er, ich hab's gesagt – sofort hinaus über die Mauer."
Francisco huschte durch eine Tür in den Garten und kletterte über eine nicht allzu hohe Mauer in ein Gäßchen, das wieder zwischen dunkle Häuser führte. Wahrscheinlich habe ich mich an der Nase herumführen lassen, dachte er und kehrte mißmutig zum Fest zurück.
Er fand die Genossen noch bei jenem Trupp von Mädchen und ließ sich festhalten, ohne indes wieder am Tanz teilzunehmen.
José, Tadeas Gatte, tauchte auf und ging geradeswegs auf ihn zu. Es war José selbst in diesem unsicheren Licht anzusehen, daß er Streit suchte.
"Francisco ist sanft geworden", begann er zu spotten.
"Für Euch bin ich Don Francisco. Im übrigen verlaßt Euch nicht zu sehr auf meine Sanftmut!"
"Aha, der will mehr sein als wir anständigen Handwerker. So ein liederliches Bürschchen spielt den Caballero."
"Zähmt Eure Zunge!"
"Zähm du lieber deinen Hochmut und deine Lumpereien!"
Francisco fuhr nach dem Degengriff. José riß das Messer aus dem Gürtel. Ein paar Männer fielen den Streitenden in die Arme. Mit Lachen und Johlen hielt man sie fest. "Keine Hahnenkämpfe bei der Verbena!" rief einer. Ein anderer meinte, man solle sie ringen lassen, damit an den Tag komme, wer im Recht sei. "Laßt sie um die Wette tanzen", schlug ein Dritter vor, und dieser Gedanke zündete.
Die beiden konnten sich dem Volksbeschluß nicht widersetzen, mußten Waffe, Mantel und Hut ablegen und sich in einen weiten, dicht geschlossenen Kreis stellen. Zwei Kameraden Franciscos saßen wieder mit ihren Gitarren am Boden, ein alter Mann mit einer Laute gesellte sich dazu. Auch ein paar Laternen wurden gebracht, weiß der Himmel woher, und an Stöcken hochgehalten.
Die Musik hub an, eine Malagueña. Die Gegner schätzten sich kurz mit den Blicken ab, als gälte es wirklich einen Ringkampf. Man tanzte diesen Einzeltanz, diesen Tanz ohne Mädchen, wohl sonst um die Gunst einer Frau, aber nun war das Urteil aller Zuschauer angerufen. Die beiden begannen dem Takt die Herrschaft über sich einzuräumen, indem sie leicht die Füße aufschlugen und den Oberkörper wiegten. Allmählich stampften sie stärker, maßen sich jeder einen eigenen kleinen Kreis als Tanzfeld aus, malten die Musik mit gebogenen Armen nach.
Man warf ihnen Kastagnetten zu, scharf klapperte der Rhythmus aus den Hölzern. Die Zuschauer verschlangen das Schauspiel mit den Augen.
Die zwei, die es gaben, waren von mittelgroßer, gedrungener Gestalt. Doch während der Maler keines Vorzugs der Jugend entbehrte, hatte der Handwerker schon Fett angesetzt, und sein reichlich vierzigjähriges Gesicht war ein wenig gedunsen. Aber es fehlte ihm nicht an Kraft, und die zeigte er jetzt in einem raschen, fast wütenden Stampfen und einigen elastischen Sprüngen. Francisco steigerte gleichfalls seine Beweglichkeit und schnellte in die Höhe, nach rechts, nach links. Obwohl er sich der Magie der rhythmischen Musik nicht entziehen konnte und mit Hingabe tanzte, blieb er sich seiner sonderbaren, etwas unbehaglichen Lage bewußt und dachte über sie nach. Noch war er durchaus im Zweifel, ob José von Tadea kam und seine Flucht bemerkt hatte oder bloß einem unbestimmten Verdacht die Zügel schießen ließ. Eifersucht spielte sicherlich mit – und so bedeutete es trotz allem einen Tanz um die Frau, was sie hier aufführten, Tadea war die leiblich nicht anwesende Zuschauerin und Richterin des Tanzes.
José trieb seine Schritte und Sprünge in eine grimmige Komik hinein. Das stachelte Francisco an, sich leicht und elegant zu zeigen. Dieser Rolle war er nicht ganz gewachsen, aber einige Mädchen und Frauen hingen mit heißem Blick an seinen Bewegungen, denn er war gegen den plumpen Jose doch der weit Begehrenswertere. Ihre Augen winkten ihm Wünsche und Versprechungen zu, aber er gewahrte sie nicht, sein flatterhafter Sinn ließ sich eine kurze Weile in die Ferne bannen.
José wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Er ermattete sichtbar, ließ die Arme sinken, suchte durch langsameres Schlagen der Kastagnetten die Musikanten zu gemessenerem Tempo zu zwingen. Francisco aber schlug schneller, sprang mit gleichen Füßen auf und nieder wie ein leichter Ball, den die Erde zurückstößt. José keuchte, hörte schließlich auf zu tanzen und versuchte die Musik zum Schweigen zu bringen. Aber die drei spielten weiter – zum Gaudium der Zuschauer. Da bahnte sich der Unterlegene wortlos einen Weg und verschwand.
Francisco leistete sich eine besonders kühne Schlußfigur, zu der alle in die Hände klatschten. Er heimste den Beifall nicht ohne Eitelkeit ein. Ein Becher Wein erhitzte ihn vollends, vermochte aber sein Unbehagen nicht auszulöschen. Er fühlte einen Feind.
Obwohl man ihm jetzt überall zeigte, daß er etwas galt, faßte er in dem Fest nicht mehr recht Fuß. Früher als die andern wandte er sich zur Stadt zurück.
Ein Mädchen hängte sich an ihn, sie wollte Geld haben. "Was mir keine schenkt, muß ich mir kaufen", sagte er nicht eben freundlich und legte den Arm um sie. Aber als er unter einer Laterne ihr unfrisches Gesicht sah und ihr künstliches Lachen hörte, löste er sich mit einer kleinen Münze aus und ließ sie stehen.
Kein Mensch war mehr unterwegs. Darum griff er, als in einer dunklen Gasse ein Dutzend Schritte entfernt eine unbestimmte Gestalt sich bewegte und stehenblieb, nach der Waffe. Im Weitergehen entdeckte er indes niemand. Die Gestalt schien ausgelöscht, obwohl er keine Tür hatte gehen hören.
Plötzlich hinter ihm ein Sprung. Er wendet sich um und sieht sich einem unbekannten Mann gegenüber, der mit blankem Degen auf ihn eindringen will. Blitzschnell zieht er vom Leder, verteidigt sich. Während dann ein paar Atemzüge lang der Unbekannte drohend und lauernd still hält, stößt er selbst zu. Er fühlt: der Stoß muß getroffen haben. Im selben Augenblick aber hört er wiederum hinter sich ein Geräusch und spürt auch schon einen Stich im Rücken.
Er taumelt, fällt, verliert das Bewußtsein.
Erst nach einer reichlichen Stunde, es ging schon gegen die Morgendämmerung, fanden ihn die vom Fest heimkehrenden Kameraden, die desselben Weges zogen. Er erwachte und stöhnte vor Schmerz, als sie ihn aufhoben und in das Zimmer dessen trugen, der am nächsten wohnte.
Es gelang noch vor Sonnenaufgang, einen Arzt herbeizuholen.
Ein paar Tage später, nachdem Francisco ein nicht ganz leichtes Fieber überwunden hatte, schafften ihn seine Freunde bei dunkler Nacht in ein anderes, verschwiegenes Quartier.
Jener im nächtlichen Kampf gleichfalls verwundete Angreifer war auf dem Heimweg von der Polizei beobachtet worden. Von des Malers Wunde munkelten die Nachbarn. Es waren Anzeichen da, daß die Behörde auch hier Witterung bekommen hatte und die beiden Vorfälle miteinander in Verbindung brachte. Besser, der Sache mindestens so lange auszuweichen, bis Francisco selbst ohne Gefahr für seine Gesundheit Rede stehen kann.
Er hatte gerade zum erstenmal das Bett verlassen, als sich unerwartet und unangemeldet ein merkwürdiger Besuch zur Tür hereinschob: Pablo, ein Verwandter seiner Mutter, ein buckliges Männchen mit blassem, verkniffenem Gesicht, kleiner Beamter beim Magistrat. Er war schwarz gekleidet, wie immer, wenn ihm Francisco begegnet war, seine Miene betonte sogleich die Wichtigkeit des Augenblicks. Während er mit etwas rauher und scharfer Stimme zu reden anfing, fühlte sich Francisco stark an einen Raben erinnert.
"Das war verteufelt schwer, den Delinquenten zu finden", hub der Rabe an. "Immerhin – den Spürsinn deines Vetters führt man nicht hinters Licht." Er lächelte eitel und schnaubte Luft durch die fast über den Mund herabhängende Nase.
"Es war nicht meine Absicht, mich gerade vor dir zu verstecken." Francisco sagte es in höflichem Ton.
Der Rabe ließ sich bewegen, auf einen Stuhl zu flattern, zog die Brauen zusammen, blähte die Brust und erklärte, daß er ohne Umschweife auf den Zweck seines Besuchs losgehen wolle.
"Es ist dir vielleicht nicht unbekannt, daß mich einige ängstliche Menschen für einen Freigeist erklären. Ich bin der Lektüre ketzerischer Schriften verdächtig. Trotzdem unterhalte ich ausgezeichnete Beziehungen zum Großinquisitor." Er prüfte die Wirkung seiner Pointe und zog zufrieden die Schultern hoch, als er Franciscos interessiert abwartende Miene sah. Es war, als lüfte er ein klein wenig die Flügel. "Natürlich nicht direkt, der Kardinal soll überhaupt wenig Verkehr haben, aber ich bin befreundet mit einem Priester, der beim Heiligen Kollegium arbeitet. Solche Beziehungen können nie schaden – du wirst es nicht bestreiten wollen."
Francisco bestritt nicht, aber er wartete noch immer ab.
Von neuem blähte sich der Magistratsrabe und zog zugleich den Kopf zwischen die Schultern. "Sehr nützlich sind solche Beziehungen. Die Sache geht dich unmittelbar an." Es war, als hackte er mit dem Schnabel. "Unter dem Siegel tiefster Verschwiegenheit, unter der Bedingung, daß du, wie auch immer die Angelegenheit sich wende, niemals meinen oder des – dir ja auch unbekannten – Gewährsmannes Namen nennst, will ich dir etwas ganz außerordentlich Wichtiges anvertrauen."
"Verlaß dich auf mich", war alles, was er als Antwort zu hören bekam.
"Man hat mich gewarnt. Für dich gewarnt. Man weiß, daß ich dich protegiere." Er rückte auf dem Stuhl hin und her, als suche er ein höheres Postament. "Man ist bei der Inquisition auf dich aufmerksam geworden. Auf eine Messer- oder Degenaffäre, an deren Untersuchung man darum herangehen will, weil ein Ehebruch dahinterstecken soll. Du weißt vermutlich, daß das Heilige Kollegium über das Sakrament der Ehe zu wachen hat, scheinst aber in diesen Dingen etwas leichtsinnig vorzugehen." Der Schnabel hackte, aber er streute sogleich das kühlende Pulver weltmännischer Skepsis auf die Wunde. "Ich frage nicht, ich bin nicht indiskret, und es ist dir nicht unbekannt, daß mich Weiberrockskandälchen und Schlafzimmeranekdoten wenig interessieren." Ein gewisser Zug um den Schnabel ließ sich nicht unterdrücken und strafte ihn Lügen. "Die hohen Gebiete wissenschaftlicher Welterkenntnis sind mein Steckenpferd. Ich kann unter vier Augen nicht bestreiten, auch einige Schriften des Franzosen Voltaire gelesen zu haben."
"Verdammt", fuhr es Francisco heraus, sobald er zu Wort kommen konnte, "als ich vor drei Jahren von Zaragoza nach Madrid ging, geschah es gleichfalls um eines Kreuzchens willen, mit dem die Väter der Inquisition auf irgendeiner Liste meinen Namen geschmückt hatten."
Der Rabe zog bedenklich die Stirn kraus, schwieg aber mit hoheitsvoller Miene, denn er vermißte die Anerkennung seines hohen Strebens. Dann überwog sein verwandtschaftlicher Sinn und die Freude am Ratgeben. "Man hat dem Kollegium in letzter Zeit viele von seinen Rechten genommen und eingeschränkt", stellte er zunächst belehrend fest, "aber glaube einem Freigeist, der gelernt hat, die Welt zu beobachten: was den Herren noch in ihre Fänge geliefert wird, darauf hacken sie mit doppelter Stärke los." In der Tat – der Rabe bediente sich dieses Raubvogelvergleichs. "Es empfiehlt sich dringend auszuweichen, die Hauptstadt zu verlassen, bis die Geschichte vergessen ist. Das heißt – es ist nicht meines Amtes, hier ein Komplott zu schmieden. Ich will durchaus nichts gesagt haben. Meine Andeutung habe ich gemacht. Du wirst eine Fügung des Schicksals in ihr sehen müssen. Welche Folgerungen du ziehst, bleibt deiner Einsicht überlassen."
Als Francisco nun doch ein Wort fand, für die Mitteilung zu danken, versicherte der Vetter kühl, es sei vor allem um Franciscos Mutter willen, daß er sich die Mühe der Nachforschung und des Besuches gemacht habe. Denn er hatte erwartet, wesentlich lauter als Retter gepriesen zu werden.
"Ich gebe zu", krächzte er, "daß gewisse Sorten von Menschen einem abenteuerlichen Untergang mit Sicherheit zueilen, auch wenn ihnen Gutgesinnte ein- oder mehrmals aus der Patsche helfen. Hoffen wir, daß es sich hier um keinen unbelehrbaren Fall handelt. Vielleicht kann dir die moralische Höhe der Weltanschauung, die mich zu dieser Warnung veranlaßt hat, gelegentlich zur Richtung dienen." Er reckte selbstgefällig den Hals.
Mit Franciscos Schweigen unzufrieden, stand er auf, versicherte nochmals, er wolle nichts gesagt haben, wünschte guten Fortgang der Studien und schob sich so beflissen zur Tür hinaus, als ob auch draußen ein wichtiger Auftrag seiner harrte.
Als die Freunde zurückkamen, beredeten sie die Flucht als eine unbezweifelbare Notwendigkeit. Einer riet zum Gebirge, einer zu Paris, einer gar zum Dienst bei den afrikanischen Truppen.
Francisco Goya stieg wieder ins Bett, streckte sich aus und lachte: "Seien wir den heiligen Vätern dankbar! Sie zwingen mich, meine Studien in Italien zu vollenden. Verbergt mich noch zwei Tage – bis dahin wird sich ein Weg finden!"
Während sie begeistert beistimmten und nach Wein schickten, um die Weltreise sogleich zu feiern, begann er im stillen zu überlegen. Er besaß noch drei Silberstücke zu je zehn Realen.
2
Der jugendliche Torero Pepe Hillo, in seinem Fach noch unberühmt, auch noch nicht zu allen Feinheiten des Könnens aufgestiegen, hatte dem Stier das erste Paar Banderillas in den Nacken gestoßen – jene kurzen, mit einem Widerhaken versehenen und mit bunten Bändern geschmückten Stäbe, die, nur äußerlich verwundend, das Tier zugleich reizen und ermüden sollen. Gegen die Regel hielt der Stier nicht erstaunt still, sondern machte sich blitzschnell daran, seinen Peiniger mit gesenkten Hörnern zu verfolgen.
Pepe Hillo, in diesem Augenblick der Schaustellung völlig unbewaffnet, kam in die schlimmste Lage, mochte man auch dem noch nicht völlig ausgewachsenen Stier weniger Kraft und Wut zutrauen als einem alten Bullen. Der Abstand bis zur nächsten Schranke, hinter der sich der Torero in Sicherheit bringen konnte, betrug wohl zehn Schritte.
Da stürzte einer der zur Cuadrilla gehörigen Gehilfen herbei, um das Tier mit dem roten Mantel abzulenken. Und wirklich – es ging auf die Finte ein: zwei-, dreimal stieß es mit den Hörnern unter den ausgestreckten Armen durch in den roten Vorhang und dahinter ins Leere. Dann stand es still, versuchte die Banderillas abzuschütteln und hatte den Angreifer vergessen.
Händeklatschen prasselte von allen Seiten nieder: von den Fenstern und Balkonen der Gebäude, die den Marktplatz dieser valencianischen Provinzstadt umgaben, von der kleinen Tribüne und hinter den Holzzäunen hervor, mit denen die Straßenzugänge verrammelt und Teile des Platzes abgeschrankt waren. Der Retter stand beiseite, nur die stolz aufgerichtete Haltung seines Kopfes verriet, daß er den Beifall auf sich bezog. Dabei fühlte er seine unordentliche Kleidung: aus dem ärmlichen Vorrat der Cuadrilla hatte es für ihn nur zu einem zerschlissenen und abgebleichten grünen Samtjäckchen gereicht, das er zu seinen Alltagshosen tragen mußte.
Dieser Stierkämpfergehilfe war Francisco Goya.
Bei Freunden und Verwandten hatte er eine kleine Summe zusammengebracht, die für die bescheidenste Überfahrt nach Italien ausreichen mochte. Aber wie in eine Hafenstadt gelangen? Die Freunde legten ein Netz von Spionage aus und brachten es in kürzester Frist fertig, ihm seinen aragonischen Landsmann Pepe Hillo zuzuführen, der mit einer kleinen Stierfechtergruppe durchs Reich zog – dem Süden, der Küste zu. Francisco, der keinen Stierkampf versäumte und des öfteren mit Toreros umging, redete ihm sogleich wunder was über seine Erfahrungen in diesem Handwerk vor und ließ einfließen, daß er Anlaß habe, sich für einige Monate von Madrid zu entfernen. Da fand Pepe, daß er einen weiteren Mann wohl brauchen könne, und nahm ihn mit – erst auf Probe, gegen Essen und Nachtlager, später sollte dann ein kleiner Anteil am Reinverdienst dazukommen.
Das war nun keine leichte Arbeit. Viel Unrat und Handlangerei, Fußreisen auf heißen, staubigen Straßen oder bei Nacht, wenn andere Menschen schliefen. Denn meist stand nur ein Esel mit einem Karren zur Verfügung, auf dem außer dem Fuhrmann Pepe Hillo gerade das Berufsgerät, die Schlafdecken und das bißchen Privatgepäck der sechs Cuadrillamitglieder Platz fanden.
Francisco hatte seine Eltern, ehemalige Dorfbauern, die nun in Zaragoza einen Kramladen führten, brieflich gebeten, ihm zu Händen eines entfernt verwandten Weinhändlers in Alicante Geld zu schicken, dort wollte er die Cuadrilla heimlich verlassen und sich nach Italien einschiffen. Viel konnten sie nicht entbehren, das wußte er, und es wäre an der Zeit, daß Pepe einmal herausrückte. Auch daran dachte er während des Beifallsregens.
Der Spektakel nahm seinen Fortgang. Pepe Hillo brachte das zweite Paar Banderillas an, ohne daß sich etwas Besonderes ereignete. Als ihm das dritte Paar gebracht wurde, hob er es hoch, ging lächelnd damit auf Francisco zu und überreichte es ihm mit ritterlicher Geste. Sturm des Beifalls: der Matador hatte seinem Retter, um ihn vor allem Volk zu ehren, das Recht abgetreten, diese Banderillas dem Stier in den Nacken zu stoßen.
Dieses Recht war zugleich ein Zwang. Ablehnung wäre ausgepfiffen, Francisco aus der Arena und seinem Aushilfsbereich gejagt worden. Er verspürte auch gar keine Lust abzulehnen. Die Gefahr reizte ihn. Jeden Tag hatte er gewünscht, wenn er schon einmal in der Arena stände, aus den Reserve- und Aushilfsstellungen herauszukommen. Jetzt war Gelegenheit, das Können zu zeigen.
Dieses Können saß freilich nur im Kopf, in der Beobachtung, in den Griffen und Stößen, die seine Einbildungskraft, nicht aber seine Hand vollführt hatte. Aber die Einbildungskraft des Künstlers ist lebensnah, eigenlebendig, darum empfand er es kaum als einen Unterschied, ob seine Finger in der Vorstellung oder in der Wirklichkeit die bunten Spieße früher schon umklammert hatten.
Er warf den roten Mantel einem Gehilfen zu – nun war es sein Gehilfe – und näherte sich mit ruhigen Schritten dem Stier. Der ließ ihn nicht aus den Augen. Es saß noch viel Kraft in diesem wuchtigen Nacken. Francisco wechselte den Standort – der Stier wandte den Kopf nach ihm. Das geschah zweimal, dreimal, zehnmal. Es war schwer, heranzukommen.
Verdammt, dieses Zögern. Hunderte von Menschen warteten. Er wußte von Hunderten von Blicken, die sich alle in ihm trafen, um ihn kreisten, ihn abtasteten. Er durchschnitt Blicke, zertrat Blicke, triumphierte, daß sie ihn nicht aufhalten konnten. Er war hier der Herr, konnte bestimmen, was geschah. Dutzendmal hatte er es erlebt, daß der Banderillero geraume Zeit verstreichen lassen mußte, bis er seine Aufgabe erfüllen konnte.
Für eine Sekunde sah er über dem Stier grellbesonnte Häuserfronten vor kobaltblauer Luft, Balkone mit stark farbigen Decken, Sonnensegel, leichtbewegte Fächer. Merkwürdig puppenhaft kamen ihm die Menschen vor. Das müßte man einmal malen ...
Der Pfiff eines Mißvergnügten. Beifallsklatschen übertönt ihn. Der Stier rührt sich nicht mehr. Er scheint müd.
Francisco geht mit rhythmischen, fast tanzenden Schritten näher, wie er es bei einem berühmten Meister gesehen und bewundert hat, eilt mit ein paar Sätzen an dem Stier vorüber und stößt ihm mit jeder Hand eine Spitze in den Nackenwulst. Die Stäbe haften, fallen über, bleiben hängen – neben den vier anderen. Der Stier hat ein wenig gezuckt, sich aber nicht von der Stelle bewegt. Wieder prasselnder Beifall.
Ein wenig Blut tropft von dem Stier auf das oberflächlich mit Sand bestreute Steinpflaster. Francisco sieht es, freut sich über die gute Arbeit, die er geleistet, weiß nichts von der Pein des Tieres. Niemand hat ihm je davon gesprochen. Keiner von all den Hunderten hier weiß davon. Niemand hat ihnen je davon gesprochen.
Als der Stier, nachdem er mit dem Scharlachtuch nochmals gereizt und ermattet worden ist, vom dritten Degenstoß des Matadors zu Tode getroffen wird, erlöscht ein verzweifelter und anklagender Blick, den nicht ein einziger dieser Menschen in sich aufgenommen und erkannt hat. Auch Francisco nicht. Wohl beginnen seine Augen mehr zu sehen als die der andern – Formen, Farben, Harmonien, Kontraste, Menschengesichter, Menschenhände. Aber sein Geist ist noch jung und denkt, was die andern denken. Der Geist wird wachsen und die Augen mit ihm. Sie werden den Wesensgrund der Menschen sehen, die Schicksalslast des ganzen Menschengeschlechts, die Niedertracht der Mächtigen, das Elend der Unterdrückten, das Grauen des Lebens, das Grauen der Gespensterreiche, das Grauen des Todes. Aber der Qual der Kreatur werden sie bis zu einer späten Stunde verschlossen bleiben ...
Zum Abend betrat Francisco eine dunkle, von großen Fässern eingeengte Kneipe, setzte sich am Ende eines leeren Tisches nieder und ließ eine Kerze zu sich heranrücken. Auch mußte der Wirt die Tischplatte abtrocknen und Tinte und einen Federkiel herbeischaffen. Francisco zog einen Bogen Papier aus der Tasche. Er mochte heute abend keine Gesellschaft leiden und fühlte trotzdem den Druck des Alleinseins, so schaffte er sich durch einen Brief Verbindung mit vertrauten Menschen.
Am Nebentisch wurde laut debattiert. Der Wirt griff ängstlich ein: es sei verboten, über Politik zu sprechen. Man lachte ihn aus.
Auch Franciscos Tisch bekam Gäste, es war Sonntag, und die Berufsklassen, denen werktags der Besuch von Schenken verboten war, nützten die Zeit. Hier schimpfte man, daß dem Bürger seine harmlosen Vergnügen genommen werden, das Karten- und Würfelspiel. Der Wirt, dem dieses Verbot nicht das schlechteste schien, weil die Spieler am längsten hockten, selten viel tranken, aber um so mehr stritten, spottete: "Geht zum Billard, wenn ihr durchaus spielen müßt." Da schlug einer mit der Faust auf den Tisch, daß Francisco ein krummer Schnörkel unterlief, und rief: "Roßäpfel sind mir lieber als die Kugeln des Königs." Das Billard war nämlich ein Reservat des Königs, das er verpachtete.
Der Wirt bat wieder um Mäßigung. Als ihm ein Schlagfertiger entgegenhielt, er möge doch die Tür schließen, dann höre man draußen nichts, wandte er sich achselzuckend ab. Auch hierauf lag ein Verbot. Schlug der Wirt die Tür zu, schloß ihm die Polizei seine Kneipe, nicht einmal ein Vorhang war erlaubt. Die Zeiten waren ärgerlich.
Francisco war dabei, ein paar Sätze über seine Tüchtigkeit als Torero niederzuschreiben – lustig und etwas eitel –, als ihn einer der Gäste erkannte: "Schaut, ein gelehrter Stierfechter – meine Bewunderung, Caballero!" Man trank ihm zu. Er bat um Geduld, er habe eine wichtige Sache zu erledigen, und zeichnete mitten in den Brief mit ein paar Strichen einen Stier und einen Banderillero, der etwas von seiner eigenen Haltung hatte. Dann kam er zum Schluß und verlieh sich feierlich den Stieradel, indem er unterschrieb: Francisco de los Toros.
Er faltete das Blatt, siegelte es mit einem Ring, adressierte es an Don Martín Zapater y Clavería in Zaragoza und erkundigte sich nach der besten Möglichkeit der Beförderung.
Dann nahm er die weiteren Huldigungen der Bürger entgegen.
3
Eine Zeitlang erging es Francisco dreckig. Pepe Hillo zahlte selten und wenig, und in Alicante wußte niemand etwas von einer Geldsendung. Der von dem reichen Weinhändler schließlich verabreichte Vorschuß zeugte von wenig Vertrauen auf das ehrliche Gesicht des Empfängers.
Vorzeitige Herbststürme machten die Überfahrt zur Qual, das auf dem Schiff schon an sich abscheuliche Essen verließ oft genug den Magen auf dem Weg, den es gekommen war. Der Schlafraum stank, und selbst der kräftigste Bursche mußte die Freude am Leben verlieren.
In elendem Zustand erreichte Francisco Rom, nachdem der Postwagen seine Eingeweide nochmals durchschüttelt und sogar unter der Narbe des Madrider Messerstichs Schmerzen erweckt hatte. Wäre es nicht einer mitleidigen alten Zimmervermieterin beigekommen, ihn in memoriam eines bei der spanischen Fremdenlegion verschollenen Sohnes notdürftig zu verpflegen – das Abenteuer hätte ein schlimmes Ende nehmen können.
Später verführte er die Nichte seiner Wohltäterin und wurde hinausgeworfen. Aber da besaß er schon Geld: die Gabe des Vaters, die der Weinhändler nach Abzug seiner Forderung nachgesandt hatte, und sogar ein wenig selbstverdientes.
Damit hatte es diese Bewandtnis: Während die andern jungen Maler in Museen Marmorfiguren abzeichneten und im Vatikan auf riesigen Leinwänden Raffaels Fresken kopierten, hockte er mit seinem Skizzenbuch auf Brunnenrändern und hielt einen Straßenhändler oder eine Gruppe schwatzender Weiber fest. Nach solchen Zeichnungen malte er in seinem Werkstattzimmer kleine Bilder. Manchmal stellte er auch eine Staffelei einfach auf die Piazza Navona zwischen die Marktstände oder auf den Campo dei Fiori zwischen die Trödler und nahm seine Skizzen schon farbig nach der Natur auf. Dies, besonders auch die kurzbesonnene Schnelligkeit seiner Arbeit, erregte Kopfschütteln bei den klassisch strebenden Kollegen, wohlausgestatteten Stipendiaten zumeist, aber Fremde kauften ihm die rasch hingeworfenen Zeugnisse römischen Volkslebens mitunter noch naß auf der Straße ab, wenn auch für geringen Preis. Sogar einige ansässige Kenner interessierten sich, und schon wurde ihm zugetragen, der spanische Gesandte beim Heiligen Stuhl, Seine Exzellenz Don Miguel Trinidad Marqués de San Millan y Villaflor, Conde de Pontejos, habe den Wunsch geäußert, gelegentlich ein paar Arbeiten des jungen Landsmannes zu sehen.
An diesem Morgen hatte Francisco wenig Lust zur Arbeit und war froh, als der Studiengenosse Agustin Esteve in seinem Werkstattzimmer erschien, um ihn zu einem Spaziergang abzuholen. Nachher wollten sie zusammen Fischsuppe essen, jenes kräftige, in der Brühe aufgetragene Gemisch der unwahrscheinlichsten Meertiere, das ein paar Kellerkneipen als Spezialität führten.
Auf einer Tiberbrücke kamen den Malern zwei Zöglinge des spanischen Priesterseminars entgegen, die sich irgendeines Feiertags erfreuten, mit dem einen, Juan Llorente, dessen breites knochiges Gesicht beim Lachen etwas Anziehendes hatte, waren sie gut bekannt. Man beschloß zusammenzubleiben und einigte sich, da die Soutanenträger eine gewisse Gewähr für einen ihrem Stand angemessenen Verlauf des Vormittags verlangten, auf den Besuch von Sankt Peter.
Dort ließen sie sich von einem Küster in die Grabkatakomben führen und wurden nicht ohne Grauen von der nur durch die Kerzen der Besucher erleuchteten Niedrigkeit und Schmucklosigkeit der Gewölbe umfangen, in denen die einfachen Steinsarkophage der Päpste standen. Ein Kaiser und eine Kaiserin, Könige und Königinnen lagen dazwischen, in der heiligen Stadt vom Tod ereilt, wurden sie der Ehre der geweihtesten Grabstätte der Christenheit gewürdigt. Ein Jahrtausend und mehr war über einige dieser Särge hingeströmt.
Der Küster wußte nicht viel zu erklären, aber die beiden Kleriker begannen ihre Kenntnisse auszukramen. Francisco horchte auf. Er hatte in der geistlichen Schule zu Zaragoza wenig von geschichtlichen Ereignissen gehört, die nicht sein spanisches Vaterland unmittelbar angingen. Nun unterwölbte sich ihm die Gegenwart, in der er stand, plötzlich mit den riesenhaften Grüften der Vergangenheit, Gestalten hoben sich vom Dunkel ab, so wie Juan sie beleuchtete, dessen Beredsamkeit seinem ungewandten Begleiter bald den Mund verschloß. Der junge Kaiser, vor achthundert Jahren in Sankt Peter gekrönt und in derselben Kirche, nach einem Durchbruch durch den Belagerungsring der Griechen und Sarazenen, mit der schönen Kaisertochter aus Byzanz vermählt – der Papst, der vor mehr als viereinhalb Jahrhunderten das erste Jubeljahr der heiligen Kirche verkündete, den Zustrom von hunderttausend Pilgern erlebte, die Oberhoheit über alle Könige für sich beanspruchte, von römischem Adel mißhandelt und im eigenen Vatikan gefangengesetzt wurde – alle die andern, von denen Juan sprach, Francisco fühlte, ja sah sie lebendig und empfand es um so tiefer als eine erregende Merkwürdigkeit, daß ihn nur die dünne Steinplatte, auf die er die Hand legte, von ihrem vermoderten Gebein trennte.
Und als er wieder in das Kirchenschiff aufstieg, bekamen auch die hier oben in die Wände eingebauten Gräber, die, ganz anders als die unteren, mit üppigen Denkmälern sich maskierten, einen besonderen Sinn für ihn: er malte sich aus, diese Päpste haben einen Kampf gegen den Tod geführt und ihren Sieg vorgetäuscht, indem sie ihren Leichnam der Kellergruft vorenthielten.
Auf der Dachterrasse, angesichts der steinernen Apostelriesen, freute er sich des Lebensstroms der freien Luft und machte, aus einer philosophierenden Melancholie mit einem Satz in die übermütigste Laune springend, Anstalten, dem heiligen Bartholomäus auf den Kopf zu klettern, um eine Taube zu verjagen. Juan hielt ihn zurück.
Während sie auf der im Scheitel der Kuppel die Laterne umziehenden Plattform sich an dem nahen, scharf umzirkten Platz, den mächtigen Höfen des Vatikans, dem Tiberfluß, den Dächern, Türmen, Kuppeln, Pinienhügeln der Stadt und dem stolzen Hintergrund der Gebirge entzückten, stellte Juan fest, daß sie noch gar nicht die höchste Höhe erklommen hätten. Sie fanden auch die Tür des Aufgangs in die Laterne, die selbst noch einen respektablen Säulenrundgang darstellte, aber sie war verschlossen und kein Aufseher in der Nähe.
"Dann müssen wir eben sehen, so hinaufzukommen", entschied Francisco. "Ich jedenfalls steige nicht ab, ohne oben gewesen zu sein. Trotz meinem Hunger."
Die andern lachten. Agustin schlug im Scherz eine Wette um die mittägliche Fischsuppe vor.
Francisco schaute an den Säulen empor – mit Augen, die aus ihrer eingesenkten Lage wie aus einem Versteck hervor mit doppelter Schärfe ihre Ziele faßten – und nahm die Wette an.
Agustin wähnte sich auf eine lustige Art zum Mittagessen eingeladen und hielt die Angelegenheit damit für abgetan.
Francisco aber hatte entdeckt, daß in die Säulen kleine Marmorplatten eingelassen waren, Lampenträger für Festbeleuchtungen, die wie die Sprossen einer Hühnerleiter senkrecht in die Höhe führten. Er umklammerte eine Säule, prüfte die Tragfähigkeit der Plättchen, schnupperte mit der breiten, ein wenig hochgestülpten Nase scherzhaft die Luft ein wie eine Katze und begann zu klettern.
Die drei unterließen jeden Versuch, ihn an den Beinen festzuhalten – vor Verblüffung und vor Angst, er könnte infolge der Behinderung gefährlich stürzen. Doch rief Agustin, dem sein Gewissen schlug, mit Hast, er nehme die Wette zurück. Es klang mit seiner knabenhaft hohen Stimme, um derentwillen ihn seine Freunde den Kapaunen nannten, fast etwas lächerlich.
"Das tut kein Caballero", tönte es von oben.
"Ich trage die Verantwortung, wenn dir etwas zustößt. Ich bitte dich, laß diese Dummheiten!"
"Mir stößt nichts zu als eine gewonnene Fischsuppe."
"Ich gebe die Wette verloren! Komm zurück!"
"Ich lasse mir nichts schenken. Außerdem ist für das, was ich tue, niemand verantwortlich als Francisco Goya. Misch dich nicht in meine Privatangelegenheiten."
Die drei sahen sich mit höchst beunruhigtem Kopfschütteln an.
Indes ging die Sache ziemlich rasch vonstatten. Francisco faßte schon an eine der steinernen Schnecken, die, unterhalb des obersten Umgangs hervorragend, für die aufwärts Starrenden den noch darüber befindlichen Teil des Bauwerks verdeckten, und erklomm mit einem vor dem leeren Himmelsgewölbe unheimlich sich abzeichnenden Schwung den Rücken der Schnecke, die letzte Marmorsprosse splitterte ab und fiel zwischen den von neuem tief Erschreckenden nieder. Dann verschwand der Körper des Kletternden.
Juans Begleiter schlug vor, sich zurückzuziehen, sein geistliches Gewand könne mit dieser frivolen Sache nicht länger in Berührung bleiben. Juan aber erklärte bestimmt, er lasse Agustin in dieser Lage nicht allein. "Aber drei brauchen wir nicht zu sein", fügte er etwas spöttisch hinzu.
"Du weißt, daß es uns verboten ist, uns zu trennen."
"Auf die zwanzig Schritte, die du dich zurückziehen wirst, kommt es nicht an."
"Ich protestiere", sagte der korrekte Zögling und stieg ab.
Francisco war es indessen geglückt, das Eisengeländer der oberen Galerie zu überwinden. Er stand auf einer schmalen Plattform, schritt den Kreis ab und fand eine niedere Glastür, die ins Innere führte. Sie war verschlossen. Unmittelbar darüber setzte der steinerne, zwischen den Rippen mit Bleiplatten belegte Turmhelm an, der in steiler Kurve anstieg und in eine große, von einem Kreuz gekrönte bronzene Kugel endete. Sie zu beklopfen, wäre das Äußerste, was sich erreichen ließe.
Als er auf einem der Steine des Helms einen Namen gekritzelt fand, reizte ihn der Gedanke mächtig, sich höher oben einzuschreiben. Schließlich bedeutete es ja für ihn, der sich ein Schwindelgefühl noch nicht einmal vorstellen konnte, keinen Unterschied, ob man eine Kletterei vom Erdboden aus oder in fünfhundert Fuß Höhe unternahm. Die steinernen Rippen waren an den Fugen etwas verwittert und boten keinen schlechten Halt.
Er machte die Probe und fand diesen Teil seines Unternehmens gefahrloser als den schon überstandenen. Als er höher kam, konnte er wiederum Lampenträger zu Hilfe nehmen, diesmal solche aus Eisenblech, sie waren in den Bleiplatten verankert und wurden bei den großen Illuminationen sicherlich von angeseilten Männern bedient.
Aber das letzte Stück erwies sich als zu steil. Auch hatte er die Maße unterschätzt: die Kugel saß auf einem viel zu hohen Hals, als daß er sie hätte berühren können. Da resignierte er, zog einen Stift aus der Tasche und zeichnete ein F und ein G auf den höchsten Stein, den er erreicht hatte. In diesem Augenblick dachte er an die toten Päpste tief unten in der Gruft und überlegte, ob er seinen Initialen nicht die Bemerkung beifügen solle: hoch über den Grüften. Aber das schien ihm doch eine blasphemische Herausforderung des Schicksals.
Ehe er sich daran machte abzurutschen, sogen seine Augen minutenlang den Rundblick ein, der ihn hier oben noch weiter und größer dünkte. Nach unten verdeckte der seltsame Rand des Kuppelbauchs einen Teil der Nähe ...
Die beiden Wartenden, die sich anfänglich, ohne es einander einzugestehen, darauf gefaßt gemacht hatten, daß Franciscos Körper, an einer für sie unsichtbaren Stelle verunglückend, herabgesaust komme, beruhigten sich allmählich. Als sich aber die Ungewißheit allzulange hinzog, begannen sie sich mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, der Absturz könnte, ohne daß sie es bemerkt hätten, auf der entgegengesetzten Seite geschehen sein. Schließlich erschien ein Aufseher, kurz entschlossen sagte ihm Agustin, einer seiner Begleiter sei versehentlich oben eingeschlossen worden.
Der Mann erklärte das für unmöglich, ließ sich aber gegen ein Trinkgeld bewegen, nachzusehen. Gerade als er aufschloß, ertönten undeutliche Rufe aus der Höhe. Der Wächter bekreuzigte sich, schüttelte schwer den Kopf und stieg auf. Die beiden folgten ihm.
Als der wohlgenährte, zwar nicht in beruflichem Eifer und Ehrgeiz, aber in beruflicher Gewohnheit gut verankerte Beamte entdeckte, daß sich in der Tat eine menschliche Gestalt nicht nur hier oben, sondern sogar außerhalb des Turmzimmers, außen auf der Galerie bewegte, erbleichte sein rotes Gesicht. "Niemals lassen wir einen Fremden hier hinaustreten, weil die Stelle gefährlich ist", stotterte er. "Heiliger Petrus, wer kann das getan haben?" Mit zitternder Hand stellte er fest, daß die Tür verschlossen war, und ließ auch die beiden rütteln, um das Übernatürliche des Vorgangs zu dokumentieren, denn die Tür war nach seiner (durchaus zutreffenden) Überzeugung seit Monaten nicht aufgeschlossen worden. Dann suchte er, während Juan etwas Unverständliches murmelte, nach dem Schlüssel und öffnete.
Sogleich rief Agustin: "Wir konnten dem Mann erst jetzt mitteilen, daß du eingeschlossen bist." Francisco verstand und fing an, über die Schlamperei der Kustoden zu schimpfen. Der arme Mann wäre sicherlich durch ein Gespenst weniger aus der Fassung gebracht worden als durch diesen lebendigen, schimpfenden Menschen – denn ein Geist hat schließlich das logische Recht zu jeder Art von Aufenthalt. Als ihm nun gar Francisco einen angeblichen Kollegen, der gar nicht existierte, als den Schuldigen beschrieb: lang, dürr, schieläugig, ein wenig hinkend, mit rotem Bart – da glaubte er es mit einem Wahnsinnigen zu tun zu haben und drängte zum Abstieg.
Er bekam noch eine Münze für die Rettung, fand aber seinen wohlgeordneten Gleichmut nicht wieder.
Als die vier ins Freie traten – der korrekte Jüngling hatte bebend in halber Höhe der Kuppel gewartet –, lachte Francisco: "Ich glaube, der da oben schüttelt immer noch den Kopf!"
"Wir auch", bemerkte Agustin. Aber er verbarg seine Bewunderung nicht.
Am andern Ende des Platzes kamen sie an einer Gruppe vorüber, die hitzig über die Möglichkeit stritt, die äußerste Spitze der Kuppel von außen zu erklettern. "Wenn ich es aber mit diesen Augen gesehen habe und auch mein Weib Zeuge ist", schrie der Gemüsehändler und gestikulierte mit einem Fenchelknollen. "Dann wart ihr eben beide besoffen", sagte der Kneipwirt von der Ecke und brachte seine rote Bauchbinde in Ordnung.
Francisco blieb stehen und fragte höflich, ob es ihm erlaubt sei, sich einzumischen. "Ich habe die Sache aus der Nähe beobachtet. Es war einer der Aufseher, der lange, dürre, schieläugige mit dem roten Bart. Er holte einen Distelfinken, der ihm entflogen war."
"Hab' ich's nicht gesagt?" triumphierte der Angegriffene, "Den Roten habe ich die Ehre zu kennen. Er gehört zur unmittelbaren Dienerschaft Seiner Heiligkeit. Ich hab' ihn auch erkannt, doch wollte ich nichts sagen – ihr hättet mir sonst noch weniger geglaubt. Was sagt ihr jetzt?"
Der Wirt und seine Parteigänger verzogen geringschätzig den Mund. Da trumpfte die Frau noch auf, indem sie die Brust im zerrissenen Mieder hochzog: "Ich habe sogar den Vogel gesehen. Wer weiß, welch hochstehender Persönlichkeit er gehört!"
"Würde für deine Spatzen jemand auf die Kuppel klettern?" höhnte der Händler zum Wirt hin. "Noch nicht für deine Gänse!" Er spielte Ball mit einer Orange.
"Ich glaube, du wirst bald deinen Salat dort oben bauen", gab der Wirt zurück und spuckte im Weggehen aus.
"Jetzt hab' ich aber wirklich Hunger", mahnte Francisco.
Der spanische Gesandte ehrte den jungen Maler durch einen Porträtauftrag und lud ihn mehrfach in sein Haus ein.
Bei einem Empfang lernte Francisco ein sehr schönes römisches Mädchen kennen, die Tochter des verstorbenen Marchese Salviati. Angelica ermunterte ihn, nachdem er einige spanische Lieder zur Gitarre gesungen hatte, durch unverhüllte Sympathie, sich ihr noch während des Festes flammend zu erklären.
Trotz der Sorgfalt, mit der des Mädchens Schritte überwacht wurden, konnten sie sich mehrmals treffen. Aber die Zusammenkünfte wurden entdeckt. Angelica versicherte, sie werde den spanischen Maler heiraten. Die Marchesa, für die Mesalliancen eine Gotteslästerung bedeuteten, verfügte nach einer Besprechung mit ihrem älteren Bruder kurzerhand, daß ihre siebzehnjährige Tochter in einem Kloster adeliger Nonnen untergebracht werde – zur Beendigung ihrer Erziehung. Das Kloster befand sich zwar in Rom, doch konnte man sich von der bekannten Strenge seiner Hausordnung Gewähr gegen alle Gefahren jugendlicher Heißblütigkeit erwarten.
In der Abschiedsunterredung verlangte die Mutter ein volles Geständnis. Angelica erklärte kühl, sie sei nicht so töricht, einem Liebhaber, über den sie Macht behalten wolle, raschen und leichten Sieg zu gewähren. Sie bitte übrigens bei dieser Gelegenheit um Aufklärung darüber, was es mit dem Gerücht auf sich habe, sie sei gar nicht die Tochter ihres Vaters, sondern ... Sie konnte den Satz, in dem noch ein Stallmeister vorkommen sollte, nicht zu Ende sprechen, weil die Marchesa, ohne sie eines Blickes zu würdigen, das Zimmer verließ.
Aber sie entging der klösterlichen Erziehungsanstalt nicht. Die spärlichen Ausgänge in die Stadt, die sich, da die Nonnen einen großen Garten besaßen, fast ganz auf den Besuch von Kirchen beschränkten, geschahen in Reih und Glied, in entstellender Tracht, unter Aufsicht mehrerer Klosterfrauen. Francisco kam einmal im Straßengedränge ganz nahe an Angelica heran, aber sie rief ihm – unbekümmert um den Zorn der Nonnen – zu: "Du sollst mich so nicht sehen!" Und diesen Willen respektierte er gar nicht ungern. Denn das aus einem störrischen Stoff schlecht geschnittene graue Kleid schien statt eines straffen Mädchenkörpers den einer zerfallenden Matrone zu verhüllen, das schwere, duftende Haar war unter einer Haube gefangengesetzt, die selbst noch die Augen beschattete. Nur dem üppigen Bogen des Mundes und seinen immer etwas hochmütig zuckenden Winkeln konnte der Zwang nichts anhaben.
Sie selbst hatte den Gedanken, bei einem solchen Ausgang aus dem verhaßten Zwang zu entfliehen, sogleich aufgegeben. Am lichten Tag, in dieser durch ihre Lächerlichkeit auffallenden Kleidung ... unmöglich ... Die Nonnen würden schreien und genug Helfer finden.
In jenen Tagen wurde Francisco zum Grafen Sergei Nikolajewitsch Korsakow gerufen, dem Gesandten Ihrer Majestät der Kaiserin aller Reußen beim Heiligen Stuhl. "Sicherlich wieder ein Porträt", sagte er zu Agustin, der sich vor Bewunderung fast verbeugte. "Übermorgen wird sich der Papst um mich bemühen." Hinter dem Scherz verbarg sich ein hübsches Stück Eitelkeit über die jähe Kurve seiner Erfolge.
Da sein Gast des Französischen nicht mächtig war, mußte sich der Graf der italienischen Sprache bedienen, die er nur mangelhaft beherrschte. Der etwas unscheinbar, aber sehr energisch aussehende alte Herr, der, wenn das Gerücht nicht log, vor etlichen Jahren einen Diener für die durch eine Ungeschicklichkeit geschehene Zerstörung einer venezianischen Glasschale mit dem Degen durchbohrt hatte – dieser alte Herr mit den kleinen heftigen Augen also bemühte sich, dem jungen spanischen Maler klarzulegen, daß es sich in Petersburg leben lasse.
Francisco verstand die wesentlichen Punkte durchaus: es gebe Öfen und Pelze gegen die Winterkälte, den Wein beziehe man aus Deutschland und Frankreich, die Köche gleichfalls, und was die Frauen anlange, so finde der Graf, daß sie mehr Temperament haben als in Rom... Es war ihm anzusehen, daß er zu einer gewürzten Anekdote ausholen wollte, doch besann er sich rechtzeitig: sollte dieser junge Mann das Angebot annehmen und im Lauf der Zeit zum Hofmaler ernannt werden, so war sein Rang der der Tanzmeister oder Leibärzte... Abstand, Abstand gegenüber künftigen Hofbediensteten... Außerdem kann man so etwas nur auf französisch erzählen.
"Also, mein Lieber", sagte er, während ein bärtiger Diener frischen Tee brachte, "über Einzelheiten noch keine Verpflichtungen. Aber kommen Sie, kommen Sie! Man kann am Hof Ihrer Majestät schnell groß werden."
"Ich werde stets der dankbare Diener Eurer Exzellenz sein", erwiderte Francisco in der unterwürfigen Sprache, die nach seiner Beobachtung solche Leute erwarteten, "aber ich kann nicht, wie ich will. Die Religion gebietet mir, zu meinen Eltern nach Spanien zurückzukehren." Er wußte selbst nicht, wie er auf die Religion gekommen war, aber die Wendung dünkte ihn wirkungsvoll. Im Innern grauste ihm vor dem unbekannten grauen Norden.
"Nehmen Sie Ihre Eltern mit!"
"Die Einwilligung wird viel Zeit erfordern." Er stellte sich die Gesichter von Vater und Mutter vor. In ein fernes, fremdes Land, in dem zu allem hin – das sah man an den Heiligenbildern dieses Hauses – ein anderer Glaube herrschte...
Aber dann meldete sich doch die Versuchung dieses plötzlichen, unerwarteten Aufstieges. Er lenkte ein: "Eure Exzellenz fassen es nicht als Unhöflichkeit auf, wenn ich um einige Tage Frist bitte..."
"Sprechen Sie wieder vor..."
Der Gesandte verabschiedete den Besucher mit korrekter Höflichkeit, doch mit ausweichenden, halbzugekniffenen Augen: es war ihm peinlich, seinen fast in die Form einer Bitte gekleideten Vorschlag von einem jungen Bürger mit Zurückhaltung behandelt zu sehen. Man hätte die Sache doch durch einen Sekretär erledigen lassen sollen...
Ein schlechter Zufall wollte, daß es Angelica zwei Tage später gelang, heimlich einen Brief zu schreiben und ihn, mit Franciscos genauer Adresse versehen, unter dem Büßergewand aus dem Kloster zu schmuggeln. Ein kühner Griff unter das Kleid, ein entschlossener Schritt beiseite – und er war zusammen mit einem der Geldstücke, die sie die ganzen drei Wochen zu verbergen gewußt hatte, einem Straßenjungen eingehändigt, der sich sofort fröhlich aus dem Staube machte, denn die Münze war hoch. Was nützte den Nonnen ihr Entsetzen? Sie konnten nicht ermitteln, um was es hier ging. Ein Gruß persönlicher Art an eine kranke Freundin, sagte Angelica. Die Strafe des Ausschlusses von den Ausgängen für die Dauer eines Monats traf auf völlige Gleichgültigkeit ...
Der Brief enthielt Angelicas Versicherung, daß das Leben im Kloster nicht auszuhalten sei, die Aufforderung, sie so schnell als möglich zu befreien, und eine Beschreibung der wichtigsten Räumlichkeiten, dazu Angaben über die Stunden der geringsten Bewachung.
Francisco war glücklich, ein Lebenszeichen der Geliebten – mehr noch: die Versicherung ihrer Liebe und ihres Zutrauens in Händen zu halten. Die Selbstverständlichkeit freilich, mit der sie von ihm die Entführung aus dem Kloster erwartete, verursachte ihm einiges Unbehagen. Aber Ritterlichkeit war ein Bestandteil seiner Erziehung, seiner Überzeugung, seines Blutes. Er sah sich als Befreier aufgerufen. Eine andere Möglichkeit, als dem Rufe zu folgen, bestand nicht.
Immerhin meldete sich auch die Frage, was nach der Befreiung geschehen werde.
Und da schien ihm nun das Schicksal deutlich einen Weg zu zeigen: das Angebot des Grafen Korsakow mußte angenommen werden. Dann konnte man zu zweit nach Rußland fliehen.
Er bat schriftlich um eine neue Audienz, doch die Antwort ließ auf sich warten. Da handelte er so, als sei die russische Abmachung schon getroffen.
Es war ein unglückseliges Unternehmen. Francisco hatte einzig Agustín Esteve ins Vertrauen gezogen. Der sah schon fast eine Aufgabe darin, dem waghalsigen, vom Glück begünstigten Genossen keine Gefolgschaft zu verweigern, und wartete nun in einem Versteck unweit der Mauer, über die die Strickleiter hing, den Erfolg oder Mißerfolg ab ...
Als der Entführer mit einer abgeblendeten Laterne in der Hand kurz nach Mitternacht, während er die Nonnen in der Kirche versammelt glaubte, in den Schlafsaal der Zöglinge eindrang, weckte ein Geräusch zwei der Mädchen, die sofort zu schreien anfingen. "Bitte schweigt, es geschieht euch nichts!" flüsterte ihnen Francisco heftig zu und bemerkte im Halblicht, daß die eine sehr schön war. Aber schon eilte eine Nonne mit einer Laterne herbei. Francisco und sie, die in einem Mantel gehüllt, doch versehentlich ohne Haube war und darum ihre kurzgeschorenen Haare zeigte, starrten sich entsetzt an. Die Frau rief laut um Hilfe. Die Szene entwickelte sich. Einige von den Mädchen krochen unter die Bettdecke, andere drängten sich, mit langen, gespenstisch aussehenden Nachthemden bekleidet, in einer dunklen Zimmerecke zusammen.
Francisco, von den Ereignissen überrumpelt, hatte in diesem Augenblick eine unsichere, fast traumhafte Vorstellung der Gegenwart, aus einem dumpfen Untergrund heraus empfand er mehr, als er es dachte, daß es Notwendigkeit gewesen sei, sich in diese Lage zu begeben, und daß irgend etwas Weiteres geschehen werde und auch von seiner Seite zu geschehen habe. Dann kam ihm der halbwegs klare Gedanke, daß nun Angelica sich bekennen und an seine Seite eilen müsse.
Aber er wurde ihrer überhaupt nicht ansichtig. Sie war eine von denen, die unter der Bettdecke staken, denn sie gab, nachdem das Kloster alarmiert war, ihre Sache schon verloren und hoffte, durch solche Zurückhaltung als Mitglied der Verschwörung unentdeckt zu bleiben. Gerne hätte sie dem Liebhaber gezeigt, daß sie ihn als einen Tölpel erkannt habe, aber das ging nicht.
Er war Ritter genug, ihren Namen nicht zu rufen. Und erkannte plötzlich, daß er die Gelegenheit versäumt hatte, die Treppe hinabzustürmen und über die Mauer zu entfliehen. Denn jetzt drängte die Schar der Nonnen mit brennenden Kerzen die Stufen herauf, geführt von der Äbtissin, die dem Feind ihr ganzes Heer entgegenwarf.
Die Mädchen im Schlafsaal begannen sich sicherer zu fühlen und das Abenteuer von der romantischen Seite zu nehmen. Aus der Zufluchtsecke wurde heftig gekichert, die schöne Ruferin, die Franciscos bewundernden Blick wohl gefühlt hatte, richtete sich ein wenig im Bett auf, neben dem er noch immer stand, und versuchte mit ihm ein Wechselspiel der Augen zu beginnen.
Aber er bemerkte von solchen Dingen nichts mehr.
Angesichts der herandrängenden Ordensgewänder quoll plötzlich aus den Schächten seiner Seele, in die die Vorstellungsbilder der Kindheit, der Schule, der häuslichen Erziehung hinabgesunken waren, eine Welle religiöser Scheu und Ehrfurcht als etwas völlig Selbstverständliches hervor und versetzte ihn in einen Zustand der Hilflosigkeit. Er erschrak über das, was er mit den Scheuklappen der Ritterlichkeit vor den Augen getan hatte, und empfand das Peinliche und Lächerliche seiner Lage. Sein voller, genußfroher Mund bekam einen knabenhaften Zug.
Die Äbtissin, eine recht handfeste alte Dame mit einer Brille vor den Augen und einem goldenen Kreuz vor der Brust, ging zwischen zwei respektvoll um einen halben Schritt zurückbleibenden Schwestern auf ihn zu und fragte geradeswegs, was er wünsche. Das Kreuz blinkte im Kerzenschein. Er grüßte sie mit einem Kniefall, ohne zu antworten, und folgte dann ihren Anweisungen. Das heißt: er entfernte sich eilends aus dem Schlafgemach, ohne nochmals den Blick zu erheben, und ließ sich in ein kleines Zimmer mit vergittertem Fenster einschließen.
Am Morgen weckten ihn aus schwerem Schlaf päpstliche Sbirren und führten ihn durch die schon belebten Gassen der Stadt ins Gefängnis.
Der treue Agustín hatte vor den Klostermauern die ganze Nacht gewacht, auch die Unruhe der Nonnen bemerkt und böse Schlüsse daraus gezogen. Voll Entsetzen sah er nun den Freund in Fesseln abgeführt werden.
Ohne langes Besinnen tat er das Richtige: er ließ sich, so früh es die Stunde gestattete, bei einem Sekretär der spanischen Gesandtschaft melden.
Dieser benachrichtigte den Gesandten selbst. Don Miguel Trinidad erkannte sofort die Gefahr, die seinem Schützling drohte. Er war sehr ärgerlich über die Störung, aber er handelte unverzüglich: er verfaßte ein Schreiben an den päpstlichen Polizeimeister, dem der Verhaftete vermutlich unterstand, ehe sich die Gerichte mit der Sache befaßten, und erbat von ihm die persönliche Gefälligkeit, den Delinquenten der Justiz Seiner Majestät des Königs von Spanien auszuliefern. Dieses Schreiben übersandte er durch einen besonderen Kurier.
Noch vor Abend wurde Francisco gefesselt im Palast der spanischen Gesandtschaft abgeliefert. Mit ihm ein Schreiben des ersten Polizeimeisters Seiner Heiligkeit, das diesen Passus enthielt: "Sollten Eure Exzellenz auf strengere Maßnahmen verzichten wollen, so werden es Eure Exzellenz mit mir für opportun halten, daß sich jener F. Goya innerhalb von drei Tagen für immer aus dieser Hauptstadt entferne und sich auch während solcher Frist nicht auf der Straße blicken lasse, jedenfalls nicht bei Tag."
Don Miguel Trinidad führte mit dem freigelassenen Häftling ein Gespräch ohne Zeugen. Er stellte ihm vor Augen, daß die Verurteilung zu ein paar Jahren Kerker ein milder Ausgang seines Prozesses zu nennen gewesen wäre, das Gericht der Inquisition aber sehr wohl die Macht und die gesetzlichen Grundlagen besessen hätte, ihn für diese Klosterschändung an den Galgen zu bringen. Und er erlebte die Genugtuung, daß sein Gegenüber still und bleich wurde.
Aber dann spendete ihm der hagere Lebemann die Anrede Caballero und lud ihn ein, die zwei oder drei Tage bis zu seiner unumgänglich notwendigen Abreise im Palast der Gesandtschaft wohnen zu bleiben.
Francisco vertraute ihm den Vorschlag des Russen an. Don Miguel Trinidad schüttelte sich und deklamierte mit ritterlicher Betonung: "Alle Ehrfurcht vor Ihrer Majestät der Kaiserin ... aber lieber Bettler in Spanien als Fürst in Rußland!"
Francisco sprang auf. "Dies ist das Wort", rief er, "Spanien um jeden Preis ... selbst als Bettler in Spanien ... Beglückwünschen Sie mich, Exzellenz, ich werde morgen nach Spanien zurückkehren!"
Unmittelbar nach diesem Ausruf schoß ihm durch den Kopf, daß sich ja auch in der Heimat die Inquisition für ihn interessiere. "Warum sind Sie plötzlich so still?" fragte die Exzellenz. "Schlagen Sie sich doch das Mädchen aus dem Kopf! Sie finden schönere in Spanien."
Francisco lachte, er hatte Angelica vergessen. Zudem fand er zu einer hoffnungsvolleren Beurteilung der Lage zurück: sicherlich gab es genug Städte in Spanien, in denen er von den Behörden nichts zu fürchten brauchte.
Als er am Morgen vom Bett aus unter tiefblauer Luft die strahlend gelbe doppeltürmige Kirche Trinità de Monti, davor den roten Obelisken, dahinter dunkle Pinien über dem großartigen Anstieg der Freitreppe stehen sah, spürte er plötzlich, daß es nicht leicht sei, Rom zu verlassen. Auch nicht für den, der nach Spanien zurückkehrt ...
Aber dann ging es wie ein Ruck durch ihn: Heraus aus allem! Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als neu anzufangen!
4
Don Miguel Trinidad händigte seinem Schützling, den er den spanischen Gerichten überliefern zu wollen vorgegeben hatte, einen Paß ein, dessen reichliche Stempel und Empfehlungsklauseln jeglichem Zwischenfall vorzubeugen geeignet schienen, sowie als Kaufpreis für zwei weibliche Akte eine ordentliche Geldsumme, durch die Francisco ängstlicher Rechnerei enthoben wurde.
Als er in La Spezia ankam, befand er sich noch durchaus im unklaren darüber, ob er von einem italienischen oder französischen Hafen seine Rückreise nach Spanien beenden oder aber auch weiterhin und bis zum Ende den Landweg wählen sollte. Da lernte er Antonietta kennen, eine aus Neapel gebürtige Tänzerin, die sich um eine Stelle als Solistin bei der herzoglichen Oper in Parma zu bewerben beabsichtigte, nötigenfalls ins Österreichische, nach Mailand, weiterreisen wollte und bis auf weiteres das Leben durchaus von der heiteren Seite nahm – im Bewußtsein, daß sich aus ihrer Schönheit ausreichende Zinsen ziehen ließen. Sie gefiel ihm außerordentlich gut: er fand sie lustiger, scharmanter, gepflegter als die Frauen, die er bisher kannte, voll übermütiger Einfälle, erfinderisch in der Liebe. So entschloß er sich im Bewußtsein seiner Unabhängigkeit zu einem Abstecher nach Parma, der bestimmt außerhalb seiner Route lag.
Seine Papiere, von einem spanischen Diplomaten ausgestellt, wurden an der Grenze des von einem spanischen Infanten regierten Landes besonders respektiert. Von diesem Hochgefühl getragen, fuhren die beiden mit Extrapost in der Stadt Parma ein, ließen aber, um die Ausgabe wettzumachen, vor dem Goldenen Krebs halten – keineswegs dem ersten Gasthaus, wenn auch keiner Kutscherkneipe.
Der Wirt Cleopatro Descalzi, dessen grauer Rock eine Art Musterkarte und Aushängeschild für fette Küche bildete und dessen unterwürfigen Bücklingen nur sein Schmerbauch eine gewisse Grenze zog – Cleopatro Descalzi also bemerkte beim Abendessen, während er persönlich den Salat mischte, mit geflissentlicher Miene, der Herr Professor sei sicherlich wegen des Preisausschreibens der herzoglichen Akademie in dieser Stadt eingetroffen.
Francisco, der nicht wußte, wovon die Rede war, antwortete geistesgegenwärtig, daß seine Reise in der Tat teilweise damit zusammenhänge. Antonietta beeilte sich, mit großem Augenaufschlag hinzuzufügen, auch sie selbst sei Trägerin einer wichtigen künstlerischen Mission. Unter dem Tisch trat sie dem Freund heftig auf den Fuß. Zugleich brach sie aus dem Tafelbukett drei rote Nelken und schob sie sich in den Brustausschnitt.
Der Wirt schnaufte. Francisco lächelte und bestellte moussierenden Wein.
Am Morgen begab er sich an das Tor der Akademie und bat einen jungen Mann, dem er den Malschüler ansah, um Auskunft über das Ausschreiben.
Jedermann sollte zugelassen sein, doch lief die Frist in drei Tagen ab. Der Gegenstand der Darstellung war genau vorgeschrieben: "Der siegreiche Hannibal wirft von der Höhe der Alpen den ersten Blick auf die Gefilde Italiens."
Da Francisco den Namen in etwas unsicheren Umrissen nachsprach, wiederholte und vervollständigte der Ausgefragte seine Mitteilung: es handle sich um den karthagischen Heerführer, der gegen das antike Rom zu Feld gezogen sei. Seine höfliche Verbeugung sollte offenbar besagen, ein Fremder könne das ja unmöglich wissen, denn Hannibal sei eine spezielle Angelegenheit von Parma.
"Karthagisch, gewiß", repetierte Francisco.
"Oder punisch, wenn man will."
"Oder punisch ... jawohl ... übrigens wie steht es mit den Preisen?"