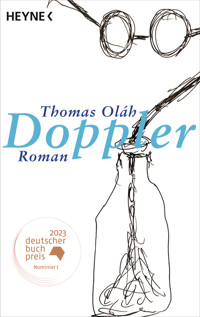
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Reifenplatzer. Als erstes fliegen die Boccia-Kugeln durch den Fahrgastraum, dann Mutti und Vati. Der unversehrt gebliebene Junge wird zu den Großeltern verbannt, sein Exil heißt: Frankenhayn. Ein Schelm, wer dabei an Frankenstein denkt – auch wenn das Dorf, in einer weinseligen Gegend Österreichs zu verorten, und sein Personal durchaus schaurige Züge aufweisen. Der Alkohol (serviert in monströsen Zweiliterflaschen, »Doppler« genannt), der Glaube (an die Kirche und Familie) und archaisch anmutende Traditionen spielen die Hauptrolle in diesem Sommer 1970, nach dem nichts mehr so ist wie vorher. Thomas Oláhs erster Roman ist ungeheuer komisch und nichts für schwache Nerven.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
„Mit dem Kümmelbraten ist es wie mit dem echten Leben: Das Grausliche muss man wegtun, dann aber findet man immer wieder was Schönes.“
Eine fremde Welt wartet in Frankenhayn auf den unterwegs in den Urlaub verunfallten Jungen: Für die Großeltern, nächtens in Sarkophage ohne Deckel gebettet, scheint es die normalste Sache der Welt, das Herz eines Schweines zu verspeisen, das eben noch fröhlich vor sich hin quiekte. Dazu trinken sie Wein mit einer Andacht, die sehr an den Pfarrer und sein sonntägliches Ritual erinnert. Überhaupt steht das Katholische in innigster Verbindung mit dem Alkoholischen. Und dem Diabolischen:
Die beiden Cousins, zwei Flaschen, wie sie im Buche stehen, lassen keine Gelegenheit zur Grausamkeit an Mitmensch und -tier aus. Die Flaschen wiederum, die auf den Tisch kommen, sind von monströser Größe: zweilitrig, Doppler genannt, geradezu emblematisch für diesen Sommer 1970.
Die Autor
Thomas Oláh, geboren 1966 in Wien, lebt und arbeitet in Wien und Berlin als Kostümdesigner für Kino und TV sowie als Kulturhistoriker mit dem Schwerpunkt Modetheorie / Geschichte des Körpers. U. a. hat er mit Leander Haußmann in „Kabale und Liebe“, mit Oskar Roehler in „Jud Süß“, mit Detlev Buck in „Die Vermessung der Welt“, mit Shirin Neshat in „Women without Men“ (Silberner Löwe in Venedig) und mit Brad Anderson in „Stonehearst Asylum“ gearbeitet. 2013 wurde er mit dem Österreichischen Filmpreis für „Die Vermessung der Welt“ ausgezeichnet, ferner erhielt er mehrere Nominierungen zum Deutschen Filmpreis. Zuletzt erschien „Wozu mich das Glück noch brauchen wird? Leben und Sterben des Herrn Winckelmann in sechs Monologen“ (2017). „Doppler“ ist sein Romandebüt und wurde für den Österreichischen (Kategorie: Debüt) und den Deutschen Buchpreis nominiert.
Thomas Oláh
Doppler
Roman
Wilhelm Heyne VerlagMünchen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Thomas Oláh
Copyright © 2023 by Müry Salzmann Verlag, Salzburg und Wien
Copyright © 2024 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Lektorat: Silke Dürnberger
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, nach einer Vorlage von: © Müry Salzmann Verlag
Titelbild: Zeichnung von Günter Brus (»Thomas, ich kenne deinen Stammbaum«), Detail
ISBN 978-3-641-32274-8V001
www.heyne.de
Fallen
In meiner Erinnerung ist alles still, kein Geräusch zu hören, Teile fliegen durch das Innere des Wagens, Muttis Schlüsselbund mit dem silbernen Anhänger, ein Apfel. Und sogar die hölzernen Boccia-Kugeln, sechs Stück zu je knapp einem Kilo; in deren Mitte das kleine, rote Pallino, in einem Plastikkäfig gefangen, ein solides Paket. Und das schwebt jetzt durch den Fahrgastraum. Das schöne Wochenende wird so nicht stattfinden, das sieht auch Vati ganz klar, während er am Lenkrad herumreißt, obwohl er längst die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat. Das sieht Mutti, einen stummen Schrei im Gesicht, die ihre beiden Kinder nicht festhält, sondern in den schwarzen Fußraum zwischen Vordersitz und Rückbank drückt, sie in Deckung bringt, weil das Unvermeidliche immer näherkommt. Zunächst für Mutti. Die Boccia-Kugeln steuern auf einen unsichtbaren Zielpunkt oberhalb ihrer rechten Augenbraue zu, während der Wagen vom rechten an den linken Fahrbahnrand und wieder zurück an den rechten geschleudert wird, hochschaukelt – die Räder links weit vom Boden abgehoben –, plötzlich wieder die Richtung ändert und herumreißt auf die andere Seite. Die Landstraße ist jetzt ein schmales Band, und bald wird es uns abwerfen. Noch weiß Vati nicht, ob nach rechts oder links, der Abgrund ist beiderseits beachtlich und der Crash unausweichlich. Ich freue mich aufs Ende, nicht auf das, was dann kommen wird, sondern darauf, dass das wilde Geschaukel und Gewerfe endlich ein Ende hat, mir ist übel.
Schon trifft das kompakte Paket der Kugeln knackend Muttis Stirn, und das kleine Auto hebt ab, noch eine bockige Wende einleitend, die Kiste fährt jetzt fast senkrecht stehend auf zwei Rädern, verlässt den geteerten Boden, ich kann den Himmel, den strahlenden, augustblauen, wolkenlosen Himmel durch das Seitenfenster sehen, Mutti hat ihren Kopf für einen Moment nach hinten gekippt, als ruhte er auf der Hutablage, und die Boccia-Kugeln haben ihre Richtung geändert und streben jetzt vorwärts auf die Windschutzscheibe zu, da trifft ein harter Schlag meinen Rücken, für einen Augenblick ist der Flug zu Ende. Doch hebt das Auto wieder ab, ein neuerlicher Sprung, jetzt in die andere Richtung drehend, ich glaube, ich muss mich gleich übergeben – ich habe Autofahren nie vertragen –, habe aber keine Tüte zur Hand, ich bin so müde, ich werde nicht kotzen, ich schlafe ein.
Der Lärm weckt mich, Schluss mit Stille, jetzt ist das Leben prall zurück. Eine heiße Sonne, die harten Erdschollen des Feldes drücken, alles voll mit Krumen, auch in der Hose, unter meinem Lieblings-T-Shirt mit lassoschwingendem Cowboy-Aufdruck, ich will auch reiten, über die Felder, die ich vor mir sehe. Vati läuft kreuz und quer über den Acker, sucht etwas, findet einen Schuh, es ist seiner, aber er zieht ihn nicht an, lässt ihn achtlos von seiner Linken baumeln, was sucht er denn?
Mutti liegt seltsam verdreht, ihr Blick gegen den wolkenlosen Hochsommerhimmel, sie träumt, wovon nur, spricht im Schlaf, unverständlich, klagend, warum wischt sie sich das Blut nicht von den Augen, du kannst doch gar nichts sehen. Wisch dir das Blut doch ab, Mutti.
Ich werde hochgerissen von einem Fremden, wo kommt denn der jetzt her, unverständlich spricht er auf mich ein, aufgeregt, mit einem fremden Akzent, wo trägt er mich hin, was macht er hier, schleppt mich die Böschung hoch, ich will sein Gerede nicht hören, alles soll gut sein, das sieht aber gerade nicht so aus, der ist ja ganz durcheinander, er stolpert, wir fallen, ich mache mich los, will zu Vati, ihm helfen zu finden, was er sucht.
Es könnte so ruhig sein hier, wenn man uns ließe. Mutti wird wieder aufwachen, Vati alles finden – meinen Bruder habe ich vergessen. „Welcher Bruder, wo ist der, wie alt?“, schreit mich der Fremde an. Mutti hat ihn unterm Sitz versteckt.
Die müde rufende Sirene des näherkommenden Rettungswagens weiß schon, dass sie nicht mehr zurückfinden werden ins Leben der Anderen, die jetzt tanzen und Würstel essen am Kirchtag in Frankenhayn, die Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen. „Wo bleiben die denn?“, wird Großvater bald fragen, und Großmutter wird sagen: „Sie werden schon kommen.“ Aber sie werden nicht kommen, nicht heute und vielleicht nie mehr. Nichts wissen sie von dem, was ich hier sehe. Die Krumen in meinem Mund weichen sich auf zu einem Brei, der seltsam metallisch schmeckt. Ich kann das nicht schlucken. Vor dem Wirtshaus steht eine Bude, ein fahrender Händler, der nicht nur Süßigkeiten verkauft, sondern auch Westerngewehre, ich kann mich nicht entscheiden: für einen nietenbeschlagenen Gürtel mit zwei Halftern, tief hängend, mit einem kleinen Bändchen am Schenkel festgebunden, so kann man sie leichter ziehen, die beiden silbernen Colts. Oder für eine Silberbüchse. Aber ich werde gar nicht auf dem Kirchtag sein, ich bin aus allem hinausgeworfen, habe keine Verbindung mehr zur Welt. Wo ist mein Bruder?
Ich sitze in einem fremden Wagen, oberhalb der Böschung am Straßenrand geparkt, die Tür offen, meine Beine baumeln über dem Gras, das die Füße kitzelt durch die offenen Sandalen, Lieblingssandalen, aus dunkelrotem Leder, stellenweise fast schwarz, zu ganz persönlichen Skulpturen geformt vom vielen Laufen durch den Sommer, Frühsommer, der voller Versprechen war, aber heute zu Ende ist. Von hier oben habe ich einen guten Ausblick über die steile Böschung: unten im Feld unser Auto, die Kiste, wie Mutti es nennt, liegt auf dem Dach, ich sehe die Eingeweide seiner Unterseite, gewundene Rohre, Streben, Ausbuchtungen, das obszöne Innenleben des Vehikels, das seine Familie in den Abgrund warf. Ein Austin Morris 1100 in hellgrau, auch Jochen Rindt fährt englische Autos, aber mit mehr Erfolg als wir. Noch.
Vati ist weg. Hat er gefunden, was er suchte? Mutti träumt weiter, jetzt zugedeckt mit einer karierten Decke, Schottenkaro, ganz feine gelbe Streifen zwischen breiten roten und schwarzen Balken, seltsam öde rechtwinkelige Anordnung.
Das klagende Heulen der Sirene kommt näher – Bitte ausmachen, nicht diesen Sommermittag stören, bitte, ich werde nie wieder Würstel am Kirchtag essen, es wird mir ohnehin immer übel davon. Jetzt ist mir nicht mehr übel, ich habe aber auch keinen Hunger. Ich will nicht weg von hier, doch diese Riesenhände, Arme zwingen mich ins strahlend weiße Innere des Rettungswagens. Stechender Geruch nach Alkohol, kein Putzmittel, klarer, eindeutig. Gelegentlich chromblitzende Akzente, die Sirene weint weiter, Mutti neben mir, auf einer Liege, ganz verschmiert ist ihr Gesicht, mit Blut und Erde verklebt. „Nein, nein, oh nein. Nein“, weint sie. Vati sitzt mir gegenüber, sein Haar zerrauft, und hält die Decke im Arm, zum Bündel gerollt. Ist da mein Bruder?
Ich hätte auf diesem Feld bleiben wollen, es wird nicht besser werden dort, wo wir jetzt hinfahren, auch der Cowboy meines T-Shirts ist blutverschmiert, der Erdenschleim im Mund wird zu viel, und mir wird schlecht.
Einschlagen
Auf eine geheimnisvoll verschlungene Weise fühle ich mich schuld an dem Unglück. Die Auflösung liegt zum Greifen nah, dennoch kann ich sie nicht sehen. Wie ein Traum, kurz nach dem Erwachen präsent, aber die eigentliche Handlung nicht mehr rekonstruierbar, entglitten, die Aufregung noch in den Knochen. Auch wenn außer mir niemand bemerken sollte, wie alles zusammenhängt, der Strafe werde ich nicht entgehen, da bin ich ganz sicher. Für jede Freude ist ab jetzt ein Preis zu bezahlen, für jedes kleine Geschenk wird mir etwas genommen werden. So liegt von nun an im Schönen immer auch ein wenig Angst.
Das Krankenhaus ist ein weißes Gefängnis, jedenfalls von innen betrachtet. Die Patienten sind Insassen, Gefangene ihrer Hinfälligkeit, bestätigt durch vergitterte Fenster und versperrte Türen.
Kinderstation heißt der hohe, kahle Raum. Die Spielsachen liegen wie Krümel auf Betten und Boden herum. Acht Betten in einem Zimmer, in jedem ein kleiner Patient, der mit großen Augen die freudlose Lage betrachtet, bewacht von nüchternen Schwestern, die stets zu laut sprechen und seltsame Faltschachteln wie Nester in ihren hochtoupierten Haarkronen tragen.
Die Tür zu diesem Verlies hat innen zwar keine Klinke, dafür aber ein Fensterchen eingelassen, auch das nur von außen zu öffnen. Und ein kleines Brett in Kniehöhe von Erwachsenen, darauf hätte man seine Tasche abstellen können, wär’s im Laden gewesen, hier aber werden nackte Kinderfüße daraufgestellt, damit die kleinen Kranken durch das Fenster ihren gesunden Besuch sehen können. Und umgekehrt. Gelegentlich geht das Fenster auf, und kleine Gaben werden hindurchgereicht. Zu sagen gibt es nichts, und Tränen sind sinnlos. Die Besuchszeit ist fünfzehn Minuten täglich, doch wochentags kommt niemand, und selbst am Wochenende könnten die kleinen Patienten nicht sagen, ob das zu kurz ist oder eigentlich viel länger als erträglich.
Die Kinder ergeben sich drinnen ihrem Schicksal wie die Alten draußen. „Es ist wie es ist. Mutti ist fort, sinnlos, auf eine Rückkehr zu hoffen“, das sehe ich in den Augen meiner mich besuchenden Verwandten. Alle sieben Onkel und die dazugehörigen Tanten sind da, allerdings ohne Cousins und Cousinen, Kinder dürfen nicht ins Krankenhaus, vermute ich, spüre das kalte Trittbrett unter meinen Füßen und schaue wortlos durch das kleine Fenster auf Kopftücher, Hüte, jemand tupft sich mit einem rosa gerahmten Taschentuch die Nase, dann die Augen. Das Fenster bleibt zu, es gibt nichts zu sagen. Sie sind mir fremd, meine Blutsverwandten. Sie sind gar nicht meinetwegen hier, das spüre ich, die Kinderstation liegt nur auf dem Weg. Wohin?
Ich weiß nicht, wie viele Tage ich dort schon zubringe, was es zu essen gibt, ob je ein Arzt nach mir sieht. Ich bin gestrandet, weiß nicht weiter und will nur weg. Was ich nicht ahne: dass dies das mich bestimmende Gefühl bleiben sollte, für lange Zeit.
„Abgeholt wirst. Weil Entlassung ist. Heute. Also.“ Hellgelbbraunes Plastik, mit Reißverschluss und langen Henkeln landet schwungvoll auf meinem Bett. Kleider, die mir bekannt sind, kommen zum Vorschein, aber diese hässliche Tasche ist mir noch nie begegnet. Auch meine Lieblingssandalen sind da, frisch geputzt. Eine weniger beliebte Hose aus breitem, dunklem Cord mit leichtem Schlag, ein T-Shirt, damals noch Leiberl genannt, mit Aufdruck. Leider nicht der Cowboy, den sollte ich nie wieder sehen. Stattdessen zwei gekreuzte Flaggen, schwarz-weiß kariert, darunter: Racing Club.
Von Gehirnerschütterung hatte ich bis zu diesem Krankenhausaufenthalt noch nicht gehört, mir gefällt aber der schwere Ernst des Wortes. Nicht so technisch wie Schädelbasisbruch oder gar flapsig wie Milzriss. Gehirnerschütterung beinhaltet einen tiefen seelischen Aspekt, und mir ist klar, dass diese Erschütterung mich und meine Welt für immer verändern wird. „Gehirnerschütterung –“, sage ich also in dunklem Ton, wann immer ich in den nächsten Wochen gefragt werde, was mir passiert sei bei dem Unfall, dem fürchterlichen. Und setze mit kleiner Pause nach: „ – schwere.“
Dazu weiß mein Onkel mit dem wilden Auge nichts zu sagen, und ich frage mich, hat er das Wort nicht verstanden oder ist er mit der Tragweite der Diagnose nicht vertraut. Schweigend fährt er den Wagen, mein Abholer, der mich vom Krankenhaus ins Dorf bringt, sein Dorf, von dem ich noch nicht weiß, dass es auch mein Dorf werden wird. Es ist die erste Frage und zugleich der letzte Satz, den dieser Onkel in diesem Sommer an mich richten wird: „Was ist dir passiert?“ Ihn möchte ich das auch fragen, fasziniert von der Asymmetrie seines Blickes, sein linkes Auge glotzt weit aufgerissen steil nach oben, während das rechte schmal und teilnahmslos auf mich herabschaut. Wie der Krampus, nur ohne Fell. Und kein Nikolaus weit und breit. Ich möchte wegschauen, mich abwenden, umdrehen, die Augen zumachen und vielleicht einschlafen. Aber das geht nicht, eine Nackenstarre klemmt meinen Blick fest auf den Onkelkopf, ich schaue abwechselnd ins linke hochgedrehte, dann wieder ins rechte zugekniffene Auge.
Sein graues Auto hat drei Sitzreihen und an der rechten Seite eine große Schiebetür. Der Motor sitzt ganz hinten und klingt aufgeregt, vor Anstrengung kreischend. In der Mitte des Lenkrads – ungewöhnlich flach, fast waagrecht wie bei einem Lastwagen angebracht – ist eine unter Klarsichtlack glänzende Vignette zu sehen: ein seltsam eckig gezeichneter Wolf, der auf einer Burg mit Türmen steht. Es scheint weniger ein Auto als ein rollender Behälter, ein fahrender Kasten zu sein. Mit leicht verächtlichem Unterton wird es von allen Bus genannt.
So also geht’s ins Exil. Meine Verbannung heißt: aufs Land, ins Dorf. Zu Großmutter und Großvater, in deren kleines Haus, das sich wegduckt unter einem zu großen rotbraunen Dach. Wie ein brüchiges Zelt aus tönernen Ziegeln, mit grauschwarzen Flecken von Flechten und moosig-grünen Einsprengseln breitet es sich über die Behausung. Vier Fenster schauen zur Straße hin, jedes ist mit einem weißen Kalkband eingerahmt und setzt sich so vom blassgrünen Anstrich der Fassade ab. Mittig die Eingangstüre mit undurchsichtiger Glasfüllung. Und ganz rechts ein braunes Holztor, steil abfallend darunter die Einfahrt zum Hof, der viel tiefer liegt als die Straße und so eine diskrete Asymmetrie schafft: vorne raus klein und geduckt, von hinten betrachtet eineinhalb Geschosse höher.
Die Häuser rundum kenne ich wie auch die meisten Einwohner des Dorfes von Besuchen als Feiertagsgast dem familiären Kalender der Verpflichtungen entsprechend: Ostern, Kirchtag immer Anfang August, Stefanitag. Die Großeltern, deren sechs Kinder, fünf davon verehelicht, und die 16 Enkelkinder, alle in ihrer Küche, die eigentlich kaum Platz für zehn bietet, essend und trinkend, das ist das großelterliche Ideal von feierlichem Zusammensein. Sie werden stets nur Vater und Mutter gerufen, auch von den Enkelkindern. Ein verniedlichendes Opa oder Großmutti wäre keinem auch nur im Scherz eingefallen, sie sind die beiden unerschütterlichen Konstanten unseres jungen Lebens. Schon die Vorstellung, dass sie jemals jugendlich und agil gewesen sein könnten, scheint absurd, sie sind nicht anders denkbar als mit behäbigem Gang. Monumente der Unveränderlichkeit. Weit weg, sehr weit weg ist ein Ende zu befürchten, aber bis dahin ändert sich nichts. Und deshalb heißen sie: Mutter und Vater.
Diese Statthalter meiner Verbannung empfangen mich jetzt im Zentrum ihrer häuslichen Existenz – wo sonst –, in ihrer Küche, mit einer Herzlichkeit, als gäbe es auch nur irgendeinen Grund zur Freude. Umarmen, drücken, über den Kopf streichen, auftischen, brotstreichen, apfelschälen, einschenken. Das in Schnitten geteilte, dick belegte Brot heißt hier: Reiter. Die verzehre ich jetzt und bemühe mich, dabei den Ausdruck des Widerwillens gegen alle Verlockungen konsequent aufrechtzuerhalten.
Mutter und Vater, sie sagen nichts, und ich traue mich nicht zu fragen. Ich will die Antwort gar nicht hören, meine Hoffnung nicht zerstört sehen. Den Lauf der Dinge anhalten, das will ich, hier mit Reiter, Vater, Mutter, den Moment so sehr dehnen, dass das, was längst geschehen ist, erst viel später einschlagen kann, mich treffen und verletzen.
Alle Reiter werde ich zerbeißen, verschlucken, und Mutter wird neue hinstellen, das ist der Lauf der Welt, und wenn wir gar keine Lücke zwischen den Augenblicken aufkommen lassen, wird alles so bleiben, wie es ist, es ist nicht gut, aber das noch viel Schlimmere wird draußen bleiben, draußen, wo es Sommer ist, die Schwalben tief fliegen und alles nach Schweinemist riecht. Mein Sommer ist das nicht, ich habe das nicht gewollt.
Mutter trägt wie immer einen geblümten Kittel, davon muss sie unzählige haben. Einer gleicht dem anderen nur auf den ersten Blick, dem aufmerksamen Betrachter offenbart sich ein Panoptikum der Kittelwelt, die hier übrigens Schürzen genannt werden, obwohl es auch Schürzen gibt, die wie Schürzen aussehen und auch so heißen, aber dann sind da eben noch die Kleiderschürzen, und das meint die Kittel, kurz Schürzen. Alle Exemplare ihrer Kleiderschürzensammlung haben vorne einen Verschluss, zumeist Knöpfe. Allerdings gibt es auch einige modernistische Exemplare mit Reißverschluss, immer mit zwei Taschen in Hüfthöhe und in einem Blumenmuster, das zwischen subtil kleinteiliger Zweifarbigkeit und psychedelischer palatschinkengroßer Buntheit eine Vielzahl von Abstufungen kennt. Schürzen trägt Mutter immer, außer sonn- und feiertags. Und beim Kirchgang jedweden Anlasses natürlich sowieso nicht, aber ansonsten stets und immer in Kombination mit einem Kopftuch. Das Haupt zu bedecken, gehört sich so, und alle halten sich daran, auch die Männer im Dorf gehen nie barhäuptig, draußen, auf der Gasse.
Im Haus, unter sich, ist man ohne Hut, und als Ausdruck des Respekts nimmt man den Hut auch auf der Straße ab vor Leuten, die ein Amt bekleiden, das jenen vorbehalten ist, die diesen Respekt verdienen. Der Hut, das Kopftuch der Männer – beweglich im Gegensatz zum Damenstück –, wird für den Herrn Doktor oder Hochwürden bei jeder flüchtigen Begegnung ehrerbietig kurz gelüftet, die vermeintliche Ergebenheit durch Entblößung andeutend. Für seinesgleichen bleibt der Hut auf dem Kopf, lediglich der Zeigefinger, gestreckt, wird kurz an die Krempe gelegt, wie ein verblödelt-militärischer Gruß. Jüngere Männer unterlassen, genauso wie die Frauen, eine Bewegung von Hand und Hut, zeigen lediglich ein schräges Nicken, als würde im Nacken etwas ganz leicht jucken, das den Aufwand, mit der Hand hinzugreifen und mit dem Finger zu kratzen, gar nicht lohnte, als ließe es sich wegnicken.
Und so ergibt sich eine gewisse Ordnung durch das Reglement der Hüte und des Anhebens derselben über die Jahre, und auch wenn heute keiner mehr so recht weiß, warum er wann was tut mit dem Hut, die Gepflogenheit ist in Fleisch und Blut übergegangen und der Kopf bleibt bedeckt. Das hilft, einen Rest von Form der Welt entgegenzustellen, die anderswo längst aus den Fugen ist.
Wie alle Männer im Dorf, die Status und Bedeutung haben, krönt auch Vater etwas, das hier als Fleischhaube bezeichnet wird. Ein absolut haarloser wie blank polierter Scheitel, umzäunt von einem dünnen Haarkranz, der stets eine deutlich sichtbare Einkerbung ringsum zeigt: den Abdruck konsequenten Huttragens.
Trotzig steht das Brett von der Wand ab, auf dem der Hut ruht, wenn er nicht im Dienst ist, hölzerner Platzhalter für Vaters Haupt und Haube. So gewiss wie der nächste Tag auf die Nacht folgen wird, so wird der Hut von der alten Hand wieder auf den kahlen Schädel gesetzt, hierhin und dorthin getragen, gelegentlich angehoben oder in den Nacken geschoben. Nichts, das nicht schon hundert Mal getan worden wäre und über die Jahre nichts hinterließ als abgegriffene Stellen, dunkel verfärbt und speckig glänzend, Fett und Filz.
„Zeit ist es. Gehen wir.“
„Ich will aber nicht. Weil ich bin noch gar nicht. Müde.“
„Bei der Nacht legen sich die Leute nieder. Und wenn’s Tag ist, steigen sie wieder auf. Gute Nacht.“
Beim Zubettgehen zeigt Mutter ihr Haar: Verflochten zu einem Strang von beeindruckender Länge, bis ins Kreuz hängt ihr der Zopf und schwingt ganz sanft im Rhythmus ihrer Schritte, rechts-links. Rätselhaft kommt mir das vor, während ich hinter ihr hertrotte, wie sich so viel Haar tagsüber unter einem so kleinen Kopftuch versteckt.
Das großelterliche Nachtlager: zwei Sarkophage ohne Deckel, Stoß an Stoß gestellt, das schwere Holz dekoriert mit allerlei Schnitzereien. Die mit gewundenen Säulen und kannelierten Applikationen besetzten Kopfteile des Bettes werden Betthäupter genannt. Ähnlich ornamentiert, aber weniger hoch die Wand am Fußende, dahinter völlig schmucklos meine Liegestatt. Tagsüber zur unbenutzten Sitzbank geknickt, abends die Lehne umgeklappt, ergibt das eine Liege, die mittig durch eine lange Ritze geteilt ist. Beiderseits wölben sich Backen hoch, ein rechtwinkeliger Hintern gewissermaßen, in dessen Spalte im Laufe der Nacht früher oder später der schlafende Körper rutscht. Doch genau das gilt es zu vermeiden, ich will nicht, niemals in der Ritze schlafen, so ist der Ehrgeiz meiner jungen Jahre. Viel lieber obenauf, doch auf keiner der beiden, sanft gerundet wie sie sind, gibt es auf Dauer Halt. Versucht muss es aber werden: die linke Backe gewählt, einen Fuß in die Ritze gestemmt, den anderen am Boden neben dem Bett abgestellt, die Arme unterm Kissen hinterm Nacken verschränkt, so kann dem Ritzenschlund der Bett-Po-Bank widerstanden werden. Bloß schlafen kann man so nicht. An Schlaf ist schon allein der Wanduhr wegen ohnehin nicht zu denken. Zeitlupenlangsam schwenkt das messingglänzende Pendel in seinem gläsernen Gehäuse, der Perpendikel, wie Vater es nennt, von einer Seite zur anderen, um mit einem verhaltenen Tick die bevorstehende Richtungsänderung anzukündigen. Einen Moment hält das Pendel inne und schwenkt langsam in die entgegengesetzte Richtung, bis: Tack. So geht es endlos dahin von rechts nach links und wieder retour. Tick. Tack. Diese Nacht nimmt kein Ende. Tick. Tack. Das sind die Sekunden des Lebens, wie sie hier im Exil der Verbannung vergeudet werden. Vater kümmert das nicht, er schnarcht genauso regelmäßig wie die Pendeluhr, nur lauter. Und nicht im Takt mit ihr. Zwei Monumente der unerschütterlichen Gleichförmigkeit, unversöhnlich im sturen Streit miteinander. Wer wird zuerst kapitulieren und sich dem Takt des Gegners unterwerfen? Vater hält die Augen geschlossen, den Mund aber offen, ganz der Regelmäßigkeit des laut flatternden Gaumensegels verpflichtet. Da spannt sich etwas an im Uhrkasten, als würde eine Feder aufgezogen, an einer kleinen Kette ein schweres Gewicht hochgezogen, mit größter Anstrengung und letzter Kraft. Dann erleichtert sich der Apparat in einem zurückhaltend angeschlagenen und leise verhallenden: Gong. Das Zeichen für ein Viertel, um Halb gibt’s zwei, zu Dreiviertel naheliegender Weise drei, aber richtig wild wird es zur vollen Stunde. Die Glaskastenuhr entlädt die ganze, über sechzig Minuten aufgestaute Anspannung – nein, nicht bloß in vier milde verhallenden Gong-Schlägen, das war nur der Auftakt zu einem höheren, mit weit größerem Hall belegten Ging-Schlagen. Für jede volle Stunde ein Ging. Das gibt um Mitternacht ein wahres Fest. Beim dritten Ging wird Vater unruhig, die Gongs hat er stoisch durchgestanden, jetzt aber setzt ihm die Bedrängnis zu – für zwei Schläge fällt sein Schnarchen aus, da: Ging. Gewonnen! schlägt die Pendeluhr zurück. Vater setzt wieder ein, lauter, tiefer als zuvor – Ging. Das zählt nicht mehr. Wer einmal aus dem Takt geraten ist, der hat verloren. Ging.
Jetzt wirft sich Mutter im Schlaf auf ihre andere Körperseite, die Sprungfedern ihrer Matratze stimmen ein kleines Liedchen an – Ging!Ich allein musizier’ hier, schlägt die Uhr mitten drein.
Soll sein, schnarcht Vater, du hast gewonnen, alte Uhr. Aber jetzt ist eine Ruh’.
Und da bemerke ich, dass inmitten dieser nächtlichorchestralen Abgelenktheit passiert ist, was nicht hätte geschehen dürfen: Mein Bubenkörper ist abgerutscht, hinein in die Ritze dieser Bett-Po-Bank, gefallen und stürzt noch, schwerelos, rücklings.
„Das Pendel des Grauens“, flüstert es in meinem Ohr, „täuscht durch tickende Gleichförmigkeit eine Seelenlosigkeit nur vor, hinter seiner mechanischen Berechenbarkeit aber wohnt das Prinzip des Bösen, sinnlos, doch blutrünstig, das dann, zum rechten Zeitpunkt, auf Schlag und Gong mit Ging hervorbrechen und alles Lebendige auslöschen wird.“
Solch apokalyptische Visionen zwingen mich letztlich zum Handeln: Als heroischen Akt sehe ich es, mein Kissen, hier Polsterl genannt, fest zu umklammern, die steil aufragende Wand am Fußende des großelterlichen Lagers zu überwinden und zwischen den warmen, in Nachthemden gehüllten Leibern meinen Schutz zu finden. Doch was erwartet mich dort: eine Ritze. Ein Spalt der Leere zwischen den väterlich-mütterlich geteilten Matratzen. Kapitulation, Ende der nächtlichen Schlacht, ich lasse mich fallen, in die Ritze, rücklings ins Nichts. Schwerelos. Fallen ist schön, wenn man nicht ans Aufschlagen denkt. Was ich da noch nicht wissen kann: Sarkophag heißt genau genommen fleischfressend. Steht das in irgendeinem Zusammenhang? Und was haben hölzerne Ehebetten mit steinernen Särgen gemein?
Tick.
Was ich da alles noch nicht wissen konnte.
Tack.
Das hätte mir auch nicht weitergeholfen.
Tick.
Die Geschichte vom Ende der Pendeluhr.
Tack.
Schauen zwei Männer auf dasselbe, sehen sie noch lange nicht das Gleiche.
Tick.
Ein Doppler der Bedeutung.
Tack.
Moment
Aus einer spontanen Laune heraus greift Dietrich Nikolaus Winkel nach dem Perpendikel, hält es still, befreit es aus der Aufhängung und stellt es auf den Kopf. Jetzt ist das runde Metall oben, und kurz vor dem anderen Ende des Gestänges soll der Drehpunkt sein, darunter ein solides Konterstück. Wenn er dann noch das obere Gewicht verschiebbar macht, dann kann man das Tempo des Taktes frei wählen. Damit kann jedermann sein ganz persönliches „Memento mori: Höre, wie deine Lebenszeit verticktackt!“ einstellen und seinen bislang nur innerlich spürbaren seelischen Takt für alle anderen vernehmbar machen. „Winkels Chronometer“, so sieht er schon die Überschriften in den Journalen, die seine Erfindung feiern werden.
Sein Versuch, den Geist der Romantik mit den Mitteln der Bureaucratie in einen Rahmen zu fassen, das ist schon eine schöne Idee, die aber leider niemand versteht, die Romantiker nicht und die Verwalter der Industrialisierung auch nicht. Und das macht Dietrich Nikolaus Winkel traurig und einsam.
Als er eines Tages vom bevorstehenden Besuch des legendären Schachtürken liest, beschleicht ihn eine Ahnung, die sich binnen kurzem zu einem starken Gefühl auftürmt. Er spürt, weiß es: Zwischen seiner einsamen Seele und jenem Türken besteht eine geheime Verbindung, eine transzendentale Verwandtschaft. Die allermeisten seiner Zeitgenossen würden über diese Anwandlungen wohl nur lachen, denn der Schachtürkeist ein Automat, eine seelenlose Maschine. Die lebensgroße Puppe ist „alla turca“ kostümiert, sitzt vor einem Schachbrett und wartet auf den Eröffnungszug des – menschlichen – Gegners. Und dann. Aus der großen Kiste, auf der das Brett steht, dringen Geräusche drehenden Mahlens von Räderwerk, von Federn, die sich anspannen und tick-tack klicken, bis sich die linke Hand der Puppe hebt, eine Figur greift, den Zug ausführt, um schließlich wieder auf dem kleinen brokatenen Kissen neben dem Spielbrett zu liegen zu kommen.
Der Präsentator dieser Maschine, ein gewisser Johann Nepomuk Mälzel, steht eine gute Armlänge entfernt, und man könnte nicht sagen, ob er die Spielzüge des automatischen Türken nur kritisch beobachtet oder, durch irgendeine metaphysische Konnexion mit der Maschine verbunden, diese insgesamt befehligt.
Winkel ist in Bann geschlagen, er sieht bei mehreren Partien zu, die allesamt der Automat gewinnt, und während zunächst die Zuschauer, bald aber die halbe Stadt darüber rätseln, wie dieses Wunderwerk bloß funktioniert, nicht nur mechanisch und motorisch, sondern vor allem, wie eine Maschine imstande sein kann, besser Schach zu spielen als jeder Mensch, da weiß Winkel, er hat die Tiefe seiner Jahre durchlitten und seine Einsamkeit bezwungen, denn im milden Lichte dieses Nachmittags, da hat er endlich einen Bruder gefunden.
Wie gut kennt er dieses Gefühl der in mechanistischen Bewegungsabläufen eingeschlossenen Seele, die Momente, die sich zu sauber geordneten Stunden aufbauen, zu Tagen verbinden und sich wie ein Räderwerk mit den Handlungsabläufen der anderen verzahnen.Genau das ist Winkel bisher nicht gelungen, jedenfalls nicht reibungslos, weil – das sieht er deutlich – keiner außer ihm selbst sich an die Ordnung hält: Schon eine leichte Verlangsamung im Gefüge reicht aus, um ein gewaltiges Knirschen zu produzieren, ein Stocken in der komplizierten Maschinerie des Alltags. Und das treibt Winkel immer weiter hinaus auf die endlosen Ebenen der Einsamkeit: Nur er selbst kann seinen Ansprüchen genügen.
Und jetzt der Automat, als Türke kostümiert zum Gaudium fürs Volk. Winkel blickt tiefer und erkennt als einziger die wahre Schönheit des Automaten, die Perfektion des Melancholischen, den geordneten Ausdruck reinen Willens. Jetzt endlich ist Winkel nicht mehr allein.
Das muss er dem Präsentator des Automaten, diesem Mälzel, sagen, der soll wissen, dass er, Winkel, verwandt ist mit dem Automaten, den alle Welt bloß den Schachtürken nennt. Und zum Beleg dafür präsentiert er sein Werk, seine große, noch von niemandem erfasste Erfindung: den Chronometer der Momente, der nicht nur mit absoluter Ebenmäßigkeit das Leben in gleich große Stücke zerteilt, nein, darüber hinaus, und das ist das Geniale seiner Konstruktion, kann man durch simples Verschieben des Gewichts seinen ganz persönlichen Seelentakt zum Ausdruck bringen. „Winkels Chronometer der Momente.“
Johann Nepomuk Mälzel, eigentlich Deutscher, doch die Jahre in Wien haben seine teutonische Aufrichtigkeit etwas verfärbt, was, je nach Beleuchtung, als schillernd-charmant oder trüb-verschlagen erscheinen kann. Kaiserlich-königlicher Hofmaschinist und Reisender in Sachen neuerster Errungenschaften. Nebst dem Schachtürken tourt er mit einem automatischen Trompeter, der Mälzels Klavierspiel mit viel Gefühl accompagniert, und einem Violine spielenden Automaten, der, von zwergenhafter Gestalt zwar, das Instrument doch wie ein Großer beherrscht.





























