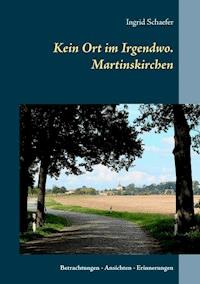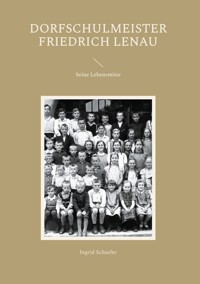
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dorfschulmeister Friedrich Lenau
- Sprache: Deutsch
In den Jahren 1925 bis 1945 sehen wir die Kinder von Friedrich und Clara Lenau heranwachsen und ihr Leben in die eigenen Hände nehmen. Auf dem Schloss versucht sich Emma Priesnitz als Mal- und Fotokünstlerin. Ihre Vernissagen sind beliebt, wobei ihre Schwester Charlotte mit ihrer Freundin Constanze, die in Berlin gemeinsam ein Dessous-Geschäft betreiben, bei ihren Besuchen in Elbkirchen ihr großstädtisches Esprit versprühen. Ende der zwanziger Jahre erstarkt die NSDAP. An den Stammtischen diskutiert man Hitlers Buch "Mein Kampf", Themen der Wirtschaft und Politik. Die meisten Dorfbewohner finden Gefallen an seinen Reden und Versprechungen. In jedem Wohnzimmer hängt ein Porträt des Führers, auf der Straße wird der Arm für Volk und Vaterland gestreckt und schon bald gibt es eine Ortsgruppe der NSDAP in Elbkirchen. Lenau und sein Kollege treten in die Partei ein. Arne Priesnitz, Sohn des Gutsverwalters, besucht eine der Adolf-Hitler-Schulen und wird zu Beginn des Krieges eingezogen. Richard Lenau macht als Ingenieur in der Rüstung Karriere. Während des Krieges muss man in Elbkirchen zusammenrücken. Zuerst kommen Mitarbeiter der Junkerswerke Halberstadt, deren Abteilung nach Borwitz ausgelagert wird. Nach ihnen Flüchtlinge aus den Ostgebieten, Wlassow-Truppen und schließlich die Amerikaner und Russen. Sie treffen sich in Torgau an der Elbe. Lenau begibt sich aus Angst vor den Russen mit seiner Familie auf die Flucht Richtung Westen. Die Ereignisse hält er in seinem Tagebuch fest. Nach seiner Rückkehr nach Elbkirchen im Juni 1945 stellt er fest, es ist nichts mehr wie es war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 725
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Romanhandlung lehnt sich an historische Begebenheiten und Vorbilder an, ohne jedoch mit ihnen identisch zu sein.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Die Autorin
Weiter danke ich meinem Mann Lutz Schäfer für seine Unterstützung und Geduld während der Entstehung dieses Buches.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
1. Kapitel
Fast zwei Jahre waren vergangen, als Friedrich Lenau vor aller Augen und Ohren in Elbkirchen verkündet hatte: „Ich bleibe!“
Noch immer hallten die Worte des Schulmeisters, die er mit fester Stimme ausgesprochen hatte, in Clara nach, wenn sie daran dachte. An jenem Tag wusste er noch nicht, dass er seinen Vater so bald verlieren würde. Es traf Friedrich bis ins Mark, als er starb. Zum ersten Mal in ihrer Ehe fühlte sich Clara hilflos. Dabei war sein Tod gar nicht so überraschend gekommen. Er hatte sich über Wochen hinweg angekündigt. Dr. Löblich hatte schon länger prophezeit, der Vater dürfe sein Nierenleiden nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber das hat den starken Mann nicht beeindruckt. Er starb im siebzigsten Lebensjahr. Als der Frühling ins Land kam und die Sonne wieder raus in die Natur lockte, versagten ihm seine Nieren den Dienst und eine Harnvergiftung verdunkelte seinen Geist.
„Ist nichts mehr!“, waren seine letzten Worte, bevor er die Augen für immer schloss.
Am Grab sang der gemischte Chor von Elbkirchen. „Über den Sternen, da wird es einst tagen“. Nein, Lenau saß nicht an der Orgel, er dirigierte auch nicht den Chor. Das wäre zu viel verlangt gewesen. Sein Kollege aus Cohnsdorf spielte und Schneider dirigierte den Chor. Während des Trauergottesdienstes saß Lenau zwischen seiner Frau und seiner Mutter, die sich schluchzend ein Taschentuch vor den Mund hielt. Richard junior war aus Dessau angereist und saß steif und unbeteiligt neben seiner Mutter, so als würde er nicht dazugehören, während Hiltrud die Hand der Witwe hielt.
„Nicht weinen, Großmama!“, flüsterte sie. „Der Großvater schaut jetzt aus dem Himmel zu. Dort geht es ihm gut.“
Pastor Moltke hatte einen bekannten Text aus der Bibel gewählt.
„Sein Herr sprach zu ihm: Ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen; gehe ein zu deines Herrn Freude!“
So ganz traf das den Geschmack von Friedrich nicht. Er hätte sich ein anderes Wort gewünscht. Das „wenigem“ störte ihn. Aber was wusste der Pastor schon von der Arbeit eines Lehrers und Organisten? Erst recht nicht, wenn er immer zur Stelle ist. Nach der Zeremonie und dem Leichenessen bei Müller im Dorfgasthof beklagte sich Lenau bei seiner Frau über die Zeremonie. Sie teilte seine Ansichten ganz und gar nicht. Der Pastor habe seine Sache doch gut gemacht und der Chor hätte so schön gesungen. So wie es der Vater immer gemocht hat.“
Tage später, als Friedrich den Schreibsekretär seines Vaters aufräumte, fiel ihm ein Büchlein mit hellgrauen Einband und weißen Längsstreifen in die Hände. Das Notizbuch seines Vaters.
Er schlug es auf und fand darin nur eine einzige Eintragung.
Je älter man wird, je näher einen die Zeit an die Schwelle des Jenseits bringt, desto vertrauter wird man mit dem Tode. Er verliert seinen Schrecken und wird mehr und mehr zu einem guten Freund, der fortwährend winkt, man solle doch schlafen gehen, dem man zwar vertraulich zunickt, aber mit der Bitte, er möge uns nur noch ein Weilchen auflassen. So geht es! Einer nach dem anderen von allen, den man gekannt, geschätzt und geliebt hat, geht den unvermeidlichen Weg ins ewige Nichts und ehe man sich versieht, steht man allein da, inmitten einer neuen Welt.
Lenau ließ das Büchlein in seiner Hand sinken. Ja, da ist er jetzt.
In einer neuen Welt. Weiter fand Friedrich ein Kuvert mit der Aufschrift „Für meine Beerdigung“. Es war nicht verschlossen.
Wahrscheinlich hatte sein Vater gedacht, die Summe fortlaufend zu ergänzen. Als er der Mutter das Geld überreichte, brach sie in Tränen aus. „Ja, so war er, mein Richard, er hat immer an alles gedacht.“
Was des einen Leid ist, ist des anderen Glück. Im Februar 1926 kam auf Schloss Elbkirchen zur Freude ihrer Eltern die kleine Elka als viertes Kind der Familie Priesnitz zur Welt. Dass die Herrschaft immer so außergewöhnliche Namen für ihre Kinder wählte, daran hatte man sich inzwischen gewöhnt. Natürlich war Charlotte auf Besuch gekommen, was Emma sehr freute, brachte sie doch immer frischen Wind aus Berlin mit. Auch Geschenke, die es weit und breit um Elbkirchen herum nicht zu kaufen gab.
Für Elka hatte sie ein entzückendes Taufkleidchen aus weißer Chinaseide im Gepäck.
„Sie wird wie eine Prinzessin darin aussehen!“, rief Charlotte vor Begeisterung.
Die fünfjährige Brigitta, die mit im Zimmer war, steckte ihren Finger in den Mund und kaute an ihren Nägeln, so dass Emma sie ermahnte: „Lass das, Brigitta, so was macht man nicht! Oder siehst du das von uns?“
„Für dich habe ich auch etwas Schönes mitgebracht, mein Schätzchen.“ Charlotte lächelte. „Ein Karussel für dein Puppenzimmer. Aber das muss Heinrich erst noch vom Bahnhof abholen.“
„Das wird er nicht können“, fiel Emma ihr ins Wort. „Er ist krank. Sein jüngster Sohn hat jetzt das Fuhrgeschäft übernommen.“
Klein-Brigitta wandte sich enttäuscht ab.
„Was hat sie?“, fragte Charlotte.
Emma seufzte kaum hörbar. „Sie verhält sich seit einiger Zeit so merkwürdig. Sie denkt immer, ich habe ihre jüngeren Geschwister lieber als sie.“
„Und? Hast du?“
„Aber nein! Es wird Zeit, dass sie nächstes Jahr Schulunterricht hat. Das wird sie auf andere Gedanken bringen.“
„Ich habe dich auch immer beneidet“, erwiderte Charlotte. „Erinnerst du dich? Immer wenn ich in Elbkirchen war, sah ich wie liebevoll unsere Mutter mit dir umging. Das hatte ich in Hohenbrück nicht. Die Verwandten unseres Vaters waren nicht an mir interessiert.“
„Du warst eifersüchtig?“, wunderte sich Emma. „Das habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte immer, du bist lieber in Berlin als hier bei uns.“
„Ja, war ich auch, damit ich nicht mit ansehen musste, wie unsere Mutter dir ihre Zuneigung schenkte.“
„Sie war sehr streng. Das war auch nicht immer angenehm.“
„Trotzdem, an der Art wie sie mit dir sprach und auch an ihren Gesten konnte man immer feststellen, dass du ihr Liebling bist.“
„Das tut mir leid. Ich habe das nicht so empfunden.“
„Egal, es ist lange her.“
Den Kaffee nahmen die beiden Schwestern ohne die Kinder und den Gutsverwalter im Rosenzimmer ein. Man hatte den Ofen tüchtig angeheizt, so dass sich eine wohlige Wärme im Raum ausbreitete.
„Wo bleibt denn Wolfram?“, fragte Charlotte. „Zum Kaffeetrinken sollte er wenigstens hier sein!“
„Sei froh, dass er dich vom Bahnhof abgeholt hat.“
„Ja, aber wo ich schon mal hier bin… Wo steckt er bloß?“
Emma zuckte die Schultern. „Das weiß ich nicht. Er ist draußen.
Es hieß, es könnte Hochwasser geben. Wenn jetzt das Eis auf der Elbe schmilzt, muss er sich kümmern. Sie haben Sandsäcke angefahren.“
„Noch nie habe ich davon gehört, dass das Schloss im Wasser gestanden hätte. Es liegt doch viel höher als die Felder und Wiesen jenseits der Teiche genau wie die Kirche.“
„Wolfram hat gesagt, man muss vorsorgen. Sicher ist sicher.“
„Frag doch mal den Schulmeister! Er kennt die Chronik in- und auswendig. Er weiß bestimmt, wann das letzte Mal Hochwasser in Elbkirchen gewesen ist.“
„Wolfram weiß das auch ohne Herrn Lenau. Da ist übrigens der Vater letztes Frühjahr verstorben.“
Charlotte zuckte hilflos die Schultern. „Ich kenne ihn nicht.“
„Aber ja doch. Du kennst ihn vom Kirschenfest her und in der Kirche zu Weihnachten hast du ihn auch immer gesehen. Er war ein großer, kahlköpfiger, breitschultriger Mann mit einem sehr strengen Gesichtsausdruck.“
Charlotte nahm einen Schluck heißen Kaffee. „Ich erinnere mich wirklich nicht.“
Um dem Gespräch eine Wendung zu geben, bat Emma, sie möge doch erzählen, wie ihr Alltag so aussieht und was es Neues gibt.
Nun begann ihre Schwester drauf los zu sprudeln. Über das Leben auf Berlins Straßen, in den Restaurants und Cafés, Bars und Clubs, wo sie sich gut auszukennen schien. Ähnlich wie Albert seinerzeit. Auch würde sie jede Woche, wenn möglich, ins Kino oder Theater gehen. Berlin hätte da viel zu bieten.
„Dazu all die schönen Damen mit ihren eleganten und manchmal auch etwas frivolen Kleidern!“, schwärmte Charlotte. „Man zeigt, was man hat. Dekolleté, nackte Arme, Beine, Po.“
Emma zog ihre hübsche Nase kraus. „Du willst mich veralbern.“
„Ja gut, der ist verhüllt, aber die Kleider sind oft sehr eng.“
„Und was ist mit der Kunst?“, fragte Emma. „Ich habe gelesen, die amerikanische Tänzerin Josephine Baker hat im Berliner Nelson-Theater gastiert. Es soll ein großer Erfolg gewesen sein.“
„War es. Ich hatte leider keine Karte mehr bekommen. Aber wie man sich erzählte, gab es stehenden Applaus.“
„Ist nicht auch ein neuer Filmpalast eröffnet worden?“
„Ja. Er ist riesig und umfasst 1600 Zuschauerplätze. Ich war bei der Premiere von „Goldrausch“ mit Charlie Chaplin dort. Wusstest du übrigens, dass in England vor kurzem die erste Fernsehübertragung stattgefunden hat?“
Emma schüttelte den Kopf. „Ich habe nur gelesen, dass es jetzt auf der Bahnstrecke Berlin-Hamburg Zugtelefon gibt. Das finde ich praktisch. Dann kann man auch schon von unterwegs aus zu Hause anrufen.“
„Was nützt es? Ich komme nicht nach Hamburg.“
„Ich auch nicht, aber ich finde es spannend“, erklärte Emma.
Weiter fragte sie nach einem Mann im Leben ihrer Schwester.
Charlotte meinte, da müsse sie Emma enttäuschen. Sie hat Constanze, ihre Freundin. Mit den Männern hätte sie keine guten Erfahrungen gemacht.
„Hast du mal wieder was von Carl Otto gehört?“
Charlotte schüttelte den Kopf.
„Trefft ihr euch denn nicht?“
„Wozu? Zwischen uns ist alles gesagt. Jetzt, wo Wolfram Gut Riedern gekauft hat, haben Carl Otto und ich gar keine Berührungspunkte mehr. Hat dein Mann es vermietet, wie er gesagt hat?“
Emma nickte. „Es kommen jetzt so viele Leute nach Borwitz und Umgebung. Die Zuckerfabrik wächst und wächst. Sie alle brauchen eine Unterkunft.“
„Das sind alles Fremde. Oder?“
„Ja, die meisten. Sag mal, was ich dich fragen wollte, wie lange hast du vor zu bleiben? Bis zur Taufe?“
Charlotte tupfte sich mit ihrer Serviette den Mund ab. „Das ist es, was ich dir sagen wollte. Ich kann nur bis Ostern bleiben, dann muss ich zurück. Constanze fährt zu einem Lieferanten von uns nach Frankreich und eine von uns beiden muss im Geschäft sein.“
„Dann bleibst du also nicht?“, vergewisserte sich ihre Schwester, der die Enttäuschung anzumerken war.
Charlotte schüttelte ihren Bubikopf. „Nein.“
„Schade. Ich dachte, wir beide könnten ein bisschen mehr Zeit miteinander verbingen.“
Charlotte machte eine Geste des Bedauerns.
Der April war schon zur Hälfte vorbei und das Hochwasser bisher ausgeblieben, als sich Friedrich Lenau auf den Weg zu Heinrichs machte. Es waren Osterferien und er wollte dem alten Karl einen Besuch abstatten, denn dieser wünschte ihn zu sehen.
Clara hatte einen Kuchen gebacken und eine Kanne Bohnenkaffee gekocht, die sie in ein warmes Wolltuch wickelte und Friedrich mit aufs Fahrrad gab. „Aber fahr‘ vorsichtig und sag’nen Gruß, wenn du ankommst!“
Als Lenau die Stube mit der niedrigen Decke am Ende des Unterdorfes betrat, wo man sich fast den Kopf anstieß, fand er den alten Kutscher fiebernd im Bett liegen.
„Ich weiß nicht“, jammerte seine Frau. „Der Doktor war hier, aber es wird nicht besser.“
„Ach was, das wird schon wieder! Es wird eine heftige Erkältung sein. Karl war nie krank, solange ich denken kann“, antwortete Friedrich.
„Aber jetzt. Der Husten quält ihn und er röchelt so komisch.“
Lenau gab ihr den Korb mit dem Kuchen und dem Kaffee und trat dann ans Bett. Der Kranke schlug die Augen auf und lächelte matt. „Da sind Se ja endlich!“
Lenau nahm einen Stuhl und schob ihn ans Bett. „Wie haben Sie das denn angestellt? Sie waren doch immer gesund und putzmunter.“
Der Alte hob seine magere Hand. „Det war mal, Herr Schulmeester! Jetzt bin ick alt und kann jehen. Wie sachte Lubisch immer?
Der Sensenmann steht schon bei Borwitz drüben.“
„An so was sollten Sie nicht denken! Der Sensenmann bestimmt nicht, wann wir gehen.“
„Nu ja…“
Lenau hörte Karl zu, der müde und schwerfällig von alten Zeiten sprach. Der Lehrer verstand nicht alles, was der Fiebernde über das Heumachen erzählte. Wie er überhaupt darauf kam?
„Von drüben bring‘n se mit de Fähre die vollen Fuder rüber.
Pferde und Wagen poltern über de Fährbrücke ruff uff de alte Fähre. Ick bin selbst’n viele Male mitjefahr’n. Gleich hinterher noch‘n Wagen. Der Schuriegel hat dort det Regiment. 60 Johr schon.“
„Was redet er denn da?“, fragte seine Frau leise. „Der alte Schuriegel is schon bald zwanzig Johr tot.“
„Vielleicht ein Fiebertraum?“ Zu Heinrich gewandt meinte Lenau: „Sie sollten nicht so viel reden, Karl, das strengt an.“
„De Kammräder scheppern, de Kurbel knarrt, de Fähre gleitet langsam von Blomberg rüber ans Altenfelder Ufer. Früh is et noch neblich. Da klingen de Stimmen von de Leute wie durch‘ ne Watteschicht. So jeht et Tach für Tach, bis de Heuernte jeschafft is.“
Lenau legte seine Hand auf die des Kutschers. „Karl, ich bin’s!
Der Schulmeister.“
Der Kranke schlug die Augen auf. „Ach Sie? Schön, dass Se jekommen sind.“ Erneut schloss er seine Augen.
Nach einer Weile des Schweigens ging Lenau wieder. Erna Heinrich hatte gerade Kaffee und Kuchen auf den Tisch gestellt.
„Lassen Sie mal, Mutter Heinrich! Ich fahr‘ besser nach Hause.
Der Karl braucht Ruhe.“
Im Schulhaus schüttelte Lenau nur den Kopf, als er Clara gegenübertrat. „Es sieht nicht gut aus. Er hat fantasiert.“
„Der Pastor war gerade hier. Karls älteste Tochter, die Dora, muss bei ihm gewesen sein, denn er wusste auch davon. Was fantasiert denn der Karl?“
„Er hatte es vom alten Schuriegel.“
„Aber der ist doch schon lange tot.“
„Eben darum. Dem Karl muss das Überqueren der Fähre mit dem Fuhrwerk in Erinnerung geblieben sein. Die von Wesenbergs hatten auch Felder jenseits der Elbe. Ich habe mich einmal lange mit dem Fährmeister unterhalten. Das muss aber schon 1907 oder sogar noch 1906 gewesen sein. Trudchen war noch nicht geboren. Karl erzählte damals, niemand kennt die Tücken der Elbe so gut wie er. Bei jeder Flut wusste er schon im Voraus aus dem Dresdner Wassertelegramm, wann die Flutwelle Altenfeld erreichen würde, so dass er und auch die Anwohner rechtzeitig Maßnahmen zur Befestigung und Bergung der Kähne und der Fähre treffen konnten. Er sagte damals, so ein Hochwasser ist immer ein interessantes Ereignis für die Gegend hier.“
„Na, ich weiß ja nicht“, entgegnete Clara.
Lenau ließ sich nicht stören und redete weiter. „Die Teiche laufen voll, Felder und Fluren stehen unter Wasser, so dass die Erhebungen hier und da kleine Inseln bilden, wohin sich die Rehe, Hasen, Kaninchen oder Füchse retten.“
„Die armen Tiere!“, seufzte Clara.
„Wenn diese Inseln überspült wurden, konnte man sehen, wie die Rehe schwimmend versuchten den Damm zu erreichen. Und Hase, Kaninchen und Fuchs taten das, was sonst nicht in ihrer Natur liegt, sie kletterten auf eine umgestürzte Kopfweide, um dem Tod zu entrinnen. Auch Maulwürfe versuchten, den sicheren Deich zu erreichen. Die Jungen im Dorf lauerten schon auf sie, denn für so ein kleines Fell zahlte der Kürschner in Moosburg immerhin zwanzig Pfennige.“
„Hör‘ mir mit solchen Geschichten auf, Friedrich! Das tut ja weh!“, rief Clara.
„Du hast mich gefragt.“
„Ja schon, aber du weißt, ich vertrage so was nicht.“ Clara wischte sich die feuchten Hände am Küchenhandtuch ab. „Hast du mir schon die Karotten aus der Miete geholt?“
„Noch nicht“, antwortete Friedrich und begab sich nach draußen.
Zwei Stunden später aßen sie zu Abend. Seit dem Tod von Richard Lenau kam seine Frau Amalie immer zum Essen runter.
Friedrich hatte gemeint, sie müsse nicht für sich allein kochen und Clara hatte sich still gefügt. Es gab Suppe, die vom Mittagessen übrig geblieben war, dazu Brot, Wurst und Käse. Amalie bemängelte, dass Trudchen nicht da war. „Wo steckt sie denn?“
„Sie ist in Cohnsdorf bei Franziska Ludwig und bleibt auch noch zwei Tage“, antwortete Clara. „Sie wollen die Zeit nutzen, denn nach den Ferien beginnt für Hiltrud das zweite Lehrjahr und Franziska fährt wieder nach Liebenwalde zu ihrer Rechtsanwaltskanzlei.“
Amalie Lenau runzelte ihre Stirn: „Ich denke, die beiden haben sich nicht so gut verstanden.“
„Damals waren sie noch Kinder, Mutter! Jetzt sind es junge Damen“, erwiderte Friedrich.
„Was ist eigentlich mit diesem Gerald Gutenbrink? Eine Zeit lang hat er jede Gelegenheit genutzt, unser Trudchen zu sehen und umgekehrt.“
„Was soll sein?“, fragte Clara.
„Weißt du, ich bin zwar alt, aber ich habe Augen im Kopf. Da war doch was.“
„Nein, da war nichts“, erwiderte Clara. „Sie haben sich ein paar Mal gesehen, wenn er nach Borwitz kam. Ganz harmlos. Du weißt doch, er studiert und ist selten zu Hause.“
„Sie sind unten an der Elbe gesehen worden beim Spazierengehen.“
„Ja, und wenn? Was ist schon dabei? Sie sind jung.“
Friedrich mischte sich ein. „Also ich möchte, dass ihr damit aufhört. Wenn es ernst ist, werden wir es schon erfahren.“
Amalie wagte dennoch einen Widerspruch. „Ich meine nur, ihr seid doch mit den Gutenbrinks gut bekannt.“
Von Lenau kam ein vorwurfsvoller Blick. Amalie wechselte das Thema. „Und Else? Warum kommt sie nicht?“
Clara holte tief Luft. „Weil Osterferien sind und Hannelore bei ihr schläft.“
„Aber da ist doch die Frau vom Hans, die Heidrun. Die kann sich auch um Lorchen kümmern.“
„Nun lass gut sein, Mutter!“ Lenaus Stimme hatte etwas an Schärfe zugenommen.
Nachdem sie gegessen und die Frauen das Geschirr abgespült hatten, ging Amalie wieder nach oben in ihre Wohnung. Clara drehte sich zu ihrem Mann um und sagte mit leiser Stimme: „Seit Vaters Tod hat sie sich verändert. Sie ist streitsüchtig geworden, Findest du nicht?“
Friedrich, der den Elbeboten unter der hellen Lampe am Küchentisch las, brummte eine Antwort. „Das gibt sich wieder. Sie hat zu viel Zeit zum Nachdenken und Grübeln.“
„Ja, vor allem das letzte. Wenn Else nur öfter käme! Dann hätte sie jemanden, der ihr zuhört.“
„Sei nicht so streng mit ihr! Wer weiß, wie wir im Alter sind.“
Lenau schlug die Zeitung um, so dass das Papier raschelte.
Insgesamt waren die Nachkriegsjahre in der Republik durch den Übergang von der Kriegswirtschaft zur Friedensproduktion gekennzeichnet. Vor allem galt es, die ehemaligen Soldaten wieder in den Wirtschaftsprozess einzugliedern. In Berlin sah man häufig versehrte Männer in Uniform auf den Straßen sitzen und betteln. Wenigstens konnten durch niedrige Lohn- und Produktionskosten deutsche Waren im Ausland zu Niedrigstpreisen verkauft werden. Ein wichtiges Thema war der Achtstundentag für Lohnarbeiter und Angestellte, dessen Einführung sich die Kommunisten im Reichstag als Ergebnis der Revolution von 1918 auf ihre Fahne geschrieben hatten. Jedoch wurde diese Regelung jetzt zur Überwindung der Krise in der deutschen Industrie und Wirtschaft aufgeweicht. Die Zahl der Arbeitslosen im Februar 1926 belief sich auf zweieinhalb Millionen; ein neuer Höchststand seit dem Frühjahr 1924. Trotzdem waren weiterhin längere Tätigkeiten bei entsprechender Bezahlung erlaubt. Die Zuckerfabrik in Borwitz verzeichnete einen großen Zulauf. Die Bewerber nahmen gern Überstunden in Kauf, sofern sie nur Arbeit bekamen, auch wenn es nur die Rübenkampagne betraf, die von Ende September bis in den April des Folgejahres hinein lief. Nicht nur aus dem Umland kamen sie hierher, um zu arbeiten, auch aus weiter entfernten Regionen. Hauptsache, man fand Arbeit. Manch einer in der Umgebung besserte seine Haushaltskasse auf, indem er ein oder zwei Zimmer in seinem Haus vermietete. So auch Lochmanns und Schmidtchens. Dr. Steinfelder in Borwitz und Wolfram Priesnitz in Elbkirchen hielten weiterhin an ihrer bisherigen Praxis fest. Kein Achtstundentag. Es wird gearbeitet, wenn die Rübenernte beginnt und die Ernte auf den Feldern ansteht. Weder in der Rübenverarbeitung noch in der Vieh- und Feldwirtschaft ließen sich derartige Forderungen umsetzen. Solange es hell ist, wird gearbeitet. Erst wenn es dunkel wird, kann man nach Hause gehen. Wer trotzdem auf dem Achtstundentag beharrt, der möge sich eine andere Tätigkeit suchen.
Am Dorfstammtisch bei Müller ging es, wie all die Jahre zuvor auch, recht munter, manchmal auch laut zu. Sie hatten wieder Grund, sich selbstbewusst zu geben. Allen voran Malermeister Göpel und Schmied Dietze. Sie hielten immer noch die Stellung, obwohl sich inzwischen ihre Söhne dazugesellt hatten. Dieter Göpel und Giesbert Dietze waren zu wichtigen Männern im Dorf herangewachsen. Vor allem der junge Dietze. Ließen doch nicht nur die Bauern aus Elbkirchen und Altenfeld, sondern auch aus den umliegenden Dörfern ihre Pferde bei ihm beschlagen und die Pflugschare schärfen. Auch Siegbert Franke, Bruno Wittig und Hans Schmidtchen lösten ihre Väter allmählich beim Stammtisch ab. Wie fast immer ging es auch in diesem Frühjahr um die Preise, die man auf dem Markt mit Weizen, Kartoffeln und Zuckerrüben erzielen konnte.
„Den Preis für die Zuckerrüben legt doch Steinfelder in Borwitz fest. Wenn wir den nicht akzeptieren, kauft er von weiter her ein.
Aus Riesa und Gröditz“, sagte Bruno Wittig. „Der kann sich det aussuchen. Unsereens nich.“
„Bei Schweine und Kühe drücken se ooch de Preise“, meinte Hans Schmidtchen. „Und bei dir?“ Er stieß Siegbert Franke, der neben ihm saß, mit dem Ellenbogen an.
Der junge Müller holte tief Luft. „Die Preise sind jestiegen, det stimmt, aber ick mahle ja nur det Korn, wat man uns bringt.“
„Kaufste nich Weizen oder Roggen dazu?“, wollte der alte Dietze wissen.
„Doch schon.“
„Dann jibst de doch ooch den Preis an deine Kundschaft weiter“, schlussfolgerte der Schmied.
Man spürte, dass dem jungen Müllerssohn das Gespräch unangenehm war.
„Nu tu mal nich so, Siegbert!“, griff Dieter Göpel ins Gespräch ein. „Du machst de Preise nich, det wissen wir alle. Jeder von uns muss sich nach seine Decke strecken. Wir krieg’n die Farbe ooch nich mehr zu dem Preis wie vorm Kriech. Wichtig is, dass et uns wieder besser jeht. Der Kriech hat uns alle janz schön zurückjeworfen.“
„Du verjisst die Abgaben“, entgegnete Hans. „Die sind ooch jestiegen.“
„Die ooch, ja!“ Göpel rief dem Gastwirt zu, er möge eine neue Runde bringen.
Von nebenan aus dem Saal, wo der gemischte Chor probte, erklang das Lied: „Kein schöner Land in dieser Zeit“. Irgendjemand hatte das Gespräch über das Frühjahrshochwasser begonnen, was erwartet worden war, aber nicht stattgefunden hatte.
„Ein mäßiges Frühjahrshochwasser wie in diesem Jahr ist alle Mal besser als wenn die Dämme brechen“, sagte Hannes Mühlbacher. „Denn dann gibt‘s kein Halten mehr.“
„Besonders für de Wiesenbesitzer hinterm Deich“, erwiderte Hans. „Det Wasser vernichtet det Ungeziefer, gleichzeitig düngt der Schlamm de Wiese, wenn et wieder abfließt oder versickert.“
„Eben. Die Schwemme macht noch mal Arbeet. Se muss zusammenjerecht und verbrannt werden“, hielt Wittig dagegen. „Sonst kannste deine Wiese gleich verjessen.“
Nach dem Abzug der französischen Besatzungstruppen aus den besetzten Gebieten im Winter 1926 hatte es in Köln, Bonn und anderen Orten Deutschlands Feiern gegeben. Zudem hatte das Deutsche Reich die Aufnahme in den Völkerbund beantragt.
Nach der Währungsreform erlaubte der Dawes-Plan der deutschen Wirtschaft einen Aufschwung, so dass es Deutschland zusehends besser ging. Natürlich kamen die Gespräche am Stammtisch auch auf Adolf Hitler, der inzwischen seine Haftstrafe im bayrischen Landsberg verbüßt hatte. Wegen guter Führung war er sogar früher freigekommen und hatte im Februar 1925 die NSDAP in Bayern neu gegründet. In Elbkirchen war man zwar eher der konservativen Seite geneigt, aber man sollte Hitler im Auge behalten, ließ der eine oder andere verlauten. Er habe übrigens ein Buch geschrieben. „Mein Kampf“.
„Ach wat! N‘Buch? Wer von uns kleenen Leuten kann sich so wat schon koofen? Und wenn, wann soll er Zeit haben, um det zu lesen?“, fragte Hans Schmidtchen in die Runde. „Wenn ick abends vom Feld heeme komme, fallen mir de Augen zu.“
Die anderen stimmten ihm zu.
Beim Stammtisch in Borwitz, wo sich die besseren Herren der Umgebung trafen, ging es weniger laut zu, dafür lebhafter in der Diskussion. Man sorgte sich um die Zukunft, denn politisch ließ manches zu wünschen übrig. Nach der Währungsreform war es zu einem Aufschwung in der Wirtschaft gekommen. Man tätigte wieder Investitionen, die die Einführung moderner Technologie ermöglichte. Firmen wie Siemens und AEG kehrten damit an die Weltmarktspitze zurück, einer Position, die sie schon vor 1914 inne gehabt hatten. Weiterhin schritten die Elektrifizierung und die industrielle Massenproduktion in großem Maße voran. In Stuttgart entstand die Daimler-Benz AG. Das Statistische Reichsamt zählte in Deutschland 200 000 Pkw und 100 000 Motorräder. Weiter setzte NSU als erste deutsche Firma im Motorradbau das Fließband ein, eine Investition, die sich sicher auch noch woanders einsetzen ließe, wie Dr. Steinfelder meinte. „Ich bin am Überlegen, ob man die Zuckerrüben von den Eisenbahnwaggons mittels Förderband nicht direkt in die Produktionsanlage transportieren kann. Man würde gegenüber der jetzigen Praxis, wo die Rüben von Hand be- und entladen werden, enorm viel Zeit gewinnen.“
„Und Kosten sparen“, ergänzte Priesnitz.
„Sie sagen es. Was das Unternehmen betrifft, so denke ich an Expansion. Es steht eine weitere Fabrik nicht allzu weit von hier zum Verkauf.“
„Die Zeichen stehen günstig, vor allem jetzt, wo wieder Kredite gewährt werden“, ließ Priesnitz noch einmal vernehmen.
Steinfelder nickte zustimmend. Dr. Löblich und Apotheker Riedel bearbeiteten ein anderes Thema. Sie hatten Hitlers „Mein Kampf“
gelesen und zweifelten daran, ob dieser Mann der Richtige für die Zukunft Deutschlands sei. Die Lehrerschaft wie Lenau, Ludwig und Schneider übten sich im Zuhören. Zu beiden Themen wollten oder konnten sie sich nicht äußern. So blieb es bei einem allgemeinem Geplänkel über das Wetter, die Bürokratie im Schulwesen und dem gemeinsamen Bier. Die Frage nach Pastor Moltke konnte Lenau nicht hinreichend beantworten. Es ginge ihm gut, ja. Er wäre jetzt zum zweiten Mal Vater geworden. Nach dem Sohn vor zwei Jahren waren jetzt Zwillinge, zwei Mädchen, geboren worden.
„Warum sieht man ihn nicht am Stammtisch?“, wollte von Rohrbach wissen, dessen Wohlstandsbauch inzwischen seine Weste wölbte.
Lenau wiegte den Kopf. „Er ist kein geselliger Typ und schon gar nicht wie sein Vorgänger Arthur Vogt.“
„Zum Josef in Elbkirchen geht er aber schon?“, forschte Riedel.
„Selten. Aber sonst gibt es an ihm nichts auszusetzen.“
„Das musst du ja sagen“, erwiderte Paul Ludwig lachend. „Er ist dein Dienstherr.“
„Nein, deswegen nicht. Ich sag ihm schon, wenn mir etwas nicht passt.“
Als die Osterferien vorbei waren, musste Hiltrud wieder nach Moosburg zur Handelsschule. Das zweite Ausbildungsjahr begann. Ihr Praktikum verrichtete sie in der Buchhaltung der Zuckerfabrik. Wie schon im ersten Jahr ging sie zu den Mittagsmahlzeiten zu Gutenbrinks. Dort hatte man sich an sie gewöhnt und behandelte sie wie ein Mitglied der Familie. Gerald war in den Osterferien nicht gekommen. Er hatte auch nicht geschrieben. Nur ein einziges Mal hatte Hiltrud eine Postkarte von ihm aus Halle bekommen, die sie daheim im Schulhaus sorgfältig in einem Kästchen aufbewahrte.
„Na, was hast du in den Osterferien gemacht?“, fragte die Hausherrin.
„Ich war in Cohnsdorf bei meiner Freundin.“
„Bei Franziska Ludwig?“
„Ja.“
„Arbeitet sie noch in dieser Anwaltskanzlei?“
Hiltrud nickte.
„Du warst sicher enttäuscht, dass Gerald zu Ostern nicht gekommen ist“, sagte Almuth Gutenbrink mit der Kelle in der Hand und fragte, ob sie noch Suppe wolle. Hiltrud dankte.
„Mir kannst du noch geben.“ Konrad Gutenbrink hielt seinen leeren Teller hin. Enttäuscht war Hiltrud schon, aber das mochte sie nicht zugeben. Was würde das für einen Eindruck machen?
„Gerald hat jetzt sein drittes Jahr angefangen. Wirtschaft ist kein einfaches Studium“, erklärte der Buchhalter.
„Aber in den Semesterferien kommt er“, sagte seine Frau, die ahnte, was Hiltrud bewegte.
„Vorher fährt er aber noch mit einem Studienfreund in die Alpen“, erwiderte Gutenbrink.
Hiltrud wurde es warm. Am liebsten wäre sie raus an die Luft gegangen, aber sie wollte nicht unhöflich sein. Nein, sie wird zu Hause Bescheid sagen, dass sie nicht mehr zum Mittagessen zu den Gutenbrinks geht. Sie wird sich ein Brot schmieren und es irgendwo draußen essen. Vielleicht unter einem Baum am Feldrand, wo sie ungestört ist oder sich etwas vom Bäcker holen. Die Bäckerei Gaede befand sich gegenüber der Fabrik. Dort konnte man auch eine kleine Mittagsmahlzeit bekommen. Die Besitzerin Alma Gaede war da sehr erfinderisch. So was gab es in Elbkirchen bei Lochmanns nicht. An manchen Tagen, wie auch an diesem, sehnte sich Hiltrud nach ihren Kindheitstagen, als Else Schmidtchen noch allgegenwärtig war. Wie hatte die Mutter gesagt? Das Erwachsenwerden ist nicht einfach.
Zu Hause stieß Hiltrud mit ihrem Vorschlag nicht auf Gegenliebe.
„Soweit kommt‘s noch, dass die Tochter des Dorfschulmeisters im Straßengraben sitzt und ihr Brot isst!“
„Es ist doch nur, wenn ich in der Zuckerfabrik arbeite. In der Schule bin ich mit den anderen Mädels zusammen“, widersprach sie.
„Ich weiß nicht, was du so plötzlich gegen Gutenbrinks hast?
Waren sie nicht immer entgegenkommend und freundlich?“,
fragte Lenau seine Tochter.
Hiltrud senkte ihren Kopf. Clara mischte sich ein. „Lass sie doch, Friedrich! Es wird schon einen Grund geben, warum sie das nicht mehr möchte.“
„Was sollen denn Gutenbrinks von uns denken?“
„Ich werde mit Almuth sprechen.“
Am Gesichtsausdruck konnte Clara erkennen, recht war es Lenau nicht. Später, als sie allein waren, fragte sie ihre Tochter nach dem Grund.
„Es sind doch eigentlich fremde Leute“, meinte diese.
„So fremd, wie du sagst, sind sie ja nun nicht“, entrüstete sich Clara. „Oder ist es wegen Gerald, weil er sich so rar macht?“
„Nein.“
„Was ist es dann?“
Hiltrud verließ achselzuckend die Küche. Erst als Else Schmidtchen sie in den Folgetagen unter vier Augen darauf ansprach, löste sich ihre Zunge. „Ich kann es dir nicht sagen, Else! Ich weiß es auch nicht.“
„Aber Trudchen! Ick kenn‘ dich jut genug. Es ist wegen Gerald, stimmt‘s?“
Else setzte sich zu ihr auf die Gartenbank. „Nu hör mir mal jut zu, Mächen! Der Gerald is in Halle. Und wenn der in zwee Johr fertig is mit seinem Studium, wird er nich nach Borwitz zurückkommen. Also schlag ihn dir aus‘ m Koppe! Det wird nüscht. Der greift nach de Sterne. Det is so sicher wie det Amen in de Kirche.“
Hiltrud sprang von der Bank auf: „Du kannst einem aber wirklich jede Hoffnung nehmen!“
„Hoffnung? Pass uff, eenes schönen Tages bringt er‘ ne junge Dame aus Halle mit und dann weeßte Bescheid. Such dir jemanden anderen! Et jibt bei uns genügend nette, junge Männer. Außerdem haste wirklich noch‘n bisschen Zeit oder hat dich die kleene Ludwig kopfscheu jemacht? Hat die denn ihren Freund noch?“
Hiltrud antwortete nicht. Stattdessen rief sie: „Du immer mit deinen Orakeln!“
„Wat heeßt Orakel? Det liegt doch uff de Hand.“
Hiltrud blickte sie argwöhnisch aus den Augenwinkeln an. Dann stürzte sie auf Else zu und umarmte sie: „Ach, Else! Ich hab mir so was auch schon gedacht. Darum will ich da nicht mehr hin.“
„Wat sacht eijentlich deine Großmutter dazu?“
„Sie weiß es nicht.“
„Mit der könntste so wat ooch bereden, wenn‘s deine Mutter nich wissen soll.“
Hiltrud ließ von Else ab. „Aber das ist doch nicht dasselbe wie mit dir.“
Die alte Frau holte tief Luft. „Is schon jut, Trudchen! Ick bin ja da.“ Sie erhob sich. Das ging etwas schwerfällig. „Und wat die Gutenbrinks anjeht, du kannst deine Eltern nich enttäuschen. Det jeht nich. Am besten du denkst nich so ville nach und jehst weiter wie bisher zum Mittachessen. Det is det Beste für alle.“
2. Kapitel
Kurz vor Pfingsten schrillte die Feuerglocke in Elbkirchen. Sofort rannten die Dorfbewohner auf die Straße. In der Nähe der Gutsscheunen waren Strohdiemen in Brand geraten und weil ein starker Wind wehte, drohten die Flammen auf die Scheunen des Gutes überzugreifen. Auf dem Gutshof herrschte Aufregung. Die Tiere im Stall waren unruhig und zerrten an ihren Ketten. Die Reitpferde waren zum Glück draußen auf der Koppel. Jemand musste nach ihnen sehen und sie eventuell beruhigen. Priesnitz konnte seine Frau gerade noch zurückhalten. „Nein, du bleibst hier! Geh rüber ins Schloss und sieh nach den Kindern!“
Über hundert Männer aus dem Dorf und aus Borwitz brachten die Kühe und Ochsen in Sicherheit und versuchten das Feuer zu löschen, aber der Wind fachte es immer wieder an. Die Funken stoben nach allen Seiten. Nach drei Stunden konnten die Flammen endlich gelöscht werden. Am Ende waren 3000 Zentner Stroh vernichtet. Verschwitzt, rußverschmiert und erschöpft gingen die Helfer in ihre Häuser zurück. Das war gerade noch mal gut gegangen. Aber wie war das Feuer zustande gekommen?
Hatte es möglicherweise jemand gelegt? Priesnitz und Broschwitz waren sich einig. Vom Gut kann es keiner gewesen sein.
Die Schuldigen waren sehr schnell gefunden. Nachdem der Brand gelöscht war, kamen sie aus ihrem Versteck hervorgekrochen. Es waren drei Jungen aus der zweiten und dritten Klasse.
Lenau kannte sie. Der Älteste war der Enkel des Schusters Huberich, der Zweite der Sohn der ältesten Tochter von Gärtner Klose und der Jüngste war ein Sohn der weitläufigen Familie Marthens aus Altenfeld. Sie hatten mit Streichhölzern gezündelt und dabei das Stroh entfacht. Nur ein ganz kleines Feuer hatten sie machen wollen, um zu sehen wie es brennt. Ihre Gesichter waren gerötet. Schuldbewusst senkten sie ihren Blick. Geständig waren diese Lausejungs ja, das änderte aber nichts an dem Schaden, den sie angerichtet hatten. Wer kam jetzt dafür auf? Broschwitz schob seinen Hut in den Nacken, als er zu Priesnitz herübersah. Der sagte kein Wort und ging ins Gutsbüro. Nolde folgte ihm.
„Und? Was machen wir nun? Erstatten wir Anzeige?“, fragte er.
Der Gutsverwalter blickte ihn wie aus einem Traum erwacht an.
„Wie?“
„Ich meine, dreitausend Zentner, das ist keine Kleinigkeit.“
Wolfram Priesnitz nickte. „Jaja, wir können froh sein, dass die Scheunen noch stehen.“
„Saubande!“, rief der Buchhalter.
Priesnitz wandte sich um und ging grußlos an Nolde vorbei hinüber ins Schloss. Dort wartete Emma schon ungeduldig auf ihn.
„Ist mit den Pferden alles in Ordnung?“, fragte sie aufgeregt.
„Jaja, mit ihnen schon.“
„Weißt du schon, wer es war?“
Priesnitz erzählte ihr von den drei Jungen.
„Von diesen Familien haben wir nichts zu erwarten. Das sind Hungerleider“, sagte sie.
„Ich weiß.“
„Wirst du es trotzdem anzeigen?“
„Ich muss es zumindest der Versicherung melden.“
„Von den Huberichs und Marthens wirst du keinen Pfennig bekommen. Die haben nichts. Klose kannst du es gegebenenfalls vom Lohn abziehen.“
„Wir werden sehen. Der Wachtmeister von der Polizei hat den Schaden aufgenommen.“ Priesnitz ließ sich in einem Sessel nieder und genehmigte sich einen Cognak.
Der Brand war die nächsten Tage Gesprächsthema im Dorf und in der Umgebung. Bis nach Burgdorf, Teschwitz und sogar Cohnsdorf hatte man die Feuer- und Rauchsäule gesehen, so dass die betroffenen Familien einige Zeit lang vermieden, durchs Dorf zu gehen, weil sie fürchteten, auf das Feuer hin angesprochen zu werden. Klose verschanzte sich in seinen Gewächshäusern und widmete sich dort seinen Tomaten und Gurken und Huberich, der sonst immer sein Fenster zur Straße hin geöffnet hatte, schloss es vorsorglich. Den Marthens in Altenfeld war es egal. Die Familie war so groß, da wusste man eh nicht, wer genau zu wem gehörte.
Zum Pfingstfest hatte sich Carl Otto von Salbach angesagt. Er wollte seinem Schwager und den Wäldern wieder mal einen Besuch abstatten. Mit ihm reiste eine aparte, junge Dame. Johanna hatte zwei getrennte Zimmer herrichten müssen. Priesnitz holte beide vom Bahnhof ab, denn Carl Otto hatte sein Auto verkauft. „In Berlin komme ich überall zu Fuß oder mit der S-Bahn und der Tram hin“, so sein Argument.
Emma hatte sich extra fein gemacht für ihren Besuch und trug ein wadenlanges Kleid aus dunkelblauer Seide mit einem weiß unterlegten, halsfernen Kragen und einer Schaluppe. Die Hüften zierte nochmals ein weißer Streifen. Da Emma sehr schlank war, konnte sie es gut tragen. Ihre langen Haare hatte sie aufgesteckt.
Sie war ein wenig aufgeregt, als sie Wolfram mit Carl Otto und Fräulein Seewald die Treppe heraufkommen sah. Die junge Frau, die Emma zum ersten Mal sah, trug einen Hosenanzug und flache Schuhe. Auf dem Kopf hatte sie einen Topfhut, wie man die neue Generation Hüte nannte, weil sie ähnlich einem Topf nur übergestülpt wurden. Nachdem sich die beiden Damen gegenseitig gemustert hatten, gaben sie sich die Hand. Carl Otto stellte sie einander vor. „Emma, das ist Fräulein Gerlinde Seewald. Gerlinde, das ist meine Schwägerin Emma.“
„Ich habe schon viel von Ihnen gehört.“ Die Seewald lächelte.
Emma fand sie ein wenig zu stark geschminkt, vor allem die Augen. Und einen Duft versprühte sie! Spritzig, frisch. Was für ein Parfüm sie wohl benutzte? Wolfram begleitete die Gäste hinauf in den zweiten Stock zu ihren Zimmern, während Emma in die Bibliothek ging. Agnes kam herein und fragte, wann sie das Abendessen servieren solle?
„In einer halben Stunde. Ich denke, das reicht.“
„Das Gepäck ist schon oben, gnädige Frau. Ich habe es gleich hinaufbringen lassen.“
„Danke, Agnes.“
Die zögerte und sagte dann: „Schön, dass wieder mal Besuch auf Schloss Elbkirchen ist.“
„Aber Agnes, meine Schwester hat uns doch erst besucht.“
„Das war im März. Jetzt haben wir Mai.“
„Die Steinfelders waren doch zwischendurch auch mal hier.“
„Das ist nicht dasselbe, wenn ich das sagen darf“, meinte Agnes.
Emma seufzte: „Ja, ich weiß.“
Agnes ging und Karin Mohnhaupt kam zur Tür herein. „Die Kinder sind jetzt im Bett, gnädige Frau! Möchten Sie ihnen Gute Nacht sagen?“
Emma winkte ab. „Jetzt nicht. Ich schaue später nach ihnen.“
„Aber Greta weint. Sie verlangt nach Ihnen.“
Nun erhob sich Emma aus ihrem Sessel und folgte dem Kindermädchen.
Als sie eine viertel Stunde später zurückkehrte, warteten die Männer schon in der Bibliothek auf sie. Carl Otto hatte ein braunkariertes Sakko zu einer hellen Hose an. Fräulein Seewald trug ein Kleid. Ein schmales, schwarzes. Darüber eine lange weiße Perlenkette. Da sie den Hut abgenommen hatte, sah man ihre Kurzhaarfrisur, die jetzt bei den jungen Damen in Mode war. Ihr dunkles, welliges Haar schmiegte sich an ihren Kopf. Sie hatte ein Täschchen und eine lange Zigarettenspitze in der Hand.
„Kann ich das, während wir essen, hier liegen lassen?“, fragte sie Carl Otto.
„Ja, warum nicht? Wir kommen nach dem Essen sicher wieder hierher.“
Priesnitz nickte. Die kleine Gesellschaft begab sich ins Rosenzimmer, um zu speisen. Emma musste kurz an Charlotte denken. Ob sie weiß, dass Carl Otto eine Freundin hat? Nein, wohl nicht, sonst hätte sie etwas bei ihrem letzten Besuch gesagt.
Emma hatte sich viel Mühe gegeben und ein festliches Menü zusammengestellt, welches auch ordentlich gelobt wurde. Das Gespräch verlief entspannt, die Damen überließen den Männern das Wort, sie selbst gaben sich mit Allgemeinplätzen zufrieden.
Erst später, als sie beim Espresso und Wein in der Bibliothek zusammensaßen, wurde die Unterhaltung lockerer.
„Carl Otto hat erzählt, Sie spielen Klavier“, sagte die Seewald zu Emma.
Sie wehrte ab und erklärte, sie habe das Klavierspiel in den letzten Monaten sehr vernachlässigt. „Bei vier Kindern ist das nicht so einfach.“
„Oh, schade, ich dachte, Sie würden uns etwas vorspielen.“
„Aber Sie reiten noch?“
„Ja, wieder. Darüber bin ich auch froh. Ich bin sozusagen mit Pferden aufgewachsen.“
„Carl Otto und ich gehen manchmal nach Hoppegarten auf die Rennbahn. Er hat ja wenig Zeit. Immer steckt er in seiner Fabrik.
Aber schön wohnen Sie. Inmitten der Natur. Es ist so still. Man hat das Gefühl, dass die Zeit hier stehengeblieben ist.“
„Das sieht nur so aus“, entgegnete Emma. „Wolfram wird Ihnen bei Tageslicht sicher das Gut zeigen.“
„Das hoffe ich doch!“, meinte die Seewald zu Priesnitz hingewandt.
„Sie können uns ja begleiten, wenn wir morgen nach Riedern fahren“, antwortete er.
Der Seewald gefiel der Vorschlag. „Ja, sehr gerne.“
Priesnitz zeigte seinen Gästen nicht nur das Gut, die Brennerei und die Ziegelei, sie inspizierten auch die Wälder, die Carl Otto nach dem Verkauf des Herrenhauses in Riedern von seinem Schwager gepachtet hatte. Carl Otto, der den verkohlten Heuschober an der Straße betrachtete, fragte, ob es auf dem Gut gebrannt habe. Er erinnere sich, dass unter dem Dach auf der anderen Straßenseite immer Stroh gelagert worden war.
Sein Freund erzählte ihm von dem Brand. „Wir können froh sein, dass nur die Strohballen Feuer gefangen hatten und es nicht noch auf andere Gebäude übergegriffen hat.“
„War es ein Unglück oder Brandstiftung?“
„Drei kleine Schulbuben haben ein Feuer gemacht. Sie wollten sehen, wie es brennt.“
„Na, das ist ihnen aber wirklich gelungen. Und wer haftet?“
„Die Eltern. Sie haben sich verpflichtet, Arbeitsstunden beim Neubau zu leisten. Geld haben sie nicht.“
„Dann baust du also neu?“
„Ja, aber nicht mehr an dieser Stelle. Weiter draußen am Feldrand nach Riedern zu. Der alte Schober wird abgerissen.“
In der Brennerei erzählte Priesnitz, sie würden verschiedene Obstbrände herstellen. Sie seien über die Kreisgrenzen hinaus beliebt. Besonders der Zwetschgenschnaps. Aber sie hätten auch einen sehr guten Korn.
„In unserer Gegend ist der Weizen besonders gut. Das liegt am Boden. Und Obst wächst überall, vor allem in unseren großen Plantagen zwischem dem Deich und dem Schloss. Eine Goldgrube, wenn man so will.“
„Das lässt sich denken“, erwiderte die Seewald, beeindruckt von der Größe des Gutes. „Und all das gehörte mal Ihrer Schwiegermutter, der Baronin von Wesenberg?“
„Eigentlich ihrem Mann. Sein Großvater hat das Schloss Ende des 18. Jahrhunderts von einem Grafen gekauft.“
Carl Otto fragte sie: „Hast du die Ahnengalerie am Treppenaufgang in der Halle nicht gesehen?“
Die Seewald schüttelte den Kopf.
„Dann werden wir das heute Nachmittag nachholen.“
Priesnitz nickte. Er wollte sich jetzt nicht auf Einzelheiten einlassen. Auch eine Verkostung durfte nicht fehlen. Gerlinde Seewald nippte nur an ihrem Glas. Priesnitz schloss daraus, dass ein Obstbrand nicht so ihr Fall war. Die Ziegelei beeindruckte die junge Frau mehr. Schließlich hatte sie so etwas noch nie gesehen.
Als sie nach Riedern zum Herrenhaus kamen, brach sie in Entzücken aus. „Das liegt aber schön! Nicht so groß, aber in einem sehr gepflegten Zustand. Hier kann man es aushalten. Dieser wunderschöne Garten dazu mit dem Gartenhaus, sehr idyllisch. Und hier hast du mal gelebt?!“, sagte sie zu Carl Otto. Es klang etwas vorwurfsvoll, so als wollte sie damit sagen: So was gibt man doch nicht auf! Aber auch er wollte nicht weiter darauf eingehen.
„Wer wohnt jetzt hier?“, fragte sie ihren Gastgeber.
„Zwei nette Familien. Eine aus Liebenwalde, die andere aus Burgdorf. Aber das sagt Ihnen sicher nichts“, antwortete Priesnitz. „Der einen Familie gehört die Porzellanfabrik im drei Kilometer entfernten Burgdorf. Das liegt dort drüben.“ Er zeigte mit dem Arm in die Richtung. „Die andere Familie, das ist ein ehemaliger höher gestellter Bahnbeamter aus der Kreisstadt. Er hat sich hier zur Ruhe gesetzt.“
Das Herrenhaus, welches bei Gerlinde Seewald so viel Begeisterung hervorrief, hatte Charlotte ihrem Schwager gerne verkauft, denn das Geld dafür versetzte sie in die Lage, in Berlin ein einigermaßen unbeschwertes Leben zu führen. Gleichzeitig stellte Schwager Wolfram die Ausstellung der monatlichen Schecks ein.
Dass Carl Otto die Forstwirtschaft weiter betrieb, hatte sie beiläufig zur Kenntnis genommen. Für sie war nur Bares von Interesse. Überhaupt nabelte sich Charlotte sehr schnell von ihrer Vergangenheit ab. Dafür interessierte sich Fräulein Seewald umso mehr für alles, was Carl Otto anging.
Als sie am Abend wieder zu viert in der Bibliothek zusammenkamen und den Tag noch mal Revue passieren ließen, saß Emma still in ihrem Sessel und ließ das Gespräch auf sich wirken. Viel konnte sie ohnehin nicht dazu beitragen, denn sie hatte fast den ganzen Tag allein verbracht. Nur am Nachmittag war sie mit den Kindern im Garten gewesen. Sie hatte Kopfweh und zog sich beizeiten zurück, so dass sich die Seewald genötigt sah, es ihr gleich zu tun. Sie sagte zu den Männern: „Ihr habt sicher noch Dinge zu bereden, die meine Anwesenheit überflüssig machen.“
Die Männer sprachen nicht dagegen. Nachdem die Frauen gegangen waren, sagte Priesnitz zu seinem Schwager: „Ich hoffe, Fräulein Gerlinde findet es nicht unhöflich, dass sie Emma mit ihrem Aufbruch genötigt hat.“ Er klingelte nach Johanna, die noch eine Flasche Spätburgunder bringen sollte.
Carl Otto gähnte hinter der vorgehaltenen Hand. „Ach was! Im Gegenteil, es wäre aufdringlich gewesen, wenn sie noch sitzen geblieben wäre.“
„Mir hätte das nichts ausgemacht.“ Priesnitz brannte sich eine neue Zigarette an. „Willst du auch?“
„Nein, danke.“
Nachdem Johanna den Wein gebracht und neu eingeschenkt hatte, wollte Priesnitz wissen, ob Fräulein Gerlinde die unglücklich Verheiratete sei, die Carl Otto vor zwei Jahren kennengelernt hatte. Nein, das war nur eine Affäre. Leidenschaftlich zwar, aber kurz. Carl Otto lachte. „Es wurde zu anstrengend. Sie hatte zu viele Allüren.“
„War sie nicht Sängerin?“
„Das ja. Trotzdem ging das mit uns nicht. Wenn man im Hintergrund immer mit dem Ehemann rechnen muss, verliert man irgendwann die Lust.“
„Und wie hast du die Seewald kennengelernt?“
„Auf einer Abendgesellschaft bei einem Lieferanten von uns.“
„Aus was für einer Familie kommt sie?“
„Ihr Vater hat ein kleines Bankhaus.“
„Lass mich raten. Und du bist dort Kunde.“
Wieder lächelte Carl Otto.
„Deine Angebetete ist aber noch sehr jung?“
Carl Otto schmunzelte. „Sie hat gerade ihren vierundzwanzigsten Geburtstag gefeiert.“
„Was?!“ Priesnitz hätte sich fast verschluckt. „Das sind ja sechzehn Jahre Unterschied!“
„Du sagst es.“
„Sie ist sehr hübsch und scheint mir auch ansonsten keine von diesen langweiligen Frauen zu sein, die sich nur für die Reichen dieser Welt, die schönen Künste und ihre Garderobe interessieren. Die meisten von ihnen haben nichts anderes im Kopf. Höchstens auf dem Kopf, was auch ganz schön ins Geld gehen kann.
Auf mich macht die Seewald jedenfalls einen sehr netten Eindruck.“
Carl Otto nickte zufrieden und prostete Wolfram zu.
Emma lag wach im Bett. Der Mond schien durch die Fenster und sie konnte nicht einschlafen. Fräulein Seewald hatte auch sie beeindruckt. Erst in letzter Zeit hatte Emma entdeckt, dass sie für sich und ihre Ehe dringend eine Auffrischung brauchte. Nicht, dass er sie nach ihren vier Kindern nicht mehr begehrte, aber es hielt sich doch in Grenzen. Dabei war sie erst einunddreißig.
Auch fehlte ihr eine Freundin, mit der sie sich austauschen konnte. Da nun Charlotte ihr Erbe verkauft hatte, war sie noch weiter in die Ferne gerückt und am Telefon ließen sich manche Dinge einfach nicht besprechen. Solche schon gar nicht. Emma seufzte.
Charlotte fehlte ihr. „Ach, wenn du doch noch hier wärst, liebste Charlotte, hier bei mir! Dann müsste ich mich nicht so vor dem Leben fürchten“, flüsterte sie.
Nachdem sich Gerlinde Seewald ebenfalls in ihr Zimmer zurückgezogen hatte, lag sie bei weit geöffnetem Fenster und lauschte in die Stille der Nacht hinaus. Die Blätter des Baumes vor ihrem Fenster säuselten leise im Wind. Irgendwo rief ein Käuzchen und im Garten unten raschelte es. Vielleicht ein Igel. Was für ein schönes Zuhause Emma hatte. Eine intakte Familie, einen sehr klugen und gutaussehenden Mann, vor allem aber hatte sie ein Schloss mit Bediensteten und Angestellten. Und wie groß das Gut war! Hier ließ es sich leben. Schade, dass Emma ihre Talente so verkümmern ließ: Das Singen, das Klavier spielen, das Malen.
Zum Pfingstfest kamen die Eltern von Clara nach Elbkirchen zu Besuch. Beide waren gealtert. August Walther hatte vor vier Jahren seinen Direktorposten bei der Grube aufgegeben und seine Frau Marie Luise war inwischen auch schon 65 Jahre geworden.
Noch hatte ihnen in Dewitz niemand die Villa streitig gemacht, aber es war an der Zeit, nach einer Alterslösung zu suchen. Clara befürchtete, sie könnten den Wunsch äußern, auch nach Elbkirchen zu kommen. Dann müsste Amalie runter zu Friedrich und Clara ziehen, damit die obere Wohnung frei würde. Aber so einfach ging das nicht, denn das Geld von Friedrichs Eltern steckte in der oberen Etage. Wie sollte man das anfangen? Und würde es dann im Schulhaus nicht zu eng? Fünf Erwachsene und eine Halbwüchsige. Clara blieb ruhig. Schlafende Hunde soll man besser nicht wecken, sagte sie sich. Die Eltern konnten ihre Sorge zerstreuen, denn sie erzählten von sich aus, sie würden sich um eine Wohnung in der Stadt kümmern, wo sie ihren Ruhestand genießen können.
„Wollt ihr nicht zu uns nach Elbkirchen kommen?“, fragte Friedrich. Clara stockte das Herz. Um Gottes Willen, Friedrich, musste das jetzt sein? Wie kommst du denn auf diese Idee?,
dachte sie.
Der Vater wedelte mit der Hand den Tabakdunst, den seine Zigarre verursachte, von seinem Gesicht weg. „Nein, Friedrich, lass mal“, sagte er. „Es ist nicht gut, wenn Alt und Jung unter einem Dach zusammenwohnen. Ihr habt deine Mutter hier. Das genügt.“
„Ich meine, wir müssten sonst zusammenrücken. Richards Zimmer ist ja jetzt frei und wir haben auch noch das Gästezimmer.“
„So einfach ist das aber nicht, Friedrich!“, mischte sich Clara ins Gespräch. Sie wusste, wären die Eltern erst einmal hier im Schulhaus, hätte sie in ihren eigenen vier Wänden nichts mehr zu melden. Das musste sie unbedingt vermeiden. Glücklicherweise meinte ihre Mutter, sie hätte schon etwas in Aussicht, eine sehr hübsche Stadtwohnung in Könnern, nicht weit von den Geschäften, der Bank, einem Café und der Post. Sie würde sich eine Köchin und eine Putzfrau zulegen, so dass sie versorgt wären. Clara atmete auf.
„Dann wollt ihr dem Land also endgültig Lebe wohl! sagen“,
fasste Friedrich zusammen.
„Wir hatten eine schöne Zeit in Dewitz, aber jetzt wollen wir in die Stadt zurückkehren“, erwiderte August. „Es ist das Beste für alle.“
Clara wechselte einen Blick mit Friedrich.
„Ja, dann nehmen wir das mal so zur Kenntnis“, antwortete er.
Der Gottesdienst am Pfingstsonntag war gut besucht. Die Sonne schien, alles blühte und die Bienen sammelten fleißig Pollen. Das wiederum erfreute die Imker im Dorf. Die Welt schien nach den Krisenjahren, nach dem Hunger und der Inflation, wieder in Ordnung zu sein, denn das Leben verlief weitgehend normal.
Gärtner Klose und den Schuster sah man aber nicht in der Kirche. Sie mieden immer noch die Öffentlichkeit so gut es ging. Die Familie Priesnitz mit Brigitta saß in der ersten Reihe rechts vor dem Altar, auf ihrem angestammten Platz. Pastor Moltke war in Hochform so wie Vogt seinerzeit. Seine Predigt über den Heiligen Geist, der vor 2000 Jahren zu Pfingsten über die Jünger Jesu kam, als sie plötzlich in vielen Sprachen anfingen zu predigen, erschien dem einen oder anderen wie eine Geschichte aus der Mottenkiste. Otto Schmidtchen, der neben seiner Else saß, fragte sich, welcher Geist wohl Pastor Moltke ergriffen hatte, dass er so gewaltig predigte. Dazu die Orgel, gespielt von Lenau. Er zog alle verfügbaren Register. Und natürlich redete man nach der Kirche auf dem Friedhof und auf dem Vorplatz unter der Eiche, dem Hundeberg, miteinander. Nele Schimmelpfennig und Berta Wittig konnten nicht an sich halten.
„Die junge Gnädige sieht immer traurich aus. Ejal, wann man se trifft“, sagte die dicke Wittig.
„Seit de älteste Tochter von de Frau Baronin nich mehr da ist, und sie ooch, is se nich mehr dieselbe. Frau Emma is‘et nich jewöhnt, det se so alleene is. Der Gutsverwalter hat anderet zu tun und ihre Kinner sind noch kleen“, wusste Nele zu berichten.
„Se is ja noch jung. Wenn wenigstens ihr Bruder, der Baron Albert, noch leben würde!“, meinte Frau Wittig.
„Da wo det Schicksal zuschlägt, da is’et schlimm. Aber jut, dass’et die Reichen ooch so jeht. Warum soll’et nur immer die Armen treffen?“, antwortete Nele. „Gott sieht schon zu, dass et jerecht verteilt is.“
Clara schnappte ein paar Worte auf. Amalie, die sich bei ihr einhakte, weil sie so sicherer gehen konnte, ärgerte sich: „Da sind sie kaum aus dem Gottesdienst, schon geht’s über die anderen her. Immer dieses Getratsche! Hast du schon mal gehört, dass die Männer so reden?“
Hiltrud mischte sich ein. „Ach Großmutter, das ist halt bei uns auf dem Dorf so. Das müsstest du doch inzwischen wissen“, antwortete sie und hielt ihren Arm auf der anderen Seite hin. „Hier!
Kannst‘ dich bei mir auch festhalten. Nicht, dass du noch fällst.“
„Wo ist denn nun der Gerolf Gutenbrink?“, fragte sie. „Wollte der nicht zu Pfingsten kommen?“
„Er heißt Gerald. Wenn er gekommen ist, dann ist er vielleicht nach Moosburg zum Gottesdienst gefahren.“
„Gehört Borwitz von der Kirchgemeinde her nicht zu Elbkirchen?“
„Und wenn, Großmutter, er ist nicht verpflichtet, zu uns zu kommen.“
„Ich denk, er mag dich. Das ist ja wohl Grund genug.“
Clara schnitt ihr das Wort ab. „Mutter! Nun lass mal Trudchen in Ruhe! Es hat alles seine Richtigkeit.“
Zu Hause bei Lenaus kochten Else Schmidtchen und Ruth Strobel. Clara hatte beide angesprochen, denn bei zwölf Personen, der Junior hatte noch einen Studienfreund aus Dessau mitgebracht und Ludwigs aus Cohnsdorf waren auch eingeladen, wäre es ihr allein mit Else zu viel geworden. Den ganzen Samstag hatten die Frauen vorgekocht. Es gab Suppe, Fleisch, Gemüse und Kartoffeln, dann ein Dessert und Kaffee und Kuchen. Ihren Otto wusste Else zu Hause von der Schwiegertochter bekocht. Was die beiden jungen Studenten anging, sie sprachen – wie könnte es auch anders sein - über Flugzeuge. Friedrichs Schwiegervater und Paul Ludwig hörten genau hin. Auch Kurt, Pauls Sohn, zeigte sich interessiert.
„Die Lufthansa nimmt jetzt auf der Strecke Berlin-Königsberg die erste Nachtfluglinie auf“, erzählte Richard.
„Wie können die starten und landen, wenn sie nichts sehen“,
amüsierte sich Kurt Ludwig.
„Ganz einfach!“, erwiderte Richards Studienkollege. „Die Piloten orientieren sich an Signalfeuern. Das kann man alles machen.“
„Ich habe gelesen, die Amerikaner haben erstmals den Nordpol überflogen“, berichtete Paul Ludwig.
„Das waren zwei Piloten, die mit einer dreimotorigen Fokker den Pol überquert haben. Und drei Tage später haben der norwegische Forscher Roald Amundsen und der italienische General Umberto Nobile mit dem Luftschiff Norge den Nordpol überflogen.“
Allgemeine Bewunderung. Dass das geklappt hat, grenzt an ein Wunder, meinten die anderen. Da kann man mal sehen, was die Ingenieurskunst so alles zuwege bringt. Fantastisch! Die Frauen sahen sich an. Für sie waren andere Dinge fantastisch, aber nicht solche.
„Nun ja, dann strengt euch mal mit eurem Studium an! Ihr seid die Zukunft des Deutschen Reiches. Auf euch kommt es an“, sagte August Walther zu seinem Enkel und dessen Studienfreund.
„Solche tüchtigen Jungs wie ihr werden gebraucht. Es ist lang genug bergab gegangen. Nun wird es Zeit, dass es wieder bergauf geht. Frischer Wind belebt die Konjunktur.“
„Och, Vater!“, erwiderte Clara. „Das sind ja ganz neue Töne! Das ist man von dir gar nicht gewöhnt.“
„Wie auch?“, entgegnete er: „Du steckst hier in deinem Elbkirchen und siehst und hörst das ganze Jahr nichts anderes als Schule, Familie, Garten und Kirche. Nicht wahr?“ August sah sich um, aber keiner wollte ihm zustimmen.
„Letztendlich sind wir Frauen auch wichtig“, meinte Martha Ludwig. „Was wären unsere Männer und Kinder ohne uns Frauen und Mütter?“
Die anwesenden Frauen nickten ihr zu. Ja, stimmt.
„Es wird Zeit, dass auch die anderen Frauen in Europa ein Frauenstimmrecht bei den Wahlen bekommen, nicht nur bei uns.
Zum Beispiel in England, Irland, Spanien, Frankreich, Italien, Belgien. Wir sind genauso Gottes Geschöpfe wie ihr Männer“,
sagte sie.
„Aber wir sind die Krone der Schöpfung. Immerhin wurde Eva aus der Rippe von Adam gemacht und nicht umgekehrt.“ Paul Ludwig lachte und nahm sein Bierglas in die Hand. „Prost, Männer!“
Martha stieß ihren Mann mit dem Ellenbogen an. Clara, die ihre Freundin genau im Blickfeld hatte, beobachtete die kleine Szene.
Sie wusste, wie wichtig sich Paul nahm und Martha ihr Kreuz mit ihm hatte. Nach dem Essen zog sich die kleine Gesellschaft zurück. Die Frauen gingen in den Garten, die Jugend fuhr mit den Fahrrädern hinunter zur Elbe und die Männer machten einen ausgedehnten Spaziergang mit Ausnahme von August Walther.
Er wollte seine Füße ein wenig hochlegen.
Der Sommer kam und mit ihm die großen Ferien. Hiltrud freute sich über vierzehn Tage, die sie bei den Großeltern in Dewitz verbringen konnte, Elbkirchen endlich hinter sich lassend. Ihr Alltag war ihr zu eng geworden. Eingespielte Rituale, selten etwas Neues. Auch in der Schule und in der Fabrik nicht. Alle aus dem Dorf, bis auf die ganz Alten, waren auf den Feldern, wo die Hitze das Gras versengte und den Boden austrocknete. Immer dann fühlte sich Elbkirchen wie ausgestorben an und die Uhr schien still zu stehen. Nichts bewegte sich. Kein Lüftchen, auf der Straße kaum Menschen, manchmal bellte irgendwo ein Hund.
Selbst die Vögel suchten im Gebüsch Schutz vor der Sonne. Nein, das hatte sie siebzehn Mal mitgemacht, jetzt wollte sie mal etwas anderes erleben.
„Aber wir haben Hochwasser“, sagte ihre Mutter. „Willst du nicht lieber zu Hause bleiben?“
„Wir hatten schon öfter Hochwasser“, erwiderte Hiltrud.
„Nun ja, ich mein‘ ja nur.“ Clara zuckte mit den Schultern.
Otto Schmidtchen fuhr die Lehrerstochter mit dem Gespann zum Bahnhof. Zwei Tage später kam Richard nach Hause. Er hatte Semesterferien und wolle, wie er sagte, mal nur faulenzen. Aber daraus wurde nicht viel.
War Elbkirchen im Frühjahr vom Hochwasser verschont geblieben, so kam es jetzt mit großer Wucht. Zuvor waren in Böhmen gewaltige Wolkenbrüche niedergegangen, so dass in drei aufeinander folgenden Wellen von Juni bis Mitte Juli die Flut im Flussbett nur so dahin rauschte. Dies führte dazu, dass die Auwiesen überschwemmt wurden und der Pegel in Moosburg, Elbkirchen Altenfeld und Teschwitz bis auf mehr als die Hälfte des Dammes anstieg. Trotz angestrengter Arbeit der Landwirte und ihrer Helfer konnte nur ein kleiner Teil des Heus rechtzeitig geborgen werden. Manche Bauern trugen es zu großen Haufen zusammen und befestigten sie mit Ketten und Tauen, in der Hoffnung, sie vor der Überflutung retten zu können. Doch es war vergebliche Mühe, denn das reißende Wasser hob die Heuhaufen an, die sich dann im Kreise drehend in Bewegung setzten und davonschwammen. Schließlich wurden sie durch die Kraft des Wassers auseinandergerissen. Wie war es soweit gekommen?
Solange die Elbe gestiegen war, hatten die Dorfbewohner hinter dem Deich wenig vom Hochwasser mitbekommen. Aber als es plötzlich fiel, zeigte sich, dass das Wasser durch die Kiesschicht des Strombettes hindurchgesickert war und nun hinter dem Deich aus dem Erdreich hervorquoll. Das hatte dazu geführt, dass sich die Teiche im Dorf fast über Nacht gefüllt hatten. Von ihrer Küche aus konnte Clara nun auf den bis an den Rand gefüllten Teich sehen. Ihren Enten gefiel es.
„Wie konnten die Teiche so schnell voll laufen?“, fragte sie ihren Mann.
„Wie ich gehört habe, hat sich durch den Druck der Wassermassen das Schleusentor bei Teschwitz geschlossen, so dass das Wasser nirgendwohin abfließen kann. Dadurch staut es sich immer mehr an. Teilweise tritt es sogar schon über die Teichufer und überschwemmt die anliegenden Felder. Bei manchen Leuten im Dorf steht das Wasser im Keller knöchelhoch. Hans Schmidtchen hat mir gestern erzählt, sie müssen ihre Vorräte auslagern und in Sicherheit bringen.“
„Kann das bei uns auch passieren?“, fragte Amalie besorgt.
„Der Vater und ich beobachten das. Du musst dir keine Sorgen machen“, erwiderte Richard. „Wenn, dann trifft es Müllers, Wittigs und Schmidtchens eher. Ihre Häuser liegen tiefer als unsere Schule.“
„Und das Gut?“, fragte Clara.
„Dem wird nichts passieren. Das liegt genauso hoch wie die Kirche“, meinte Friedrich.
Richard erbat sich den Kirchenschlüssel von seinem Vater.
„Was willst du damit?“
„Ich wollte hinauf auf den Kirchtum und mir die Überschwemmung von oben ansehen.“
Friedrich begleitete seinen Sohn. Sie liefen den Hundeberg hinauf und dann über den Friedhof zur Kirche. Nachdem sie die zahlreichen Stufen im Turm hinaufgestiegen waren, bot sich ihnen ein erstaunlicher Blick durch das West- und Nordfenster.
Noch nie hatte Richard so viel Wasser gesehen. „Es ist ja alles überflutet. Die Wiesen, die Felder, die Gutsplantagen, sogar einige Höfe im Unterdorf stehen im Wasser!“, rief er.
Sein Vater erklärte ihm, so muss es vor mehr als 200 Jahren ausgesehen haben, als die Elbe noch in ihrem alten Flussbett dahinfloss. Damals sei Altenfeld noch eine Insel gewesen, die von der Elbe umspült wurde.
„Das ist ja gewaltig!“ Richard konnte sich immer noch nicht beruhigen.
„Die Landwirte klagen jetzt schon. Das Getreide steht bis zu den Ähren im Wasser und die Kartoffeln und Rüben sind gänzlich abgesoffen.“
„Ich habe gelesen, es wäre nicht das erste Mal, dass die ganze Ernte vernichtet ist“, erwiderte der junge Lenau.
„Das wird so sein. Ich denke an Schmidtchens. Sie haben ihre Felder nah am Deich. Die Gutsfelder dürften keinen Schaden genommen haben. Sie liegen weiter oben nach Riedern und Cohnsdorf zu.“
„Nein, da ist alles trocken“, antwortete Richard, der jetzt aus dem Südfenster blickte. „Dabei hieß es doch noch im Frühsommer, es soll eine gute Getreideernte geben. Hast du das nicht gesagt?“
„Ja, das dachten alle.“
Als sie die knarrende Holztreppe wieder hinabstiegen, meinte Richard: „Die Schlossherren haben anscheinend schon immer gewusst, wo sie was kaufen oder hinbauen.“
Es gab aber auch Menschen, die dem Hochwasser etwas Gutes abgewinnen konnten. Vor allem die Jungen aus Elbkirchen und Altenfeld. Es dauerte bis weit in den August hinein, ehe das Wasser wieder abfloss und die Elbauen begehbar wurden. Zeit für die 13- und 14jährigen Fische zu fangen, die es nun reichlich in den Senken und Dellen der zuvor überschwemmten Wiesen gab, und somit die häusliche Speisekarte bereicherten.