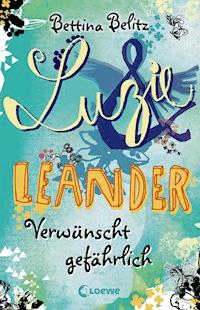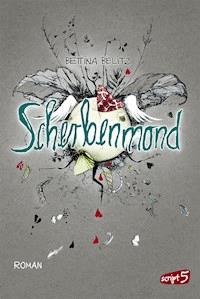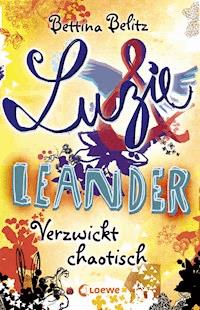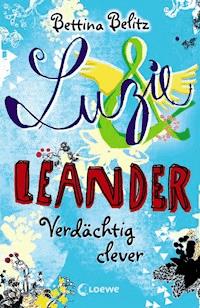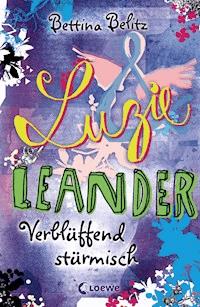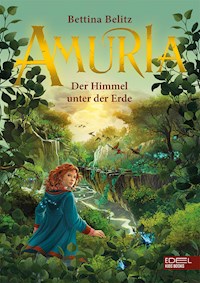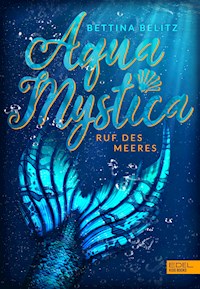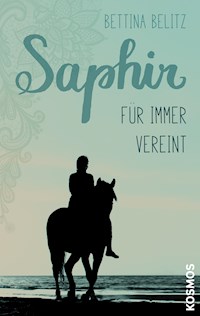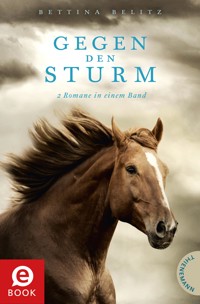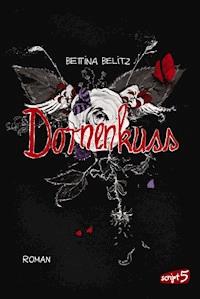
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: script5Hörbuch-Herausgeber: The AOS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Splitterherz-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Elisabeth Sturm hat am eigenen Leib erfahren, welche Gier, welche zerstörerische Kraft und welches Grauen in der Welt der Mahre lauern - und doch hält sie an ihrer Liebe zu Colin fest. Erschöpft und bis ins Mark verletzt, fürchtet und ersehnt sie den Tag, an dem er zurückkehrt und sie sich auf die Jagd nach Tessa machen, der uralten Mahrin, die ihr Glück bedroht. In Italien hoffen sie, Tessa auf die Spur zu kommen und Hinweise auf Ellies verschollenen Vater zu erhalten. Fast gegen ihren Willen findet Ellie in der Hitze, dem Meer und der Kargheit des Landes die Ruhe, nach der sie sich seit Monaten sehnt, und dankbar gibt sie sich diesem neuen, freien Leben hin. Als von unerwarteter Seite ein Verbündeter auftaucht, scheinen die Antworten auf Ellies Fragen plötzlich greifbar. Aber je tiefer sie in das Geheimnis der Mahre eindringt, desto größer werden Ellies Zweifel: Ist selbst ihre Liebe nicht stark genug, um gegen Colins Hunger zu bestehen? Mit der romantischen Liebesgeschichte von Elli und ihrem träumeverzehrenden Nachtmahr Colin gelang Bettina Belitz ein grandioses Debüt. Die Splitterherz-Trilogie ist All-Age Lesefutter vom Feinsten. Für alle, die gerne Paranormal Romances lesen, ein Muss. "Dornenkuss" ist der dritte Band einer Trilogie. Die beiden Vorgängertitel lauten "Splitterherz" und "Scherbenmond".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1117
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Vater, den ich immer dann am meisten vermisse, wenn ich am wenigsten damit rechne.
Auf der Welt sein: im Licht sein … standhalten dem Licht, der Freude … im Wissen, daß ich erlösche im Licht über Ginster, Asphalt und Meer, standhalten der Zeit, beziehungsweise Ewigkeit im Augenblick. Ewig sein: gewesen sein.
(Max Frisch, Homo Faber)
PROLOG
Es wird der Tag kommen, an dem du dir wünschst, jemand anderes zu sein.
Dein Körper wird dir lästig erscheinen und deine Angst als ewige Geißel deiner Gedanken. Du wirst deiner Gefühle überdrüssig werden, weil sie dich in ihrem immer gleichen Zirkel gefangen halten. Zweifel werden deine Träume stören, während dein Herz dich wild schlagend daran erinnert, dass du zu Höherem berufen bist.
Gib nach, wenn es beginnt. Stelle dich dem, was du sein kannst, sobald deine Ängste im Licht verglühen.
Du wirst über dich hinauswachsen, dich in dir selbst verlieren, ohne den Sturz hinab ins Nichts fürchten zu müssen. Du wirst dich schöner finden denn je, dich über deine Kraft und Anmut wundern und an deiner Leichtigkeit erfreuen.
Alles, was du dafür tun musst, ist, deine Augen zu öffnen und mich anzusehen. Tauche ein in meine blaugrüne Welt.
Ich fange dich auf, wenn du fällst, und wenn der Schlaf dich übermannt, findest du in meinem Schoß jene tiefe Geborgenheit, nach der du dich immer gesehnt hast.
Ich warte auf dich.
PHILIA
UN ATTIMO DI PACE
Ich war bereit. Mein Nacken hatte endlich die richtige Position auf dem Kissenberg unter meinem Kopf gefunden und meine Füße waren warm in die hellblaue Fleecedecke eingepackt, während ich Hüfte und Schultern in ein etwas dünneres Exemplar aus Baumwolle gewickelt hatte. Das Dröhnen der Rasenmäher, das an trockenen Tagen wie diesen unvermeidlich gegen Mittag einsetzte und jeglichen Frieden bis zur Dämmerung zerstörte, war soeben überraschend verstummt und sogar der Nachbar hatte aufgehört, die buschigen Seitenränder seines Vorzeigerasens mit der elektrischen Schere zu bearbeiten.
Doch vollkommene Stille wollte ich nicht. Deshalb lag mein rechter Zeigefinger startklar auf meinem MP3-Player, um beim ersten Sonnenstrahl, der durch die Wolken brach, ein Lied abzuspielen, dessen Urheber einen noch dämlicheren Namen trug als der Titel selbst. Fatal Fatal von DJ Pippi. Aber für mich war der Song seit dem Durchforsten der Chill-out-Plattensammlung meines Bruders der Inbegriff des Sommers, ja, eine Hymne an das Nichtstun, das Entspannen, und genau darauf wartete ich, ungeduldig und erfüllt von beinahe krankhafter Vorfreude. Denn ich hatte nicht viel Zeit, mich zu entspannen. Mein Computer wartete im Stand-by-Modus auf mich. Ich musste nur die Maus bewegen, damit er wieder zu rechnen und mein Gehirn zu arbeiten begann. Ich hatte mir heute Nacht nur knappe drei Stunden Schlaf erlaubt, wie üblich zwischen zwei und fünf; schon bei Anbruch der Helligkeit und dem elend fröhlichen Vogelgezwitscher vor meinem Fenster hatte ich mich wieder an meinen Schreibtisch gequält und weitergeforscht – um schon nach wenigen Klicks zu ahnen, dass es sinnlos sein würde. Ich fand die heiße Spur nicht, nach der ich suchte, geschweige denn den roten Faden, den es geben musste – ja, es musste ihn geben, also warum zum Henker offenbarte er sich mir nicht?
Unruhig wälzte ich mich auf die Seite und zog die rutschende Decke wieder über meine Hüfte. Sollte ich jetzt schon meine Ruhepause beenden? Und weitersurfen? Nein, es hatte keinen Zweck, ich hatte vorhin nichts mehr erkennen können auf dem Bildschirm, weil meine Augen überreizt und ausgetrocknet waren. Gedanklich ordnen konnte ich all die Informationen, die auf mich einprasselten, sowieso nicht mehr. Ich musste mich ausruhen. Ich wollte es ja auch. Erst recht, nachdem ich wieder unfreiwillig auf einer dieser kunterbunten Touristikseiten gelandet war, die mir genau das versprachen: tiefe, glückselige azurblaue Entspannung. Müßiggang und Nichtstun in der Wiege der mediterranen Kultur. Italien. Italien, das gelobte, ferne Land, das mich wahlweise an den Rand des Zusammenbruchs brachte oder mit Entzücken erfüllte – und mir das verweigerte, was es verbarg.
Mahre. Mahre und vielleicht meinen Vater.
Und Tessa.
Genau das konnte ich nicht glauben, wenn ich all die Internetseiten durchforstete, die Google ausspuckte, sobald ich »Italien« in das Suchfenster tippte. Natürlich gab es da – vorausgesetzt, man hatte die unzähligen Seiten mit Urlaubsangeboten hinter sich gelassen – nicht nur Verheißungen. Nein, Italien hatte zum Beispiel verheerende Erdbeben hinter sich, litt unter einer korrupten Politik mit einem zweifelhaften Staatschef (ich hatte mich sogar kurz gefragt, ob er möglicherweise ein sexbesessenes Halbblut war), im Süden herrschten die Mafia und eine hohe Arbeitslosigkeit, ungelöste Flüchtlingsprobleme gärten vor sich hin, die Wirtschaft krankte, aber diese Meldungen wirkten beinahe niedlich und unbedeutend zwischen dem Übermaß an südlicher Schönheit, die sich mir darbot, vor allem auf Blogs von Reisenden und Seiten über Kunst und Architektur. Italien war nicht nur das sagenumwobene Urlaubsland, sondern auch der Inbegriff künstlerischer Ästhetik. Vor lauter Verzweiflung hatte ich mir gestern stundenlang die Gemälde der Sixtinischen Kapelle angeschaut und gehofft, versteckte Hinweise auf Mahre zu finden. Ich fand allerhand, doch Mahre waren es nicht.
Es machte mich schier verrückt. Die kargen Informationen, die ich vorher bereits mühsam gesammelt hatte, passten nicht mit den Ergebnissen meiner Recherchen zusammen und waren überdies bizarr, kryptisch und voller unausgesprochener Albträume.
Information Nummer eins: Mein Vater war in Italien verschollen, immer noch. Kein einziges Lebenszeichen. Seit Monaten warteten wir auf irgendeinen Hinweis, der uns sagte, dass er noch lebte, und wenn er noch so winzig war. Nichts. Mama hatte sogar schon angefangen, um ihn zu trauern. Mein Magen verkrampfte sich bei jedem Telefonklingeln, das durch das stille Haus schallte, weil ich hoffte, er sei der Anrufer. Doch dieses Land hatte ihn verschluckt. Über Information eins wollte ich nie lange nachdenken. Sie schmerzte mich zu sehr, schnürte mir die Kehle zu.
Also weiter zu Information Nummer zwei: Tessas Lebensmittelpunkt befand sich angeblich in Süditalien. Tessa. Oh Gott, Tessa … Colins Mutter. Und Geliebte. Sie war so alt und mächtig, dass selbst ein brutaler Genickbruch ihrem irren, lüsternen Kichern nichts anhaben konnte. Sie hatte Colins Leben von Beginn an beeinflusst und unterwandert; sie spürte ihn gnadenlos auf, sobald er glücklich war, um sich zu nehmen, was sie als ihr Eigentum betrachtete: ihr Kind. Colin Jeremiah Blackburn, meine große Liebe und, wie es schien, mein düsteres Schicksal. Ich konnte nicht an Colin denken, ohne an Tessa zu denken, aber ich konnte auch nicht an Colin denken, ohne an François zu denken, jenen Mahr, der meinen Bruder befallen und ihm jegliche Lebensenergie aus dem Leib gesaugt hatte, bis Paul an einer Herzschwäche erkrankte und beinahe starb. In letzter Sekunde hatten Gianna und Tillmann ihn wiederbeleben können.
»Verflucht, da muss es doch einen Zusammenhang geben!« Ich schrak zusammen und lauschte argwöhnisch, als ich bemerkte, dass ich meine Gedanken versehentlich laut ausgesprochen hatte – ein Ausruf, der sich anhörte wie das aufgebrachte Zischen einer Schlange. Ich mahnte mich trotz meiner bleischweren Lider und dem Schwindelgefühl in meinem Kopf zur Konzentration. Wenn ich schon nachdachte, bis die Sonne sich zeigte, sollte ich es vernünftig tun.
Ich war bei Information Nummer zwei stehen geblieben. Tessa. Tessa, die sich erneut auf den Weg gemacht hatte, um Colin heimzusuchen, weil wir für einen kurzen Moment Glück empfunden hatten. War es wirklich Glück gewesen? Oder hatten wir sie lediglich provoziert? Was würde sie wütender machen? Mit einem beunruhigenden Gefühlsmix aus Erregung und Wut dachte ich an jene Minuten zurück, die Colin und ich im Wald bei den Wölfen verbracht hatten, nachdem François raubunfähig geworden war und Colin sich von seiner Vergiftung befreit hatte. Ich war geradezu berauscht gewesen und sicher, alle Hürden überwinden zu können, wenn wir nur um unser Glück kämpfen und versuchen würden, Tessa zu töten.
»Tessa töten …«, flüsterte ich mit jähem Spott mir selbst gegenüber. Tessa töten? Ja, es war der einzige Weg, der Colin und mir eine Zukunft ermöglichen konnte, und es gab vielleicht eine Tötungsmethode, von der ich noch nichts wusste und die Colin mir überbringen wollte. Das hatte er mir versprochen. Doch nachdem die Euphorie des Sieges über François abgeklungen war und meine Wunden zu schmerzen begonnen hatten, war mir langsam bewusst geworden, was wir uns da vorgenommen hatten.
Wir, nicht ich. Ich war nicht die Einzige, die Tessa tot sehen wollte. Tillmann wollte es auch. Sein Leben hatte sie ebenfalls verdunkelt. Nicht nur das – sie hatte seinen Körper verändert, ihn schneller reifen lassen, ihm seine Fähigkeit zu schlafen geraubt. Und wenn Colin nur einen Funken Verstand in seinem sturen Mahrschädel hatte, würde er sie ebenfalls töten wollen. Alles, was ihm in seinem Dasein Schreckliches widerfahren war, hatte er ihrem Fluch zu verdanken. Ob sie ihn dieses Mal eingeholt hatte? Hatte er überhaupt fliehen können? Oder hatte sie den Dämon in ihm neu entfacht?
Ich rieb meine Füße nervös aneinander. Wie immer beim Nachdenken blieb ich bei Information Nummer zwei hängen und kam nicht weiter. Allein Tessas Name ließ mich innerlich erstarren. Im Frühjahr hatte François sie für eine Weile aus meinem Kopf verdrängen können; meinem Bruder war es so schlecht gegangen, dass wir darauf bauen mussten, ihn erlösen zu können und Tessa dabei nicht versehentlich anzulocken. Was funktioniert hatte, da Colin auf einer Insel lebte und wir bei unseren wenigen Begegnungen auf dem Festland nicht sonderlich glücklich miteinander waren – jedenfalls nicht dauerhaft. Doch jetzt gab es zwei Mahre, die ungefragt in meine nächtlichen Träume eindrangen und mich schweißgebadet hochschrecken ließen: François, dieser schleimige, gierige Wandelgänger, der mich fast bei lebendigem Leibe hatte verwesen lassen, als ich ihn bei seinem Befall erwischte, und Tessa, die François’ ohnehin schon ekelerregende Bösartigkeit um ein Vielfaches übertraf.
»Aber wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt!«, murmelte ich in meine Faust, auf deren Knöcheln ich in meiner Anspannung wie ein Kaninchen herumnagte. »Es ist möglich …«
Tot war François nicht. Nur raubunfähig. Aber das genügte, damit er keinen Schaden mehr anrichten konnte, und war für ihn eine größere Strafe, als ihn umzubringen. Auf ewig hungrig. Eine andere Chance hatten wir nicht gehabt. Wegen seines geringeren Alters war Colin nicht in der Lage gewesen, ihn im Kampf vollends zu töten.
Doch bei Tessa konnten wir uns solche Spielereien nicht erlauben. Niemals würde Colin so viel Wut und Zorn in mir heranzüchten können, um sie damit zu vergiften. Tessa war selbst voller Gift. Außerdem war ich nicht mehr bereit, als Brutstätte für schlechte Gefühle zu dienen. Schlechte Gefühle hatte ich von ganz alleine genug und leider überwältigten sie mich meistens dann, wenn ich versuchte, mich von den Strapazen meiner sinnlosen Recherchen zu erholen. Wie jetzt.
Meine Vorfreude auf ein paar dösige Sonnenstunden im Garten war auch an diesem Nachmittag eine trügerische Angelegenheit gewesen. Sie war es jedes Mal. Zu schnell konnte sie in Gereiztheit und Wut umschlagen, weil ich nicht bekam, was ich wollte – nein, was ich brauchte. Ich brauchte den Sommer wie eine lebensrettende Infusion, die mir immer wieder im letzten Moment verwehrt wurde, weil man beschloss, dass ich auch ohne sie noch einige Zeit vor mich hin vegetieren konnte. Ja, so fühlte es sich an, obwohl ich wie eine Besessene arbeitete – als würde ich nur vegetieren.
Hör auf zu denken, Ellie, knurrte ich mich im Geiste an. Es konnte sich nur noch um wenige Augenblicke handeln, bis mir die ersehnte Infusion aus Wärme und Erholung verabreicht wurde, und dann sollte ich sie genießen und neue Energie daraus ziehen. Ich hatte das freie Stück blauen Himmel während meiner sinnlosen Grübeleien genau beobachtet und auch den Zug der Wolken. Gleich würde der kalte, böige Wind sich legen – ich erkannte es an den gezackten Rändern der Wolke über mir, die nun in einem grellen Hellorange angestrahlt wurden. Ich schob mir die Sonnenbrille auf die Nase, lehnte mich zurück und kostete die letzten Sekunden aus, bis die Sonne sich ihren Weg freigekämpft hatte und mir Wärme spenden würde. Wärme und wenigstens eine Illusion dessen, was die Klänge in meinen Ohren mir zeitgleich vermitteln würden.
Denn dieser Frühsommer war bislang eine Beleidigung. Ich war fest davon überzeugt gewesen, dass der sonnige Frühlingstag, an dessen Abend Colin mich mit sich ins Meer genommen hatte, um mich dann den Wellen zu überlassen, der Auftakt jener großen Erlösung gewesen war, nach der ich mich den gesamten harten Winter über gesehnt hatte. Doch der Westerwald entschied sich anders. Er entschied sich für Regentage, ständigen Wind, kalte Nächte und er gönnte der Sonne nur kurze Zwischenspiele, bis die nächste Wolke vor ihre scheuen Strahlen wanderte und es ihr nicht erlaubte, den winterharten Boden zu lockern. Noch immer schien der Frost in dem lehmigen Grund unseres Gartens festzusitzen.
Auch jetzt würden mir nur wenige Momente des Friedens geschenkt werden. Ich kannte dieses frustrierende Spiel aus Licht und Schatten zur Genüge. Zeigte die Sonne sich, flaute der Wind am Boden ab und ich konnte mit einer raschen Bewegung die dünnere Decke von meinem Körper schlagen. Doch weit oben am Himmel ließ der Wind sich seine Macht nicht nehmen und sorgte zuverlässig für stetigen Wolkennachschub. Manchmal musste ich mir Mühe geben, um es nicht persönlich zu nehmen.
Selbst Mama, die zu den Menschen gehörte, für die schlechtes Wetter nur eine Folge von schlechter Kleidung war, hatte vor dem Wind kapituliert und uns eine sündhaft teure Liegeinsel aus wetterbeständigem Plastikrattan gekauft. Über ihrer schneeweißen Matratze – garniert mit zahlreichen Kissen, die einem dank ihres elektrostatisch aufgeladenen Synthetikbezuges ständig Stromschläge versetzten – erhob sich ein muschelförmiger Schirm, der Wind und Sonne abhalten sollte. Das tat er nur unzureichend, doch er bot mir hervorragenden Sichtschutz vor werkelnden Nachbarn und half mir dabei, die trostlose Realität um mich herum für ein Weilchen auszublenden, bis der Wind mich ausgekühlt und die Sonne aufgegeben hatte.
Während ich auf den gleißenden Wolkenrand starrte, begannen meine Gedanken sich von ganz allein wieder zu erheben und mich zu mahnen, sich mit dem zu streiten, was mein Körper von mir verlangte. Ich wollte mich allen Ernstes erholen, während ich doch jede Sekunde darauf wartete und hinarbeitete, endlich einen Mord begehen zu können? Doch wie immer, wenn ich mir diese Tatsache verinnerlichte, wurde der Wunsch, mich vorher noch einmal gründlich auskurieren zu können, fordernder denn je. Was ich brauchte, war Erholung. Stillliegen. Besonntwerden.
Nein. Was ich brauchte, war ein Plan.
Doch konnte man Pläne fassen, wenn man ständig am Rande des Zusammenbruchs wandelte? Oft fühlte sich meine Haut so verwundet an, dass ich glaubte, jede zu schnelle Bewegung könne sie an all den Stellen aufreißen lassen, die gerade erst notdürftig verheilt waren. Immer wieder suchten mich Kopfschmerzattacken ungeahnten Ausmaßes heim. Ich verabscheute Hektik und Aktionismus wie nie zuvor, obwohl ich bei meinen Recherchen nichts anderes tat, als mich in hektischem Aktionismus zu verlieren, und Mamas Bitten, mich doch wenigstens pro forma um eine Zukunft zu bemühen, hatten in den letzten Wochen erheblich an mütterlicher Nachsicht eingebüßt. Wozu einen Job annehmen, wenn es sein konnte, dass ich ihn am nächsten Tag schon wieder aufgeben musste, wenn … Ja, wenn. Wenn, wenn, wenn. Wie so oft verfluchte ich im Geiste die Diskrepanz zwischen dem Zeitgefüge der Mahre und dem von uns Menschen. Sie hatten so schrecklich viel Zeit dank ihrer vermaledeiten Unsterblichkeit.
Colin hatte mir das Versprechen gegeben, nach der zweiten Tötungsmethode zu forschen und sie mir mitzuteilen. Denn die gängige fiel weg; Tessa war zu alt und damit viel zu stark, um Colin in einem Duell gegen sie antreten zu lassen. Er würde sie nicht besiegen können. Ja, das Versprechen hatte ich mir erbettelt – nur über das Wann hatten wir nicht geredet. Ich hoffte, er würde sein Versprechen wahr machen, bevor meine Hand zu zittrig war, um eine Pistole zu halten. Eine Pistole? Wohl kaum, eine Kugel würde Tessa nicht töten können. Vielleicht musste man ihr einen Pfahl ins Herz schlagen, wie bei den Vampiren? Kam mir albern vor. Oder musste man ihr am Ende den Kopf abhacken?
Ich rieb erneut meine Füße aneinander, die trotz ihres Fleecekokons kalt geworden waren. Pfahl ins Herz und Kopf abhacken war ekelhaft, aber zu einfach. Nein, es musste etwas anderes sein. Etwas Gewichtigeres. Und ich würde erst wieder Ordnung in meine Gedanken und mein Leben bringen können, wenn ich darum wusste und herausgefunden hatte, wo Papa war und was es mit den Mahren in Italien auf sich hatte. Bis dahin würde ich recherchieren und in meinen wenigen Erholungspausen nach der Sonne lechzen und hoffen, dass sie meine Haut nicht nur bräunte, sondern auch dicker und robuster machte, damit ich mich dieser Aufgabe stellen konnte.
Mama wusste nichts von meinen unausgegorenen Zielen. Sie wusste nicht einmal genau, was in Hamburg eigentlich geschehen war. Weder Paul noch ich hatten uns überwinden können, ihr auch nur irgendwelche Einzelheiten zu erzählen, obwohl wir es uns anfangs fest vorgenommen hatten. Doch wir schoben das Gespräch auf und machten uns gegenseitig vor, uns zuerst von den Strapazen des Kampfes und der Fahrt zu den Wölfen ausruhen zu wollen, und sobald einige Zeit verstrichen war, zweifelten wir daran, dass Mama die Wahrheit verkraften konnte. Vielleicht redeten wir uns das auch ein.
Paul scheute sich, Mama zu gestehen, dass er zwischenzeitlich schwul geworden war, weil er von einem Wandelgänger befallen wurde (mit dem er wiederum sein Schwulsein halbherzig ausgelebt hatte), und ich hatte Angst, sie würde mich einsperren, sobald sie erfuhr, was Colin alles mit mir angestellt hatte und dass der gerade erst verheilte Bruch in meiner Hand von ihm rührte.
Doch Mama war nicht auf den Kopf gefallen. Ihr musste vollkommen klar sein, dass mehr geschehen war, als wir berichtet hatten. Und da Papa immer noch verschollen war, mutierte sie das erste Mal in ihrem mütterlichen Leben zur Glucke und kontrollierte jede meiner Bewegungen. Lediglich mein Computer, den ich mit mehreren Passwörtern schützte, war mein alleiniges Hoheitsgebiet geblieben.
Paul hatte sich ihrer Kontrollsucht geschickt entzogen. Er musste in Hamburg noch etliche Dinge regeln und ließ sich schon lange keine elterlichen Befehle mehr erteilen. François hatte nichts als Chaos hinterlassen. Abgesehen von der Räumung eines verdreckten, rattenverseuchten Kellerlochs unterhalb seiner Galerie hatte Paul die undankbare Aufgabe, seine Wohnung aufzulösen und einen der vielen gierigen Hamburger Immobilienhaie mit deren Verkauf zu betrauen. Auch versuchte er, den gemeinsamen Erbvertrag mit François rückgängig zu machen, was sich als schwierig herausstellte, doch François kam dabei glücklicherweise als Ansprechpartner nicht mehr infrage.
Schon wenige Tage nach seiner Vergiftung durch meine von Colin ausgesaugte Wut wurde François festgenommen, da er sich wahllos Hamburger Passanten auf den Rücken krallte und versuchte, ihre Träume zu trinken, was die Leute im günstigsten Falle als lästig empfanden und sie im schlimmsten Falle vorübergehend an den Rande einer Psychose katapultierte.
François’ Übergriffe waren harmlos, aber auffällig genug, um ihn als nicht gesellschaftsfähig einzuordnen und der geschlossenen Psychiatrie zu übergeben, in der er sich vermutlich selbst Geschossen wie Valium gegenüber als äußerst robust erwies. Doch er konnte wenigstens in ein abgesichertes Einzelzimmer verfrachtet werden und damit keinen weiteren Schaden bei den Touristen der Hansestadt anrichten.
Paul überließ die Verwaltung von François’ Besitz diversen Anwälten, denn es belastete ihn bereits genug, sich um seine eigenen Habseligkeiten kümmern zu müssen, von denen er kaum etwas behalten wollte – nicht einmal seinen geliebten weißen 911er Porsche, mit dem ich damals zu Colin nach Sylt gebrettert war. Ihm schien alles, was mit François zu tun hatte und er sich in der Zeit zusammen mit ihm angeschafft hatte, beschmutzt und mir ging es genauso. Kurz und gut – wir konnten Mama mehr schlecht als recht erklären, warum Paul so unvermittelt seine Galerie und seine Wohnung aufgegeben hatte und sein gesamtes vorheriges Leben in den Boden stampfte. Noch weniger leuchtete ihr ein, wieso er und seine kleine Schwester sich in einer solch desolaten Verfassung befanden, nachdem sie heimgekehrt waren. Meine Blessuren und mein gebrochener Finger waren nicht zu übersehen gewesen. Pauls angeschlagener Gesamtzustand wog fast noch schwerer. Ich hatte gehofft, all seine Zipperlein, ja, sogar sein Herzfehler würden verschwinden, sobald wir ihn aus François’ Klauen befreit hatten. Aber so war es nicht. Er schlug sich mit körperlichen Unzulänglichkeiten herum, die ansonsten Männer jenseits der Midlife-Crisis heimsuchten, aber gewiss nicht Mittzwanziger wie ihn. Und wahrscheinlich war es in Mamas Augen äußerst verdächtig, dass ich neuerdings die Nächte im Internet totschlug und dann nachmittags, bleich und mit Ringen unter den Augen, ein sonniges Plätzchen suchte und jede größere Aufgabe mit den Worten ablehnte, ich müsse mich ein bisschen erholen.
So wie ich es jetzt wieder tat, in diesem kurzen Moment der Vorfreude, während der Wind neue Kraft entfachte, um die Sonne von der riesigen watteweißen Wolke über mir zu befreien. Ich atmete langsam aus. Frieden. Nur einen einzigen Augenblick des Friedens. Ich musste heilen. Heilen, um denken und weitermachen zu können. Um an die Information Nummer drei zu gehen und den roten Faden zu suchen … wir brauchten den roten Faden …
»Ellie! Ellie?«
Die Sonne war da, aber mein Frieden vorbei. Mamas Rufen hatte ihn zerstört. Ich winkelte meine Beine an, damit sie mich nicht sehen konnte, wollte mich ganz in die Rundung der Muschel schmiegen, für den Rest der Welt unsichtbar. Doch das war sinnlos. Mama wusste, wo ich steckte. Ihre Schritte näherten sich bereits.
Ich biss auf meine Unterlippe, um nicht ungerecht zu werden und sie anzuschreien, ihr bitterste Vorwürfe zu machen. Sie hatte mich gerade eine volle Stunde in Frieden gelassen, obwohl sie anfangs noch direkt neben mir Unkraut gejätet hatte und Hilfe hätte gebrauchen können. Eine Stunde, in der sich die Sonne geschätzte zehn Minuten lang gezeigt hatte. Doch dafür konnte Mama nichts.
»Ellie, das solltest du dir ansehen.«
Seufzend zog ich die Stöpsel aus meinen Ohren.
»Was?«, blaffte ich ungehalten und erinnerte mich wie in einem Déjà-vu an diesen bedrückenden Moment vor einem Jahr, als Papa mich aufgefordert hatte, die Begrüßungskarten bei den Nachbarn einzuwerfen. Damals hatte ich ähnlich reagiert und mich ähnlich gestört gefühlt. Doch hätte ich je glücklicher sein können als an diesem kalten Maiabend, als alles erst anfing? Als Papa noch bei uns war, ich Colin kennenzulernen und ihn zu lieben begann, als alles noch möglich war?
Colin? Ein Blitz fuhr durch meinen Bauch. »Das solltest du dir ansehen«, hatte Mama eben gesagt und es hatte sich bedeutsam angehört. Nicht so bedeutsam, dass sie Papa meinen konnte. Nein, wenn Papa überraschend zurückkehrte, würde sie andere Worte wählen.
Aber konnte es sein, dass – dass Colin …? Ich wagte nicht, meinen Gedanken zu vollenden, denn mein Herz pulsierte nur noch synkopisch, statt in einem vernünftigen Rhythmus zu schlagen. Ein unerklärlicher Fluchtimpuls trieb mich dazu, beide Decken von meinem Körper zu strampeln, um weglaufen zu können, falls meine Ahnung sich als richtig erwies.
Mamas Worte hatten nicht nur bedeutsam, sondern auch skeptisch geklungen und sie war gegenüber meiner Verbindung zu Colin seit den Geschehnissen des Winters überaus skeptisch eingestellt. Ja, es konnte sein, dass Colin gekommen war und sie mich darauf hinweisen wollte, doch fühlte ich mich schon imstande, all das zu tun, was seine Anwesenheit erfordern würde? Fühlte ich mich imstande, ihm in die Augen zu sehen?
»Was sollte ich mir anschauen?«, fragte ich Mama erneut, weil sie nicht antwortete. Ich stand auf und schlüpfte in meine Schuhe. Meine dunkle Brille behielt ich an, obwohl die Sonne gerade wieder verschwand. Ich hatte das Gefühl, die schwarzen Gläser schirmten alles Echte, Wahre und Unausweichliche von mir ab. Sie würden mir einen Vorsprung verschaffen, falls meine wildesten Hoffnungen und Befürchtungen sich erfüllen sollten.
»Komm mit.« Mama drehte sich um und lief behände die Steinstiege zu unserem Wintergarten hoch, um Papas Büro anzusteuern, von dessen Fenster aus wir einen ungehinderten Blick auf unseren Hof hatten. Mein Atem stockte, als ich meine Lider hob und nach unten schaute. Zorn und bittere Enttäuschung schnürten mir schlagartig die Kehle zu und wurden für einen Moment so überwältigend, dass ich am liebsten wie ein pubertierendes Mädchen nach oben auf mein Zimmer gerannt wäre und mich aufs Bett geschmissen hätte. Mama konnte nicht entgehen, dass mir das Blut heiß wie Lava ins Gesicht schoss und meine Lippen zitterten, doch ich verschränkte betont kühl die Arme vor meiner Brust; eine Haltung, die Mama in der letzten Zeit selbst immer öfter einnahm, wenn sie sich meiner Sturheit und der meines Bruders nicht mehr gewachsen fühlte. Trotzdem quälte sich mein Atem seufzend durch meine Kehle, als die Enttäuschung dumpf in meine Oberarme stieg. Wieso zum Henker war ich enttäuscht, wenn ich doch eben noch der Meinung gewesen war, es sei zu früh für ein Wiedersehen? Und wieso konnte es überhaupt zu früh sein? Ich sehnte mich doch nach Colin. Was nur stimmte da nicht mehr? War es die Tatsache, dass wir uns begegnen würden, um einen Mord zu vollbringen? Es war ein Mord an einem Dämon, der uns vernichten wollte und unser gesamtes Dasein infrage stellte. Wir mussten es tun! Ich hegte keinen Zweifel, dass Tessa mich bei einer neuerlichen Begegnung bemerken würde; noch einmal würde ich nicht davonkommen. Und dann gab es nur zwei Varianten: Entweder sie verwandelte mich ebenfalls oder sie tötete mich. Ich konnte mir vorstellen, dass dazu ein Blick ihrerseits genügte. Vielleicht sogar ein Gedanke. Bei François hatte ich Skrupel gehabt, den Tod eines anderen Wesens zu beschließen. Bei Tessa blieb mir keine andere Wahl. Sie würde jeden killen, der sich ihr in den Weg stellte; nicht alleine mich, sondern meine ganze Familie.
Lediglich Tillmann würde ein anderes Schicksal ereilen – ihn würde sie niemals töten. Sie würde ihn zum Mahr werden lassen. Vielleicht würde es sogar so ausgehen wie in meinen Träumen. Tessa würde Tillmann nicht nur verwandeln, sondern ihn darauf ansetzen, mich zu jagen und zu befallen. Mein bester Freund würde zu meinem ärgsten Feind werden. Am Wahrheitsgehalt dieser Träume zweifelte ich nie. Ich wusste, dass sie keine Ausgeburten meiner Fantasie, sondern eine Warnung waren. Wahrscheinlich wusste Tillmann es auch.
Wir hatten sie wütend gemacht. Zum ersten Mal hatte Colin sich ihr nicht gefügt, indem er floh und das Mädchen, das er liebte, verließ. Er hatte gegen sie gekämpft und er war zu mir zurückgekehrt. Und obwohl wir beide gespürt hatten, dass sie abermals Colins Fährte aufgenommen hatte und uns wittern konnte, hatten wir uns noch einmal ineinander verloren, bevor Colin ins Meer gegangen war. Tessa musste schäumen vor Zorn und Rachsucht. Ein drittes Mal würde es nicht geben – es sei denn, wir kamen ihr zuvor.
Aber ich brauchte Colin nicht nur, um Tessa zu töten. Ich brauchte ihn auch, um Papa zu finden.
Und ich brauchte ihn für mich. Für meine Seele. Wieder konnte ich ein Seufzen nicht unterdrücken, denn in meine Sehnsucht mischten sich Unruhe und Angst. Ich war mir selbst ein Rätsel.
»Kennst du sie?«, wollte Mama wissen und tat so, als habe sie von meinen Gefühlswallungen nichts bemerkt.
»Ja«, erwiderte ich. Ich klang nun deutlich genervt; eine Stimmung, die mir lieber war als Enttäuschung und Ratlosigkeit. Von hier oben hatte ich Gianna Vespucci und ihren verlotterten Kleinwagen sofort erkannt. Warum sie allerdings in der Hocke auf dem Kopfsteinpflaster unserer Auffahrt kauerte, die Stirn auf die Unterarme gelegt und die Haare nur knapp über dem Boden, leuchtete mir nicht ein. Unseren Nachbarn sicherlich auch nicht, die diese kuriose Szenerie garantiert schon sensationsgierig unter die Lupe nahmen. Spätestens heute Abend würde Giannas Ankunft zum neuesten Dorftratsch gehören – wie alles, was wir Sturms taten oder nicht taten. Auf der Beliebtheitsskala befanden wir uns nur noch knapp über der versoffenen Ponybesitzerin, die gerade wieder ihren Führerschein verloren hatte und spätabends gerne in ihrer Wohnung randalierte, bösen Gerüchten zufolge sogar ihren Mann verprügelte. Weder soffen noch randalierten wir, doch wir hatten einen fortgelaufenen Vater und eine äußerst unkonventionelle Mutter, die sich ab und an mit meinem Biologielehrer zum Yoga traf und in Bonn für ein Kunstgeschichtestudium eingeschrieben hatte, obwohl sie sich doch eigentlich langsam auf ihre Großmutterzeit vorbereiten sollte. Wir waren nicht Mitglied im Schützen- und auch nicht im örtlichen Fußballverein geworden und im Winter hatten wir nur sporadisch Schnee geschippt. All das genügte, um in einem 400-Seelen-Dorf in Ungnade zu fallen und an den Rand der Gesellschaft gerückt zu werden. Dass nun eine junge Frau samt Katzentransportbox auf unserer Einfahrt hockte und sich wimmernd vor- und zurückwiegte, war da nur Öl im Feuer.
»Eine Freundin von dir?«, fragte Mama vorsichtig. Sie kannte sich schon lange nicht mehr in meinem Bekanntenkreis aus. Zu meinen früheren besten Freundinnen hatte ich den Kontakt radikal abgebrochen. Wir hatten uns nichts mehr zu sagen. Auch Maike und ich waren geschiedene Leute. Lediglich Tillmann war mir geblieben. Er befand sich momentan jedoch bei Paul in Hamburg und ließ sich von Dr.Sand wegen seiner chronischen Schlaflosigkeit untersuchen.
Tillmann hatte mich gefragt, ob ich mitkäme, doch ich fürchtete die Speicherstadt, wollte nicht wieder an jenen Platz zurückkehren, an dem ich mich in Todesangst auf dem Boden gewunden hatte, getreten und gedemütigt von meinem eigenen Freund. Ich hatte nicht sofort abgelehnt – schließlich war es möglich, dass Dr.Sand mir bei meinen Recherchen behilflich sein konnte. Aber dann entschied ich mich anders. Ich schätzte Dr.Sand als jemanden ein, der gerne die Regie übernahm und mich zudem wie eine Art Tochter betrachtete. Wenn ich ihn einweihte, würde er mich keinen Schritt mehr allein gehen lassen und schon gar nicht würde er es dulden, dass ich alles daransetzte, einen Mahr zu töten. Dazu fühlte er sich meinem Vater zu sehr verpflichtet. So hatte ich auch Tillmann eingebläut, ihm ja nichts von unserem Vorhaben anzudeuten. Aber Tillmann pflegte momentan sowieso wieder eine seiner Rückzugsphasen, in denen er lieber stumm blieb, als seine Gedanken mit mir oder einem anderen Menschen zu teilen. Erst wenn er mit seinen Schlussfolgerungen im Reinen war, setzte er zu epischen Lehrervorträgen an. Ich kannte dieses Phänomen schon, was aber nicht hieß, dass ich es klaglos hinnehmen konnte. Ich wusste, dass er nachdachte, viel nachdachte, vielleicht ebenso viel wie ich. Aber er weigerte sich, mich in seinen Kopf schauen zu lassen. Wir überlegten und recherchierten seit Wochen getrennt vor uns hin – was sollte das für einen Sinn haben? Es war nicht effektiv. Doch Tillmann zum Reden zu drängen, endete stets mit noch verbissenerem Schweigen seinerseits. Und so hatte ich ihn ziehen lassen. Allerdings war sein Besuch bei Dr.Sand auch mir wichtig. Ich wollte endlich wissen, was mit ihm geschehen war und warum er nicht mehr schlief.
Nebenbei half Tillmann Paul, seine Altlasten zu beseitigen oder wahlweise zu Geld zu machen. Sein Vater hatte ihm dies widerstrebend gestattet, nachdem Paul ihm ein lobhudelndes Zeugnis über sein »Praktikum« in der Galerie ausgestellt hatte.
Deshalb wunderte es mich umso mehr, dass Gianna ohne jegliche Voranmeldung hier aufschlug und nicht in Hamburg war. Auch passte ihr augenscheinlich schlechter Gesamtzustand nicht zu jener aufgekratzten, gewitzten Gianna, die sich mir in ihren Mails präsentiert hatte – Mails, die zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten, vornehmlich aber zwischen Mitternacht und frühem Morgen bei mir eingetrudelt waren und mich mit diversen Infos zum Volksglauben über Nachtmahre, zickig-intellektuellen Sticheleien und YouTube-Links versorgt hatten. Trotzdem hatte ich ihr nicht gesagt, dass ich auf eine Botschaft von Colin wartete und diese dazu dienen sollte, einen Mahr zu ermorden. Ich wollte sie dann einweihen, wenn es konkret wurde, wenn Colin mir die zweite Methode verriet. Falls er das jemals tun würde.
Ungeduldig schüttelte ich den Kopf, um mich wieder auf Mamas Frage zu besinnen. Ob Gianna eine Freundin von mir war, hatte sie wissen wollen und ich hatte minutenlang nichts anderes getan, als zu grübeln, anstatt zu antworten. Ja, eine Freundin war Gianna wohl, obwohl wir uns in unseren Mails mit Leidenschaft angifteten und oftmals die Grenze zur Beleidigung überschritten.
»Sie ist Pauls Freundin«, antwortete ich dennoch. Ich wollte von meiner Person ablenken.
»Oh«, machte Mama und beugte sich weiter vor, als könne sie dadurch mehr von Gianna erkennen, was definitiv nicht möglich war, denn Gianna hatte sogar damit aufgehört, vor- und zurückzuwippen. Wir sahen nur ihren gebeugten Rücken und ihren Hinterkopf. Langsam mussten ihre Kniescheiben schmerzen.
»Sie ist hübsch, oder?«, fügte Mama vage hinzu – eine mutige These, die angesichts Giannas strähniger Haare zusätzliche Brisanz gewann.
Ich drehte mich achselzuckend um und tat das, worauf Gianna vermutlich schon minutenlang wartete: Jemand musste sich um sie kümmern. Als ich den Hof betrat, erhob sich ein schauriges, zweistimmiges Jaulen, das kein Ende mehr nehmen wollte und sich schließlich in einem klagenden »Jajaijaijaijaijaijai« entlud. Mister X hatte den eingesperrten Rufus entdeckt und näherte sich ihm in seiner gefährlichsten Pose: auf dem buckeligen Rücken ein gezackter Haarkamm, den Körper schräg gestellt, den Schwanz zur Flaschenbürste aufgeplustert, die Ohren angelegt. Seine spitzen weißen Eckzähne leuchteten wie gezückte Waffen aus seinem schwarzen Katergesicht heraus.
»Ist gut, Hase«, brummelte ich beruhigend, doch Mister X nahm mich nicht wahr. Fauchend stimmte er eine neue Arie an, während sein Geifer auf das Pflaster troff und Rufus die Krallen über den Plastikboden seiner Transportbox ratschen ließ.
»Gianna? Alles okay?«
Nein, es war nichts okay. Ich fühlte ihr Elend unter meiner eigenen Haut. Ihre Knie waren schwach, ihr Magen tat weh, seit Tagen schon. Sie hatte geweint. Ich konnte das Salz auf ihren Wangen riechen. Doch sie reagierte nicht.
»Hey, Gianna, sag doch was!«
»Ich bin am Ende«, tönte es dumpf hinter ihrem Haarvorhang hervor. Ihre Stimme klang kraftlos. Nun kippte sie gefährlich seitwärts. Meine Hand brachte sie wieder in Balance. »Paul da?«, lallte sie.
»Paul ist in Hamburg, Gianna. Er ist nicht hier. Ihr … ihr seid doch noch zusammen, oder?« Seitdem Mama mich auf sie aufmerksam gemacht hatte, schwelte in mir die Angst, die beiden hätten sich schon wieder getrennt. War das der Grund, weshalb es ihr schlecht ging? Sie durften sich nicht trennen, nein, das durften sie nicht! Bis zu Colins Rückkehr musste alles so bleiben, wie es war. Wir waren ein Team. Wir mussten zusammenhalten, um das zu tun, was nötig sein würde. Gianna brauchten wir dafür, weil sie Paul stärkte, und Paul brauchten wir, weil ich keine Unternehmung mehr ohne meinen Bruder machen würde, nachdem wir jahrelang getrennt gewesen waren. Doch nicht nur ich brauchte ihn. Vor allem brauchte er uns. Er hatte außer uns niemanden. François hatte alle Menschen von ihm fortgetrieben. Er hatte keinen einzigen Freund. Nicht einmal Bekannte. Allerhöchstens ehemalige Kommilitonen.
»Weiß nicht«, nuschelte Gianna. »Keine Ahnung. Wir lassen es langsam angehen. Ich würde ihn trotzdem sofort heiraten, wenn er mich fragen würde. Tut er aber nicht.«
Ich ließ mich stöhnend auf den Boden sacken.
»Paul ist nicht hier, Gianna. Er ist in Hamburg. Deshalb frag ich mich, warum du …«
»Weil ich nicht mehr kann!«, bellte Gianna heiser. »Hab ich doch eben gesagt! Ich rede von meinem Job, von meiner Wohnung, von all dem – Scheiß!« Ihre Hände schnellten in die Höhe, worauf sie ihre Balance verlor und auf den Hintern knallte. Nun saßen wir uns gegenüber und konnten uns immerhin ins Gesicht sehen. Ihre olivfarbene Haut hatte jenen grünlichen Schimmer angenommen, der Gianna immer dann zierte, wenn ihr übel oder sie gestresst war. Wahrscheinlich traf beides zu.
»Mein Boiler ist kaputtgegangen, einfach so. Einfach so! Ich hab kein warmes Wasser mehr!«
»Bisschen leiser, Gianna, bitte …«, bat ich sie gedämpft und versuchte, dabei möglichst verständnisvoll zu klingen. Gianna war nicht klar, dass ein halbes Dutzend Ohren mithörte und mindestens doppelt so viele Augen zusahen. »Okay, der Boiler ist kaputt. Und dann?«
»Nichts dann! Das war zu viel! Diese Scheißbude und dieser Scheißjob und diese Scheißkollegen und ich … ich hab … hingeschmissen. Alles. Ich hab …« Sie schluckte und sah mich verzweifelt an. Ihre bernsteinfarbenen Augen waren stumpf vor Erschöpfung. »Ich hab meinem Boss aus lauter Zorn heißen Kaffee über die Tastatur gekippt. Eine ganze Tasse. Ich kann nicht mehr dorthin zurück. Auch nicht in meine Wohnung. Ich hab kein warmes Wasser mehr.«
Ich sah ein, dass ein sachliches Gespräch momentan nicht im Bereich des Machbaren war, schnappte mir den jaulenden Rufus und zog Gianna am Ärmel nach oben. Sie ließ sich wie ein altes blindes Mütterchen zum Haus führen und stolperte neben mir die Stufen zum Wintergarten hoch, wo Mama bereits in angestrengt unterdrückter Neugierde auf uns wartete.
»Und?«, fragte sie behutsam. Gianna strich sich die Haare aus dem Gesicht, um Mama anzusehen. Sie rang sich ein Lächeln ab, doch es konnte ihre miserable Verfassung nicht kaschieren.
»Burn-out«, diagnostizierte ich knapp und war mir einen Atemzug lang nicht sicher, ob ich von Gianna sprach – oder nicht doch von mir selbst.
AUSGEBRANNT
»Weißt du, was mich an unserer Situation am meisten nervt?«
Gianna hatte zu später Stunde an meine Tür geklopft, sofort ihre Nase durch den Spalt gesteckt, als ich mich zu einem höflichen »Ja?« hinreißen ließ, und rechnete damit, dass mich ihre Antwort brennend interessierte. Dabei hatte ich selbst unzählige Varianten dieser Antwort in petto. Sie musste nicht noch eins obendraufsetzen.
Doch ich hatte in den vergangenen Wochen zu viele Nächte allein in meinem Zimmer verbracht; etwas Gesellschaft war vielleicht nicht verkehrt. Andererseits steckte ich gerade mitten in einer Recherche. Ob sie mir etwas brachte, wusste ich noch nicht. Ich hatte mich in das Leben von Leonardo da Vinci vertieft, der immerhin Erfindungen gemacht hatte, die von einer herausragenden Intelligenz und visionärer Kraft zeugten. Ein Halbblut? Oder vielleicht sogar ein Mahr? War er eventuell niemals gestorben und am Ende einer der Revoluzzer, mit denen mein Vater kooperierte?
»Komm rein«, bat ich Gianna dennoch. Die Internetseite war auch später noch da. Und wenn Gianna nicht allzu lange blieb, konnte ich vielleicht nach dem Da-Vinci-Exkurs WikiLeaks einen Besuch abstatten. Sollte irgendein Mensch außer uns etwas von Mahren wissen, dann wohl Julian Assange. Gianna ließ ihrer Nase den Rest ihres schmalen Körpers folgen und trippelte zu meinem Bett, wo sie sich sofort im Schneidersitz ans Kopfende hockte. Bibbernd schob sie meine Decke über ihre nackten Zehen. Obwohl ich ihrem Erscheinungsbild kaum Aufmerksamkeit schenkte, war mir nicht entgangen, dass sie ein wenig frischer und gesünder aussah als bei ihrer Ankunft vor zwei Tagen.
Gianna war wirklich am Ende gewesen – vielleicht nicht am Ende ihrer Weisheit, aber am Ende ihrer Kräfte. Der kaputte Boiler und das Kaffeeattentat auf die Tastatur ihres Chefs waren nur die Spitze des Eisbergs, der ihr Leben zum Kentern gebracht hatte. Das fanden Mama und ich bei einer aufreibenden Fragestunde heraus, zu der wir Gianna genötigt hatten, nachdem ich sie in den Wintergarten geschleppt und Mama vorgestellt hatte. Gianna bereitete das Antworten große Mühe, denn sie hatte mir vorab das Versprechen geben müssen, nichts von unseren düsteren Nächten mit François und Colin auszuplaudern. Ich fürchtete, dass auch diese Erlebnisse ihr Energie gestohlen hatten.
Gianna hatte ihr Kuchenstück während unseres Kreuzverhörs nicht angerührt und nur ab und zu wie ein Vögelchen an ihrem Kaffee genippt. Ich wusste, dass sie beides liebte: Kaffee und Kuchen. Gianna war eine Kaffeetante. Es gehörte zu den Höhepunkten ihres Tages, sich um exakt halb fünf ein Plunderteilchen oder – wenn die Recherchen besonders gut liefen – ein Stück Kuchen zu gönnen und es am Redaktionsschreibtisch zu einer guten Tasse starkem Kaffee zu verzehren. Über Giannas Arbeitstage wusste ich dank ihrer Mails mittlerweile einigermaßen gut Bescheid. Deshalb: Wenn Gianna nachmittags um halb fünf Kuchen ablehnte, lag etwas im Argen. Trotzdem überraschten mich die Abgründe, die sich vor mir auftaten, als sie reuig wie eine Sünderin mit der Wahrheit herausrückte.
Gianna war nicht nur ausgebrannt, sondern auch vollkommen abgebrannt. Weil sie die bürokratischen Hürden des Lebens als lästiges, aber zu vernachlässigendes Übel betrachtete und laut ihren eigenen Worten ihr Hirn sofort von alleine abschaltete, wenn in einem Satz Zahlen vorkamen, hatte sie die Briefe des Finanzamts nur oberflächlich gelesen und das Steuergesetz für Studenten falsch verstanden.
»Studenten?«, hatte ich mich erstaunt vergewissert.
»Ja, ich hab vor einem Jahr noch studiert«, gab Gianna etwas patzig zurück. Mein vermeintliches Nichtstun und mein gut gefüllter Geldbeutel waren ihr schon in Hamburg ein Dorn im Auge gewesen. Sie hatte keine Ahnung, was ich seit Wochen hier so trieb. Denn sie wusste auch nicht, dass Tillmann und ich vorhatten, nach Italien zu fahren und Tessa zu töten. Noch nicht.
»Ich dachte, du arbeitest schon jahrelang bei der Presse.«
»Tu ich auch. Bedeutet ja nicht, dass man nebenbei nicht sein Examen machen kann, oder?«, entgegnete sie angriffsfreudig. »Tagsüber Termine, nachts lernen und Magisterarbeit schreiben. Da kommt keine Langeweile auf.«
Jedenfalls hatte Gianna die Klausel mit der Bemessungsgrenze und dem Freibetrag für Studenten eher großzügig interpretiert und geglaubt, sie müsse lediglich die Einnahmen oberhalb dieser Grenze versteuern und nicht alles, sobald sie die Grenze überschritten hatte. Und die hatte sie überschritten – um einiges. Nun hatte sie 5000 Euro Steuernachzahlungen an der Backe, chronische Schulterschmerzen, einen kaputten Boiler und zudem in all der Hektik eine Mail, in der sie sich gewohnt spitzzüngig über die Gepflogenheiten ihrer Zeitungskollegen ausließ, versehentlich an den öffentlichen Artikelpool der Redaktion statt an Paul gesendet, wo die Nachricht minutenlang – laut Gianna die schlimmsten Minuten ihres Lebens – für alle ersichtlich gewesen war.
Sie hatte den Technikchef unter Tränen überreden können, die Mail wieder aus dem System zu löschen, aber irgendjemand hatte sie schon ausgedruckt und herumgereicht. Es gab also keinen Grund mehr für Gianna, diese Redaktion ein weiteres Mal zu betreten.
Ich fragte mich, ob ihre Kollegen nicht sahen oder wenigstens spürten, in welch jämmerlichem Zustand sie gefangen war. Sie war so müde, dass ihr manchmal im Sitzen die Augen zufielen, die kleinsten Dinge brachten sie aus der Fassung, sie hatte weder Hunger noch Durst und die ersten beiden Tage in unserem Haus verbrachte sie damit, in Mamas Nähzimmer auf dem Bett zu liegen und reglos vor sich hin zu dösen. Sie sei einfach froh, liegen zu können, sagte sie, wenn ich nach ihr sah und sie fragte, ob sie nicht wenigstens in den Garten gehen oder fernsehen wolle. Nein, wollte sie nicht. Gianna spielte toter Mann.
Doch eben, als sie mich gefragt hatte, ob ich wüsste, was sie am meisten nervte an unserer Situation, hatte sie das erste Mal wieder wie ein lebendiger Mensch gewirkt – ein Mensch, der sich genauso dringend erholen musste wie ich, aber für den es genügte, einen vernünftigen Job und einen neuen Boiler zu bekommen, um sein Leben in Ordnung zu bringen. Konnte ich sie überhaupt mit unseren Mahrplänen belasten? In unseren Mails war höchstens Colin zur Sprache gekommen, und das eher auf humorige Weise. Aber Giannas Loyalität kannte keine Grenzen und sie war viel zu neugierig, um sich nicht mehr mit der Mahrwelt zu beschäftigen, sobald Tillmann, Paul und ich uns wieder unseren Plagegeistern zuwandten. Selbst wenn es keinen akuten Handlungsbedarf gab: Der Nachhall der Mahre war zu stark, zu mächtig. Sie erlaubten einem kein normales Leben mehr – als wäre es Sinn und Zweck ihres Raubens, alle sicheren Strukturen zu zerstören, wie François bei Paul, bevor er sich an ihm zu laben begann. Gianna musste über sie nachgedacht haben. Falls nicht, hatte ich mich komplett in ihr getäuscht.
»Also, was nervt dich?«, fragte ich, als sie betont laut mit meiner Decke zu rascheln begann, um meine lange überfällige Reaktion einzufordern. Meine Augen hingen trotzdem noch am Postfach meines Mailprogramms, wie so oft während meiner durchwachten Nächte. Ich konnte nicht recherchieren, ohne immer wieder ins Outlook zu gucken, und selbst jetzt zog es mich magisch an.
Der Grund dafür war mir inzwischen fast schon peinlich. Vor einer Woche hatte ich Grischa in einem Business-Netzwerk gefunden und ihm eine Mail geschrieben. Beim Schreiben der Mail fühlte ich mich stark und schön, nach dem Abschicken nur noch dumm und unreif. Denn nun wartete ich auf eine Antwort, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, und bislang vergebens. Ich ärgerte mich über mich selbst, weil ich mich in eine solch überflüssige Zwangslage gebracht hatte. Trotzdem verschaffte mir diese Zwangslage immer wieder einen kleinen Stromschlag im Bauch, wenn ich an das Checken meiner Mails dachte, und das wiederum vermittelte mir den Eindruck, dass sich etwas in meinem Leben bewegte. Der Frust, nur mit Spam oder Nachrichten von Gianna überhäuft zu werden und mich bei meinen Recherchen im Kreise zu drehen, war anschließend umso größer. Dass ich Giannas Mails eigentlich gerne las, konnte diesen Frust nicht mindern.
Aber nun saß sie hier in meinem Zimmer und die Wahrscheinlichkeit war hoch, keine Mails von ihr zu bekommen. Wenn eine eintrudelte, konnte sie von Grischa stammen – oder von Colin? Würde ich per Mail von der zweiten Methode erfahren? Colin wusste mit moderner Technik umzugehen, doch das Rauschen in seinem Körper machte sie äußerst störanfällig. Es erschien mir auch zu profan, eine so wichtige Information auf dem PC zu verschicken.
Noch einmal klickte ich auf das Senden-Empfangen-Feld von Outlook, obwohl ich das automatische Abrufen schon auf den Einminutentakt erhöht hatte. Übermittlung abgeschlossen. Keine neuen Nachrichten. Ich signalisierte Gianna mit einem Kopfnicken, dass sie reden durfte, aber sie fing erst damit an, als ich mich vom Bildschirm abwendete.
»Mich nervt, dass wir alle drei offenbar auf unsere Männer warten. Drei Frauen sitzen in einem Haus und warten auf ihre Männer, weil sie ohne ihre Männer handlungsunfähig sind. Das ist nicht zeitgemäß und sehr unemanzipiert. Es ist mir zu edwardesk.« Ich lachte trocken auf. Gianna konnte es nicht lassen, das Mahruniversum mit allen gängigen Fantasy-Ausgeburten aus Literatur und Film zu vergleichen – vorneweg mit den modernen Vampirgestalten. Edwardesk war ihre neueste Wortschöpfung. »Lach nicht! Wir sollten unser Leben auch allein in die Hand nehmen können, Ellie. Ich mag nicht länger sinnlos herumlungern.«
»Oh, Mama tut das bereits«, erwiderte ich spitz. »Siehst du doch, Yogakurse, ein Studium, ein Brunnen im Garten …« Den Brunnen nahm ich ihr besonders übel. Papa hatte ihn nie haben wollen, weil das perlende Wasser an Sommertagen das Licht zu sehr spiegelte und reflektierte – Gift für seine »Migräne«. Aber jetzt hatte Mama ihren Traum von einer plätschernden Fontäne neben dem Rosenhain verwirklicht – als würde Papa nie wiederkommen.
»Ach, Ellie, das alleine macht doch kein glückliches, erfülltes Leben aus. Yoga, Studium, Gartengestaltung. Sei nicht ungerecht!«, rief Gianna belustigt. »Deine Mutter will eben nicht in Trauer und Apathie versinken, sondern etwas tun. Sie ist stark. Und ich bin froh und dankbar, dass sie mich aufgenommen hat.«
Es war Mamas ausdrücklicher Wunsch gewesen, Gianna nicht zurück nach Hamburg fahren zu lassen. In dieser Verfassung konnte sie sich sowieso nicht ins Auto setzen, zumal ihr alter Fiat dringend durch den TÜV musste. Wir hatten Gianna außerdem angeboten, ihr finanziell unter die Arme zu greifen, doch sie wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen. Ihr werde schon etwas einfallen, womit sie dieses Problem lösen könne. Dabei war Gianna gar nicht mehr in der Lage, Einfälle zu haben. Ihre kreative Energie war verpufft und ich selbst war nie besonders kreativ gewesen.
Doch sie nahm immerhin das Angebot an zu bleiben. Es gab nur einen, der damit nicht einverstanden war: Mister X. Schon am ersten Abend waren Gianna und ich uns in die Haare geraten, weil sie es für unverantwortlich befand, nachts die Katzenklappen offen zu lassen. Rufus sei ein Stubenkater und mit der Realität dort draußen überfordert. Doch Mister X einzusperren, machte ebenso wenig Sinn, wie es bei seinem Herrchen zu versuchen. Er randalierte unter lang gezogenen, kehligen Rufen, die selbst den ausgeglichensten Menschen aus der Fassung bringen mussten, im Wohnzimmer und pinkelte anschließend die Tür des Wintergartens voll. Außerdem schien es im Keller Streit um das Katzenklo zu geben. Die Hälfte der Hinterlassenschaften landete einen halben Meter neben der Plastikschale, bestäubt mit Einstreu, die während der Revierrangeleien um den angestammten Kackplatz im gesamten Keller verteilt wurde. Vor lauter Stress hatte Rufus auch noch Durchfall bekommen.
Mama freute sich, dass endlich wieder Action im Hause Sturm war, doch nachdem wir das Frühstück appetitlos und mit gerümpfter Nase zugebracht hatten, entschied sich Gianna, den Tränen nahe, Rufus in die Freiheit zu entlassen. Er stapfte über den Rasen, als verätzten die grünen Halme seine empfindlichen Pfoten, und verhedderte sich gleich beim ersten Ausflug im Zaun unseres Nachbarn, wo er in eine Art Schockstarre fiel und jämmerlich weinte. Gianna und ich mussten Hausfriedensbruch begehen, um ihn zu befreien.
Doch langsam schienen Rufus und Mister X sich zu arrangieren. Zumindest hatten heute Morgen keine größeren Fellbüschel mehr auf der Einfahrt gelegen.
»Ja, Mama ist okay«, gab ich zu. »Und du – gibt es bei dir denn keine Mutter?« Himmel, was für eine blöde Frage.
»Keine, zu der ich mit meinen Sorgen gehen könnte«, antwortete Gianna in einem Ton, der mir jedes weitere Bohren untersagte. Ihre Mutter war also tabu. Und leider hatte sie mit dem, was sie über unsere Situation sagte, recht, ohne zu ahnen, wie recht sie hatte. Auch wenn es nicht so aussah, wartete Mama wahrscheinlich insgeheim ebenso sehnlich auf Papa wie ich. Außerdem warteten Mama und ich auf Paul, genau wie Gianna. Ich selbst wartete sogar insgesamt auf vier Männer: Papa, Paul, Tillmann und Colin. Papa strich ich in Gedanken gleich wieder von der Liste. Selbst wenn Papa auftauchte, würde sich an meiner Warterei auf die anderen Männer nichts ändern. Denn damit wäre nur eine Aufgabe gelöst. Für die zweite hatten wir immer noch keine Lösung parat. Und obwohl ich Tag und Nacht das Internet durchkämmte, wusste ich, dass wir nur mit Colins Erscheinen aktiv werden konnten. Alles andere war eine vage Vorbereitung, mehr nicht.
Ja, es war so, wie Gianna sagte. Wir waren handlungsunfähig. Immerhin wollten Paul und Tillmann sich bald auf den Weg zu uns machen, vielleicht morgen schon. Doch das nützte alles nichts, solange Colin uns keine Botschaft überbrachte.
»Hast du eigentlich mal was von Colin gehört?«, erriet Gianna meine Gedanken. »Weißt du, ob er es geschafft hat?« Ich schüttelte den Kopf. »Ich meine – du hattest auch keine … ähm …« Gianna schien die Worte mit der Pinzette auszuwählen und einzeln zu begutachten, bevor sie entschied, sie zu benutzen. »Keine … Eingebungen?«
Eingebungen. Haha. Meine letzte Eingebung hatte darin bestanden, Grischa eine Mail zu schreiben, die mindestens ebenso wirr ausgefallen war wie der Brief, den ich ihm damals in der Schule geschickt hatte. Dieses Mal aber hatte ich immerhin eine Botschaft mitzuteilen. Ich berichtete, dass ich von ihm geträumt hatte und er in diesem Traum meine Hilfe brauchte und dass dieser Traum so eindringlich gewesen war, dass … Ja, dass. Ab dieser Passage verlor ich mich in Gedankenpunkten und Fragezeichen. Denn ich hatte nicht den blassesten Schimmer, wobei Ellie Sturm jemandem wie Grischa Schönfeld helfen konnte. Wie konnte ich hoffen, dass er überhaupt daran dachte, mir zu antworten? Bis auf diese merkwürdige Episode mit der Mail, ausgelöst durch einen melancholisch-süßen Grischa-Traum wie in meinen besten Teenagerzeiten, war mein Dasein eingebungsfrei geblieben.
Sollte ich Gianna jetzt schon in meine Recherchen einweihen? Würde das etwas ändern? Immerhin hatte sie Geschichte und Literatur studiert. Und sie dachte darüber nach, was mit Colin geschehen sein konnte, ob er zurückkam. Doch obwohl ich schon den Mund geöffnet hatte und sie mich gebannt anstarrte, hielt ich inne und sagte nichts. Nein, besser war es, noch zu warten. Es würde ohnehin schwierig werden, sie von unseren Mordplänen zu überzeugen, denn Gianna hatte wie Paul Tessa nie zu Gesicht bekommen, sie konnte nicht wissen, was für eine Ausgeburt des Grauens sie war. In Hamburg hatten Tillmann und ich Gianna eines Abends überrumpelt, als wir ihre Hilfe gebraucht hatten, um Paul zu retten, und es hatte funktioniert. Es war geschickter, wenn wir sie auch dieses Mal überrumpelten, sobald es so weit war und ich die Botschaft von Colin erhalten hatte. Wusste sie vorher Bescheid, würde sie ins Nachdenken geraten und aus lauter Dankbarkeit womöglich sogar Mama davon erzählen. Deshalb schloss ich den Mund wieder und schluckte, um so zu tun, als sei ich traurig und kämpfe gegen die Tränen an. Gelogen war das nicht.
»Nein, keine Eingebungen«, antwortete ich bitter. Ich träumte von Colin, immer wieder, aber es fühlte sich an wie diese typischen Erinnerungsträume, zusammengefügt aus tatsächlich Erlebtem, doch unbeeinflusst von ihm, und leider war dieses Erlebte nun mal von schrecklichen Szenarien durchsetzt gewesen.
Unsere telepathische Verbindung war wie durchgeschnitten. Vielleicht hatte Colin sie durchtrennt, um mich zu schützen. Tessa hatte gar nicht mehr unser vollkommenes Glück gebraucht, um uns zu orten. Ihr hatte eine vertraute, intime Nähe ausgereicht. Ich redete mir ein, dass die Gefahr, von ihr gewittert zu werden, der Grund war, weshalb Colin seinen Geist meinem nachts nicht mehr näherte. Oder er war viel zu weit weg von mir.
Wie immer, wenn ich darüber nachsann, bekam ich das Gefühl, die Situation nicht mehr ertragen zu können. Ich musste Swing of Things von a-ha hören und mir das Video dabei ansehen, dessen Link Gianna mir eines Nachts geschickt hatte, jetzt, sofort. Ich rief YouTube auf, damit der Clip schon einmal laden konnte, während Gianna noch hier war, schaltete die Boxen am PC aber auf stumm. Ich wollte es erst dann hören, sobald Gianna sich wieder in das Nähzimmer verzogen hatte.
»Ellie … worauf warten wir eigentlich konkret? Worauf wartest du?«, fragte sie beiläufig, doch die Ungeduld in ihrer Stimme war wie ein Tritt in die Kniekehlen. Mach was, Ellie. Unternimm etwas.
Ehe ich es verhindern konnte, sprangen die Worte über meine Zunge, kalt und höhnisch. »Darauf, dass Colin mir sagt, wie wir Tessa lynchen können.«
Lynchen klang gut – vor allem klang es weniger gefährlich als Mord. Lynchen hörte sich in meinen Ohren herrlich fern und altmodisch an, als würde dabei kein Blut fließen. Gianna erschauerte sichtlich, bevor sie in ein gläsernes, unechtes Lachen ausbrach.
»Haha, sehr witzig, Ellie. Und der kleine Scheißer, will der da auch mitmachen?«, hakte sie ironisch nach.
»Klar. Tillmann brennt darauf«, entgegnete ich barsch. »Und Colin wird mir eine Botschaft überbringen und sagen, wie es geht. Vielleicht schon morgen.«
Ich klang wie ein weltfremder, naiver Teenager. Gianna verkniff sich eine Antwort, stand von meinem Bett auf und streckte sich gähnend. Sie nahm mich nicht ernst. Dachte, ich hätte einen Witz gemacht. Glück gehabt! Ab jetzt sollte ich meine Zunge besser im Zaum halten.
Für Gianna war Tillmann sowieso nur ein halbgarer Jugendlicher mit Hang zur Gesetzesübertretung, für mich aber inzwischen einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Nach unseren Abenteuern im vergangenen Sommer hatten wir beide gemerkt, dass wir uns eigentlich gar nicht kannten, und Tillmann war auf Abstand gegangen. Doch im vergangenen Frühjahr hatten wir beinahe jede Nacht nebeneinander geschlafen und das hatte ein Band zwischen uns gewoben, das fester kaum hätte sein können. Ja, es war tatsächlich so, als hätten sich in den dunklen Stunden unserer Bewusstlosigkeit unsere Träume einander genähert, sich überlagert und unsere Seelen fester aneinandergeknüpft, als wahrhaftige Erlebnisse es jemals tun konnten – und das, obwohl Tillmann nur noch stundenweise schlief und meistens erst gegen Morgen eindämmerte. Daran hatte sich nichts geändert.
Nun hatte er zwei Nächte in Dr.Sands Schlaflabor verbracht, denn die in meinen Augen wichtigste Kompetenz des Sandmanns rührte daher, dass er an die Existenz von Mahren glaubte. So hatten wir ihm vorher ausführlich geschildert, wie Tillmanns Kontakt mit Tessa ausgefallen war und worin seine Schlafstörungen bestanden. Gedankliche Ruhelosigkeit, die nur mit Haschisch ein wenig gedämpft werden konnte.
Es gab immer noch vieles an Tillmann, was meine Nerven strapazieren konnte – vorneweg seine kühle Schnoddrigkeit und seine Weigerung, mit mir zu flirten, wenigstens ab und zu ein paar nette Dinge über mich zu sagen, mich fühlen zu lassen, dass ich eine Frau war und nicht sein bester Kumpel. Doch wann immer wir uns zusammen in einem Raum befanden, waren mein Kopf und mein Herz von einem einzigen Gedanken beseelt. Ich mag dich.
Ich vermisste es, neben ihm zu liegen, obwohl es mir im Winter oft genug wie ein Angriff vorgekommen war, weil ich nach Colins Erinnerungsraub auf Trischen keine menschliche Nähe mehr ertragen konnte. Doch jetzt, in manchen meiner unendlich langen Nächte, die so ruhelos und gedankenzerfurcht geworden waren, wünschte ich mir ihn herbei, nicht nur in den gleichen Raum, sondern auf das gleiche Lager – ohne Berührungen, nein, Berührungen musste es nicht geben. Ich wollte ihn nur neben mir wissen. Seinen Atem hören. Sein charakteristisches trockenes Räuspern, das er ab und zu von sich gab. Die Vorstellung, dass jener Mensch neben mir lag, der mich tagsüber so oft zur Furie werden ließ, stimmte mich kurioserweise friedlich.
»Wenn sich morgen nichts tut, unternehmen wir aber mal etwas«, verscheuchte Gianna meine Sehnsucht nach Tillmann. »Wir machen etwas, anstatt hier rumzusitzen, und wenn wir uns nur ein Paar Socken kaufen oder Locken in die Haare drehen. Okay, du brauchst das nicht.« Ein neidvoller Blick streifte meinen wilden Schopf, den ich schon lange seinem Eigenleben überlassen hatte. »Dann backe ich eben einen Kuchen. Einen Apfelkuchen.« Nun, das würde die Emanzipation im Westerwald nur schwerlich vorantreiben. »Nacht, Ellie.«
»Nacht.«
Gianna tapste an mir vorbei und schloss vorsichtig die Tür hinter sich, als könne sie das Haus in die Luft jagen, wenn sie zu heftig ins Schloss fiel. Ich schnaubte grinsend. Giannas Eigenheit, etwas besonders sanft und rücksichtsvoll zu tun, wenn sie eigentlich das Gegenteil wollte und genau spürte, dass Dynamit in der Luft lag, konnte mich zur Weißglut bringen. Doch mir war klar, warum sie sich so verhielt. Weil sie ebenfalls zu viel wahrnahm und interpretierte und nicht immer damit umgehen konnte, genau wie ich.
Ihr Freund aber war ein größtenteils normaler Mann, der viel zu abgekämpft war, um sie jemals derart in Gefahr zu bringen, wie Colin es bei mir vermocht hatte. Ich hatte es nicht anders gewollt. Ich hatte mich entschieden, meinen Bruder zu retten – um jeden Preis. Dass Gianna und Paul ein Paar werden konnten, hatten sie Colin und mir zu verdanken. François hätte Paul vernichtet.
Aber ich fühlte weder Triumph noch Stolz, wenn ich mir diesen Zusammenhang bewusst machte. Ich wollte jetzt nur eines: in der Musik versinken, bis ich das Gefühl hatte, von den Worten gestreichelt zu werden. Der Clip, den ich eben geladen hatte, war zu meiner privaten Foltermethode geworden, denn Gianna war überzeugt davon, dass er Colin am Schlagzeug zeigte. Das Schlimme war, dass ich es ebenfalls glaubte. Die Qualität des Clips war mies, sowohl was das Bild als auch den Ton betraf, und die Band selbst offenbarte noch viele Entwicklungsmöglichkeiten nach oben. Es musste eine Aufnahme aus den Achtzigern sein. Niemand würde sich heute freiwillig so anziehen wie Sänger, Keyboarder und Gitarrist. Nur der Drummer stach angenehm dezent heraus. Trotzdem war auch seine Frisur eigenwillig. Im Nacken kurz und auf dem Oberkopf aufgeplustert – etwas, was Colins Haare gerne ohne Spray und Gel erledigten. Sich aufplustern. Und dabei sacht hin und her wiegen. Manchmal auch züngeln.
Das Gesicht des Drummers war kaum zu erkennen – und doch sah ich genug, um weiße Haut, einen betörend schönen Mund, kantige Wangenknochen und eine markante Nase auszumachen. Die Band spielte Swing of Things von a-ha, einen Song, den ich bis zu Giannas Videoclipattentaten nie zuvor gehört hatte, doch sie sendete mir umgehend das Original als MP3, wodurch dank des ländlich langsamen DSL beinahe eine Stunde lang unsere Internetverbindung blockiert war. Seitdem hörte ich diesen Song mindestens einmal am Tag, meistens vor dem Einschlafen oder beim Autofahren, und bekam bei den letzten Takten unweigerlich Gänsehaut, weil ich den Videoclip vor Augen hatte samt dem unruhigen Flimmern und Flackern, wenn die Kamera wenige Sekunden lang auf den Schlagzeuger – Colin? – gerichtet war. Denn er trommelte nicht nur, er sang auch die zweite Stimme, und genau das war es, was mir den letzten Zweifel nehmen wollte. Sie klang tief und rein und klar und … sexy. Oder wie Gianna es formulierte: »Die Stimmfärbung macht einiges wett und immerhin trifft er die Töne.« Ich fand ihn um Längen besser als den Sänger, der in den hohen Passagen regelmäßig scheiterte.
Trotzdem hielten sich meine Zweifel, denn sie erlaubten mir, jene junge schwarzhaarige Frau zu ignorieren, die in der ersten Reihe stand und mit glasigem Blick auf die Bühne starrte. Für je zwei Sekunden war sie am Anfang und am Schluss des Songs im Bild und jedes Mal glaubte ich, das Mädchen in ihr zu erkennen, das ich hatte küssen wollen, als ich bei der Achtzigerjahre-Party im vergangenen Sommer während Being Boiled von Human League in Colins Erinnerungen gerutscht war.
Das Video war Fluch und Segen zugleich und dennoch das Wertvollste, was ich an Colin-Andenken besaß. Immerhin konnte ich ihn ansehen, wenn auch in einer Zeit, in der ich nicht einmal ein Gedanke gewesen war – und er bereits zwanzig und offensichtlich verliebt. In ein schwarzhaariges Mädchen, das ganz bestimmt nicht auf Mahrjagd gegangen war und sich von ihm in den Bauch treten ließ, damit er ihren Bruder retten konnte.
»Oh, but how can I sleep with your voice in my head, with an ocean between us and room in my bed …«