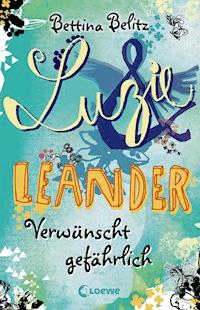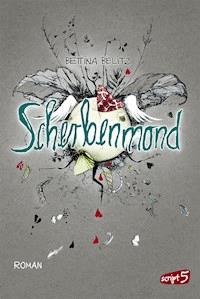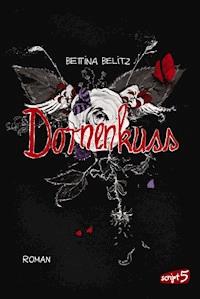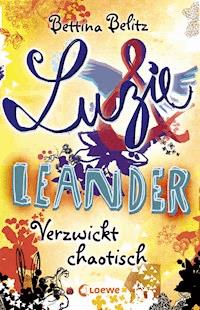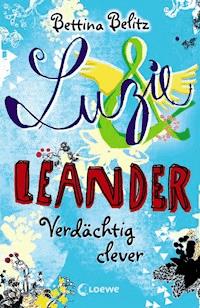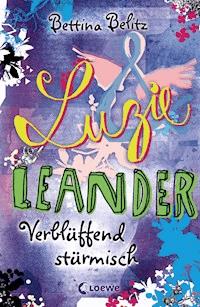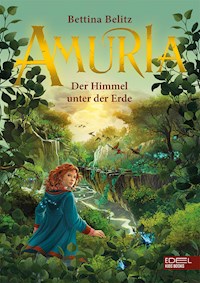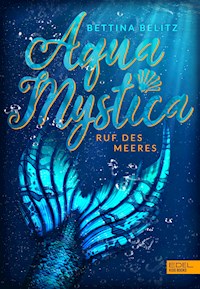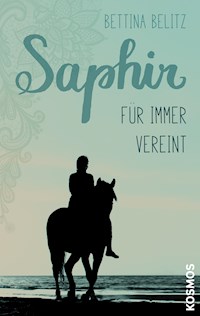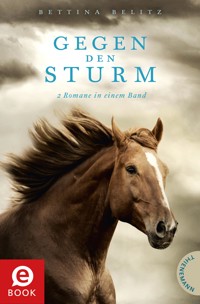Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Luzie & Leander
- Sprache: Deutsch
Leanders Traum ist wahr geworden: Endlich hat er einen menschlichen Körper! Doch genau das ist plötzlich richtig gefährlich, denn Leander wird schwer krank. Und wen soll Luzie um Hilfe bitten, wenn Leander für andere nicht sichtbar ist? Noch dazu erkennt Luzie sich selbst nicht wieder: Als erklärter Modemuffel verspürt sie neuerdings den unwiderstehlichen Drang, Klamotten zu designen, und soll auch noch bei einer Modenschau mitmachen! Als es Leander immer schlechter geht, muss Luzie sich entscheiden: Darf sie jemandem von all den rätselhaften Veränderungen in ihrem Leben erzählen? Die himmlische Jugendbuch-Reihe von Bettina Belitz! Mit viel Humor und Einfühlungsvermögen erzählt die Splitterherz-Autorin, wie sich Luzie und ihr Schutzengel Leander durch das Pubertätschaos kämpfen und die erste Liebe erleben. "Verboten tapfer" ist der sechste Band der Luzie und Leander-Reihe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Luzie braucht Stoff
Das große Umstyling
Kekskontrolldienst
Die Topmodelkrise
Regenbogenbrücke
Letzte Ruhe Rhein
Phantomhusten
Blitzentscheidungen
Identitätskrisen
Überhöhte Erwartungen
Streikende Hennen
Nacht und Nebel
Der hypochondrische Eid
Back to the roots
Französischer Patient
In flagranti
Parkour verboten
Luzie braucht Stoff
»Ich kann nicht hinsehen. Ich kann nicht hinsehen!«
»Dann lass es bleiben! Und hör vor allem auf, um mich herumzutanzen, ich muss mich konzentrieren!«
»Ich tanze nicht«, entgegnete Leander würdevoll und bewies in der nächsten Sekunde das Gegenteil, indem er ein weiteres Mal hinter mir aufs Bett sprang, um mir skeptisch über die Schulter zu blicken. Quietschend gab die Matratze unter seinem Gewicht nach und die Nadel kam meinem linken Zeigefinger gefährlich nahe.
»Siehst du? Hast du das gesehen?«, rief er triumphierend. »Schon wieder!« Sein Schatten fiel über mich, sodass ich kaum mehr erkennen konnte, was ich da eigentlich genau tat. Offen gestanden hatte ich sowieso nur eine grobe Idee davon, aber diese Idee fand ich so gut, dass ich sie umsetzen musste. Ich hätte sonst keine ruhige Minute mehr gehabt.
»Luzie, ich bitte dich, leg das weg und …«
»Es sind nur eine Nadel und ein Faden und ein Stück Stoff! Keine geladene Kalaschnikow, okay?«, herrschte ich Leander an und stieß ihm meinen Ellenbogen in die Rippen. »Und jetzt geh mir aus dem Licht, ich sehe nichts!«
»Ein Stück Stoff«, knurrte Leander verächtlich. »Das ist allenfalls ein Lumpen.«
Ganz unrecht hatte er da nicht. Es war ein Fetzen Stoff, rot-schwarz-grau kariert; dick und kräftig fühlte er sich unter meinen Händen an, aber auch immer noch klamm und feucht. Schließlich hatte er stundenlang auf dem regennassen Asphalt gelegen. Ich entdeckte ihn auf dem Nachhauseweg von der Schule und hatte sofort eine Idee. Also las ich ihn zu Leanders hellem Entsetzen (»Viren kleben da dran! Todbringende Bakterien!«) auf, steckte ihn in meinen Rucksack und nahm ihn mit nach Hause. Um das mit ihm zu tun, wonach er meiner Meinung nach bestimmt war. Mehr gab es nicht zu erzählen.
»Luzie, eine Nadel oder eine Kalaschnikow, das ist in deinen Händen so ziemlich das Gleiche«, redete Leander weiter, als ich nicht antwortete, sondern erneut die Nadel durch den Stoff stach, und kniete sich vor mich aufs Bett, um mich mahnend anzusehen. Ich hob meine Lider nicht, obwohl es immer verlockend war, Leanders grün-blauen Blicken zu begegnen. Aber jetzt hatte ich Wichtigeres zu tun. »Du hast dir eben beinahe das Auge ausgestochen!«
»Aber doch nur, weil du mich nicht in Ruhe lässt! Ich wäre längst fertig, wenn du nicht ständig nach deiner Daseinsberechtigung suchen würdest! Kapiert?«
Leander verstummte schlagartig, wandte sich ab und verkrümelte sich auf den Schreibtisch, wo er mit baumelnden Beinen sitzen blieb und trübe aus dem Fenster starrte. Ich wusste nicht, was mir mehr zu denken geben sollte: dass ich plötzlich gestelzte Wörter wie Daseinsberechtigung benutzte oder dass er so empfindlich darauf reagierte. Ohne es zu wollen, hatte ich mitten ins Schwarze getroffen. Leander konnte mich nicht mehr beschützen. Nicht mich und auch niemand anderen mehr. Sky Patrol war ein für alle Mal Vergangenheit und so langsam dämmerte mir, dass das nicht nur ein Grund zum Jubeln war.
Ja, sie hatten nach seinem Leben getrachtet, wollten ihn auslöschen – die Schwarze Brigade hatte ihn überall gesucht, weil er Schande über die ach so ehrenwerten Körperwächter gebracht hatte. Nur der Dreisprung hatte ihn retten können. Ich hatte schon nicht mehr damit gerechnet, dass Leander den Dreisprung überhaupt schaffen würde, zumal ich nicht die leiseste Ahnung hatte, wie dieser ominöse Dreisprung genau aussah. Doch wie durch ein Wunder war er ihm in letzter Sekunde gelungen. Seitdem hing er zwischen den Welten fest. Für seine ehemalige Truppe und die Schwarze Brigade – so etwas wie die Elitepolizeieinheit von Sky Patrol – war er nicht mehr zu orten, weder sicht- noch hörbar. Nun konnte nur noch ich ihn sehen und hören. Ich war sein einziger Kontakt unter den Menschen. Daher konnte man auch nicht behaupten, dass er ein echter Mensch geworden war, denn Menschen waren im Allgemeinen sichtbar. Hatten Eltern und einen Personalausweis und eine einigermaßen vernünftige Schulbildung, wenn auch Leanders Hunger und Verdauung menschlicher waren, als mir lieb war.
Allerdings konnten andere Menschen ihn fühlen, was das Zusammenleben mit Leander unendlich kompliziert und chaotisch gestaltete, da ich nonstop darauf achten musste, dass er niemandem in die Quere kam, schon gar nicht Mama und Papa oder meinen Jungs, obwohl er bereits sehr leibhaftig mit ihnen auf einem Sofa gesessen hatte und sie ihn sogar gespürt hatten. Aber sie dachten, er sei ein anderer gewesen. Außerdem war es dunkel, bis auf schwachen Kerzenschimmer. Hätte ich das Licht angeschaltet, hätten sie den Schrecken ihres Lebens bekommen und womöglich allesamt auf einen Schlag den Verstand verloren – und die Jungs benahmen sich sowieso die meiste Zeit, als hätten sie ihn aus purem Überdruss beim Fundbüro abgegeben.
Wenn ich darüber nachdachte, dass Leander mit seinem Dreisprung mit einem Mal seine Familie verloren hatte, wurde mir jedes Mal mulmig zumute, ein dumpfes, lastendes Schweregefühl auf meiner Brust, das ich nicht abschütteln konnte. Gut, echte Familien gab es bei Sky Patrol nicht; Leanders Vater und Mutter waren gleichzeitig seine Dienstherren gewesen und nur darauf bedacht, ihren guten Ruf zu wahren und Karriere zu machen. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätten sie Leander längst nach Guadeloupe strafversetzt. Es war also kein großer Verlust, Nathan und Clarissa von Cherubim aus den Akten zu streichen, aber immerhin hatte Leander seit seiner Erschaffung mit ihnen zu tun gehabt, genauso wie mit seinen beiden Schwestern. Die jüngere von ihnen hatte ich sogar recht sympathisch gefunden, als Leanders Truppe ein Stelldichein in meinem Zimmer gegeben hatte. Damals hatten sie keine Ahnung gehabt, dass ich sie sehen und hören konnte, wenn auch nur Leanders Verwandte – die anderen Körperwächter blieben für mich unsichtbar. Ob sie es inzwischen wussten? Hatte die Schwarze Brigade herausgefunden, dass Leander und ich uns kannten und zumindest so etwas Ähnliches wie eine Freundschaft hatten? Oder gar eine Beziehung?
Ich hielt inne und schaute rätselnd zu Leander hinüber, der nach wie vor mit leerem Blick aus dem Fenster starrte. Beziehung. Das klang ätzend. Das klang nach »und nächstes Jahr heiraten wir und kriegen drei Kinder«. Aber Freundschaft? Freundschaft war zu wenig. Wir hatten uns geküsst. Mehrmals. Ich hatte den Jungs gegenüber sogar gesagt, dass ich ihn liebe, ohne dass sie wussten, wen oder was ich genau meinte. Das mulmige Gefühl verstärkte sich. Ich liebte jemanden, den niemand sah außer mir selbst? Das war ja fast wie früher mit meinem erfundenen Freund Herr Niemand.
Unwillkürlich schüttelte ich mich. Leander war nicht erfunden, er war schrecklich real und ich konnte es kaum ertragen, ihn so still und müde zu erleben. Da war es mir beinahe lieber, wenn er wie ein aufgescheuchtes Huhn um mich herumsprang und versuchte, mich zu beschützen. Dabei hatte er seine Sky-Patrol-Qualitäten seit dem Dreisprung in weiten Teilen eingebüßt. Fliegen konnte er schon lange nicht mehr und beim Breakdance fiel er immer öfter auf die Schnauze. Außerdem hatte er sich bei einem seiner berühmten Spins – die nur ich sah, haha – neulich eine Zerrung zugezogen, was für mich drei Tage Dauerjammern im Akkord bedeutete. Nur mit Mühe und Not hatte ich ihn davon abhalten können, sich zur Gesundung ein bis fünf Gläschen von Papas Danziger Goldwasser hinter die Binde zu kippen. Ja, Leander hing nicht nur zwischen den Welten, er kämpfte auch immer noch gegen den Drang an, sich zu betrinken, um sich »menschlicher zu fühlen«. Als die Schwarze Brigade ihn noch jagte, mochte das erfolgreich gewesen sein, aber ich hatte kein Interesse daran, einen alkoholkranken Schutzengel in meinem Zimmer zu beherbergen. Da war es wirklich erquicklicher, nasse Stofffetzen vom Bürgersteig aufzuheben und etwas daraus zu basteln. Ich machte einen überraschend ordentlichen Knoten ins Garn, schnitt den restlichen Faden samt Nadel ab und schüttelte meine Kreation aus.
»Probier das mal an.«
Leander rümpfte angeekelt die Nase und streifte mich nur kurz mit seinem grünen Auge.
»Komm schon, ich bin sicher, dass es dir steht!«
»Was soll das überhaupt sein, dieses – Ding?« Seufzend glitt er vom Tisch und stellte sich vor mich.
»Hab noch keinen Namen dafür«, murmelte ich und wand es um Leanders viel zu schmale Hüften. Er war immer noch zu mager, obwohl er zwischendurch wahre Fressanfälle hatte und ich die halbe Speisekammer plündern musste, um ihn satt zu kriegen. Doch dann verlor er ohne ersichtlichen Grund jegliche Lust am Essen und nahm tagelang fast nichts zu sich. Vorsichtig befestigte ich die Sicherheitsnadel über seinem Po, wobei ich ihm so nahe kam, dass ich seinen Atem in meinen Haaren fühlte. Wenn Mama jetzt ins Zimmer stürzte, würde sie denken, dass ich eine besonders exotische Yogaübung mit einem Stück Stoff in den Händen vollführte. Stattdessen musste ich der Versuchung widerstehen, mich an Leander zu lehnen und das Stück Stoff, sein Alkoholproblem und die nervigen Dreisprung-Folgen ein für alle Mal zu vergessen.
Doch ich riss mich zusammen, richtete mich wieder auf und beäugte mein Werk kritisch – nicht minder kritisch als Leander.
»Da fehlt noch was …«, sagte ich zu mir selbst. Leder? Leder würde sich gut daran machen und vielleicht noch ein paar Nieten. Aber wenn ich es selbst nähen wollte, brauchte ich weiches Leder, am besten Lederimitat, genau, das war es. Samtiges schwarzes Velourslederimitat. Und Silbernieten. Die Nieten würden ihm den letzten Schliff verleihen.
»Luzie … Ich weiß nicht, ob du es vergessen hast, aber ich bin ein Mann. Männer tragen keine Röcke.«
»Es ist kein Rock. Außerdem hast du schon einen getragen, sogar einen karierten. Weißt du nicht mehr?« Ich wedelte kreisend mit den Händen. »Bei deiner Körpergestaltung. Du warst zwischendurch Schotte.«
Es kam mir vor, als läge es Ewigkeiten zurück, dass Leander in meinem Krankenhauszimmer herumgeisterte und sich eine Gestalt nach der anderen zulegte. Zwischendurch hatte er ausgesehen wie Bill von Tokio Hotel. Glücklicherweise hatte er irgendwann die geniale Idee gehabt, sich von der Optik des jungen Johnny Depp inspirieren zu lassen, mit dunkelblondem Haar statt braunem und einem grünen und einem blauen Auge. Er hatte sich nicht rechtzeitig für eine Farbe entscheiden können. Also: Huskyaugen. Ich konnte mir nichts anderes mehr an ihm vorstellen.
»Mag sein, aber …«
»Ich muss in die Stadt«, unterbrach ich ihn fahrig, legte meine Kreation zur Seite und steuerte die Tür an. »Kommst du mit? Ein bisschen frische Luft würde dir guttun.«
Leander und ich stockten gleichzeitig und guckten uns fragend an, er erstaunt, ich betreten. Was war denn das wieder für ein seltsamer Satz gewesen? Frische Luft würde dir guttun – ich hörte mich an wie Papa. Es war grässlich. Diese Sätze kamen aus dem Nichts angeflogen, wie meine Ideen, ich konnte kaum etwas dagegen tun.
Ohne Leanders Reaktion abzuwarten, drehte ich mich von ihm weg und verließ mein Zimmer, um zu Mama in die Küche zu gehen.
Sie saß vor drei aufgeschlagenen Kochbüchern am Tisch und hatte ihre Locken so zerrauft, dass sie sich in alle Himmelsrichtungen kräuselten. Ihr altes Problem: Sie wusste nicht, was sie kochen sollte. Im Grunde war es egal, was sie zubereitete, es schmeckte alles nicht toll, aber aus ihrem Tick war in letzter Zeit eine Manie geworden. Es konnte einem Angst einjagen. Früher hatte sie ihre eigenen Gerichte wenigstens mit Hingabe in sich hineingeschaufelt. Jetzt fand sie an fast keinem mehr Gefallen.
»Mama?« Ich versuchte mich an einem Lächeln, obwohl meine Sorgen um Leander mich immer noch gefangen hielten. »Könntest du mir vielleicht Geld leihen? Nur ein bisschen, zehn oder zwanzig Euro«, sagte ich vage, als sie ihre Stirn zu runzeln begann. Ich hatte mir erst gestern fünfzehn Euro erbettelt, um Leander einen Schal und neue Socken kaufen zu können. Seine alten waren völlig durchlöchert gewesen.
»Nur? Das ist viel Geld, mein Schatz.«
»Ja, aber ich muss es haben … Bitte, Mama«, bettelte ich. »Ich brauche neuen Stoff.«
Mamas Gesichtszüge entgleisten. Sie sprang so heftig auf, dass eines der Kochbücher vom Tisch fiel und mit der spitzen Kante auf ihre Zehen prallte, doch sie kickte es nur zur Seite, um mich an den Schultern zu packen und mein Gesicht ins Licht zu drehen. »Oh Luzie, nein … bitte nicht … nicht das auch noch … Deine Augen … guck mich an! Du sollst mich anschauen, Fräulein!«
»Mama … bisschen leiser, bitte.«
»Leiser? Meine Tochter nimmt Drogen und ich soll leise sein?«, trompetete sie los. »Heribert, komm schnell!«
»Papa ist unten im Keller bei seinen Leichen, er hört dich nicht.« Ich war mir darin zwar nicht so sicher, aber es genügte, wenn Mama durchdrehte. Und es konnte dauern, Mama begreiflich zu machen, dass sie sich irrte. »Ich brauche Stoff, keine Drogen. Stoff. Hörst du, Mama?«
»Es war doch alles so gut!« Mama warf die Arme in die Luft und streifte dabei die Deckenlampe. In schlingernden Kreisen trudelte das Licht über den Tisch. Wenn ich noch länger hineinsah, würde ich tatsächlich wirken, als nähme ich Drogen. »Endlich war alles gut, und jetzt … warum? Warum?«
»Mama, hör mir doch mal zu. Ich will nur Stoff kaufen. Lederimitat. Zum Nähen. Davon wird man nicht high.«
»Nein?«, fragte Mama schwach und brachte mit einem Griff die Lampe zum Stillstand. »Nähen? Was? Aber … Nähen?« Irritiert legte sie die rechte Hand hinter ihr Ohr. »Du – willst – nähen? Freiwillig?«
»Ja«, antwortete ich mit fester Stimme, obwohl es mir selbst ein wenig beängstigend vorkam, wenn Mama es aussprach. Ich wollte nähen. Meine Finger juckten geradezu, sehnten sich nach Nadel und Faden.
»Aber du … du … Bist du krank, Liebes?« Besorgt legte sie mir ihre erhitzte Hand auf die Stirn. »Geht’s dir nicht gut? Oder ist es für eine Schulaufgabe?«
»Nein. Es ist für L… für mich«, verbesserte ich mich rasch. »Warte, ich zeige es dir.«
Ich flitzte in mein Zimmer, wo Leander wie angewurzelt vor dem Bett stand und in sich hineinstierte, schnappte mir meinen Entwurf, rannte zurück in die Küche und zeigte ihn Mama. Mit spitzen Fingern klaubte sie ihn mir aus den Händen und breitete ihn auf dem Küchentisch aus.
»Das ist ein sehr kurzer Rock, Luzie. Und er ist schief. Vor allem aber ist er zu kurz. Den wirst du nicht anziehen, mein Fräulein!«
»Es ist kein Rock«, wiederholte ich ungeduldig, was ich vorhin schon Leander vorgebetet hatte. »Es ist eher eine … na, eine Gürteltasche ohne Tasche.«
Mama blinkerte mich verständnislos an. »Aha.« Noch einmal berührte sie flüchtig meine Stirn. »Luzie, du gefällst mir nicht ganz. Erst das mit deinen Haaren und dann das Auge an der Wand …«
Okay, die Haare. Sie hatte es immer noch nicht verdaut. Vorgestern Nacht war ich aufgewacht und wollte ausprobieren, wie es aussehen würde, wenn ich vorne ein paar schwarze Strähnen in meinem roten Kurzhaarschnitt hätte. Da ich kein Haarfärbemittel zur Hand hatte, malte ich sie mit meinem schwarzen Eddinglackstift an. Ich fand es cool. Mama jedoch war beinahe in Tränen ausgebrochen, als sie mich erblickt hatte. Sie verkraftete es ohnehin kaum, dass ich mich weigerte, meine Haare wachsen zu lassen.
Ähnlich wie mit den Haaren war es mir mit dem Auge ergangen. Ich hatte kurz vor Mitternacht die Idee, ein Auge an meine Wand zu malen. Dummerweise war mir zu spät eingefallen, dass ich gar nicht malen konnte. Jedenfalls nicht gut genug, um mich auf meiner Wand zu verewigen. So blieb es bei der Pupille und der Iris. Aber das jetzt, mit der Gürteltasche ohne Tasche, war etwas anderes. Das musste ich zu Ende bringen. Und ich wusste, dass ich es konnte. Es würde einzigartig werden.
»Bist du sicher, dass du keine Drogen nimmst?«
»Ganz sicher, Mama. Ich will hier nur noch ein Stück Leder applizieren …« Schon wieder so ein bescheuertes, erwachsenes Klugscheißerwort, dachte ich und biss mir auf die Zunge. »… und vielleicht Nieten dranmachen. Mal sehen. Aber mein Taschengeld ist alle.«
»Was ist mit den fünfzehn Euro von gestern?«
»Ich hab davon Socken gekauft. Und einen Schal«, antwortete ich wahrheitsgemäß. Socken in Größe 42. Die konnte ich mir höchstens über den Kopf ziehen. Der Schal war leuchtend lila, nie im Leben würde ich ihn freiwillig tragen. Außerdem hatte Leander ihn die ganze Nacht um seinen Hals gehabt, er war inzwischen durchsichtig geworden. Doch Mama gab sich vorerst zufrieden, schnaufte bebend durch und kramte einen zerknitterten Zwanzig-euroschein aus ihrer Hosentasche. Da ich nur schwarze und graue Klamotten trug, würde ihr ein weiterer grauer Schal in meinem Schrank sowieso nicht auffallen – es war sinnlos, meine Aussage zu überprüfen. Sie hatte es aufgegeben, mich zu Pink und Rosa zu überreden. Wie glücklich es sie gemacht hätte, wenn ich ihr den lila Schal gezeigt hätte … oder wenigstens einen Freund präsentieren konnte, der lilafarbene Schals trug. Aber so wie es aussah, würde sie Leander niemals zu Gesicht bekommen. Was gut und schlecht gleichermaßen war. Sie würde auf der Stelle ohnmächtig werden, wenn sie erfahren würde, dass seit einem Jahr ein Junge in meinem Zimmer wohnte, dem ich schon mehrfach beim Duschen assistiert hatte und der auf unserer Klassenfahrt vor den Augen ihrer eigenen Tochter splitternackt in den Pool gesprungen war. Ein Junge, auf dessen Rücken ein riesiges Engelsflügeltattoo prangte …
»Danke, Mama. Ich bin bald wieder zurück.« Ich warf einen prüfenden Blick auf meinen senilen Hund Mogwai, der sich neuerdings immer auf die kühlen Küchenfliesen statt in sein Körbchen legte. Da lag er auch jetzt, ein Auge offen, das andere geschlossen. Sein Atem ging schwer. Er habe Wasser in der Lunge, hatte der Tierarzt bei der letzten Untersuchung gesagt. Es sei eben ein alter Hund und herzkrank dazu. Bedauernd beschloss ich, ihn hierzulassen, und zog stattdessen Leander am Ärmel aus meinem Zimmer und die Treppe hinunter. Er sperrte sich nicht dagegen, zeigte aber auch keinerlei Begeisterung für unseren abendlichen Ausflug. Teilnahmslos stolperte er mir hinterher, während uns der scharfe Dezemberwind unbarmherzig kalt ins Gesicht blies.
Es war doch gerade erst alles gut, hatte Mama gesagt. Ja, das hatte ich auch gedacht. Dass es nun besser würde und leichter, wo Leander seiner Truppe entkommen war. Dass wir ganz von vorne anfangen könnten, ohne Angst, Missverständnisse und Sorgen. Wie sehr nur hatten wir uns geirrt.
Das große Umstyling
»Nicht, Luzie, nicht! Das darfst du nicht!«
Aber es war schon zu spät. Ich hatte mich bereits in bester Parkour-Manier über den Ladentisch geschwungen und die verdutzte Fatima hinüber zu ihrem Anprobespiegel geschubst.
»Mon Dieu«, stöhnte Leander und wandte sich peinlich berührt ab. »Sie ist Muslimin, Luzie, sie will ihr Haar verdecken, du darfst das nicht … Mon Dieu, sie tut es wirklich.«
Ja, ich tat es, ich konnte nicht anders. Es war wieder eine dieser Eingebungen, gegen die ich völlig machtlos war. Nachdem ich die Geschäfte im Rathaus-Center erfolglos durchkämmt hatte, war ich in einer der zahlreichen kleinen Änderungsschneidereien Ludwigshafens gelandet, die fast alle fest in türkischer Hand waren. Fatima kannte ich sogar ein bisschen; Mama ließ bei ihr ihre Sporthosen umändern. Meistens waren sie ihr zu eng. Fatima trennte die Nähte auf, setzte einen schillernden Streifen in die Mitte und schon passten Mamas stramme Diskuswerferschenkel hinein. Übergrößen zu kaufen kam für Mama nicht infrage; schließlich war sie nicht dick, sondern durchtrainiert, wie sie stets mit weinerlichem Unterton bemerkte, wenn die Sprache auf ihre Klamottenprobleme kam. Ich hatte Fatima also schon ein paarmal zu Gesicht bekommen – aber jetzt betrachtete ich sie mit völlig anderen Augen. Ihre fein gezeichneten, schrägen Brauen, die kühne Nase, der geschwungene Mund und dazu ein pupsnormal gebundenes Kopftuch? Das war eine Schande.
»Schauen Sie mal«, sagte ich beflissen und guckte mir dabei zu, wie meine Hände in ihren Nacken griffen und geschickt die Enden des Tuchs lösten. Für einen kurzen Moment bekam ich ihre zu einem Knoten gesteckten dunklen Haare zu Gesicht. Sie störte sich nicht daran; sie wusste ja nicht, dass ein männliches Wesen im Raum war. Wahrscheinlich war sie ohnehin zu überrumpelt, um sich an etwas zu stören. Ich schüttelte das Tuch flink aus, warf es über ihren Kopf und verknotete seine Enden so, dass es nun eher wie eine Piratenkopfbedeckung aussah. Es stand ihr richtig gut. Die Enden des Tuchs hingen lässig über ihre linke Schulter. Nun noch ein großer goldener Ohrring und Jack Sparrow hätte sie vom Fleck weg geheiratet.
»Oh«, machte sie mit gespitzten Lippen und starrte ihr Spiegelbild an. Prüfend fuhr sie sich über den Hinterkopf, doch ihre Haare waren gut versteckt. Leander tat indessen so, als müsse er sich Luft zufächeln.
Ich hielt das Stück schwarzes Velourslederimitat in die Luft, um Fatima von ihrem Spiegelbild abzulenken und daran zu erinnern, dass ich es kaufen wollte, doch sie winkte abwesend in meine Richtung, ohne mich anzusehen. »Schenke ich dir.« Wie ein Model stellte sie sich in Pose, Rücken straff, Hals gerade, Brust raus. Und Fatima hatte viel Brust.
»Weg hier, aber schnell«, zischte Leander und drückte mich in Richtung Tür. »Das ging zu weit, Luzie!«
»Es hat ihr gefallen!«, verteidigte ich mich flüsternd, als wir wieder draußen auf der Straße standen. Es wurde immer schwieriger für mich, daran zu denken, dass niemand außer mir Leander hören konnte, und so ertappte ich mich auch dieses Mal dabei, mit ihm zu sprechen. Doch die Menschen, die an uns vorbei durch die Fußgängerzone hasteten, waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um mich zu beachten. Vorweihnachtsstress.
Inzwischen war es dunkel geworden und der böige Wind hatte sich verschärft. Leander zog die Schultern hoch, nieste kurz und wickelte sich den Schal enger um den Hals.
»Kalt«, bemerkte er schlotternd. Seine Lippen schimmerten bläulich im Licht der Weihnachtsbeleuchtung über unseren Köpfen. Ja, ihm musste kalt sein, erbärmlich kalt sogar. Zu seinen Wächterzeiten hatte Leander eine erhöhte Temperatur gehabt, die ihm von innen heraus Wärme verschafft hatte. Doch seit dem Dreisprung nahm er kalte Temperaturen wie Menschen wahr, obwohl sich seine Haut nach wie vor wärmer als meine anfühlte. Wir hatten uns nicht mehr oft berührt – auch etwas, worüber ich nicht nachdenken wollte, weil es mich bedrückte –, aber wann immer meine Finger seine Hand streiften, flirrte seine Wärme wie ein kleines Feuer über meine Haut. Was jedoch auch daran liegen konnte, dass ich Leander nun mal gerne anfasste.
»Ob wir dafür eine Jacke kriegen?« Ich zog den Zwanzig-euroschein aus meiner Hosentasche, den Mama mir vorhin gegeben hatte. Eine Winterjacke für zwanzig Euro? Das würde selbst bei Kik schwierig werden. Aber vielleicht einen Fleecepulli? Das war auf jeden Fall besser als das zerrissene schwarze Longsleeve und die Weste, die Leander trug. Seine Jeans hatte mittlerweile so viele Löcher, dass er eigentlich auch ohne sie hätte herumlaufen können. Mit einem merkwürdig ziehenden Gefühl im Bauch – ich glaube, es war Wehmut – dachte ich an unseren ersten gemeinsamen Klamotteneinkauf im New Yorker zurück, der ziemlich genau ein Jahr zurückliegen musste. Damals hatte Leander sich ebenjenes schwarze Shirt mit der Aufschrift »Wilde Zeiten« und eine Cargohose ausgesucht und mich unentwegt in Schwierigkeiten gebracht, weil wir uns zu zweit in eine Umkleidekabine quetschen mussten und er sich kapriziös gab wie immer, wenn es um sein Aussehen ging. Doch nun schien es mir, als sei es ihm beinahe egal, was er anzog, wenn es ihn nur wärmte.
Wortlos setzten wir uns in Bewegung und liefen dem Hemshof entgegen. Bei unserem Zwischenstopp im Rathaus-Center fand ich tatsächlich eine Fleecejacke für 19,95Euro, die Leander früher keines Blickes gewürdigt hätte, nun aber mit einem knappen Nicken akzeptierte. Anziehen konnte er sie noch nicht; er musste sie erst eine Weile unbemerkt tragen, bis sie sich ihm angepasst hatte und transparent geworden war. Als wir ein schmales, stilles Gässchen ohne störende Passanten erreicht hatten, fing er wieder an zu plappern.
»Luzie, Luzie …« Tadelnd schüttelte er den Kopf. »Chérie, das hätte danebengehen können. Was glaubst du, was los gewesen wäre, wenn Ümit plötzlich hereingekommen wäre?«
»Wer ist Ümit?«, fragte ich mäßig interessiert, aber froh, dass Leanders frierendes Schweigen beendet war.
»Na, Fatimas Ehemann. Wer weiß, wie er reagiert hätte, wenn er gesehen hätte, was du da machst! Fummelst einfach an seiner Frau herum, ohne sie um Erlaubnis zu fragen! Das macht man nicht, Luzie!« Leander hustete trocken auf. »Ist ja fast schon wie bei Gunnar …«
»Gunnar?« Jetzt wurde ich hellhörig. Gunnar war Leanders Onkel, ein Verschmähter wie er selbst. Genaues hatte ich nie über ihn herausfinden können, aber was ich mir aus Leanders Äußerungen und denen seiner Truppe zusammenreimte, ließ den Rückschluss zu, dass er ebenfalls die Nähe zu Menschen gesucht hatte. Wie Leander. Womöglich war ihm sogar der Dreisprung geglückt.
»Na, deine Anfälle.«
Anfälle. Soso. Ich hakte nicht nach, was er damit meinte; ich wusste es selbst zu gut. Als Zufall konnte man das alles nicht mehr abtun. Meine Eddingfrisur, das Auge an der Wand, die Gürteltasche ohne Tasche und nun auch noch Fatimas Kopftuchumstyling. Irgendetwas stimmte nicht mit mir. Auf unserer Klassenfahrt im Frühjahr hatte ich mich beim aufgezwungenen Nähen meines Burgfräuleinkostüms noch zu Tode gelangweilt und nun griff ich freiwillig zu Nadel und Faden. Aber Gunnar war ein Wächter gewesen. Ich war ein Mensch.
»Was haben diese Anfälle mit Gunnar zu tun?«
»Nichts mit Gunnar. Mit mir. Dem Dreisprung. Allem«, erwiderte Leander unbestimmt und machte eine ausladende Armbewegung Richtung Himmel. »Wie es aussieht, hat dich die Muse geküsst. Und Gunnar war so etwas wie eine Muse für seinen Klienten. Vielleicht war ich ja deine Muse oder … oder etwas aus unserer Truppe ist auf dich übergetreten. Von den künstlerisch begabten Klienten, die wir beschützt haben. Musiker, Schauspieler, Maler. Vermutlich von allen ein bisschen. Es kommt von uns.«
»Schon wieder?«, fragte ich deutlich genervt. Es reichte mir, dass ich Leanders Truppe sehen und hören konnte. Gerade Letzteres war kein Vergnügen. Wenn sie miteinander sprachen, hörte sich das an, als würde man mit seinen Fingernägeln über eine Tafel fahren. Mir war davon fast übel geworden. Nun hatte ich auch noch Eigenschaften von ihnen und ihren Klienten geerbt?
»Den Ohrwurm hast du ja noch, oder?«
Ich nickte nur. Ja, den hatte ich und er nervte mich ausnahmsweise nicht – im Gegensatz zu den meisten anderen Dingen, die Leander mit mir anstellte. Ich mochte diesen Ohrwurm sogar. Egal, wie anstrengend mein Tag gewesen war und wie müde ich mich fühlte, wenn ich mich abends ins Bett legte: Kurz vor dem Einschlafen schlich er sich in meinen Kopf und ich summte ihn innerlich mit. »Who’s gonna drive you home … tonight …« Ich fühlte mich durch diesen Song beschützt und geborgen. Wenn er zufällig bei Mama in der Küche im Radio lief, kam er mir vor wie ein persönliches Geschenk. Es machte mich beinahe stolz. Leander hatte ihn mir im Zuge seines Dreisprungs ins Ohr gepflanzt und nun würde er mich mein Leben lang begleiten. Ich hatte nichts dagegen. Aber jetzt, wo Leander mich danach fragte, fiel mir auf, dass er auch während meiner »Anfälle« aufbrandete. Er kam zeitgleich mit meinen Ideen und verflüchtigte sich wieder, wenn ich sie umgesetzt hatte. Ich versuchte Leanders forschendem Blick auszuweichen, doch er hatte in meiner Miene bereits gelesen, was ich dachte.
»Also doch«, wisperte er und fuhr sich in seiner typisch lässigen Art durch sein welliges Haar, das ihm sogleich wieder in die Stirn fiel. Dennoch leuchtete sein blaues Auge hell und klar, während er mich musterte. »Dann musst du dich wohl damit abfinden. Mit diesen Anfällen.«
»Sie gehen nicht mehr weg? Nie wieder?«
»Nie wieder«, bestätigte Leander mit Grabesstimme. Ich wusste nicht genau, wie ich das finden sollte. Eher einschüchternd als schön. Noch immer konnte ich mich nicht des Eindrucks erwehren, dass die Anfälle eigentlich gar nichts mit mir zu tun hatten. Ich war mir selbst fremd, wenn ich ihnen erlag. Mama hatte sogar gedacht, ich sei krank. Was sollten erst die Jungs denken? Früher machten wir zusammen Parkour, jagten über Hausdächer und vollführten halsbrecherische Stunts. Nun nähte ich Gürtel-taschen ohne Tasche. Das war lächerlich. Auf einmal hätte ich das Stück Velourslederimitat am liebsten in den nächsten Mülleimer geschmissen. Doch es fühlte sich so schön samtig unter meiner Hand an, dass ich es nur sanft streichelte und in meiner Tasche ruhen ließ. Ich streichelte ein Stück Stoff! Ich war wirklich nicht mehr ganz dicht.
»Und diese blöden Wörter und Sätze, die ich manchmal benutze? Kommen die auch von euch? Würde ja passen«, bemerkte ich grantig. Nathan und Clarissa von Cherubim übertrafen in ihrer gestelzten Ausdrucksweise fast schon meinen eigenen Vater – und wer Papa kannte, wusste, dass das kein Kinderspiel war.
»Nö. Glaub ich nicht.« Leander stopfte die Hände in die Taschen seiner Jeans und zog die Schultern noch weiter hoch. »Du wirst halt langsam erwachsen.«
»Was!?«, quietschte ich entsetzt. »Und deshalb muss ich gleich solchen Müll reden? Das ist ja krank!«
»Du hast jetzt keinen Wächter mehr, Luzie. Dir bleibt gar nichts anderes übrig, als erwachsen zu werden.« Leanders Tonfall war so scharf geworden, dass ich stehen blieb. Ja, das hatte er mir in den vergangenen Wochen nicht nur einmal gesagt. Du hast keinen Wächter mehr, Luzie. Blablabla. Aber machte es einen Unterschied? Seitdem Leander einen Körper bekommen hatte, war er ein noch mieserer Wächter gewesen als zuvor schon. Durch seinen übertriebenen Beschützerinstinkt hatte er mich mindestens so oft in eine riskante Situation gebracht, wie er mich vor einer Gefahr bewahrt hatte. Das glich sich also aus. Außerdem hatte Vitus, sein Cousin und mein Ersatzwächter während Leanders Nachschulung vergangenen Winter, bereits beschlossen, dass ich keinen Schutz mehr brauchte. Und doch fühlte ich eine brennende Leere in meinem Herzen, wenn ich darüber nachdachte. Ob Leander wollte oder nicht, er konnte mich nicht mehr ansatzweise in der Intensität und mit der Magie beschützen, wie es ihm einst in die Wiege gelegt worden war. So faul und schlampig er diese Aufgabe auch bewältigt hatte, es war ihm ernst damit gewesen.
»Können wir weitergehen? Mir ist kalt. Ehrlich, mir ist kalt, Luzie.«
Es war nicht zu übersehen. Seine Nasenspitze leuchtete rot, und seine Lippen sahen aus, als habe er zu lang in kaltem Wasser gebadet.
»Schau mich nicht so an«, nuschelte er und drehte sich im Laufen von mir weg.
»Zicke«, zischte ich leise, wohl wissend, dass er es hörte, aber er sollte es ja auch hören. Seit seinem Dreisprung durfte ich ihn nicht länger als ein paar Sekunden ansehen. Sogar nachts schien er zu spüren, wenn meine Blicke auf ihm ruhten, während er schlief, und drehte sich zum Fenster, sodass ich nur noch seinen Rücken begutachten konnte, eingehüllt in seine Kuscheldecke, die ihn mehr schlecht als recht wärmte. Ich wusste gar nicht mehr genau, wie sein Engelstattoo aussah. Neuerdings zog er sich um, wenn ich nicht im Zimmer war, und duschte, sobald Mama und Papa das Haus verlassen hatten und ich zur Schule ging. Fast immer allein. Auch etwas, von dem ich nicht wusste, ob ich es gut oder schlecht fand. Es war ungeheuer entspannend, ohne Leander S-Bahn zu fahren, mit meinen Jungs oder Sofie zu quatschen und im Unterricht zu sitzen, doch gleichzeitig fragten mich tausend flüsternde Stimmen, was er wohl gerade anstellte, ob er heimlich von Papas Danziger Goldwasser trank, sich von Mama unter der Dusche erwischen ließ – und ob es ihm total egal war, was ich den ganzen Tag trieb. Trotzdem, es war gut, dass einer im Haus blieb, um nach dem Hund zu sehen, und Mogwai liebte Leander über alles. Für ihn war er genauso präsent wie ein Mensch.
Schweigend liefen Leander und ich zurück nach Hause, wo ich, ohne ein Wort zu verlieren, damit begann, das Velourslederimitat zurechtzuschneiden – es bekam Fransen; die Nieten mussten warten, bis ich wieder Taschengeld hatte – und an den Karostoff zu nähen. Ich schaute nicht von meiner Arbeit auf, bis sie fertig war, aber aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, dass Leander sich samt Fleecejacke in seine Decke gehüllt hatte und seinen Rücken an die Heizung presste.
Das Abendessen nahm ich lustlos ein, unter vielen prüfenden und auch besorgten Blicken von Mama und Papa, doch was sollte ich schon sagen? Dass es zwischen meinem unsichtbaren Freund und mir seit Wochen heftig kriselte? Überhaupt, Freund – was bedeutete das? Mochte Leander mich? Hatte er mich lieb? War »lieb haben« nicht etwas für Sofie und ihre Kicherfreundinnen? Und »lieben« ein viel zu großes Wort für uns? Anders gefragt: Fand er mich hübsch? (Fand mich überhaupt jemals ein Junge hübsch?) Erinnerte er sich an unsere Küsse? Umarmungen? Dass er mich durch die halbe Stadt getragen hatte, über tausend Umwege, damit mich niemand sah, nur weil er mich nicht wecken wollte?
Bedeutete das alles gar nichts?