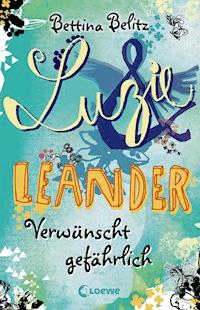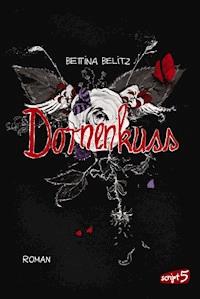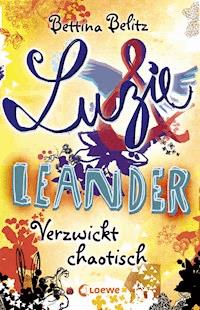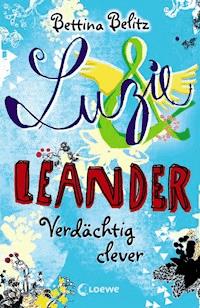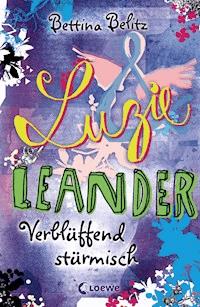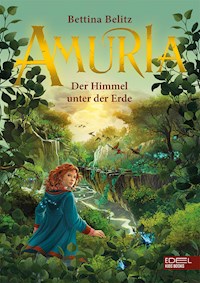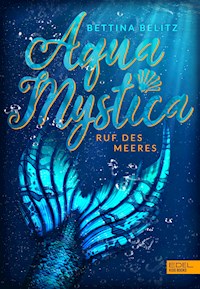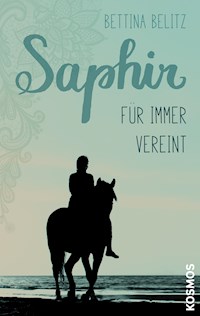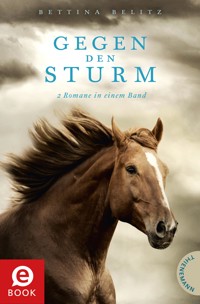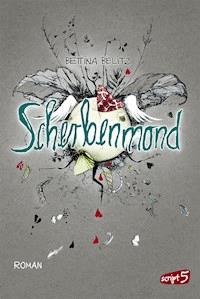
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: script5Hörbuch-Herausgeber: The AOS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Splitterherz-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Längst ist der Sommer vergangen, der Elisabeth Sturm die Augen öffnete für die gefährliche Welt der Mahre, der Sommer, in dem sie sich in einen von ihnen verliebte. Seit Monaten ist Colin nun verschwunden und Ellie quält sich durch einen nicht enden wollenden Winter. Die Tage tröpfeln gleichförmig vor sich hin, in den Nächten dagegen wird Ellie von Albträumen heimgesucht, die sie verstört zurücklassen. Um auf andere Gedanken zu kommen, quartiert Ellie sich bei ihrem Bruder in Hamburg ein. Doch sie erkennt Paul kaum wieder: Er wirkt erschöpft und gehetzt und scheint etwas vor ihr zu verbergen. Je mehr sie in Pauls Welt eintaucht, desto deutlicher überkommt Ellie ein Gefühl der Bedrohung und plötzlich weiß sie nicht mehr, wem sie noch trauen kann. Sie ahnt nicht, dass ihre Sorge um Paul und ihre Liebe zu Colin sie tiefer verletzen könnten als der abgründigste Traum. Bester Roman 2011 auf BücherTreff.de Mit der romantischen Liebesgeschichte von Elli und ihrem träumeverzehrenden Nachtmahr Colin gelang Bettina Belitz ein grandioses Debüt. Die Splitterherz-Trilogie ist All-Age Lesefutter vom Feinsten. Für alle, die gerne Paranormal Romances lesen, ein Muss. "Scherbenmond" ist der zweite Band einer Trilogie. Der Titel des ersten Bandes lautet "Splitterherz".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 913
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für S. J., Primus inter Pares.
Denn das Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.
PROLOG
Ich bin wie die See.
Ich werde mich über dich erheben und dich von allen Seiten umfangen. Ich muss nur auf den richtigen Augenblick warten und es dann tun, wenn jene Brücken zerstört sind, über die du früher so sicher und selbstvergessen gelaufen bist.
Du wirst in mir dein Heil sehen, dem Schicksal für mein Kommen danken.
Du wirst mir willfährig sein, wann immer ich dich brauche. Und das werde ich oft, so oft, dass du glaubst, ohne mich nicht mehr existieren zu können. Denn ich nähre dich.
Ich werde dich sehen, bevor du mich siehst.
Komm nur zu mir, in die Welt des Wassers. Hier ist niemand außer uns. Wir werden uns ganz nah sein.
Und selbst in deinen tiefsten Träumen werde ich dich niemals loslassen.
ACEDIA
VORAHNUNGEN
»Diesmal ist es anders.«
Obwohl ich seit Stunden wach lag und jeden einzelnen von Mamas Schritten gehört und schon lange auf diesen Satz gewartet hatte, fuhr mir der Schreck in die Knochen. Mein Herz begann von einer Sekunde auf die nächste zu rasen und eine plötzliche Übelkeit krallte sich in meinem Magen fest. Ich hatte Strategien für diesen Moment entworfen, mir kluge Argumente zurechtgelegt, an souveränen Gesichtsausdrücken gearbeitet. Doch ihn zu erleben war etwas gänzlich anderes, als darüber nachzudenken.
Ich blieb starr liegen, die Augen geschlossen. Papa war weg. Verschwunden. Und das bereits viel zu lange. Ein paar Wochen – ja, das hatte es immer wieder gegeben. Aber nun hatten wir seit Silvester nichts mehr von ihm gehört. Das Einzige, was wir als Anhaltspunkt für seinen Verbleib hatten, war sein letzter Aufenthaltsort. Rom. Angeblich Rom.
Rom klang harmlos. Die Situation aber war nicht harmlos. Mama und ich wussten das. Denn Papa hatte von Rom aus in den Süden des Landes aufbrechen wollen, um »Dinge in Erfahrung zu bringen«. Im Süden lebte Tessa. Und Tessa war das absolute Gegenteil von harmlos.
Doch bis zu dieser sturmzerzausten Nacht hatte keine von uns gewagt, es auszusprechen. Ich hatte in den ersten Tagen nach Papas letztem Funkspruch daran gedacht, es dann jedoch verworfen. Was half es, darüber zu reden? Nichts. Wir konnten ihn nicht erreichen. Dass Mama das Schweigen nun brach, kam mir vor, als habe sie eine geheime Abmachung missachtet. Es fühlte sich beinahe an wie Verrat.
»Ellie, ich weiß, dass du nicht schläfst.«
Gereizt fuhr ich hoch. »Verdammt, Mama, wir kennen das doch beide. Er verschwindet hin und wieder. Und kommt meistens genau dann zurück, wenn wir nicht damit rechnen. Oder?«
Der Sturm ließ die Rollläden klappern und schickte eine wütende Böe über das Dach. Direkt oberhalb meines Bettes rumpelte es im Gebälk. Mit einem metallischen Klong schlug das Telefonkabel gegen den Schornstein.
Automatisch hoben wir unsere Blicke und schauten an die Decke. Mama seufzte leise.
»Mag sein, dass das bisher immer so war. Aber es ist das erste Mal, dass er so lange verschwunden ist, seitdem …«
»Sei still, bitte!«, fiel ich Mama ins Wort, lief ans Fenster und starrte hinaus in die tiefschwarze Februarnacht.
»Ellie, wir müssen doch …«
»Nein!« Kurz presste ich mir die Hände auf die Ohren, bevor ich begriff, wie albern und kindisch ich wirken musste. »Ich will davon nichts hören«, setzte ich etwas sanfter hinzu, vermied es aber, Mama dabei anzusehen. Ich konnte ihren ratlosen, fragenden Blick spüren und ich würde ihm nicht standhalten können.
Ich hatte Angst vor dem, was sie sagen könnte. »Es ist das erste Mal, dass er so lange verschwunden ist, seitdem …« – seitdem was? Würde ich die Version hören, die ich kannte oder zu kennen glaubte? Oder würde ich erfahren, dass ich mir alles nur eingebildet hatte?
Was ich zu wissen glaubte, erschien mir inzwischen so absurd, dass ich in manchen meiner schlaflosen Nächte wieder einmal an meinem Verstand zweifelte. Ich hatte mich in einen Nachtmahr verliebt. Colin. Colin Jeremiah Blackburn. Ein glückliches Händchen bei der Partnerwahl hatte ich ja nie gehabt. Aber ein Nachtmahr – stopp.
Ich ließ meine Stirn an die eiskalte Fensterscheibe sinken und versuchte zu rekapitulieren, was ich im Sommer erfahren und erlebt hatte. Okay, da war Colin. Colin, der sich nicht verlieben und nicht glücklich sein durfte, weil dann Tessa kam – jener Mahr, der ihn erschaffen hatte. Und wegen niemand anderem als mir kam sie tatsächlich. Er kämpfte mit ihr, konnte nicht gewinnen, ich brachte ihn in Papas Klinik, weil er dort sicher war. Sicher, aber krank vor Hunger. Und dann haute er einfach ab.
Ach ja, mein Vater war ebenfalls ein halber Mahr – das durfte nicht unerwähnt bleiben. Und weil er aus dem Schlechten etwas Gutes machen wollte, hatte er sich vorgenommen, so ganz nebenbei die Welt zu retten.
Ich schüttelte unmerklich den Kopf. Wenn es eines gab, was ich von diesem ganzen Hokuspokus glaubte, dann die Tatsache, dass ich Colin geliebt hatte. Der Rest war mit den Wochen und Monaten immer unwirklicher geworden. Bis zu dem Tag, an dem ich daran zu zweifeln begann, all das erlebt zu haben.
Denn es gab keine echten Beweise. Ja, ich hatte eine Narbe an meinem Bein, die Frankensteins Monster alle Ehre gemacht hätte. Doch im Krankenbericht stand: von einem Keiler angefallen. Treibjagd. Und so war es ja auch gewesen – sah man von der unbedeutenden Tatsache ab, dass direkt nebendran zwei Mahre auf Leben und Tod miteinander gekämpft hatten und der männliche Mahr dem weiblichen circa drei- bis fünfmal das Genick gebrochen hatte. Noch immer schreckte mich das trockene Knirschen aus dem Schlaf, mit dem Tessas zerborstene Knochen wieder zusammenwuchsen, nur unterbrochen von einem zufriedenen Schnalzgeräusch, wenn die Wirbel in die richtige Position sprangen. Aber meine Narbe stammte von einem wütenden Keiler.
Auch Mister X war nur ein Indiz, kein Beweis. Colin hatte ihn nicht persönlich bei mir abgeliefert. Der Kater war mir zugelaufen, bevor er schließlich beschloss zu bleiben. Seit Colins Verschwinden hatte er nur noch wenig Mystisches an sich. Zweimal täglich setzte er ein bestialisch stinkendes Würstchen ins Katzenklo und versuchte anschließend, wild scharrend mit seiner Streu Schloss Neuschwanstein nachzubauen. Erfolglos. Er knusperte wie jeder pupsnormale Hauskater sein Trockenfutter, ließ sich von Frauchen hinter den Zauselohren kraulen und baute sich Höhlen unter sämtlichen Teppichen und Bettdecken dieses viel zu großen Hauses. Nein, Mister X zählte nicht, obwohl mir seine schwarzpelzige Anwesenheit immer wieder Trost spendete.
Vielleicht wäre Tillmann eine Art Beweis gewesen. Immerhin hatten wir dieses Abenteuer gemeinsam überstanden. Er hatte Tessa gesehen, war sogar beinahe von ihr angefallen worden. Er hatte mich in den Wald gefahren, zum Kampf, auch wenn er den Kampf selbst nicht miterlebt hatte. Das war allein mir vorbehalten gewesen – eine Erfahrung, auf die ich gerne verzichtet hätte. Nur ich wusste, welch grausame Kraft in Tessa schlummerte. Außer Colin. Colin wusste es auch – aber der trieb sich auf den Weltmeeren herum.
Ja, Tillmann hätte mir helfen können, Traum von Wirklichkeit zu unterscheiden. Doch er zog es vor, so zu tun, als pflegten wir nur eine flüchtige Bekanntschaft. Noch schlimmer: Seit einigen Wochen ging er nicht mehr auf unsere Schule. Vor Weihnachten hatte ich ihn das letzte Mal gesehen. Wir waren uns in der Pause begegnet, ganz in der Nähe der Müllcontainer – jenes Ortes, an dem ich ihm im Frühsommer aus der Patsche geholfen hatte.
»Hi, Ellie«, sagte er, um dann, ohne mich anzusehen, an mir vorbeizulaufen. Er grüßte mich; ich konnte ihm nicht vorwerfen, dass er mich ignorierte. Aber meine Versuche, mit ihm über das zu reden, was uns beide verband – ein Rendezvous mit Tessa –, scheiterten allesamt kläglich. Er blockte ab. Warum, wusste ich nicht. Und als nach Colins Flucht einige Wochen verstrichen waren, wurde mir auch bewusst, dass Tillmann und ich uns eigentlich nicht kannten. Wir hatten extreme Situationen zusammen durchgestanden. Trotzdem genügte es nicht, um von Freundschaft zu sprechen. Das war genau das, was er mir jetzt demonstrierte: Wir waren nur flüchtige Bekannte. Mehr nicht.
Seit dem neuen Jahr wusste ich nicht einmal, wo er abgeblieben war. Herrn Schütz, der sich als Tillmanns Vater entpuppt hatte, wagte ich nicht zu fragen. Irgendwie fand ich es peinlich, meinen Biologielehrer nach seinem Sohn auszuquetschen. Außerdem hatten die beiden ohnehin kaum Kontakt. Womöglich riss ich damit nur alte Wunden auf.
Nein, es gab keine Beweise – bis auf zwei Zettelchen und die beiden Briefe, die Colin mir geschrieben hatte. Vier Stücke Papier, die ich kurz nach seinem Verschwinden in eine kleine metallene Kiste gepackt hatte. Die Kiste hatte ich auf meinen Kleiderschrank gestellt und weit nach hinten geschoben – so weit, dass ich sie nicht sehen konnte. Denn ich war mir sicher gewesen, es nicht ertragen zu können, seine Zeilen zu lesen. Ich wollte abwarten, bis sich mein Herz nicht mehr ganz so verwundet fühlte und all die Risse und Schnitte zu heilen begannen. Doch sie heilten nicht. Sie vernarbten nur und es reichte eine Erschütterung meiner Seele, um sie aufbrechen und von Neuem bluten zu lassen.
Und jetzt – jetzt hatte ich die Befürchtung, dass es gar keine Kiste auf meinem Schrank gab. Dass diese Briefe nur ein weiteres Bewusstseinsirrlichtern meines halluzinatorischen Sommers gewesen waren.
Ein offenes, ehrliches Gespräch mit meiner Mutter würde möglicherweise zu den besten Beweisen führen, die ich überhaupt finden konnte. Denn Mama bildete sich nichts ein. Das wusste ich genau. Trotzdem wollte ich es nicht, denn es gab zwei Erklärungsvarianten, von denen die eine so wahrscheinlich war wie die andere: Entweder erfuhr ich bei unserem Gespräch, dass es Colin nicht gegeben hatte, jedenfalls nicht als Cambion, sondern als Psychopathen, dass Tessa ein Albtraum gewesen und ich auf dem besten Wege war, meinen Verstand zu verlieren. Die andere Variante machte mir jedoch auch keinen Mut. Sie bedeutete, dass dieses ganze Mahrgedöns die Wahrheit war, Tessa existierte und Papa ihretwegen verschwunden war. Nein, nicht ihretwegen. Sondern meinetwegen. Weil ich mich gegen meine Eltern gewandt hatte, um Colin trotz ihrer Verbote immer wieder zu sehen und damit Tessa anzulocken – woraufhin Papa sich genötigt gesehen hatte, sie zu verraten. Er hatte Colin gesagt, dass sie sich auf den Weg gemacht hatte.
Ich und niemand anderes als ich hatte das alles angerichtet. Den Gedanken an diese Schuld ertrug ich genauso wenig wie die Vorstellung, dass mein Sommer mit Colin ein Hirngespinst war. Selbst meine Liebe zu ihm war kein Beweis. Ich war auch in Grischa verliebt gewesen, dabei hatte es ihn nicht gegeben. Es hatte einen Jungen mit seinem Namen gegeben, der auf meine Schule ging – das ja. Doch er hatte nichts oder nicht viel mit dem Jungen gemein, der in meinen Tag- und Nachtträumereien aufgetaucht war. Dennoch hatte ich ihn geliebt. Ich traute mir durchaus zu, mich ein weiteres Mal in ein Hirngespinst verliebt zu haben. Dafür hatte ich offenbar Talent.
»Gut, du willst nicht reden. Aber ich werde etwas unternehmen«, riss mich Mamas ruhige Stimme aus meinen selbstzerfleischenden Grübeleien.
»Was willst du denn bitte unternehmen?«, fauchte ich sie an.
»Ehrlich gesagt ist mir das reichlich egal. Hauptsache, ich sitze nicht länger untätig herum. Das habe ich an der ganzen Sache immer am meisten gehasst und ich hasse es immer noch. Ich werde morgen die Polizei informieren.«
»Die Polizei …« Ich lachte trocken auf. Aufreizend langsam drehte ich mich zu Mama um. Sie saß hellwach und mit durchgedrücktem Kreuz auf meiner Bettkante und musterte mich aufmerksam. Ihre weichen grünbraunen Mandelaugen schimmerten schwach im Halbdunkel. Sie sah ausgeruht aus. Ich hatte sie nie zuvor so ausgeruht gesehen und aus einem jähen Impuls heraus wollte ich sie dafür anklagen. Dafür, dass sie schlief, während wir uns fragen mussten, ob Papa noch lebte. Ich würgte meinen Ärger mühsam hinunter. Mama hatte mein ganzes Leben lang nicht richtig geschlafen, weil sie unterschwellig fürchtete, dass Papa ihre Träume rauben könnte. Sie hatte das nie ausgesprochen, aber ich wusste es. Und es war nur natürlich, dass ihr Körper jetzt nachholte, was ihm achtzehn Jahre Nacht für Nacht verwehrt worden war.
»Ja, die Polizei. Vielleicht hatte er einen Unfall, bei dem all seine Papiere verloren gegangen sind, liegt hilflos in irgendeinem italienischen Krankenhaus und wartet nur darauf, dass sich jemand nach ihm erkundigt.«
Ich stockte und das Blut schoss mir heiß ins Gesicht. Krankenhaus? Unfall? Das klang viel zu normal. Erschreckend normal. Dann hatte ich also tatsächlich alles nur geträumt?
»Oder es könnte sein«, Mama räusperte sich und auch ich bekam plötzlich das Gefühl, nicht mehr sprechen, geschweige denn atmen zu können, »dass sie ihn aus Rache verschleppt haben.«
»Sie«, erwiderte ich heiser.
Mama nickte. »Doch wir müssen alles andere abklären, bevor wir selbst etwas unternehmen. Und ich bitte dich, dass du mich dabei unterstützt. Wir sind nur noch zu zweit, Ellie. Lass mich nicht alleine mit der Polizei reden.«
Mama war nach wie vor gefasst, aber zum ersten Mal hörte ich blanke Angst in ihrer Stimme. Ich trat vom Fenster weg und setzte mich in gebührendem Abstand von ihr ans Kopfende meines Bettes. Ich wollte nicht, dass sie auf die Idee kam, mich in den Arm zu nehmen. Jede Berührung wäre zu viel gewesen. Meine Haut kribbelte vor Anspannung und mir war, als würden bis zum Zerreißen gespannte Stricke an meinem Herz zerren.
»Elisabeth«, sagte Mama sanft. »Ich habe dich in Ruhe dein Abitur machen lassen. Ich wollte dich nicht belasten. Du warst krank genug vor Weihnachten und ich bin stolz, dass du es trotzdem geschafft hast, für die schriftlichen Prüfungen zu lernen. Aber wir müssen handeln. Verstehst du das?«
Ich nickte abermals, unfähig, ihr zu antworten. Nun war es also so weit. Wir rechneten ganz offiziell damit, dass Papa etwas zugestoßen war. Und es würde nur eine Frage der Zeit sein, bis irgendjemand behauptete, dass es meine Schuld gewesen war. Bis Mama das behauptete … Ich schaute sie flüchtig an. Ich konnte keine stillen Vorwürfe in ihrem Blick entdecken. Doch in mir brodelten sie unentwegt.
Mit einem hatte sie definitiv recht: Wir waren nur noch zu zweit. Mein Bruder Paul hatte schon lange einen Schlussstrich gezogen und beschlossen, dass diese Nachtmahrgeschichte seines Vaters Humbug und das Symptom einer beginnenden Geisteskrankheit war. Er glaubte ihm nicht. Papa selbst war fort.
Mama und ich waren übrig geblieben. Mama kannte Papas Narben am Nacken und sie hatte seine Veränderung deutlicher wahrgenommen als jeder andere. Sie hatte zugesehen, wie aus einem Menschen ein Halbblut wurde.
Aber ich, ich hatte im Arm eines Cambion geschlafen und mit meinen Lippen seine kühle Haut berührt. Ich hatte dem pulsierenden Rauschen in seinem Körper gelauscht, mich in seinen Erinnerungen verloren und mir von ihm meine Tränen von den Wangen küssen – nein, essen lassen.
Ich war ihm in den Kampf gefolgt und hatte zugesehen, wie er versuchte, einen Mahr zu besiegen, der so erschreckend viel stärker und bösartiger war, als ich es jemals für möglich gehalten hatte. Und dieser Mahr war seine eigene Mutter.
Nur ich wusste, was Mamas Entscheidung wirklich bedeutete.
ERMITTLUNGSSTOPP
»Sie wollen mir also sagen, dass Ihr Mann in der Vergangenheit immer wieder wochenlang weg war? Regelmäßig? Und sich auch damals nicht gemeldet hat?«
Der Polizist verlagerte sein Gewicht auf die rechte Seite seines ausladenden Hinterns und das abgewetzte Polster seines Schreibtischsessels knarzte bedrohlich. Es wunderte mich, dass der Stuhl unter seiner Last noch nicht zusammengebrochen war. Alles in diesem schäbigen Zimmer der Polizeiwache wirkte zu klein für ihn – der altersschwache Tisch mit den drei halb ausgetrunkenen Kaffeetassen, der schmale Laptop vor seiner Nase, den er durchweg ignorierte, das winzige, beschlagene Fenster über seinem feisten Nacken und sogar die stahlgrauen Aktenschränke zu unserer Rechten. Was jedoch zu ihm passte, war der Mief nach kaltem Schweiß, Laserdruckersmog und vollen Aschenbechern, der sich wie zäher Nebel auf meine Atemwege legte.
Ich hatte nie zuvor einen solch fetten Menschen gesehen – jedenfalls nicht in natura. Deshalb fiel es mir schwer, seinen Worten zu folgen. Ich glotzte ihn an wie ein seltenes Insekt und musste mich gleichzeitig immer wieder abwenden, weil mir dieses Insekt sehr unappetitlich erschien. Trotzdem drang zu mir durch, was er uns mit seinen Worten bedeuten wollte. Und es ärgerte mich.
»Ja«, antwortete Mama mit mühsamer Beherrschung. »Ja, das meine ich. Doch er ist nie so lange weggeblieben wie jetzt.«
Der Polizist gab einen schleimigen Kehllaut von sich und kritzelte ein paar Notizen auf den winzigen Block, den er vorhin aus seiner Hosentasche gezogen hatte, anstatt die Tastatur seines Laptops zu benutzen (vermutlich konnte er ihn nicht einmal bedienen). So sahen also moderne Ermittlungsmethoden im Westerwald aus. Gekrakel auf DIN A6. Als er mit seinen Kritzeleien fertig war – leider konnte ich nichts entziffern –, schnaufte er tief durch und legte seine fleischige Pranke auf Mamas verkrampfte Finger.
»Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, Frau Sturm, aber …«
»Das tun Sie bereits«, entgegnete Mama knapp und zog ihre Hand weg.
Der Polizist grinste. »Jedenfalls – haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob Ihr Mann ein Doppelleben führt?«
»Ha!«, entfuhr es mir und Mama warf mir einen strengen Blick zu. Doppelleben. Hundert Punkte! Nur leider würden wir ihm dieses Doppelleben nicht en détail erläutern können.
»Mein Mann hat keine Affäre, falls Sie darauf anspielen wollen.«
»Liebe Frau Sturm.« Der Polizist griff nach der vollsten der drei Kaffeetassen – uns hatte er keinen Kaffee angeboten, was vielleicht aber auch besser war – und nahm einen tiefen Schluck. Sein Hals wabbelte. »Ich weiß, dass man das nicht wahrhaben möchte. Aber was glauben Sie, wie oft wir so etwas erleben? Achtundneunzig Prozent der vermissten Ehemänner geht es prächtig. Sie liegen irgendwo am Strand, mit einem jungen Mädchen im Arm, und genießen ihren neuen Start ins …«
»Jetzt hören Sie mir mal gut zu!« Mama stand auf und hieb die Hände auf den Tisch. Ein paar Papiere segelten zu Boden. »Mein Mann ist seit dem 31.Dezember verschwunden und wir haben kein Lebenszeichen mehr erhalten. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie gründlich recherchieren, ob ein Leopold Sturm oder ein Leopold Fürchtegott in einem italienischen Krankenhaus liegt und sein Auto gefunden wurde. Ob er eine junge Frau im Arm hat oder nicht, ist mir wurscht. Haben Sie das verstanden?«
»Gewiss, Frau Sturm«, erwiderte der Polizist, doch wieder hatte sich das dümmliche Grinsen auf sein Gesicht geschlichen. Er stopfte den Block in seine Hosentasche, tippte sich an die Stirn und watschelte an uns vorbei aus dem Raum. Er ließ uns einfach sitzen! Mama und ich starrten uns einen Augenblick ratlos an, dann erhoben wir uns ebenfalls und liefen nach draußen. Die letzten Schritte rannte ich. Erst als ich mir sicher war, dem Dunstkreis des Fettwanstes vollkommen entwichen zu sein, und wir im Auto saßen, wagte ich, tief einzuatmen. Noch immer hing mir der Schweißgeruch in der Nase. Angeekelt drückte ich meinen Schal gegen meinen Mund und schluckte, während Mama schweigend ihre Ente startete und das Röhren des Motors jegliches Gespräch unmöglich machte. Mein Schal roch gut. Ein winziger Hauch Pfefferminzaroma – wie fast immer, da mein japanisches Heilpflanzenöl nach wie vor zu meinen wichtigsten Accessoires gehörte, dicht gefolgt von meinem Labello –, Parfum und Zuhause.
Doch unser Zuhause war auch kein Ort mehr, an dem ich mich allzu gerne aufhielt. Im Sommer hatte der Westerwald sich mir (und Colin) in seiner ganzen wilden Schönheit präsentiert – bevor Tessa gekommen war und alles zunichtegemacht hatte. Doch jetzt war wahrscheinlich selbst eine nordsibirische Tundraenklave ein lieblicherer Ort als dieser hier. Unser Garten bot ein Bild absoluter Trostlosigkeit. Der Rasen lag braun und versumpft unter einer harschigen Schicht Altschnee und die Erde in den Beeten hatte sich in gefrorenen Schlamm verwandelt. Der Februar war schon in Köln der tristeste Monat überhaupt gewesen. Doch der Winter im Westerwald überbot alles, was ich bislang an miesen Wintern erlebt hatte. Die meiste Zeit lag das Dorf so still und verschneit vor uns, dass es mir vorkam, als seien wir die einzigen lebenden Wesen weit und breit, und ich war fast erleichtert, wenn ich einen qualmenden Schornstein oder Licht in einem Fenster entdeckte.
Wenige Tage nachdem Colin geflohen und Tessa verschwunden war – ich ging davon aus, dass sie verschwunden war, alles andere mochte ich mir nicht ausmalen –, brach im Nachbarort Hepatitis A aus. Keiner wusste, wer den Erreger eingeschleppt hatte. Man tippte auf Touristen. Touristen? Niemals. Ich hatte sofort Tessa in Verdacht. Colin hatte mir die Windpocken geschickt. Hepatitis war für Tessa wahrscheinlich ein Kinderspiel.
Doch die Epidemie ebbte ab, bevor Panik ausbrechen konnte. Das übernahm die Schweinegrippe. Ende Oktober erwischte es mich und die Virusinfektion machte binnen weniger Tage den Weg frei für allerlei bakterielle Folgeerscheinungen. Vier Wochen lang lag ich mit hohem Fieber, Bronchitis, vereitertem Hals und Mittelohrentzündung im Bett und hasste mich selbst. Ich hasste mich dafür, krank zu sein, nichts mehr essen zu können, ich hasste meine Augen, die so tief und tot in ihren Höhlen lagen, ich hasste meinen mageren Körper. Das erste Antibiotikum versagte komplett. Das zweite schlug nur zögerlich an. Auf ein drittes verzichtete Papa. Er hatte Angst, dass ich Resistenzen bilden würde.
Fast täglich hatte Papa mir mit dem Krankenhaus gedroht und ich hatte beharrlich gebettelt und argumentiert, bis er mich schließlich zu Hause an den Tropf hängte. Mein rechter Arm sah immer noch aus wie der eines Junkies.
Kurz vor Weihnachten kannten wir im Dorf niemanden mehr, der gesund war. Unsere Nachbarin starb an einer Lungenentzündung und die alte Frau zwei Straßen weiter erlag ihrem Krebsleiden. Die Zeitung wimmelte nur so von Todesanzeigen. Allein Papa blieb gesund wie eh und je.
Dann fiel Schnee – beinahe täglich, bis Tauwetter ins Land zog und sich die Straßen in widerlich braungraue Matschpisten verwandelten, die Nacht für Nacht gefroren und tagsüber wieder aufweichten, um erneut von Schnee bedeckt zu werden. Mir blieb kaum etwas anderes übrig, als mich in meine Schulbücher zu vertiefen und all meine Energie in das Abitur zu stecken. Denn ansonsten gab es nicht mehr viel in meinem Leben. Ich traf mich ab und zu mit Maike und Benni zu abendlichen Unternehmungen, aber es kam immer irgendwann der Punkt, an dem ich mich mitten im fröhlichen Trubel an Colin erinnerte, so deutlich und lebhaft, dass ich all die Bilder mit roher Gewalt löschen musste, um nicht zu Boden zu sinken und meinen Tränen freien Lauf zu lassen.
Der Frühling war noch lange nicht in Sicht. Doch auch er würde nichts an der Sinnlosigkeit meines Daseins ändern. Mitte März standen meine mündlichen Prüfungen an – und dann? Was sollte ich tun? Ich hatte keine Ziele. Ich wusste nicht, was ich studieren sollte. Mir fehlte jeglicher Ehrgeiz, irgendetwas in meinem Leben zu erreichen, obwohl mir mein Abidurchschnitt wahrscheinlich keinerlei Grenzen setzen würde. Ich hatte mir nicht einmal die Informationsbroschüren der Universitäten zukommen lassen. Mama duldete meine gewollte Perspektivlosigkeit stillschweigend. Uns beiden war klar, dass ich zum Sommersemester kein Studium beginnen würde, obgleich im Grunde nichts dagegensprach.
Sobald Mama und ich von der Polizeiwache nach Kaulenfeld zurückgekehrt und ausgestiegen waren, warf ich meinen Mantel über den Garderobenhaken und nahm mit schweren Schritten die Treppe nach oben in mein Dachzimmer, um meine Tiere zu füttern. Tiere war eigentlich eine zu nette Umschreibung für diese Absurditäten der Natur. Nachdem Tillmann mir die Spinne, die ihn und mich in den Kampf begleitet hatte, einfach wieder vor die Tür gestellt hatte – auch etwas, das ich ihm übel nahm –, hatte ich ihr widerstrebend Asyl gewährt. Immerhin konnte sie mir möglicherweise Aufschluss über Tessas Verbleib geben, wie sie es schon im Sommer getan hatte. Doch sie verhielt sich so normal und unspektakulär, dass ich meine Angst vor ihr verlor. Ich taufte sie Berta und war dankbar, ihr nur noch ein Heimchen pro Woche zum Verzehr reichen zu müssen, denn mein Bad sollte keine Mördergrube werden. Ich vollendete mein Referat, erntete eine Eins und motivierte Herrn Schütz damit leider Gottes dazu, mir in regelmäßigen Abständen weitere unschöne Kreaturen zu überlassen.
Seit einigen Wochen war ich also nicht nur stolze Besitzerin der Spinne Berta, sondern erfreute mich überdies der Gesellschaft eines Albinomolchs, der Tag und Nacht in Dunkelheit unter einem schlammigen Stein vor sich hin vegetierte (ich nannte ihn schlicht Heinz), einer graugrünen Stabheuschrecke (Henriette) und zweier Grundeln, Hanni und Nanni. Kreativität war nie meine Stärke gewesen, auch nicht beim Namenverteilen.
»Ellie, ich weiß nicht, wie du neben diesen Monstern leben und schlafen kannst«, sagte Mama, die mir nachgekommen war und angeekelt beobachtete, wie ich Henriettes Vitrine öffnete und ihr eine zappelnde Grille reichte. Nun war mein Badezimmer doch eine Mördergrube geworden. Die Fensterbank diente ausschließlich der Aufbewahrung artgerechten Lebendfutters, und wenn ich duschte, begannen die Heimchen fröhlich zu zirpen, nicht ahnend, was sie in den kommenden Tagen erwartete. Nämlich ein schneller, konzentriert vollendeter Tod. Henriette und Berta arbeiteten bewundernswert effektiv.
Ich schüttete etwas Futter in die Aquarien von Heinz, Hanni und Nanni und wandte mich Mama zu. Sie war noch immer wütend wegen des Fettkloßes und wirkte dadurch umso entschlossener.
»Ich glaube, der Zeitpunkt ist da.«
»Welcher Zeitpunkt?«, fragte ich verständnislos. Mit einem lautlosen Schnappen verschlang Heinz sein Leckerli. Gott, war der hässlich.
»Komm mit. Ich zeige es dir.«
Mama ging voraus und lotste mich in Papas Büro. Ich musste schlucken, als ich über die Türschwelle trat. Meine Kehle wurde eng. Verdammt, Papa, warum bist du nicht hier, dachte ich verzweifelt und klammerte mich am Regal fest. Ich hatte sein Arbeitszimmer seit seinem Verschwinden nicht mehr betreten.
Sein Schreibtisch war gähnend leer – bis auf ein Kuvert, das exakt in der Mitte der Arbeitsfläche lag.
»Das hat er jedes Mal dort liegen lassen, wenn er zu einer seiner Konferenzen aufbrach«, wisperte Mama. »Und ich bin mir sicher, dass es für uns ist. Dass wir es öffnen sollen.«
»Es ist bestimmt für dich«, sagte ich hastig und wollte mich zurückziehen, doch Mama hielt mich am Handgelenk fest.
»Nein, Ellie, bleib hier. Es ist für uns.«
Ich löste mich aus ihrem Griff, lief aber nicht weg. Eine Weile standen wir stumm da und beäugten das Kuvert.
»Wer macht es auf?«, fragte Mama schließlich bang.
Seufzend trat ich hinter den Schreibtisch, nahm es an mich und wollte Papas silbernen Brieföffner durch den Schlitz ziehen. Doch das konnte ich mir sparen, denn der Umschlag war offen. Der Brief rutschte ein Stück heraus, als ich das Kuvert wendete, und berührte kitzelnd meine Fingerkuppen. Ich ließ den Umschlag auf den Schreibtisch fallen, als hätte er mir die Haut aufgeschlitzt. Mama stöhnte auf.
»Soll ich …?«
»Nein!«, rief ich schnell und nahm ihn wieder an mich, um den Briefbogen aus seinem Versteck zu befreien und zu entfalten. Das leise Ticken der altmodischen Tischuhr hallte in meinen Ohren, bis ich mich endlich überwinden konnte, nach unten zu sehen. Ja, das war Papas Schrift.
»Lies vor«, bat Mama mich und trat einen Schritt auf mich zu. Abwehrend wich ich ans Fenster zurück. Ich wollte diesen Brief nicht aus meinen Händen geben, bevor ich ihn gelesen hatte, und trotzdem fürchtete ich mich vor dem, was er mir sagen würde. Ich kniff ein paarmal meine Lider zusammen, bis die Buchstaben klarer wurden.
»Nun ist es so weit«, begann ich mit zitternder Stimme. »Ich bin nicht zurückgekehrt und Ihr habt das Kuvert geöffnet. Gut so. Ich habe zwei Aufträge – einen für jede von Euch.«
Mama schnaubte leise. Ich wusste nicht, ob aus Protest oder Kummer. Ich blinzelte meine Tränen weg, um weiterlesen zu können.
»Da ich genau weiß, dass Ihr keine Befehle akzeptiert, weil eine sturer ist als die andere, habe ich meine Befehle Aufträge genannt. Und ich wäre sehr glücklich, wenn Ihr sie befolgtet.
Ellie: Hol Paul zurück. In seinen Mauern findest Du den Schlüssel für den Safe. Mia: Halte die Stellung. Behalte das Haus. Zieh nicht fort.
Ich liebe Euch. Und ich bin bei Euch. Vergesst das niemals.«
Mama hatte sich auf das grüne Ledersofa sinken lassen, während ich Papas Zeilen vorgelesen hatte, und auch ich konnte kaum mehr stehen.
»Was bildet dieser Verrückte sich eigentlich ein?«, knurrte Mama nach einer Pause, in der sie mehrmals angestrengt geschluckt und geschnieft hatte. »Hierbleiben. Stellung halten. Befinden wir uns im Krieg, oder was?«
»Ich kann das nicht«, sagte ich tonlos und wie zu mir selbst. »Ich kann jetzt nicht weg.« Gleichzeitig wusste ich, dass ich mir im Grunde meines Herzens nichts sehnlicher wünschte als einen Auftrag, auch wenn er sich so unmöglich und unerfüllbar anhörte wie dieser.
Wieder schwiegen wir. Dann holte Mama tief Luft, richtete sich auf und wandte sich mir zu.
»Doch. Wir sollten gehen. Wenn mein Mann es vorzieht, in die Welt der Mahre zu verschwinden, will ich wenigstens meinen Sohn bei mir haben. Leo hat recht. Wir müssen Paul zurückholen. Außerdem finden wir bei ihm den Schlüssel für den Safe. Und ich möchte verdammt noch mal wissen, was in diesem Safe ist.«
»Mama … Er meint nicht uns. Er meint mich. Du sollst hierbleiben, schreibt er«, protestierte ich schwach. Mit einem Mal wurde mir bewusst, was Mama eben überhaupt gesagt hatte. Die Welt der Mahre. Nun hatte sie es ausgesprochen. Die Mahre. Es gab sie. Und wenn es sie gab, gab es womöglich auch Colin …
»So, schreibt er das, ja?« Mama stemmte wütend die Arme in die Seite. »Ist mir schnurzegal, was der Herr schreibt und befiehlt. Ich lasse dich nicht alleine nach Hamburg fahren, niemals! Ausgeschlossen!«
»Aber Papa wird sich etwas dabei gedacht haben und ich glaube kaum, dass Paul es toll findet, wenn wir zu zweit dort auftauchen und auf ihn einreden.« Ich spürte, wie mein zögerlicher Protest sich vervielfachte, stark wurde – unbeugsam. So schlecht war Papas Idee gar nicht. Ja, ich brauchte einen Auftrag, um nicht verrückt zu werden, um endlich etwas tun zu können. Und immerhin hatte ich diesen schauderhaften Winter genutzt, um meinen Führerschein zu machen. Aber erst musste ich wissen, ob Papa tatsächlich verschollen war und nicht doch in einem Krankenhaus lag und auf ein Lebenszeichen von uns hoffte.
»Wir warten, bis wir Nachricht von der Polizei bekommen«, schlug ich Mama vor, die immer noch aussah, als wolle sie im nächsten Moment das komplette Büro kurz und klein schlagen und anschließend in Flammen setzen. »In Ordnung? Wenn die nichts rausfinden, fahre ich.«
»Ellie, ich habe meinen Sohn verloren und ich will nicht noch meine Tochter verlieren …«
»Du verlierst mich nicht. Und ich bringe Paul zurück. Falls ich fahre. Versprochen. Er wird mehr auf mich hören als auf dich, glaubst du nicht?«
Mama nahm die Hände von den Hüften und verschränkte sie vor der Brust. Wenn sie diese Haltung einnahm, war nicht gut Kirschen essen mit ihr, das wusste ich genau. Doch ich wusste ebenso gut, dass ich nicht mit ihr nach Hamburg fahren wollte. Ich wollte es allein tun. Auch weil ich Angst hatte, dass dieses Haus seine Wärme und Geborgenheit endgültig verlieren würde, wenn meine Mutter es verließ. Dass Tessa kam und es sich nahm, wie sie sich Colins Haus genommen hatte. Wir brauchten ein Zuhause.
Mama würde es fertigbringen und sich in Hamburg eine Wohnung mieten, falls Paul weiterhin auf stur stellte. Und sosehr ich den Westerwald am Anfang auch abgelehnt hatte – das hier war Colins und mein Revier. Sie durfte mich hier nicht wieder herausreißen. Nicht solange ich Hoffnung hatte, dass Colin und ich eines Tages in den Wald zurückkehren durften.
»Mama – da ist noch etwas …« Ich hielt ihn die ganze Zeit schon in der Hand. Einen dünnen, zusammengefalteten Briefbogen, der sich ebenfalls in dem Kuvert befunden hatte. Es stand nur ein Wort drauf. »Mia.« Und er war das beste Ablenkungsmanöver, das ich jetzt parat hatte. »Der ist für dich. Nicht für mich.«
Ich reichte ihn ihr, floh aus dem Büro und hastete die Stufen zum Dachgeschoss hinauf. Noch bevor ich die Tür schließen konnte, strömten die Tränen über meine Wangen.
»Ach, Papa«, schluchzte ich, während Mister X aufgeregt schnurrend um meine Beine strich. »Warum alleine für Mama? Hättest du mir nicht auch einen Brief schreiben können? Ein paar Zeilen nur für mich?«
Weinend verkroch ich mich unter die Bettdecke. Mister X rollte sich wärmend auf meinen Füßen zusammen.
Hatte Papa mir den Auftrag gegeben, weil er mich dafür büßen lassen wollte, dass ich mich ihm widersetzt und mit meiner Liebe zu Colin Tessa angelockt hatte? War das der erste Teil meiner Sühne?
Oder hatte ich ihn bekommen, weil er nur mir und niemandem sonst zutraute, Paul zu überzeugen?
Und was befand sich in dem Safe?
Wie immer hatte ich Angst, dass Colin mir im Schlaf begegnen würde. Doch ich weinte bereits. Was machte es schon für einen Unterschied, weinend einzuschlafen, weinend von ihm zu träumen oder weinend aufzuwachen?
Mein Schlaf gehörte meinen Tränen und meine Tränen gehörten ihm. Wo immer er auch war.
ÜBERLEBENSPAKETE
Eine Woche später stand Papas Wagen wieder bei uns im Hof. Ohne Papa. Der Volvo war auf dem Flughafen in Rom gefunden worden, mustergültig in der Tiefgarage abgestellt und mit bezahltem Parkticket für die ersten drei Tage. Für den Rest mussten wir nun aufkommen, ebenso wie für die Überführungskosten. Papas letzter Flug hatte ihn nach Neapel gebracht. Dort verloren sich die Spuren. Kein Krankenhaus hatte ihn aufgenommen, weder auf dem Festland noch auf Sizilien. Der Wagen selbst war unversehrt. Ein Unfall wurde ausgeschlossen.
Die Polizei tippte noch immer auf ein amouröses Doppelleben, doch Mama und ich wussten, dass es in diesem Doppelleben wenig amourös zuging. Nun standen wir im Wintergarten und spitzelten argwöhnisch durch den dichten Efeu vor den Fenstern auf den eckigen dunkelblauen Volvo hinunter, als könne er im nächsten Moment ätzende Säure verspritzen.
Die Mitteilung der Polizei – »Verbleib unbekannt« – war nicht die einzige Nachricht, die uns in dieser Woche erreicht hatte. Ich hatte eine freundlich formulierte Zusage für eine Putzstelle in einer Hamburger Klinik erhalten, was ich angesichts meines Abidurchschnitts, der aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwo zwischen 1,0 und 1,3 liegen würde, nicht besonders komisch fand. »Wir freuen uns, Sie am 19.Februar um 20Uhr zu Ihrer ersten Schicht begrüßen zu dürfen.« Es musste sich um eine Verwechslung handeln und ich war schon versucht gewesen, den Brief zu zerreißen und in den Papierkorb zu werfen, doch ich tat es nicht. Auch mein Versuch anzurufen endete damit, dass ich auflegte, bevor jemand abnehmen und ich das Missverständnis aufklären konnte. Denn die Klinik befand sich in Hamburg und in Hamburg lebte Paul. Ich konnte also persönlich in der Klinik erscheinen, dem zuständigen Menschen Bescheid sagen, dass ich nicht diejenige war, die hier den Boden schrubben wollte, und damit möglicherweise irgendeiner armen Seele einen Job verschaffen, den sie aufgrund dieser Verwechslung nicht bekommen konnte.
Somit hatte ich doppelt Grund, nach Hamburg zu fahren. Das war es, was ich seit Tagen tat: Gründe suchen, um nach Hamburg zu fahren. Dieser hier war lächerlich, denn ich konnte auch einfach eine E-Mail an die Klinik schreiben, anstatt anzurufen. Doch je mehr Gründe ich fand, persönlich in Hamburg zu erscheinen, desto besser und sicherer fühlte ich mich bei meinem Vorhaben. Dieser Brief erschien mir wie ein Wink des Schicksals – ja, als hätte er eine besondere Bedeutung. Sie erschloss sich zwar aus dem Schreiben ganz und gar nicht, aber jedes Mal, wenn ich es durchlas, lösten die Zeilen ein leises Summen in meinem Bauch aus.
Außerdem brauchte ich diese bunte Palette an Gründen nicht nur für mich. Ich brauchte sie auch für Mama. Denn sie wehrte sich immer noch gegen die Idee, mich alleine gen Norden reisen zu lassen. Der Winter ließ nicht locker. Wieder hatte es Schnee gegeben und die Straßen waren permanent vereist. Umso stärker brannte in mir der Wunsch, diesem stillen, bedrückenden Haus den Rücken zu kehren und meinen Auftrag zu erfüllen. Nicht zuletzt trieb mich meine Neugier zu Paul – und die Sehnsucht nach meinem großen Bruder, den ich all die Jahre so schmerzlich vermisst hatte.
Jetzt war das passende Auto da. Sich in Mamas Ente zu setzen glich einem unausgesprochenen Selbstmordkommando. Ich fürchtete mich bereits darin, wenn Mama am Steuer saß. Ich selbst am Steuer dieses Knattertorpedos? Unvorstellbar. Papas Auto erschien mir gemütlicher und weitaus verkehrssicherer. Trotzdem wagte ich mich nicht in seine Nähe.
»Ich werde ihn durchsuchen«, beschloss Mama nach einigen Schweigeminuten. »Vielleicht finde ich etwas.«
»Hm«, murmelte ich zustimmend und war froh, dass sie die Angelegenheit übernehmen wollte. Dann war wenigstens ein vertrauter Mensch nach Papa auf den abgewetzten Sitzen herumgekrabbelt. Im Moment war es für mich immer noch Papas Auto und möglicherweise roch es nach ihm … Vielleicht steckte eine seiner heiß geliebten Pink-Floyd-CDs im Player … Vielleicht lagen seine Pfefferminzdrops, die er so gerne lutschte, im Handschuhfach. Es war schon bedrückend genug, sich das Auto von außen anzusehen.
Mama band sich ihre wilden Locken im Nacken zusammen, als wolle sie Ordnung auf und in ihrem Kopf schaffen, und reckte das Kinn.
»Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, Ellie. Entweder ich hoffe darauf, dass er lebt und zurückkommt, und werde meine gesamte Zeit mit Warten verbringen; Warten auf ein Ereignis, das vielleicht nie eintreffen wird. Oder ich gehe davon aus, dass … dass ihm etwas zugestoßen ist, habe die Chance zu trauern und freue mich umso mehr, wenn er eines Tages wieder in der Tür steht.«
»Und wofür entscheidest du dich?« Ich gab mir keine Mühe, den vorwurfsvollen Ton in meiner Stimme zu unterdrücken. Denn ich ahnte bereits, wie Mamas Antwort lauten würde.
»Ich habe die vergangenen achtzehn Jahre immer wieder mit Warten und Wachen verbracht. Und ich habe immer wieder mit diesem Moment gerechnet. Ich möchte trauern, Ellie. Es ist ein Wunder, dass bislang nichts geschehen ist.«
»Du glaubst also, er ist tot«, sagte ich hart.
»Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er in einer Lage ist, in der wir ihn nicht mehr erreichen können. Und dass es ihn früher oder später sein Leben kosten wird.«
»Das ist doch das Gleiche!« Ich drehte mich heftig zu Mama um, aber sie hatte ihren Blick nach wie vor auf den Volvo geheftet.
»Leo ist ein Halbblut, Ellie. Du und ich, wir sind Menschen. Es sind verschiedene Kategorien. Uns sind Grenzen gesetzt. Und du darfst nicht vergessen, dass diese – diese Mahre unendlich viel Zeit zur Verfügung haben. Alle Zeit der Welt. Wenn sie ihn haben, sind sie nicht gezwungen, schnell zu handeln …«
Mamas Offenheit machte mich rasend. Ich verschlang meine Hände ineinander, um sie nicht gegen das Glas des Wintergartens zu schlagen.
»Schön. Mag ja sein, dass du dich jetzt hinsetzen und trauern kannst, um dann ein neues Leben zu beginnen. Aber ich sehe das nicht ein. Ich werde herausfinden, was mit Papa passiert ist …«
»Elisabeth!«, unterbrach Mama mich und riss ihren Blick von dem Volvo los. Entsetzt schaute sie mich an. »Das wirst du nicht! Bist du des Teufels? Soll ich dich auch noch verlieren? Du hast keine Chance! Nicht die geringste!«
Ich wollte ihr widersprechen, ihr sagen, dass ich es immerhin geschafft hatte, Colin aus dem Kampf mit Tessa herauszulocken, ohne von ihr gewittert zu werden. Doch Mama wusste von alldem nichts. Ich hatte es nicht einmal Papa ausführlich erzählt. Er wusste nur, dass ich versucht hatte, mich zu tarnen, nicht aber, was genau ich im Wald erlebt und beobachtet hatte. Außerdem hatte Mama recht. Allein hatte ich tatsächlich keine Chance. Und ich war allein. Der Gedanke, ohne meinen geduldig-väterlichen Fahrlehrer – einem molligen Schnauzbart namens Bömmel, der selbst dann noch die Ruhe bewahrt hatte, als ich mit Tempo achtzig über eine Autobahnraststätte gebraust war – nach Hamburg zu fahren, ließ mein Adrenalin ohnehin ungebremst in die Höhe schießen. Mich auf eigene Faust nach Italien aufzumachen, um Papa zu suchen, war vollkommener Irrsinn.
»Okay, nicht jetzt«, lenkte ich seufzend ein. »Irgendwann. Irgendwann werde ich Papa finden. Und ich werde nicht trauern.« Denn mehr Trauer geht nicht, dachte ich, was ich nicht aussprechen wollte. Ich trauerte bereits um Colin – und das, obwohl ich wusste, dass er nur mit äußerster Mühe sterben konnte. Er existierte. Doch er gehörte nicht zu meinem Leben. »Vielleicht gibt uns ja der Safeinhalt Aufschluss, wohin es ihn verschlagen haben könnte«, setzte ich trotzig hinzu.
Mama verdrehte ihre Augen aufstöhnend gen Himmel und ihre Locken tanzten, als sie den Kopf schüttelte.
»Seit wann bist du eigentlich so abenteuerlustig?«
»Ich bin nicht abenteuerlustig. Ich will wissen, was passiert ist. Aber ich beuge mich eurem Diktat und hole zuerst Paul zurück. Einverstanden?«
Nun musste sie Ja sagen. Es ging gar nicht anders. Sie hatte die Wahl – Hamburg oder Italien.
Mama presste für eine Sekunde die Lippen zusammen. »Wann wirst du fahren?«
»Morgen früh«, entschied ich spontan. Ich musste die Gunst der Stunde nutzen. »Ich werde gleich meine Sachen packen. Kümmerst du dich um das Auto?«
Mamas Schluchzen und Wüten und Schimpfen drang bis zu mir hoch, als ich ebenfalls fluchend und völlig konzeptlos Klamotten aus meinem Schrank zerrte und in meinen Trolley knüllte. Währenddessen arbeitete sich Mama zeternd durch Papas Wagen und zog dabei die Blicke der Nachbarn auf sich. Ihr war das so gleichgültig wie mir. Es machten sowieso schon die ersten Gerüchte über Papas Verschwinden die Runde und von der Klinik war ein verschnupfter Brief gekommen, dem sogleich die fristlose Kündigung beigelegt worden war. Papa hatte es sich hier ordentlich vergeigt.
Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wie lange ich brauchen würde, um Paul dazu zu überreden heimzukommen. Mir war klar, dass Mama nicht erwartete, ihn hier für alle Zeit einquartieren zu können. Er hatte sein Medizinstudium und seine Wohnung in Hamburg. Es ging vielmehr darum, ihn überhaupt wieder mit seiner Restfamilie zusammenzubringen, wenn auch nur für ein oder zwei Stunden – etwas, was in den vergangenen sieben Jahren kein einziges Mal geglückt war, weil Paul mit eselsähnlicher Sturheit so tat, als gäbe es uns nicht mehr.
Also packte ich ein, was in den Koffer passte, warf ein paar CDs obendrauf und genoss die zornige Anstrengung, die ich benötigte, um die Verschlussschnallen zuschnappen zu lassen. Keuchend schleppte ich den Trolley zur Tür und sah mich um.
»Was mach ich denn mit euch?«, fragte ich ratlos und betrachtete meine lieben Tierchen. Henriette hatte die Fangarme wie zum Gebet gefaltet und sah dabei gottloser aus als Satan persönlich. Berta kauerte reglos unter einer Wurzel, satt und träge von dem Heimchen, das sie heute Morgen verspeist hatte. Heinz war wie immer vor dem Tageslicht geflohen und versteckte sich vor mir und der Welt unter seinem Stein. Nur Hanni und Nanni suhlten sich entspannt im Sand.
Papas Wagen war theoretisch groß genug, um sie samt ihren Behausungen unterzubringen, und ich stellte mit Erstaunen fest, dass es mir schwerfallen würde, mich von ihnen zu trennen. Außerdem traute ich Mama schlichtweg nicht zu, dass sie es fertigbrachte, ihnen ihr Lebendfutter zu geben. Lieber setzte sie die Tiere im Garten aus. Und das würde keines von ihnen bei dieser Kälte überleben.
Gut, ich würde sie also mitnehmen. Paul hatte schließlich ein Faible für hässliche Tiere.
»Und du, Hase?« Ich ließ mich neben Mister X auf das Sofa plumpsen und fuhr ihm mit beiden Händen über das knisternde Fell. Für eine Sekunde sah ich nicht meine, sondern Colins Hände, die ihn stets so nachlässig und zärtlich zugleich gekrault hatten, wie nur er es vermochte … Mister X hatte sich seitdem unzählige Male in fast neurotischer Ausführlichkeit geputzt und doch: Colin hatte ihn berührt. Ich ließ meine Handflächen auf seinem Bauch ruhen. Das kehlige Schnurren des Katers vibrierte sanft unter ihnen.
Es tröstete. Und Mama hatte beschlossen zu trauern. Ich wollte sie immer noch für alles Mögliche anklagen, zuallererst für ihre vernünftige Hoffnungslosigkeit, obwohl sie mir gleichzeitig so leidtat, dass es mir die Kehle zuschnürte. Doch sie würde Trost nötig haben. Ganz zu schweigen davon, dass ich nicht wusste, ob ich es überleben würde, wenn Mister X seinen tierischen Bedürfnissen nachging und seine Stinkwurst der Einfachheit halber während der Fahrt in den Kofferraum setzte. Bis nach Hamburg waren es ein paar Stunden.
»Du passt auf meine blöde Mutter auf, okay?«
Mister X fuhr seine Krallen aus und begann, ekstatisch tretelnd meinen Sofabezug zu zerfetzen.
Als wir zu Abend aßen, hatte Mama sich wieder beruhigt. Sie hatte nichts Verdächtiges gefunden in Papas Auto, es jedoch geputzt, den Erste-Hilfe-Kasten überprüft, mir die Bedienungsanleitung ins Handschuhfach gelegt und einen Kasten Wasser plus eine Kuscheldecke und zwei Packungen Kekse in den Kofferraum gestellt. Sie ging also davon aus, dass ich spätestens auf halber Strecke im Straßengraben landen und nimmermehr herausfinden würde. Zugegeben, meine Fahrkünste waren nicht berauschend. Aber ich wollte hier weg und ich wollte dabei unabhängig bleiben. Mamas Versuche, mich zum Zugfahren zu bewegen, waren vergebens gewesen.
Nach dem Essen zog ich mir meinen Mantel über, wickelte den Schal fest um meinen Hals und lief durch das dunkle, stille Dorf. Wie immer bei diesen abendlichen Runden begegnete ich keinem anderen Menschen. Ab und zu kreuzte eine Katze meinen Weg und die Schafe auf der Weide neben der alten Eiche blökten vertraulich, als sie mich witterten. Bisher hatte ich die Kuppe des Feldwegs gemieden. Doch heute ging ich ihr mit pochendem Herzen entgegen.
Zwei der knorrigen Apfelbäume hatten dem letzten Sturm nicht standhalten können. Wie verdrehte Gerippe drückten sie sich in den feuchten Boden. Sie verströmten einen modrigen Geruch, nicht jene verheißungsvolle und zugleich verderbliche Süße wie während des Abschieds von Colin und mir, von dem ich nicht wusste, ob er wahr oder nur ein Traum gewesen war. Hatte Colin ihn mich im Schlaf erleben lassen oder war ich wirklich hier gewesen? In meinem dünnen Nachthemd und barfuß, ohne zu frieren, ohne meine Verletzung zu spüren?
Und spielte es überhaupt eine Rolle, ob ich es geträumt hatte oder nicht?
Nein, für meine Gefühle spielte es keine Rolle. Für meinen Auftrag jedoch schon. Ich konnte Paul gegenüber nur überzeugend sein, wenn ich selbst überzeugt war. An Papas Verstand mochte er ja zweifeln. An meinem jedoch nicht.
Mit hallenden Schritten rannte ich zum Haus hinunter, wild entschlossen, das zu tun, wovor ich mich den gesamten Winter über gefürchtet hatte.
Ich würde die Kiste mit den Briefen öffnen.
TEMPERATURSCHWANKUNGEN
Im letzten Moment überlegte ich es mir anders, doch es war schon zu spät. Meine Finger hatten die Kiste ein Stückchen über den Rand bewegt, den Rest erledigte die Schwerkraft. Obwohl ich losließ und gleichzeitig zurückzuckte, als hätte ich mich verbrannt, krachten erst ich und dann die Kiste auf den Boden – und das leider so unglücklich, dass die scharfe Metallkante meine Schläfe traf.
Ich blieb ein paar Minuten lang scheintot liegen und wartete, bis sich der stechende Schmerz, der regelmäßig wie ein Metronom durch meinen Kopf pochte, in ein erträgliches Pulsieren verwandelt hatte. Mit fest geschlossenen Lidern streckte ich meine Hand aus und ließ sie auf den Teppich sinken. Es raschelte. Ja, das war Papier unter meinen Fingern. Eines der zwei Zettelchen, die in Mister X’ Halsband gesteckt hatten. Ich kannte beide immer noch auswendig, ebenso wie die Briefe.
»Du weißt ja – er liebt Fisch. Und ich liebe Dich.«
Einbildung? Leeres, unbeschriebenes Papier? Oder Buchstaben?
»Buchstaben«, flüsterte ich, nachdem ich endlich den Mut gefunden hatte, meine Augen zu öffnen, mich aufzurichten und neben mich zu blicken. »Buchstaben …«
Da waren sie, Colins aristokratische Lettern. Die Tinte war ein wenig verblasst und nun beinahe braun, aber intensiv genug, um seine Zeilen geradezu aufleuchten zu lassen. Zwei Briefe, zwei Zettel. Beweise. Ich hatte Beweise.
Hastig faltete ich sie wieder zusammen, legte sie zurück in die Metallkiste, verschloss sie und verfrachtete sie an ihren Stammplatz auf dem Schrank. Den plötzlichen Gedanken, dass ich die Zeilen in meinem sommerlichen Irrsinn selbst verfasst hatte – möglich war alles im Hause Sturm –, verdrängte ich beharrlich. Ich hatte weder Büttenpapier noch Sepiatinte zur Hand. Nein, das hier waren Beweise, Schluss, fertig, aus. Schlimm genug, dass ich die halbe Nacht vor dem Schrank gesessen und gegen meinen inneren Schweinehund angekämpft hatte.
Jetzt hatte ich gewonnen und konnte aufbrechen.
So gut es mit einem tonnenschweren Koffer in der Hand möglich war, schlich ich die Treppe hinunter und nach draußen in den Hof. Ich wollte Mama nicht aus dem Schlaf reißen. Fürsorglich stellte ich die Standheizung an, damit meine hässlichen Kreaturen nicht an einem Kälteschock sterben würden, wenn ich sie dem Kofferraum des Wagens anvertraute. Dann schleppte ich die Aquarien und Terrarien nach unten.
Bei meinem zweiten Schleichgang die Treppe hinauf und hinunter wurde Mama wach. Stumm und mit verschränkten Armen – fror sie oder missbilligte sie, was ich da tat? – sah sie mir dabei zu, wie ich ein Ungetüm nach dem anderen durchs Morgengrauen trug und die durchsichtigen Transportboxen, die ich gestern noch besorgt hatte, beinahe zärtlich zwischen Wasserkasten, Terrarien und Erste-Hilfe-Paket klemmte. Im Kofferraum war es inzwischen warm genug. Berta sprang dennoch gereizt gegen die Wand ihrer Box, als ich sie als letzte sensible Fracht ins Auto brachte, und für eine Schrecksekunde schoss mir Tessas modriger Geruch in die Nase. Ich hielt inne und atmete tief aus und ein. Mama beobachtete mich lauernd.
»Kein Frühstück?«, fragte sie wortkarg. Ich drehte mich zu ihr um und sah, dass sie geweint hatte. Ich schüttelte nur den Kopf. Mein Mund war trocken und die Zunge schien mir am Gaumen festzukleben. Ich wollte nichts essen und reden konnte ich auch nicht. Wir nahmen uns hölzern in die Arme, ohne uns dabei besonders nahezukommen.
»Pass auf dich auf, Ellie«, sagte Mama, doch sie schien nicht daran zu glauben, dass ich mich an ihren Rat halten würde, nachdem ich ihn im Sommer mit aller Macht in den Wind geschlagen hatte.
Bevor ich die Handbremse löste und den Gang einlegte, schob ich die neue Moby-CD in den Player. Sie hatte mir den Winter gerettet und ich hoffte inständig, dass sie mir auch die Autofahrt nach Hamburg erträglich machen würde. Ich besaß kein Navigationssystem, nur eine Karte, die ich beim Fahren jedoch schlecht lesen konnte. Mama hatte mir die Adresse von Pauls Wohnung notiert, aber so weit dachte ich gar nicht. Wenn ich erst in Hamburg war, lautete meine Devise, erledigte sich der Rest von ganz alleine.
Dass sich gar nichts von allein erledigte, wurde mir bereits auf der Landstraße klar. Der Asphalt war eisglatt und rutschig, die Reifen machten ein merkwürdiges vibrierendes Geräusch unter meinen Oberschenkeln und der dahinkriechende Traktor vor mir trieb mich in den Wahnsinn. Entnervt startete ich das erste Überholmanöver meines Lebens. Die Gegenfahrbahn war schließlich frei.
Ich trat aufs Gas und alles Weitere lag nicht mehr in meiner Hand. Mit einem jähen Ruck schob sich der Hintern des Volvos zur Seite. Die Reifen quietschten schrill, als ich panisch meinen Fuß auf die Bremse hieb. Beinahe elegant drehte der Kombi sich einmal um sich selbst, während der Trecker haarscharf an meinem Heck vorüberzog, und rumpelte dann mit der Schnauze voran in den Feldweg neben der Straße. Dort versagte der Motor. Ich hatte ihn mit meiner Aktion abgewürgt. Es gab einen kurzen, unerwarteten Schlag, der meine Stirn gegen das Lenkrad knallen ließ.
»Und wieder ein paar Gehirnzellen weniger«, diagnostizierte ich, bevor mein Körper begriff, was gerade passiert war. Mein Herz sprang mit einem Satz in meinen Hals und versuchte, ihn hektisch pochend zu sprengen. »Oh Gott«, wimmerte ich.
Schlagartig war mir so heiß, dass ich mit bebenden Fingern den Gurt löste und mich aus meiner Jacke schälte. Dann hatte mein Gehirn das Absterben seiner Zellen mit einem Mal überwunden und machte mir augenblicklich klar, wo ich mich befand. Das war nicht irgendein Feldweg. Das war der Feldweg. Jener Feldweg, der mich zu Colins Haus im Wald bringen würde.
Ich hatte das Haus nie wieder aufgesucht. Als Tillmann und ich auf Louis davongestürmt waren, hatten wir Tessa in ihrer rasenden Gier auf dem kiesbestreuten Hof zurückgelassen – ich gab mich keinen Illusionen darüber hin, dass sie das Haus noch einmal betreten und alles an sich gerissen hatte, was sie zwischen ihre abartig kleinen, behaarten Finger packen konnte. Während er mit ihr gerungen hatte, waren Tillmann Gegenstände von Colin in die Hände gefallen, die sie zuvor gestohlen und in ihre Gewänder geschoben hatte, und auch Colins Wagen war von den Kratzspuren ihrer Nägel übersät gewesen. Ich wollte das Haus so in Erinnerung behalten, wie ich es kennen- und lieben gelernt hatte. Diese berückend stilvolle Mischung aus Alt und Neu, Colins breites Bett mit dem samtigen roten Überwurf, sein Badezimmer, das mich an die Kajüte eines Luxussegelschiffes erinnerte, sein zerschlissener Kilt an der Wand – wer wusste schon, wie es jetzt dort aussah?
Ich hatte kaum Zweifel, dass Tessa fort war. Doch ich hatte ihre Spuren nicht sehen, nicht wahrhaben wollen. Nicht solange ich hier leben musste.
Hinter mir brauste ein Schulbus über die Straße. Der Volvo erzitterte. Seine Hinterreifen drehten durch, als ich den Motor anwarf und rückwärts aus dem Feldweg herausfahren wollte. Er weigerte sich und zum Wenden hatte ich nicht genügend Platz. Aber in Colins Hof war Platz – gerade so viel, dass ich mich ohne weitere gefährliche Manöver wieder auf den richtigen Weg begeben konnte. Außerdem verbreiterte sich die Straße kurz vor dem Forsthaus.
Das waren die sachlichen Argumente. Schön und gut. Doch sie beeindruckten mich wenig. Viel mächtiger war der unterschwellig nagende Wunsch, noch ein einziges Mal unter dem Dach vor dem Haus zu sitzen und auf den Waldsaum zu blicken, wenn auch allein, wenn auch bei Minusgraden und im Schnee. Aber dort zu sitzen, nur ein paar stille Atemzüge lang, würde mir vielleicht die Kraft für all das geben, was ich vorhatte. Ich wollte ja nicht ins Haus hineingehen, sondern nur da draußen sitzen. Sonst nichts.
Andererseits: Öffnete ich damit nicht alte Wunden? Würde die Sehnsucht nicht viel schlimmer werden, als sie ohnehin schon war? Oder fand ich das Haus nicht nur leer, sondern gar völlig verändert vor, so wie in meinen aufreibend langen schlechten Träumen, in denen es zu einem finsteren, modrigen Loch verkommen war, besetzt von Kellerasseln und Schaben, mit verschimmelten Wänden und erdrückend niedrigen Decken?
Aber es war mein Refugium gewesen. Beinahe war es mir wie eine Burg vorgekommen, die mich schützte – die uns schützte. Bis Tessa gekommen war. Und verflucht, sie sollte nicht die Letzte gewesen sein, die dort gewesen war. Sie nicht.
Ungläubig sah ich mir dabei zu, wie ich den ersten Gang einlegte und in den Wald hineinfuhr. Der Wagen kroch dahin – je näher ich dem Haus kam und je dunkler das Dickicht um mich herum wurde, desto stärker drosselte ich das ohnehin geringe Tempo. Mein Atem ging nur noch stoßweise, wie in den fiebrigen Nächten meiner Bronchitis, wenn ich hustend und würgend geglaubt hatte, mein letztes Stündlein habe geschlagen. Etwas lastete auf meiner Brust …
Beim nächsten gepressten Atemzug trat ich erneut auf die Bremse, diesmal eine Spur liebevoller als vorhin. Der Volvo kam ohne Schleudergänge zum Stehen. Mit einem Klacken drehte ich den Schlüssel herum und der Motor erstarb. Die Stille tropfte wie flüssiges Blei in meine Ohren. Einen Moment glaubte ich, taub geworden zu sein. Doch leider hatte ich meine Sehkraft behalten. Ich blinzelte, kniff die Augen zu, öffnete sie wieder – das alte Spiel. Ich hatte immer noch nicht gelernt, dass es Dinge gab, die meinen Horizont aufs Brutalste erweiterten.
Das hier war eines davon. Klebrig und tödlich und vollkommen unlogisch. Spinnweben. Überall zwischen den Büschen und Bäumen – selbst die Steine auf dem Schotterweg waren von ihnen überzogen. Sie bedeckten die Baumstümpfe, das Laub und die Stämme der Tannen, zogen sich in einem verwirrenden, aber beängstigend ästhetischen Muster von Strauch zu Strauch, und zwar bis zu einer Höhe von einem Meter fünfundvierzig. Tessas Körpergröße.
Abseits des Weges gab es nicht eine einzige Möglichkeit, einen Schritt in den Wald hineinzugehen, ohne die Spinnweben zu berühren und ihre Bewohner zu reizen. Welche Bewohner?, fragte ich mich mit schwachem Spott. Es mussten Überbleibsel aus dem Herbst sein, beim ersten Frost eingefroren und konserviert, und weil bis hierher keine Menschenseele vordrang, waren sie geblieben. Eine Laune der Natur, nicht mehr. Doch ich wusste, dass das nicht stimmte. Das Wild, das hier nachts durch das Dickicht streifte, hätte sie zerreißen müssen. Oder gab es hier gar kein anderes Leben? Vielleicht sollte ich mir die Netze ansehen. Nur kurz. Ein flüchtiger Blick, um mich davon zu überzeugen, dass es so war, wie ich dachte. Kältestarre. Doch wenn ich ehrlich war, suchte ich nur einen Grund, um meinen sicheren Platz im Auto zu verlassen. Denn es waren nicht allein die Abertausend Spinnweben, die mich irritierten und meine Neugierde weckten, sondern auch die schmale Rauchsäule, die sich hinter der nächsten Biegung – also nur wenige Schritte von Colins Haus entfernt – in den blassen Himmel schob.
Ich versuchte, die gespenstische Stille und die flüchtige Überlegung, wie viele Bertas wohl in all den Netzen hausten – ob schockgefrostet oder nicht –, zu ignorieren, und öffnete die Tür. Argwöhnisch schnupperte ich. Nein, kein Moder, kein erstickender, bestialischer Moschus. Es roch nach heißen Steinen und nach – nach Salbei? Ich zog witternd die Luft ein. Ja, Salbei, eindeutig.
Nun, es war sicher nicht Tessa, die sich in einem morgendlichen Barbecue ihre Schweinelende im Kräutermantel briet. Mahre brauchten kein menschliches Essen. Trotzdem öffnete ich den Kofferraum und warf einen prüfenden Blick auf Berta. Sie machte einen beleidigten Eindruck, befand sich aber weder im Paarungsrausch, noch sprang sie gegen das Glas. Sie hockte einfach nur da und wartete.
Ich ließ die Verriegelung des Autos einrasten. Und wieder aufschnappen. Für eine eventuelle Flucht war das die bessere Voraussetzung. Ich setzte mich in Bewegung, der Rauchsäule entgegen, und musste aufpassen, dass meine glatten Sohlen auf den eisüberzogenen Schottersteinen nicht ins Rutschen gerieten. Ab und zu glitt mein Blick über die Spinnweben links und rechts von mir, doch ich war nicht kühn genug, um bewusst hineinzublicken oder sie gar zu berühren. Erst wollte ich sehen, was am Haus vor sich ging. Mit prügelndem Herzschlag steuerte ich die Qualmwolke an – und brauchte einige Sekunden, um zu verstehen, was ich da sah.
Es war kein Barbecue. Es war ein Zelt, zusammengesetzt aus mehreren Planen, die sich über ein Astgestell spannten. Dampf quoll aus den Ritzen und verlor sich zwischen den Zweigen der kahlen Bäume. Der Salbeigeruch war nun so stark, dass er mich in der Nase kitzelte. Vor dem Zelt brannte ein kleines Feuer, in dem dicke, runde Steine lagen und vor Hitze glühten.
»Was tust du da?«
Tillmann drehte sich nicht zu mir um. Regungslos saß er im Schneidersitz vor dem Zelteingang, den Blick auf die züngelnden Flammen gerichtet. Sein Gesicht schimmerte rötlich und doch fiel mir auf, dass seine Haare blasser geworden waren. Sie hatten nicht mehr jenes feurige Tizianrot, das Tillmann überall hatte herausstechen lassen. Auch seine Haut hatte sich verändert. Die Sommersprossen waren geblieben, aber sie hoben sich kaum noch vom milchigen Grundton seiner Wangen ab.
»Ich hab dich gefragt, was du da tust!«, zischte ich, obwohl mir sonnenklar war, was er – oberflächlich betrachtet – tat. Er hockte vor Colins Haus und zelebrierte eine indianische Sauna. Auch eine nette Art, sich den Winter zu vertreiben. Und so spirituell.
»Ich schwitze nicht mehr, Ellie.« Seine Stimme war tiefer geworden. Dabei war sie für sein Alter ohnehin tief gewesen. Ich erschauerte unwillkürlich und wusste nicht, was ich erwidern sollte. Warum sah er mich nicht an? Und was bedeutete das – er konnte nicht mehr schwitzen?
»Ich bin rothaarig«, fuhr Tillmann scheinbar ungerührt fort, doch ich sah, dass seine Kiefermuskeln sich verkrampften. Er lachte lautlos auf. »Korrektur. Ich war rothaarig. Doch ich bin immer noch hellhäutig. Ich hab früher weder Hitze noch Sonne gut vertragen. Ich müsste eingehen da drinnen. Es hat fast hundert Grad in dem Zelt. Aber es passiert – nichts. Nichts.«
»So. Und anstatt mit mir darüber zu reden, sitzt du hier in diesem Scheißwald und lässt dich braten? Wartest du etwa darauf, dass sie zurückkommt?«
Tillmann ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, aber seine Lippen wurden schmal. Hässlicher hatte die Begegnung mit Tessa ihn nicht werden lassen. Ganz im Gegenteil.
»Ich warte darauf, dass ich verstehe, was passiert ist.«
Nein. Seine winterlichen Saunagänge in Ehren, aber das ging nicht. Er durfte hier nicht sitzen bleiben. Begründen konnte ich diese Überzeugung nicht und Befehle hasste er, aber eines spürte ich genau: Das, was er tat, war keine Lösung. Hier würde alles nur noch schlimmer werden. Er war mitten in ihr Gift eingetaucht und glaubte, darin seine Heilung zu finden – so kam es mir vor. Das war absurd. Außerdem brauchte ich einen Freund. Ich sehnte mich nach jemandem, der mir beistand. Jemandem, der verstehen konnte, warum ich wegmusste. Und mir die Karte las?
»Komm mit mir mit, Tillmann. Ich fahr nach Hamburg, zu meinem Bruder … Du darfst hier nicht bleiben. Bitte. Bitte!«
Doch er fuhr damit fort, in die Flammen zu starren, ohne mir eine Antwort oder auch nur einen Blick zu schenken. Ich kam nicht an ihn heran.