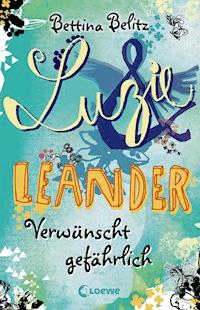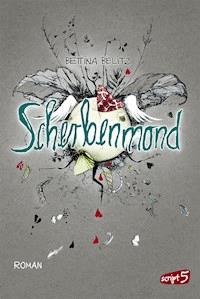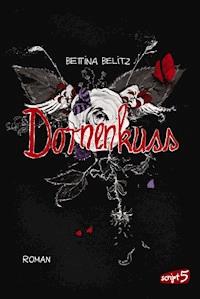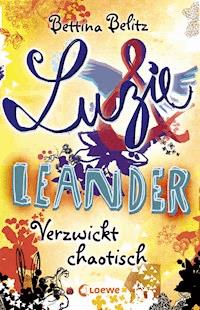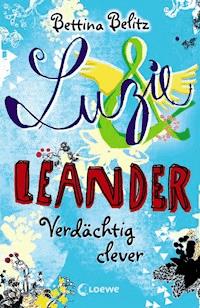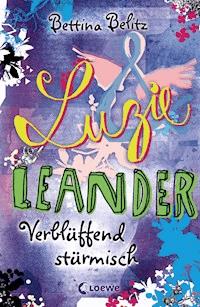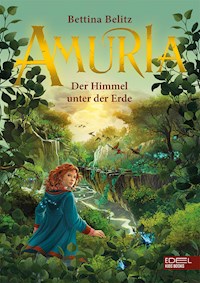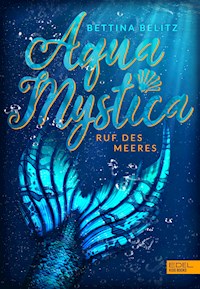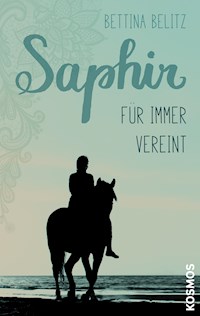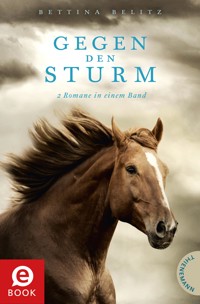Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: script5Hörbuch-Herausgeber: The AOS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Splitterherz-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Es gibt genau einen Grund, warum Elisabeth Sturm nicht mit fliegenden Fahnen vom platten Land zurück nach Köln geht, und dieser Grund heißt Colin. Der arrogante, unnahbare, aber leider auch äußerst faszinierende Colin gibt Ellie ein Rätsel nach dem anderen auf, und obwohl sie sich mit aller Macht dagegen wehrt, kann sie sich seiner Ausstrahlung nicht entziehen. Bald muss Ellie einsehen, dass Colin viel mehr mit ihrer Familie verbindet, als sie sich je vorstellen könnte. Ihr Vater Leo verbirgt ein Geheimnis, das ihn und Colin zu erbitterten Gegnern macht - und das Ellie in tödliche Gefahr bringt. Dass sie mit ihren seltsamen nächtlichen Träumen den Schlüssel zu dem Rätsel in der Hand hält, begreift Ellie erst, als ihre Gefühle für Colin alles zu zerstören drohen, was sie liebt. Mit der romantischen Liebesgeschichte von Elli und ihrem träumeverzehrenden Nachtmahr Colin gelang Bettina Belitz ein grandioses Debüt. Die Splitterherz-Trilogie ist All-Age Lesefutter vom Feinsten. Für alle, die gerne Paranormal Romances lesen, ein Muss. "Splitterherz" ist der erste Band einer Trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 833
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Guido, ohne den ich dieses Buch nie hätte verwirklichen können, und für Mio, der von den ersten Zeilen an dabei war – auf, neben und liebend gerne auch unter meinem Schreibtisch
PROLOG
Etwas hat sich verändert. Ich kann es wittern. Die Luft ist weicher geworden, der Wald grüner, der Nachthimmel schwärzer. Der Mond weint.
Eine neue Seele ist da. Sie flattert wie ein gefangener Vogel. Sie ist unruhig, verzweifelt, launisch. Sie ist zart und wild zugleich. Sie hat feine, spitze Widerhaken.
Sie schmeckt köstlich.
Es ist die Seele eines Mädchens. Ich sitze hier oben auf meiner Ruine, schaue hinab in die Finsternis und bin hungrig.
Ich kämpfe dagegen an, mit aller Kraft. Stunde für Stunde, Minute um Minute, und ich werde weiterkämpfen, bis die Seele alt und taub wird und stirbt.
Ich kämpfe. Kämpfe.
Und verliere.
FRÜHLING
KOPFLOS
Jetzt. Jetzt geschah es endlich. Mit einem Mal schmiegte sich mein Körper weich in die Matratze und ich sank ein winziges Stück tiefer – nur wenige Millimeter, aber sie reichten aus, um meine Lider schwer werden zu lassen. Meine Gedanken zerrissen sich gegenseitig und die Wut wurde milder. Ich war noch wach genug, um mich träge auf das Nichts zu freuen, aber zu müde, um traurig zu sein. Vielleicht erwarteten mich sogar Träume. Tröstende Träume. Irgendetwas, das mich nur für einen Moment glauben ließ, ein anderer Mensch zu sein.
Doch ehe sie eine Chance hatten, sich in meine Seele zu schleichen, näherten sich entschlossene Schritte. »Elisabeth! Bitte.«
Ich knurrte unwillig. Nur wenige Atemzüge später und Papa hätte mich tief schlummernd vorgefunden. Einen Moment lang hasste ich ihn dafür, mich aufgeschreckt zu haben. Mein Herz schlug schmerzhaft gegen mein Brustbein.
»Nein, später«, antwortete ich murrig und zog mir die Decke über den Kopf. War es denn nicht möglich, einfach nur in Ruhe auf dem Bett zu liegen und an nichts zu denken? Ja, es war erst früher Abend, aber an einem Sonntag, und wenn es irgendeinen Tag in der Woche gab, an dem tagsüber schlafen erlaubt sein sollte, dann doch den Sonntag.
Ich wusste genau, was Papa von mir wollte. Er hatte mir gleich nach unserer Ankunft im Nirgendwo damit gedroht. Er wollte, dass ich Umzugskartons schleppte, mir das Haus anschaute, ihm beim Einräumen seiner Bücher half. Und er wollte, dass ich Begrüßungskarten an die Nachbarn verteilte. Nun stand er wieder vor meinem Bett und wedelte mit einem Bündel Briefkuverts vor meinem verborgenen Gesicht herum. Er machte seine Drohungen also wahr.
Genauso wie er wahr gemacht hatte, von Kölns City aufs platte Land zu ziehen und dieses Haus im Westerwald zu kaufen. Ich hatte gelacht, als er mir diesen Entschluss verkündet hatte, weil ich dachte, es sei ein schlechter Witz. Denn Papas Praxis lief gut. Doch er wollte wieder mehr forschen und die psychiatrische Klinik in Rieddorf suchte händeringend nach einem neuen Chef. Wenn Papa wenigstens in Rieddorf nach einem Haus Ausschau gehalten hätte. Aber nein. Wennschon, dennschon. Wennschon ein Umzug aufs Land, dann mitten in die Einöde. In diesem Kaff hier gab es nichts. Gar nichts. Nicht einmal eine Bäckerei. Knapp 400Seelen, davon wahrscheinlich gut die Hälfte ein Fall fürs Altersheim. Und den Namen des Kaffs wollte ich nicht einmal aussprechen. Kaulenfeld. Das klang nach geschlachteten Tieren.
Mama hatte Papas Idee sofort gefallen. Sie wirkte fast erleichtert, nachdem er den Kaufvertrag unterschrieben hatte. Und daran hatte sich bis jetzt nichts geändert. Die beiden benahmen sich seit Wochen wie Teenager auf der ersten Klassenfahrt. Ich hingegen hatte mich immer öfter in mein Zimmer verkrochen und geheult.
Aber jetzt wollte Papa nicht mehr zulassen, dass ich mich verkroch. Mit einem Auge lugte ich am Kissen vorbei aus dem Fenster. Draußen war es noch hell. Zwar wurde es bereits dämmrig, das Grau wich langsam einem bläulichen Anthrazit, doch man würde mich noch sehen und als fremd erkennen und als exotisch und großstädtisch beurteilen können. Ich wollte mich aber nicht sehen und beurteilen lassen. Von nichts und niemandem.
Papa seufzte und zog eine Grimasse. Die Stirnlocke unter seinem Wirbel fiel zwischen seine Augenbrauen und zeichnete ein dunkles S auf seine Stirn. Er hatte einfach unverschämt schöne Haare für einen Mann, befand ich zum hundertsten Mal. Es war ungerecht. Frauen sollten solche Haare haben. Ich sollte sie haben.
»Elisabeth, ich habe keine Lust zu diskutieren. Du hast uns in all den Wochen kein einziges Mal beim Renovieren geholfen – gut, das haben wir akzeptiert. Dass du dich heute wieder den ganzen Tag ins Bett legst, obwohl wir alle Hände voll zu tun haben – von mir aus. Aber jetzt bitten wir dich nur, die Begrüßungskarten bei unseren Nachbarn einzuwerfen. Und ich weiß nicht, was –«
»Ich mache es ja!«, rief ich giftig und riss das Kissen herunter. »Ich habe nicht behauptet, dass ich mich weigere. Ich will mich nur noch ein bisschen – ausruhen.«
»Ausruhen«, wiederholte Papa. Sein linker Mundwinkel zuckte amüsiert. »Wovon?«
»In einer Stunde«, ignorierte ich seine Frage stur. Ich drehte den Kopf weg, weil mich sein Blick zu durchleuchten schien. Er ahnte sehr wohl, dass man kaum ausgeruhter sein konnte, als ich es in diesem Moment war – so ausgeruht, dass es in meinen Beinen nervös kribbelte. Ich hatte schließlich nicht nur den heutigen Nachmittag, sondern das gesamte Wochenende im Bett verbracht. Eben hatte ich lange und geduldig warten müssen, bis der Schlaf sich meiner erbarmte. Mir fehlte die Bettschwere. Mein Kopf und meine Gedanken fühlten sich müde an, aber mein Körper war es leid, nur herumzuliegen.
Hoffentlich hatte ich richtig geschätzt und in einer Stunde war es tatsächlich dunkel. Ich wollte so unbeobachtet wie möglich durchs Dorf schleichen. Eine Fremde fiel hier auf wie ein bunter Hund. Am liebsten wäre es mir gewesen, wenn mich dieses vermaledeite letzte Jahr vor dem Abi überhaupt niemand zu Gesicht bekommen würde.
Aber Mama und Papa hatten es sich offenbar in den Kopf gesetzt, zu den Anwohnern mindestens verwandtschaftliche Beziehungen aufzubauen. Als ob meine Eltern sich jemals ernsthaft für ihre Nachbarn interessiert hätten oder gar umgekehrt. Da hätte Jesus persönlich nebenan wohnen können und Papa hätte doch nie mehr gemacht, als vielleicht mal über den Gartenzaun zu winken. Doch die Stimmung war eisig genug und ich hatte keine Lust, mit meinen Eltern über ihren nicht vorhandenen Freundeskreis zu diskutieren. Gut, Mama hatte einen, zumindest telefonierte sie mit Freundinnen und schrieb ihnen oder besuchte sie hin und wieder. Aber zu Gesicht bekamen wir sie trotzdem fast nie. Die beiden sind sich eben selbst genug, dachte ich in einem plötzlichen Anflug von Neid und schnaubte kurz.
»Elisa.« Papas Stimme klang nicht mehr ganz so aufgeräumt und freundlich. »Überspann den Bogen nicht.« Der leichte Luftzug auf meinem Gesicht verriet mir, dass er schon wieder mit den Briefkuverts wedelte, aber ich drehte mich nicht zu ihm um. Die Gefahr war einfach zu groß, dass er mich überredete, sofort aufzubrechen. Schon vorhin hatten sich an den Nachbarfenstern die Vorhänge bewegt, als wir aus dem Auto gestiegen waren und ich frierend im Wind stehen musste, bis Mama endlich den richtigen Schlüssel herausgekramt hatte.
»Na gut. Eine Stunde. Von mir aus«, gab Papa sich geschlagen, ließ die Kuverts auf mein Bett fallen und verschwand.
Mit polterndem Herzen blieb ich liegen und versuchte, an nichts zu denken, während der anthrazitfarbene Himmel sich blauschwarz verfärbte und die Straßenlampe vor dem Haus in einem ungesunden Orangerosa ansprang. Mir war regelrecht übel vor Hunger. Seit Freitagabend hatte ich kaum mehr etwas gegessen, und als ich mich aufrichtete, begann das Zimmer vor meinen Augen zu tanzen. Trotzdem stellte ich mich mit einer schnellen Bewegung auf meine tauben Füße, schlüpfte ungeachtet meiner schmerzenden Zehen in die hochhackigen Stiefeletten von heute Nachmittag und warf mir einen Strickmantel über. Sollte ich doch vor Schwäche und Kummer umkippen und Papa mich finden, ohnmächtig und am besten schwer verletzt dazu – so schwer, dass meine Eltern einsahen, mich an den falschen Ort verschleppt zu haben, und alles rückgängig machten. Der Gedanke hatte seinen Reiz. Wenigstens die theoretische Möglichkeit, Grischa noch einmal wiederzusehen … ihn nur noch einmal anzusehen. Auch wenn er mich nicht sah. Aber hier, hier im Nirgendwo, würde ich ihm niemals mehr begegnen. Es blieb mir nur, von ihm zu träumen.
Nein. Schluss. Kein Grischa. Grischa gehörte jetzt endgültig der Vergangenheit an und vielleicht war das sogar das einzig Sinnvolle an dieser Zwangsumsiedlung. Ich würde ihn nicht wiedersehen. Tobias nicht und Grischa auch nicht. Nicht in der Realität und nicht in Gedanken.
»Bloß kein Rückfall, Ellie«, wies ich mich selbst zurecht. Tagträumereien hatte ich mir schon lange verboten. Sie brachten nur wirre Gefühle und die Realität war anschließend umso gnadenloser. Selbstmitleidige Tagträume waren erst recht tabu. Und das mit Grischa hatte einfach nur wehgetan. Von ihm zu träumen hatte es meistens nicht besser, sondern nur noch schlimmer gemacht, denn die Kluft zwischen meinen Träumen und dem, was tatsächlich gewesen war, verschlang und zermalmte mich jedes Mal brutal aufs Neue.
Nun gelang es mir nicht mehr, meine Augen unscharf zu stellen, weil ich die Tränen wegblinzeln musste. Ich biss mir in die Faust, um nicht zu weinen, und drehte mich langsam einmal um mich selbst. Vorhin, gleich nach unserer Ankunft, hatte ich mich mehr blind als sehend aufs Bett geworfen und Mama weggeschickt. Sie war so stolz auf all das gewesen, was sie mir hier zeigen wollte – und nun wusste ich, warum. Das Zimmer war riesig. Ein ausgebautes Dachstudio, mindestens viermal so groß wie mein altes Zimmer in Köln. An drei Fronten große Fenster, insgesamt sechs Stück, mit Blick über das ganze erbärmlich kleine Dorf. Das Bett stand geborgen unter den Schrägen, aber ich konnte rechts und links nach draußen sehen. Daneben mein Kleiderschrank, am anderen Ende des Raumes die Stereoanlage, eine kleine Couch, unter zweien der Fenster mein Schreibtisch. Und zwischendrin genug Platz für ein geselliges Tanzkränzchen.
Ich fand es tatsächlich schön. Zwar zu leer und zu groß, aber irgendwie heimelig. Meine Schritte hallten nicht, wahrscheinlich wegen der Schrägen und der schweren alten Bodendielen, die mit flauschigen bunten Flickenteppichen ausgelegt waren.
Und trotzdem konnte ich immer noch nicht glauben, dass sie es wirklich getan hatten, dass sie mich aus meinem Leben gerissen und hierher aufs Land verschleppt hatten und das jetzt mein neues Zuhause war – es hätte einfach nicht sein müssen. Nicht ein Jahr vor meinem Abitur. So lange hätten sie noch warten können. Nur dieses eine Jahr. Davon wäre doch niemand umgekommen.
Einen Sommer. Einen Winter. Und noch einen wahrscheinlich viel zu kalten Frühling. Dann konnte ich hier wieder weg. Das musste ich durchstehen, irgendwie.
Vielleicht sollte ich Nicole anrufen. Oder Jenny. Ich glaubte nicht, dass sie mich vermissten; sie wussten schon lange, dass ich wegziehen würde, und in den vergangenen Wochen schien es, als hätten sie sich bereits damit abgefunden. Ich war ständig mies gelaunt und so trafen sie sich auch ohne mich. Trotzdem. Eine vertraute Stimme – einfach nur Hallo sagen. Ich angelte mein Handy aus der Jackentasche. »Kein Empfang«, leuchtete es mir vom Display entgegen. Kein Empfang?
»Scheiße«, fluchte ich und lief in die andere Ecke des Studios. Immer noch kein Empfang. Nicht mal ein kleiner Streifen auf der Funkanzeige. Ich war abgeschottet. Einen kurzen, schmerzhaften Moment lang dachte ich an Tobias, der mich am Wochenende plötzlich wehmütig angeschaut und nach meiner Handynummer gefragt hatte – ach, es hätte sowieso nichts werden können, ich hier, er in Köln, beide ohne Auto. Zum ersten Mal hatte sich ein Junge wirklich für mich interessiert, und was passiert? Ich ziehe nach Dunkelhausen. Ins Exil.
Und nun zwang Papa mich auch noch dazu, mich den anderen Exilanten freundlichst vorzustellen. Ich nahm das Bündel Briefe in meine zittrige Hand und tapste so leise wie möglich die knarzende Treppe hinunter. Aus Mamas und Papas Schlafzimmer ertönte viel zu glückliches Lachen und das Klappen von Kofferscharnieren. »Ich bin dann weg!«, rief ich und schlug die schwere Haustür zu, bevor ich eine Antwort hören konnte. Falls sie mich überhaupt wahrgenommen hatten.
Es war dunkel. Zu dunkel für meine lichtverwöhnten Augen. Die Straßenlampe leuchtete zwar inzwischen hellgelb, warf aber nur einen matten Kegel auf den nassen Asphalt. Ein feiner Nieselregen benetzte mein Gesicht und kroch kalt in meinen Nacken. Es war totenstill – so still, dass ich glaubte, das Rauschen meines Blutes hören zu können. Der Wind hatte sich gelegt. Kein Blatt, kein Strauch bewegte sich.
Starr thronte die riesige Eiche neben dem Feldweg, der an unserem Garten vorbei bis hinauf zur Kuppe führte. Ihre Äste glänzten feucht im verblassenden Schein der letzten Laterne, bevor pure Finsternis den Weg verschlang. Dieser Baum war mir bei unserer Ankunft sofort aufgefallen und hatte ein beklemmendes Gefühl ausgelöst – Trostlosigkeit vermischt mit Neugierde. Ein dicker Ast stand merkwürdig waagerecht ab und war fast frei von weiteren Gabelungen.
»Ich möchte nicht wissen, wer daran schon sein Leben lassen musste«, hatte Papa bemerkt, als Mama begeistert die knorrige Rinde der Eiche berührt und sich an ihren mächtigen Stamm gelehnt hatte – und ich zu fürchten begann, sie würde den Baum umarmen oder gar um ihn herumtanzen. Es war kein gewöhnlicher Baum. Es war eine Gerichtseiche. Man hatte dort Diebe und Mörder gehängt. Heute stand eine Bank darunter, deren morsche Lehne halb abgerissen im hohen Gras steckte. Gestiftet vom Verschönerungsverein.
Papa hatte es sich in seiner Euphorie nicht verkneifen können, eine haarsträubende Geschichte zum Besten zu geben – nicht dass ich sie hatte hören wollen. Irgendein dämlicher Priester hatte sich an diesem Ast erhängt, weil er sich in ein Mädchen verliebt und es geschwängert hatte, und trieb fortan als kopfloser Reiter sein Unwesen. Das zumindest erzählte man sich im Dorf. Sonst gibt es hier ja auch nichts zu tun, dachte ich zynisch.
Gut, es war keine allzu schöne Vorstellung, dass an diesem Baum einst Leichen baumelten. Aber das lag immerhin Jahrhunderte zurück. Jetzt rasteten hier allenfalls Wanderer. Und finstere Gesellen trieben sich auch nicht herum. Ich sah lediglich zwei Schafe mit schauderhaft schmutzigem, verklumptem Fell auf der Weide nebenan ihr graugrünes Gras kauen.
Nun hatte ich mich ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt. Ich schlang meinen Strickmantel enger um den Bauch und suchte die passenden Häuser zu den Adressen auf den Kuverts. Alles in nächster Nähe, und sämtliche Häuser sahen aus, als würden alte Menschen darin wohnen. Ich war umzingelt von Greisen.
Nur die letzte Adresse fand ich nicht sofort. »Das ist ganz am Ende der Gartenstraße«, hatte Papa noch gesagt, wie ich mich jetzt erinnerte. Was für ein schöner Name für einen so ungepflegten Weg. Die meisten Häuser wirkten verlassen. Nicht nur die Gärten waren zugewuchert, auch die Büsche neben dem Pfad streiften dornig meine Schultern, so weit ragten sie über die Zäune. Ein Wollfaden an meinem Mantel riss, als sich ein besonders vorwitziger Ast darin verhakte. Ich schloss kurz die Augen und atmete tief durch. Konnten die hier nicht mal die Straßen frei halten?
Da, endlich, die letzte Adresse und ein Hort der Zivilisation. Solarerhellte eisblaue Schmetterlinge aus dem Verkaufsfernsehen (»Die müssen Sie einfach haben!«) schwebten über den ordentlichen Rabatten und alle Fenster wurden akkurat von Rüschen und Übergardinen erstickt. Also auch Greise.
Eine verknöcherte Hand griff von innen zwischen die Vorhänge. Hastig stopfte ich die Grußkarte durch den Briefschlitz. Wenn ich nicht sofort verschwand, würden sie die Tür öffnen und mich in ein Gespräch verwickeln. Und ich wollte nicht reden.
Ich zerrte an dem Gartentörchen, das sich hinter mir von allein geschlossen hatte. Meine Hand rutschte ab und schlug gegen den Holzzaun. Schon bewegte sich die Klinke der Haustür langsam nach unten. Ich griff ein weiteres Mal nach dem Törchen und zog fest daran. Das Scharnier löste sich.
»He, junges Fräulein!«, ertönte eine heisere, unverkennbar alte Männerstimme hinter mir. Ich tat, als habe ich nichts gehört, und trat die Flucht an. Gott, war das albern. Ich floh vor den Nachbarn, die soeben mit liebreizenden Grußkarten der Familie Sturm versorgt worden waren. Mir war die Hitze ins Gesicht gestiegen und mein Herz schlug hart und lebendig unter dem feuchten Stoff meines Mantels, als ich die Straße entlangrannte, bis sie eine Biegung nahm und in einen unbefestigten Waldweg mündete. Das Dorf lag hinter mir.
Doch ich fürchtete, der Greis würde neben seinen Solarschmetterlingen geduldig warten, bis ich meinen Irrtum erkannt hatte, um mich dann in sein gardinenverhangenes Reich zu entführen und mir Kuchen oder Tee aufzuzwingen. Ich musste Zeit schinden.
Ich schloss die Augen, lehnte mich an einen Baum und ließ den Nieselregen auf mein erhitztes Gesicht perlen. Ein unverhofft vertrautes Geräusch holte mich schlagartig in die Gegenwart zurück. Irritiert sah ich an mir herunter. Meine Wangen trieften vor Nässe und mein Mantel hing schlaff und nach Schaf müffelnd um meine Schultern. Den konnte ich in die Tonne kloppen. Wie lange hatte ich hier gestanden?
Jetzt hörte ich es wieder – ein leises, beständiges Gluckern und Schmatzen und dazwischen jenes Quaken und Knottern, das mich und Paul Frühling für Frühling auf die Straße getrieben hatte, damals bei Oma im Odenwald. Kröten. Natürlich. Es waren Kröten, die einen Platz zum Laichen suchten und sich gegenseitig auf dem Rücken trugen. Bewaffnet mit Eimern waren wir losgezogen, um die Kröten vor den viel zu schnell fahrenden Autos zu retten, und waren zu Tränen enttäuscht, wenn wir keiner einzigen begegneten. Doch manchmal fanden wir sie dutzendweise und pirschten immer und immer wieder die Straße auf und ab, während Oma sorgenvoll auf uns wartete.
Seitdem hatte ich keine Kröte mehr gesehen, geschweige denn berührt. Obwohl ich Letzteres lieber meinem Bruder überlassen hatte, der sich grundsätzlich brennend für sämtliche schleimigen Objekte dieses Planeten interessierte.
Hier mussten Tausende von Kröten wandern oder laichen. Ihr Gesang schwoll an und verebbte wieder. Ich richtete meine Augen in die Dunkelheit, bis sie fast zu tränen begannen, und tatsächlich konnte ich nach einigen Minuten meine Umgebung schemenhaft erkennen. Unser Feuchtbiotop auf dem Schulhof in Köln war ein Witz gegen das, was ich hier erahnen konnte – eine weite, lang gestreckte Sumpflandschaft. In einem verschlungenen Muster durchbrach meterhohes Schilf das schwarz glitzernde Wasser. Ehe ich mich versah, hatte ich mich darauf zubewegt. Der Boden unter mir gab schmatzend nach und Schlamm saugte sich an meinen Sohlen fest.
Nicht weitergehen, befahl mir mein Gehirn. Du machst dich schmutzig. Es ist spät am Abend. Es ist kalt. Du holst dir den Tod.
Weitergehen, sagte mein Gefühl. Schau dir eine Kröte an. Irgendwie glaubte ich, dass mich der Anblick einer Kröte trösten würde. Doch ich sah keine. Sie sangen nach wie vor ihr unmusikalisches Lied für mich, aber zwischen dem Schilf und den faulenden Baumstümpfen konnte ich nur schillernde Bläschen und wabernde Algengeflechte ausmachen.
Doch da – etwas flirrte über das zähe Wasser, bläulich und zitternd, dann verharrte es und erlosch. Erlosch? Eines wusste ich: Kröten hüpften träge, nicht schnell und zitternd. Und schon gar nicht schimmerten sie bläulich. Vor allem aber erloschen sie nicht.
Wollte mir da jemand einen Schrecken einjagen? War das etwa ein beliebter Dorfbrauch – zugezogene Großstädter das Fürchten lehren? Vielleicht steckten ja sogar Mama und Papa im Dickicht und freuten sich diebisch über die Finte mit den Begrüßungskarten?
Da war noch eines – ein bebendes blaues Flämmchen, das mit leisem Zischen die Wasseroberfläche erhellte und sofort wieder in die Schwärze der Nacht abtauchte. Okay, ganz ruhig, mahnte ich mich, obwohl es direkt neben mir, beunruhigend nah, laut schmatzte. Du drehst dich jetzt um, verschwindest von hier und kehrst so schnell wie möglich nach Hause zurück. Ich hob testweise meinen linken Fuß an – gut, ich konnte ihn noch mühelos aus dem Schlamm ziehen. Ich war also noch nicht im Begriff, vom Sumpf verschlungen zu werden. Es war ja auch ein mitteldeutsches Biotop und kein schottisches Hochmoor. Trotzdem konnte ich meinen Blick kaum vom Wasser abwenden. Und da, wieder flackerte es bläulich, diesmal hinten am Waldrand, und wieder gelang es mir nicht, mich in Bewegung zu setzen. Was zum Teufel war das nur? Ich starrte mit aufgerissenen Augen über die Wasserfläche und stockte. Nein. Das konnte nicht sein. Das gab es nicht. Nein, Elisabeth, das siehst du nicht. Du bist überreizt und müde.
Doch meine Augen wollten sich nicht von der finsteren Silhouette lösen, die sich zwischen den Baumgerippen aus dem Morast erhoben hatte. Die Flämmchen schossen ihr entgegen und ließen sie nachtblau aufschimmern, bevor sich vollkommene Dunkelheit über den Sumpf senkte und den Schemen verschluckte. Ein jähes Schaudern ergriff mich und meine Zähne schlugen hart aufeinander, ein Geräusch wie das Klappern von morschen Knochen.
Dann wurde es so still, dass ich die Gasbläschen im Schlamm blubbern und gären hören konnte. Die Kröten waren verstummt. Da war nur noch das beständige, glucksende Flüstern des Moores, das sich modrig in meinen Ohren festsetzte.
Ich zog meine versinkenden Füße aus dem gurgelnden Untergrund. Mit zwei staksigen Schritten rückwärts fand ich den Weg wieder. Der Schotter grub sich beruhigend scharfkantig in die dünnen Gummisohlen meiner Stiefeletten. Ich warf nicht einen einzigen Blick zurück.
Erst als ich mit klammen Fingern und bis auf die Haut durchnässt die Eingangstür aufschloss und in die Wärme des Hauses eintauchte, erlaubte ich mir, jenes gespenstische Bild in meinen Kopf zurückzuholen, das zwischen den zuckenden blauen Irrlichtern des Moores aufgetaucht war. Nur ein Kontrast, mattes Schwarz vor dunstigem Grau – eine Gestalt auf einem Pferd, nicht kopflos, aber zumindest lautlos, und für meinen Geschmack viel zu geisterhaft.
Ich lehnte mich an die rustikal verputzte Wand des Hausflures. Er trug bereits Mamas Spuren und wirkte so vertraut und verlässlich, dass ich einen Moment lang nicht wusste, ob ich lachen oder weinen sollte. Überall hingen Bilder aus dem Kölner Haus, die schönen bunten Gemälde, die Papa einst in der Karibik gekauft hatte. Dazwischen hatte Mama Kerzenhalter, angelaufene Spiegel und all die merkwürdigen Reisemitbringsel an die Wand genagelt, die sich im Laufe der Jahre angesammelt hatten. Sogar der struppige norwegische Troll, den ich schon in Köln nicht gemocht hatte, starrte mir aus dem Winkel über den Garderobenhaken entgegen. Und doch – alles sah vertrauter aus, als ich dachte. Das war schön und schmerzlich zugleich. Wenn sie das Haus doch wieder so einrichteten wie in Köln, warum hatten wir dann nicht gleich dort bleiben können? Es sah aus wie Köln. Aber es war nicht Köln. Es war Dunkelhausen.
Ich zog mir den nassen Mantel von den steif gefrorenen Schultern, knüllte ihn in die Ecke und zerrte mir die über und über schlammverkrusteten Stiefel von den Füßen.
»Bin wieder da!«, rief ich in Richtung Wohnzimmer, wo ich Weingläser aneinanderklirren hörte. Da saßen sie jetzt und freuten sich an ihrem neuen, tollen Leben, während ihre Tochter vor lauter Stress und Kummer schon Halluzinationen bekam. Ich kam mir entrückt vor – und gleichzeitig absolut hysterisch.
Ein Reiter in der Nacht, ja, natürlich. Ich war definitiv zu alt, um mich von Papas Spukgeschichten beeindrucken zu lassen. Wie würde Papa das nennen, was mir widerfahren war?, fragte ich mich spöttisch. Landeierpsychose?
Doch als ich mir lustlos ein Käsebrötchen einverleibt, mir die Kälte aus den Knochen geduscht und mich in meinem Bett vergraben hatte, tauchte die Vision noch einmal auf und zog stumm vor meinen geschlossenen Lidern vorüber. Tanzende blaue Lichter, schwarzes Wasser und die wehende Mähne eines auf der Stelle tretenden Pferdes.
Ich hatte scheußliche Angst vor Pferden.
Ich war schon fast eingeschlafen, als mein Gehirn mich daran erinnerte, dass heute Abend kein einziger Lufthauch gegangen war. Tagsüber – ja, da war es windig gewesen. Nachts nicht. Aber die Mähne des Pferdes hatte sich bewegt. Wie dünne Schlangen, die sich ins schwarze Nichts kringelten.
Es hätte mich beunruhigen sollen. Doch ich war dankbar für den endgültigen Beweis dafür, dass ich etwas gesehen hatte, was es nicht gab.
Es gab keinen schwarzen Reiter. Ob mit oder ohne Kopf.
Es gab keinen Reiter.
Zufrieden drehte ich mich auf die andere Seite. Und meine Traumbilder brachten mich zurück in die Stadt.
GROSSSTADTPFLÄNZCHEN
»Iss was, Ellie«, sagte Mama ohne rechten Nachdruck. Sie saß übernächtigt im Morgenmantel am Frühstückstisch, während Papa geschäftig seine Arbeitstasche packte. Mama verschlief das Frühstück normalerweise. Das war Papas und meine Zeit. Wenn überhaupt. Am liebsten war ich um diese Zeit alleine und gerade im Sommer stand Papa gern in aller Herrgottsfrühe auf und verschwand zur Arbeit. Anscheinend dachte Mama, sie würde es mir mit ihrer Anwesenheit leichter machen.
»Keinen Hunger«, murmelte ich.
»Das hier ist aber doch – wirklich schön, oder?«, fragte Mama gähnend. Ich seufzte und sah mich um. Ja, einen Wintergarten hatten wir in Köln nicht gehabt. Und ja, wahrscheinlich war es ein exklusiver Platz zum Frühstücken, auch wenn Mama diese Mahlzeit meistens im Wachkoma zubrachte. Aber Menschen, die morgens geistig anwesend waren, mussten es wohl als schön beurteilen. Es sei denn, sie hatten Heimweh wie ich.
Die ersten Sonnenstrahlen ließen das dunkle Holz unseres wurmstichigen Esstisches warm aufleuchten. Papa trat zu uns, trank im Stehen einen Schluck stilles Wasser und wandte blinzelnd die Augen ab.
»Die Vorhänge sind bald fertig, nur noch ein, zwei Tage«, sagte Mama und strich Papa schlaftrunken über den Arm. »Außerdem hab ich Jalousien bestellt.«
Ich verkniff mir einen bösartigen Kommentar. Es war schließlich nicht gerade nett, über die Krankheiten anderer Leute zu spotten. Aber Papa und seine Migräne – das war etwas, woran ich mich einfach nicht gewöhnen konnte. Und schon gar nicht daran, dass die hellsten Räume im Haus an jedem Schönwettertag rigoros abgedunkelt wurden. Ich wunderte mich, dass er den Wintergarten nicht gleich abgerissen hatte.
Papa musterte meinen leeren Teller.
»Elisa, iss doch was«, ermahnte er mich, bevor Mama ihn daran hindern konnte.
»Ich habe keinen Hunger«, erwiderte ich bockig. Achselzuckend zog Papa sich in den Flur zurück und pfiff dort vor sich hin. Ich hatte wirklich keinen Hunger. Stattdessen war mir schlecht, vor Nervosität und Aufregung und weil ich nachts um drei in bleierner Stille aufgewacht war und nicht mehr hatte einschlafen können. Es war, als ob das Haus lebte. Überall knackte und knirschte es und gleichzeitig war es draußen so beängstigend ruhig. Nicht ein Auto fuhr durch das Dorf, stundenlang.
Stattdessen schrie am Waldrand immer wieder ein Vogel – es war ein merkwürdig sehnsüchtiger, gequälter Ruf, der sich in meinen Ohren einnistete und mir die letzte Müdigkeit raubte. Als es dämmerte, begannen die Singvögel ihr unerträglich optimistisches Konzert und ich marterte mich mit der Frage, was ich anziehen sollte. Ein sicheres Zeichen, dass ich wieder in der Realität angekommen war.
Mein abendlicher Ausflug an den Sumpf – bei Tageslicht betrachtet bestimmt ein lieblicher Teich mit Seerosen und Dotterblumen – kam mir vor wie ein Erlebnis aus fernen Zeiten und meine Vision begann mir sogar peinlich zu werden. Schließlich waren es nur Sekunden gewesen, in denen ich glaubte, so etwas wie einen finsteren Reiter gesehen zu haben. Und selbst wenn das sogar stimmte – vielleicht hatte sich jemand auf seinem Reitausflug verspätet und dort hinten kehrtgemacht. Oder so ähnlich. Ich beschloss jedenfalls, die ganze Angelegenheit so schnell wie möglich zu vergessen und mich ernsthaft meinem Klamottenproblem zu widmen.
Als mein Wecker schließlich um sechs klingelte, war ich allerdings so übermüdet und durcheinander, dass ich nachlässig nach einem engen Wollpulli und meiner Jeans griff. Dazu meine hohen Stiefel mit den Absätzen, ein solides Make-up, ordentlich Mascara, fertig.
»Ich nehme dich heute mit und setze dich bei der Schule ab. Ist ja ganz in der Nähe. Nach Hause kannst du dann mit dem Bus fahren«, rief Papa aus dem Flur.
»Okay«, antwortete ich erleichtert. Ein Lichtblick.
In Papas Auto war ich wenigstens ein bisschen zu Hause. Ich schwieg und gab vor, die Landschaft zu betrachten. Doch da gab es nicht viel zu sehen. Eine grüne, undurchsichtige Welt. Bäume über Bäume, dazwischen fette Wiesen mit hüfthohem Gras, keine Wege, keine Häuser, keine Straßen außer diesem schmalen, schlecht asphaltierten Pfad. Die gesamte Strecke nach Rieddorf fuhren wir an einem dieser unzähligen verschlungenen Bäche entlang, der viel zu viel Wasser führte und sich sumpfig in die Niederungen ausbreitete. Alles war grün und nass und wenig einladend.
Ich schluckte krampfhaft, um das flaue Gefühl in meinem Magen zu vertreiben. Wie würden sie auf mich reagieren – meine neuen Klassenkameraden? Köln schien mir momentan das Paradies zu sein, aber auch dort war es anfangs alles andere als leicht gewesen. Ich hatte irgendwann kapiert, wie man sich anpasst – was man sagen und anziehen muss und welche Interessen cool sind. Worüber man sich aufregen darf und worüber besser nicht. Und dass man sich über gute Noten lieber nicht freut und sie mit einem »Pffft« abtut. Am besten noch sagt, dass man gespickt hat und eigentlich gar nichts kann.
»Sei einfach du selbst«, hatte Mama zum Abschied gesagt. Ich wusste allerdings nicht genau, wie das aussah: ich selbst sein. Ich wusste ja nicht einmal, was ich anziehen sollte. Na, einen Vorteil würde der Umzug aufs Land wenigstens haben, dachte ich grimmig. Hier würde mich hoffentlich niemand Lassie taufen wie in Köln. Oh, wie hatte ich das gehasst. Ich war doch keine Hündin.
»Schau, hier geht’s zur Klinik«, riss Papa mich aus meinen düsteren Erinnerungen. »Und da zur Schule.«
»Schulzentrum. Psychiatrische Klinik. Schützenverein«, stand auf dem Schild an der Straßenkreuzung. Eine gute Kombination, dachte ich zynisch.
»Vielleicht kannst du dich ja in einem Sportverein anmelden«, sagte Papa beiläufig, als er zum Schulzentrum abbog.
»Du möchtest, dass ich Sport mache?«, erwiderte ich belustigt.
Papa wusste genau, dass ich seit meinem achten Lebensjahr circa siebzehn verschiedene Sportarten mit beschämend geringem Erfolg angefangen und wieder aufgegeben hatte. Bis ich schließlich gar nichts mehr gemacht hatte. Dabei war es nicht so, dass es mir grundsätzlich an Talent fehlte. Ich war nur viel zu sehr damit beschäftigt gewesen, mich nicht zu fürchten, den Trainer nicht zu verärgern und auf meine Mitspieler zu achten – und irgendwann machte ich einen Fehler nach dem anderen. An Spott und Häme hatte es nicht gemangelt.
»Warum denn nicht?«, fragte Papa. »Du kannst dich ja mal in der Schule umhören, was deine Klassenkameraden machen. So, nun raus mit dir. Melde dich im Sekretariat – die wissen Bescheid. Viel Glück, Kleine.«
»Tschö, Paps.« Ich schlüpfte aus der Tür und war mir kurz sicher, dass meine Beine unter mir nachgeben würden. Ich sah mir den überraschend modernen Bau an. Hier also würde ich mein Abitur machen – und das bedeutete wiederum, dass ich studieren durfte, und da es hier mit Sicherheit keine Universitäten gab, wäre das die Freikarte für die Flucht in eine Großstadt. Vielleicht nach Hamburg wie mein Bruder Paul, mit dem ich mich immerzu gezankt hatte und den ich jetzt so schrecklich vermisste. Er hatte es gut. Er war 23 und konnte machen, was er wollte. Und ich? Mitgefangen, mitgehangen. Ich hatte nicht einmal Hoffnung, dass sich hier etwas ändern und Paul uns besuchen kommen würde. Er hatte es in Köln nicht getan, warum sollte er es jetzt tun? Wie immer wurde meine Kehle eng, wenn ich an meinen Bruder dachte. Sich als 17-Jähriger mit seinen Eltern verkrachen – gut. Das war bestimmt nicht ungewöhnlich. Aber die eigene Schwester gleich mit vergessen? Ja, wir hatten uns gestritten. Aber so heftig nun auch wieder nicht. Und wenn er mir mal schrieb, dann hörte er sich an wie ein Fremder. Als hätte ihn jemand mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, sich bei mir zu melden.
Niemand beachtete mich, als ich durch das Foyer lief und nach dem Sekretariat Ausschau hielt. Ah. Da war es. Mit weichen Knien lehnte ich mich an den Tresen.
»Elisabeth …« Meine Stimme versagte. Ich räusperte mich und versuchte es noch einmal. »Elisabeth Sturm. Ich bin neu – in der 12. LK Bio, Chemie und Französisch.«
»Wow. Das ist echt krank«, hörte ich eine unverschämt freche Stimme neben mir. Ich blickte in zwei haselnussbraune Augen über einer krausen Nase, die einem Jungen in meinem Alter gehörte. Seine Jeans hing fast in den Kniekehlen. Anscheinend war die Botschaft, dass nun wieder engere Hosen angesagt waren, noch nicht bis in den Wald vorgedrungen. »Bio, Chemie und Französisch«, sagte er grinsend und musterte mich amüsiert.
»Man kann deine Unterhose sehen«, entfuhr es mir und er fing schallend an zu lachen. Die Sekretärin schaute entsetzt zu mir hoch. Mir stieg die Röte ins Gesicht. Verdammt. Genau das war einer der Gründe gewesen, weshalb ich in Köln anfangs nicht mitspielen durfte. Mein unbeherrschtes Mundwerk.
»Fräulein Sturm, das ist Benni, Ihr Tutor, er begleitet Sie in Ihre Klasse und zeigt Ihnen alles. Er ist Vertrauensschüler und Schulsprecher«, sagte die Sekretärin und machte keinen Hehl aus ihrer Missbilligung mir gegenüber. »Und er ist der Sohn des Bürgermeisters«, fügte sie bedeutungsvoll hinzu.
»Na dann«, sagte ich spröde und wandte mich ihm zu. »Bitte mach es kurz. Ich wollte hier nie hin, niemand wird mich mögen, ich erledige einfach nur mein Abitur.«
Meinte Mama etwa das mit »Sei einfach du selbst«? War das ich? Wenn ja, dann war es eine verdammt schlechte Idee, ich selbst zu sein und nichts zu spielen. Danke, Mama. Benni behielt sein Grinsen, doch seine Augen wurden ernster.
»Du bist die aus Köln, oder?«
»Ja.«
Er schleuste mich durch die Gänge und wich geschickt den uns entgegenstürmenden Unterstufenschülern aus.
»Ich kann dir nur den Rat geben, nicht zu sehr die Großstadtpflanze rauszuhängen. Das mögen die hier gar nicht.«
»Das eben war keine Großstadtpflanze«, blaffte ich ihn an. »Das war pure Verzweiflung.«
»Du meinst also, wir leben hier alle in nachtschwarzer Verzweiflung? Tun wir nicht. Ich jedenfalls nicht.«
Offenbar hatte ich ihn beleidigt.
»So hab ich das nicht gemeint. Ich dachte nur, dass ich – ach, egal.« Ich spürte schon wieder die Tränen hinter meinen Augenlidern und blinzelte hektisch. Ich hatte es vermasselt, in den ersten drei Minuten. Respekt.
»Hier ist dein Stundenplan. Und hier der Saal für deine erste Chemieblockstunde heute Morgen.« Ich lugte vorsichtig in einen Unterrichtsraum, in dem fast nur Jungs saßen und mich neugierig anschauten. Ich schreckte automatisch zurück.
»Halt dich am besten anfangs ein bisschen zurück. Hier kommen die Leute auf einen zu. Du musst nichts dafür tun«, sagte Benni leise.
»Du bist also Experte für das Landleben, was?«, fragte ich säuerlich. Es klingelte.
»So ähnlich«, antwortete er, doch sein Grinsen war verschwunden.
»Dann kannst du mir bestimmt sagen, ob nachts kopflose schwarze Reiter durch das Dickicht brechen«, platzte ich heraus. Ellie, was tust du da nur?, fragte ich mich stumm. Benni sah mich ratlos an.
»Ja, natürlich, jeden Abend mindestens einer, und wenn du nicht deinen Teller leer isst, holen sie dich und vergraben dich im Wald«, antwortete er ein wenig mitleidig. Ich fühlte mich hundeelend, als ich in den Saal schlich und mich in eine freie Zweierbank setzte.
»Hi«, sagte ich mit brüchiger Stimme in Richtung der gaffenden Jungs und schlug die Augen nieder. Ich wollte niemandem ins Gesicht sehen. Damit sie mich nicht sahen. Wie am Abend zuvor. Noch nie hatte ich mich so über die Ankunft eines Lehrers gefreut wie an diesem Morgen.
Nach der sechsten Stunde war ich unerträglich müde. Ich hätte auf der Stelle einschlafen können. Der Unterricht selbst war mir leichtgefallen. Das war nichts Neues. Schon immer war das so gewesen, seit der Grundschule. Doch wenn ich meinen Kopf zu schnell hob, wurde mir schwindlig, und ständig drohten mir die Augen zuzufallen.
In der Pause war Benni noch einmal zu mir gekommen und hatte mir den Weg zum Schulkiosk gezeigt. Er war freundlich gewesen, aber distanziert. Ich hätte mich gerne bei ihm entschuldigt, doch ich fand weder den Mut noch die richtigen Worte.
»Gibt es hier irgendwo ein ruhiges Plätzchen, wo man mal allein sein kann?«, fragte ich ihn schließlich.
»Hm. Eigentlich nicht. Wozu auch? Ist dir schlecht? Dann kannst du zum Hausmeister ins Zimmer, da ist eine Liege.«
»Nein, mir ist nicht schlecht. Ich – ist nicht wichtig, vergiss es«, sagte ich und blieb tapfer und sehr einsam zwischen den schwatzenden Grüppchen im Hof stehen. Vermutlich hatte sich spätestens jetzt herumgesprochen, dass ich den Sohn des Bürgermeisters, Schulsprecher und Vertrauensschüler und damit auch das ganze städtische Dorf beleidigt hatte, und ich würde fortan sowieso alleine mein Dasein fristen. Ob ich nun ein ruhiges Plätzchen dafür fand oder nicht.
Aber jetzt war der erste Tag geschafft und schlimmer konnte es kaum kommen. Mit schweren Schritten schlurfte ich zur Bushaltestelle. Mein Handy hatte wieder Empfang, ausgerechnet in der Schule, wo strengstes Handyverbot herrschte. Aber es war keine SMS für mich eingetrudelt, nicht einmal von Nicole und Jenny.
Der nächste Bus sollte in einer halben Stunde fahren – genug Zeit für mich, um mir die nähere Umgebung der Schule anzusehen. Doch da war nichts außer einem schmuddeligen Bauernhof mit schwarz-weiß gefleckten Rindern auf der Weide und wieder einmal Wiesen und Feldern und Wald. Und einem Edeka in Richtung Zentrum. Die Bäume der Allee spiegelten sich in den Pfützen des Schotterweges, der zur Bushaltestelle führte, und ich machte große Bogen, um meine mühsam geputzten Stiefel nicht ein zweites Mal zu ruinieren.
Es roch nach Heu und Mist und Katzenpipi. Überhaupt roch es hier ganz anders als in Köln – es roch besser, musste ich zugeben. Den Gestank der Autos hatte ich nie gemocht. Großstadtpflanze … Bennis Bemerkung ärgerte mich immer noch. Wenn der wüsste. Ich war keine Großstadtpflanze. Ich war im Odenwald aufgewachsen, in einem kleinen, ländlichen Vorort von Heidelberg. Erst als ich zehn war, zogen meine Eltern nach Köln, weil Papa in der City eine Praxis übernehmen konnte. Aber damals sollte ich sowieso aufs Gymnasium gehen – und ob Köln oder Heidelberg, das spielte keine große Rolle.
Okay, Ellie, sei ehrlich, sagte ich streng zu mir selbst, als ich mich dem Bushäuschen näherte und immer zögerlicher wurde. Es hatte eine Rolle gespielt. Es war höllisch schwer gewesen, auch damals. Ich musste fünf Jahre lang kämpfen, um mich an Köln zu gewöhnen, und dann durfte ich es karge zwei Jahre genießen. Alles umsonst.
Vorsichtig lugte ich um die Ecke in das schäbige, bekritzelte Innere des Unterstands. Gut. Niemand hier. Trotzdem wollte ich fluchtbereit bleiben und mich nicht hinsetzen. Doch die träge Stille der Umgebung wirkte beruhigend auf mich. Die langen, nicht enden wollenden Schulstunden verblassten allmählich in meinen Gedanken.
In einem erneuten Angriff überfiel die Müdigkeit mich so gnadenlos, dass ich meinen Rücken kaum mehr gerade halten konnte. Ich ließ mich widerstrebend auf einen der drei schmutzig orangefarbenen Plastiksitze sinken und rieb mir die Schläfen. Spannungskopfschmerzen, diagnostizierte ich aus alter Gewohnheit. Hervorgerufen durch Angst, Stress, Anspannung. Ich vermisste mein japanisches Heilpflanzenöl und drückte meine Stirn gegen das kühle Metall der Sitzhalterung.
Dann merkte ich in meinem müden Gedankenkarussell, dass ich beobachtet wurde. Es gelang mir nicht sofort, meine Augen zu öffnen. Es war wie in einem dieser Träume, aus denen man aufwachen möchte, nur um immer wieder in einen neuen, noch schrecklicheren Traum zu rutschen, wenn es einem endlich glückt, die Bilder abzuschütteln. Aber selbst als ich es nach einem kleinen, wütenden Gewaltakt schaffte, brauchte ich mehrere Sekunden, um ein klares Blickfeld zu bekommen. Ich registrierte nur noch, dass ein riesiges schwarzes Auto um die Ecke bog. Gehört hatte ich es nicht – war ich in einen so tiefen Schlaf gesunken, mitten am Tag?
Das unangenehme Gefühl, beobachtet worden zu sein, ließ mich nicht los, obwohl sich nach wie vor kein Mensch in der Nähe befand.
Gingen jetzt schon die Nerven mit mir durch, nach einem jämmerlichen Tag an der neuen Schule in der neuen Heimat? Ich schnaubte. Heimat … Es würde nie meine Heimat werden.
Eine schleimige Sonne drang mühsam durch die dunstigen, tief hängenden Wolken. Unter den Achseln brach mir der Schweiß aus. Unruhig rutschte ich auf dem harten Plastiksitz herum. Ich war viel zu dick angezogen. Es war warm geworden, geradezu schwül – so schwül, dass ich das Gefühl hatte, von Abertausend winzigen Wassertropfen überzogen zu sein. Verstohlen schnupperte ich an meinem Pulli. Nein, kein Schweißgeruch. Mein Deo hatte sein Versprechen gehalten.
Wo blieb der verdammte Bus? Oder fuhr er nur, wenn hier mehr als eine einsame Schülerin wartete? Ich stand wieder auf und lief nervös auf und ab. Das passte ja. Ein grauenhafter erster Schultag und dann blieb auch noch jenes Gefährt weg, das mich in den einzigen sicheren Hafen bringen konnte – mein viel zu großes, mit viel zu vielen Fenstern ausgestattetes Dachzimmer. Ich sehnte mich danach, mich auf mein Bett zu legen und einfach nur an die Decke oder in den Himmel zu starren.
Ein summendes Motorengeräusch ließ mich herumfahren. Schwere, dicke Reifen knirschten auf dem Schotter der Haltebucht, als das Fahrzeug schlagartig bremste. Es war natürlich nicht der Bus. Sondern, wenn mich nicht alles täuschte, das schwarze Auto von vorhin. Durch die verdunkelten Scheiben konnte ich niemanden erkennen, aber ich sah, wie sich die Fahrertür langsam öffnete und eine Stiefelspitze herausschob. Zornig stürzte ich auf das wuchtige Gefährt zu. Ich war plötzlich unerklärlich wütend.
»Hallo? Wissen Sie, wann dieser verfluchte Bus fährt?«, rief ich. Ich wollte raus aus allem – aus dieser Situation, aus dieser »Stadt« und am liebsten auch aus meiner eigenen Haut. Noch dazu beschlich mich erneut das beklemmende Gefühl, von allen Seiten beobachtet und durchleuchtet zu werden, obwohl der Fahrer mit dem Rücken zu mir saß. Es gelang mir kaum, meine Augen scharf zu stellen. Schweiß prickelte mir im Nacken.
Die Stiefelspitze stockte. Ich setzte zum Sprechen an, doch meine Stimme war nur noch ein heiseres Flüstern. Hilflos sah ich dabei zu, wie die Stiefelspitze wieder ins Wageninnere verschwand, eine Hand die Tür zuschlug und der Wagen mit dröhnendem Motor startete. Kleine spitze Steinchen schlugen gegen meine Unterschenkel und eine stinkende Wolke aus Staub, Öl und Benzin stieg mir in die Nase.
»Idiot!«, rief ich hustend und beherrschte mich mühsam, dem Fahrer nicht den Mittelfinger zu zeigen. Schließlich tat ich es doch – als das Auto um die Kurve gefahren war und der unhöfliche Mensch im Wageninneren mich garantiert nicht mehr sehen konnte. Stattdessen sah mich jemand anderes.
»Elisabeth – was in Gottes Namen tust du da?« Verwirrt drehte ich mich um. Ich hatte unseren Kombi nicht heranfahren hören. Papa lehnte lässig auf der heruntergekurbelten Scheibe des Wagenfensters und blickte mich fragend an.
»Ähm. Ich – ich warte auf den Bus, aber der kommt nicht, und da wollte ich …«, stotterte ich betreten.
»Der Bus?« Papa blinzelte mich zweifelnd an. »Elisa, es ist halb vier, um diese Uhrzeit fährt kein Schulbus.«
Halb vier? Ich zog den Ärmel meines verschwitzten Pullis hoch, um ihm das Gegenteil zu beweisen. Doch es war halb vier. Und ich hatte um Viertel nach eins Unterrichtsschluss gehabt. Nun verstand ich gar nichts mehr. War ich hier eingeschlafen – so fest, dass ich den Bus nicht gehört hatte?
»Steig schon ein«, forderte Papa mich ungeduldig auf. Hinter ihm bildete sich bereits ein kleiner Stau. Auf einmal war Leben auf der Straße und ortseinwärts konnte ich mehrere Menschen sehen, bepackt mit Einkaufstüten und Taschen. Vom Supermarkt drang das Scheppern der Einkaufswagen herüber. Benommen umrundete ich den Kombi und stieß mir schmerzhaft den Kopf, als ich einstieg. Im Wageninneren lief kaum hörbar Pink Floyd und die Klimaanlage pustete mir kühlend über mein klebriges Gesicht.
»Ich muss eingeschlafen sein«, sagte ich matt. »Ich hab schlecht geträumt heute Nacht«, versuchte ich meine geistigen Ausfälle zu erklären – und in derselben Sekunde, in der ich diese spontane Ausrede aussprach, kam mir alles wieder in den Sinn. Es war keine Ausrede. Ich hatte wirklich einen bösen Traum gehabt. Nun, eigentlich war er nicht böse gewesen. Eher seltsam. Und jetzt waren seine Bilder derart nah, dass ich glaubte, sie greifen zu können – so plastisch und deutlich schwebten sie vor mir.
»Was hast du denn geträumt?«, fragte Papa neugierig. Träume waren sein Steckenpferd. Wer zu ihm in Therapie kam, musste Traumtagebuch führen, ob er nun wollte oder nicht. »Du weißt doch, was man sagt: Die Träume in der ersten Nacht in einem neuen Zuhause werden wahr«, fügte er schmunzelnd hinzu.
»Ich hab von einem Baby geträumt«, antwortete ich gedankenlos.
»Prost Mahlzeit«, sagte Papa trocken und warf mir einen prüfenden Seitenblick zu – halb belustigt, halb argwöhnisch. »Damit lass dir noch ein bisschen Zeit, okay?«
»Ich hab nicht gesagt, dass es mein Baby war«, erwiderte ich hastig und beschloss, dass der Rest des Traumes allein mir gehören würde. Genau wie meine Erinnerung an diese vier langen, grüblerischen Wochen vergangenen November, als ich tatsächlich fürchtete, schwanger zu sein. Das sollte Papa niemals erfahren.
Doch der war mit seinen Gedanken schon längst wieder bei der Wissenschaft. Unbekümmert fachsimpelte er, dass alle Mädchen und Frauen im Laufe ihres Lebens von Babys träumten. Und meistens wäre in diesen Träumen der Kindsvater völlig unwichtig oder nicht einmal präsent – was für ihn der Beleg dafür sei, wie wenig der Kinderwunsch eigentlich von dem passenden Mann abhängig sei, sondern ein Urbedürfnis jeder Frau. Und so weiter und so fort.
Aber ich hörte nicht richtig zu. Mein Traum nahm meine Gedanken vollkommen in Beschlag. Ich schloss die Augen und versuchte, mich zurück ins Traumgeschehen zu befördern – denn ich verspürte ein merkwürdiges Verlangen, dort einzutauchen, wo ich aufgewacht war. Als gäbe es noch etwas für mich zu tun, zu erledigen, zu bewirken. Obwohl der Traum unheimlich und düster gewesen war, überfiel mich beim Gedanken an ihn eine fast brennende Sehnsucht. Das kannte ich von schönen Träumen, nicht aber von Träumen wie diesem. Hatte ich überhaupt schon einmal einen so deutlichen, real wirkenden Traum gehabt?
Mit Erstaunen stellte ich fest, dass es klappte – ich sah alles wieder exakt so vor mir, wie ich es heute Nacht vorgefunden hatte. Im Traum hatte ich die Szenerie von oben betrachten können und besaß die fantastische Gabe, mich frei und lautlos zu bewegen. Aber ich war wie ein fremder, beobachtender Besucher gewesen. Ich spielte keine Rolle in dem Geschehen. Ich war lediglich da.
Und ich konnte meine Augen kaum von dem winzigen Säugling abwenden, der auf einem schäbigen, mit rostigen Nägeln zusammengesetzten Holzdielenboden in seiner Wiege lag. Nein, es war keine Wiege – es war ein alter Futtertrog, lieblos ausgepolstert mit Heu und ein paar schmutzigen Tüchern. Es war kalt. Bitterkalt. Über die schräge, grob gezimmerte Decke zogen sich Eisblumen.
Das Baby war nur wenige Tage alt. Sein Gesicht war noch ganz zart und die Haut wie aus dünnem Pergament. Ich wusste, wie Neugeborene aussahen. Papa hatte direkt nach meiner Geburt im Kreißsaal gefilmt – kurze Aufnahmen von der Hebamme, die mich badete, dem glücklichen und erschöpften Gesicht meiner Mutter, dann wieder von mir in meinen allerersten Klamöttchen samt weißem Mützchen auf dem Kopf. Viel geschrien hatte ich nicht, aber man konnte sehen, dass ich verwirrt war und fror, und dauernd versuchte ich, meine Augen mit meinen winzigen Fäustchen zu verdecken.
Aber ich war verteufelt hässlich gewesen. Rot und schrumpelig, Ohren und Nase zu groß für den Rest des Kopfes, und auf dem Schädel klebten wie müde Blutegel ein paar schwarze Locken, die wenige Tage nach der Geburt ausfielen und einem braunroten Flaum Platz machten.
Doch dieses Baby sah anders aus. Seine Haut war rein wie Alabaster und schimmerte im fahlen Licht des Dachbodens. Es hatte bereits dichte schwarze Haare, die in weichen Wellen vom Kopf abstanden. Seine Hände, die zu Fäusten geballt und nach oben gewinkelt neben den Ohren ruhten, waren perfekt – wie Erwachsenenhände in Miniaturform.
Das Ungewöhnlichste aber waren seine Augen: schräg und groß und von einer tiefdunklen, schillernden Farbe. Augen wie Edelsteine. Das Baby regte sich nicht. Es blickte bewegungslos und mit einem engelhaft ruhigen Gesichtsausdruck zur Dachluke hinaus, direkt in den Wintervollmond, der über dem Haus wachte und die karge Schneelandschaft mit einem schwachen bläulichen Licht überzog. Und obwohl es so kalt war und die Brust des Babys sich langsam, aber regelmäßig hob und senkte, bildeten sich keine Atemkristalle vor seiner Nase.
Wo waren die Eltern?, hatte ich mich im Traum gefragt. Wer legte sein Baby allein und schutzlos in der Kälte ab? Wie es nur in Träumen möglich ist, war ich lautlos und unbemerkt die Dachstiege hinuntergeschwebt und hatte sie gefunden. Sie lagen in einem großen, quadratischen Holzbett; zwischen ihnen und eingekuschelt am Fußende der Frau zwei Kleinkinder, die friedlich und geborgen schlummerten. Der Vater schlief ebenfalls tief und fest. Ich konnte seine Atemzüge deutlich hören.
Der Ruf eines Käuzchens durchbrach die Stille der Nacht. Die Mutter wälzte sich unruhig auf den Rücken. Ihr Gesicht verzog sich und ein Ausdruck abgrundtiefer Furcht zeichnete ihren Mund. Sie riss die Augen auf – müde, gerötete Augen – und blickte angstvoll auf die Stiege, die hoch zum offenen Dachboden führte, wo ihr Baby alleine schlief, alleine und hilflos und ohne menschliche Wärme.
Ich wollte sie fragen, warum sie das Baby nicht zu sich holte, warum es da oben so einsam wach liegen musste. Doch als ich meinen Mund zum Sprechen öffnete, war ich schlagartig aus dem Traum aufgewacht und binnen Sekunden wieder eingeschlafen. Vermutlich war er mir auch deshalb erst jetzt wieder eingefallen.
Ich wurde nach wie vor nicht daraus schlau. Was mochte der Traum bedeuten? War ich etwa das Baby? Fühlte ich mich von meinen Eltern im Stich gelassen? Papa sagte immer, die Empfindungen, die ein Traum nach dem Aufwachen hinterließ, seien der wichtigste Schlüssel zu seiner Deutung. Ich war nach wie vor sauer, aber verlassen kam ich mir gewiss nicht vor. Eigentlich verstanden wir uns gut. Jeder ließ den anderen in Ruhe und unsere merkwürdigen Urlaube waren immer friedlich gewesen. Wenn man in die Wildnis fuhr, musste man zusammenhalten, das hatte ich schnell kapiert. Nein, vernachlässigt fühlte ich mich nicht.
Das Gefühl, das der Traum in mir auslöste, war viel eher eine unerklärliche Sehnsucht. Ich wollte noch einmal dorthin zurückkehren, noch einmal in die schimmernden Augen des Babys blicken.
Nein. Das Baby war nicht ich. Der Traum hatte nichts mit meinem Leben zu tun. Vor allem aber spielte er in einer anderen Zeit. In welcher, konnte ich nicht sagen. Aber in diesem Haus hatte es nur einen Kamin gegeben, in dem ein paar quadratische Ballen vor sich hin glühten. Kein elektrisches Licht oder gar eine Heizung. Zum Leben hatte diese Familie nur das Nötigste gehabt und die Wände bestanden aus zusammengefügten, unregelmäßig großen Steinen.
Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als mein Kopf unsanft gegen die Scheibe schlug. Papa überquerte eine schmale alte Brücke und der Kombi schlingerte wie ein Schiff auf hoher See. Mit müden Augen folgte ich dem trüben Wasser des Bachs und stutzte. Im Dickicht erkannte ich eine steinerne Brückenhälfte, dunkelgrün bewachsen mit Flechten und Moos – eine Ruine. Ich konnte meine Augen nicht so schnell wieder abwenden, wie ich wollte. Ich musste hinsehen. Das war nicht lieblich oder romantisch. Die Ruine sah – ja, sie sah unheimlich aus.
»Was ist das denn?«, fragte ich neugieriger, als mir lieb war.
»Oh, hier gab es mal eine Eisenbahnstrecke. Stillgelegt seit den Fünfzigern«, erklärte Papa aufgeräumt. »Nur die Brücken sind noch übrig geblieben.«
»Also sind die Fluchtwege auch versperrt«, grummelte ich und schloss erneut die Augen. Doch der Traum war nur noch fern, seine Farben verblichen. Jetzt lag das Baby unter der Brückenruine auf dem feuchten, lehmigen Waldboden und ich sah, wie meine weißen Hände nach ihm griffen, es behutsam aufhoben. Es war federleicht. Ich presste mein Ohr fest an den kleinen Leib, um zu hören, ob es noch atmete …
»Elisa? Schläfst du schon wieder?«
»Nein!«, rief ich schnell und löste hastig den Gurt, obwohl ich zu gerne erfahren hätte, wie der Säugling sich in meinen Armen anfühlte … Aber wir waren zu Hause. Die zuschlagenden Autotüren hallten in der Stille nach. Niemand außer uns war auf der Straße. Nur hinten, auf dem Feldweg, führte eine alte, bucklige Frau ihren Hund aus. Er drehte sich um und kläffte keifend, als er uns witterte. Wie sollte ich nur den Rest dieses Tages füllen? Was sollte ich um Himmels willen tun, wenn ich mit den Hausaufgaben fertig war?
Ich ließ meine Augen über unser Haus schweifen, das ich mir bis jetzt nur flüchtig angesehen hatte – ein hoch aufragender, eckiger Bau mit ausgebautem Giebeldach, großem Hof, Garagenhäuschen und einem riesigen quadratischen Rasenstück. Mama hatte bereits einen Beetstreifen entlang des Zaunes angelegt und unzählige Pflanzen in den Boden gesetzt. Wilder Wein rankte sich über die gesamte Vorderfront des Hauses und wucherte bis über die verwitterten Läden der kleinen Sprossenfenster. Das kannte ich schon aus Köln. Ich erschauerte, als ich an die farblosen Spinnen dachte, die im Weinlaub wohnten und sich ab und zu in mein Zimmer verirrt hatten. Noch waren die Dachfenster frei von Laub, aber die ersten Triebe versuchten schon, sich an den Fenstersimsen festzukrallen.
Der Garten endete auf der einen Seite direkt am Feld, das sich anhob und an den dunstigen Abendhimmel grenzte, als fiele man nach dieser Steigung ins Nichts. Oben auf der Kuppe reckten vier Apfelbäume ihre dünn belaubten Zweige wie verkrüppelte Hände in Richtung der matten Sonne.
Die Stille dröhnte in meinen Ohren.
»Na komm schon, Elisa.« Ich schrak zusammen. Papa stand immer noch neben mir.
»Gefällt es dir denn gar nicht?«, fragte er, als er die Haustür aufschloss.
»Doch. Es ist nur – nichts. Es ist okay.« Es war wirklich okay. Und den Wein konnte ich ja zurückschneiden.
»Hallo!«, rief Papa gut gelaunt in den kühlen Flur hinein. Ich fröstelte. »Hab früher Feierabend gemacht! So kann ich dir ein bisschen im Haus helfen und arbeite heute Nacht.«
»Schön«, hörte ich Mamas Stimme. Ihr Lockenkopf tauchte vor uns im Halbdämmer des Flurs auf. »Dann …« Sie stockte, als sie mich hinter Papa bemerkte. »Hallo, Ellie. Da bist du ja endlich.«
Ich rümpfte die Nase. Es roch durchdringend nach geschmortem Sellerie. Ich ging in die Küche und lupfte den Deckel des großen Topfes, der auf dem Herd stand. Puh. Gemüsesuppe. Angewidert wandte ich mich ab. Nicht einmal das Essen konnte diesen Tag retten.
»Hi«, sagte ich und wollte mich in den Wintergarten zurückziehen, doch ein Stapel Umzugskisten versperrte mir den Durchgang.
»Musst durchs Wohnzimmer gehen, Ellie«, rief Mama aus dem Flur, bevor sie Papa etwas zuflüsterte. Er lachte leise.
»Was ist denn hier los?«, fragte ich entrüstet. Im Wintergarten sah es aus wie in einem unaufgeräumten Partyzelt. Auf dem Boden standen offene Umzugskartons voller Dekomaterial und Geschirr und Besteck und Tischtücher. Die Hälfte der Glasfronten wurde bereits durch lange nachtblaue Vorhänge verdunkelt. Auf den äußeren Fenstersimsen standen schwere Terrakottatöpfe, in die Mama Rankgitter gesteckt hatte. Also noch mehr wilder Wein und noch mehr farblose Spinnen.
»Sehr hübsch«, brummte Papa, der aus dem Wohnzimmer in den Wintergarten trat und sich neugierig umsah. Er zog den Vorhang ein Stück weiter zu.
»Na ja«, sagte ich spitz. »Das liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Und was bedeutet das da?«
Ich zeigte auf das Sideboard, das mit Tellern, Gläsern und mehreren Flaschen Wein bestückt war.
»Umtrunk!«, verkündete Mama freudig und schob die Kartons mit ein paar gezielten Fußbewegungen zur Seite. »Heute Abend. Mit unseren neuen Nachbarn.«
Am liebsten hätte ich laut »Nein!« gebrüllt. Bitte nicht noch mehr Menschen, die mich anstarren. Ich halte das nicht aus.
»Ohne mich«, sagte ich leise. »Sorry, aber ich kann das nicht. Nicht heute.«
»Ellie …«, seufzte Mama und lächelte mir aufmunternd zu.
»Ich hab einen Berg Hausaufgaben zu erledigen und mir fallen jetzt schon die Augen zu, weil ich in diesem scheißstillen Haus nicht schlafen kann«, log ich. »Ich sage Guten Tag und mehr nicht. Okay?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, schnappte ich mir meine Schultasche und stürmte nach oben. Der »Berg« Hausaufgaben kostete mich exakt dreiundvierzigeinhalb Minuten. Ich hatte alles erledigt – und nicht nur das: Ich hatte es in Schönschrift getan, die Zwischenzeilen bunt unterstrichen und zum Geschichtsreferat sogar noch zwei Datengrafiken angefertigt. Mehr konnte ich nicht tun. Es war ja bereits mehr als genug.
Von Nicole und Jenny hatte ich immer noch nichts gehört. Ich angelte mir mein Handy aus der Schultasche. Wieder keine Funkverbindung. Stattdessen flackerte das Display unruhig vor sich hin. War nun etwa auch noch das Handy kaputt? Ich legte es auf die Fensterbank. Für eine Sekunde baute sich ein Funkbalken auf, dann erlosch das Licht komplett. Ich schloss das Akkukabel an. Kopfschüttelnd sah ich dabei zu, wie sich die Batterie auflud, im unruhigen Rhythmus des flimmernden Lichts.
Aber eine SMS trudelte nicht ein. Vielleicht hatten die beiden schon längst Nachrichten geschickt und sie kamen nur nicht an? Ich versuchte mir vorzustellen, wie es ihnen ohne mich erging. Jetzt war der Platz neben ihnen frei – der begehrte Fensterplatz schön weit weg von Lehrerpult und Tafel. Ich fragte mich, wie schnell wohl jemand nachrücken würde. Nicole und Jenny waren beliebt. Es konnte nicht lange dauern. Und es hätte mich nicht gewundert, wenn es ein Junge gewesen wäre.
Ich ging an eines meiner vielen Fenster und schaute hinaus, ohne etwas zu sehen. Unten rumpelte und polterte es wieder. Der ständige Geräuschpegel machte mich nervös. Trotzdem gähnte ich ohne Unterlass.
»Warum nicht?«, murmelte ich, als ich mich dabei ertappte, wie ich das Bett anstarrte. Schlafen war besser, als hier zu sein. Ich kuschelte mich mit knurrendem Magen in die weiche, duftende Decke und konnte mir gerade noch das Zopfgummi aus den Haaren ziehen, bevor die Müdigkeit mich überwältigte.
DER TEUFEL UND SEIN PFERD
»Und das ist Elisabeth, unsere Tochter.«
Papa trat drei Schritte nach hinten, schnappte sich mein Handgelenk und zog mich neben sich in den Wintergarten. Also war mein Plan, lautlos zu verschwinden, schon mal gründlich danebengegangen.
»Hallo«, sagte ich artig und griff nach den Händen, die mir entgegengestreckt wurden. Eine faltige Hand, die einem Greis mit Rübennase gehörte, unserem Nachbarn von links nebenan. Die gelben Finger einer Frau, die nach Nikotin roch, und die zupackenden Hände eines älteren Ehepaars, er in Karohemd und Bundfaltenhose, sie in einem rostroten knielangen Kostüm. Zwischen diesen Menschen wirkte Mama mit ihren Ringellocken und dem bunten Batikhemd wie ein Paradiesvogel. Die Augen der Frau im Kostüm huschten zwischen Papa und mir hin und her.
»Ja, die Tochter, das ist nicht zu übersehen«, lächelte sie. Ihre Hand zitterte leicht, als ich sie losließ. Sie setzte dazu an, noch etwas zu sagen, doch dann schloss sich ihr Mund wieder. Der Greis und die Raucherin wechselten gedämpft ein paar Worte.
Ich sah auf das Sideboard. Die Schnittchen und der Kuchen waren unberührt.
»Und Sie sind also Psychiater?«, fragte der Mann mit dem Karohemd.
»Ja«, erwiderte Papa ruhig. Schweigen breitete sich aus. Ich kannte diese Situationen schon. Es war immer so. Sobald Papa sagte, was er beruflich machte, verstummten alle. Als hätten sie Angst, in den nächsten Minuten in eine Zwangsjacke verfrachtet zu werden. Der Greis hustete und zeigte nach draußen, wo die Weinranken im schwülen Wind sachte das Glas der Scheibe kitzelten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!