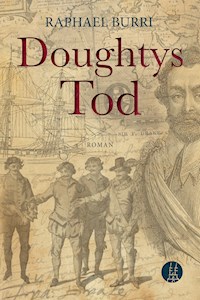
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Münsterverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mord im Namen Francis Drakes? Oder die Hinrichtung eines Aufrührers? Königin Elisabeth verlangt Antworten und beauftragt den jungen Walter Raleigh, sie ihr zu bringen. Der Fall: Der englische Edelman Thomas Doughty wurde in den fernen Gewässern der neuen Welt zum Tode verurteilt und geköpft. Richter und Initiator des Prozesses ist der berühmte Weltumsegler Francis Drake. Doch weshalb? Bald findet sich Walter Raleigh in einem Gespinst aus Lügen und Halbwahrheiten wieder und sieht sich konfrontiert mit einer möglicherweise erschreckenden Wahrheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raphael Burri
Doughtys Tod
Roman
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Prolog
I. Teil
II. Teil
III. Teil
IV. Teil
V. Teil
VI. Teil
VII. Teil
Epilog
Anhang
Die Doughty-Affäre
Nachwort
Dank
Personen
Glossar
Anmerkungen
Die Quellen
Impressum
1. Auflage September 2022
© Münster Verlag, Zürich und Raphael Burri
Verlag: Münster Verlag, CH-Zürich und D-Singen
Lektorat: Sibylle Liedtke
Coverdesign und Satz: Cedric Gruber
Klappentext: P.B.W. Klemann, Sibylle Liedtke
Druck und Einband: CPI Buch bücher.de GmbH
Printed in Germany
ISBN: 978-3-907301-42-5
elSBN: 978-3-907301-43-2
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Buchs darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags
reproduziert werden.
Verlagsanschrift:
Münster Verlag Deutschland
Werner-von-Siemens-Straße 22, D-78224 Singen
Tel: +497731-8380, [email protected]
www.muensterverlag.ch
Der Verlag dankt für die Unterstützung:
Kanton und Stadt Schaffhausen Kulturförderung
www.kulturraum.sh
IN MEMORIAM
MACHO
2002 – 2020
Plymouth: Start (13.12.1577) und Ziel (26.9.1580)
Die Insel Mogador. Der Matrose Fry wird von Eingeborenen entführt. (27.12.1577)
Kapverden. Doughty mit Wynter auf Mayo (28.1.1578), Kaperung der
Santa Maria
(31.1.1578).
Port St. Julian. Prozess und Hinrichtung Doughtys (2.7.1578).
Südpazifik: Untergang der
Marigold
(30.9.1578).
Bucht von Coquimbo: Richard Minivy fällt im Kampf gegen Spanier (19.12.1578).
Vor der Küste Equadors : Kaperung der
Nuestra Señora de la Concepción
(1.3.1579).
Bandasee: Die
Golden Hinde
gerät auf Grund (9.1.1580).
„O time most accurst!
'Mongst all foes that a friend should be the worst!“
„O schlimme Zeit! So tief kann nichts verwunden,
Als wird im Freund der schlimmste Feind gefunden!“
William Shakespeare (1564 - 1616),
Aus: Zwei Herren aus Verona
Prolog
Mittwoch, 2. Juli 1578
Port St. Julian
Patagonien
„Lebt wohl, ihr alle!“
Thomas Doughty stand auf dem hastig aus ein paar Planken zusammengezimmerten Schafott und liess seinen Blick über die hundertsechzig Mann der Expedition gleiten. Er musste seine Stimme erheben, um das Gekreische der Seevögel, das verhaltene Rauschen der Wellen am Strand, das Flappen der Zeltbahnen und vor allem den Wind zu übertönen.
„Gott weiss, dass ich keinem von euch etwas Schlechtes wollte!“
Gott wusste aber auch, dass er beileibe nicht alle in sein Herz geschlossen hatte. Dazu hatte er auch keinen Grund. Sarocold, der ihn erniedrigt und gepiesackt hatte; Brewer und Bright, die ihn beschimpft und verhöhnt hatten, Drake, der ihn gedemütigt hatte. Drake, der seinen Tod wollte. Drake…
Doughty durchlief ein leichtes Zittern, und er hoffte, dass die Männer es nicht bemerkten und fälschlicherweise für Furcht hielten. Er fürchtete sich nicht. Nicht mehr. Aber er fror. Es war bereits Juli, doch hier unten war es so kalt wie in Plymouth im tiefsten Winter. Und der Wind tat ein Übriges. Dieser ewige Westwind…
Ablandig, die ganze Zeit, als ob es kein Morgen gäbe. Gab es auch nicht. Nicht für Thomas Doughty. Nie hätte er sich träumen lassen, so sein Ende zu finden. Fröstelnd mitten im Sommer. Am Podex mundi, weiss Gott! Dabei hatte doch alles so gut angefangen, seine Einlage von eintausend Pfund schien eine lohnende Investition in dieses Unternehmen gewesen zu sein. Danach hätte er sich mit seinem Gewinn als wohlhabender Landedelmann schon in jungen Jahren zur Ruhe setzen können, hätte nie mehr als Soldat durch irische Marschen stolpern oder sich von Sir Christopher irgendwelche Briefe diktieren lassen müssen. Er hätte endlich Zeit gehabt für die schönen Dinge: Musik, Theater vielleicht, die Liebe… Das viele Geld hätte vielleicht auch eine politische Karriere befördert, Macht und Einfluss wären ihm sicher gewesen. Stattdessen stand er nun da, mit zweiunddreissig Jahren in seinem besten Mannesalter, und nahm Abschied von der Welt. Kurz sah er auf die Bucht hinaus und auf die vier Schiffe, die noch übrig waren. Die Pelican, die Elizabeth und die Marigold lagen nebeneinander und hingen mit dem Bug im Wind an ihren Ankertrossen. Etwas abseits wartete das Wrack der Mary darauf, an Land gesetzt und zu Brennholz zerlegt zu werden. Nur drei von ursprünglich fünf Schiffen würden durch die Magellan-Strasse in den Pazifik segeln. Wenn der Wind noch ein paar Strich mehr auf Nord drehte, hätten sie ideales Segelwetter. Raumer Wind und die Küste in Luv. Aber Drake hatte beschlossen, hier zu überwintern.
Doughtys Blick suchte den von Drake und fand ihn. Er versuchte darin etwas zu lesen, Hass, Befriedigung, Bedauern vielleicht, aber da war nichts. Drakes Miene blieb ausdruckslos, beinahe leer. Das Einzige, das Doughty erkennen konnte, war Geduld. Mühsam erzwungene und kaum beherrschte Geduld. Der Wind trieb ihm Tränen in die Augen, und Drakes gedrungene Gestalt verschwamm. Er fragte sich, ob er diesen Bauern wirklich je gemocht hatte. Er hatte ihn bewundert, ja. Er war von ihm fasziniert gewesen, sogar jetzt noch. Aber gemocht? Jedenfalls nicht so, wie er andere Männer gemocht hatte. Bevor er aufs Schafott gestiegen war, hatten sie sich umarmt. Die Intimität dieser letzten Berührung hatte ihn erschüttert, und nun kam er zu einer letzten Erkenntnis: Ganz egal, ob er Drake je geliebt oder auch nur gemocht hatte, nach seiner Mutter, die ihn geboren hatte, war Francis Drake der wichtigste Mensch in seinem Leben. Allein schon, weil er jetzt seinen Tod veranlasste. Doughty starrte auf den roten Fleck. Er blinzelte und der Fleck wurde wieder zu Drakes Bart. Dunklere Haarlocken zitterten im Wind, doch der grünäugige Blick blieb unverwandt und starr.
Dann ein kaum merkliches Nicken. Doughty straffe sich.
„Lebt wohl!“, rief er noch einmal, und vielleicht war den Männern nicht klar, ob er sie alle damit gemeint hatte oder nur ihren Anführer; er wusste es selbst nicht. Auf ein weiteres Nicken Drakes setzten die drei Trommler mit ihrem tristen Doppelschlag-Rhythmus ein. Doughty kniete sich nieder, faltete die Hände auf dem Richtblock, den jemand sich die Mühe gemacht hatte an Land zu bringen, und hob den Blick zum weiten Himmel.
„Herr, beschütze Elisabeth, unsere Majestät die Königin“, betete er, „und segne und beschütze England. In Deine Hände gebe ich meine Seele. – Amen.“
Dann legte er seinen Kopf auf den Richtblock.
Er war bereit.
Aus dem Augenwinkel sah er die Bewegung.
Er hatte sich irgendwann in den vergangenen Stunden gefragt, wer es tun würde. Ed Carberry vielleicht, der als Schiffsprofoss der Pelican amtete. Aber eigentlich war die Frage unbedeutend. Irgendeiner würde es tun. Irgendeiner der hundertsechzig Mann, die mit ihm bis hierher gesegelt waren. Irgendeiner würde es tun und sein Leben lang Stillschweigen darüber bewahren. Ein Mann, der nur seine Pflicht tat. Ein Mann, der Befehlen gehorchte. Jedenfalls würde es kaum einer der Gentlemen sein.
Wer immer es war, er tat es
jetzt.
Das Beil fuhr durch Doughtys Nacken. Sein Kopf löste sich vom Rumpf, fiel polternd auf die Planken des Schafotts, kullerte ins Geröll, blieb liegen.
Und für Thomas Doughty erstarb der Wind augenblicklich.
In alle Ewigkeit.
I. Teil
Walter Raleigh
„Amore et Virtute“
Oktober 1580
Richmond Palace
London
Alter vor Schönheit, dachte Staatssekretär Francis Walsingham mit einem Anflug von Selbstironie, als er Lordschatzmeister William Cecil Baron Burleigh den Vortritt liess. Mit achtundvierzig war er auch nicht mehr der Jüngste, und was seine Schönheit betraf, nun, die lag im Auge des Betrachters. Bis zur staatsmännischen Würde eines Burleigh, der ihm in seiner pelzverbrämten Robe und mit dem silberweissen Priesterbart voranschritt, fehlte ihm dann aber doch ein Stück.
Kaum hatten sie das Kabinett betreten, schloss der Gardist von aussen leise die Tür. Walsingham schauderte leicht, stellte verdrossen fest, dass im Kamin kein Feuer brannte und verfluchte im Stillen einmal mehr den Geiz seiner Königin. Elisabeth erwartete sie bereits.
„Francis Drake. Wir müssen über ihn reden, meine Herren“, begrüsste sie ihre beiden engsten Vertrauten und lud sie mit einer Geste ein, sich zu setzen.
„Das müssen wir allerdings, Ma’am“, sagte Lord Burleigh entschlossen und verneigte sich.
Nichts Gutes ahnend, erwies auch Walsingham seiner Königin die Reverenz. Seit Drakes triumphaler Rückkehr waren noch keine drei Wochen vergangen, und nun wirkte Elisabeth, als hätte er es geschafft, in dieser kurzen Zeit bei ihr in Ungnade zu fallen.
Während Burleigh umständlich Platz nahm, fragte Walsingham an niemand Besonderen gewandt: „Weiss man schon, wie hoch der Ertrag seiner Reise ausgefallen ist?“ Er selbst wusste es natürlich, sogar auf den Penny genau. Er stellte die Frage auch nur, um Elisabeth daran zu erinnern, dass sie dem Mann eine gewisse Dankbarkeit schuldete.
„Man spricht von einer Rendite von eins zu siebenundvierzig, nach Abzug aller Kosten“, kam Burleigh der Königin zuvor, nur um zu beweisen, wie gut er informiert war.
„Das ist allerdings exorbitant“, meinte Walsingham und setzte sich ebenfalls. „Bei Eurer Einlage in das Unternehmen von eintausend Pfund bringt Euch das siebenundvierzigtausend Pfund ein, Hoheit.“
Walsingham schielte schnell zu Burleigh hinüber, aber der liess sich nichts anmerken. Hängte wie stets sein Mäntelchen nach dem Wind. Drakes Erfolg aber ging ihm – zumindest politisch betrachtet – mächtig gegen den Strich.
Elisabeth verzog schnippisch den Mund. „Natürlich“, sagte sie. „Streng genommen sind es sogar siebenundfünfzigtausend1, wenn man Drakes persönliches Geschenk dazurechnet. Zuzüglich erfreut sich auch meine Staatskasse eines nicht unerheblichen Anteils an dem Gold.“
„Spanisches Gold, Ma’am“, gab Burleigh zu bedenken.
„Jetzt ist es mein Gold, Cecil.“
„Drake sei Dank“, warf Walsingham ein. Er konnte es nicht lassen, Burleigh eins auszuwischen, ausserdem hielt er Drake für einen Mann, der seine Unterstützung verdiente. „Und natürlich“, fuhr er fort, „hat die Reise auch ihn zu einem reichen Mann gemacht.“
„Daran ist wohl nichts Verwerfliches“, konstatierte die Königin in einem Anflug von Grosszügigkeit. „Wenn es einer verdient hat, dann er. Stellen Sie sich vor, meine Herren, einmal rund um den Globus! Das hat vor ihm noch keiner geschafft!“
„Und Magellan, Ma’am?“ Burleigh wieder, der alte Miesepeter.
Elisabeth konterte mit einem süffisanten Lächeln: „Der zählt nicht. Erstens hat der es nicht lebend nach Hause geschafft und zweitens war er kein Engländer. Drake aber gebührt die besondere Dankbarkeit seiner Königin.“
Das geht ja leichter als erwartet, dachte Walsingham und beugte sich vor.
„Ihr solltet ihn zum Ritter schlagen, Ma’am“, sagte er und lehnte sich wieder zurück, mit einem Seitenblick auf Burleigh, der sich leicht indigniert einen unsichtbaren Fussel von der Robe wischte.
„Ja“, sagte die Königin und hatte nun die volle Aufmerksamkeit der beiden Männer, denn ihre ganze Koketterie war mit einem Mal wie weggewischt. Bei Walsingham läuteten die Alarmglocken. Und tatsächlich fuhr die Königin nach einer bedeutungsschweren Pause fort: „Allerdings gibt es da ein Problem. Deshalb habe ich Euch rufen lassen, meine Herren.“
Burleigh seufzte: „Spanien, ich weiss.“
Die Königin sah ihn nur fragend an, sodass sich Burleigh genötigt sah, hinzuzufügen: „Was für uns eine…äh…Heldentat, ist für Spanien ein reiner Akt der Piraterie. Philip wird darauf bestehen, dass Drake als Pirat verhaftet und hingerichtet und die Beute zurückerstattet wird.“
Spielverderber, dachte Walsingham beinahe amüsiert. Er hatte von Anfang an mit Burleighs Widerstand gerechnet, aber er wollte noch abwarten, wie die Königin darauf reagierte, bevor er einschritt. Er war überrascht, als er sie kichern hörte.
„Das gefällt mir!“ rief sie aus und klatschte in die Hände. „Drake – mein Pirat. Und was das Gold betrifft, denke ich nicht, dass wir’s zurückgeben sollten, Cecil.“
„Jedenfalls…“, versuchte es Burleigh erneut und tastete sich mit seinen Worten vorsichtig über diplomatisches Glatteis, „wenn wir Drake zum Ritter schlagen…das wird den Spaniern nicht gefallen, Ma’am.“
Doch mit jedem Wort grub sich die Zornesfalte tiefer in Elisabeths Stirn.
„Nun ist’s aber genug!“, fauchte sie. „Mit meinen Untertanen verfahre ich immer noch, wie es mir gefällt, ohne die Spanier um ihre Meinung, geschweige denn um ihre Erlaubnis zu fragen!“
„Selbstverständlich, Ma’am“, nahm Burleigh die Zurechtweisung hin und schaffte es, dabei kein bisschen verlegen auszusehen, was ihm Walsinghams widerwillige Bewunderung eintrug.
„Unsere Politik funktioniert jedenfalls nicht schlecht“, warf der Staatssekretär ein.
Diese Politik bestand im Wesentlichen darin, auf den britischen Inseln den katholischen Kräften entschlossen entgegenzutreten – unter anderem auch durch Walsinghams stetig wachsendes Agentennetz – und im Übrigen auf dem Kontinent die protestantische Sache, seien es die Geusen in den spanisch besetzten Niederlanden, seien es die verfolgten Hugenotten in Frankreich, mehr oder weniger heimlich zu unterstützen.
„Bis jetzt sind wir damit durchgekommen, ja!“, schnaubte Burleigh ungehalten. „Eine offizielle Anerkennung und Würdigung von Drakes Taten aber kommt einer offenen Kriegserklärung so nahe wie es nur geht.“
„Was fürchtet Ihr?“, fragte die Königin ihren Lordschatzmeister.
„Ich fürchte nichts, ich gebe nur zu bedenken. Spanien hat die beste Armee der Welt, Ma’am.“
„Und ich habe die besten Seeleute der Welt, und um zu uns zu gelangen, müssen die Spanier immer noch über das Meer.“
„Gut gesprochen, Ma’am“, mischte sich Walsingham wieder ein. „Da es wohl so oder so zum offenen Krieg mit Spanien kommen wird, kann es nicht schaden, unsere Sea Dogs2 ein wenig zu ermuntern.“
„Indem ich Drake zum Ritter schlage?“
„Nun, wenn Ihr es nicht tut, Ma’am, dann werden sich nicht nur er, sondern auch Hawkins, Frobisher, Seymour und die anderen an Eure Undankbarkeit erinnern, und zwar dann, wenn man diese Männer am dringendsten braucht.“
Elisabeth stiess einen ungeduldigen Seufzer aus. „Und wenn ich es tue, kann der Schuss auch nach hinten losgehen.“
Walsingham war plötzlich beunruhigt.
„Wegen Spanien?“, fragte er.
„Wegen Thomas Doughty“, erwiderte Elisabeth müde.
„Thomas Doughty?“, fragte Burleigh und sah verwundert zu Walsingham. Doch dieser zuckte nur ratlos mit der Schulter.
„Sollten wir ihn kennen?“, fragte er scheinheilig, nur um zu sehen, ob Burleigh darauf eingehen würde. Dieser öffnete auch tatsächlich den Mund, schloss ihn aber wieder, ohne etwas zu sagen.
Erwischt, mein Lieber, dachte Walsingham, du willst also nicht zugeben, Doughty zu kennen. „Moment…“, sagte er und tat, als krame er in seinem Gedächtnis, „das ist doch ein Freund von Drake…“
„War“, unterbrach ihn Elisabeth.
„War?“
„Er ist tot. Drake hat ihn auf seiner Reise hinrichten lassen.“
Eine gedankenvolle Stille trat ein, in die Burleigh ein verhaltenes „Oh!“ fallen liess. Sowohl er als auch Walsingham überlegten fieberhaft, was sich aus dieser Eröffnung für Konsequenzen ergeben mochten und wie sie diese zu ihrem jeweiligen Vorteil nutzen konnten. Walsingham sprach als erster wieder.
„Weiss man, aus welchem Grund?“
Elisabeth sah ihn an und antwortete: „Einen Grund wird es wohl gegeben haben, aber das ist im Augenblick eher zweitrangig. Wichtiger ist die Frage, ob Drake überhaupt ermächtigt war, Doughty enthaupten zu lassen.“
„Ich verstehe nicht…Wenn er einen Grund hatte, dann…“ Ratlos brach er ab. Doch Burleigh, ganz Wolf im Schafspelz, war schon einen Schritt weiter.
„Ich nehme an, dieser Thomas Doughty war von vornehmer Geburt, Ma’am?“, fragte er beiläufig. Ein sinisteresLächeln erschien auf Elisabeths Gesicht.
„Ihr erstaunt mich immer wieder, mein lieber Burleigh. So schnell kommt Ihr selten auf den Punkt.“
„Genau“, sagte Walsingham. „Dieser Thomas Doughty war doch der Privatsekretär von Sir Christopher Hatton, nicht?“
„Richtig“, bestätigte Elisabeth.
Burleigh liess sich die Gelegenheit nicht entgehen: „Und Sir Christopher wiederum ist einer der Hauptinvestoren von Drakes Reise. Er wird wohl nicht sehr erbaut darüber gewesen sein, dass Drake seinem Sekretär den Kopf abschlagen liess.“
Walsingham legte ihm eine Hand auf den Arm und sagte liebenswürdig: „Der Profit wird ihn milde gestimmt haben, Cecil.“
Bevor Burleigh etwas erwidern konnte, sagte die Königin kalt: „Ich kann mir diese Milde nicht leisten, Walsingham. Thomas Doughty war von edler Geburt. Francis Drake ist es nicht.“
Burleigh nickte zustimmend. „Das ist in der Tat alarmierend. Es kann nicht sein, dass einfache Leute über Adlige zu Gericht sitzen und diese auch noch zum Tod verurteilen.“
„Es sei denn, sie haben die Befugnis“, schaltete sich Walsingham wieder ein. Das Ganzewürde also auf ein formaljuristischesHickhack hinauslaufen, ein Gebiet, auf dem er dem Lordschatzmeister nicht gewachsen war. Aber er würde seine und Drakes Haut so teuer wie möglich verkaufen. „Und wie Ihr wisst hatte Drake die Befugnis, Ma’am.“
„Er hatte weitreichende Vollmachten, gewiss. Aber ich muss wissen, ob er sie nicht missbraucht hat.“
„Missbraucht, Ma’am? Wieso hätte er das tun sollen?“
Es war Burleigh, der antwortete.
„Es gibt Leute, die sagen, Drake hätte sich in einer Privatfehde eines missliebigen Widersachers entledigt – dreist und vor aller Augen.“
„Wer sagt das?“, wollte Walsingham wissen.
„Doughtys Bruder.“
„War er dabei?“
„Oh, ja, das war er tatsächlich.“
Eine nachdenkliche Stille schloss sich an, in welcher alle die möglichen Konsequenzen erwogen. Zunächst dachten sie alle drei dasselbe: Wenn Doughtys Bruder durch die Weltgeschichte spazierte und als Augenzeuge überall herumposaunte, Drake habe an Thomas Doughty einen schnöden Mord begangen und dafür seine Vollmachten missbraucht, dann war Drake in argen Schwierigkeiten. Walsingham dachte ohne Punkt weiter: und dann hatte auch die Königin ein Problem, und damit ganz England. Burleighs Gedanken umgingen das augenscheinliche Problem, um gleich auf ein anderes zu stossen. Als Einziger im Raum wusste Burleigh um John Doughtys üblen Leumund, und er hatte nicht vor, dieses Wissen frühzeitig mit seiner Königin und dem Staatssekretär zu teilen. Jedenfalls war Burleigh klar, dass die Königin ihr Problem nicht lösen konnte, indem sie Drake aufs Schafott schickte; nicht allein aufgrund von John Doughtys Aussage. Ausserdem war Drake im Volk zurzeit zu beliebt, da kam ein öffentliches Verfahren so ohne Weiteres nicht in Frage. Elisabeth dachte in etwa dasselbe, ohne allerdings John Doughty in ihre Überlegungen einzubeziehen; er war nur ein weiteres Malheur in der ganzen Angelegenheit. Obwohl sie alle drei in unterschiedlichen Richtungen überlegten, kamen sie erstaunlicherweise zum selben Ergebnis. Es war Burleigh, der damit die Stille brach.
„Das bedeutet eine Untersuchung über die Umstände von Doughtys Tod“, sagte er.
„Genau, Lord Burleigh. Ich brauche Klarheit darüber, sonst weiss ich nicht, ob ich Drake zum Ritter schlagen oder aufhängen soll.“
„Wer soll die Untersuchung leiten, Ma’am?“, erkundigte sich Burleigh und kam mit überraschendem Tempo gleich zum nächsten heiklen Punkt. Walsingham ärgerte sich darüber und argwöhnte, dass Burleigh bereits einen geeigneten Ermittler in petto hatte, der ihm sicherlich das gewünschte Untersuchungsergebnis liefern würde. Das durfte er nicht zulassen. Er erschrak, als die Königin antwortete: „Das überlasse ich ganz Euch.“
Wer war gemeint? Nur Burleigh? Oder sie beide? Walsinghams Verunsicherung dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, bis er sich klar wurde, dass die Königin kaum sie beide zu dieser Unterredung einbestellt hätte, wenn sie vorhatte, das Feld ausschliesslich Burleigh zu überlassen. Doch bevor er etwas sagen konnte, sprach schon wieder der Lordschatzmeister.
„Es müsste jemand sein, der in dieser Sache weder für Drake noch für Doughty Partei ergreift; jemand mit klarem Blick auch für die politischen Aspekte der Angelegenheit und mit diplomatischem Geschick; aber auch mit dem nötigen Sachverstand in militärischen und seemännischen Belangen sowie aus eigener Erfahrung vertraut mit der Situation als Kommandant in feindlichen Gewässern. Da er zahlreiche Leute, darunter Drake selbst, einer Befragung wird unterziehen müssen, sollte er über eine gewisse natürliche Autorität verfügen. Zumindest sollte er Drake ebenbürtig sein.“
„Solche Leute wachsen nicht eben an Bäumen, wollt Ihr wohl sagen“, brachte es Elisabeth auf den Punkt.
Und diesmal war Walsingham zur Stelle.
„Ich wüsste jemanden, der in Frage käme, Ma’am“, sagte er. „Mehr noch, er wäre geradezu ideal. Er ist zwar noch recht jung, so um die dreissig, von adliger wenn auch unbegüterter Herkunft, war aber schon mit siebzehn als englischer Agent und Söldner in Frankreich, wo er für die Hugenotten kämpfte. Er hat auch seemännische Erfahrung, war vor zwei Jahren in Westindien. Zurzeit kommandiert er eine Kompanie unter Lord Deputy Grey in Irland, ist also sozusagen ein Waffenbruder von Drake, der ja auch in Irland gedient hat. Er ist gebildet, ehrgeizig, klug und ein Mann von grossem Charme.“
Während sich Burleighs Miene immer mehr verfinsterte, leuchtete das der Königin geradezu auf, als hätte sie auf diese Intervention Walsinghams nur gewartet. Sie lächelte ihren Staatssekretär an und fragte: „Und wie heisst dieser von Gott derart gesegnete Wunderknabe?“
Samstag, 19. November 1580
Barn Elms
Walter Raleigh zog sich den Hut tiefer ins Gesicht und achtete sorgsam darauf, dass sein gestärkter Kragen ganz vom Mantel bedeckt war, damit er nicht nass wurde. Hinter sich hörte er die Ruderdollen knarren, ringsumher plätscherte ein aufdringlicher Regen ins Flusswasser und übertönte das schwere Atmen der beiden Männer an den Riemen, die das Mietboot gemächlich themseaufwärts trieben. Ein verhaltenes Husten des Bootssteurers, der ansonsten wie die meisten Flussschiffer ein schweigsamer Mann war. Am Morgen noch hatte sich Raleigh auf eine Bootsfahrt im Herbstnebel gefreut, doch gegen Mittag hatte es zu nieseln begonnen und vor zwei Stunden hatte es sich so richtig eingeregnet, was das Ganze nun zu einer äusserst unerquicklichen Angelegenheit machte.
„Barn Elms, backbord voraus, Sir“, liess sich der Bootsteurer vernehmen. Raleigh sah hoch und konnte durch die Regenschleier und das kahle Geäst der Bäume, die das Flussufer zu seiner Linken säumten, schemenhaft ein stattliches Anwesen erkennen. Auf einer weiten Rasenfläche erhob sich im Zwielicht ein grosser zweistöckiger Ziegelbau von fast perfekter Symmetrie. Rechts und links traten am Haupttrakt zwei erkerartige Vorbauten mit drei Seiten eines Achtecks aus der Fassade; diese Ausluchten erhoben sich wie Wehrtürme in einer Festungsmauer bis zu einer weissen Balustrade, über der sich ein Walmdach mit mehreren Kaminen erhob. Der trutzige Charakter des Hauses wurde etwas gemildert durch eine Reihe aus neun hohen Fenstern, die sich auf jedem Stockwerk über Ausluchten und die Fassade dazwischen zog. Ein harmonischer Bau, in dem sich wehrhafter Stolz mit Leichtigkeit verband.3
Hier also wohnte einer der mächtigsten Männer Englands, wenn nicht vielleicht der mächtigste, mit nichts über sich als Gott und der Königin. Raleigh empfand leises Unwohlsein. Nicht dass er sich fürchtete, er war ein treuer Untertan der Krone wie nur sonst wer und hatte in Irland seine Pflicht erfüllt, die beileibe nicht nur angenehm gewesen war. Aber so plötzlich ins Blickfeld der allerobersten Kreise und in den Dunstkreis des Hofes zu geraten, fühlte sich merkwürdig an. Seit ein berittener Bote in sein Feldlager in Smerwick geprescht war und ihm den Brief mit der Aufforderung, sich umgehend nach London zu begeben, in die Hand gedrückt hatte, war kaum eine Woche vergangen. Froh, von Grey, Mackworth und den Scheusslichkeiten in Smerwick wegzukommen, war er der Aufforderung nur zu gerne gefolgt. Da in dem Brief aber keinerlei erhellende Begründung gestanden hatte, tat sich allerdings die Frage auf: Was wollten die am Hofe bloss von ihm?
Das Boot näherte sich nun dem Flussufer, und Raleigh bemerkte, wie vom Haus her eine Gestalt über den Rasen durch die Regenschleier hastete, auf die Stelle zu, an der ihr Boot gleich anlegen würde. Man hatte ihn also bereits bemerkt. Raleigh strich sich über den sorgfältig gestutzten, modischen Bart und zwirbelte die Spitzen seines Schnurrbarts zurecht. Die Gestalt, ein Diener in Livree, erreichte das Ufer noch vor dem Boot, das mit dem letzten Riemenschlag sanft heranglitt. Raleigh erhob sich, bezahlte den Bootsführer und liess sich von dem Diener an Land helfen, der ihm auch gleich über die Wiese und ins Haus voranging. Kaum war Raleigh durch die Tür und in der Halle, trat auch schon ein weiterer Diener heran, nahm ihm Hut und Mantel ab und verschwand mit dem klitschnassen Zeug irgendwohin, wo es vermutlich warm und trocken war.
„Bitte hier entlang, Sir.“
Raleigh folgte seinem Führer die Treppe hoch in den oberen Stock, wo der Bedienstete sachte an eine Tür klopfte.
„Ja, bitte?“, ertönte es von drinnen, worauf der Page antwortete: „Captain Raleigh ist hier, Sir.“
Nur mit halbem Ohr registrierte Raleigh, dass ihn der Diener mit seinem militärischen Rang angekündigt hatte.
„Soll reinkommen!“
Der Page liess Raleigh eintreten und schloss die Tür hinter ihm. Ein Arbeitszimmer, konstatierte Raleigh. Volle Bücherschränke an den Wänden, überall Akten und Papiere, lose und in Stapeln, ein Ort, an dem gelesen und geschrieben wurde. Spätes Novemberlicht fiel durch ein Bleiglasfenster und kämpfte vergebens gegen den Schein eines halben Dutzends Kerzen und des munteren Feuers im Kamin, vor dem zwei gepolsterte Stühle standen.
„Walter Raleigh!“, ertönte es von einem grossen überfüllten Schreibtisch her.
Raleigh stand immer noch bei der Tür, verbeugte sich und erwiderte ehrerbietig: „Sir Francis.“
„Immer herein in die gute Stube. Kommen Sie, setzen Sie sich ans Feuer. Ein Glas Wein?“
„Gern.“
Francis Walsingham erhob sich, schenkte aus einer Karaffe zwei Gläser Wein ein, kam damit um den Schreibtisch herum und reichte Raleigh eines davon.
„Danke ergebenst, Mylord“, sagte Raleigh und setzte sich.
Die Fältchen um Walsinghams Augen verdichteten sich zu einem Schmunzeln, während er sich auf den zweiten Stuhl niederliess. „Nicht so förmlich, Raleigh. Zum Wohl.“
Sie hoben ihre Gläser und tranken einen Schluck. Dann wurde der Staatssekretär ernst.
„Wie stehen die Dinge in Irland?“, erkundigte er sich.
Raleighs Blick verlor sich kurz in den züngelnden Flammen des Kamins. „Smerwick war die Hölle, Sir“, sagte er leise.
„Sie haben getan, was Sie tun mussten.“
„Es war ein Massaker.“
„Dass es Ihnen keinen Spass gemacht hat, spricht für Sie, Raleigh.“
Raleigh wusste darauf nichts zu sagen. Er war froh, dass Walsingham zur Sache kam, als er fortfuhr: „Umso mehr wird es Sie vielleicht freuen, dass ich Sie für einige Zeit von Ihrem Dienst in Irland entbinde.“
Raleigh sah mit einem Ruck vom Feuer auf und Walsingham direkt ins Gesicht.
„Ich soll hierher nach England zurück, Mylord?“
„Nur vorübergehend.“
„Um was zu tun?“
Walsingham stellte sein Glas ab und wurde auf einmal sehr geschäftsmässig. „Sie sollen eine Untersuchung führen“, sagte er und setzte nach einer kurzen Pause hinzu: „Kennen Sie Francis Drake?“
Raleigh zuckte die Schultern. „Ich bin ihm persönlich nie begegnet, falls Ihr das meint. Aber ich habe natürlich von ihm gehört. Seit seiner Weltumsegelung ist er ein Volksheld. War vorher mehrmals in Westindien und auch in Irland. Mehr weiss ich eigentlich nicht“, fasste er seinen Kenntnisstand zusammen.
Doch Walsingham schien durchaus zufrieden.
„Gut“, sagte er, zögerte kurz und fuhr dann fort: „Auf seiner Weltumsegelung kam es zu einem…nun ja…bedauerlichen Zwischenfall. Drake liess einen Gentleman namens Thomas Doughty hinrichten, und jetzt weiss die Königin nicht, ob sie ihn für seine Verdienste zum Ritter schlagen oder wegen Überschreitung seiner Befugnisse hängen soll. Ihre eigenen Worte. Tja, und nun ist es der Wunsch ihrer Majestät, dass die näheren Umstände, die zu Doughtys Enthauptung geführt haben, untersucht werden.“
„Von mir?“, fragte Raleigh mit einem überraschten Stirnrunzeln. „Aber ich war nicht dabei.“
„Das macht Sie umso objektiver“, erwiderte Walsingham knapp, erhob sich und ging zu seinem Schreibtisch, wo er nach einer Aktenmappe aus abgewetztem Leder griff. „Hier sind Memoranden und einige andere Dokumente die Angelegenheit betreffend sowie eine Liste mit Namen – Leute, die Sie befragen können, inklusive Drake. Teilen Sie mir Ihre Wahl der Zeugen so schnell wie möglich mit, es wird dafür gesorgt, dass sie sich zur von Ihnen gewünschten Zeit einfinden.“ Damit reichte er Raleigh die Mappe und bemerkte, dass Raleigh plötzlich blass geworden war.
„Ist Ihnen nicht gut?“
Raleighs Stirn glänzte feucht. In Gedanken schien er ganz woanders.
„Mr. Raleigh?“
„Wie? …Nein…es ist nur…“ Raleigh grinste schief. „Enthauptet, sagtet Ihr…Ich habe mich nur gefragt, wie es sich wohl anfühlt, wenn…“
„Wenn die Axt in den Nacken fährt und sich der eigene Kopf vom Rumpf löst?“, vollendete Walsingham den Satz.
Wieder zuckte Raleigh mit den Achseln. „Ja. Ich meine, in Smerwick haben wir sechshundert einen Kopf kürzer gemacht – Was dachten diese Männer in dem Augenblick? Was empfanden sie?“
War es die Beklemmung von Schuldgefühlen? War es reine wissenschaftliche Neugier? Raleigh wusste es selbst nicht. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem.
Walsingham schüttelte leicht den Kopf und meinte: „Ich bin mir sicher, dass Sie das nicht erfahren wollen.“ Und aus einer Laune heraus fügte er hinzu: „Ohne Zweifel ist das Beil des Henkers eine scharfe Medizin, aber es heilt so gut wie alle Krankheiten.“
Raleigh nickte und verzog das Gesicht. „Wohl wahr. Dann scheint dieser Doughty ja ein gesunder Mann zu sein. Ein bisschen tot, aber gesund. Womit hat er sich diese…Heilung denn verdient?“
Walsingham ging nicht auf Raleighs Sarkasmus ein.
„Hochverrat. Und Hexerei. So lautete die Anklage“, erklärte er knapp.
Raleigh riss die Augenbrauen hoch. „Hexerei? Drake hat ihn allen Ernstes der Hexerei bezichtigt?“
„Es scheint so. Was allerdings genau dahintersteckt, sollen Sie eben herausfinden.“
Merkwürdig, dachte Raleigh, dieser Doughty musste ja ein bedeutender Mann gewesen sein, wenn die Krone eigens wegen ihm eine Untersuchung gegen den allseits bewunderten Drake anstrengte. Nur hatte er noch nie etwas von Doughty gehört. Oder war Drake etwa in Ungnade gefallen, und jetzt suchte man einen Grund, um ihn abservieren zu können? In diesem Fall aberwürde er, Raleigh, als ahnungsloser Handlanger füreine Intrigebenutzt werden, eine Intrige in den allerhöchsten Machtgefilden. Und das war gefährlich, sehr gefährlich. Vor allem für Raleigh selbst.
Vorsichtig fragte er: „Ist Doughty denn so wichtig?“
„An sich nicht“, gab sich Walsingham ganz offen. „Aber er war von edler Geburt, während Drakes Vater nur Pastor ist…ein kleiner, unbedeutender Mann aus dem gemeinen Volk. Und wenn es Schule macht, dass Pfarrersöhne Adligen den Kopf abschlagen, dann ist der Anfang vom Ende schon sehr weit fortgeschritten, finden Sie nicht?“
Das war natürlich ein Argument.
„Andererseits hatte Drake vielleicht gute Gründe, Mylord“, gab Raleigh zu bedenken.
„Finden Sie sie. Und finden Sie heraus, ob diese Gründe womöglich so schwer wogen, dass Drake gezwungen war, seine Befugnisse zu überschreiten.“
Interessant, fand Raleigh. Das deutete vielmehr darauf hin, dass Walsingham Drake entlastet sehen wollte. Aber ob nun hier irgendwelche Ränke geschmiedet wurden oder nicht, er hatte jedenfalls vom Staatssekretär und Mitglied des Kronrats einen Auftrag erhalten. Seine Ausführung zu verweigern,wäre eine Majestätsbeleidigung an der Grenze zum Verrat und verbot sich von selbst.
Walsingham war wieder an den Schreibtisch getreten. „Für die Zeit, die Sie dazu benötigen, wird Ihnen ein Haus in Devon nördlich von Plymouth zur Verfügung gestellt.“ Er klaubte einen Zettel aus den Papierbergen und reichte ihn Raleigh. „Hier ist die Adresse; begeben Sie sich noch in dieser Woche dorthin. Allein.“
„Allein, Mylord?“
„Ja, allein. Ohne Dienerschaft. Sie werden dort gut versorgt sein. William Parker und seine Frau Eleanor kümmern sich um das Haus; sie haben drei kleine Kinder, Edward, George und Jane. Dann sind da noch John Babbage, der Gärtner und seine Frau Annie, die Köchin; ihr Sohn Tom ist der Stallbursche, seine Schwester Molly, das Dienstmädchen. Diese Leute werden sich gut um Sie kümmern.“
Walsingham nahm ein weiteres Schriftstück zur Hand, ein Brief dem Anschein nach, jedenfalls sauber eingeschlagen und mit Siegel versehen.
„Dieses Dokument hier gibt Ihnen alle nötigen Vollmachten, Zeugen vorzuladen und zu befragen, Dokumente einzusehen und so weiter. Wenn Sie darüber hinaus etwas benötigen, schicken Sie mir eine Nachricht. Nicht nach Whitehall, sondern an meine Adresse an der Seething Lane, das ist diskreter. Schicken Sie auch Ihre Berichte dorthin. Noch Fragen?“
„Nein, Mylord.“
Da die Besprechung offenbar zu Ende war, erhob sich Raleigh und nahm die Vollmacht entgegen.
„Nun, dann ist soweit alles gesagt“, meinte Walsingham, reichte ihm die Hand und sah ihm plötzlich sehr eindringlich in die Augen. „Ausser vielleicht… Ich persönlich würde es begrüssen, wenn diese Untersuchung zutage bringt, dass sich Drake nichts Unrühmliches hat zuschulden kommen lassen. Die Zeiten sind gefährlich; England sieht sich einer katholischen Übermacht gegenüber, und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis es zum Krieg mit Spanien kommt. Dann brauchen wir Männer wie Drake. Wie Sie eben selbst gesagt haben: Er ist ein Volksheld. Und in Zeiten der Not sollte man Volkshelden nicht aufs Schafott schicken. In diesem Sinne: Viel Glück, Raleigh.“
Erst jetzt gab er Raleighs Hand wieder frei.
Samstag, 19. November 1580
Barn Elms
Nachdem Raleigh gegangen war, blieb Walsingham noch lange am Kamin sitzen und starrte in sein leeres Weinglas. Er dachte an Drake. Und er dachte an Raleigh. Verglich die beiden mit einander. Das dunkel gelockte Haar, der rötliche Bart, der kluge Blick. Und das waren sie auch schon, die Gemeinsamkeiten. Waren Drakes Augen grün, leuchteten Raleighs in einem hellen Graublau aus einem länglichen Gesicht mit schmaler Nase. Raleigh war unwidersprochen ein gutaussehender, schlanker junger Mann von achtundzwanzig Jahren, während Drake gut zehn Jahre älter, einen halben Kopf kleiner und von wesentlich robusterem Körperbau war, mit einer fleischigen Nase in einem gutgenährten, rechteckigen Gesicht, in das sein Seemannsleben als Stirnfalten und Krähenfüsse eingegraben war. Beiden Männern, konstatierte Walsingham, war eine gewisse Eitelkeit zu eigen, doch war Drakes Kleidungsstil so robust wie der ganze Mann, erst recht verglichen mit der modischen Extravaganz eines Raleigh. Walsingham selbst nahm sich daneben in seiner schlichten schwarzen Kleidung und der weissen Halskrause wie eine Nebelkrähe aus.
Und diese Nebelkrähe machte sich Gedanken. Walsingham fragte sich, ob er mit Raleigh eine gute Wahl getroffen hatte. Die Enthauptungen in Smerwick hatten ihn offensichtlich mitgenommen. Da war es naheliegend, dass ihn die Beschäftigung mit einer weiteren Enthauptung über Gebühr strapazierte und ihn gegen den Mann, der sie verursacht hatte, einnahm.
Andererseits war Raleigh keine Memme und intelligent genug, der Angelegenheit mit Objektivität zu begegnen.
Wie auch immer, es half nichts, das Wild war auf, das Spiel hatte begonnen.
Am selben Abend
Middle Temple
London
Aha!
Aha, aha.
Ojemine!
Walter Raleigh schlug sich die Hände vors Gesicht und seufzte. Er sass auf der Bettkante seines Zimmers im Gästehaus des Middle Temple, jener Anwaltskammer, in der er sich vor fünf Jahren eingeschrieben hatte, und starrte völlig ratlos auf die Papiere aus Walsinghams Aktenmappe, die er vor sich auf dem Boden ausgebreitet hatte. Eigentlich gab es kaum einen passenderen Ort als den Middle Temple, um sich mit Schriftstücken dieser Art zu befassen: Schriftliche Zeugenaussagen. Doch die Ironie, die darin lag, bemerkte Raleigh nicht, dazu war er viel zu befremdet durch das, was er da sah. Dutzende loser Blätter und Zettel, beschrieben in unterschiedlichen Handschriften, die in keinem logischen Zusammenhang zu stehen schienen. Raleigh nahm ein Blatt zur Hand und las:
Gewisse Reden, geführt von Thomas Doughty an Bord des Vlieboots, in Gegenwart von mir, John Sarocold, und anderen.
Erstens, bei seinem Anbordkommen erklärte er, dass er als Gefangener geschickt wurde und als einer, der verdächtigt werde, ein Zauberer und Verräter am General zu sein, wovon er sagte, er sich in England vor denen, die auf jene wetteten, die ihn anklagten, reinwaschen werde, wenn das Gesetz ihm diene, so er wisse, dass es das tue, und zu deren grosser Schande.
Zweitens, machte er ein grosses Gerede, was für eine grosse Hilfe er unserem General in London in der Förderung dieser Reise gewesen sei, sowohl mit seinem Geld als auch mit dem Aufsuchen einiger der Besten Englands, was dieser nicht so leicht zustande gebracht hätte, wenn er mit seinen Freunden nicht so eifrig gewesen wäre.
Drittens, hielt er gewisse Reden über das grosse Vertrauen, welches unserem General in Irland vom Earl of Essex entgegengebracht wurde durch die Vermittlung des genannten Thomas Doughty, an den ganzen Inhalt dieses Geredes kann ich mich nicht deutlich erinnern.
Viertens, da gab es eines Tages nach dem Essen ein gewisses Gespräch betreffend solchen, die in irgendeiner Weise Feinde oder Verräter entweder an unserem General oder an der Reise wären, worauf ich das Glück hatte zu erwidern, dass unser General gut daran täte, sie so zu behandeln, wie Magellan es getan hatte, nämlich sie aufzuhängen als Bespiel für den Rest. Worauf Mr. Doughty antwortete: Immer mit der Ruhe, seine Befugnis reicht nicht so weit wie jene Magellans; denn, sagte er, ich kenne seine Befugnisse so gut wie er selbst. Und das Hängen ist was für Hunde und nicht für Männer. Dieses und solcherart Gerede gebrauchte er an Bord des Vliebootes in meiner Gegenwart.
Durch mich, John Sarocold
Raleigh konnte damit nichts anfangen. Er las es ein zweites Mal und stellte fest, dass der gehässige Unterton auf einen Verfasser deuten liess, der Thomas Doughty nicht gerade wohlgesonnen war. Aber was konnte der eigentliche Inhalt anderes sein als blosser Tratsch? Doch es war von ernsthafter Hand zu Papier gebracht worden. Es musste also eine Bedeutung haben. Und einen Zweck.
Raleigh rief sich in Erinnerung, was er wusste, oder vielmehr was Walsingham geruht hatte, ihn wissen zu lassen. Nebst den mündlichen Ausführungen des Staatssekretärs fand sich in dessen Mappe nur ein äusserst dürftiges Memorandum:
Md., die näheren Umstände zu untersuchen, welche zur Hinrichtung des Mr. Thomas Doughty, Gentleman, in der Bucht Port S. Julian am ii. Juli im Jahre 1578 führten, und ob Mr. Francis Drakes Vollmachten und Befugnisse in dieser Sache den Anforderungen entsprachen.
Auf Francis Drakes nun vielbejubelter Weltumsegelung hatte sich ein Mann namens Thomas Doughty befunden, den Drake hatte hinrichten lassen. Wegen Verrat und Hexerei. Es gab also eine Bestrafung, und es gab eine Anklage. Wenn die Anklage zur Bestrafung geführt hatte, musste auch ein Urteil erfolgt sein. War es also möglich, dass es eine Gerichtsverhandlung gegeben hatte?
Raleigh kannte Drake nicht, konnte daher auch nicht abschätzen, wie der Mann in Krisensituationen verfuhr. Aber wenn jemand aus seiner Besatzung des Verrats bezichtigt und hingerichtet wurde, lag es nahe anzunehmen, dass vor der Exekution ein entsprechendes Urteil durch eine Art Gericht, von wessen Gnaden auch immer, ergangen sein musste. Wenn das stimmte, hatte Raleigh dann hier auf dem Fussboden seiner Kammer Zeugenaussagen liegen, die vor diesem Gericht gemacht worden waren?
Raleigh las John Sarocolds Aussage ein drittes Mal. Wer war mit General gemeint? Nun, Drake natürlich, der Oberkommandierende. Drake war mit nur einem Schiff zurückgekehrt, das hatte Raleigh irgendwo aufgeschnappt. Aber zu Beginn der Sache waren sicherlich mehrere Schiffe beteiligt gewesen. Darunter ein Vlieboot. Raleigh kannte den Schiffstyp niederländischen Ursprungs, ein hochseetüchtiger Dreimaster, ideal als Versorgungsschiff.
Er griff sich ein anderes Blatt, auf dem er das Wort Vlieboot erkannt hatte. Zuoberst stand dort:
Berichte und Artikel geäussert an Bord des Vlieboots von Thomas Doughty, wie folgt.
Punkt eins. Erstens, als der genannte Thomas Doughty auf dem Vlieboot, Swan genannt, war, beteuerte er, dass er der Erste war, der unseren General beim Earl of Essex zu Ansehen brachte.
Zeugen, Jhon Sorocold, Gregory Cary, Frances Flecher.
Das Vlieboot hiess also Swan. Einer Eingebung folgend erhob sich Raleigh, stieg über die ausgebreiteten Papiere und trat an den kleinen Tisch, auf dem Feder, Tinte und Papier bereit lagen. Dort notierte er sich:
Schiffe:
Swan, Vlieboot
Er wusste nicht, ob ihn das irgendwie weiterbringen würde, aber er hatte zumindest das Gefühl, einen Anfang gemacht zu haben. Eine vollständige Liste der beteiligten Schiffe würde insofern hilfreich sein, als dass er sich ein Bild von den Umständen machen konnte. Wenn er mit den Gegebenheiten vertraut war, konnte er auch die Ereignisse besser beurteilen.
Er betrachtete die Namen der Zeugen, Leute, die offenbar auf der Swan gefahren waren. Trotz der unterschiedlichen Schreibweise war Jhon Sorocold offensichtlich mit John Sarocold identisch; verbindliche Regeln gab es ja nicht, er hatte seinen eigenen Namen in den unterschiedlichsten Versionen geschrieben gesehen: Raleigh, Rawley, Ralegh oder Rawleigh.
Wer war dieser Sarocold? In welcher Funktion fuhr er an Bord der Swan? Hatte Walsingham nicht etwas von einer Liste mit Namen gesagt? Raleigh wandte sich wieder den Papieren auf dem Boden zu, suchte und fand zwei Bögen Papier, die ganz nach einer Liste aussahen. In zwei Spalten waren zahlreiche Namen aufgeführt, beginnend mit:
Francis Drake, Gll. John Wynter, Cpt.
John Thomas, Cpt. decd.John Chester, Cpt.
Thomas Moone, Crpt. Thomas Doughty, Cpt. decd.
Thomas Cuttle, Mstr. William Markham, Mstr.
Nicholas Anthony, Mstr. decd. John Sarocold, Mstr.
Die Abkürzungen waren für Raleigh zunächst etwas kryptisch. Cpt. zumindest bedeutete Captain, aber es war nicht klar, ob damit Kapitän oder Hauptmann gemeint war. Als Anführer eines Trupps Soldaten war man nicht notwendigerweise auch Schiffskapitän. Das Crpt. hinter Thomas Moon mochte ein simpler Schreibfehler sein, was allerdings dem Gesamteindruck der Liste widersprach, der von einer fast besessenen Sorgfalt zeugte. Das Gll. hinter Drakes Namen interpretierte Raleigh als Generall, einer häufigen Schreibweise für General. Das Mstr. konnte Mister oder Master bedeuten, Raleigh entschied sich für das zweite, da es den Namen nachgestellt war und somit eher auf einen Titel als auf eine Anrede verwies. Demnach wäre Sarocold der Master der Swan gewesen, der Mann, dem die Schiffsführung und Navigation oblag.
Raleigh suchte die Liste nach den anderen Namen der Zeugenaussage ab und fand sie, allerdings an weit voneinander entfernten Stellen.
Gregory Cary, Gent.
Francis Fletcher, Rev.
Ein Gentleman und ein Reverend? Weil ihm dazu nichts mehr einfiel, zählte Raleigh die Liste durch und kam auf insgesamt hundertfünfundsechzig Namen, wobei hinter etlichen davon die Abkürzung decd. stand. Raleigh grübelte nicht näher darüber nach, viel mehr beschäftigte ihn die Frage, was er mit dieser Liste anfangen sollte.
„Eine Liste mit Namen – Leute, die Sie befragen können“, hatte Walsingham gesagt. Raleigh schüttelte den Kopf. Er konnte doch unmöglich über hundertsechzig Personen einer Befragung unterziehen! Erst recht nicht, wenn die Angelegenheit so dringlich war, wie der Staatssekretär hatte durchblicken lassen. Er würde also eine Auswahl treffen müssen. Aber woher sollte er wissen, wer auf dieser Liste etwas Wesentliches zur Aufklärung beitragen konnte? Er würde sich wieder den schriftlichen Zeugenaussagen zuwenden müssen. Mit etwas Glück fand er darin Aussagen von Substanz und die Namen der Männer, die sie gemacht hatten.
Raleigh seufzte und machte sich an die Arbeit.
Zwei Stunden später hatte er sämtliche Aussagen zweimal durchgelesen und sich die Namen der Zeugen sowie ihre Häufigkeit notiert. Mit Abstand am häufigsten erschien Francis Fletcher, der nicht weniger als fünfzehn Aussagen unterschrieben hatte, die meisten zusammen mit anderen, einige aber auch als einziger.
Raleigh setzte sich an den Tisch und begann mit einer neuen Liste mit der Überschrift:
Zur Befragung im Fall Doughty aufzubietende Zeugen
Darunter setzte er als erstes den Namen:
Francis Fletcher
Er überlegte kurz, ob er auch Sarocold aufbieten sollte, entschied sich dann aber dagegen, da Sarocold wohl so ziemlich das Gleiche erzählen würde wie Fletcher. Denn Sarocold hatte nur wenige Aussagen unterschrieben, die nicht auch von Fletcher bestätigt worden waren. Die meisten Aussagen schienen sich ohnehin durch einen Mangel an Relevanz auszuzeichnen. Doughty sagte dies, Doughty sagte jenes. Tatsächlich bezogen sich die Aussagen nur darauf, was Doughty den lieben langen Tag so gesagt, und nicht darauf, was er getan hatte. Und im Wenigsten davon konnte Raleigh auch nur ein Körnchen von Verrat oder Aufruhr erkennen. Es gab jedoch auch durchaus interessante Aussagen. Beispielsweise eine seitenlange, wirr zusammengestoppelte Geschichte, deren Einzelheiten unbestreitbar etwas Prickelndes hatten. Leider wurde sie von keinem namentlich genannten Urheber bestätigt. Ebenso wenig wie jene andere, in welcher Fletcher als Person der Handlung auftauchte:
Diese Dinge wurden von T. D. auf der Pelican gesagt und beschlossen
Inprimis, dass Thomas Doughty, als er aufgefordert wurde, dem Kapitän mitzuteilen, dass da welche waren, die vorschlugen, ein Schiff gegen das andere zu führen und so die Pelican wegzunehmen, der genannte Thomas Doughty sich weigerte, den Kapitän davon zu unterrichten. Versichernd, dass man ihn für den Anführer hielte. Und als von Francys Fletcher gesagt wurde, dass er dem Kapitän davon berichten würde, bat ihn der genannte Thomas Doughty inständig, es nicht zu tun. Denn, sagte er, ich würde verdächtigt werden.
Doch wie alle anderen Aussagen schien sie aus einem grösseren Zusammenhang gerissen und liess eine korrekte Deutung nicht zu. Die umständlich formulierten Sätze sagten eigentlich nur, dass es Gerüchte über eine geplante Meuterei gegeben und Doughty sich geweigert hatte, Drake darüber zu informieren, aus Angst, selbst in Verdacht zu geraten. Vielleicht war Doughty einfach nur ein Feigling gewesen. Einen Beweis, dass Doughty selbst zu den Meuterern gehört hatte, stellte diese Aussage jedenfalls nicht dar. Immerhin hatte Raleigh den Namen eines zweiten Schiffes, Pelican, den er auf seine Schiffsliste setzte.
Wen aber sollte er noch auf seine Liste der zu befragenden Personen setzen? Er beschloss, sich noch einmal die Liste der hundertfünfundsechzig Namen anzusehen.
Thomas Blackeley, b’swain Thomas Brewer, Mar. decd.
Charles Cauby, Gent. Thomas Flood, Mar. decd.
Robert Wynterhay, Gent, decd. Edward Cliffe, Mar.
John Brewer, Tromp. Edward Bright, Crpt.
William Haynes, C’trel. Thomas Hord, Gent.
John Fry, Mar. Leonard Vicary, Gent.
Richard Minivy, Mar. decd. John Doughty, Gent.
John Doughty? Die Namensgleichheit mochte Zufall sein. Oder auch nicht. Vielleicht ein Verwandter von Thomas Doughty? Ob das vielleicht ein geeigneter Zeuge wäre? Raleigh verwarf den Gedanken sofort wieder, denn wenn John ein Verwandter des enthaupteten Thomas war, dann war er sehr wahrscheinlich voreingenommen. Und befangene Zeugen waren der Wahrheitsfindung selten dienlich, das war Raleigh klar.
Darüber hinaus fiel ihm auf, dass hinter vielen, wenn nicht den meisten Namen die Abkürzung Mar. oder Gent. stand. Mariner, also Matrose, und Gentleman. Natürlich konnte man erwarten, dass bei einem Unternehmen zur See, an dem mehrere Schiffe beteiligt waren, die einfachen Seeleute das Gros der Mannschaften bildeten. Hinzu kamen Spezialisten wie Zimmerleute, Segelmacher, Stückmeister und so weiter; ausserdem Deckoffiziere, Offiziere, Master und Kommandanten. Da Offiziersposten fast ausschliesslich an vornehme Herren aus den oberen Schichten vergeben wurden, durfte man zwar eine Reihe von Gentlemen auf der Liste erwarten. Aber hier wurden derart viele Männer als Gentlemen ausgewiesen, dass auf rund zwei einfache Seeleute ein Offizier kam, und das erschien Raleigh dann doch sehr fragwürdig. Was hatten so viele vornehme Leute auf dieser Fahrt zu suchen gehabt? Und Doughty war einer von ihnen gewesen. Instinktiv spürte Raleigh, dass die seltsame Zusammensetzung der Mannschaft etwas mit Doughtys Fall zu tun haben musste, er konnte sich nur nicht ausmalen, was. Wenn es aber darum ging, für die Befragung Leute auszuwählen, dann konnte es nur hilfreich sein, wenn sich die Befragten aus allen Rängen zusammensetzten. Mit Francis Fletcher hatte er weder einen Gentleman noch einen einfachen Matrosen, als Schiffskaplan konnte man ihn am ehesten als einen der Spezialisten bezeichnen. Drake war als zu Befragender natürlich gesetzt, fehlten ihm noch ein Matrose und ein Gentleman. Aber welche? Verzweifelt starrte er auf die Liste und bat seine Intuition um Hilfe.
Sie kam anders als erwartet, denn plötzlich erkannte er die Bedeutung der Abkürzung decd. hinter etlichen der Namen.
„Deceased“, murmelte er vor sich hin, „Verstorben.“
Schnell überprüfte er Doughtys Namen, der einzige Mann auf der Liste, von dem er sicher wusste, dass er tot war. Und tatsächlich: Thomas Doughty, Cpt. decd.
Raleigh kam das decd. an dieser Stelle ein wenig euphemistisch vor, denn immerhin war Doughty nicht einfach verstorben, er war hingerichtet worden. Zwar konnte er nun zahlreiche Namen streichen, aber es blieben immer noch mehr als genug zur Auswahl übrig.
Wünschenswert wären natürlich Leute gewesen, die in der Lage waren, einen anschaulichen Bericht über die Ereignisse abzuliefern. Aber aus der Liste ging natürlich nicht hervor, hinter welchem Namen sich ein Erzähltalent verbarg. Falls überhaupt ein einziges darunter war.
Mit wenig Hoffnung machte sich Raleigh daran, die übrigen Papiere zu sichten, um vielleicht auf einen Hinweis zu stossen, der ihn in dieser Frage weiterbringen würde. Er fand nur eine einzige Notiz, die sich auf ein Mitglied der Mannschaft bezog:
Md., dass der Seemann John Fry, welcher an der Barbareskenküste von Mauren entführt wurde, nicht lange danach auf Geheiss des dortigen Königs nach Hause geschickt wurde, und dass der genannte Fry auf einem englischen Handelsschiff wohlbehalten am iv. Februar im Jahr 1578 in Plymouth eintraf.
Raleigh fand tatsächlich einen John Fry auf der Liste der Hundertfünfundsechzig. Aber als Doughty enthauptet wurde, war Fry schon lange wieder in England. Viel würde der Mann also nicht erzählen können.
Als die Turmglocke von St. Clement Danes zwei Uhr Früh schlug, fühlte sich Raleigh müde und ausgelaugt. Seine Arbeit hatte ihn nicht so weit gebracht, wie er gehofft hatte, aber er sah ein, dass er Schlaf brauchte. Also räumte er die Papiere zusammen, zog sich aus, löschte alle Kerzen und verkroch sich ins Bett und unter die kalte Decke.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der weiss, wer als Zeuge etwas taugt, dachte Raleigh, während er durch die Dunkelheit an die Zimmerdecke starrte.
Hakluyt! schoss es ihm durch den Kopf. Natürlich! Richard Hakluyt! Raleigh hielt den Geographen für einen ausgemachten Stubenhocker, aber er dachte fortschrittlich, und das gefiel Raleigh. Was ihn aber auf Hakluyt brachte, war dessen Steckenpferd. Er las und sammelte wie ein Besessener Reiseberichte. Jeder Abenteurer, der auszog, die Nordwestpassage zu entdecken, erhielt nach seiner erfolglosen Rückkehr die Einladung, Hakluyt von seiner Reise zu berichten. Wenn Hakluyt nur rechtzeitig von Drakes Heimkehr von seiner Fahrt rund um den ganzen Globus erfahren hätte, er wäre der erste gewesen, der mit sabbernden Lefzen am Kai gestanden hätte. Drakes Rückkehr war schon zwei Monate her; Raleigh war sich sicher, dass es Leute aus der Mannschaft gab, die bereits bei Hakluyt4 gewesen waren. Leute, die ihm der Geograph empfehlen konnte.
Und mit diesem hoffnungsvollen Gedanken drehte er sich auf die Seite, um endlich einzuschlafen.
Doch dann sah er das Gesicht.
Hohlwangig, verdreckt und schlecht rasiert; gehetzter Blick aus dunklen Augen, die erstaunlich guten Zähne gebleckt: Der elfte Mann.
Elf Tage vorher
Dienstag, 8. November 1580
Dún an Óir, Smerwick
Irland
Der Vormittag schritt voran und Raleigh freute sich aufs Töten. Nicht, dass er den eigentlichen Akt des Tötens geniessen würde. Es war keine leidenschaftliche Freude, eher eine pragmatische. Das Ergebnis war, was zählte. Tote Katholiken.
Er hasste die Papisten, weil er in einer protestantischen Familie aufgewachsen war, zu einer Zeit, da protestantische Familien um ihr Leben fürchten mussten. Weil er in diese Furcht hineingeboren und darin aufgewachsen war. Weil man hasst, was man fürchtet. Deshalb bohrte Raleigh seinen Absatz ins irische Gras auf einer Halbinsel namens Dingle und sah ungeduldig über die rauchenden Geschütze zur Festung Dún an Óir hinüber. Die eigentliche Festung lag auf einem Klippenvorsprung, der nur über einen schmalen Pfad zu erreichen war; ein paar Holzhäuser umgeben von einer niedrigen Mauer, die am Rand der Klippe um den Vorsprung herum verlief. Ein Depot, ein Aussenposten im Nirgendwo, nicht gebaut, um einer Belagerung standzuhalten. Doch davor hatte der Feind einen Graben ausgehoben und behelfsmässige Bastionen angelegt. Nicht viel mehr als eine bessere Barrikade aus hastig aufgeschütteten Erdwällen mit hölzernen Katzen und Banketten, verstärkt mit allem, was gerade zur Hand war: Fässern, Balken und improvisierten Schanzkörben. Der Bereich innerhalb des Schutzwalls mass an seiner breitesten Stelle hundertfünfzig Fuss und vom Wall bis zur Landspitze etwa dreihundert Fuss. In diesem Geviert drängten sich nach englischer Schätzung rund siebenhundert Menschen, italienische, spanische und baskische Söldner sowie eine Handvoll Iren, darunter auch einige Frauen.
Vor zwei Monaten waren die Söldner in der Bucht von Smerwick gelandet, um den Aufstand zu unterstützen, den James FitzMaurice FitzGerald5 ein Jahr zuvor losgetreten hatte. Doch FitzMaurice hatte das ausserordentliche Pech, getötet zu werden, noch bevor die Rebellion richtig ins Rollen kam, weshalb sich die Söldner etwas ratlos in Dún an Óir eingenistet hatten.
Natürlich wäre es für die Söldner das Beste gewesen, sich so schnell wie möglich zu verdrücken, doch im Osten versperrte ihnen der Mount Brandon, einer der höchsten Berge Irlands, den Weg, und ihre paar Schiffe wurden in der Bucht von Smerwick durch Captain Binghams Swiftsure blockiert.
Sie sassen in der Falle.
Und von Dingle auf der anderen Seite der Halbinsel aus machte sich Lord Deputy Arthur Grey auf den Weg, die Falle zuschnappen zu lassen.
Noch vor Grey traf am 5. November Admiral William Wynter mit einem grösseren Verband ein, schaffte im Schutz der Dunkelheit acht Culverinen an Land und liess in zweihundertvierzig Yards Entfernung zum Schanzwerk der Söldner einen Graben ausheben. Dann erreichte Grey mit dreitausend Mann den Schauplatz, liess weitere Sappen im Zickzack bis auf hundertzwanzig Yards an die Bastion heranbuddeln und brachte die Geschütze in Stellung. Den Captains Raleigh und Zouch fiel die Aufgabe zu, mit ihren Männern die Gräben vor etwaigen Angriffen zu verteidigen und Feuerschutz zu geben.
Im Morgengrauen des 7. Novembers eröffneten die englischen Geschütze das Feuer. Die papistischen Söldner verfügten selbst über vierzehn leichtere Geschütze und erwiderten den Beschuss, doch die meisten ihrer Stücke waren so ungünstig ausgerichtet, dass sie nur zwei davon zum Einsatz bringen konnten. Bis zwei Uhr war das eine krepiert und das andere durch eine englische Culverinenkugel ausser Gefecht gesetzt. Mit Musketen und Arkebusen schossen die Belagerten weiter, ohne grossen Schaden anzurichten. Englische Musketiere pirschten sich im Pulverqualm durch die Sappen heran und gaben Salve um Salve zurück.
Der nächste Tag begann, wie der vorige geendet hatte. Greys Culverinen wummerten, Musketen knatterten, und in der Windstille mischte sich der Pulverqualm mit dem Nebel und legte sich schwer und beissend über Geschützstellungen und Gräben. Den ganzen Morgen über hatte Raleigh nicht viel zu tun, und gegen Mittag stand er am Graben, den die Seeleute ausgehoben hatten, und malträtierte ungeduldig und frustriert mit dem Stiefelabsatz das Gras zu seinen Füssen, als unter ihm Captain Edward Denny aus dem Qualm auftauchte.
„Du bist dran, Walter, wir sind ausgeschossen“, sagte er, nahm seinen Helm ab und wischte sich übers russverschmierte Gesicht.
„Na endlich!“
„Und nimm den jungen Cheke mit, dann kann er was lernen.“
Raleigh sah seinen Vetter fragend an. „Cheke?“
Denny kam aus dem Graben geklettert und zog sich die Handschuhe aus. „Kam am Sonntag in Dingle angeritten. Direkt aus Corke. Das Pferd war völlig am Ende.“
„Ach so, der“, sagte Raleigh und sah sich um, bis er Cheke entdeckte, der mit offenem Hosenstall neben einem Geschütz stand und pisste.
„Du liebe Güte!“, seufzte Raleigh.
Denny kicherte. „Wenn er nur das Pulver nicht nass macht.“
„Mr. Cheke!“, rief Raleigh und winkte ihn zu sich.
Denny beugte sich nah zu Raleigh und sagte leise: „Du behältst ihn besser ihm Auge, er ist William Cecils Neffe.“
„Und weiss Cecil, dass er hier ist?“
„Frag ihn“, sagte Denny und deutete mit dem Kopf auf Cheke, der sich im Laufen die Hose zuknöpfte und lächelnd vor den beiden Offizieren zum Stehen kam. „Captain Raleigh, Sir?“
Raleigh musterte den blonden Mann, der etwa in seinem Alter sein mochte. Aber alle nannten ihn nur den „jungen Cheke“, weil er der Sohn eines berühmten Gelehrten war.
„Weiss Lord Burleigh, dass sie hier sind, Mr. Cheke?“
„Keine Ahnung, Sir, ich hab’s ihm nicht gesagt“, antwortete Cheke fröhlich. „Hab mir aus seinem Stall ein Pferd geliehen und bin losgeritten.“
Raleigh warf Denny einen Blick zu und sagte dann: „Wir gehen gleich nach vorn, wollen Sie mitkommen?“
Denny führte an diesem Tag das täglich wechselnde Kommando6; sein Vorschlag, Cheke mitzunehmen, kam daher einem Befehl gleich. Dennoch wollte Raleigh die Entscheidung Cheke überlassen und hätte nichts dagegen gehabt, wenn er Nein gesagt hätte.
„Mit Vergnügen, Sir!“
„Dann besorgen Sie sich eine Muskete. Und beeilen Sie sich!“
Raleigh band sich den Kinnriemen seines Helms fest und streifte die Handschuhe über.
„Sag mal, Ned, weisst du, wann Grey vorhat, das Dreckloch zu stürmen?“
Denny verzog das Gesicht und sah zu Grey hinüber, der aufrecht zwischen den Geschützen auf und ab marschierte. „Vielleicht will er, dass sie sich ergeben“, meinte er. „Denen geht irgendwann das Trinkwasser aus und der nächste Brunnen steht anderthalb Meilen von hier. Ist also nur eine Frage der Zeit.“
„Und was will er dann mit ihnen machen?“
„Du fragst Sachen!“, murmelte Denny kopfschüttelnd und ging.
Raleigh liess ihn gehen, zog sein Rapier und rief seinen Männern zu: „Los geht’s!“
Einer nach dem anderen sprangen sie mit klappernden Pulverkapseln und Musketen in den Graben und verteilten sich auf die Sappen, die an das Bollwerk heranführten.
Dicht gefolgt von Cheke sprang Raleigh in den Graben und lief geduckt durch eine der Sappen nach vorn, wo bereits eine muntere Schiesserei im Gange war. Raleigh kauerte sich hin und verfolgte, wie Cheke umständlich seine Muskete über den Grabenrand schob und die Lunte anblies. Kugeln pfiffen über sie hinweg oder fuhren pochend in die Grasnarbe vor dem Graben. Cheke liess sich nicht beirren, spähte über den Rand und schoss. Dann liess er sich auf den Boden des Grabens sinken und begann, die Muskete nachzuladen. Leise vor sich hin summend nahm er die Lunte ab und legte sie vor sich auf die Erde, schüttete den Inhalt einer Pulverkapsel in den Lauf, wickelte den Filzpfropfen um die Kugel und steckte sie ebenfalls in die Mündung. Er machte alles richtig, keine Frage, doch hatten Raleighs Männer bis dahin ihre Musketen dreimal nachgeladen und abgefeuert.
Cheke wusste, wie man mit einer Waffe umging, aber er war sicher nie daran gedrillt worden. Das und Chekes Unbekümmertheit sagten Raleigh, dass der Mann soeben seine Feuertaufe erlebte.
„Warum sind Sie hier?“, fragte Raleigh.
Cheke zog den Ladestock aus dem Schaft und zuckte die Achsel. „Mein Vater wollte, dass ich Gelehrter werde, wie er. Und nach seinem Tod übernahm es Onkel William, dafür zu sorgen, dass sein Wusch erfüllt wurde.“
Mit unnötiger Vehemenz trieb Cheke den Ladestock in den Lauf und rammte Kugel und Ladung fest. Im Takt dazu zählte er auf: „Lateinisch, Griechisch, die Rechte, Philosophie! Das ist nichts für mich.“
„Nun, ein bisschen Bildung schadet ja nichts.“
Eine Kugel fuhr in die Grabenwand neben Raleigh und liess Erdklumpen und Kiesel spritzen.
„Ein bisschen Bildung? Den ganzen Tag über Büchern hocken und sich den Kopf mit Dingen füllen, von denen kein Mensch weiss, wozu man’s brauchen kann. Tagelang, wochenlang, jahrelang! Nein, danke.“
Er steckte den Ladestock in den Schaft zurück und schüttete etwas Pulver auf die Pfanne. „Ich habe den Mief der Studierstuben nicht mehr ausgehalten. Ich musste da raus und etwas tun.“ Sorgsam schob er mit dem Daumen den Pfannendeckel zu. „Und wissen Sie was? Hier und jetzt fühle ich mich zum ersten Mal in meinem Leben frei.“ Und damit blies er die Lunte an und klemmte sie in die Serpentine.
„Haben Sie Kinder, Mr. Raleigh?“, fragte er unvermittelt und sah Raleigh ins Gesicht.
Raleigh lachte auf. „Ich bin noch nicht mal verheiratet! Und mein Rang ist übrigens Captain, Mr. Cheke.“
„Sollten Sie jemals Kinder haben, Captain Raleigh, lassen Sie ihnen die Freiheit, das zu kriegen, was sie wollen.“
Cheke kam hoch und schob den Musketenlauf wieder über die Grabenkante.
Raleigh wandte sich ab, um nach seinen Männern zu sehen und hörte im selben Moment hinter sich ein hässliches Geräusch. Als er sich umdrehte, sah er Cheke zu Boden gehen. Die Kugel war in seine Stirn dicht über dem rechten Auge eingedrungen und hatte einen Teil des Schädels weggerissen. Cheke war auf der Stelle tot.
„Scheisse!“, fluchte Raleigh und kniete sich nieder. „Das haben Sie wohl nicht bekommen wollen, Mr. Cheke“, sagte er leise und schloss ihm mit behandschuhtem Daumen sanft das verbliebene Auge.
Als es Zeit für die Ablösung war und Raleigh aus dem Graben kletterte, kam Captain Wingfield daher, schlenkerte einen Helm am Kinnriemen und hielt ihn schliesslich Raleigh hin.
„Hier, für den jungen Cheke, ich hab’ gesehen, dass er keinen anhat.“
„Er braucht ihn jetzt nicht mehr.“
Müde schob sich Raleigh an Wingfield vorbei und trottete zu seinem Zelt, während zwei Soldaten Chekes Leiche aus dem Graben hoben.
John Cheke sollte der einzige Tote auf englischer Seite bleiben.
Chekes Tod hatte eine Massierung des englischen Artilleriefeuers zur Folge, da niemand geringeres als Lord Deputy Arthur Grey gesehen haben wollte, wo der tödliche Musketenschuss abgegeben worden war. Auch Winters Schiffe feuerten eifrig Salve um Salve auf die Stelle ab, bis ein Teil der Mauer samt dem hölzernen Wehrgang in einer Lawine aus Stein, Holz und Staub über die Klippe auf den Strand donnerte. Doch in Raleigh wuchs die Frustration. Die Befestigung war schon lange sturmreif geschossen, und mit ihren dreitausend Mann hätten die Engländer das feindliche Lager einfach überrennen können, aber der Befehl dazu blieb aus. Weshalb zögerte Grey? Raleigh verstand den Lord Deputy nicht. Nicht nach Glenmalure.
In dem Tal rund fünfundzwanzig Meilen südlich von Dublin war Grey mit dreitausend Mann, darunter Raleigh, in einen irischen Hinterhalt geraten. Mehr und mehr englische Soldaten waren durch Heckenschützen gefallen, bis schliesslich alle Ordnung und Disziplin zusammengebrochen war. Als die Engländer ihr Heil in der Flucht suchten, verliessen die Iren ihre Deckung und fielen mit Schwertern, Piken und Äxten über die Flüchtenden her. Fast ein Drittel von Greys Streitmacht wurde im irischen Blutrausch bestialisch abgeschlachtet. Grey wie auch Raleigh waren dem Blutbad nur mit knapper Not entkommen.
Und nun stand Raleigh auf dieser Halbinsel vor den zerschossenen Wehranlagen des Feindes und lechzte nach Vergeltung, und obwohl in Grey dieselbe Mischung aus Scham, Hass und Wut kochen musste, tat dieser nichts, ausser bis zum Einnachten mit seinen Culverinen zu schiessen.
Am nächsten Morgen tat der Feind genau das, was Raleigh befürchtet hatte. Ein biestiger Westwind jagte tiefhängende graue Wolken von der See her ins Landesinnere. Die Geschütze hatten gerade ihre erste Salve des Tages abgefeuert, als über den Trümmern des Walls eine weisse Fahne geschwenkt wurde. Grey liess das Feuer einstellen, alles wartete.
Erstaunlicherweise war das hölzerne Tor noch einigermassen intakt geblieben, doch einige sauber gestanzte Einschusslöcher verzierten die Flügel und der Rahmen war in Schieflage geraten. Mühsam und ruckend wurde ein Flügel geöffnet, wobei der ganze Rahmen wackelte, und durch den Spalt erschien eine Handvoll Gestalten. Einfach über die Trümmer des Walls zu klettern, wäre mit weniger Aufwand verbunden gewesen, doch die Belagerten wollten offenbar noch einen letzten Rest Würde bewahren.
Grey trat ein paar Schritte vor die Geschützstellungen, begleitet von seinem Sekretär und Adjutanten Edmund Spenser, englische Offiziere kamen aus ihren Stellungen und scharten sich um ihn. Bingham von der Swiftsure war da, wie auch die Captains Denny, Mackworth, Zouch und Wingfield. Auch Raleigh kam bis auf Hörweite heran, neugierig, was als nächstes geschehen würde.





























