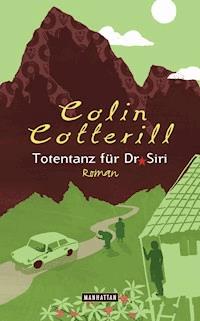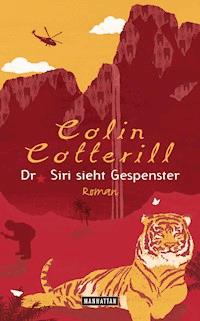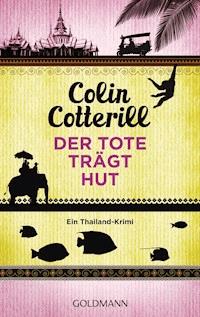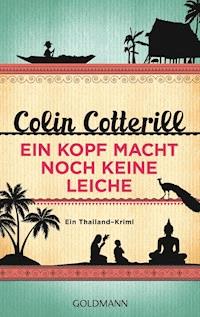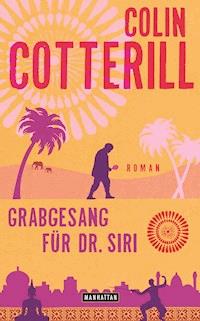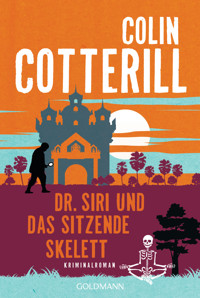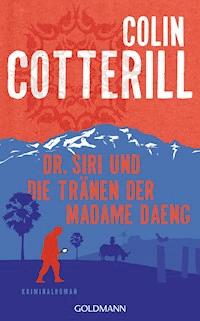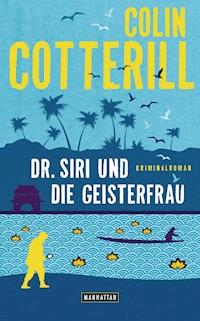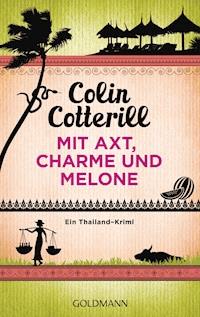8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Krimi
- Serie: Dr. Siri ermittelt
- Sprache: Deutsch
Sieht aus, als könnte Dr. Siri endlich in Rente gehen. Obwohl er seine Arbeit als Pathologe liebt, ermüdet den bald 80-jährigen der Job zunehmend. Außerdem würde er vor seinem baldigen, vom örtlichen Medium prophezeiten Tod gerne mehr Zeit mit seiner Gattin verbringen. Pech für Siri, dass die laotische Regierung andere Pläne mit ihm hat: Er soll die internationale Suche nach einem amerikanischen Piloten überwachen, dessen Hubschrauber ein Jahrzehnt zuvor über dem thailändischen Dschungel abstürzte. Ein plötzlicher Todesfall überschattet das Suchprojekt – gefolgt von ein paar Unfällen, die dem scharfsinnigen Siri nicht ganz zufällig erscheinen. Kann er weiteres Unglück abwenden, bevor sich die Prophezeiung des Mediums erfüllt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Sieht aus, als könnte Dr. Siri endlich in Rente gehen. Obwohl er seine Arbeit als Pathologe liebt, ermüdet ihn der Job zunehmend. Außerdem würde er vor seinem baldigen, vom örtlichen Medium prophezeiten Tod gerne mehr Zeit mit seiner Gattin verbringen. Pech für Siri, dass die laotische Regierung andere Pläne mit ihm hat: Er soll die internationale Suche nach einem amerikanischen Piloten überwachen, dessen Hubschrauber ein Jahrzehnt zuvor über dem laotischen Dschungel abstürzte. Ein plötzlicher Todesfall überschattet das Suchprojekt – gefolgt von ein paar Unfällen, die dem scharfsinnigen Siri nicht ganz zufällig erscheinen. Kann er weiteres Unglück abwenden, bevor sich die Prophezeiung des Mediums erfüllt?
Colin Cotterill
DR. SIRI UND DER EXPLODIERENDE DRACHE
Roman
Aus dem Englischen
Mein ganz besonderer Dank gilt Charles Davis, von dem ich mehr über Hubschrauber erfahren habe, als ich jemals wissen wollte, und seinen wunderbaren Reminiszenzen an die Ära der Air America, die er in dem Buch Across the Mekong festgehalten hat.
Ein großes Dankeschön auch zahlreichen anderen Veteranen aus jener Zeit in Südostasien, die manche gern vergessen würden, während andere sich voller Stolz an sie erinnern. Für ihre Hilfe danke ich Edmund McWilliams, MacAlan Thompson, Wallace Brown, Denny Lane und Dr. Amos Townsend.
Besten Dank auch an You Jia Zhu und ihren Bruder Jin Zhu, Polly Griffith und Steven Schipani.
Des Weiteren danke ich den üblichen Verdächtigen: Dad, Tony, Lizzie, Valérie, Kye, Kay, Martina, Robert, Bambina, Leila, David und Jess.
Mit einem herzlichen Gruß an Dr. Siris neue Besitzer in dem schicken, schlanken Hochhaus unweit des Bloomsbury Square: Ihr habt mir den Glauben an mich selbst zurückgegeben. Danke.
INHALT
PROLOG: AUGUST 1968
1 EIN FEINES SÜPPCHEN
2 UNTERDESSEN IN METRO MANILA
3 PEACH
4 DER SUMO-RINGER IM SOMMERKLEID
5 CUEBALL DAVE
6 KOFFER, KANAPEES UND WEISSES PULVER
7 EISBRECHER AHOI!
8 SPOOK CITY
9 DER SCHWANZ DES DRACHEN
10 LA PLAINE DES ALAMBICS
11 BAUMOTTERN
12 DAS TOTENFELD
13 LIPPENROT UND SPITZENHÖSCHEN
14 ÜBERSETZUNG ÜBERFLÜSSIG
15 ABSTURZ FÜR EILIGE
16 DER MANN, DER DIE HAND SEINER FRAU MIT EINER SERVIETTE VERWECHSELTE
17 AN DER BIEGUNG DES FLUSSES
18 EIN REPUBLIKANISCHER US-SENATOR IN EINEM VERSCHLOSSENEN RAUM
19 SUPERNAPALM
20 EINEN IM TEE
21 ERZ AUS STEIN
22 SEIT WANN GEHÖREN WIR ZUM ALTEN EISEN?
23 GUERILLA IM NEBEL
24 EIN GUTER GEIST
25 DER ZIVILORDEN FÜR HERVORRAGENDE VERDIENSTE UM SICHERHEIT UND AUFBAU DER DEMOKRATISCHEN VOLKSREPUBLIK LAOS (2. KLASSE)
PROLOG:
AUGUST 1968
Wer einmal stockbesoffen und mit bedröhntem Schädel in einer 500000 Dollar teuren fliegenden Metallkiste gesessen hat, der weiß: Mit einem lebenden Bären in einem Käfig eingesperrt zu sein, ist ein Fliegenschiss dagegen.
Der Vollmond winkte verführerisch. Wie ein elfenbeinerner Wok hing er am weiten stahlgrauen Himmel und tauchte die Landschaft in ein schauriges Schwarzweiß. So musste die Welt für Hunde aussehen. Mittelgrauer Dschungel vor dunkelgrauen Bergen. Pechschwarze Inseln im mit Silbersplittern übersäten Fluss. Boyd konnte jedes Blatt, jeden Stein deutlich erkennen, so klar wie am Tag der Schöpfung. Er war ein Gott. Oh, yeah. Unterwegs in himmlischer Mission. Der allmächtige Held eines Films aus jener Zeit, als man sich noch keine Farbe leisten konnte: in der Hauptrolle Boyd Bowry auf seiner unendlichen Suche nach … Käse.
»Käse, Kleiner«, hatte er zu Marcos gesagt. »Ich bring dir einen Kanten Mondkäse mit. Den braucht man sich bloß abzusäbeln. Fritten dazu?«
»Mensch, du kannst mich mit dem Vieh doch nicht allein lassen«, hatte Marcos kleinlaut zurückgegeben. In der Käfigtür war Boyd noch einmal stehen geblieben, hatte sich umgedreht und einen letzten Blick auf die Bärin geworfen: betrunken, schnarchend, furzend, den Kopf im Futtertrog versenkt.
»Keine Angst, die tut nix, die will nur spielen. Morgen früh braust du ihr ein Tässchen Kaffee. Erzählst ihr, wie schön es gewesen ist. Und gibst ihr deine Telefonnummer.«
Worauf Marcos ihm einen eher unmilitärischen Gruß entboten hatte. Ziemlich langer Finger, das. Kein Wunder. Er kam ja auch nur selten aus der Übung. Das war jetzt wie lange her? Eine Stunde? Eine halbe? In zehntausend Fuß Höhe, über einer monochromen Welt, verlor man jedes Zeitgefühl. Darüber müsste mal jemand eine Doktorarbeit schreiben. Die Beziehung zwischen … zwischen Farbe und Zeit. Die Farbe von Minuten. Marcos hatte ihm auf Filipino Flüche und Verwünschungen hinterhergebrüllt. Der Kleine war nicht mehr ganz dicht. Lächelte in einer Tour, aber …
Moment mal. Marcos? Was für ein Quatsch. Marcos ist der Präsident, verdammt noch mal. Der Knabe im Käfig wird über kurz oder lang im Magen einer Bärin landen. Da werde ich mich doch wohl an seinen Namen erinnern können. Schließlich kenne ich ihn schon seit …
Okay, reiß dich zusammen.
Konzentration.
Käse.
Das ganze Gedöns mit der Zündung und den Instrumenten beherrschte er im Schlaf, zum Glück, denn er hatte keinerlei Erinnerung daran. Er hatte den Motor angeworfen, die Mühle in den Himmel gewuchtet, und jetzt war er auf dem Weg zum Mondimbiss. Ein Sikorsky hatte einem Chevy gegenüber jede Menge Vorteile. Erstens hatte er einen Sikorsky noch nie gegen einen Hydranten gesetzt. Zweitens hätten die Bullen ihn damit niemals geschnappt. Und drittens? Mit einem Chevy konnte man nicht auf dem Mondlicht surfen wie mit einem Sikorsky H-34.
Oh, no.
Oh, yeah.
Was für ein abgefahrener Trip. Was für ein total abgefahrener Trip. Schwerelos im Grau, den Blick starr auf den Mond gerichtet. Eine kosmische Erfahrung. Warum gab es solche Nächte eigentlich nicht mehr? Was war aus Love, Peace and Harmony geworden? Für die Affen da unten in den Bäumen gab es weder Ruhe noch Frieden. Genauso wenig wie für die fetten Eidechsen, die sich auf den Felsen wärmten. »Sorry, Freunde.« Wenigstens brauchte er sich das ohrenbetäubende Geknatter der Maschine nicht anzutun. Er hatte seinen Kopfhörer direkt in das Kassettendeck gestöpselt. The Who: Briten, aber nicht ohne, die Jungs. Getrommel wie das Sperrfeuer einer Flak.
I know you’ve deceived me, now here’s a surprise
I know that you have ’cause there’s magic in my eyes
I can see for miles and miles and miles and miles and miles
Oh, yeah
Und obwohl ihm die Musik schnurstracks ins Hirn fuhr und dort hängen blieb, stellte er sich vor, dass der Song bis nach Nam im Westen und nach Thailand im Osten zu hören war und ein karmischer Übersetzungsdienst den Bauern in ihren Bambusbetten die Message übersandte. Er brüllte gegen die Musik an: »Sie haben euch verarscht, Brüder, aber ihr wisst genau, was wir getan haben, stimmt’s? Ihr habt die magic eyes. Ihr wisst, dass wir in einem anderen Leben die Quittung dafür kriegen werden. Worauf ihr einen lassen könnt. Aber was soll’s? Drauf geschissen, Baby.«
Und in diesem Augenblick passierte es. Panik durchfuhr ihn. Weltuntergang. Erst tat es einen Rums, dann vibrierte plötzlich nichts mehr. Eben noch hatte die Landschaft ihn getragen, jetzt öffnete sich im Universum eine Falltür, und er stürzte hindurch. Schwerkraft! Irre Erfindung! Die Treibstoffanzeige blinkte wie ein Weihnachtsbaum. Es gab »Notfallroutinen«. Er konnte wahrscheinlich Hilfe rufen. Aber welcher auch nur halbwegs klar denkende Mensch hockte frühmorgens um zwei am Funkgerät und wartete auf den Notruf eines Acidheads auf Magical Mystery Tour? Und die Zeit drängte. Er hatte vierzehntausend Pfund Metall unter dem Arsch und raste mit zwanzig Kanistern einer hochexplosiven Substanz an Bord auf die Erde zu. Von wegen Rettung. Er schaltete die Rotoren ab, wartete, bis die Kiste sich einigermaßen stabilisiert hatte, öffnete seinen Gurt und stand auf. Er bedachte den Aktenkoffer auf dem Copilotensitz mit einem Lächeln. Leider hatte er keine Zeit, ihn mitzunehmen. Ihm blieben kaum dreißig Sekunden, um sich auf das Ende vorzubereiten. Und Bilanz zu ziehen.
»Nutze die Zeit gut, mein Freund.«
An wen sollte er denken? Wem ewige Liebe schwören? Wen hassen? Nein, diese Frage erübrigte sich. Spätestens morgen war der Wichser fällig. Und jetzt das. Mist. Ein einfacher Expressfahrschein zum großen Bowry-Barbecue. Gut in der Zeit. Er klappte den Copilotensitz nach hinten, kroch durch den Spalt in den Laderaum und richtete sich schwankend auf. Er hatte tausend Männer tausend Tode sterben sehen. Er wusste, welche Frage Petrus ihm als erste stellen würde.
»Wie bist du hopsgegangen? Hast du dem Schicksal ruhig ins trübe Auge geblickt? Heulsusen und Jammerlappen können wir hier oben nicht gebrauchen, Jungchen.«
Also ging Boyd es locker an. Wenn man locker bleibt, kommt einem der Tod nicht mehr ganz so endgültig vor.
Das Dorf lag im Tiefschlaf, mit zwei Ausnahmen. Sie sahen, wie der Hubschrauber vom Himmel stürzte, nicht wie ein Stein, nicht lotrecht, eher wie eine Schieferplatte, die ins Wasser klatscht. Sie sahen, wie das Fahrwerk die Baumwipfel streifte, dann ein Funke, und der große Vogel explodierte und spuckte eine ganze Galaxie von Sternen. Der eine der beiden Schlaflosen klatschte lachend in die Hände, war jedoch außerstande, jemandem von dem Schauspiel zu berichten. Der andere Zeuge – eine Frau – fiel vor Schreck von einem Baum, wobei sie sich den Kopf stieß und erblindete. Doch an dem letzten Bild, das sich ihr ins Gedächtnis brannte, gab es für sie nicht den geringsten Zweifel. Sie hatte es genau gesehen. Ein Drache war mit dem Mond kollidiert. Der war in tausend Stücke zersprungen, und die Scherben waren auf den Dschungel herabgeregnet, und nun würde die Nacht auf ewig dunkel bleiben.
1
EIN FEINES SÜPPCHEN
Dr. Siri und Madame Daeng saßen auf der Kante des muffigen Bettes und betrachteten die Leiche, die am Türknauf hing. Die beiden waren nicht eben für ihre Schweigsamkeit berühmt, doch diesmal hatte es selbst ihnen die Sprache verschlagen. Ratlos bestaunten sie den knallroten Lippenstift und die knallenge Unterwäsche. Sie atmeten die Whiskydämpfe und den Geruch von Erbrochenem und Desinfektionsmittel. Beide hatten weiß Gott viele Tote gesehen, wahrscheinlich mehr als genug. Aber so etwas hatten sie noch nicht erlebt.
»Tja«, sagte Daeng schließlich und schüttelte die frühmorgendliche Stille schaudernd ab. Der neblige Dunst sickerte durchs Fenster und kratzte sie im Hals.
»Du sagst es«, bekräftigte ihr Gatte.
»Ein feines Süppchen haben Sie uns da wieder eingebrockt, Dr. Siri.«
»Ich? Ich habe damit nichts zu schaffen.«
»Nein. Damit nicht. Jedenfalls nicht direkt. Aber ohne deine tätliche Mithilfe wäre es wohl kaum dazu gekommen.«
»Gute Frau, den vorliegenden Indizien nach zu urteilen wäre es früher oder später ohnehin geschehen, ob wir nun hier gewesen wären oder nicht. Und es hätte noch nicht einmal hier passieren müssen. Diese Tragödie hat ja geradezu darum gebettelt, endlich aus dem Sack gelassen zu werden.«
»Das ist zwar richtig. Aber hättest du dich nicht freiwillig gemeldet, und uns gleich mit, würden wir jetzt zu Hause am Mekongufer sitzen und verhältnismäßig friedlich unsere Nudeln schlürfen. Und nicht in diesem Loch, mit dieser Leiche und der zweifelhaften Aussicht, in einen internationalen Skandal verwickelt zu werden. Jemand anders müsste sich damit herumschlagen. Jemand, der gesund und gut zu Fuß ist und mit solchen Dingen umzugehen weiß. Aber nein. Ein letztes Abenteuer, bevor ich mich zur Ruhe setze, hast du gesagt. Was soll schon passieren?, hast du gesagt. Es kann überhaupt nichts schiefgehen, hast du gesagt. Und das haben wir nun davon. Vor fünf Wochen waren wir glücklich und zufrieden, und jetzt stecken wir bis zum Hals in Exkrementen.«
»Nun mach aber mal halblang, Daeng. Wie hätte ich es denn deiner Meinung nach verhindern sollen?«
»Muss ich dir das wirklich erklären?«
»Ja.«
»Du hättest die Nachricht bloß zerreißen müssen.«
Fünf Wochen zuvor
Es stimmte, noch vor fünf Wochen war alles ganz normal gewesen. Jedenfalls für Vientiane’sche Verhältnisse. Bis der Spuk, die Nachricht und nicht zuletzt die Amerikaner ihr Leben gründlich auf den Kopf gestellt hatten. Aber so war das nun einmal im Laos der späten Siebzigerjahre. Was soll man sagen? Das Land war immer schon rätselhaft gewesen, immer schon ein Opfer seiner Politik, seiner inneren Widersprüche und seines Wetters. Während der Norden unter dem verfrühten Beginn der Trockenzeit zu leiden hatte, setzte Taifun Joe die südlichen Provinzen unter Wasser. Am schlimmsten traf es Champasak, die Vorzeigeprovinz, wo fast die Hälfte der bäuerlichen Kooperativen des Landes angesiedelt war. Sie alle hatte der Regen in die Knie gezwungen, und die Einheimischen waren wieder einmal davon überzeugt, dass Mae Phosop, die Göttin der Reisernte, mit der Regierungspolitik, gelinde gesagt, unzufrieden war. Das Kollektivierungsprogramm stand vor dem Scheitern. Ein harter Schlag für das Landwirtschaftsministerium, das zur Vorbereitung auf diesen großen sozialistischen Plan den Grundbesitz der alten Royalisten verstaatlicht hatte.
Und als ob das Wetter noch nicht schlimm genug gewesen wäre, sorgte die Nähe des Landes zu Kampuchea, einst ein wichtiger Partner in Sachen Handel und Kultur, für weiteren Verdruss. Auf der Flucht vor den Khmer Rouge strömten Tausende über die Grenzen nach Thailand und Südlaos. Die laotische Regierung hatte zwanzig offizielle Verlautbarungen herausgegeben, in denen sie die Anschuldigungen der Roten Khmer zurückwies, sie gewähre vietnamesischen Truppen den Durchmarsch über laotisches Gebiet. Nein, hieß es, man treffe mitnichten Vorbereitungen für eine Invasion, dabei war natürlich das genaue Gegenteil der Fall. Doch da es noch immer keine richtigen Gesetze gab, konnte das Politbüro mit Fug und Recht behaupten, gegen keinerlei Rechtsvorschriften zu verstoßen. Der sechsundvierzigköpfige Oberste Rat arbeitete seit acht Jahren an der Formulierung einer nationalen Verfassung, war über den Entwurf des Schutzumschlages jedoch bislang nicht hinausgekommen. Dieses allgemeine Durcheinander sowie der Umstand, dass Geld noch schwerer zu beschaffen war als ein eisgekühltes Bier, hatte zur Folge, dass täglich an die 150 Bürger über den Fluss nach Thailand zu entkommen suchten – 120 davon mit Erfolg. Ein Leitartikel in der Pasason Lao verkündete jenen vierzig Prozent der Bevölkerung, die des Lesens mächtig waren, und den zwei Prozent, die es tatsächlich interessierte, der Demokratischen Volksrepublik Laos sei es noch nie so gut gegangen.
Im Juli 1978 taten die Leute der Pathologie der Mahosot-Klinik den großen Gefallen, auf gänzlich unmysteriöse Weise das Zeitliche zu segnen. Sie starben einfach, wie es sich gehörte und geziemte, sodass es weder offene Fragen zu beantworten noch finstere Motive zu ermitteln galt. Gerade so als spürten sie, dass Dr. Siri Paiboun, der erste und einzige Pathologe des Landes, sich dem Ende seiner ungebetenen Amtszeit näherte, weshalb sie ihm keine Scherereien mehr bereiten wollten. Seit seiner Zwangsverpflichtung durch die Partei vor drei Jahren hatte der gute Doktor Monat für Monat seine Kündigung eingereicht, und sein Vorgesetzter, der in jedem Sinne kleine Richter Haeng, hatte sie Monat für Monat ignoriert. »Ein guter Kommunist«, hatte er gesagt, »gibt den Pflug nicht einfach aus der Hand und überlässt es dem Büffel, das Feld zu beackern. Er isst mit ihm, verarztet seine Wunden und schläft mit ihm.« Nur mit Mühe hatte Siri der Versuchung widerstanden, das Gerücht zu streuen, die Partei fördere die Sodomie. Er wusste, dass seine Zeit irgendwann kommen würde. Doch als es schließlich so weit war, wäre er um ein Haar selbst auf dem Seziertisch gelandet. Er hatte den Geistern der Toten Auge in Auge gegenübergestanden, und sie warteten auf ihn. Seit seiner unschönen Begegnung mit den Roten Khmer im vergangenen Mai war er noch immer auf einem Ohr taub und hatte kaum Gefühl in seiner rechten Hand. Wenn er überhaupt einmal Schlaf fand, quälten ihn Albträume. Alle waren sich einig, dass Dr. Siri sich einen friedlichen Lebensabend sauer verdient hatte.
Wenn er sich keinen Ärger einhandelte, blieben Siri nur noch knapp acht Wochen bis zu seiner Pensionierung. Dann würde er endlich das geruhsame Leben führen können, von dem er in all den Jahrzehnten im Dschungel stets geträumt hatte: morgens eine schöne Tasse Kaffee mit Blick auf den Mekong, zu Mittag eine Schüssel Nudeln im Restaurant seiner geliebten Daeng, abends ein Fläschchen Reiswhisky und ein ungepflegter Plausch mit seinem alten Freund, dem Expolitbürokraten Civilai. Und nachts dann würde er sich mit einem Keilkissen im Rücken in sein geheimes Hinterstübchen verkriechen, wo er französische Literatur und Philosophie zu lesen pflegte. Stille Stunden mit den Genossen Sartre, Hugo und Voltaire. In der Tat. Er brauchte sich bloß keinen Ärger einzuhandeln. Ein anderer hätte damit vermutlich kein Problem gehabt. Aber er war eben kein anderer. Er war Dr. Siri Paiboun: vierundsiebzig Jahre alt, seit achtundvierzig Jahren wenig engagiertes Mitglied der Partei und von zehn Jahren in Paris kulturell gründlich verdorben. In seinem Körper beherbergte er den Geist eines tausend Jahre alten Hmong-Schamanen, und seit seiner Zeit als Feldarzt an der Front war er abgestumpft, gefühllos gegen Tod und Blutvergießen, weshalb er es als sein quasi gottgegebenes Recht betrachtete, ein knurriger alter Kauz zu sein. Nein. Zwei Monate ohne Ärger, das war für einen so komplizierten Mann fürwahr kein leichtes Unterfangen.
Seit sein Rücktrittsgesuch angenommen worden war, hatte er es mit nur einem Fall zu tun gehabt. Und gemessen an einigen seiner früheren Abenteuer hatte das Ganze diese Bezeichnung eigentlich gar nicht verdient. Die Kinder an der Mittelschule in Thong Pong waren zutiefst verstört. Einige von ihnen hatten unkontrolliert zu zittern begonnen und redeten in fremden Zungen. Die Schulschwester hatte derlei noch nie erlebt und das Gesundheitsministerium um Hilfe gebeten. Geschichten verbreiteten sich in Vientiane wie radioaktiver Niederschlag nach einem Atombombenabwurf, und so dauerte es nicht allzu lange, bis die Kunde auch die Pathologie erreichte, wo Dr. Siri und seine Kollegen schon seit Wochen untätig herumsaßen. Sofort hatte Siri sich mit seiner getreuen Gehilfin Dtui und dem Sektionsassistenten Herrn Geung auf sein altersschwaches Motorrad der Marke Triumph gequetscht und sich zur Schule aufgemacht. Da für Religion und Aberglaube unter dem neuen Regime kein Platz war, wagte niemand auszusprechen, was alle dachten: dass es in der Schule spukte. Obwohl sie darauf brannten, eine übersinnliche Ursache für die kuriose Epidemie zu finden, heuchelten Arzt und Krankenschwester bei ihrer Ankunft eifrig Desinteresse. Dtui war eine von etwa einem halben Dutzend Personen, die um Siris heißen Draht ins Jenseits wussten, und hatte nicht den geringsten Zweifel, dass in der Schule ein böser Geist sein Wesen trieb.
Der Schulleiterin zufolge verwandelten sich täglich bis zu vierzig Schüler gleich nach dem Morgenappell in Zombies und begannen unbeherrscht zu toben, zu sabbern und zu zittern. Anfangs hatte sie angenommen, es handele sich lediglich um einen Streich, mit dem sich die Schüler um die erste Stunde Marxistisch-Leninistische Theorie drücken wollten. Schließlich hatten die vom Jugendverband eingeschleusten Spitzel schon den einen oder anderen Schabernack enttarnt. Aber das hier war einfach zu verrückt. Einige Schüler hatten sogar begonnen, wüsteste Obszönitäten von sich zu geben, mit Stimmen, die eindeutig nicht zu zwölf- oder dreizehnjährigen Kindern passten. Für Siri hörte sich das alles stark nach einer schamanischen Massenhysterie an. Aus irgendeinem Grunde hatten gar zu ausgelassene Geister die biegsamen Seelen der Kinder gekapert. Doch es musste irgendein unsichtbares Medium geben, mit dessen Hilfe sich die Dämonen bändigen ließen.
»Sagen Sie«, wandte er sich an die Direktorin, »wie läuft der Morgenappell gewöhnlich ab?«
»Nach dem üblichen Prozedere, Doktor«, antwortete sie. »Die Schüler stellen sich nach Klassen auf, ich gebe die Tageslosung aus, die Flagge wird gehisst, und das Schulorchester spielt die neue Nationalhymne.«
Die neue sozialistische Nationalhymne hatte zufälligerweise dieselbe Melodie wie die alte royalistische Nationalhymne. Nur der Text war ein anderer. Trotz der holprigen Verse und des etwas irreführenden Inhalts vermochte Siri darin an und für sich nichts Böses zu entdecken. Also bat er darum, sich die Musikinstrumente ansehen zu dürfen. Kaum hatte die Schulleiterin den Schrank im Musiksaal aufgeschlossen, war der Übeltäter auch schon gefunden. Siri zog das mit Quasten und Kronkorkenrasseln versehene Exorzismus-Tamburin heraus und sah lächelnd zu Schwester Dtui.
»Wissen Sie, was das ist?«, fragte er die Direktorin.
»Ein Tamburin?«, riet sie.
»Ein Schamanentamburin, Genossin, wie es gemeinhin bei Séancen Verwendung findet«, sagte er. »Und ein energiegeladenes noch dazu. Haben Sie irgendeine Ahnung, wie es in Ihren Besitz gelangt sein könnte?«
»Ein Beamter aus der Kreisschulbehörde hat es mitgebracht«, erinnerte sie sich. »Er sagte, es sei bei einem Royalisten beschlagnahmt worden.«
»Ich gehe jede Wette ein, dass es die Hysterie verursacht hat«, sagte er.
»Aber … aber es ist doch bloß ein Musikinstrument«, widersprach sie.
Siri bedachte die Frau im Mao-Hemd mit einem Lächeln. Sie war ein Kader aus dem Nordosten, der nur in Schwarz und Weiß zu denken vermochte und für Dimensionen jenseits der drei bekannten wenig Verständnis hatte. Und so kam es, dass sowohl in Siris Bericht als auch in dem der Direktorin von verdorbenen Süßigkeiten die Rede war, die ein schurkischer Händler vor dem Schultor verkauft habe. Und dennoch: Kaum war das Tamburin beseitigt, hatte der Spuk auch schon ein Ende.
Jetzt lag das Instrument auf Siris Schreibtisch in der Pathologie, und von Zeit zu Zeit schnippte er nur so zum Spaß mit dem Fingernagel gegen die Schellen. Schwester Dtui und Herr Geung blickten jedes Mal von ihren unwichtigen Tätigkeiten auf und seufzten. Siri entschuldigte sich und ließ kurz darauf ein neuerliches Klingeln ertönen. Seiner einzigen anderen, nicht minder nervtötenden Marotte hatte Dtui einen Riegel vorgeschoben. Sie hatte die Uhr über der Bürotür abgehängt, weil der Doktor es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, die Minuten bis zu seiner Pensionierung zu zählen.
»Noch siebzigtausendfünfhundertfünfundvierzig Minuten«, flötete er. Dtui wusste, dass er sie mit diesem Tick nach spätestens ein oder zwei Tagen ebenso wahnsinnig machen würde wie die Schüler in Thong Hong. Und so war sie eines Tages etwas früher zum Dienst erschienen und hatte die Uhr vom Hausmeister abhängen lassen. Siri hatte sie gesagt, sie sei zur Reparatur. Da sie nie log, fragte er nicht weiter nach.
Schwester Dtui saß an ihrem Schreibtisch und hatte eine thailändische Popzeitschrift aufgeschlagen vor sich liegen. Für einen unaufmerksamen Besucher mochte es so aussehen, als ob sie heimlich davon träumte, ihre 44er-Maße in einen jener 36er-Bikinis zu zwängen, welche die TV-Starlets aus Bangkok auf den Hochglanzfotos trugen. Dabei lag zwischen den Seiten ihres Magazins ihr »Grundkurs Gynäkologie« auf Russisch. Trotz einer ungeplanten Schwangerschaft und der Geburt der inzwischen fünf Monate alten Malee hatte Dtui die Hoffnung noch nicht aufgegeben, eines Tages im Ostblock Medizin studieren zu können. Die Klinikleitung betrachtete Eigeninitiative als fragwürdigen Charakterzug, ein sicheres Zeichen dafür, dass man mit seiner Rolle in der neuen Republik nicht recht zufrieden war. Darum studierte Dtui heimlich. Obgleich sie keineswegs die Absicht hatte, ihre Tochter oder ihren Mann im Stich zu lassen und sich nach Moskau abzusetzen, rüstete sie sich nach wie vor für jenen fernen Tag, da sie die Leitung der Pathologie übernehmen würde. Wenn die Zeiten hart waren, konnte es nicht schaden, einen Traum zu haben. Und die Zeiten in Vientiane waren ohne jeden Zweifel hart.
Wenn auch anscheinend nicht für alle. In einer Ecke des Büros, hinter seinem nur selten benutzten Schreibtisch, stand Herr Geung und wippte auf den Fersen, gefangen in einer seligen Down-Syndrom-Trance. Auf Außenstehende hatte seine Krankheit zweierlei Wirkung. Die einen waren entsetzt darüber, dass ein Idiot in einer Klinik arbeiten durfte. Die anderen, unter ihnen seine zahllosen Fans in der Belegschaft, beneideten ihn um sein vermeintlich sorgenfreies Dasein. Er liebte seine Arbeit. Er war absolut loyal. Stets aufrichtig und freundlich. Herr Geung schien mit seinem einfachen, genügsamen Leben glücklich und zufrieden. Doch alle fragten sich, was wohl hinter seiner Stirn vorging. Wie konnte ein Mann in mittleren Jahren mit einer so schrecklichen Erkrankung derart mit sich im Reinen sein? Und neuerdings schien sich sein heiteres Gemüt in Sphären weit jenseits der berühmten Wolke sieben aufgeschwungen zu haben. Nur Siri und Dtui kannten den Grund für seinen Höhenflug. Obwohl Herr Geung beharrlich schwieg, sahen seine Kollegen es ihm an der Nasenspitze an. Es war die Liebe. Die Vögel taten es. Die Bienen taten es. Und Herr Geung ganz offensichtlich auch.
Andere hätten die Male am Hals ihres Freundes vielleicht als allergische Reaktion auf die Waschpulverrückstände an seinem Hemdkragen gedeutet. Doch Siri und Dtui arbeiteten in der Pathologie. Sie wussten, wie eine Bissspur aussah. Und billigten diese Praktik keineswegs. »Eine Vorstufe des Vampirismus«, hatte Siri sie genannt. Doch keiner von beiden missgönnte Herrn Geung seine erste, wenn auch nicht eben zarte Kostprobe der Liebe. Als Tudka in der Personalkantine angefangen hatte, war Geung zunächst außer sich gewesen.
»Sie hat Down … Down-Syndrom«, hatte er gesagt, in demselben herablassenden Tonfall, den er sein Leben lang zu hören bekommen hatte. »Sie … sie hat hier nichts verloren.«
Dennoch ließ sich nicht leugnen, dass Genossin Tudka eine liebenswerte und noch dazu recht hübsche junge Dame war. Weshalb Herr Geung alle Mühe hatte, seine Kollegen davon zu überzeugen, dass er sie nicht attraktiv fand. Und durch die verschlungenen Flure und Gänge ihrer Krankheit fanden Geung und Tudka schließlich zueinander. Wie, wo und ob sie trieben, was sie trieben, wusste niemand. Nur die Waschpulverallergie an Geungs Hals und das dämliche Grinsen, das sich auf seinem Gesicht breitmachte, wenn ihr Name fiel, verrieten ihn. Er verweigerte sich allen Fragen zu diesem Thema. Wies sämtliche Unterstellungen zurück. Es war sein … ihr Geheimnis. Dennoch bestand kein Zweifel daran, dass Herr Geung überglücklich war.
Und so vertrieb das Personal der Pathologie sich die Tage. Siri zählte die Minuten. Dtui büffelte. Geung wippte. Dann plötzlich, an einem heißen Julimorgen, kam eine Nachricht. Keiner von ihnen hätte sich jemals träumen lassen, welch gewaltige Wirkung dieses unscheinbare Blatt Papier entfalten sollte.
Schweigend widmeten die Frühstücksgäste sich der verantwortungsvollen Aufgabe, Madame Daengs Nudeln zu vertilgen. Es war, als würde man einer Büffelherde dabei zusehen, wie sie – im Sitzen – eine üppige sattgrüne Weide abgraste. Obwohl man zusätzliche Hocker herbeigeschafft und diese aufs Geratewohl zwischen den Tischen verteilt hatte, gab es noch immer nicht genug Sitzplätze. Daeng und Siri baten die Gäste höflich, ihren Platz zu räumen, sobald sie ihr Mahl beendet hatten, sodass auch andere sich ihr Frühstück schmecken lassen konnten, aber Madame Daengs Nudeln ließen sich nicht schlingen. Sie waren die besten Suppennudeln auf der ganzen Welt. Hätte man die Kritiker vom Guide Michelin ins Land gelassen, hätten sie Daengs namenloses Restaurant mit Sternen buchstäblich gepflastert. Doch trotz alledem wäre es ihr nie und nimmer in den Sinn gekommen, die Preise zu erhöhen oder die Portionen zu verkleinern. Sie wusste eben, worauf es ankam.
Siri stand neben ihr und ließ den Blick stolz über den See von gekrümmten Schultern und wackelnden Köpfen schweifen.
»Ich brauche wohl keine Angst zu haben, dass wir verhungern, wenn ich in Pension gehe«, sagte er.
Daeng blickte vom Kessel auf, förderte behutsam ein Drahtsieb voller Nudeln daraus zutage und ließ es wieder im sprudelnden Wasser versinken. Sie war eine gutaussehende Frau mit struppigem, kurzgeschnittenem grauem Haar. Sie sah stets aus, als habe sie gerade eine rasante Fahrt mit dem Motorrad hinter sich, was nicht selten tatsächlich der Fall war.
»Wobei ich mir schon so meine Gedanken mache, wie wir ohne deine dreißigtausend Kip im Monat über die Runden kommen sollen«, erwiderte sie lächelnd. »Wie viel ist das derzeit auf dem internationalen Währungsmarkt? Ein Dollar fünfzig?«
»Zwei achtzig. Die zahlreichen Vergünstigungen nicht zu vergessen.«
»Ein Dutzend Mückenspiralen. Vier Kilo schädlingsverseuchter Reis. Das eine oder andere Gartenwerkzeug. Socken. Sechs Rollen selbstzersetzendes Toilettenpapier. Ich weiß nicht, wie wir ohne all das überleben sollen.«
»Und die Benzinration.«
»Zwei Liter im Monat. Da wirst du wohl oder übel auf mein altes Fahrrad umsteigen müssen.«
»Wo soll ich denn hinfahren? Ich werde einfach von morgens bis abends um dich sein – tagein, tagaus. Du jammerst doch ständig, dass wir zu wenig Zeit füreinander haben.«
»Aber man muss es ja nicht gleich übertreiben. Zwei Stunden vor dem Schlafengehen würden mir schon genügen.«
»Ich werde dir vierundzwanzig Stunden täglich zur gefälligen Verfügung stehen. Dein ergebener Liebessklave rund um die Uhr.«
Daeng lachte und schaufelte Nudeln in eine Schüssel Brühe. Da es keine freien Plätze mehr gab, setzte sich der Gast mit seinem Essen auf die unterste Treppenstufe.
»Siri, du könntest genauso wenig vierundzwanzig Stunden still sitzen wie ich. Du würdest ständig um mich herumscharwenzeln, deine Nase überall reinstecken. Und nimm’s mir nicht übel, aber wenn mir der Sinn nach einem Liebessklaven stünde, würde ich mir einen sehr viel jüngeren Mann suchen. Einen Bodybuilder. Angebote habe ich genug.«
»Ha! Da würde er es aber mit mir zu tun bekommen! Habt ihr gehört?«, rief er. »Wer auf die Idee kommt, mit meiner Frau durchzubrennen, muss es erst einmal mit mir aufnehmen.«
»Kein Problem«, sagte Pop, eine schrumplige alte Bohnenstange, deren Gewicht sich nach einer Portion von Daengs feurig-scharfer Nummer 2 mehr als verdoppelte. Er war vermutlich der einzige Gast im Restaurant, der älter war als Siri. »Sieh dich doch an«, sagte er zu Siri. »Noch keine zwei Wochen wieder auf den Beinen, gebrochene Hand, von oben bis unter voller Narben und blauer Flecken. Hä. Dich könnte ich mit einer Hand fertigmachen, besonders wenn ich Daeng dafür bekomme. Ein Schlag mit diesem Teelöffel, und du liegst flach.«
»Ach ja, Genosse?«, entgegnete Siri. »Das wollen wir doch mal sehen.«
Mit seiner gesunden Hand schnappte er sich ein Essstäbchen aus einem Glas und ging damit in Paradestellung wie ein Fechter. Pop stand auf und brachte den Teelöffel in Anschlag. Es kam zu einem Besteckduell, und die anderen Gäste feuerten die beiden Alten an, indem sie mit ihren Stäbchen laut klappernd gegen ihre Blechtassen schlugen.
Ein halbwüchsiger Knabe im weißen Hemd kam vom staubigen Gehsteig herein, warf einen verwirrten Blick auf die beiden Streithähne und schlich nervös zur Nudelköchin.
»Genossin«, sagte er. »Ich habe eine dringende Nachricht für Dr. Siri Paiboun. Bin ich hier richtig?«
»Das ist er«, antwortete sie. »Da drüben. Der kleine Junge mit dem weißen Haar und den struppigen Augenbrauen, der mit dem Stäbchen herumfuchtelt. Sie kämpfen um mich.«
Der Knabe war völlig verdattert.
»Na los. Gib sie ihm«, sagte sie. Zögernd trat er hinter Siri und tippte ihm auf die Schulter. Siri drehte sich um, und Pop nutzte die Gelegenheit und zog Siri seinen Teelöffel über das läppchenlose Ohr. Siri schrie jaulend auf und fiel in gespieltem Schmerz auf die Knie. Mit lautem Stäbchengetrommel wurde Pop zum Sieger gekürt. Kurz bevor ihn ein schmachvoller Teelöffeltod ereilte, riss Siri dem Knaben die Nachricht aus der ausgestreckten Hand, dann sank er auf den Boden der Nudelküche und starb. Kurz: ein ganz normaler Tag in Daengs Nudelrestaurant.
2
UNTERDESSEN IN METRO MANILA
Nino Sebastián hatte seine Zeit bei Air America durchaus gewinnbringend genutzt. Er hatte sparsam gelebt, sich hier und da mit kleinen Schiebereien etwas hinzuverdient und seinen Sold im Unterschied zu den Romeos vom Stützpunkt in Udon nicht in den Kneipen und Massagesalons verprasst. Nach Kriegsende war er nach Manila zurückgekehrt, hatte ein Haus gebaut, gleich nebenan eine Tankstelle eröffnet und ein Mädchen geheiratet, das ihn ohne die vierzigtausend Dollar in seiner Tasche mit dem Arsch nicht angesehen hätte. Seine Eltern zapften Benzin, seine Schwester stand am Herd des kleinen Cafés, und er und sein Bruder Oscar kümmerten sich um die Werkstatt. Alles lief bestens. Leben. Liebe. Schmieröl. Es war zwar nicht besonders abenteuerlich, aber das war nicht weiter schlimm. Wer das Abenteuer suchte, der riskierte, dass ihm die Eier weggeballert wurden. Und darauf konnte er getrost verzichten. Wenn er seinen Puls auf Touren bringen wollte, sah er sich einen Boxkampf an oder ging zum Jai alai.
Heute Abend fand ein Spiel statt: die Jets gegen Redemption. Er hatte ein hübsches Sümmchen auf die Reds gesetzt. Er wollte mit dem Pick-up zum Stadion fahren. Unterwegs seinen Cousin Poco aufgabeln. Es war ein schwüler Abend. Er hatte geduscht und sein türkisfarbenes Glückshemd angezogen, doch er schwitzte so stark, dass er am liebsten gleich noch einmal unter die Brause gestiegen wäre. Er schaute aus dem Küchenfenster und stellte wütend fest, dass in der Werkstatt Licht brannte. Oscar war nach Samal gefahren; es konnte sich also nur um einen Kunden handeln, der es besonders eilig hatte und die Unverfrorenheit besaß, einfach das Licht einzuschalten. Manche Leute hatten mehr Mumm als Manieren. Aber der Bursche konnte ihm sonst was bieten, an seinem pelota-Abend würde er keinen Finger rühren.
Als Nino die Werkstatt durch die Hintertür betrat, erblickte er einen dunkelhäutigen Mann, der den Kopf unter die Haube des 61er Cadillac steckte, an dem Nino und Oscar seit vier Wochen herumschraubten.
»Tut mir leid«, sagte Nino. »Aber wir haben schon geschlossen.«
»Macht nichts«, sagte der Mann. »Ich wollte nur mal fragen, ob Sie vielleicht eine Aushilfe gebrauchen können.«
Nino musterte den Fremden von Kopf bis Fuß. Er sah nicht gerade aus wie jemand, der sich gern die Finger schmutzig machte. Eher der pingelige Typ. Hinten in seinen Haaren steckte ein Kamm, als hätte er ihn nach der morgendlichen Körperpflege dort vergessen. Manche jungen Leute hielten das für cool. Nino hielt es für bescheuert. Und wie um noch eins draufzusetzen, trug der Kerl trotz der Hitze ein Jackett, vergoss jedoch nicht einen Tropfen Schweiß.
»Nee, wir machen hier alles selbst. Ich und mein Bruder. Wir nehmen nur so viele Reparaturen an, wie wir zu zweit erledigen können. Tut mir leid.«
Der Fremde zuckte die Achseln.
»Kein Problem. Fragen kostet ja nichts.« Er warf einen letzten Blick auf den Motor. »Nehmen Sie’s mir nicht übel, aber ich glaube, beim Einbau des Vergasers ist Ihnen ein kleiner Fehler unterlaufen.«
»Wie bitte?« Wenn es um Motoren ging, war Nino noch nie ein Fehler unterlaufen.
»Da«, sagte der Kerl. »Sie haben den Drosselhebel falschrum angebracht.«
Nino hastete zum Wagen und sah unter die Haube.
»Soll das ein Witz sein?«, sagte er. »Der ist hundertpr…«
Er spürte kaum, wie ihm die Nadel in den Hals drang, und im Handumdrehen war es mit Nino Sebastián vorbei.
3
PEACH
Die Regenzeit, die in Nordlaos normalerweise zwischen April und August fiel, hatte dieses Jahr schon Mitte März begonnen, und im Juni war ihr der Saft ausgegangen. Obgleich Flutwasser aus China den Mekong hatte anschwellen lassen und im Süden schwere Unwetter wüteten, hatte es in Vientiane seit einem Monat nicht geregnet. Die – in der DDR ausgebildeten – laotischen Meteorologen waren der Ansicht, dass die Industrialisierung im Westen, vor allem aber in den USA, die Umwelt nachhaltig veränderte. Sie forderten ein Symposium kommunistischer Staaten zu den Auswirkungen des Kapitalismus auf den Klimawandel. In der Demokratischen Volksrepublik Laos gab es wenig, was sich nicht den Amerikanern in die Schuhe schieben ließ, und um ehrlich zu sein, waren die meisten Vorwürfe berechtigt.
Vientiane bestand aus unbefestigten Seiten- und gepflasterten Hauptstraßen, angelegt von denselben Amerikanern, die nun das Wetter durcheinanderbrachten. Der ebenso anhaltende wie frühzeitige Regen des Jahres 1978 hatte die rote Erde aus den Gassen auf die Hauptstraßen geschwemmt. Gärten, Reisfelder und Brachen erstreckten sich in alle Himmelsrichtungen. Die Stadt war ein einziger großer Morast. Die Rinnsteine waren verstopft, die Schlaglöcher unter einer Schlammschicht verschwunden. Die Gehsteige, sofern vorhanden, befanden sich auf einer Höhe mit der Fahrbahn. Dieser riesige Matschkuchen buk in der brennend heißen Julisonne und zerfiel unweigerlich zu Staub. Eine vorbeihuschende Katze wirbelte mehr Staub auf als eine Herde Gnus, die durch die Kalahari galoppiert. Mit dem Besen war dem schwerlich beizukommen. Trotz der Hitze schlossen die Leute Türen und Fenster. Wer einen Gartenschlauch und einen Anschluss ans Versorgungsnetz besaß, spritzte jeden Morgen bei Sonnenaufgang die Straße ab. Doch schon gegen Mittag war der rote Dunst zurück. Bis zum offiziellen Beginn der Trockenzeit waren es noch gut vier Monate, und wenn es so weiterging, war Vientiane bis dahin von der Landkarte verschwunden, auf Satellitenbildern als Stadt nicht mehr zu erkennen.
Siri hatte sich seinen Reservesarong um den Kopf geschlungen, damit ihm der Staub nicht in den Mund flog. Er trug seine alte Motorradbrille mit den dunklen Gläsern und eine Castro-Mütze und sah ziemlich zwielichtig aus, als er vor dem Justizministerium hielt. Er hätte sich natürlich auch anders entscheiden und die Nachricht, mit der sein Intimfeind Richter Haeng ihn um eins in sein Büro bestellte, einfach zerreißen können. Er stand kurz vor der Pensionierung. Was konnten sie ihm da schon anhaben? Aber Siri hatte eine boshafte Ader, und nichts bereitete ihm größeres Vergnügen, als seinem Vorgesetzten auf den sprichwörtlichen Schlips zu treten. Sehr viel Gelegenheit würde er dazu nicht mehr haben. Die Wache am Tor entbot ihm einen militärischen Gruß. Der Junge war unbewaffnet und steckte in einer Uniform, die gleich drei grundverschiedene Grüntöne in sich vereinte. Siri, der immer noch als Terrorist verkleidet war, stieg von seinem Motorrad und ging zum Wachhäuschen.
»Wissen Sie, wer ich bin?«, fragte er den Jungen.
»Nein, Genosse«, lautete die Antwort, gefolgt von einem weiteren Gruß.
»Ich könnte also durchaus ein Attentäter sein, der den Richter und den Minister ermorden will. Ich könnte einen Sprengstoffgürtel unter der Jacke tragen.«
Der Junge machte ein zweifelndes Gesicht.
»Na ja, möglich wär’s.«
»Und trotzdem grüßen Sie mich?«
»So lautet mein Befehl, Onkel.«
»Das ist alles?«
»Ja.«
»Himmel, hilf«, murmelte Siri, ließ den Wachsoldaten stehen und stieg die Vortreppe des Ministeriums hinauf. »Welch ein System«, sagte er laut vor sich hin. »Schnöder Schein und nichts dahinter. Das Land versinkt in Schutt und Asche, aber Hauptsache, es wird ordentlich gegrüßt.«
Oben angekommen schüttelte er den Staub aus seinen Sandalen und trat an den Empfang. Dort herrschte gähnende Leere: acht Schreibmaschinen ohne Schreibkräfte und ein großer Verwaltungsschreibtisch ohne Manivone, die Sekretärin des Richters. Wäre zufällig ein geschäftstüchtiger Dieb des Weges gekommen, hätte er die Maschinen, womöglich mit tatkräftiger Unterstützung des hilfsbereiten Wachsoldaten, ohne Weiteres zur Tür hinausbefördern und in einem wartenden samlor-Fahrradtaxi verstauen können. Der Laden ging vor die Hunde. Ein Glück, dass Siri ihm bald den Rücken kehren konnte.
Noch immer missgelaunt, stakste er über den offenen Korridor zu Richter Haengs Büro und stieß die Tür auf, ohne anzuklopfen. Die Tür knallte gegen etwas Großes, Weiches und öffnete sich dann. Siri betrat den kleinen Raum, der von nur einem Fenster mit kaputter Jalousie erhellt wurde. Unter Siris verbotenen Büchern befand sich auch ein prächtiger Bildband über die Wunder dieser Welt, und die Sonne, die sich durch das winzige Fenster quetschte, überzog die Wände mit einem Schattenmuster, das ihn an Stonehenge gemahnte. Im Zimmer drängte sich eine Horde ungemein beleibter Westler. Manche saßen, andere standen, die meisten trugen Uniform, und alle schwitzten, da der einsame Deckenventilator gegen die stickige Juliluft nur wenig auszurichten vermochte. Lauter ölig-weiße Männer und zwei Frauen. Eine der beiden Letzteren erinnerte Siri an einen beperückten Sumo-Ringer im Sommerkleid.
Trotz dieses Gedankens besann er sich seiner guten Kinderstube. Er ging von einem zum anderen, schüttelte Hände und sagte artig sabai dee – Wohlsein. Alle schlugen bereitwillig ein – bei diesen Temperaturen blieb kein Pfötchen trocken. Einige erwiderten den Gruß. Andere antworteten ihm auf Englisch, eine der vielen Sprachen, die er nicht beherrschte. Als er so die Runde machte, kam er sich vor wie ein Tourist zwischen den Steinriesen der Osterinsel. Im hintersten Winkel des Zimmers stieß er auf Richter Haeng, der an seinem Schreibtisch saß und sich an ein mattes Lächeln klammerte. Sein fettiges Haar fiel ihm in das pickelige, aufgedunsene Gesicht. Hitze und Stress waren Gift für seine Haut. Der kleine Richter litt wahrscheinlich unter beidem.
»Siri? Sind Sie’s?«, erkundigte er sich.
Im ersten Moment erschien Siri die Frage reichlich absurd, als habe der Mann quasi über Nacht das Augenlicht verloren. Doch dann fiel dem Doktor ein, dass er noch immer seine Verkleidung trug. Das Zimmer wurde etwas heller, als er seine getönte Brille absetzte, und kühler, als er Schal und Kopfbedeckung auszog. Kaum hatte er abgelegt, wirkten auch die Gäste um einiges entspannter.
»Was ist denn hier los?«, fragte Siri den Richter.
»Amerikaner.«
»Wieso? Haben sie etwas vergessen?«
»Es handelt sich um eine Delegation, Siri.«
»Und was wollen sie?«
»Ich … Ich bin … Ich …«
»Sie wissen es nicht.«
»Doch, natürlich. Aber …«
»Sie sprechen kein Englisch, stimmt’s?«
»Das kann man so nicht sagen. Es ist nur ein wenig eingerostet, weiter nichts. Und Sie?«
»Ein paar Brocken, aber die dürften uns kaum weiterhelfen.«
»Ich dachte, Sie waren in Westeuropa?«
»Frankreich. Eine völlig andere Sprache. Das bisschen Englisch, das ich kann, habe ich von Seeleuten in Hafenkneipen aufgeschnappt. Rule Britannia«, rief er laut und reckte den Daumen in die Höhe. Alle starrten ihn entgeistert an. »Sehen Sie? Völlig nutzlos. Spricht denn keiner von ihnen Laotisch?«
»Nein.«
»Seit wann reisen ausländische Delegationen ohne Dolmetscher?«
»Es scheint etwas dazwischengekommen zu sein. Der Minister hat sie hierhergebracht und mich gebeten, sie bei Laune zu halten, bis die Dolmetscher eintreffen.«
»Haben Sie ihnen schon Ihre Richard-Nixon-Parodie vorgeführt?«
Aber solche Scherze waren verlorene Liebesmüh bei einem Mann bar jeglichen Humors.
»Ich weiß nicht, wovon …«
»Und wie haben Sie sie dann bei Laune gehalten, Richter?«
»Wir hatten keine Limonade mehr. Ich habe Manivone losgeschickt, um welche zu besorgen. Ich hatte ja nicht mit ihnen gerechnet. Das übrige Personal bereitet das Mittagessen zu. Sie stehen jetzt seit einer Viertelstunde hier herum.«
Siri lachte.
»Aber Sie, Siri«, sagte Haeng in gestrengem Ton, »Sie kommen wie immer zu spät. Ich habe Ihnen aufgetragen, um ein Uhr hier zu sein. Jetzt ist es Viertel nach eins.«
»Man hat mir die Uhr geklaut. Ich musste mich nach dem Stand der Sonne richten, und die war vor lauter Staub nirgends zu sehen. Richter Haeng, hier schmoren alle im eigenen Saft, und es riecht ein wenig streng. Was halten sie davon, wenn wir die Klimaanlage einschalten?«
»Die ist seit letzten Mittwoch defekt.«
»Und wenn wir die Leute draußen unter einen Baum stellen?«
»Das sind doch keine Schafe, Siri.«
Siri bedachte die dürstenden Gäste mit einem Lächeln.
»Sie wären sicher dankbar für ein wenig frische Luft.«
»Der Minister hat gesagt …«
In diesem Augenblick wurde die Bürotür aufgestoßen und kollidierte mit dem Hinterteil desselben Mannes, den auch Siri bei seinem Eintreffen gerammt hatte. Da er noch immer an derselben Stelle stand, schien er es nachgerade zu genießen, eine Tür ins Kreuz geschmettert zu bekommen. Eine blonde junge Frau stürzte nervös lachend ins Zimmer. Plötzlich redeten alle in ihrer Sprache durcheinander; Grußformeln, Bemerkungen und kollektives Aufatmen gaben Anlass zu der Hoffnung, dass die Delegation endlich ins Freie entlassen werden würde. Nachdem die junge Frau die Runde gemacht hatte, wandte sie sich Haeng und Siri zu und entbot ihnen einen vollendeten nop: Sie legte die Handflächen in Kinnhöhe aneinander, sodass ihre Nase nur Millimeter über ihren Fingernägeln schwebte, und neigte den Oberkörper in ihre Richtung.
»Verehrte Herren«, sagte sie in herrlichstem Laotisch. »Wohlsein. Ich bitte mein Zuspätkommen zu entschuldigen.«
Trotz ihres Alters und ihrer Stellung ertappten Haeng und Siri sich dabei, wie sie den nop erwiderten. Siri lächelte. Haeng errötete verlegen. Das Politbüro hatte die Geste als bourgeoisen Rückfall in die Zeit der Knechtschaft unter dem Joch der Royalisten verurteilt. Doch nun fand er sich einer weißen Imperialistin gegenüber, die sich in seinem Land seiner Sprache und seiner Gesten bediente, weshalb ihm nichts anderes übrig blieb, als Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Sein Unbehagen wurde noch verstärkt durch die Tatsache, dass sie geradezu beschämend attraktiv war.
»Ich hatte einen Kurs am lycée«, fuhr sie lächelnd fort. »Eigentlich hätte ich höchstens zehn Minuten bis hierher gebraucht, aber mein Fahrrad hatte einen Platten, den ich erst einmal flicken musste, daher der Staub an meinem Rock und die Schweißflecken in meinem Gesicht. Normalerweise sehe ich wesentlich gepflegter aus. Wirklich.«
In Gedanken schloss Siri die Augen und lauschte dem klangvollen Singsang ihrer Stimme, die ihn an die jungen Mädchen aus der Gegend nördlich von Luang Prabang erinnerte. Es war sein bei Weitem liebster Akzent. Selbst die dicksten Frauen mit den haarigsten Zehen konnten das Herz eines Mannes mit diesem Zungenschlag im Sturm erobern.
»Wo haben Sie Laotisch gelernt?«, erkundigte er sich fasziniert.
»Meine Eltern waren Missionare in Ban Le an der Grenze bei Luang Prabang. Ich bin dort geboren«, antwortete sie.
»Sie sind Laotin«, sagte er lachend, ohne einen Anflug von Herablassung.
»Im Herzen, ja«, sagte sie. »Aber auf meinem Reisepass prangt ein Adler, und ich bin dazu verdammt, in diesem fetten, unförmigen farang-Körper mein Dasein zu fristen. Offiziell bin ich eine von denen.«
Sie wies mit einem Nicken zu der schweißfeuchten Delegation. Die Amerikaner fragten. Sie antwortete. Plötzlich blitzten allenthalben strahlend weiße, fachmännisch regulierte Zahnreihen. Sie hatte offenbar die richtigen Worte gefunden. Ihr diplomatisches Geschick schien ebenso beeindruckend wie ihr äußere Erscheinung. Sie war alles andere als unförmig, sondern schlankgliedrig wie ein junges Rennpferd, mit frischem, rosigem Teint. Diese junge Frau würde noch vielen Männern das Herz brechen, wenn sie es nicht längst getan hatte. Obgleich es nicht ganz leicht war, das Alter eines Westlers zu bestimmen, schätzte Siri sie auf höchstens sechzehn oder siebzehn. Dass sie Peach – Pfirsich – hieß, ließ sie nur noch appetitlicher erscheinen.
Richter Haeng, der in den wenigen noch verbliebenen Nachtclubs von Vientiane ob seiner Vorliebe für junge Damen wohlbekannt war, schien zu demselben Schluss gelangt zu sein. Er hatte sein erschlafftes Lächeln auf Vordermann gebracht und stützte das Kinn in die Hand wie ein eitler Schriftsteller in Denkerpose.
»Sie sind sehr schön«, sagte er. Die Worte eines alten Lustmolchs.
»Danke«, sagte sie. »Aber das ist ein zeitweiliges Privileg der Jugend, weiter nichts. Wahrscheinlich werde ich zu viel essen und trinken und aufgehen wie ein Hefekloß, bevor ich dreißig bin.«
Ihr Lächeln brachte das Zimmer zum Leuchten. Siri war hingerissen. Ein mythisches Wesen aus der amerikanischen Version der Ramayana war in ihrer Mitte gelandet und redete in ihrer Zunge. Obwohl sie fließend Laotisch sprach, wirkte sie wie von einem anderen Stern. Vielleicht lag es an ihrer Jugend, aber sie hatte nichts von dem sittsamen Reiz einer Laotin. Sie bot den Männern mutig die Stirn. Sie war rauherzig wie ein Soldat, und Siri konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie ihrem Beschäler mit Freuden den Kopf abgebissen hätte, wenn sie mit ihm fertig war. Richter Haeng irrte sich gewaltig, wenn er glaubte, sich solch ein Geschöpf mit seinen üblichen Balzritualen gefügig machen zu können.
4
DER SUMO-RINGER IM SOMMERKLEID
In der Suite, die an das Büro des laotischen Justizministers grenzte, stand ein Konferenztisch aus Teakholz. Er war so groß und schwer, dass man ihn in Stücke hatte sägen müssen, um ihn in den dritten Stock hinaufzuwuchten. Die Remontage war nicht ganz reibungslos verlaufen, und nun zogen sich zwei unschöne, mit dem Schriftzug »Happy New Year« versehene Klebestreifen über die Platte, um die Fugen zu kaschieren. Auf der einen Seite des Tisches saß die amerikanische Delegation, auf der anderen die Laoten. Zwar gab es auch zwei durchaus brauchbare Tischenden, doch wie es schien, durfte dort niemand Platz nehmen. Die beiden Abordnungen belauerten einander wie zwei Footballmannschaften vor dem Anpfiff. Es waren sieben Amerikaner, die Dolmetscherin nicht mitgerechnet, und sieben Laoten.
Siri war nicht sonderlich erstaunt, als er erfuhr, dass der laotische Simultandolmetscher, Richter Haengs Cousin Vinai, mit Kehlkopfentzündung im Bett lag. Zum Leidwesen des stellvertretenden Ministers wurde die Konferenz von Peach, der Missionarstochter, geleitet, und auch wenn sich ihre Übersetzungskünste nur schwer verifizieren ließen, wirkte sie derart überzeugend, dass die beiden Parteien bald eifrig Höflichkeiten und Grußformeln austauschten. Wie alle guten Dolmetscher wurde sie rasch unsichtbar – außer für Richter Haeng, der sie über den Tisch hinweg grienend beäugte.
Justizminister Bounchu war von Haus aus Militär, was mehr oder weniger auf alle seine Kabinettskollegen zutraf, von denen einige mit dem Umstieg vom Tarnanzug auf grauen Flanell so ihre Schwierigkeiten hatten. Bounchu war sein halbes Leben Soldat gewesen und hatte die Revolution in den Höhlen von Sam Neua miterlebt. Was Wunder, dass er sich inmitten von Mörserfeuer wohler fühlte als in Diplomatenkreisen? Trotz seiner Leibesfülle und seiner grimmigen Miene wirkte er leicht verschüchtert, wie ein rasierter Eisbär in einem schlechtsitzenden Smoking. Dieses Ministerium war die Belohnung für sein heldenhaftes Leben, eher ein Pöstchen als ein Amt. Er nickte, lächelte und überließ sämtliche Entscheidungen seinen Lakaien. Er saß dem Sumo im Sommerkleid, der demokratischen Abgeordneten Elizabeth Scribner aus Rhode Island, gegenüber. Miss Scribner, die man wahrscheinlich ihres Körperumfangs wegen für diese Mission auserkoren hatte, war keine lächelnde, stets freundliche Politikerin. Im Gegenteil, und man durfte getrost vermuten, dass sie nur in den Kongress gewählt worden war, weil ihr Anblick den Leuten Angst und Bange machte.
Siri, der noch immer keinen Schimmer hatte, was er hier eigentlich sollte, lauschte erst der pompösen Ansprache des Ministers, dann der Lesung aus der umfangreichen Korrespondenz zwischen dem Missionschef des US-Konsulates in Vientiane und dem Außenministerium der Pathet-Lao-Regierung. Im April 1975 war Saigon an die Viet Minh gefallen, und acht Monate später hatten die Pathet Lao in einem wohlorganisierten Handstreich Vientiane eingenommen. Als faire Gewinner ließen sie den Amerikanern ihr Konsulat unter der Bedingung, dass sämtliche CIA-Agenten ihren Posten räumten. Zurück blieben insgesamt sechs Beamte, die Vientiane normalerweise nicht verlassen und nur gelegentlich den Mekong überqueren durften, um einen Einkaufsbummel durch Nong Kai zu machen oder sich in Bangkok zu vergnügen. Zwar hatte das State Department versucht, den einen oder anderen Schlapphut als Buchhalter oder Putzkraft einzuschleusen, doch die PL verfügten über eine umfassende Liste mit den Namen und Biografien von CIA-Mitarbeitern, die sie den überaus findigen Sowjets zu verdanken hatten. Weshalb das verbleibende Personal des Konsulates wenig mehr zu tun hatte, als selbiges in Schuss zu halten und die PL mit Memos zu bombardieren. Der Belegschaft war es ausdrücklich verboten, in Laos umherzureisen. Das Lager der US-Hilfsorganisation USAID war geschlossen und die Angestellten eilig außer Landes geflogen worden. Und so hielten sich offiziell nur noch ein paar Dutzend US-Bürger in Laos auf. Einige arbeiteten als Lehrer oder waren mit Laoten verheiratet, andere missionierten für die Quäker oder Mennoniten.
Wie aus der Korrespondenz hervorging, hatte das Konsulat vor etwa einem Jahr um die Erlaubnis gebeten, nach US-Bürgern zu fahnden, die in laotischen Kriegsgefangenenlagern festgehalten wurden. Die Laoten hatten die Amerikaner freundlich darauf hingewiesen, dass im Zuge des sogenannten »Homecoming«-Programms sämtliche militärischen und politischen Häftlinge in Laos und Vietnam ihren jeweiligen Delegationen übergeben worden seien. Nicht ohne hinzuzusetzen, dass der Krieg vorbei und es daher wenig sinnvoll sei, sie weiter festzuhalten. Doch die Vermisstenlobby in den USA war stark, und es mehrten sich die Hinweise darauf, dass sich tatsächlich ehemalige US-Soldaten auf laotischem Gebiet aufhielten. Die PL hatten das Konsulat in gleich mehreren Memos daran erinnert, dass sich, wie im Genfer Abkommen über die Unabhängigkeit und Neutralität von Laos aus dem Jahre 1962 festgeschrieben, noch nie amerikanische Militärs auf laotischem Grund und Boden befunden hätten. Da offiziell weder Bodentruppen noch Angehörige der US-Luftwaffe in Laos stationiert gewesen waren, hatten die PL sich scherzhaft danach erkundigt, wie die vermissten Soldaten denn, bitte schön, in ein Kriegsgefangenenlager in einem neutralen Land hätten gelangen sollen. Das Hin und Her drohte in einer Sackgasse zu enden.
Da ihre Mitarbeiter weder reisen, noch nach vermissten Soldaten fahnden durften, forderte die US-Botschaft in Bangkok die laotischen Bürger auf, sich mit Hinweisen auf abgestürzte Flugzeuge und/oder die sterblichen Überreste amerikanischer Flieger an das Konsulat in Vientiane zu wenden, wo US-Beamte sie auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen würden. Unbestätigten Gerüchten zufolge winkte für echte Funde eine nicht unerhebliche Belohnung. Die Amerikaner hätten sich nicht träumen lassen, was das für einen Ansturm auslöste; die Warteschlange zog sich um den ganzen Block. Die Bürger hatten keine Mühen gescheut, um sich einen Passierschein zu besorgen, der es ihnen erlaubte, in die Kapitale zu reisen und ihre Mitbringsel und Andenken dort einzureichen. Andere schickten Pakete mit der wenig verlässlichen Post und exakten Angaben, wohin die Schecks zu senden seien. Ein Mitarbeiter des Zentralen Identifikationslabors in Bangkok musste sich durch Berge von Knochen wühlen – die zumeist von Schweinen stammten. Die zahllosen Zähne nicht zu vergessen, darunter so manches Beißerchen, das einem betagten Verwandten vor dessen Ableben aus dem Mund gerissen worden war. Es fanden sich aus Kronkorken gefertigte Hundemarken und Fotos von Onkel Dtoom, der zwar ein Albino war, aus einer bestimmten Perspektive jedoch haargenau wie ein US-Flieger aussah. Ein besonders hoffnungsfroher Antragsteller schickte gar die vordere Stoßstange eines alten Ford, der, so schwor er Stein und Bein, vom Himmel gefallen sei, als er sein Reisfeld beackert habe.
Trotz ihrer offensichtlich zweifelhaften Herkunft musste sämtlichen Hinweisen nachgegangen werden. Alle angeblichen Fundstellen wurden auf einer Landkarte mit einem Kreuz markiert, und schon nach einem halben Jahr war die Zahl der Kreuze höher als die der Soldaten im Dienst der US-Streitkräfte. Gerade so als sei über jedem noch so entlegenen laotischen Dorf ein Flieger abgestürzt. Dennoch konnte in all der Zeit kein einziger von ihnen zweifelsfrei identifiziert werden, und so wurde das Programm schließlich eingestellt. Die Washingtoner Lobby war davon nicht eben begeistert, darum setzte die US-Botschaft auf Plan B und regte an, gemischte amerikanisch-laotische Teams aufs Land zu entsenden und das Beweismaterial von Fachleuten prüfen zu lassen.