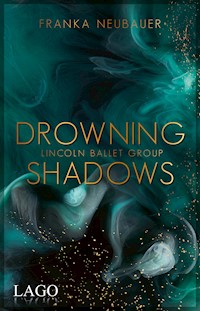
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lago
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Grace hat ein Ziel: als Balletttänzerin in New York ihren Platz finden. Doch das Leben in der strahlenden Metropole ist nicht so, wie sie es sich erhofft hat. Trotz Panikattacken und Alpträumen schlägt sie sich durch, bis sie bei einer Audition der Lincoln Ballet Group den Choreografen Eliot kennenlernt. Eliot, der ihr deutlich zeigt, dass er sie nicht dabeihaben möchte. Eliot kämpft dabei mit seinen ganz eigenen Sorgen: Im Winter steht seine erste eigene Aufführung an, die nicht nur perfekt werden muss, sondern ihn zurück in eine Zeit wirft, die er für immer vergessen will. Die verwirrende Ablenkung in Form der Tänzerin Grace kann er dabei wirklich nicht gebrauchen. Doch je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto näher kommen sie sich. Nur ist Eliot nicht der einzige, der mit seiner Vergangenheit kämpft, auch Grace scheint etwas vor ihm zu verbergen. Etwas, das nicht nur ihre Herzen in Gefahr bringt, sondern auch ihre Leben … Nachdem Franka Neubauer als »bloggingwithfranka« schon viele Menschen auf Bookstagram erreicht hat, wird ihr Debüt nun direkt in das Herz der Buchliebhaber*innen treffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
FRANKA NEUBAUER
DROWNING SHADOWS
LINCOLN BALLET GROUP
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Originalausgabe
1. Auflage 2023
© 2023 by LAGO Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Jil Aimée Bayer
Umschlaggestaltung: Isabella Dorsch
Umschlagabbildung: Shutterstock.com/Anna Holyph, ivan_kislitsin, Olga Moonlight
Satz: inpunkt[w]o, Haiger (www.inpunktwo.de)
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95761-224-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-95762-340-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95762-341-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.lago-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für das kleine Mädchen, das von einer Zukunft geträumt hat, in der ihre Geschichten Platz haben.
Für die Jugendliche, die so in ihren Ängsten gefangen war, dass sie sicher war, es würde nie wieder besser werden.
Wir haben es geschafft.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1: Grace
Kapitel 2: Eliot
Kapitel 3: Grace
Kapitel 4: Eliot
Kapitel 5: Grace
Kapitel 6: Grace
Kapitel 7: Eliot
Kapitel 8: Grace
Kapitel 9: Eliot
Kapitel 10: Grace
Kapitel 11: Eliot
Kapitel 12: Grace
Kapitel 13: Eliot
Kapitel 14: Grace
Kapitel 15: Eliot
Kapitel 16: Grace
Kapitel 17: Eliot
Kapitel 18: Grace
Kapitel 19: Eliot
Kapitel 20: Grace
Kapitel 21: Eliot
Kapitel 22: Grace
Kapitel 23: Eliot
Kapitel 24: Grace
Kapitel 25: Eliot
Kapitel 26: Grace
Kapitel 27: Eliot
Kapitel 28: Grace
Kapitel 29: Eliot
Kapitel 30: Eliot
Kapitel 31: Grace
Kapitel 32: Grace
Kapitel 33: Eliot
Kapitel 34: Grace
Kapitel 35: Eliot
Kapitel 36: Grace
Kapitel 37: Grace
Kapitel 38: Eliot
Kapitel 39: Eliot
Kapitel 40: Grace
Kapitel 41: Grace
Kapitel 42: Eliot
Kapitel 43: Grace
Kapitel 44: Grace
Kapitel 45: Grace
Kapitel 46: Eliot
Kapitel 47: Grace
Kapitel 48: Grace
Epilog
Nachwort
Danksagung
Prolog
Mit zittrigen Fingern umklammerte ich den kalten Metallrand des Waschbeckens, während mein Blick förmlich an meinem Spiegelbild klebte. Meine Sicht verschwamm, als meine Augen sich mit Tränen füllten. Trotzdem löste ich meinen Blick nicht vom Spiegel, nahm nichts anderes wahr als das intensive Blau meiner Augen. Früher hatten sie mich immer an die Farbe des Ozeans erinnert, besonders, wenn sie wie jetzt ganz nass vor Tränen waren und so schön schimmerten. Ja, früher waren sie mein liebstes Merkmal an mir gewesen. Jetzt reichte alleine ein zu langer Blick in meine Augen aus, dass sich Schweiß auf meiner Stirn bildete und mein Magen verkrampfte. Als das Prickeln auf meiner Haut nicht mehr auszuhalten war, wandte ich mich ab und stieß kraftvoll den Atem aus, den ich angehalten haben musste.
Allein der Gedanke, dass ein Blick in mein Gesicht ausreichte, mich in eine Panikattacke zu schicken, ließ mich innerlich auflachen, weil das alles so unendlich bizarr war. Wie hatte ich nur hier enden können? In einem abgeranzten Motelzimmer am Ende von Las Vegas? Noch dazu auf der Flucht vor meinem Leben, dem ich niemals entkommen konnte, ganz egal, wie weit ich rannte.
Es war absurd, einfach nur absurd. Und doch war ich hier. Mühsam hob ich meinen Kopf, um erneut in den Spiegel zu sehen.
Ich fuhr mit meinen Fingern die Konturen meines Gesichts nach, die mir so vertraut sein sollten wie nichts anderes in dieser Welt, weil ich sie tagtäglich gesehen hatte. Was einst leicht rundlich gewesen war – mit rot glühenden Wangen –, wirkte jetzt eingefallen und blass. Ich kannte jede Wölbung, jede Form, jede Kurve auswendig. Und trotzdem fühlte ich mich seit Minuten so, als würde ich eine völlig Fremde anstarren – und irgendwie tat ich das ja auch. Das strahlende Blond meiner Haare hatte ich mit einem dunklen Braun, das beinahe schwarz wirkte, erstickt und die langen Strähnen radikal abgeschnitten, bis sie nur noch knapp mein Schlüsselbein berührten und mir ein fransiger Pony ins Gesicht fiel. Der Schnitt war schief und meine Haare sahen genau so strapaziert aus, wie ich mich fühlte, aber es war mir egal. Alles war mir egal, weil da nur noch dieser tiefe Schmerz in mir saß. Ein Schmerz, den ich nie wieder loswerden würde, egal, wie krampfhaft ich versuchte, alles hinter mir zu lassen. Das wusste ich, er gehörte ab jetzt zu mir.
Mein Abbild hatte nichts mehr mit dem Mädchen gemein, das mir all die Jahre entgegengestarrt hatte. Doch ganz egal, wie oft ich Farbe und Frisur wechselte, unter wie viel oder wenig Schminke ich mein Gesicht zu verbergen versuchte, wie anders ich auch aussehen mochte, mich selbst würde ich nie belügen können. Wie auch? Meine Erinnerungen würden durch einen anderen Haarschnitt nicht verschwinden. Das Schlimmste würde bleiben – in mir drin. Da war diese Leere, von der ich mir nicht vorstellen konnte, sie jemals wieder füllen zu können. Die Ereignisse jener Nacht hatten sich in mein Gehirn gebrannt wie ein heißes Eisen in meine Haut. Ich würde die Narben immer in mir tragen, unsichtbar für jeden, doch täglich sichtbar für mich selbst. Mein Versagen, meine Schuld – sie brannten auf meiner Haut und zerfraßen meine Seele jeden Tag etwas mehr.
Deine Haare sind wunderschön, du darfst sie niemals abschneiden, Prinzessin, flüsterte eine mahnende Stimme in meinem Kopf und meine Finger krallten sich wie von selbst fester in das kalte Metall des Waschbeckens. So fest, dass ich glaubte, es würde nachgeben und sich unter meiner Verzweiflung verbiegen.
Ich widerstand dem Drang, erneut zur Schere zu greifen und meine Haare noch kürzer zu schneiden, weil es nichts bringen würde. Auch wenn ich mir jede Strähne vom Kopf riss – aus Angst, aus Wut, aus Trotz –, es würde nichts mehr ändern.
Seufzend löste ich endgültig den Blick von meinem Spiegelbild und drehte den Hahn auf, um mir eine Ladung eiskaltes Wasser ins Gesicht zu spritzen. Es half ein wenig gegen mein heiß glühendes Gesicht, aber in mir tobten so viele Emotionen, die ich nicht voneinander trennen konnte, dass mir nur wenige Sekunden später wieder viel zu heiß wurde. Ob vor Wut oder aus Angst oder weil die Klimaanlage des Motels kaputt war, wusste ich nicht. Es war auch nicht wichtig.
Mit immer noch viel zu zittrigen Händen griff ich nach dem Handtuch. Trocknete mein Gesicht ab, schloss die Augen und konzentrierte mich nur auf das Gefühl des rauen Stoffes auf meiner Haut. Auf den Geruch nach billiger Seife. Nachdem sowohl mein Gesicht als auch meine Hände trocken waren, straffte ich die Schultern, legte für einen Moment den Kopf in den Nacken und holte tief Luft. Ich atmete ein, langsam. Atmete aus, noch langsamer. Immer wieder, bis mein Puls nicht mehr galoppierte und ich zu frösteln begann, weil die Hitze meinen Körper verlassen hatte, der Angstschweiß jedoch geblieben war.
»Du schaffst das. Reiß dich zusammen. Du. Schaffst. Das«, flüsterte ich die Worte meinem zweiten Ich zu. Kurz wartete ich auf eine Reaktion. Auf ein ermutigendes Lächeln oder ein bestärkendes Zwinkern. Doch der Spiegel blieb nur schmutziges Glas und meine Miene hoffnungslos.
Ich ließ beides hinter mir und wandte mich zur Tür, die mich zurück in das sparsam eingerichtete Zimmer führte.
Auf dem Bett, in dem ich selbst dann nicht schlafen würde, wenn der Teufel es mir unter Höllenqualen befahl, befand sich meine große Trainingstasche. Darin hatte ich alles verstaut, was ich noch besaß. Mein ganzes Leben reduziert auf den wichtigsten Besitz, der nur dazu diente, mich durchzuboxen. In der Tasche gab es ebenso wenig Platz für Sentimentalität wie in mir. Wenn ich mir jetzt erlaubte, wirklich darüber nachzudenken, was ich hier gerade tat, was vor knapp drei Monaten geschehen war und wie mein perfektes Bilderbuchleben innerhalb einer Nacht aus sämtlichen Fugen gerissen worden war, wäre ich zu gelähmt, um klar denken zu können. Es wunderte mich schon, dass ich es überhaupt bis hierher geschafft hatte und jetzt nur noch in den Bus steigen musste, um von hier fortzukommen. Die Angst vor dem Unbekannten war groß, keine Frage. Doch die Angst vor dem, was geschehen könnte, wenn ich hierblieb, war viel größer. Viel schmerzhafter. Und irgendwie war das tröstlich, so verquer das auch klang. Denn nur so – wegen dieser Angst – hatte ich es geschafft, all die lähmenden und zugleich beißenden Gefühle, die mich innerlich erstarren ließen und zugleich verbrannten, in einen Motor zu verwandeln.
Halte noch ein paar Stunden durch, Grace. Ein paar Stunden, dann bist du fort von hier. Dann darfst du zusammenbrechen, aber nicht jetzt. Noch nicht jetzt! Halte durch!
Seit Wochen hielt mich dieses immer gleiche Mantra am Leben und mit jedem geschafften Tag verringerte sich die Zeit, die ich durchhalten musste. Inzwischen verblieben nur noch wenige Stunden und ich würde jetzt ganz sicher nicht aufgeben.
Um meine verräterischen Hände, die mittlerweile doch wieder bebten, abzulenken, griff ich nach der dunklen Plastiktüte in meiner Tasche. In ihrem Inneren befand sich eine viel zu hohe Summe Geld, von der für mich jedoch alles abhing. Darum bemüht, nicht laut mitzuzählen – wer wusste schon, ob ich nicht doch belauscht wurde? –, ging ich die vielen Banknoten durch und holte einmal tief Luft, als ich fertig war. Fünfundzwanzigtausend Dollar. Die grünen Scheine waren wohl das Einzige, was mir von meinem früheren Leben blieb. Ich wusste nicht, wie lange ich von dem Geld leben konnte, aber es würde irgendwie reichen müssen, um mir eine neue Existenz aufzubauen. Musste, musste, musste.
Möglichst ruhig ging ich ein letztes Mal den restlichen Inhalt meiner Tasche durch. Kramte durch die wenigen Klamotten, die unter der Menge von Spitzenschuhen bereits jetzt völlig zerknittert waren.
Ich hatte alles, was ich brauchte: Sämtliche Unterlagen, die mir einen Neustart erleichtern würden, sowie eine Menge Geld, das zum Überleben notwendig war. Ich hatte nichts vergessen. Alles, was einst mir gehörte, war vernichtet. Die Speicherkarte meines Handys hatte ich zerstört, das Gerät lag jetzt nutzlos auf dem Schreibtisch, an dem ich so viele Stunden verbracht hatte. Meinen Laptop hatte ich gelöscht, jeder Suchverlauf war fort und damit auch die letzte Spur von mir. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlte, war das Gefühl von Erleichterung. Doch es kam nicht – nicht einmal dann, als ich die schwarze Kapuze meines viel zu großen Hoodies über meinen Kopf zog und das Zimmer verließ.
Es kam auch dann nicht, als ich wenig später endlich in den Bus stieg, mich in meinen Sitz einrollte und dabei zuschaute, wie das Motel und die Skyline von Las Vegas langsam verschwanden.
Als wir Nevada verlassen und inzwischen drei weitere Bundesstaaten durchquert hatten, konnte ich es immer noch nicht spüren. Die Busreise dauerte mit Pausen einige Tage, und ich sehnte mich nach dem Gefühl der Erleichterung, doch es wollte sich nicht einstellen. Dabei brauchte ich es so sehr. Selbst als wir New York City erreichten und sich irgendwann die strahlende Metropole von Manhattan vor mir aufbaute, war da einfach nichts. Ein endloses Nichts.
Die Leere blieb, füllte mich aus. Bis ich schließlich nichts anderes spürte als das trügerische Gefühl, allem für einen Moment entkommen zu sein. Trügerisch deshalb, weil ich doch ganz genau wusste, dass meine Vergangenheit mich einholen würde. Früher oder später würde ihr Schatten sich erneut über mich legen und auch den letzten Funken Licht in mir ersticken, bis nichts mehr blieb außer der Dunkelheit und dem Wissen, dass ich versagt hatte.
Kapitel 1
Grace
Vielen Dank für Ihre Teilnahme, leider haben wir uns dieses Mal nicht für Sie entschieden, wünschen Ihnen aber viel Glück für Ihren weiteren Weg. Mein Herz rutschte mir beinahe in die Hose, als ich auf mein Handydisplay starrte. Mahnend und verhöhnend zugleich prangte mir dieser eine Satz entgegen. Ein Satz, der mir in wenigen Sekunden den gesamten Tag vermiesen und alle Hoffnung zunichtemachen konnte.
»Verdammt«, fluchte ich leise und las die Mail noch ein weiteres Mal – in der stillen Hoffnung, ihr Wortlaut würde sich dadurch ändern. Es war die fünfte Absage, die ich alleine heute bekommen hatte. Man sollte meinen, es würde irgendwann leichter werden, diese harten Worte zu ertragen. Stattdessen trafen sie mich jedes Mal erneut mit voller Wucht und der Gedanke, vielleicht einfach aufzugeben, wurde immer lauter.
Ein vertrautes Kribbeln kroch meine Wirbelsäule hinauf und meine Brust schnürte sich zu.
Nicht jetzt, befahl ich mir stumm. Atmen!
»Rivers! Du wirst nicht bezahlt, um auf dein Handy zu starren, sondern fürs Arbeiten. Beweg endlich deinen Arsch, bevor das Essen kalt wird!«
Erschrocken zuckte ich zusammen und löste den Blick von dem grellen Display, nur um in das wütende Gesicht meines Chefs zu gucken. Konnte der Tag eigentlich noch schlimmer werden? Wenn es eine Sache gab, bei der man von Garry nicht erwischt werden sollte, dann war es ein kurzer Blick aufs Handy.
»Sorry, kommt nicht mehr vor«, murmelte ich entschuldigend, während ich mein Smartphone hastig in der Tasche meiner Schürze verschwinden ließ. Bevor ich zur Essensausgabe huschte, warf ich einen schnellen Blick in die Verspiegelung der Bar. Glücklicherweise saß noch alles an der richtigen Stelle und meine Haare waren sicher zur Seite gesteckt. Die zarte Röte auf meinen Wangen verriet nichts von der Scham, die ich gerade verspürte, sondern ließ eher auf einen regen Betrieb schließen. Zur Sicherheit strich ich den weißen Kragen meines Hemdes noch einmal glatt und richtete die schwarze Fliege, die ein wenig verrutscht war. Damit mir nicht doch noch ein Fauxpas passierte, festigte ich den Knoten der schwarzen Schürze und strich auch hier einmal über den teuren Stoff, um nicht sichtbare Falten zu glätten.
Ich durfte mir in meiner Schicht keinen weiteren Fehler mehr erlauben, denn wenn ich diesen Job auch noch verlor, wäre ich komplett am Arsch. Einen tiefen Atemzug später schritt ich an den Pass, an dem das Essen ausgegeben wurde, und ließ meinen Blick über die vielen Zettel schweifen, um mir erst mal einen Überblick darüber zu verschaffen, was fertig war und wo noch etwas fehlte.
»Rivers!«, schnitt Garrys scharfe Stimme erneut durch die Luft und ließ mich abermals zusammenzucken. Wenn ich auf diesen blöden Job nicht so verdammt angewiesen wäre, würde ich ihm die heiße Pasta um die Ohren werfen, nach der ich gerade gegriffen hatte. Aber das konnte ich mir nicht leisten, also schluckte ich meinen Stolz herunter und fing damit an, die Teller etwas versetzt auf meinen Arm zu stapeln. Es waren drei Stück, gefüllt mit den besten Speisen des Restaurants, und ich balancierte zwei davon vorsichtig auf meinem linken Arm, bevor ich den letzten in die Hand nahm und mich auf den Weg zum entsprechenden Tisch machte. Normalerweise konnte ich diese Anzahl Teller locker tragen. In den absoluten Hochzeiten schaffte ich sogar vier Stück auf einmal – mit viel Mühe und großer Vorsicht natürlich. Nur gab es dort für gewöhnlich keine Absagen, die mich aus dem Konzept rissen, wie es heute leider der Fall war. Diese Broadwayshow wäre so eine verdammt große Chance gewesen. Ich hätte den Job nicht nur aus finanzieller Sicht dringend gebraucht, sondern besonders auch aus tänzerischer. Mein letztes richtiges Engagement war viel zu lange her.
Ich war nach New York gekommen, um meine Tanzkarriere weiterzuverfolgen. Das große Ziel war es, in einer der Kompanien einen Platz zu finden. Doch das wurde mit jedem Tag, den ich als Kellnerin und nicht als Tänzerin verbrachte, zunehmend schwieriger. Nicht nur, weil meine Leistungen immer mehr schwanden – egal, wie viel ich auch privat zu trainieren versuchte – sondern auch, weil die Konkurrenz enorm stark war. Und wen würde das New York City Ballet lieber nehmen: eine sechzehnjährige Tänzerin, die gerade aus der langjährigen Ausbildung kam, oder mich, die nur noch das Abbild jener Tänzerin war, die sie einst gewesen war. Allein bei dem Gedanken, dass ich es bereits geschafft hatte und meinen Traum schon gelebt hatte und alles aufgeben musste, wurde mein Herz verräterisch schwer.
Schnell schüttelte ich die Gedanken ab. In Mitleid konnte ich später versinken, jetzt musste ich die Schicht hinter mich bringen, ohne meinen Chef noch weiter gegen mich aufzuhetzen.
Als ich den ersten Schritt Richtung Gäste machte, spürte ich sofort, dass mein Konstrukt nicht funktionierte. Meine Beine fühlten sich zu wacklig an und meine Arme zu schwach. Nur hatte ich unter Garrys prüfendem Blick keine andere Wahl, als mich zusammenzureißen und zu hoffen. Zu hoffen, dass es hielt und ich mich nicht blamierte.
Leider war es ein Hoffen, das sich kurz darauf als falsch herausstellte, als der erste Teller gefährlich zu schwanken begann und letztlich bei dem Versuch, ihn auf meinem Arm zu halten, herunterrutschte. Mit lautem Scheppern fiel er zu Boden und verteilte das teure Essen auf dem dunklen Parkettboden und meiner Schürze.
O nein, nein, nein!
Das laute Getuschel der Gäste sowie das Geklirre von Gabeln auf Porzellan, welche das »Pinocchio’s« immer erfüllten, verstummten abrupt und ich spürte die urteilenden und mitleidigen Blicke der Restaurantbesucher und meiner Kollegen auf mir. Am liebsten wäre ich im Erdboden versunken oder aus dem Restaurant gestürmt, nur hielt ich immer noch zwei Teller in der Hand. Ohne es zu wollen, zuckte mein Blick zu Garry, der enttäuscht den Kopf schüttelte, wobei er Angela – eine meiner Kolleginnen – zu sich rief. Wenn er mir jetzt kündigte, war ich geliefert.
Ich nahm einen tiefen Atemzug, bevor ich mich auf meinen persönlichen Walk of shame zu Tisch vierzehn begab, um die verbliebenen Teller abzustellen. In dem Moment wusste ich nicht, was schlimmer war: die mitleidigen Blicke, die die drei Frauen mir zuwarfen, oder der enttäuschte Ausdruck meines Chefs, den ich noch immer mahnend im Nacken spürte.
»Einmal die Pasta Frutti di Mare und das Risotto«, verkündete ich mit belegter Stimme und suchte den direkten Blickkontakt. Die zwei Frauen, die die angekündigten Gerichte geordert hatten, gaben ein leises »Hier« von sich, und ich stellte die Teller behutsam ab. »Es tut mir wahnsinnig leid, dass Sie noch länger auf Ihr Essen warten müssen, es wird nicht noch einmal vorkommen, versprochen«, entschuldigte ich mich bei der älteren Dame, die ohne Essen verblieb, mir jedoch trotzdem ein ermutigendes Lächeln schenkte.
»Ach, das macht doch nichts, Liebes. Missgeschicke passieren uns allen hin und wieder!«
Ich schenkte ihr ein dankbares Lächeln und hoffte bloß, dass mein Gesicht nicht so rot war, wie es sich anfühlte. Meine Wangen glühten regelrecht vor Scham. Trotzdem verspürte ich etwas Dankbarkeit, denn zum Glück war mir diese Katastrophe bei einem verständnisvollen Tisch passiert. Die ganze Situation war für mich schon schlimm genug, aber herablassende Blicke und offene Anfeindungen der Gäste würde ich jetzt nicht auch noch ertragen können.
»Bitte, verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. So was passiert wohl, wenn man dahergelaufenen Touristinnen einen Job gibt.« Garry lachte kalt und erhoffte sich wohl, damit die Stimmung zu lockern. Ein Blick in die Gesichter der drei Frauen reichte, um zu verstehen, dass ihnen nicht mein Missgeschick, sondern sein Verhalten unangenehm war. »Als Entschuldigung dafür, dass Sie jetzt auf Ihr Essen warten müssen, übernehmen wir das natürlich. Und es gibt eine Runde Drinks für Sie drei aufs Haus, weil jetzt Ihr aller Mahl ruiniert ist.« Bei seinen strafenden Worten mir gegenüber wollte ich am liebsten die Stimme erheben. Ihn darauf hinweisen, dass es das erste Mal war, dass mir so etwas passiert war und das ganz sicher kein Weltuntergang war. Nobles Restaurant hin oder her. Doch die Konsequenzen, die ein solches Verhalten mit sich bringen würden, wollte ich nicht in Kauf nehmen.
Mit einer letzten gemurmelten Entschuldigung verließ ich den Tisch rasch und wollte gerade hinter die Bar eilen, um mein Durcheinander aufzuräumen. Bevor ich jedoch hinter dem Tresen verschwinden konnte, spürte ich eine Berührung an meinem Arm, die mich davon abhielt.
»Nicht so schnell, ich glaube, du hast hier heute genug Chaos angerichtet, vielleicht wäre es besser, du verschwindest für den Rest des Tages hinter der Spüle. Was ein Glück für dich, dass unser Spüler heute krank ist und ich somit tatsächlich noch einen Nutzen für dich habe.« Mein Chef funkelte mich wütend an und ich zuckte unter seinem Blick abermals zusammen. Etwas, das heute viel zu oft passiert war.
»Es tut mir leid, ich …«
»Spar dir deine Ausrede«, zischte er mich so leise an, dass niemand um uns herum ihn hören konnte, aber laut genug, dass ich hart schlucken musste. »Wir sind hier nicht in einem billigen Diner, in dem du vorher gearbeitet hast, sondern in einem Sternerestaurant. Fehler wie eben darfst du dir hier nicht mehr erlauben! Bekomm deine privaten Probleme – oder was auch immer mit dir los ist, weswegen du so unkonzentriert bist – in den Griff, oder das wars endgültig. Glaub mir, du bist absolut austauschbar. Hast du mich jetzt verstanden?«
Meine Atmung beschleunigte sich und ich spürte, wie sich alles in mir zusammenzog. Garry blickte mich so wütend an, dass ich mit aller Mühe gegen meine Tränen ankämpfen musste. Ich durfte weder weinen noch in Panik ausbrechen. Nicht jetzt. Nicht hier. Nicht vor ihm. Vor allem nicht vor ihm.
Da ich meiner Stimme im Moment nicht traute, nickte ich bloß und konzentrierte mich weiter auf meine Atmung.
Einatmen, ausatmen, du schaffst das, redete ich mir innerlich Mut zu.
»Gut. Angela wird deinen Bereich übernehmen, sie kann im Gegensatz zu dir sogar mit der doppelten Auslastung umgehen.« Erneut brachte ich kein Wort hervor und nickte bloß. Auch wenn ich noch nicht so lange hier arbeitete, an die ruppige Art meines Chefs und seine unterschwelligen Beleidigungen müsste ich mich längst gewöhnt haben. Nur nahm ich seine Worte noch immer viel zu persönlich und an Tagen wie heute konnte ich überhaupt nicht mit ihnen umgehen. Aber es war, wie es war: Wenn Garry schlechte Laune hatte, dann war das »Pinocchio’s« ein einziges Minenfeld und allein ein falscher Schritt ließ es hochgehen wie eine Bombe. Heute war so ein Tag und ich war volle Kanne in jede einzelne – noch so versteckte – Mine getreten.
Als er mich endlich losließ und sich von mir abwandte, huschte ich so schnell wie möglich in die Küche. Sobald ich das atmosphärische Restaurant gegen die hektische Geschäftigkeit in der Zubereitung getauscht hatte, fiel mir das Atmen leichter. Nur das Brennen in meinen Augen nahm zu. Für einen kleinen Moment lehnte ich mich an die Tür hinter mir, schloss die Augen und versuchte, mein zu schnell schlagendes Herz zu beruhigen.
»Grace?«, riss mich eine vertraute Stimme aus meiner Trance. Widerwillig öffnete ich meine Augen – zu gerne wäre ich einfach eins mit der Tür geworden – und blickte in das besorgte Gesicht von Rachel. Sie war die Chefköchin und wohl das, was einer Freundin am nächsten kam. Oder vielleicht eher einer guten Bekanntschaft. Seit ich in Manhattan lebte, hatte ich keine Freundschaften geschlossen oder Kontakte aufgebaut, außer eben zu Rachel. Was aber eher daran lag, dass sie nicht lockergelassen hatte. »Ist alles okay? Was ist passiert?« Die Sorge in ihrer Stimme nahm weiter zu, als sie mich näher musterte. Hastig rieb ich mir über meine feuchten Augen, um die paar verräterischen Tränen, die es herausgeschafft hatten, verschwinden zu lassen.
»Es ist alles okay, heute ist bloß kein guter Tag«, sagte ich ehrlich. Sie wusste zwar, dass ich verzweifelt versuchte, Fuß in der Tanzwelt zu fassen, aber ich war es leid, immer dieselben Worte zu sagen. Es ist eine weitere Absage gekommen. Ich war wieder nicht gut genug.
»Für dich oder für Garry?«
Mir entwich ein Schnaufen. »Für uns beide. Die wohl beste Kombi, oder?«
Sie schüttelte den Kopf, einen wissenden Ausdruck im Gesicht. »Sobald ich diesen Laden übernehme, wird hier ein anderer Wind wehen, das verspreche ich dir. Es kann doch echt nicht sein, dass mit seiner Laune alles steht oder fällt.«
Das wäre eine Änderung, mit der ich mehr als einverstanden wäre. Und das, obwohl ich gerade mal gut drei Monate hier arbeitete und nicht wie die meisten schon mehrere Jahre. Wie sie es so lange ausgehalten hatten, fragte ich mich jedes Mal, wenn ich den Laden verließ und mir schwor, nächstes Mal zu kündigen, obwohl ich genau wusste, dass ich es nicht tun würde. Nicht tun konnte. Denn so sehr ich meinen Chef und das ganze Restaurant oft verfluchte, ich brauchte diesen Job und vielmehr das Geld, das er mir einbrachte. So gut bezahlt wie hier wurde ich bisher nirgendwo anders. Seit meiner Ankunft in Manhattan hatte ich in einigen Diners gearbeitet, teilweise in zwei gleichzeitig, um mich über Wasser zu halten. Dort hatte ich nur vom Trinkgeld gelebt, was vielleicht in manchen Gegenden funktionierte, jedoch nicht in der teuersten Stadt Amerikas und vermutlich auch der ganzen Welt. Hier bekam ich zumindest einen Stundenlohn von einigen Dollar und das Trinkgeld war durch die vielen reichen Gäste wirklich mehr als gut.
»Ich bestelle dir jetzt erst mal einen Chai Latte mit extra viel Sirup. Zum Glück ist Matteo heute an der Theke, bei dem habe ich nämlich noch einiges gut, nachdem ich ihm letzte Woche den Arsch in seiner Schicht gerettet habe. Wie es aussieht, ist mir gerade außerdem leider eine Portion Risotto angebrannt. Natürlich ganz leicht nur, aber dennoch nichts für unsere noblen Gäste. Schade aber auch«, sagte sie schulterzuckend und schenkte mir ein schelmisches Grinsen, woraufhin ich sofort mitlachen musste. Ohne Rachel wäre ich hier wirklich aufgeschmissen.
»Danke, Rach, du weißt, wie sehr ich das zu schätzen weiß.«
»Nicht dafür. Garry ist ein Arsch und spielt sich zu sehr auf für seine Position. Nur weil er genug Glück im Leben hatte, irgendwie Restaurantleiter zu werden, heißt das nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Außerdem kann er es sich nicht erlauben, dir zu kündigen, dafür sind wir zu unterbesetzt – ganz egal, was er sagt«, erwiderte sie zwinkernd, bevor sie sich von mir abwandte und zurück in die Küche an den Herd huschte. Schmunzelnd blickte ich ihr hinterher, während ich mich an die Spüle stellte, wo sich bereits das schmutzige Geschirr stapelte. Irgendwie hatte Rachel recht und das wusste ich auch, trotzdem konnte ich nicht auf ihre Spekulationen vertrauen. Zumal sie als Chefköchin leicht reden hatte. Sie war wirklich nicht so leicht zu ersetzen, ich schon, oder? Auch wenn wir unterbesetzt waren, konnte ich mich einfach nicht in Sicherheit wiegen.
Als ich vor fast neun Monaten in Manhattan angekommen war, hatte ich mir sofort einige Kellnerjobs gesucht und war selbst überrascht davon gewesen, wie gut ich mich in dem Business schlug. Es war viel härter, als ich immer gedacht hatte, aber als Ballerina, die ein Leben in Disziplin und Strenge geführt hatte, konnte ich sowohl mit dem Druck als auch mit der körperlichen Belastung umgehen. Nur deshalb hatte ich vor drei Monaten den Job hier im »Pinocchio’s« ergattern können. So konnte ich immerhin ein wenig durchatmen, was meine Finanzen anging. Dass mein Stresslevel seither jedoch trotzdem höher war als vor einem wichtigen Vortanzen, ignorierte ich. Genauso wie die Tatsache, dass ich seit knapp neun Monaten in New York lebte und mein eigentliches Ziel, wieder Tänzerin sein zu können, immer mehr vor meinen Augen verschwamm. In meinem alten Leben hatte ich den Luxus genossen, mich nur auf das Tanzen konzentrieren zu können. Von morgens bis abends in Spitzenschuhen zu leben, mit meinen Freundinnen zwischen dem Training zu lachen und uns gemeinsam so lange an die Grenze zu treiben, bis alles an uns nach Perfektion schrie. Ja, diesen Luxus hatte ich hier nicht. Doch das, was ich an meiner Situation am meisten hasste, war die Tatsache, dass ich ganz genau wusste, wie viel mehr in mir steckte. Wie viel mehr Potenzial und Talent ich besaß. Und ich konnte es nicht beweisen, weil ich mehr Zeit mit einer dunklen Schürze und einem Tablett verbrachte als mit meinen geliebten Spitzenschuhen. Durch das fehlende Training und den ganzen Stress, dem ich mich selbst aussetzte, war mein Funke irgendwie immer mehr erloschen. Meinem Tanzstil fehlte dieses kleine bisschen Besonderheit, das mich einzigartig und unvergesslich machte. Denn ich konnte noch so gut tanzen, wenn ich es nicht schaffte, dass der Funke aufs Publikum übersprang, würde ich nicht gesehen werden. Dann wäre ich bloß eine von vielen Tänzerinnen im Hintergrund, die man sofort wieder vergaß, wenn sie die Bühne verließen. Es war ein Teufelskreis – und mir dessen bewusst zu sein, machte es nur schlimmer. Wie sollte ich mehr Zeit in ein Training investieren, welches ich bitter nötig hatte, wenn ich gefühlt jede Sekunde hier war, um mir überhaupt das Leben in dieser Stadt leisten zu können?
Seufzend griff ich nach dem ersten Teller, schabte die Essenreste in den Müll und stellte ihn anschließend in den riesigen Geschirrkorb des Gastrospülers. Ich war von einer gefeierten Profitänzerin mit einer strahlenden Zukunft zu einer austauschbaren Kellnerin geworden, die nicht mal mehr diesen Job schaffte und jetzt dreckiges Geschirr schrubben musste. So hatte ich mir mein Leben in der strahlenden Metropole definitiv nicht vorgestellt.
Kapitel 2
Eliot
»Mom!«, unterbrach ich den Monolog meiner Mutter, welcher bereits einige Minuten andauerte, und fuhr mir genervt über die Stirn. Kurz ließ ich meinen Blick zu dem kleinen Bildausschnitt huschen, der mich selbst zeigte. Ich hoffte inständig, dass die Verbindung auf ihrer Seite genauso schlecht war wie auf meiner und sie die dunklen Schatten unter meinen Augen nicht wahrnahm. Sonst würde ihre Tirade niemals enden.
»Ich mache mir doch nur Sorgen um dich, mein Schatz. Heute ist das erste Mal seit Wochen, dass du mich nicht nach zwei Minuten abwimmelst, und gesehen haben wir dich auch schon ewig nicht mehr.« Meine Mutter runzelte besorgt die Stirn und ich konnte die Traurigkeit in ihren Augen selbst durch das verpixelte Bild auf meinem Bildschirm erkennen.
»Mir geht es gut, Mom, versprochen. Es ist gerade einfach ziemlich stressig mit dem Besuch der Reporter nächste Woche Freitag und den ganzen Proben dazwischen. Irgendwie kommen jeden Tag noch weitere Dinge hinzu, die ich erledigen muss, und es tauchen ständig kleine Probleme auf.« Bei meinen Worten wuchs die Sorge in ihrer Miene nur noch weiter an, weshalb ich schnell den Kopf schüttelte. »Nichts, was ich nicht hinbekommen werde, versprochen. Wir können am Wochenende auch in Ruhe reden, ich wollte nämlich vorbeikommen«, offenbarte ich ihr die Entscheidung, die ich vor wenigen Sekunden spontan getroffen hatte. Noch bevor ich meinen Satz vollkommen beendet hatte, bereute ich ihn schon. Ich vermisste meine Familie, natürlich tat ich das, aber streng genommen hatte ich keine Zeit für Besuche.
»Ehrlich? Oh, Eliot! Dein Vater wird sich riesig freuen und Amalia erst! Sie fragt mich jeden Tag, wann du endlich wieder nach Hause kommst«, sagte meine Mutter und es klang anschuldigend und freudig zugleich. Auch wenn ich ganz genau wusste, dass sie es nicht böse meinte, versetzten ihre Worte mir einen Stich. Ich vermisste meine Schwester vermutlich noch mehr als sie mich, besonders jetzt, wo sie sich ständig weiterentwickelte und ich eine Sprungmarke nach der anderen verpasste.
»Es tut mir wirklich leid, dass ich in den letzten Wochen quasi unerreichbar war. Aber gerade ist alles etwas viel und ich will einfach, dass es perfekt wird, weißt du?« Meine Mutter nickte verständnisvoll und schenkte mir ihr liebevollstes Lächeln, das sogar über den Bildschirm dafür sorgte, dass ich mich besser fühlte.
»Und das wird es, Schatz, hab ein bisschen mehr Vertrauen in dich selbst. Du hast so hart dafür gearbeitet, um jetzt dort zu stehen. Feier dich bitte zwischendurch dafür, auch wenn dir noch einiges bevorsteht.« Ich schnaufte, weil sie ganz genau wusste, dass sie mit diesen Worten den richtigen Knopf drückte. »Ich freue mich, wenn du am Wochenende endlich wieder einmal nach Hause kommst, und halte dich jetzt auch nicht weiter auf, wann gehen die Proben los?«
»In einer Stunde, ich mache mich gleich auf den Weg, damit ich noch genug Zeit habe, alles vor Ort vorzubereiten. Du weißt, dass ich gern vor meinen Tänzern da bin.«
»Viel Erfolg beim Training und denk bitte daran, dein Vater und ich sind unglaublich stolz auf dich und wir wünschen dir allen Erfolg der Welt. Aber es ist trotzdem wichtig, dass du Pausen machst. Versprichst du mir das?«
»Natürlich, Mom!«, antwortete ich ihr und konnte mir einen genervten Unterton nicht verkneifen. Ich war schließlich kein kleines Kind mehr, sondern ziemlich gut in der Lage, auf mich selbst aufzupassen. Außerdem wusste ich, wie viel von all dem abhing, das ich mir hier aufbaute.
»Ich bin nun mal deine Mutter und sorge mich um dich, besonders, wenn du dich in das reinste Arbeitstier verwandelst, das nur Pausen macht, um zu essen und zu schlafen – du darfst nicht das Leben vergessen!«
»Immerhin mache ich für die beiden Sachen eine Pause, ich könnte sie auch vergessen«, versuchte ich, die angespannte Situation mit einem Witz aufzulockern, was meiner Mutter natürlich überhaupt nicht gefiel.
»Eliot Cooper, das ist alles andere als lustig! Du solltest aufhören, Scherze zu machen, und lieber dafür sorgen, dass du deine Work-Life-Balance wieder in den Griff bekommst. Glaubst du wirklich, ich würde nicht sehen, wie müde du bist? Du hast das gleiche Glück wie ich, dass deine blonden Locken unter Stress total leblos aussehen. Ich habe keine Lust, dich im Krankenhaus besuchen zu müssen, weil du vor lauter Stress einen Herzinfarkt hattest!«, fuhr sie mich an und ich konnte bloß abermals den Kopf schütteln. Ich liebte meine Mutter mehr als alles andere, aber sie trieb mich mit ihrem Hang zur Übertreibung wirklich in den Wahnsinn.
»Ich werde weder einen Herzinfarkt erleiden noch aus einem anderen Grund im Krankenhaus landen. Beruhig dich, Mom, es ist alles gut. Ich habe alles im Griff. Vertrau mir bitte, wenn ich dir das sage, okay?«, sagte ich so ruhig und liebevoll, wie ich nur konnte. Denn das Letzte, was ich wollte, war, dass nachher meine Mutter einen Herzinfarkt bekam, weil sie sich so viel Stress um meinen Stress machte. Das wäre zu absurd und zu schlimm.
»Okay, ich vertraue dir. Wehe, du beweist mir am Wochenende das Gegenteil, dann werde ich nach Manhattan kommen und dich in dein Apartment sperren!« Ich musste lachen, als sie mahnend mit dem Finger auf mich zeigte. Das Lachen diente dabei jedoch eher meiner eigenen Beruhigung als ihrer, weil ich ganz genau wusste, wie ernst sie ihre Worte meinte.
Bevor ich schließlich auflegte, versicherte ich meiner Mutter ein letztes Mal, dass es mir wirklich gut ging und ich sie lieb hatte. Sie wollte mir zwar noch immer nicht so richtig glauben, aber zumindest legte sie schließlich doch auf und ich hoffte einfach, sie insoweit überzeugt zu haben, dass sie nicht vorbeikam.
Als das Display schwarz wurde, atmete ich erleichtert auf. Meine Mutter meinte es nicht böse und ich war dankbar für alles, was sie für mich getan hatte und immer noch tat. Nur war es nicht sonderlich hilfreich, ständig unter Druck gesetzt zu werden, dass ich weniger arbeiten sollte, weil ich ihrer Meinung nach unter zu viel Druck stand. Es war ja nicht so, als ob ich wirklich eine Wahl hätte.
Im Winter würde mein erstes eigenes Stück seinen Weg auf die Bühne finden und neben der jährlichen Nussknacker-Aufführung in der Woche vor Weihnachten im Lincoln Center stattfinden. Ich hatte so lange auf genau dieses Ziel hingearbeitet. Jetzt, wo es zum Greifen nahe war, konnte ich nicht zulassen, dass irgendetwas schieflief. Egal, was es mich kostete. Was war schon ein bisschen mehr Stress, wenn wir dafür alle eine bessere Leistung erbringen würden? Nicht nur für mich hing viel von dem Erfolg meines Stückes ab, auch für meine Tänzer war es wichtig, im besten Licht zu stehen. Ich schuldete es ihnen, genau dafür zu sorgen, schließlich verdankte ich ihnen viel.
»War das deine Mom?« Erschrocken blickte ich auf und sah, wie Aiden in unser Wohnzimmer kam.
»Jap. Mit ihrer geliebten Du-hast-zu-viel-Stress-Ansprache.« Erschöpft seufzte ich. Aiden hingegen schüttelte amüsiert den Kopf.
»Sie meint es nur gut und hat außerdem recht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann wir uns das letzte Mal außerhalb unserer Wohnung oder der Trainingsräume gesehen haben.« Jetzt fiel mir auch noch mein bester Freund in den Rücken, großartig.
»Apropos Trainingsräume, wir sollten gleich mal los«, sagte ich und wechselte damit gekonnt das Thema. Aiden und ich hatten uns vor einigen Jahren kennengelernt, als wir beide mit sechzehn je eine der begehrten Praktikantenstellen für die Lincoln Ballet Group ergattert hatten. Das war jetzt acht Jahre her. Als wir beide nach dem Praktikum übernommen wurden, waren wir uns schnell einig, dass wir gemeinsam in eine Wohnung ziehen wollten. Seit wir diese Entscheidung vor fünf Jahren in die Tat umgesetzt hatten, hatte sich nichts geändert. Wir lebten und arbeiteten zusammen und waren in beidem ein wirklich gutes Team. Alles war genau so wie damals, als wir zusammengezogen waren. Na ja, bis auf die Tatsache, dass ich kein Tänzer mehr war, sondern mittlerweile als Choreograf arbeitete. Eine Entscheidung, die ich vor vier Jahren getroffen und seither nicht bereut hatte. So gerne ich auch tanzte, ich blühte viel mehr darin auf, mir Geschichten zum Vertanzen auszudenken, als von Choreografen in eine Rolle gesteckt zu werden. Was ich am Tanzen nämlich immer am meisten geliebt hatte, war es, für ein paar Stunden jemand anderes zu werden. Alles, was mich betraf, zusammen mit meiner Trainingstasche in einen Spind zu schließen und abzutauchen. Doch das Gefühl von Freiheit, welches das Tanzen mir früher immer geschenkt hatte, war irgendwann … weg gewesen. Da waren nur noch die Strenge und Perfektion und dieser beißende Druck gewesen, dass alles gut sein musste. Perfekt. Es hatte mich einiges gekostet, endlich zu realisieren, dass ich nicht für die Bühne gemacht war, sondern im Hintergrund viel besser funktionierte.
»Klar, aus dem Grund bin ich reingekommen. Gehen wir danach noch aus? Jacky hat gefragt, ob wir uns treffen wollen.«
»Vielleicht ein anderes Mal, ich will morgen wieder früh hin«, lehnte ich entschuldigend ab, woraufhin Aiden nur die Augen verdrehte.
»Du solltest dir die Worte deiner Mutter wirklich mal zu Herzen nehmen, Eliot. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit.«
Nicht er auch noch. Warum schienen in der letzten Zeit eigentlich alle so viel besser über mein eigenes Leben Bescheid zu wissen als ich selbst? Frustriert fuhr ich mir über die Stirn, die ich unbewusst schon wieder in Falten gelegt hatte, und erwischte dabei eine meiner blonden Locken. Sie fühlte sich genauso leblos an, wie sie aussehen musste, und meine Mutter hatte wieder einmal recht behalten. Verflucht noch mal.
»Das weiß ich, Aiden. Aber wenn die Presse nicht überzeugt wird und schlechte Kritiken schreibt, dann wars das mit meiner Karriere, bevor sie richtig angefangen hat. Und das weißt du ganz genau.«
»Es ist nicht so, als ob es sich um eine Aufführung handeln würde, sondern lediglich um einen Besuch von ein paar Reportern. Sie werden dich nicht zerreißen, nur weil bei den Proben für ein Stück, welches erst in circa zwei Monaten aufgeführt wird, noch nicht alles perfekt läuft. Was soll bitte schiefgehen?« Aiden beobachtete mich, während ich mich daranmachte, meine Sporttasche zu packen.
»Sag niemals nie«, erwiderte ich bloß und fing mir für diesen Kommentar ein mir zugeworfenes verschwitztes Handtuch ein. Sofort rümpfte ich meine Nase. »Alter! Hör auf, mit deiner schmutzigen Wäsche rumzuwerfen!«
»Gerne, wenn du im Gegenzug endlich damit aufhörst, so verdammt pessimistisch zu sein. Lass den Gedanken doch zu, dass auch alles ohne Probleme verlaufen kann.«
»›Erwarte Enttäuschung und du wirst niemals wirklich enttäuscht werden‹«, zitierte ich MJ aus dem letzten Spider-Man-Film, woraufhin Aiden frustriert aufstöhnte.
»Gott, Eliot, ich hätte dir niemals die Marvel-Filme zeigen dürfen. Nimm dir doch bitte nicht diese Einstellung als Vorbild!«
»Ich bleibe bloß realistisch.«
»Mit dieser Einstellung durchs Leben zu gehen, wäre mir zu anstrengend, aber mach, wie du meinst. Ich gehe auf dem Rückweg von Jacky dann noch einkaufen, was brauchst du?« Er fuhr sich durch seine hellbraunen Haare, die in dem schwachen Licht unserer kaputten Lampe, welche wir schon seit Wochen tauschen wollten, fast schon dunkelbraun wirkten. Ich schüttelte den Kopf und schob mein Handy in die Tasche meiner Jeans. »Wenn mir was einfällt, dann schreib ich es noch auf unsere Liste. Danke fürs Übernehmen, eigentlich bin ich heute dran.«
»Schon gut, du hast den Kopf voll genug. Sollen wir dann?«, fragte er und zeigte Richtung Tür.
Nach einem kurzen Nicken füllte ich noch flott das Wasser, welches ich mir heute Morgen extra kalt gestellt hatte, in meine Trinkflasche, dann machten wir uns endlich auf den Weg.
»Okay, das war gut, mehr als gut. Und keine Sorge, es war wirklich der finale Durchlauf, nicht so wie in den letzten Proben«, beendete ich lobend das Training und ein erleichtertes Seufzen erfüllte den Raum. Ich musste grinsen, als ich in die erschöpften Gesichter meines Tanzensembles blickte. Auch wenn ich sie mal wieder an ihre Grenzen getrieben hatte, konnte ich das zufriedene Funkeln bei jedem Einzelnen sehen. Wir befanden uns auf der Zielgeraden, und zum ersten Mal fühlte ich einen Hauch von Stolz. Auf die Tänzerinnen und Tänzer, aber vor allem auf mich selbst. Vielleicht hatten meine Mutter und Aiden recht und ich sollte den Gedanken daran, dass alles gut laufen würde, endlich zulassen. Mich einfach dem Gefühl hingeben, dieser Mischung aus Stolz, Aufregung und Vorfreude vertrauen und nicht immer nach der nächsten Abbiegung suchen, ab der alles schiefgehen konnte.
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht blickte ich der Gruppe Tänzer hinterher, die sich nach und nach von mir verabschiedeten und den Raum verließen. Aiden gesellte sich zu mir, damit wir noch einmal über den längst fälligen Einkauf reden konnten, als wir von einer zarten Stimme unterbrochen wurden.
»Was grinst du denn so fröhlich, Cooper?« Ich drehte mich um und begegnete Juliettes strahlendem Blick. Automatisch wanderten meine Mundwinkel weiter in die Höhe.
»Ob du es glaubst oder nicht, aber ich bin tatsächlich zufrieden mit der Choreo. Die Schritte sitzen, die Chemie zwischen allen stimmt – und ich glaube, das könnte richtig gut werden. Nein, weißt du was? Ich weiß es!«
Sie riss schockiert die Augen auf und presste sich ihre Hände auf die Brust. »Du? Zufrieden? Wer bist du und was hast du mit dem pessimistischen Menschen, den ich kenne, angestellt?« Sie ließ ihren Blick von mir zu Aiden huschen, der sofort mit in die melodramatische Geste einstimmte.
»Das habe ich mich auch schon gefragt, Jules. Vielleicht sollten wir doch den Notarzt rufen? Nicht, dass uns hier ein Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde vorliegt!«
»Haha, ihr seid so unglaublich witzig«, kommentierte ich trocken und griff nach dem Handtuch neben mir, mit dem ich Aiden bewarf, weil wir das jetzt scheinbar so in unserer Freundschaft machten. Wieder lachten beide lauthals, wobei Juliette ihren Zopf löste und ihre langen blonden Haare wellig über die Schulter fallen ließ.
Sie war Tänzerin an der School of American Ballet gewesen und hatte vor drei Jahren einen Platz als Praktikantin für die Lincoln Ballet Group ergattert. Seit letztem Sommer war sie als feste Tänzerin eingestellt und bereits jetzt war ihre Beförderung zur ersten Solistin im Gespräch. Ich hatte sie ziemlich schnell ins Herz geschlossen, was durch ihre freundliche und herzliche Art wirklich nicht schwer war. Auch wenn sie deutlich jünger als Aiden und ich war, machte uns das nichts aus und wir verbrachten gerne Zeit mit ihr. Das lag vielleicht auch daran, dass das gemeinsame Training uns zusammengeschweißt hatte und Juliette sich mit ihren neunzehn Jahren oft reifer verhielt als wir.
»Es freut mich, dass du zufrieden bist, du kannst es auch wirklich sein. Mit diesem Stück wird sich die Tür in die Choreografen-Welt für dich öffnen. Eines Tages werden wir alle Säle füllen. Ein Stück von Eliot Cooper, mit Juliette Willson und Aiden Coleman in den Hauptrollen, könnt ihr es vor euch sehen?« Mit ihren Händen malte sie einen Halbkreis in die Luft und funkelte mich belustigt an. Vor allem erkannte ich aber den Stolz in ihren Augen. Das ausgerechnet von ihr zu hören, obwohl Juliette fast noch kritischer mit ihrer eigenen – großartigen! – Leistung war als ich, sorgte dafür, dass ich mich noch mehr dem Höhenflug hingab.
»Du bist wirklich verrückt, Jules. Lass uns erst mal die Presse überzeugen und dann die Aufführung im Winter überstehen, dann können wir mit den größeren Träumen anfangen.«
»Also, ich sehe es schon bildlich vor mir. Deine Choreografie, wir in den Hauptrollen: Wir werden jeden mit unserem Charme und unserem Talent von den teuren Plätzen reißen und dann steht unserer Tour durch Amerika nichts mehr im Weg.«
Ich konnte über die beiden nur die Augen verdrehen, mir ein amüsiertes Schnaufen aber nicht verkneifen. Ihr Optimismus tat mir gut, das wussten wir alle. Und wenn ich es schon nicht schaffte, an unseren Traum von einer Rundreise durch die Staaten, wo wir die verschiedensten Theater füllen würden, zu glauben, sollten sie es ruhig übernehmen. Für uns alle.
»Ihr macht mich wirklich fertig, ehrlich. Wie wird euer Ego bloß aussehen, wenn wir das alles wirklich erreichen?«
»Wenn? Eliot, das hier ist keine Frage des Wenn, sondern des Wann.« Aiden zwinkerte mir zu, was mich seufzen ließ. Er war einfach unverbesserlich. Gleichzeitig spürte ich aber auch, wie die Ruhe warm durch meinen Körper floss, mich ausfüllte und insbesondere erdete. Ich wusste meine Freunde immer zu schätzen, jetzt gerade jedoch noch mehr als sonst. Sie wussten ganz genau, wie viel mir das alles hier bedeutete, und auch wenn sie sich gerne über mich amüsierten, waren sie da. Und das war alles, was wirklich zählte.
»Warum ich dich eigentlich sprechen wollte, kannst du mir vielleicht bei ein paar Schritten helfen?«, wechselte Juliette plötzlich das Thema und richtete ihre volle Aufmerksamkeit auf mich.
»Klar, wobei brauchst du denn Hilfe?«, fragte ich sie und konnte nichts gegen die Verwunderung in meiner Stimme tun. Wenn es jemanden gab, von dem ich diese Frage nicht erwartete, dann war es Juliette.
»Ich glaube tatsächlich, ich könnte eine Stelle noch etwas mehr perfektionieren. Irgendwie fühlt sich der Übergang noch zu ruppig an. Hast du noch etwas Zeit übrig oder musst du weg? Ich will dich auch nicht weiter aufhalten, dein Tag war genauso lang wie meiner, dennoch …«, bat sie mich und blickte mich mit einem schüchternen Lächeln an. Wenn ich eines über Juliette gelernt hatte, dann, wie sehr sie es hasste, um Hilfe zu bitten. Das hier kostete sie wirklich viel.
»Na dann, Miss Willson, ab in die Mitte mit dir. Aber beschwer dich morgen nicht, wenn dir deine Muskeln zu sehr wehtun, du hast es so gewollt.« Ich scheuchte sie mit meinen Händen in die Mitte des Raums, in der sie bereits wenige Sekunden später in Position ging.
»Sie ist nun mal noch perfektionistischer als du, Eliot. Und außerdem kann sie einfach keine Zeit ohne uns verbringen, weil wir schließlich ihre allerliebsten Menschen sind«, mischte sich Aiden ein und stellte sich mit vor der Brust verschränkten Armen und breit grinsend neben mich.
»Dann kann mein allerliebster Mensch mir ja schon mal einen großen schwarzen Tee und ein paar Churros von ›Twisted Pastries‹ besorgen, damit ich nicht Gefahr laufe, hier zu verhungern.« Juliette blickte Aiden mit großen Augen an und schob schmollend die Unterlippe vor.
Tja, das hatte er wohl davon, wenn er sie provozieren wollte. Instant Karma, schoss es durch meine Gedanken. Sie würde die Kalorien bei ihrem heutigen Pensum brauchen und ich gönnte sie ihr. Mir selbst würden sie ebenfalls nicht schaden.
»Punkt für dich, Willson. Und als Wiedergutmachung werde ich Essen für uns alle holen. Auf dem Rückweg bringe ich dann auch lieber Jacky mit, sonst ist Muskelkater vom Training unser kleinstes Problem.« Juliette klatschte erfreut in die Hände, während Aiden uns verließ, um das versprochene Essen zu besorgen und Jacky, die Letzte aus unserer Gruppe, mitzubringen. Diese war heute den ganzen Tag in einem anderen Training eingespannt gewesen und würde erst morgen wieder mit uns trainieren.
Eigentlich war es mein Plan gewesen, heute früh ins Bett zu gehen, damit morgen ein genauso erfolgreicher Tag wie heute werden würde. Aber nach dieser gelungenen Trainingseinheit hatte ich mir einen gemütlichen Abend mit meinen Freunden verdient. Mein knurrender Magen unterstützte diese Aussage nur umso vehementer. Ich wandte mich von dem davoneilenden Aiden ab und blickte zu Juliette, die mich dankbar anlächelte. Sofort fing sie an, mir zu erklären, welche Stelle sich für sie nicht gut anfühlte. Etwas, was ich zwar nicht wirklich nachvollziehen konnte – immerhin war sie die Tänzerin, bei der ich mir die geringsten Sorgen machen musste.
Während ich mit Juliette noch weiterübte und ihre Schritte bis an die Grenze des Möglichen perfektionierte, spürte ich, wie aus der Ruhe ein Gefühl von Sicherheit wurde.
Das hier würde gut gehen. Es musste gut gehen.
Kapitel 3
Grace
Der vertraut muffige Geruch des alten Wohnkomplexes, in dessen obersten Stockwerk meine winzige Wohnung lag, begrüßte mich, als ich eintrat. Kurz spielte ich mit dem Gedanken, den Fahrstuhl zu nehmen, aber selbst meine müden Knochen und die volle Einkaufstasche konnten mich nicht dazu bringen, dieses alte Ding zu benutzen. Ich kam bereits bei normalen Fahrstühlen an meine Grenzen, weshalb ich bisher noch keinen der beliebten Aussichtspunkte der Stadt besucht hatte. Dieser hier besaß jedoch eine Tür aus Holz, die man eigenständig schließen musste, wenn man in der Kabine stand. Alles ratterte und knatterte bei jedem Stock, den man zurücklegte. Ich würde zumindest gerne noch ein paar Jahre länger leben und nicht in einen schnellen Tod stürzen.
Mit schweren Schritten schleppte ich mich also die Treppen hoch in den fünften Stock. Immer wieder musste ich die Tasche absetzen, kurz die Hände auf meinen Knien aufstützen und durchatmen. Völlig außer Atem kam ich nach einer gefühlten Ewigkeit am Ziel an. Trotzdem wollte ich mich nicht beschweren, denn dazu hatte ich wirklich nicht das Recht. Selbst wenn es bedeutete, immer bis ganz nach oben laufen zu müssen, hatte ich immerhin eine eigene Wohnung, die ich mir leisten konnte und von der aus ich nicht noch drei Stunden nach Manhattan pendeln musste.
Mühsam klemmte ich mir die Einkaufstüte wieder unter den Arm, um meine Hand zum Klopfen heben zu können. Schon nach wenigen Sekunden öffnete mir Mrs Delmar, der einzige Grund, warum ich immer noch weiterträumen konnte.
»Grace, Liebes, du siehst müde aus, hattest du einen harten Tag?«, begrüßte mich die ältere Dame mit ihrem breiten Lächeln, während sie sich ihr Kopftuch zurechtschob, mit dem sie sich immer ihre schwarzen Locken aus dem Gesicht hielt.
»Etwas anstrengender und länger als geplant, aber nichts, worüber ich mich beschweren kann.« Mühsam zwang ich mich zu einem Lächeln, auch wenn meine zufallenden Augen sicher für sich sprachen. Die alte Dame streckte ihre Hand aus und fuhr mir liebevoll über die Schulter. Eine Geste, die sofort eine Gänsehaut bei mir auslöste und gleichzeitig dafür sorgte, dass ich mich ein wenig leichter fühlte.
»Warst du etwa bis gerade eben auf der Arbeit? Und dann noch einkaufen? Du musst ja am Verhungern sein! Komm doch rein, ich habe noch eine Portion Lasagne übrig. Habe ich heute frisch gekocht!« Für einen Moment spielte ich mit dem Gedanken, wirklich reinzukommen, vor allem, weil mein Magen anfing zu rumoren. Das Risotto heute Mittag war zwar lecker gewesen, bei der ewig langen Schicht hatte es jedoch nicht lange gehalten. Dafür war die Portion, die Rachel meinetwegen zubereitet hatte, auch zu klein gewesen.
Aber alles in mir schrie nach einer heißen Dusche und meinem Bett.
»Vielen Dank, Mrs Delmar, ich weiß Ihr Angebot wirklich zu schätzen, aber ich bin froh, wenn ich gleich einfach ins Bett fallen kann«, gestand ich ehrlich und wechselte die Belastung von meinem linken Bein auf das rechte. Gott, ich konnte nicht mehr stehen. Jeder Muskel brannte. »Aber ich habe es eben noch geschafft, für Sie einkaufen zu gehen und alle Sachen zu besorgen. Also hoffe ich zumindest, wenn ich was vergessen habe, dann hole ich das morgen natürlich noch und …« Bevor ich weitersprechen konnte, nahm sie mir die Tüte aus der Hand, stellte sie ab und umschloss meine Hände mit der Wärme ihrer eigenen.
»Und selbst wenn etwas fehlen sollte, dann kannst du das auch nächste Woche besorgen, mach dich nicht verrückt.« Manchmal fragte ich mich, wie ich bloß so viel Glück hatte haben können, sie kennengelernt zu haben. Meine ersten Wochen in Manhattan hatte ich nämlich damit verbracht, mich verzweifelt von einem Inserat zum nächsten zu kämpfen. Es war kein Geheimnis, dass der Wohnungsmarkt hier unbezahlbar war. Doch als jemand, der in einem reichen Elternhaus aufgewachsen war, hatte ich nie begriffen, was es wirklich bedeutete, jeden einzelnen Penny umdrehen zu müssen.
Mrs Delmar war die Vermieterin des Wohnkomplexes im Norden von Harlem und hatte sich vor einigen Jahren dazu entschieden, den Raum neben ihrer Wohnung, der eigentlich als Abstellkammer diente, in eine kleine Wohnung umzubauen.
Mit der Bedingung, die Einkäufe für sie zu übernehmen und ihr bei körperlich schwierigen Aufgaben unter die Arme zu greifen – sie war mit ihren zweiundsiebzig Jahren nicht mehr die Jüngste und wollte sich schonen, wo es ging –, konnte ich für Manhattaner Verhältnisse fast schon günstig hier wohnen.
»Gib mir kurz einen Moment, ich schaffe schnell die Einkäufe hinein und bring dir die Reste raus.« Sie wollte sich schon abwenden, da überlegte sie es sich anders, drehte sie sich noch einmal zu mir um und blickte mich streng an. »Denk erst gar nicht daran, mein Angebot abzulehnen. Du hast einen harten Tag hinter dir, ich habe leckeres frisches Essen gekocht und damit hat sich das Thema erledigt!« Bei ihrem strengen Blick entwich mir ein Lachen und ich nickte. Auch wenn ich ständig das Gefühl hatte, ihre Freundlichkeit überzustrapazieren, konnte ich ihr Angebot nicht ausschlagen. Und mein knurrender Magen dankte mir dafür, dass ich meine Sturheit nicht gewinnen ließ.
Einen kurzen Moment später tauchte Mrs Delmar mit einem gefüllten Vorratsbehälter aus Glas auf, den sie mir sofort in die Hand drückte.
»Danke. Mein Abend ist damit gerettet«, sagte ich noch, bevor ich mich von ihr verabschiedete und zur Tür nebenan huschte.
»Und denk daran, nicht in die Mikrowelle packen, sondern auf dem Herd aufwärmen, sonst verliert die Lasagne ihr ganzes Aroma!«, rief sie mir noch hinterher. Sie wusste ganz genau, dass ich es sowieso nicht machen würde, trotzdem konnte sie es nicht lassen, es mir jedes Mal aufs Neue zu sagen. Schmunzelnd drehte ich den Schlüssel im Schloss und trat in meine Wohnung. Wenn man den kleinen Raum überhaupt als Wohnung bezeichnen konnte.
Meine vier Wände waren alles andere als groß. Wenn man eintrat, befand sich direkt links die kleine Kochnische, bestehend aus einer Theke mit zwei Kochplatten, einem Hängeschrank und einem kleinen Kühlschrank, und rechts ging es in das winzige Badezimmer. Ansonsten war in dem Raum nur Platz für ein Bett, einen kleinen Tisch und eine Kommode. Die Möbel waren alle nicht mehr die neusten und das kleine Fenster spendete nicht genug Licht, um das gesamte Zimmer auszufüllen. Aber es reichte mir.
Nachdem ich die Tür hinter mir zugezogen hatte, schloss ich sie sofort ab und verriegelte sie zusätzlich mit dem kleinen Schieber über dem Griff. Eine Sicherheitsmaßnahme, die mich zumindest etwas ruhiger schlafen ließ. Denn auch die Tatsache, dass ich im obersten Stockwerk wohnte, half nicht gegen die unterschwellige Panik, die mich ständig begleitete. Das Essen von Mrs Delmar stellte ich vorerst neben die Mikrowelle und meine Tasche sowie meinen Mantel hing ich an den Haken direkt neben der Tür. Zunächst musste ich duschen, denn ich konnte es kaum erwarten, den Stress und Schweiß des heutigen Tages abzuwaschen. Auch wenn es bereits November und somit immer kühler wurde, kam ich nach jeder Schicht vollkommen verschwitzt nach Hause.
Also schlurfte ich ins Bad, warf alle meine Klamotten achtlos in die Ecke und huschte unter die Brause. Das heiße Wasser bewirkte Wunder und meine schweren Muskeln wurden ein wenig lockerer und leichter. Ich wusch den ganzen Schweiß und den Geruch Manhattans von mir und versuchte dabei, auch gleichzeitig all den Frust und die Verzweiflung in mir loszuwerden. Natürlich ließen sie sich nicht einfach mit etwas Seife und heißem Wasser wegwaschen, aber versuchen konnte ich es ja. Einige Minuten blieb ich einfach nur so unter dem Strahl stehen und ließ das heiß prickelnde Wasser wohltuend über meinen Körper laufen. Ein weiterer Tag, den ich mit neuen Absagen beendete. Wie lange würde ich das noch aushalten? Es ärgerte mich, wie pessimistisch ich mittlerweile dachte. Doch es war schwer, die Hoffnung zu bewahren, wenn es mir einfach nicht gelingen wollte, wieder Fuß als Ballerina zu fassen. Ich vermisste mein altes Leben. Die Leichtigkeit, mit der ich jeden Tag begonnen hatte, weil ich das Glück gehabt hatte, etwas tun zu dürfen, was ich liebte. All die schmerzenden Knochen, wund getanzten Füße und schlaflosen Nächte vor Aufführungen waren vergessen, wenn ich auf der Bühne stehen und tanzen durfte. Egal, wie hart es gewesen war, es war alles, was ich wollte.
Doch eine einzige Nacht hatte mir alles, was ich liebte, genommen, sodass ich nicht nur mein bisheriges Leben, sondern vor allem mich selbst vollkommen verloren hatte. Ich wollte immer nur Tänzerin werden. Seit ich das erste Mal einen Trainingssaal betreten und vor den imposanten Holzbarren gestanden hatte, wusste ich es.
Natürlich könnte ich mir etwas anderes suchen, aber das Tanzen war das Einzige, was mich immer glücklich gemacht hatte. Das Ballett war mein Anker, ohne wäre ich vermutlich schon längst ertrunken. Alleine bei dem Gedanken daran, dass ich diesen Anker vielleicht verlieren würde, wenn ich keine Lösung fände, spürte ich, wie einzelne Tränen sich mit dem Wasserstrom vermischten. Ich hasste es, weinen zu müssen, immer und überall, aber unter der Dusche war der eine Ort, an dem ich es mir erlaubte. An dem ich alles rausließ. Lieber brach ich für mich zusammen, als unter den Augen anderer Menschen.
Bevor ich noch mehr Wasser verschwendete, drehte ich es schließlich ab und trat auf die kleine Badematte. Die kalte Luft, die mich sofort umhüllte, ließ mich frösteln, und ich wickelte mich schnell in ein Handtuch ein. Mein Blick fiel auf den durch Wasserdampf beschlagenen Spiegel. Ich betrachtete mein verschwommenes Abbild, meine verzerrte Silhouette und kam nicht drum herum, über diese absolut bizarre Situation zu schnaufen. Denn selbst als ich mit den Händen über das nasse Glas fuhr, klärte sich meine Sicht nicht wirklich. Die dunkelbraunen Haare, die bis knapp auf mein Schlüsselbein fielen, und der Pony, der in nassen Strähnen auf meiner Stirn klebte. Und meine Augen. Die blauen Augen, die ich an mir immer am meisten geliebt hatte und die ich jetzt am meisten verabscheute. Bei meinem eigenen Anblick schnürte sich mir die Brust zusammen und eine Welle der Traurigkeit erfasste mich, schüttelte mich. Ich fühlte mich, als würde ich mich jeden Tag etwas mehr verlieren – war das überhaupt noch möglich? –, bis wirklich nichts mehr von mir übrig bleiben würde.
Grace, flüsterte eine leise Stimme in meinem Kopf. Du bist Grace. Du willst Tänzerin werden. Du bist nach New York gekommen, um neu anzufangen. Du wirst wieder okay. Wenn ich das doch nur endlich glauben könnte.
Gerade, als sich mein Blick in meinem Spiegelbild zu verlieren schien, fing mein Magen wieder an zu knurren und riss mich damit aus meiner Trance. Schnell wickelte ich mich in meinen kuscheligen Bademantel und tapste zurück in mein Zimmer, wo ich mich endlich darum kümmerte, das Essen aufzuwärmen. Ich war inzwischen kurz davor, zu verhungern, und nach dem ersten Biss wäre ich am liebsten rüber zu meiner Nachbarin gelaufen und ihr um den Hals gefallen. Die Süße der Tomatensoße mischte sich mit den herben Gewürzen und ich fragte mich, wie etwas so gut schmecken konnte. Kochen hatte noch nie zu meinen Stärken gehört und mir war es schon fast peinlich, wie oft ich mich von Tütensuppen ernährte. Vielleicht war das auch der Grund, warum meine Vermieterin es sich zur Aufgabe gemacht hatte, mich ständig mit ihrem Essen zu versorgen. Vielleicht hatte sie aber auch einfach genau das richtige Gespür dafür, wenn ich einen grauenvollen Tag hinter mir hatte und dringend etwas Warmes brauchte. Denn selbst wenn Essen noch lange nicht die Lösung für alles war – so sehr ich es mir auch oft wünschte –, es war ein Anfang, um mich besser zu fühlen.
Damit es in meinem Zimmer nicht ganz so erdrückend still war, griff ich nach meinem Handy, um meine liebste Playlist einzuschalten, die zum Großteil nur aus Taylor-Swift-Liedern bestand, und machte mich schließlich an mein abendliches To-do: die Suche nach Auditions und möglichen Tanzjobs in der Gegend. Dabei war es mir ganz egal, ob es sich um Auditions für feste Ensembles oder Kompanien handelte oder es nur um einen kleinen Job als Background-Tänzerin ging. Ich nahm alles, was ich kriegen konnte. Den Luxus, wählerisch zu sein, hatte ich nicht mehr.





























