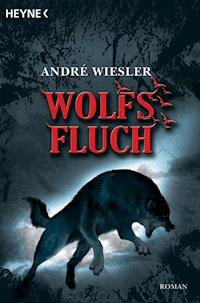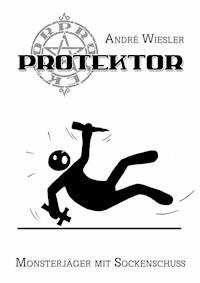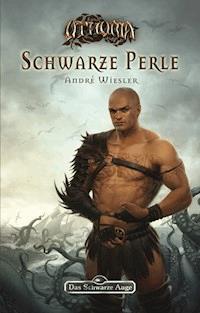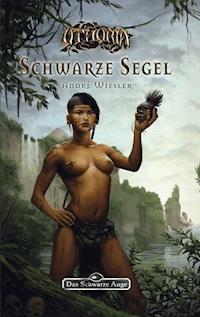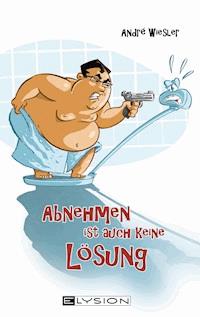Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Ein neues Epos aus der Welt des Schwarzen Auges, Deutschlands beliebtesten Fantasy-Rollenspiel: Der lebenslustige Hangard genießt seine Tage als König der Diebe, bis ihm ein mysteriöser Konkurrent die Krone streitig macht. Aus dem anfangs freundlichen Wettstreit wird schnell ein Kampf um Leben und Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biografie
Der 1974 geborene André Wiesler lebt zusammen mit seiner Frau Janina und seinem Sohn Lorenz in Wuppertal. König der Diebe war sein erster Roman für Das Schwarze Auge, sein Oevre umfasst insgesamt aber schon mehr als ein Dutzend Romane, auch die Mystery-Trilogie Die Chroniken des Hagen von Stein und diverse Bücher der Shadowrun-Reihe.
Neben der Schriftstellerei arbeitet er als Übersetzer, Spieleentwickler, Redakteur und tritt als Lese-Komiker auf. Darüberhinaus organisiert er als ein Teil der Wuppertaler Wortpiraten Poetry-Slams und gibt Schreibkurse und leitet Schreibwerkstätten.
Weitere Informationen zu André Wiesler finden Sie auf seiner Internetseite:
www.andrewiesler.de
Titel
André Wiesler
König der Diebe
Erster Teil
Dreiundsiebzigster Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 73
Kartenentwurf: Ralf HlawatschE-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Copyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN: 3-453-18805-5 (vergriffen)E-Book-ISBN: 978-3-86889-639-8
Widmung
Für Janina – ohne deinen Optimismus, dein grenzenloses Vertrauen und deinen Beistand wäre ich heute vermutlich ein unglücklicher Straßenkehrer.
In Erinnerung an Wilhelm Wiesler
Der Fuchs hat leisen Tritt
Still lag die Stadt da. Hangard vom Wiesenfeld hockte auf einem schmalen Dachfirst und schaute auf sie herunter.
Es war seine Stadt, er kannte sie von hier oben ebenso gut, wie er unten ihre Straßen und Gassen kannte.
Er lauschte. Dem großen Rommilys waren nur wenige Momente der Ruhe vergönnt, aber zu dieser Stunde der Nacht, kurz bevor sich der Himmel mit einem grauen Gürtel zieren würde, war niemand mehr in Rommilys unterwegs, der nicht etwas im Schilde führte. Und wenn es nur das Wappen der Stadt war. Gut acht Schritt unter ihm stapfte die übernächtigte Stadtgarde im Gänsemarsch durch die schmale Gasse –, wie immer auf den gleichen Wegen, wie immer zur gleichen Zeit, wie immer und wie in jeder Nacht. Man konnte sich nach ihr richten wie nach dem Nachtwächter, der seine Arbeit mit dem Ausrufen der fünften Stunde beendet hatte.
Und der Oberst der Garde war auch noch stolz auf diese Vorhersehbarkeit. Jeder Dieb, der seinen Titel verdiente, wusste genau, wann und wo die Gardisten auftauchten.
Hangard schmunzelte. Und nach oben schauten sie auch nie. Er blickte den im Lampenlicht aufblitzenden Helmen nach und lauschte, wie sich der Klang der schweren Stiefel entfernte, um schließlich ganz zu verstummen. In der Stille, die zwischen den Stunden des Phex und denen des Praios lag, glaubte man manchmal sogar das Donnern der Darpatfälle bis hierher vernehmen zu können – sogar der kleine Stadtteil, den man das Paradies nannte, lag mittlerweile still und bot trotz seiner unzähligen Freudenhäuser, Spielhallen und Tavernen einen friedlichen Anblick. Wer um diese Zeit durch seine Gassen schlich, war unterwegs, um besinnungslos Betrunkene einzusammeln – oder deren Wertsachen.
Apropos! Hangard steckte die Hand in den kleinen Beutel an seinem Gürtel und zog die Beute der heutigen Nacht heraus: ein Paar Diamantohrringe, eine Perlenkette und einen Rubinring. Er lachte leise auf, als er sich den Gesichtsausdruck der Geliebten des Richters vorstellte, wenn sie seinen Einbruch bemerken würde. Immerhin hatte sie den Schmuck noch am Leib getragen, als sie sich schlafen gelegt hatte. Und was für ein Leib das gewesen war, bei Rahja! Fast hätte Hangard sich der Versuchung hingegeben, sie zu wecken.
Zufrieden steckte er die Liebesgeschenke des Richters wieder ein und machte sich an den Abstieg. Er kannte dieses Haus, wie er die meisten Häuser der Stadt mit Augen und Händen kannte, und so fiel es ihm leicht, Halt zu finden. Er war eben ein Kind von Rommilys – seinem Rommilys.
Dieser Einbruch würde sich schnell herumsprechen und natürlich wäre allen klar, wer ihn verübt hatte. Seit drei Jahren trug Hangard nun unangefochten die Würde des Königs der Diebe zu Rommilys und auch in diesem Jahr würde ihm keiner den Titel streitig machen können.
Nicht, dass die Krone zu irgendwelchen Rechten verhalf oder allgemein anerkannt war, aber unter den Dieben, den Beutelschneidern und Fassadenkletterern galt sie etwas, sofern diese der Gemeinde um den Mondschatten Phedrian angehörten. Soweit Hangard wusste, gab es nur in Rommilys einen König der Diebe. Wie dem auch sei, seine Siegesgewissheit war kein Grund, faul zu werden. Hilf dir selbst, dann hilft dir Phex, hieß es nicht umsonst.
Die letzten zwei Schritt ließ er sich fallen. Seine weichen Stiefel machten kaum ein Geräusch auf dem Pflaster, als er landete, leicht in die Hocke ging, um die Wucht des Absprungs abzufangen, und sich dann mit einer übermütigen Drehung aufrichtete. Im Gehen zog er seine Jacke aus und wendete sie. Das dunkle Blau verschwand und ein strahlendes Rot kam zum Vorschein. Die Jacke hatte ihn ein kleines Vermögen gekostet, aber das war sie wert. Sie betonte seinen schlanken, geschmeidigen Körper, beide Farben passten hervorragend zu seinen blauen Augen – und nachts schützte ihn der dunkle Stoff vor neugierigen Blicken.
Er fröstelte. Es war erstaunlich frisch in dieser Nacht im Phex. Aus den Stulpen des Stiefels erschien wie durch Zauberhand ein rotes Barett. Die Feder war zerzaust und gebrochen, aber das war zu verschmerzen. Hangard zupfte sie ab und war im Begriff, sie auf den Boden zu werfen. Doch dann hielt er inne und steckte sie in die Hosentasche – als König der Diebe wollte er zwar, dass jeder wusste, wer den Diebstahl begangen hatte, aber man sollte es ihm nicht beweisen können. Er strich sich die hellbraunen Haare aus dem Gesicht. Er wollte sie wachsen lassen, aber im Moment war die Pracht eben lang genug, um ihm die Sicht zu nehmen. Man sagte, er sähe gut aus – egal, welche Frisur er trug – und wer war er, da zu widersprechen?
Eine erfolgreiche, aber lange Nacht lag hinter ihm, und als nun die freudige Aufregung, die der Einbruch bei ihm verursacht hatte, von ihm wich, spürte er die Müdigkeit. Hangard gähnte ausgiebig und bog in Richtung Althafen ab. Die Gegend wurde zusehends schlechter, je weiter er sich von Praiosstadt entfernte.
Interludium
Das kleine Zimmer war von der Hitze ihrer Körper erfüllt. Die Decke und das Laken ihrer Bettkiste, feiner Stoff, so weich und weiß wie die Wolken, waren feucht von ihrem Schweiß. Isida hatte sich das Daunenkissen unter den Kopf gesteckt und strampelte jetzt die Decke zur Seite.
»Zu warm«, erklärte sie ihrem Geliebten, der seinen Kopf auf ihre Brüste gebettet und die Augen geschlossen hatte. Aber Tanglans zufriedenes Lächeln zeigte, dass er noch nicht eingeschlafen war.
»Was denkst du?«, fragte sie ihn und strich mit der Hand über seine kräftige Schulter. Er war ein so schöner Mann. Ganz anders als ihre Brüder, die rund und speckig waren und überall Haare hatten, fast wie Orks.
»Ich möchte diesen Moment in den Norden schikken, damit er gefriert, und wann immer es mir schlecht geht, möchte ich ein Stück davon auftauen«, sagte er und hob den Kopf, um ihr in die Augen zu schauen.
»War das von dir?«, fragte sie und kniff ihn in den Nacken. »Sag die Wahrheit!« Er schüttelte lächelnd den Kopf. »Perval von Wintersgrund hat es für mich erdacht. Ich habe ihm gesagt, er soll mir etwas schreiben für einen Augenblick, in dem man zum Zerspringen glücklich ist. Enttäuscht?«
Statt einer Antwort presste sie ihn so fest an sich, wie sie nur konnte. Er war so klug und sanft und so ehrlich. So ganz anders als die Schurken und Halsabschneider, mit denen ihr Vater sie immer verkuppeln wollte.
Sie entließ den lachenden Tanglan aus ihrem Klammergriff und sank auf das Kissen zurück. Der Gedanke an ihren Vater hatte sie betrübt gemacht.
»Wir müssen es ihnen bald sagen«, flüsterte sie.
Tanglan legte den Kopf auf ihre Schulter und seine Hand auf ihre Brust. »Ja, das müssen wir«, gab er zu.
»Bald! Ich glaube, sie ahnen schon etwas«, mahnte sie.
»Bitte, meine Blume, lass uns nicht jetzt darüber sprechen«, bat Tanglan.
»Aber mein Vater schleppt morgen wieder einen von den Flusspiraten an. Ich habe es satt, mich von diesen ungeschlachten Kerlen angaffen zu lassen, als wäre ich ein Stück Schlachtvieh. Ich kann meinen Vater nicht mehr lange hinhalten. Es wird Zeit«, sagte sie eindringlich.
»Das sieht einem Musker ähnlich – seine Tochter an den Höchstbietenden zu verschachern«, grollte Tanglan.
»Ach?«, meinte Isida spitz. Daher wehte also der Wind. »Und bei euch Fernels macht man es anders, oder was? Da frag mal deine Schwestern.«
Tanglan setzte sich auf. »Wir ...«, hub der junge Mann an. Aber dann schüttelte er den Kopf. »Ach Isida, meine wunderschöne, bezaubernde Isida. Lass uns nicht über unsere Familien streiten!«
Er küsste sie zärtlich auf das Kinn, dann auf den Mund. Sie erwiderte seinen Kuss. Wie Recht er hatte! Sollten die ganzen Muskers und Fernels doch in einen Trollhintern fahren und nimmer mehr daraus hervorkriechen! Solange sie mit ihrem Tanglan hier liegen, ihn nah bei sich spüren, seinen Geruch einatmen konnte, solange konnte die Welt da draußen tun, was ihr beliebte.
»Ja«, sagte sie leise. »Halte mich für immer so, mein Geliebter!«
Aber Tanglan löste seinen Kopf aus ihren Armen und beugte sich über ihre Brust. Er ließ seine Zungenspitze um ihre Brustwarzen kreisen, küsste ihren Bauch und wanderte weiter nach unten.
Isida kicherte. »Dein Bart, mein Stier, er kitzelt.«
Tanglan legte das Kinn auf ihren Bauch und blickte über ihre Brüste hinweg zu ihr auf. »Wenn es Euch juckt, muss ich Euch kratzen. Ich halte das Werkzeug dazu wohl bereit.«
Isida schaute ihn überrascht an. »Noch einmal?«
Er nickte stumm und zog das Laken zwischen ihren Schenkeln weg. Dann wandte er sich wieder ihrem Bauch zu, liebkoste ihn und knabberte sanft an ihrem Rahjahügel.
Unten in der Stube polterte etwas. Eine dumpfe Stimme fluchte.
»Mein Vater!«, sagte Isida erschrocken.
Tanglan biss sie leicht in den Oberschenkel. »Wir wollten doch nicht mehr über ...«
Sie packte ihn bei den Haaren und zog ihn hoch. »Mein Vater ist zurück!«, keuchte sie entsetzt.
»Was, schon?« Tanglan wurde bleich. Er rollte sich aus dem Bett, wollte aufstehen, aber seine Beine verhedderten sich in der Decke. Er schlug der Länge nach hin.
»Was treibst du denn da oben, Isida?«, brüllte ihr Vater von unten. Er hatte schlechte Laune, das war nicht zu überhören. Sicher war etwas mit der Lieferung schief gelaufen. Seitdem die Stadt mehr Kanalgrafen herumschickte, wie er die Wachen in der Kanalisation nannte, war er oft schlecht gelaunt.
»Vielleicht übt sie tanzen?«, hörte sie Dabbert spotten. Vielstimmiges Gelächter antwortete ihm. Die ganze Sippe war zum Nachtschlussmahl, wie es die Schmuggler nannten, eingekehrt.
»Beeil dich!«, flehte Isida. »Sie schlagen dich tot.« Tanglan torkelte durch den Raum, sprang in seine Hose und zog hüpfend seinen Stiefel an.
»Wo ist der andere? Der andere Stiefel?«, zischte er.
Isida blickte sich eilig um. Da war er, unter dem Bett. Sie zog ihn hervor und warf ihn zu Tanglan herüber. Er hatte ihn gerade angezogen, als sie schwere Schritte auf der Treppe hörte.
»Durchs Fenster, schnell!«, raunte sie.
Tanglan hatte das Hemd unter dem Arm und die Beinkleider standen ihm offen, aber er schwang die Beine aus dem Fenster und suchte nach dem Steigbrett, das sie heimlich angenagelt hatten. Isida küsste ihn noch einmal. »Geh! Geh!«, drängte sie dann. Er sprang auf die große Regentonne, fiel fast hinein, konnte sich aber noch fangen und hüpfte hinunter auf die Straße. »Morgen!«, rief er leise. Sie nickte und winkte.
In diesem Moment flog die Tür auf und ihr Vater kam hereingepoltert. Er blieb wie angewurzelt im Türrahmen stehen und sein Gesicht färbte sich dunkel vor Wut oder Scham. Der schwarze Vollbart und die buschigen Augenbrauen umgaben es wie ein Pelzkragen. Sein gewaltiger Bauch hob und senkte sich mit jedem tiefen Atemzug.
»Isida!«, grollte er. »Du kommst mir sofort vom Fenster weg! Was sollen denn die Nachbarn denken, wenn du splitterfasernackt ...« Er verstummte und starrte zu Boden.
Isida folgte seinem Blick. Tanglans Gürtel lag dort, ein breites, schwarzes Ungetüm mit einer silbernen Schnalle. Daneben lag das neue Halstuch, das sie ihm geschenkt hatte. Es war sonnengelb und nicht zu übersehen.
»Wo ist er?«, brüllte ihr Vater, stieß sie zur Seite in ihr Bett und hob es mit einer Hand an, als wäre die schwere, eichene Kiste aus Stroh. »Wo ist er?« Wutschnaubend wandte sich ihr Vater im Zimmer um, dann stürmte er zum Fenster und schaute hinunter. Mit einem Krachen riss er die Latte aus dem Holz des Fachwerks und hielt ihr das nagelstarrende Ding unter die Nase. »Wer ist er? Sag mir den Namen dieses Schufts, Kind, oder ich schwöre bei allen Göttern, ich erschlage dich mit ihm zusammen. Mir brennt nicht noch eine Tochter mit einem Habenichts durch!«
Isida hatte große Angst. Ihr Vater war wie von Sinnen. Schaum troff ihm vom Mund auf den struppigen Bart. »Rede! Wie heißt er?«, brüllte er. Isida liefen Tränen über das Gesicht. Was sollte sie nur tun? Sie konnte Tanglan unmöglich verraten, ihr Vater würde ihn in Stücke reißen! Aber wem könnte sie die Tat anhängen, wem würde man zutrauen, dass er so dreist wäre, Eberhelm Muskers Tochter anzurühren? Ihr fiel nur ein Name ein: »Hangard vom Wiesenfeld.«
Aufruhr im Verzug
Hangard war auf dem Weg zur östlichen Neustadt, wo er seinen Unterschlupf für den Tag errichtet hatte. Er ließ den neuen Markt hinter sich, auf dem im Licht der ersten Sonnenstrahlen zahlreiche Händler ihre Stände aufbauten.
Er schlenderte gut gelaunt Richtung Efferdtempel, als er vor sich den gewaltigen Eberhelm Musker stehen sah. Der dicke Mann blickte in die andere Richtung, die Straße herunter, als würde er auf jemanden warten. Die Tür zum Muskerhaus stand hinter ihm offen, seine im Vergleich zu ihm winzige Frau Wina lehnte im Rahmen und fragte: »Haben sie ihn schon?«
Der Mann schüttelte den Kopf.
»Ich hoffe, sie erwischen ihn und gerben ihm gehörig das Fell. Diesem Tunichtgut. Der soll erleben, was es heißt, sich mit den Muskers anzulegen!«, schimpfte sie.
Hangard schmunzelte. Solange er denken konnte, lagen die Muskers und die Fernels miteinander im Streit. Beide betrieben neben ihren normalen Händlergeschäften einen schwunghaften Schmuggel nach und aus Rommilys und kamen sich immer wieder ins Gehege.
Offensichtlich war es wieder einmal Zeit für eine Keilerei. Phex sei Dank war bisher noch keiner der Beteiligten ernsthaft verletzt worden; so eine Fehde konnte schnell das Ende einer oder gar beider Familien bedeuten.
»Guten Morgen, Eberhelm. Sucht ihr jemanden?«, fragte Hangard und nickte der Frau zu. Ihr Gesichtsausdruck wandelte sich, aber nicht zu dem freundlichen Lächeln, das sie ihm sonst schenkte. Es war blankes Erstaunen.
»Da ist er!«, kreischte sie und der gewaltige Eberhelm drehte sich um. Auch er schaute erstaunt.
»Guten Morgen, ich fragte gerade ...«, begann Hangard, aber im nächsten Moment rollte er auf der Flucht vor den wuchtigen Schlägen des Musker-Vaters über den Boden.
»Du wagst es!«, donnerte dieser, sodass die Bewohner der ganzen Straße geweckt wurden.
»Eberhelm! Was?« Wieder kam Hangard nicht weiter. Ein schneller Sprung zur Seite bewahrte ihn vor einem weiteren Schwinger und davor, in Stücke geschlagen zu werden. Dieses Schicksal erlitt stattdessen der Fensterladen des Nachbarhauses, der krachend aus den Angeln flog.
»Unsere kleine, unschuldige Isida zu verführen«, grollte Eberhelm und schlug diesmal mit der Linken zu. Hangard sah den Schlag kommen, beugte sich zur Seite und umklammerte dann den ausgestreckten Arm des Schmugglers.
»Helmbrecht, kommt zu Verstand! Ich bin es, Hangard«, beschwor er den tobenden Kerl. Isida und unschuldig, dass er nicht lachte! Sie teilte schon seit Monaten das Lager mit Tanglan Fernel. Hangard höchstselbst hatte den beiden geholfen, ihre knospende Liebe zu pflegen, ohne dass ihre Familien es bemerkten. Aber er hatte sie nie angerührt. Oder doch? Im Suff war vieles möglich, und dass sie ihn wollte, wusste er sicher. Jede Frau wollte ihn.
Seine Gedanken hätten ihn beinahe den Kopf gekostet. Im letzten Augenblick ließ er den Arm los und ging in die Knie, um der Rechten auszuweichen, die zischend über ihn hinwegfegte.
Er sprang einige Schritte zurück: »Helmbrecht, ich schwöre Euch, ich habe niemals ...«
Er brach ab, als er sah, dass Mutter Wina mit einer Armbrust aus dem Haus kam und sie ihrem Mann reichte: »Schieß ihn ab, Eberhelm, schieß ihn ab!«
Hangard erkannte, dass dies nicht die Zeit und der Ort waren, um das Missverständnis aufzuklären. Er wirbelte herum und nahm die Beine in die Hand. Sicherheitshalber schlug er Hasenhaken die Straße entlang und nahm die erste Abzweigung. Wie bei allen Dämonen kam Musker nur darauf, dass er etwas mit Isida haben könnte? Er würde ein oder zwei Tage abwarten, bis sich das Gemüt des Schmugglers abgekühlt und sich dieser bedauerliche Irrtum aufgeklärt hätte, und dann würde er großzügig die Entschuldigung und eine gute Flasche Wein entgegennehmen. Aber vorerst war es sicherer, einen gehörigen Abstand zwischen sich und seinen Verfolger zu bringen.
Obwohl er wenig später sicher war, den schnaufenden Musker abgehängt zu haben, nahm er einen größeren Umweg in Kauf und lief durch Neuhafen, um das Haus der erbosten Familie möglichst weiträumig zu umgehen. Eben kam er an dem Gasthof »Angroschs Lob« vorüber. Xorgosch, der zwergische Wirt, war wohl gerade erst seine letzten Gäste losgeworden. Er stand vor der Tür und atmete in tiefen Zügen die kühle Morgenluft ein. Hangard nickte ihm zu. Der Zwerg grüßte müde zurück, trat ins Haus und zog die Tür hinter sich zu. Im selben Augenblick vernahm Hangard einen Schmerzensschrei. Er vermeinte eine männliche Stimme zu erkennen. Da es also keine Frau zu erretten galt oder gar ein Kind in Not, ging er weiter, bis er erneut ein schmerzerfülltes Stöhnen vernahm. Mit einem leisen Fluch auf den Lippen wandte er sich um und lief zu der Gasse zurück, aus der die Geräusche kamen. Er war einfach zu gut für diese Welt!
Der Anblick, der sich ihm bot, als er vorsichtig um die Ecke lugte, war wenig erfreulich. Xerber Dreifinger stand über einen alten, rundlichen Mann gebeugt und zerrte an dessen Geldbeutel. Nahm denn die Aufregung in dieser Nacht gar kein Ende mehr? Der Räuber bekam die Börse nicht vom Gürtel los. Der Alte versuchte offensichtlich ebenfalls, den Knoten des straff gespannten Lederbandes zu öffnen, um den Schlägen zu entgehen, aber Xerber drosch trotzdem immer wieder auf ihn ein. Dabei hätte man dem jungen Mann auf den ersten Blick solche Brutalität nicht zugetraut. Er war schmutzig, sicher, und seine Kleidung war nicht die beste. Aber wenn sein Gesicht nicht gerade vor Gier und Wut verzerrt war, hatte er die feinen, sanften Züge eines Dichters. Er war offensichtlich in die falschen Kreise geraten und das war bedauernswert – allerdings schien er sich in diesen Kreisen wohl zu fühlen und das verdiente Strafe.
»Lass schon los!«, zischte der Gossendieb und hieb dem Mann erneut auf den Arm.
Wut kochte in Hangard auf – das war nicht der Weg seines Gottes! Er trat in den Eingang der Gasse, stemmte die Hände in die Hüfte und sagte, gerade laut genug, dass der Halsabschneider ihn hören konnte: »Das wollte ich dir auch gerade raten.«
Xerbers Kopf ruckte hoch und seine Augen wurden groß: »Der König ...«
Dann aber schlich sich ein gemeiner Tonfall in seine Stimme und er drohte mit dem Knüppel: »Wenn du weißt, was gut für dich ist, verschwindest du am besten gleich wieder.«
Hangard lachte trocken auf: »Und wenn nicht? Verhaust du mich dann mit deinem Stöckchen?«
Es war jahrelanger Übung zu verdanken, dass seine Stimme bei diesen Worten nicht zitterte. Es gab wenig, wovor Hangard wirklich Angst hatte, aber jede Art von direktem Kampf gehörte dazu. Zu seinem Glück war zu seinem Ruf als meisterlicher Beutelschneider und Fassadenkletterer irgendwann auch die Überzeugung der anderen dazugekommen, er müsse mit dem Dolch ebenso unübertrefflich sein.
Xerber überlegte. Dann ließ er den Beutel des Mannes los: »Er wird dir das heimzahlen«, zischte er.
Hangards Lächeln verschwand, er zog seinen Dolch aus dem Hosenbund. Xerber hatte natürlich von seinem Anführer Akhim gesprochen. Wenn es jemanden gab, dem Hangard in Rommilys aufrichtig den Tod wünschte, dann war es dieser Schurke. Immer mehr ehrbare Diebe presste er in seine ruchlose Truppe und brachte sie dazu, die Tugenden Phex‘ gegen Knüppel und Hinterhalte zu tauschen.
»Nur zu! Lauf zu deinem Herrchen, und richte ihm aus, dass ich mich schon darauf freue, ihn zu treffen – mitten ins Herz.«
Xerber wollte augenscheinlich etwas erwidern, aber als Hangard den Dolch wie zum Wurf erhob, drehte er sich um und floh. Wenig später war er verschwunden.
Hangard ließ den Dolch sinken und atmete tief durch. Dann trat er zu dem Alten und half ihm aufzustehen.
»Ihr habt mir das Leben gerettet«, keuchte der und eine Wolke Branntweinatem hüllte Hangard ein. Er widerstand der Versuchung, sie mit dem Barett beiseite zu wedeln.
»Na ja, so wild war es nicht. Wohnt Ihr weit von hier?«
Der Mann wankte. Eine Platzwunde verunzierte seinen Kopf und ein Arm war stark geschwollen. Seine Kleidung war schmutzig, aber von guter Qualität, wenn auch farblich etwas eigenwillig zusammengestellt. Ein rotseidenes Rüschenhemd flatterte an seiner dürren Gestalt, nur über dem kleinen Spitzbauch spannte es sich, und die grünen Beinkleider gaben sich alle Mühe, das kräftige Sonnengelb des Obergewandes auszustechen. Einzig die Schuhe waren schlicht und aus einfachem Leder. Nein, dieser Mann war nicht arm.
»Ein Stückchen ist es wohl.«
Hangard lächelte ihm zu. »Ich geleite Euch!«
Er legte sich den unversehrten Arm des Mannes um die Schulter und gemeinsam stapften sie los. Nach ein paar Schritten hatte Hangard das störrische Lederband des Geldbeutels gelöst und ließ die Börse des Alten in seiner Tasche verschwinden. Sie war nur halb gefüllt, aber fühlte sich nach Dukaten an. Phexens Gebot war damit Genüge getan, die Hilfe mit einer Gegenleistung vergolten.
Sie kamen nur langsam voran und so zeigte sich Praios schon am Horizont, als sie das Haus des Alten erreichten. Es bestätigte Hangards Vermutung: Dieser Mann war wohlhabend.
Auf das Klopfen des Alten hin öffnete eine Frau, die nur wenig jünger war als er. Trotz der frühen Stunde war sie bereits sorgfältig in ein schmuckloses Gewand gekleidet. Den Mund hatte sie zu einem engen Strich zusammengepresst. »Hat er sich wieder besoffen?«, fragte sie spitz.
Hangard schenkte ihr ein strahlendes Lächeln, das aber wirkungslos an ihr abprallte. Es bezauberte eben nur jüngere Frauen. »So scheint es. Und überfallen wurde er auch.«
Sie schien nicht sehr überrascht davon.
»Schwesterchen, sei mir gut, ja?«, lallte der Alte.
»Seid so freundlich und bringt ihn herein.« Sie öffnete die Tür ganz und ging voran. Hangard wuchtete den Betrunkenen die Eingangsstufen hoch und schob ihn vor sich her in den geräumigen Flur. Dabei wanderte sein Blick über Wandteppiche, edles Holz und vergoldete Türknäufe. Als er das Kaminzimmer betrat, den Alten immer noch vor sich herschiebend, entdeckte er endlich etwas Brauchbares: Eine Sammlung gold- und edelsteinverzierter Fingerhüte stand auf einem kleinen Schränkchen an der Wand.
»Wohin mit ihm?«, fragte er die Schwester.
»Werft ihn einfach auf den Boden«, entgegnete die Frau scharf und ging hinüber in die Küche. Hangard ließ den Mann in einen Stuhl sinken, in dem er schief sitzen blieb, und streckte die Hand nach den Fingerhüten aus.
»Bitte, seid mein Gast! Verweilt und speist mit uns!«, lallte es vom Stuhl herüber.
Hangards Hand verharrte. Musste das jetzt sein? Als Gast konnte er nichts stehlen, wollte er nicht den Zorn der gütigen Travia heraufbeschwören. Seine Finger tanzten in der Luft über den Fingerhüten, sicher einen Dukaten wert das Stück. Aber nein! Es war nicht ehrenvoll, in einem Haus zu stehlen, in das man gebeten wurde. Er verdrehte die Augen und wandte sich um.
»Habt Dank, aber ich muss weiter. Das Tagwerk ruft, guter Mann. Achtet nur in Zukunft darauf, nicht alleine zu trinken.«
Aber der Branntweinfreund war bereits sanft entschlummert und so hörte er die Ermahnung nicht mehr. Seine Schwester kam aus der Küche und hielt Hangard eine Wurst vor die Nase: »Für Eure Mühe.«
Er musste sich ein Lachen verkneifen. »Das ist wirklich nicht nötig. Ich werde mich nun empfehlen. Einen guten Tag noch.«
Die Wurst pendelte noch einen Augenblick vor seinem Gesicht hin und her, dann wurde sie gesenkt. »Nun ja, habt Dank.«
Anscheinend verursachte es der Frau körperliche Anstrengung, diese Worte auszusprechen.
Hangard trat lächelnd in den Sonnenschein des frühen Morgens hinaus und klopfte auf die gestohlene Börse in seiner Tasche. »Ich habe zu danken.«
Interludium
Die fürstliche Wache war auf der Hut. Niemand konnte das Reichskanzler-Randolph-Tor passieren, ohne von den »Goldenen Raben« bemerkt zu werden. Aber der Beobachter in der dunkelblauen engen Kleidung wollte ja gar nicht durch das Reichskanzler-Tor. Er wollte darauf.
Mit langsamen Bewegungen, um die Wachsoldatin, die ihm das Gesicht zuwandte, nicht auf sich aufmerksam zu machen, zog er die Graue Maske zurecht. Löcher für die Augen und den Mund waren hineingeschnitten, aber davon abgesehen, umgab das Leinen seinen Kopf zur Gänze. Der Dieb überprüfte mit sicheren, hundertfach geübten Bewegungen den Sitz der Ausrüstung – alles bestens. Und dann hieß es warten.
Aber Phex war gnädig in dieser Nacht. Schon wenige Herzschläge später wandte sich die Frau von ihm ab und trat zu den anderen Raben. Geduckt und im Schatten huschte er zur Seite des Tores und war im Nu an den griffigen Steinen emporgeklettert. Oben angekommen, empfing ihn die Hitze der Ölbecken, die auf dem Tor brannten. Zum Glück ragten sie seitlich über die Torbreite hinaus und leuchteten so die Oberseite nicht völlig aus. Ein wenig Schatten blieb, mehr als genug für die schmale Graue Maske. Auf dem Bauch robbte der Dieb sich an sein Ziel heran. Ein rascher Blick nach unten. Dort standen die drei Wachen, jetzt genau unter ihm. Die goldenen Rabenspangen auf ihren Schultern blitzten im Licht der Fackeln, die den Torbogen erhellten. Das in jeder Hinsicht diebische Lächeln erschien erneut in dem schmalen Atemschlitz der Maske. Ob diese Abzeichen aus reinem Gold waren?
Später! Er hob den Blick und zog ein kleines Messer. Jetzt war eine andere Beute in Griffweite.
Wenn zwei sich streiten ...
Als Hangard erwachte, war die Sonne schon wieder dabei, hinter dem Horizont zu versinken. Er stand auf und trat ans Fenster. Von draußen zog der Geruch gebratenen Fleisches herein. Er winkte der Praiosscheibe ein »Lebewohl« zu und kleidete sich an. Er hatte ausgesprochen gut geschlafen, was zum einen an der Güte des Bettes lag und zum anderen natürlich an seiner grandiosen Tat der Vornacht. Mittlerweile müssten alle davon erfahren haben und würden sich hinter vorgehaltener Hand darüber erzählen.
Er ging in die Speisekammer und sah sich um. Leere – außer einer knochenharten Wurstkette war nichts zu finden.
Das war der Nachteil, wenn man die Häuser von Leuten bewohnte, die verreist waren: Sie hinterließen einem selten brauchbare Vorräte. Nun ja, würde er eben irgendwo einkehren, sparen musste er nun wirklich nicht.
Er ging hinaus und zog die Tür hinter sich zu – sicher war sicher. Er wohnte sozusagen im Moment hier und er wollte ja nicht bestohlen werden! Der Gedanke entlockte ihm ein Lachen.
Sein Weg führte ihn ins Katzloch, das Armenviertel der Stadt. In »Phexens Finger« war zwar das Essen schlecht, aber man würde ihn dort feiern wie den König, der er war. Er pfiff einen Gassenhauer aus Gareth vor sich hin, der »In Dexter Nemrods Bette« hieß. Man hatte ihm in Rommilys einige sehr erfindungsreiche Strophen hinzugefügt, die von den Bleikammern und dem Archiv der Kaiserlich Garethischen Informations-Agentur handelten, die bis vor kurzem noch in der Stadt gewesen waren. Mittlerweile hatte man beides verlagert.
Das Aussehen der Leute auf der Straße änderte sich rasch. Im Katzloch hielt man vergebens Ausschau nach Schauben, Federhüten oder gar nach Strümpfen. Die Menschen hier trugen kaum mehr als Lumpen am Leib und die Erschöpfung eines harten Tagwerks im Gesicht.
Aber sie hatten wenigstens ein Tagwerk – noch schlimmer traf es die zahlreichen tobrischen Flüchtlinge. Sie hatten kaum mehr als Narben und Angst im Gepäck geführt, als sie ihre Heimat den Dämonenhorden überlassen mussten, und obwohl sie nach bestem Gewissen Gastung von den Städtern erhielten, wurde keiner von ihnen fett in Rommilys.
So wie diese beiden. Ein dünner Junge von vielleicht fünf Jahren stolperte an der Hand seiner nicht weniger ausgemergelten Mutter an Hangard vorbei und staunte dessen rote Jacke mit großen Augen an.
Hangard schenkte ihm ein Lächeln und blinzelte ihm zu. Schnell blickte der Junge zu Boden. Zweifelsohne hatte man ihn gelehrt, keinem Fremden zu trauen. Es war eine Schande! Kinder sollten herumtollen, Streiche spielen und sich des Lebens freuen. Die Dämonen hatten bereits einen empfindlichen Sieg davongetragen und ihre Beute war der Frohsinn der Kinder. Hangard nahm sich vor, mal wieder im Traviatempel vorbeizuschauen und etwas zu spenden. Aber nicht heute.
Heute würde er sich in »Phexens Finger« feiern lassen und ein bisschen Geld unter die ehrbaren Falschspieler der Stadt verteilen – man wusste nie, von wem man mal einen Gefallen brauchte.
Er sah schon die schmutzige Vorderseite der Taverne vor sich, als er hinter sich eine jammernde Stimme vernahm: »Edler Herr, eine Münze für einen armen tobrischen Versehrten? Ein Dämon fraß meine Frau und mein Bein.«
Hangard drehte sich lächelnd um. »Lass gut sein, Fungard.«
Der abgerissene Kerl hinter ihm, der nicht im Entferntesten tobrisch aussah, verzog das Gesicht. »Ach, du bist es.« Das abgefressene Bein erschien wundersam unter dem speckigen Umhang und die krude Krücke wurde über die Schulter gelegt.
»Ein Dämon hat dir das Bein abgefressen?«, fragte Hangard. »Du hattest auch schon bessere Geschichten.«
Der Bettler zuckte mit den Schultern. »Man muss mit der Zeit gehen.«
»Kommst du mit rein? Der Erste geht auf mich.« Hangard wies in Richtung »Phexens Finger«.
Fungard nickte erfreut und sie gingen weiter.
»Hast du‘s schon gehört? Letzte Nacht?« Fungard flüsterte jetzt voller Ehrfurcht.
Hangard lächelte. Es hatte sich wie erwartet herumgesprochen.
»Das muss das Dreisteste gewesen sein, das je einer von uns in Rommilys gewagt hat.« Fungard machte hinter der vorgehaltenen Hand das heimliche Zeichen des Phex.
»Danke sehr!« Hangard deutete eine Verbeugung an.
»Das heißt – du warst es, der ...« Fungard deutete nach oben.
Hangard nickte lächelnd und weidete sich an der fassungslosen Bewunderung des Bettlers.
»Du verrückter Hund«, rief Fungard lachend und schlug ihm auf den Oberarm. »Einfach so die Flagge der Stadt zu klauen.«
»Oh, ich habe schon ...«, Hangard wurde bewusst, was Fungard gesagt hatte. »Die was?«, fauchte er irritiert.
Fungard wich zurück. »Die Flagge? Vom Reichskanzler-Tor? Ich dachte ...«
»Ich habe die Geliebte des Richters ausgeraubt«, sagte Hangard mit Nachdruck.
Fungard kniff den Mund zusammen. »Oh, sehr ...«, er suchte nach Worten, »sehr beeindruckend, doch, wirklich. Davon hab ich noch gar nichts gehört.«
Dieses Gespräch verlief nicht so, wie Hangard es erwartet hatte. Er hatte nichts davon gehört? Von einer so großartigen Tat? Was war mit dieser Stadt los?
Er zog Fungard an der Krücke zu sich heran. »Jetzt noch mal ganz von vorne. Was ist mit der Flagge?«
»Na, jemand hat gestern Nacht die Flagge mit dem Stadtwappen vom Reichskanzler-Randolph-Tor gestohlen. Während die Raben direkt darunter standen.« Fungards Stimme zitterte vor Ehrfurcht vor dem unbekannten Dieb.
Hangard stieß ihn von sich. »Wo sollten sie auch sonst stehen?«, gab er gereizt zurück. Die Lust auf einen Tavernenbesuch war ihm gründlich vergangen. Er musste herausfinden, wer hinter dieser dreisten Tat steckte. Aber dafür brauchte er mehr Geld. Er wandte sich ab und ging die Straße hinunter.
»Und mein Bier?«, rief Fungard ihm nach.
Wortlos warf Hangard einen Heller über die Schulter nach hinten. Die Münze klirrte über den Boden. »Trink auf mein Glück«, rief er, ohne sich umzuwenden. Er konnte im Moment jeden noch so kleinen Segen brauchen.
Helme der Vergolder war ein unglaublich fetter Mann. Seine Speckwülste quollen derart über die Armstützen und Sitzfläche des Lehnstuhls, dass er um das Möbel herumgewachsen zu sein schien.
»Was hast du diesmal für mich, König?«, fragte Helme nun und rieb sich die runden Hände mit den viel zu kurzen Fingern. Reste von Zuckerbrot klebten daran.
Hangard schüttete die Geschmeide der Konkubine auf den Tisch. »Hier. Aber die Sachen sind heiß.«
Helme blickte auf. »Woher stammen sie?«
Hangard ballte die Fäuste. Nicht einmal Helme wusste von seinem Raubzug? »Sie stammen aus der Hand des Richters und vom Leib seiner Geliebten.«
Helme nickte unbeeindruckt. »Na, da hast du ja Glück. Wegen dieser Flaggengeschichte wird sich im Moment keiner darum scheren, dass die Lustgrotte des Richters ein paar Klunker weniger hat. Ich geb dir zehn Dukaten für den ganzen Plunder.«
Hangard mochte wütend sein und vielleicht war er im Moment sogar unvernünftig, aber er konnte niemals so erzürnt sein, dass er Helme etwas überlassen hätte, ohne zu feilschen.
Hangard betrat das unscheinbare Eckhaus mit dreizehn Dukaten und zwei Silbertalern mehr in der Tasche. Er nickte der alten Witwe Jendbrunn zu, als er die Kammer betrat: »Phex zum Gruße. Ist er da?«
Sie schenkte ihm ein mütterliches Lächeln, denn sie kannte ihn von Kindesbeinen an. Ihr Mann war seinerzeit einer der größten Diebe der Stadt gewesen, bis sein eigener Sohn ihn verraten hatte. Sie wurden erwischt und beide aufgeknüpft – so strafte Phex Verrat. Es hatte der armen, alten Frau das Herz gebrochen.
»Er ist unten, Hangard, und er erwartet dich.«
Hangard ging an ihr vorbei hinter den gekachelten Ofen und hob die lockeren Dielen aus dem Boden. Eine wackelige Treppe führte nach unten ins Dunkel. Er stieg hinunter und zog die Bohlen über sich zurück an ihren Platz. Erst dann schlug er den Vorhang zur Seite, der den Abstieg von der Kammer dahinter trennte.
Sanftes Halbdunkel ließ die Ränder des Raumes verschwimmen und verlieh ihm den Eindruck von Größe, obwohl er nur wenige Schritt in jede Richtung maß. Ein glimmendes Kohlebecken an der Stirnseite war die einzige Lichtquelle.
Auf einem kleinen Tisch in der Mitte des Zimmers stand eine Fuchsstatuette aus Eibenholz auf einem grauen Tuch, daneben eine Schale aus dem gleichen Material und auf dem Boden davor eine Art Mosaik aus bemaltem Holz, gehalten von einem hölzernen Rahmen – es zeigte das volle Madamal. Statuette und Mosaik waren mit wenigen Handgriffen zu zerlegen. So fand jeder, den es nichts anging, im Gepäck des Mondschatten nur einige verdrehte Eibenäste und bunte Holzstückchen. Außerdem lagen ein paar dicke, mit Stroh gefüllte Kissen auf dem Boden. Mehr gab es hier nicht. Dieser Phextempel war an Pracht nicht zu vergleichen mit den anderen Tempeln der Stadt, allen voran natürlich dem prunksüchtigen Praiostempel. Selbst wenn Phex es auf derlei Schmuck angelegt hätte, wäre eine goldbeladene Ausstattung nicht möglich gewesen, denn der Phextempel blieb nie lange an einer Stelle. Dies war einer von vielen Orten, an denen er in Rommilys unterkam. Er war immer da, wo Phedrian sich befand, und wegen der zahlreichen Umzüge wäre mehr Einrichtung nur hinderlich gewesen.
Mondschatten Phedrian trat aus dem Schatten. Wer nicht wusste, dass er ein Priester des Phex war, hätte ihn für einen Schreiber oder Marketender gehalten. Seine blaue Schaube war mit einem Fuchsfellkragen verziert, seine Beine steckten in weiten Hosen, die in eng geschnürten, kniehohen Stiefeln mündeten. An seiner Seite hing ein Rapier mit einem Parierkorb, der mit Türkissplittern geschmückt war. Sein Gesicht war ernst und aufrichtig und erhielt durch den buschigen Schnurrbart sogar eine gewisse Strenge. Allein die Augen, aufmerksam und schelmisch, und die Lach-falten, die sie umgaben, verrieten seine wahre Natur. Sie hatten nunmehr bald fünfzig Jahre Zeit gehabt, sich in sein Gesicht zu graben.
»Ich habe auf dich gewartet«, sagte er jetzt und sanfter Spott schwang in seiner dunklen Stimme mit.
»Wer, Phedrian? Wer hat das getan?« Hangard hörte sich an, als suche er den Mörder seiner Eltern – aber das hier war schlimmer. Es war ein Dieb in der Stadt, der ein dreistes Phexstück vollbracht hatte. Eines, das seinem – Hangards – Ruf schadete. Man sprach über den Flaggenräuber und nicht über Hangard, den König der Diebe.
»Aber Hangard ...« Phedrian hob tadelnd den Finger. »Du kennst die Regeln!« Er wies auf die Eibenholz-Schale.
Hangard schürzte die Lippen. »Phedrian. Du warst zu mir wie ein Vater und jetzt willst du mir Geld abnehmen? Ich bin wie der Sohn, den du niemals hattest.«
Phedrian lachte. »Ich habe vier Söhne und alle erfreuen sich der besten Gesundheit genauso wie ihre jeweiligen Mütter. Und vor allem bin ich ein Mondschatten. Also: Hör auf zu jammern und zahle – und wage es nicht, Phex durch Knauserigkeit zu beleidigen!«
Hangard öffnete seine Geldbörse und ließ einen Dukaten in die Opferschale fallen. Als er den Beutel wieder zuzog, schnellte Phedrians Rapier in der Scheide vor. Es schlug von unten gegen den Geldbeutel. Ein sattes Klimpern erklang, dem Phedrian mit schief gelegtem Kopf lauschte.
Hangard seufzte und zog zwei weitere Dukaten heraus.
Nun nickte der Priester zufrieden und wies auf eines der Kissen. Hangard setzte sich, nur um gleich wieder aufzuspringen. Er konnte jetzt nicht stillsitzen.
»Nun sag schon!«, drängte er Phedrian.
Der ließ sich mit übertriebenem Ächzen auf ein Kissen sinken und lächelte. Endlich begann er: »Es ist ein neuer Dieb in der Stadt. Man nennt ihn die Graue Maske. Und er hat einen überaus beeindruckenden Einstand gegeben. Er scheint sehr entschlossen.«
Hangard ging auf und ab wie ein eingesperrtes Tier. Dann blieb er stehen. »Entschlossen wozu?«
Phedrian lächelte und schwieg.
»O nein!« Hangard dämmerte es. Dieser Neuling war auf die Königswürde aus.
»Aber er hat doch keine Aussichten, oder? Ich habe im vergangenen Jahr Unglaubliches geleistet. Er kann mich in der Gunst Phexens doch keinesfalls in zehn Tagen überholen, nicht wahr?«, fragte Hangard flehentlich.
»Mein Junge, Phex ist zwar auch der Gott der Händler, aber er ist kein Krämer«, erklärte Phedrian. »Es kommt ihm auf das Können, die Gewitztheit und den Mut seiner Kinder an – nicht auf die reine Anzahl der Phexdienste.«
Hangard sank auf das Kissen nieder. Noch zehn Nächte bis zum Tag des Phex. Zehn Nächte, in denen er den Raub der Flagge übertreffen musste.
Er hörte die Bodendielen knarren. Phedrian wandte den Kopf und sagte: »Wenn mich nicht alles täuscht, wird das die Graue Maske sein. Ich habe ihn eingeladen, um ihm zu seiner großen Tat zu gratulieren.«
Hangard grunzte unmutig. Auch das noch! Auge in Auge mit seinem neuen Rivalen. Na gut. Sollte die Vorstellung beginnen. Er sprang auf und lehnte sich scheinbar entspannt gegen die Wand, ein verächtliches Lächeln auf den Lippen.
Der Vorhang schwang zur Seite und ließ eine schlanke Gestalt ein, die einen langen schwarzen Mantel mit Kapuze um sich geschlungen hatte. Unter der Kapuze konnte Hangard eine Graue Maske erkennen. Er schnaubte leise. Dieser Aufzug schrie förmlich: Ich bin ein Dieb. Ein Wunder, dass der Fremde bis hierher gekommen war, ohne verhaftet zu werden.
»Willkommen im Haus des Phex«, sagte Phedrian und machte eine einladende Bewegung. »Wir freuen uns, einen so vollendeten Dieb begrüßen zu können.«
»Habt Dank!«, sagte der Besucher und zog die Kapuze herunter. Die Maske umschloss den ganzen Kopf und reichte bis unter den Umhang. Die Stimme des Diebes klang weibisch.
»Ich hoffte, hier dem Herren Phex für den Beistand der letzten Nacht danken zu können?« Die Maske wies auf das Mosaik am Boden und Phedrian nickte lächelnd. »Nur zu! Es war ein ganz außergewöhnliches Meisterstück und es ehrt diese Hallen, Euch hier zu haben.«
»Jetzt ist aber genug!«, zischte Hangard leise. Also wirklich. Phedrian tat gerade so, als habe dieser Bursche dem Boten des Lichts das Zepter gestohlen.
Jetzt erst wandte sich die Maske zu ihm um. »Und du musst Hangard sein, der König der Diebe dieser Stadt.«
Hangard richtete sich auf. Er war nicht sonderlich groß, aber diesen Hänfling überragte er um einen guten Kopf. »Für dich, Maske, immer noch Herr Hangard vom Wiesenfeld oder einfach: Euer Majestät.«
Phedrian kicherte leise. Als Hangard ihm einen wütenden Blick zuwarf, hob er entschuldigend die Hände, aber hörte nicht auf, leise, glucksende Geräusche von sich zu geben.
»Nun dann, Euer Majestät«, sagte nun die Maske und deutete eine Verbeugung an, »wenn Ihr die Freundlichkeit besitzen wollt, mich für einen Augenblick zu entschuldigen. Phex erwartet zu Recht seinen Anteil – immerhin hat er mich bei einem Meisterstück angeleitet.«
Hangard machte eine wegwerfende Handbewegung. »Glückstreffer!«
Der Leib der Maske versteifte sich. »Möglich«, presste er zwischen den Zähnen hervor, »aber da, wo ich herkomme, sagt der Volksmund: Das Glück ist mit den Kindern des Fuchses.«
Hangard lächelte. »Tatsächlich? Bei uns sagt man, das Glück ist mit den Dummen.«
Die Maske kam einen Schritt auf ihn zu und Hangard erkannte hellgrüne Augen hinter den Schlitzen. »Nun, ich mag dumm sein, aber wenigstens brauche ich nicht schlafende Frauen zu bestehlen.«
Was bildete sich dieser Bursche eigentlich ein? »Diese schlafende Frau hatte sechs Wachen im Haus«, stellte er klar. »Das sind sechs Wachen mehr, als sich auf dem Tor befunden haben, nicht wahr?«
Die Maske nickte. »Richtig, die Wachen standen darunter, aber ...« Hangards Gegenüber ließ die Hand hochzucken und etwas Goldenes flog durch die Luft auf Phedrian zu. Der Priester fing es und stieß einen Pfiff aus. Dann hielt er ein kleines, goldenes Abzeichen in Form eines Raben hoch, sodass Hangard es sehen konnte.
»... ich habe den Raben danach noch einen kleinen Besuch abgestattet«, vollendete die Maske ihren Satz und verschränkte die Arme vor der Brust.
Hangard war baff. »Man wird dich hängen!«
Die Maske lachte auf: »Dazu müssten sie mich erst einmal erwischen. Und wenn das geschieht, habe ich den Tod verdient.«
Sie wandte sich dann Phedrian zu. »Also, wo ist die Liste?«
»Welche Liste?«, fragte Phedrian.
»Die Liste derer, die König der Diebe werden wollen. Ich möchte mich eintragen«, erklärte die Maske.
Hangard traute seinen Ohren nicht.
»Es gibt keine Liste. Wer immer ein Phexenstück in Rommilys vollbringt, darf sich am Tag des Phex hier einfinden und der Fuchs wird entscheiden, wer die bemerkenswertesten Dinge fertig gebracht hat. Dieses Phexkind wird dann zum König oder zur Königin ausgerufen«, erläuterte Phedrian.
Hangard trat zwischen den Priester und seinen Konkurrenten. »Du kleiner Beutelschneider willst dich mit mir messen?«, fragte er drohend.
»Aber nein!«, widersprach die Maske. »Um sich mit jemandem zu messen, muss man auf der gleichen Stufe stehen.«
Hangard nickte zufrieden.
»Ich aber habe Euch schon in der letzten Nacht weit überflügelt«, fügte der maskierte Dieb hinzu.
Das war ja wohl die Höhe! »Womit?«, setzte Hangard nach. »Mit deiner kleinen Fassadenkletterei und einem Rabenabzeichen, das du beim Kleingeldsuchen auf der Straße gefunden hast?«
Jetzt war es an der Maske, empört nach Luft zu schnappen. »Nun, wenigstens habe ich es nicht nötig, Kinder zu bestehlen.«
»Ja, weil Kinder zu gewitzt für dich sind. Und außerdem befand sich dieses Kind im Inneren einer bewachten fahrenden Kutsche und war ein von Rabenmund. Immerhin scheint es, als sei mein Ruf bis dorthin gedrungen, wo eine unglückliche Nacht zu deiner Geburt geführt hat.« Hangard lächelte triumphierend.
»Aber sicher. Spottlieder kommen weit herum. Jeder bei uns kennt den Stutzerdieb von Rommilys, der schön sich wähnt, doch hässlich ist.« Das Letzte sang er auf eine bekannte Melodie.
Hangard gefror sein Lächeln. »Wenigstens bin ich nicht so hässlich, dass ich eine Maske tragen müsste.«
»O doch, das müsstet Ihr – Ihr wollt es nur nicht einsehen«, lachte die Maske.
»Ach ja, dann lass uns doch mal vergleichen«, fauchte Hangard und griff blitzschnell zu. Der andere versuchte sich wegzudrehen, aber Hangard hatte die Maske schon gepackt und riss sie nach oben.
Gelocktes, halblanges, braunes Haar kam zum Vorschein. Aber es umgab kein hageres, entstelltes Männergesicht. Die Graue Maske war eine Frau!
»Du bist kein Mann«, sagte Hangard verwundert.
Die Maske funkelte ihn an. »Ich bewundere Euren Scharfsinn.« Nun, unbehindert von der Maske, war ihre Stimme hell und wohlklingend.
»Warum die Maske, wenn du nicht entstellt bist?«, fragte er. Hangard fühlte sich halb benommen und konnte seinen Blick nicht vom Gesicht der Diebin wenden.
»Ich wollte Euch nicht in Versuchung führen. Man weiß ja, dass Ihr Euch auf jeden Rock werft, der bei drei nicht im Traviatempel Schutz gesucht hat.« Mit diesen Worten riss sie ihm die Maske aus der Hand. Um ihr rechtes Handgelenk trug sie einen silbernen Armreif mit einem Türkis darauf und einen dünnen Goldring um das linke.
Die boshafte Bemerkung klärte Hangards Kopf. »Ich gebe mich nur mit hübschen Frauen ab – tut mir Leid, deine Hoffnungen enttäuschen zu müssen«, gab er zurück, aber sein Herz war nicht im Einklang mit seinen Worten. Denn sie war hübsch. Sehr hübsch sogar.
Sie besaß ein feines, fast elfengleiches Gesicht mit lustigen Sommersprossen auf der Stupsnase, sanft gerundete Wangen und volle, jetzt trotzig geschürzte Lippen. Und ihre Augen, groß, grün und strahlend, fingen seinen Blick und hielten ihn fest. Die Frau konnte nicht älter als zwanzig sein.
Ein Moment der Stille trat ein. Die Maske kam einen Schritt näher an Hangard heran und sein Herz klopfte schneller. Sie hauchte: »Bevor ich mich Euch hingebe ...« – ihr Tritt traf von oben Hangards Fuß – »... treibe ich es lieber mit einem Troll.«
Hangard jaulte auf und hielt sich auf einem Bein hüpfend den Zeh. »Das lässt sich einrichten, du Mist ...«
Phedrian unterbrach die beiden mit einem energischen »Bitte!«
Sie blickten ihn an.
»Bitte! Nicht in meinem Tempel. Wenn ihr euch unbedingt messen wollt, dann in einem Wettstreit nach Phexens Art.«
Was hatte der Alte jetzt wieder im Sinn, fragte sich Hangard. Seit der Priester ihn vor rund fünfzehn Jahren von der Straße weg als »Lehrling« angenommen hatte, wartete er immer wieder mit Überraschungen auf – und nicht alle waren angenehm.
Phedrian wies auf zwei Kissen und die Diebe kamen dem stummen Befehl nach.
»Es ist offensichtlich, dass ihr euch beide für Phexens Liebling haltet. Vermutlich seid ihr es sogar. Aber wie bei dem ewigen Streit, welches der Kinder dem Vater am liebsten ist, gibt es auch hier eine einfache Antwort: Derjenige, der seinem Vater am meisten Freude macht und ihn stolz sein lässt, wird am höchsten geschätzt.« Er nahm die Münzen aus der Opferschale und ließ sie beiläufig in seine Tasche gleiten.
»Du, Hangard, hast das Jahr über immer wieder brillante Schurkereien ausgeheckt und Phex bei vielen Gelegenheiten erfreut – aber dir fehlte die Konkurrenz, der Ansporn, um zu den wirklichen Höhen zu gelangen. Du bist – tut mir Leid – faul geworden.«
Phedrian hob die Hand, als Hangard etwas einwerfen wollte. Faul, er? Und was war mit der Richterhure? Aber er schwieg, denn er wollte Phedrian nicht verärgern.
»Und sie?«, fragte er stattdessen und wies auf die Frau.
»Ginaya. Ginaya Mandelbroter«, sagte sie.
»Was für ein Name!«, lachte Hangard leise, verstummte aber gleich wieder, als ihn ein böser Blick von Phedrian traf.
»Du, Ginaya, hast einen beeindruckenden Raub vollbracht, aber es ist dein erster in der Stadt. Es ist nicht abzusehen, was Phex höher schätzen wird.
Darum, und damit nachher keiner jammern kann, sage ich: Wir machen ihm die Entscheidung etwas einfacher. Jeder von euch wird in der Zeit bis zum Tag des Phex einen einzelnen Phexdienst vollbringen. Es ist nicht wichtig, wie viel Gold ihr dabei erbeutet – es zählt nur, wer das dreistere Diebeskunststück vollbringt.« Phedrian lächelte.
»Und wer entscheidet, was die größere Sache war?«, fragte Hangard.