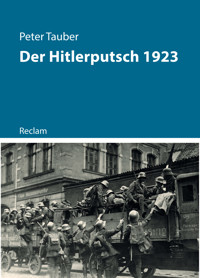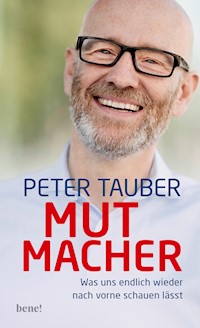14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bene! eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Der CDU-Politiker Peter Tauber hat ein Buch für alle Männer geschrieben, die sich in der Lebensmitte Fragen nach dem »Warum?«, »Wozu?« und »Wohin?« stellen. Und er bietet nebenbei einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Spitzenpolitik. Peter Tauber hat eine steile politische Karriere hinter sich. Als bis dato jüngster Generalsekretär der CDU führte er die Partei an der Seite von Angela Merkel während der Flüchtlingskrise durch eine der schwierigeren Phasen ihrer Geschichte. Als ihn eine schwere Darmerkrankung aus der Bahn wirft und sein Leben nur durch eine Notoperation gerettet werden kann, muss er sich plötzlich Fragen stellen, die er lange ignoriert hat: Was treibt mich eigentlich an, immer bis an meine Grenzen und auch darüber hinaus zu gehen? Was wäre, wenn heute mein letzter Tag wäre – was bleibt? Selbstkritisch blickt der gläubige Christ Peter Tauber in diesem sehr persönlichen Buch auf sein bisheriges Leben zurück. Wann ist ein Mann ein Mann? Was macht ein Mann, wenn er merkt, dass er nicht mehr kann und nicht mehr weiter weiß? Wofür lohnt es sich eigentlich, sich derart aufzureiben? Und was passiert mit dem eigenen Ego, wenn man plötzlich feststellt, dass man gar nicht so tough ist, wie man immer dachte, und kürzertreten muss?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Ähnliche
Peter Tauber
Du musst kein Held sein
Spitzenpolitiker, Marathonläufer, aber nicht unverwundbar
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Der CDU-Politiker Peter Tauber hat ein Buch für alle Männer geschrieben, die sich in der Lebensmitte Fragen nach dem »Warum?«, »Wozu?« und »Wohin?« stellen. Und er bietet nebenbei einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Spitzenpolitik.
Peter Tauber hat eine steile politische Karriere hinter sich. Als bis dato jüngster Generalsekretär der CDU führte er die Partei an der Seite von Angela Merkel während der Flüchtlingskrise durch eine der schwierigeren Phasen ihrer Geschichte.
Als ihn eine schwere Darmerkrankung aus der Bahn wirft und sein Leben nur durch eine Notoperation gerettet werden kann, muss er sich plötzlich Fragen stellen, die er lange ignoriert hat: Was treibt mich eigentlich an, immer bis an meine Grenzen und auch darüber hinaus zu gehen? Was wäre, wenn heute mein letzter Tag wäre – was bleibt? Selbstkritisch blickt der gläubige Christ Peter Tauber in diesem sehr persönlichen Buch auf sein bisheriges Leben zurück.
Wann ist ein Mann ein Mann? Was macht ein Mann, wenn er merkt, dass er nicht mehr kann und nicht mehr weiter weiß? Wofür lohnt es sich eigentlich, sich derart aufzureiben? Und was passiert mit dem eigenen Ego, wenn man plötzlich feststellt, dass man gar nicht so tough ist, wie man immer dachte, und kürzertreten muss?
Inhaltsübersicht
Soll man aufschreiben, was [...]
Es ist bereits deutlich [...]
I Weichenstellungen
II In Turbulenzen
III »Und dann liegt man da …«
IV »Beschäftige dich mal mit dir selbst!«
V Neustart
Soll man aufschreiben, was man erlebt hat,
wie man sich gefühlt hat, wenn man krank war?
Darüber habe ich viel nachgedacht.
Ich habe mich entschieden, es zu tun.
Was mich nicht loslässt, was mich beschäftigt,
was mir wehgetan und was mich
am Ende stärker gemacht hat.
Denn ich habe erkannt, dass sich durch die Krankheit etwas verändert hat.
Und ich habe gemerkt, dass niemand zur Tagesordnung übergehen sollte,
wenn er nach schwerer Krankheit wieder gesund ist.
Sonst verpasst man die Chance, sich über sich selbst bewusst zu werden.
Vielleicht hilft mein Buch anderen,
die in eine ähnliche Krise geraten sind.
Das wünsche ich mir!
Es ist bereits deutlich nach Mitternacht. Eigentlich sollte ich längst schlafen. In weniger als vier Stunden wird der Wecker klingeln, um sechs Uhr steht ein wichtiges Interview mit dem Morgenmagazin an. Anschließend die Koalitionsverhandlungen mit der FDP und den Grünen, die wir in der Parteizentrale seit Tagen vorbereiten. Doch an Schlaf ist nicht zu denken. Ich liege im Bett und habe starke Schmerzen. Es fühlt sich an, als ob es mich von innen zerreißt.
»Morgen früh, direkt nach dem Interview gehst du zum Arzt«, sage ich zu mir selbst. Es wird schon nichts Schlimmes sein … Dieser Gedanke beruhigt mich kurz.
Ich lobe mich selbst, dass ich so vernünftig bin und die Schmerzen nicht einfach ignoriere. Aber das geht auch gar nicht anders, denn sie sind heftig, und sie werden nicht weniger. Irgendwann halte ich es nicht mehr aus. Schüttelfrost und Hitzewallungen wechseln sich ab. Ohne Decke, mit Decke – egal, beides ist unerträglich. Ich bin nass geschwitzt. So schlecht habe ich mich noch nie gefühlt. Nachts um halb drei entschließe ich mich, den Notarzt zu rufen.
Es fällt schwer, mir einzugestehen, dass ich jetzt Hilfe brauche. Bin ich plötzlich ein Schwächling? Ich habe Bauchschmerzen. Das ist doch kein Grund, den Notarzt zu rufen – oder? Im Wohnungsflur stehend, halte ich mein Mobiltelefon in der Hand und zögere doch wieder. Soll ich wirklich den Notruf wählen? Ich überwinde mich regelrecht.
Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine unbekannte Stimme und lotst mich durch die entscheidenden Fragen. Meine Antworten sind kurz und so weit wie möglich präzise. Ich bin nicht panisch. Aber es ist mir total unangenehm, jetzt zu dieser Zeit um Hilfe zu bitten.
Nachdem ich aufgelegt habe, obsiegt aber die Erleichterung: Jetzt kann nichts mehr passieren. Es wird jemand kommen.
Jede Menge Gedanken schießen mir durch den Kopf. Ich bin so froh, dass die Schmerzen kurz weg sind. Und ich erschrecke für einen Moment. War das alles nur Einbildung? Vielleicht ist ja gar nichts? Bin ich ein Simulant? Doch dann kommen die Schmerzen auch schon mit aller Macht zurück. Ich muss mich hinsetzen. Kalter Schweiß steht auf meiner Stirn. Ich habe über 40 Grad Fieber, sitze auf der Bettkante und warte.
Aber es geht ja gar nicht nur um mich! Ich habe eine Aufgabe, die muss erfüllt werden! Da ist das Fernsehinterview am nächsten Morgen. Irgendwie schaffe ich es, unseren Pressesprecher Jochen Blind kurz per SMS zu informieren, was Sache ist. Das Fernsehinterview wird ausfallen. Auch das ist mir unangenehm. Nicht nur, weil das Interview nicht stattfinden kann und damit eine Einordnung zum Stand der Koalitionsverhandlungen »fehlt«, sondern auch, weil ich nicht will, dass sich mein Mitarbeiter Sorgen macht. Und die macht er sich bestimmt. Dazu arbeiten wir zu eng und zu vertrauensvoll zusammen.
Alles, was sonst für mich zählt, kann ich nun vergessen: Aufgaben vollständig zu erfüllen, egal wie schwierig. Immer da sein, keine Schwäche zeigen und funktionieren. Das geht jetzt nicht mehr! Jetzt warte ich nur noch auf den Rettungswagen.
Die Zeit vom Anruf bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter dauert gefühlt ewig. Bevor sie kommen, mache ich mir tatsächlich ernsthaft Sorgen, dass ich nicht Staub gesaugt habe. Den Versuch, damit die Zeit zu überbrücken, bis es klingelt, unterlasse ich aber, auch aufgrund der starken Schmerzen. Selbst wenn ich mich nicht bewege, tut es weh.
Endlich das erlösende Klingeln an der Haustür. Das kurze Gespräch mit einem der Rettungssanitäter, der Weg zum Rettungswagen, das grelle Licht, die Fahrt durch die Nacht. Dann die Ankunft in der Notaufnahme, eine erste Untersuchung und beruhigende Worte. Ansonsten erinnere ich mich nur noch an Bruchstücke aus dieser Nacht.
Den Notarzt, der mich in Empfang nimmt, werde ich später erst nach mehreren Begegnungen wiedererkennen. Vielleicht ist meine lückenhafte Wahrnehmung durch das hohe Fieber in eine Art Nebel gehüllt? Ich werde jedenfalls lange brauchen, um mich daran zu erinnern, wie jene Nacht wirklich abgelaufen ist. Erst nach und nach wird mir bewusst werden, was eigentlich passiert ist. Bei vielen Bildern spielt mir mein Kopf einen Streich. Es muss anders gewesen sein als in meiner Erinnerung. Doch auch wenn sich das Puzzle durch Gespräche und Berichte der Ärzte irgendwann zusammensetzen wird, ist vieles bis heute für mich unwirklich.
In der Notaufnahme bekomme ich nach der Untersuchung Medikamente, auch etwas gegen die starken Schmerzen. Die Medizin tut ihre Wirkung. Und ich schlafe irgendwann.
Als ich aufwache, steht ein Arzt neben meinem Bett, schaut mich ernst an und stellt sich vor. Dann sagt er: »Es war gut, dass Sie den Notruf gewählt haben, Herr Tauber!«
I Weichenstellungen
Je mehr ich über meine Krankheit und die dramatischen Stunden damals im November nachdenke, desto klarer wird mir: All dies hat sehr viel mit meinem Selbstbild, einem bestimmten Rollenbild, zu tun. Dieser inneren Stimme, die mir all die Jahre immer wieder gesagt hat: »Los, halte durch! Behaupte dich, zeige möglichst keine Schwäche! Gib nicht auf! Niemals! Nur dann erreichst du das Ziel.« Früher hieß es bei den Soldaten: »Klagt nicht! Kämpft!« Ist das ein Rollenbild, das ich mir selbst zurechtgelegt habe? Das von der Gesellschaft vorgegeben wurde? Oder eines, das mir anerzogen worden ist?
Seit vielen Jahren laufe ich mehrmals die Woche, trainiere für Langstreckenläufe und den nächsten Marathon. Durchhalten, Schwächephasen überwinden, das ist bei einem Marathonlauf ebenso wichtig wie im Job. Wer stehen bleibt und ausruht, wird von den anderen überholt. Das Laufen ist ein schöner, aber auch tückischer Sport. Sosehr er mir ermöglicht, bei mir selbst zu sein, nachzudenken oder auch mit vertrauten Menschen während des Laufens zu sprechen, eine große Nähe zu erfahren, so sehr ist dieser Sport auch das perfekte Abbild unserer Leistungsgesellschaft. Einer Gesellschaft, die immer mehr fordert. Die erwartet, dass man hart gegenüber sich selbst ist und Schwächen überspielt, sie irgendwie überwindet. Ist das der Grund, warum so viele Entscheidungsträger Ausdauerläufer sind? Weil sie auf diese Weise spielerisch nachvollziehen können, was die Menschen von ihnen erwarten? Marathon läuft man schließlich gegen sich selbst und nicht gegen andere.
Man stelle sich vor, wie Gesellschaft und Medien reagieren, wenn ein Unternehmer Tränen in den Augen hat, während er verkünden muss, dass er mehrere Hundert Mitarbeiter entlassen wird. Was denken Angestellte, wenn der Chef bei einer Präsentation auf einmal einen roten Kopf bekommt, den Faden verliert und ins Stottern gerät? Und wie reagieren politische Mitbewerber, wenn ein Minister erklärt, dass er einen Fehler gemacht hat und nun die Unterstützung aller Parteien braucht, damit die Sache wieder in Ordnung kommt? Sie kennen die Antwort. Es gibt eine Reaktion, die wünschenswert wäre, und eine, die absehbar ist.
Ich weiß sehr wohl, wann ich in meiner politischen Karriere so reagiert habe, wie es absehbar war, und nicht, wie es vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Auch weil ich keine Ahnung hatte, was sonst passiert. Und auch das fügt sich wieder ins Rollenbild: nichts Unvorhersehbares tun. Keinesfalls die Kontrolle verlieren, lieber Spannungen aushalten. Als Mann keine Schwäche zeigen und auch sonst keine Emotionen. Das wird verlangt – und man macht sich dieses Bild zu eigen.
Immer dann, wenn es für mich schwierig wurde, wenn mir der Wind heftig entgegenblies und es manchmal sogar absolut unmöglich schien, die anstehende Aufgabe unter den gegebenen Voraussetzungen überhaupt zu bewältigen – dann war für mich der Reiz umso größer, es irgendwie doch noch zu schaffen. Ich habe mir gesagt: »Du musst durchhalten, egal wie.« Nächtelang habe ich gearbeitet, mich total abgehetzt, alles gegeben.
Damit ich nicht falsch verstanden werde: Das war ein selbst gewähltes Schicksal. Und es war erfüllend. Ich wusste schon vorher, dass die Politik kein Job von neun bis fünf Uhr ist, und habe den zeitlichen Einsatz nie hinterfragt. Meine Aufgaben habe ich gerne im Sinne der guten Sache erfüllt. Für mein Land und für meine Partei. Mehr noch für die Menschen in meiner Partei und die, die mich gewählt haben. Und ich war damit auch erfolgreich: Schon früh die Wahl in den Bundestag. Dann das Amt des Generalsekretärs. Ich war der jüngste, den die CDU bis dato hatte. Meine Arbeitstage hatten immer mehr als zwölf Stunden, dazu kam eine wachsende öffentliche Aufmerksamkeit. Das war zusätzlicher Druck, oft heftiger Stress. Irgendwann erschien mir das alles als richtig und normal, so, wie es war. Alle, die in der Politik Verantwortung tragen, kennen eine solche Situation nur zu gut. Die Anforderungen von außen sind groß. Es gilt, eine Rolle auszufüllen, Erwartungen zu entsprechen und zu genügen. Und irgendwann vergisst man zu fragen, was eigentlich die eigenen Ansprüche sind.
Ich weiß, dass mein Pensum keine Ausnahme ist, eher der Normalfall. Gerade deshalb verdrängt man die Frage, ob man an eine Grenze gekommen ist. Denn die anderen machen ja auch weiter, zeigen keine Schwäche. Genauso wenig wie ich. Und siehe da: Meist klappt es ja dann irgendwie doch!
Ob das mit dem Adrenalin zu tun hat, das bei Stress in unserem Körper ausgeschüttet wird? Bestimmt. Aber es ist auch eine Willensfrage. Es gibt Menschen, die brauchen den Druck, die Herausforderung. Ich gehöre wohl auch dazu. Und von vielen Männern, die ich kenne, weiß ich, dass es ihnen ähnlich geht. Durchhalten ist wichtig. Wenn es dann trotz allen Einsatzes schiefgeht, dann sagt man sich: »Ich habe es ausgehalten. Ich stecke das weg, bin hart im Nehmen. Weiter geht’s.« Aber ist es nicht verrückt, so zu denken? So als könnte man immer wieder seine Leistungsgrenze überschreiten, ohne dass es Folgen hätte? Müssen wir als Mann immer als Gewinner vom Platz gehen?
Und wenn von Gewinnen gar nicht mehr die Rede ist? Ist es wirklich so schlimm, stehen zu bleiben und auszuruhen, wenn man schwach ist und nicht mehr weiterkann? Warum ist Aufgeben für viele Männer keine Option? Obwohl wir ständig von Fehlerkultur reden, ist das Scheitern immer noch verpönt.
Wir sind und bleiben in unserer Existenz verletzlich. Das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Eigentlich wissen wir das schon früh. Die ersten Schürfwunden und Schrammen ziehen wir uns als Kind beim Ballspielen oder Radfahrenüben zu. Die Narben zeigen wir als Jungen oftmals stolz. Sie stehen für ausgehaltene Schmerzen und ein bisschen für Abenteuer. Auch später nehmen wir Risiken billigend in Kauf. Beim Skifahren holen wir uns Prellungen, wenn’s schlimm kommt, brechen wir uns sogar einen Arm. Aber dass es Situationen geben kann, in denen es plötzlich ums Ganze geht, um das Leben an sich, dass die eigene Existenz plötzlich am seidenen Faden hängt, darüber denken wir viel zu wenig nach. Diese Erfahrung zu machen war neu für mich. Und sie wirkt nach.
Um das Ende zu verstehen, muss man den Anfang kennen. Darum noch einmal zurück auf Start. Wie kommt man dazu, in der ersten Reihe der Politik mitzumischen? Und wie kommt man dazu, sich in einer solchen Rolle für derart unersetzlich zu halten, dass man alle Grenzen missachtet, alle Signale überfährt und den Bogen derart überspannt, dass es am Ende zum Kollaps kommt? Vielleicht sogar kommen muss?
Die vielleicht wichtigste Entscheidung meines politischen Lebens fiel im Frühjahr 2008. Damals kam in meinem Kreisverband die Frage auf: Wer wird unser Kandidat für den Bundestag? Die Altvorderen in der Partei, aber auch Freunde, die meine Leidenschaft für die Politik und die Partei kannten, kamen auf mich zu: »Peter, mach du das doch!«
Damit nahm mein Leben eine völlig neue Wendung.
Ich war zwar schon seit vielen Jahren in der Jungen Union engagiert und hatte auch schon seit einiger Zeit einen Sitz im Stadtparlament inne. Kurz nach dem Studium hatte ich als Bürgermeister für meine Heimatstadt kandidiert. In der SPD-Hochburg Wächtersbach war das allerdings ein Ansinnen ohne Aussicht auf Erfolg gewesen. Aber ich als Mitglied im Bundestag? Das war ein neuer Gedanke – und natürlich verlockend. Davon hätte ich kaum zu träumen gewagt. Natürlich haben mir der Zuspruch und das Vertrauen richtig gutgetan. Wer fühlt sich nicht geehrt, wenn man für eine solche Aufgabe gehandelt wird und einem andere so etwas zutrauen?
In den nächsten Tagen teilte ich den Gedanken, für den Bundestag zu kandidieren, zunächst mit meinen Eltern und den Geschwistern, dann mit einigen engen Freunden und meinen politischen Weggefährten. Ich wollte wissen, was die Menschen darüber denken, die mich am besten kennen. Da gab es keine Spur von Zögern oder Zweifeln. Im Gegenteil – die Zustimmung war ungeteilt. Meine Freunde haben mir gesagt: »Ja klar. Du machst das!« Meine Eltern waren stolz, wie Eltern eben nun mal so sind.
Die Erfahrung, von jeder Menge Menschen in einem anstrengenden Wahlkampf unterstützt und getragen zu werden, war einmalig. Ich fand es total berührend, dass andere sich mit großer Begeisterung für mich einsetzten. Wie oft haben mir Leute im Wahlkampf am Infostand gesagt: »Ihr Team ist derart motiviert und freundlich. Allein deshalb muss man Sie wählen.« Ohne mein Team hätte ich das alles nicht geschafft. So viel steht fest.
Den Wahlkampf haben wir in unserer Freizeit geführt. Einige haben sich nach Feierabend nur kurz umgezogen und sind dann Plakate aufhängen gefahren. Andere haben Veranstaltungen organisiert, Pressemeldungen geschrieben und Unterstützer geworben. Viele im Team waren deutlich jünger als ich und haben noch studiert. In den Semesterferien ging es nicht in den Urlaub, sondern sie haben mir geholfen. Ich selbst habe die ersten Monate noch voll gearbeitet und dann, als es in die heiße Phase des Wahlkampfes ging, meinen gesamten Jahresurlaub auf einmal genommen. Auch die alten, erfahrenen Parteifreunde haben natürlich mit angepackt. Es war das zu spüren, was ich an meiner Partei so mag: Wenn es drauf ankommt, dann halten wir zusammen. Alle, wirklich alle kämpfen gemeinsam. Als Team haben wir uns einmal pro Woche abends getroffen und alles, was gerade anstand, besprochen: »Wer fährt in die Druckerei?«, »Wer mietet den Saal?«, »Wer hängt die Plakate auf?«
Ich war damals 34 Jahre alt. In Gelnhausen habe ich Abitur gemacht, hier lebten die meisten Freunde und die Familie. Und plötzlich hingen überall Plakate mit meinem Konterfei. Das war seltsam und mir irgendwie auch nicht ganz geheuer. Ich war nun jemand, auf den andere schauten. Mein Verhalten, mein Tun, es wurde bewertet und kommentiert. Auch daran muss man sich erst einmal gewöhnen.
Die letzten sechs Wochen bis zum Wahltag habe ich mich um nichts anderes mehr gekümmert als um den Wahlkampf. Und der harte Kern meines Teams ebenfalls, zumindest soweit es Studium und Arbeit zuließen. Manchmal habe ich mich dabei erwischt, dass ich dachte: »Wenn jetzt um 23 Uhr noch jemand an seinem Schreibtisch sitzt und für dich arbeitet, dann kannst du doch nicht fernsehen oder dich ins Bett legen.« Pausen habe ich mir deshalb kaum gegönnt. Meist nur fünf Stunden Schlaf, das Allernötigste an Zeit für mich selbst – das war’s. Dann wieder raus, an den Bahnhöfen Flugblätter und Brötchen verteilen, abends noch auf Veranstaltungen auftreten. Jeden Tag ein anderer Ort, ein anderes Dorf. Zwischendurch Besuche von Unternehmen, Podiumsdiskussionen mit den weiteren Kandidaten oder ein Interview mit der örtlichen Zeitung.
Es war positiver Stress, so wie ich diese Zeit überhaupt als inspirierend, toll und aufregend in Erinnerung habe. Atemberaubend trifft es – im wahrsten Sinne des Wortes – ganz gut. Es ist klar, dass man sich in einer solchen Situation sagt: »Komm, ein bisschen Luft hast du noch, mach lieber noch etwas fertig, bevor du schlafen gehst! Es gibt so viel zu tun.« Und man lernt einen Zustand kennen, der in der Politik systemimmanent ist: Man ist nie fertig. Nie. Es kommen immer neue Aufgaben dazu. Der Schreibtisch ist niemals leer.
Rückblickend betrachtet, begann sich genau dort eine Haltung einzuschleifen, die sich später verselbstständigt hat: alles geben, sich selbst wenig gönnen; Sprüche klopfen wie »Pausen und Urlaub werden überbewertet«.
Ein so großer Einsatz zieht unter Umständen auch Erfolg nach sich. Euphorie und das Gefühl »Ich bringe mehr zustande, als mancher glaubt!« stellen sich ein. Vielleicht zuweilen auch der Gedanke: »Mir kann keiner was, wenn ich nur will!« Es ist eine ungute Verabsolutierung des Willens, mit dem man glaubt, die Wirklichkeit zwingen zu können. Aus der Not wird eine Tugend. Manchmal ist es ein Uhr nachts, wenn ich vom Schreibtisch aufstehe, um kurz nach fünf bin ich schon wieder auf den Beinen – und es macht mir nichts aus! Wenn einer besonders hart arbeitet, dann ich. Denn ich muss und will schließlich Vorbild sein!
So wird der Grundstein dafür gelegt, sich selbst stets mit Härte zu begegnen. Eine Haltung, die man anschließend nicht mehr hinterfragt und die ja auch zu vermeintlichem Erfolg führt. All das, was auf der Strecke bleibt, das blendet man aus. Und es bleibt nicht bei der Härte gegen sich selbst – zumindest nicht in meinem Fall. Wer mit sich selbst nicht fürsorglich umgeht, der kann das auch mit anderen nicht. Alles leidet: Freundschaften, Beziehungen, letztlich auch die eigene Seele und die Gesundheit.
Damals habe ich solche Gedanken nicht gehabt, sondern nur gedacht: Hier passiert etwas ganz Großes! Nicht weil mein Gesicht an nahezu jeder zweiten Straßenlaterne hing, sondern weil ich die Chance bekam, etwas Außergewöhnliches zu tun. Ich liebe meine Heimat und mein Land. Im Parlament mitzuarbeiten, das ist bis heute für mich etwas sehr Besonderes.
In einem Moment, in dem ich alleine bin, denke ich: Was passiert hier eigentlich gerade? Und was wird sein, wenn wir wirklich gewinnen?
Nach vielen Wochen intensiven Wahlkampfes, in denen ich tagelang von Tür zu Tür unterwegs war, stundenlang auf Marktplätzen oder vor Supermärkten stand, mit Bürgern gesprochen und viele Tausend Hände geschüttelt habe, ist es endlich so weit. Der Abend der Entscheidung ist da. Bundestagswahl!
Ich erinnere mich noch genau an die Stunden, in denen ich zu Hause sitze und auf das Ergebnis warte. Der Fernseher läuft, auf dem Handy verfolge ich die Kurznachrichten von Freunden und die aktuellen Hochrechnungen. Die CDU hat bundesweit die Wahl gewonnen, das steht ziemlich schnell fest. Aber es gibt zunächst keine wirklich verlässlichen Zahlen, wie es hier bei mir im Wahlkreis aussieht. Stattdessen sind es einzelne Anrufe aus den unterschiedlichen Wahlbezirken, die das Ergebnis vor Ort verkünden. Ganz langsam fügt sich ein Bild zusammen. Nach der Schließung der Wahllokale dauert es eine gute Stunde, bis die ersten Bezirke die Stimmen ausgezählt haben, und dann tröpfeln die Ergebnisse nach und nach herein. Flörsbachtal ist ausgezählt und geht an den SPD-Kandidaten, in Jossgrund habe ich die Nase vorne. Die Spannung steigt. Wieder ein Anruf, diesmal aus Bad Orb: »Du hast hier die Wahl eindeutig gewonnen!« Dann eine Nachricht aus dem nächsten Ort: »Die SPD liegt vorne.« So geht es weiter. Ich sitze bei mir zu Hause, schreibe mit, verfolge den Trend. Es ist ein Rechenexempel: In Bad Orb wohnen mehr als doppelt so viele Leute wie in Flörsbachtal. Wenn ich in diesem kleinen Ort verloren habe, ist das nicht so schlimm. Mehr und mehr wird klar: Das läuft für mich richtig gut! Und im Laufe des Abends ergibt sich ein immer klareres Bild. Nach eineinhalb Stunden fühle ich: »Es ist geschafft!« Wahnsinn!
Natürlich ist es kein Zufall, dass ich die Wahl von zu Hause aus verfolge. Parteifreunde haben mir dazu geraten.
Ob bei den Regionalwahlen, der Wahl für den Hessischen Landtag oder den Bundestagswahlen – es ist das gleiche Bild: Die Hochrechnungen werden immer verlässlicher, dann dauert es eine Weile, bis sich die ersten Politiker vor Mikrofone oder laufende Kameras stellen. Es geht nicht nur darum, Zeit zum Nachdenken zu haben, was es Kluges zu sagen gibt. Man will sich einfach ungern in dem Moment ins Gesicht schauen lassen, wenn das Ergebnis auf dem Tisch liegt. Denn die hängenden Mundwinkel und der Ausdruck tiefer Enttäuschung – das sind nicht die Bilder, die die Medien hunderttausendfach teilen sollen. Wenn man monatelang um etwas gekämpft hat und dann verliert – ob ganz knapp oder himmelhoch –, ist es einfach enttäuschend. Diese Enttäuschung muss man im ersten Moment hinunterschlucken – am besten nicht direkt vor einer Kamera. Und auch wenn man haushoch gewinnt, gilt es, sich innerlich zu zügeln. Ein selbstgefälliges Grinsen oder lautes Triumphgeheul können ein riesiger Fehler sein, denn das nimmt einem mancher Beobachter zu Recht übel. Viel besser ist es, sich im Moment der Wahrheit erst einmal zu sortieren und zu sammeln.
Da ist wieder der Wunsch nach Kontrolle und Deutungshoheit über ein Bild, das man nach außen zeigen will. Es ist selten ein Bild, das einen echten Einblick erlaubt.
Das endgültige Wahlergebnis steht übrigens meistens erst fest, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Dann wird in den Parteizentralen noch gerechnet und aufgelistet, wer welchen Wahlkreis gewonnen hat. Und irgendjemand wird im Konrad-Adenauer-Haus in dieser Nacht meinen Namen in das Feld hinter unserem Wahlkreis eingetragen haben.
Der formelle Ablauf eines solchen Wahlabends wird natürlich schon lange vorher geplant. Hier in Gelnhausen geht man, wenn die Hochrechnungen stabil sind und das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit feststeht, ins Landratsamt. Dort gibt es eine große Leinwand – und dort kommen nach und nach viele Menschen zusammen. Parteimitglieder und interessierte Bürgerinnen und Bürger warten bei einem Glas Wasser oder einem Bier auf das Ergebnis und diskutieren die Ergebnisse.
Auch ich mache mich nun von zu Hause aus auf den Weg ins Landratsamt. Meine engsten Freunde und Unterstützer nehmen mich gleich am Eingang in Empfang. Man applaudiert, viele klopfen mir auf die Schulter, ich werde umarmt, gedrückt und in den Saal geschoben. Jetzt ist es wirklich amtlich: Wir haben gewonnen! Und das mit einem respektablen Vorsprung.
Drei Sätze ins Mikrofon für die örtliche Presse, Glückwünsche der anderen Parteien entgegennehmen, Danke sagen für einen meist fairen Wahlkampf. Und dann nichts wie weg, ab zu meinen Freunden und Wahlkampfhelfern. Die warten schon. Natürlich haben wir eine ordentliche Wahlparty organisiert. Es wird ein langer Abend und eine kurze Nacht. Ein Freudenfest!
Für den Fall der Fälle haben wir schon vor längerer Zeit mein Lieblingscafé in Gelnhausen reserviert. Wahlkampfhelfer, Freunde und meine Familie sind hier, um miteinander das wunderbare Ergebnis zu feiern. Alle sind eingeladen, die Getränkerechnung am Ende deutlich vierstellig, die Bar leer getrunken. Egal, das ist es wert.
Als Hingucker im Wahlkampf hat uns eine Piaggo Ape gedient, ein kleines Gefährt auf drei Rädern, das wir mit allerlei Aufklebern und Plakaten dekoriert haben. Monatelang stand die Kiste kaum still. Und auch jetzt ist sie wieder im Einsatz. Momentan sitzt Christoph Engel, ein Zwei-Meter-Hüne aus meinem Wahlkampfteam, am Steuer und grinst von einem Ohr zum anderen. Eigentlich ist der Wagen viel zu klein für ihn. Aber er hat es trotzdem geschafft, sich hineinzuquetschen. Den Kopf hält er aus dem Seitenfenster, um Luft zu bekommen. Und los geht’s!
Runde um Runde kurvt er mit dem Ding um den Block und hupt jedes Mal wie ein Verrückter, wenn er an uns vorbeikommt. Und jedes Mal antwortet ihm ein ohrenbetäubender Jubel. Alle singen: »So sehen Sieger aus …« Ich muss grinsen und genieße den Trubel.
Als ich am frühen Morgen endlich ins Bett komme, kann ich es noch immer kaum fassen. »Ich bin jetzt Mitglied des Bundestags!« Und für den Moment einfach nur glücklich.
Dass ich einmal eine politische Laufbahn einschlagen würde, war nicht geplant. Mein Vater hatte zunächst ganz andere Ideen, wie meine berufliche Zukunft aussehen könnte, auch wenn ich immer alle Freiheiten hatte, selbst zu entscheiden. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn ich in seine Fußstapfen getreten und ebenfalls Jurist geworden wäre. Entsprechend verhalten war seine Reaktion, als ich nach dem Abitur ankündigte, Geschichte studieren zu wollen: »Mach doch lieber was Richtiges.« So oder ähnlich klingen mir seine Worte noch heute im Ohr. Am Ende hat sich meine Mutter auf meine Seite geschlagen. »Der Junge soll studieren, was ihm Spaß macht und was ihn interessiert.« So ihre Ansage. Vielleicht half mir, dass sie zu der Generation von Frauen gehört, die sich jeden Schritt in die Eigenständigkeit mühsam erkämpfen mussten. Sie selbst durfte nicht studieren, was sie wollte.
Ich habe mich für das Studienfach entschieden, ohne zu fragen: Was kann ich später einmal damit anfangen? Geschichte war einfach das Fach, das mich am meisten faszinierte. Die Leidenschaft dafür hatte meine Mutter schon früh geweckt – bewusst oder unbewusst. Mit viel Freude haben meine Geschwister und ich schon als Kinder ihre Sammlung französischer Asterix-Comics zerlesen. Meine Mutter war es auch, die uns jedes Jahr Sachbücher zu den Römern, Wikingern oder dem Leben im Mittelalter unter den Weihnachtsbaum legte. Ich habe sie mit Begeisterung verschlungen. Die Freude an der Geschichte ist mir geblieben, die Liebe zu Büchern auch. Heute gehe ich sorgsam damit um und stimme Erich Kästner zu, der gesagt hat: »Wer Bücher schenkt, schenkt Wertpapiere.«
Geschichte ist für mich so viel mehr als nur trockene Jahreszahlen. Es fasziniert mich, die historische Entwicklung und das Werden unseres Landes und seiner Menschen nachzuvollziehen, in die europäischen Zusammenhänge und globalen Entwicklungen einzutauchen. Da sind die Fragen nach den Wurzeln unserer Kultur – wie sich verschiedene Gesellschaftsformen entwickelt haben. Wie unser Land mit all seinen Eigenheiten von denen, die vor uns waren, geprägt wurde. Wer die geistigen Väter und Mütter unserer heutigen Vorstellung vom Menschen als einem zur Freiheit berufenen Individuum sind. Dies alles finde ich nicht nur spannend, sondern ich bin überzeugt, dass man ohne Geschichte die Welt nicht versteht. Und wie will man dann die Probleme unserer Zeit lösen?
Ja, ich weiß: Geschichte ist für viele auch nicht der Inbegriff von Kreativität und Selbstentfaltung. Aber ich wusste, worauf ich mich einlasse. Schon früh, während meiner Schulzeit, hatte ich damit begonnen, mich mit der Vergangenheit meiner Heimatregion zu beschäftigen. Ich war begeistert von den alten Fotografien, die das Leben in meiner Stadt vor gut 50 Jahren zeigten und mir trotz der vertrauten Mauern eine andere Welt offenbarten. So wurde ich das jüngste Mitglied im örtlichen Geschichtsverein. Und parallel zum Abitur schrieb ich mein erstes Buch über die Geschichte meiner Schule.
Am Ende habe ich mich von den Einwänden bei der Wahl meines Studiums zwar nicht beirren lassen, aber ich konnte die Skepsis meines Vaters durchaus nachvollziehen. Meine Eltern sind in den 50er-Jahren groß geworden und – wie jeder von uns – Kinder ihrer Zeit. Als sie aufwuchsen, kam das sogenannte Wirtschaftswunder in Gang. Man packte mit an, ergriff die Chancen, die sich einem boten. Vieles wurde möglich, an das zuvor keiner geglaubt hatte. Man wählte nicht unbedingt den Beruf, von dem man träumte. Es war schlicht wenig Zeit für Selbstverwirklichung. Vor Ort gab es vielleicht einen Betrieb, der eine Schreinerlehre anbot. Oder eine Metallwarenfabrik suchte kaufmännische Lehrlinge. Man machte das, was gebraucht wurde – oder das, was einem die Eltern rieten. Es galt, die Chancen, die sich boten, zu nutzen und das vom Krieg zerstörte Deutschland wiederaufzubauen. Und es gab bei alldem eine starke Leistungsorientierung.
Dass mein Vater den Gedanken, den gleichen Weg zu wählen wie er, überhaupt an mich herantrug, war eigentlich überraschend. Schließlich war er selbst aus der Familientradition ausgeschert. Statt wie sein Vater und seine Brüder Pharmazie zu studieren und Apotheker zu werden, hatte er sich für Jura entschieden. Er hatte wohl gespürt, dass dies für ihn der richtige Weg war. Und er hat sich durchgesetzt. Ich bin sehr stolz auf ihn.
Die klassischen bürgerlichen Werte sind meinen Eltern sehr wichtig. Disziplin, Verlässlichkeit, Fleiß.
Ein Jurastudium, dessen berufliche Möglichkeiten sehr viel klarer sind als die Aussichten, die man mit einem abgeschlossenen Studium der Geschichte hat, passten für meinen Vater einfach besser in sein Bild – so vermute ich. Aber mir war Jura viel zu trocken. Der Gedanke, tief in Gesetzestexte und Urteile einzutauchen und jede Menge auswendig zu lernen, lag mir fern. Und ganz ehrlich, da war noch etwas: Mein Vater ist ein hervorragender Jurist. So gut wie er, das war mir klar, würde ich nie werden. Ich scheute nicht nur den Vergleich, sondern wollte ein Studienfach wählen, in dem ich richtig gut sein würde. Da war er wieder, der Leistungsgedanke, der in meiner Familie und auch in unserer Gesellschaft stets eine große Rolle spielt.
In den Jahren 1995 und 1996 habe ich in Schwarzenborn und Mainz meinen Wehrdienst abgeleistet. Ich gehöre zu denen, die nicht gerne zum Bund gegangen sind. Aber die Atteste vom Hausarzt haben nichts genutzt. Am 3. Juli 1995 fuhr ich mit dem Einberufungsbescheid in der Tasche und einem etwas mulmigen Gefühl durch das Kasernentor in Schwarzenborn.
Die Skepsis wich erst sehr viel später dem Gedanken, an der richtigen Stelle zu sein. Ich bin der Bundeswehr dankbar für viele Erfahrungen, das Soldatsein hat mich geprägt. Darum habe ich nach dem Wehrdienst als Reservist weitergemacht. Die Idee dazu kam, als ich an der Uni war und einen Kameraden traf. Gemeinsam verpflichteten wir uns für die Laufbahn als Unteroffiziere der Reserve. Später wollte ich dann Offizier werden. Inzwischen bin ich Hauptmann.