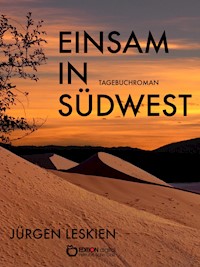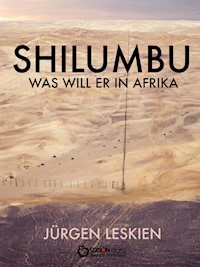8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dunkler Schatten Waterberg – über allen seinen Begegnungen und Gesprächen mit den Namibia-Deutschen, die der Schriftsteller Jürgen Leskien getroffen hat, liegt wie ein Schatten die Niederschlagung des Herero-Aufstandes 1904 am Waterberg, der grausame Rachfeldzug der kaiserlichen deutschen Kolonialsoldaten gegen die von ihnen so genannten Hottentotten. Am Anfang des dicken Buches steht ein sehr ehrliches Bekenntnis: „Sich der Seelenlage Deutscher in Namibia anzunehmen, den Frauen und Männern unvoreingenommener, geduldiger Zuhörer zu sein, ihnen aufmerksam in die Augen zu schauen war lange noch für mich mit dem Ruch des Ungehörigen behaftet.“ Dennoch gelingt, als der Schriftsteller Jürgen Leskien kurz nach 1989 nach Windhoek gelangt, ein vielschichtiges Porträt der heutigen Namibia-Deutschen, die Nachfahren der einstigen Südwester, das sich aus vielen einzelnen Porträts zusammensetzt Und wir erfahren zugleich, wie, aus welchen unterschiedlichen Gegenden und aus welchen unterschiedlichen Gründen die Deutschen damals nach Afrika gekommen waren, nach Deutsch Südwest. Deutsche Geschichte aus ungewohnter Perspektive. LESEPROBE: Meine Geburt ereignete sich gewissermaßen zufällig, während des Urlaubs meiner Eltern in Swakopmund. Groß geworden bin ich in Otjiwarongo. Wir wohnten zwar ein oder zwei Jahre zwischendurch in Otavi, sind aber dann hierher zurückgekehrt. Damals hatte der Ort so um die fünfzehntausend Einwohner, ich schätze dreitausend davon waren Deutsche. In Otjiwarongo bin ich auch bis zum zwölften Schuljahr zur Schule gegangen. Dann an die Uni nach Stellenbosch/Südafrika zur Lehrerausbildung. Dort habe ich erst einmal mein BSc, den Bachelor of Science, naturwissenschaftliche Richtung, gemacht. Dem folgte 1986 das Lehrerdiplom. Das waren politisch ziemlich turbulente Zeiten. Südafrikanisches Militär stand im Norden Namibias, war praktisch überall im Lande. Wir hatten auch hier in der Stadt eine große Militärbasis. Unter den Studenten an der Uni hatte ich liberale Freunde, die teilweise die SWAPO unterstützten. Ansonsten waren die Universitäten in Südafrika weiß und sehr konservativ. In Namibia gab es damals überhaupt keine Universität. In Otjiwarongo hielten sich die Leute konsequent an die Gewohnheiten der Apartheid. Sie kennen ja sicher das Hotel Hamburger Hof bei uns in Otjiwarongo. Da gab es während der Apartheid zwei Türen. Auf der einen Tür stand: nur Weiße, und auf der anderen Seite stand: nur Schwarze.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Jürgen Leskien
Dunkler Schatten Waterberg
Afrikanische Nachtgespräche
ISBN 978-3-95655-037-9 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 2004 Schwartzkopf Buchwerke, Hamburg Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Johannes Leskien
© 2014 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.com
Leb in der Gegenwart, sagst du; Leb ganz in der Gegenwart!
Aber ich will nicht die Gegenwart, ich will Wirklichkeit; Ich will die Dinge und nicht die Zeit, die sie misst.
Fernando Pessoa
Spuren im offenen Terrain
Sie stellen zunächst fest, dass sie es nicht schätzen, wenn über sie gesprochen wird. Fast immer sagen sie das. Zu oft sind wir verraten worden, behauptet Arthur, der Lüderitzer Diamantfischer deutscher Zunge.
Wir stehen auf dem Vorschiff seines blutroten Zehn-Meter-Kutters. Arthur hat vor der Küste vier Claims gepachtet, deren Grund er mit dem Plastikrohr vom Bug des Schiffes aus bestreicht. Ein kräftiger Staubsauger, der Kies und Diamanten schlürft. Sehr viel Kies, sehr wenig Diamanten. Nach der Rückkehr lauert an der Pier die Diamantenpolizei, übernimmt die verplombten Säcke mit dem Diamanten gespickten Kies. Und nach zwei Wochen fließt die Kohle. Das ist mein Leben, verstehst du. Mehr gibt es nicht zu sagen. Keine Zeit für tiefsinnige Betrachtungen über Tage und Nächte im Flaschenhals Lüderitz. Warum wer hier bleibt und warum andere bei Nacht verschwinden. Schwarze, Weiße, Bunte. Schluss und weg. Obwohl hier alles begonnen hat. Und die alten Verträge rechtens sind, was ihr Deutschländer natürlich bestreitet. Oder?! Alles klar? Zum Wohl!
Ausgesprochen selbstbewusst, die deutschsprachigen Weißen in Lüderitz. Wenn man auf ihren Planken steht, sich zum Sundowner auf ihrer Terrasse lümmelt.
Sich der Seelenlage Deutscher in Namibia anzunehmen, den Frauen und Männern unvoreingenommener, geduldiger Zuhörer zu sein, ihnen aufmerksam in die Augen zu schauen war lange noch für mich mit dem Ruch des Ungehörigen behaftet.
Sind sie nicht die Nachkommen der Schutztruppler, jener Schlapphutsoldaten des deutschen Kaisers, die am Waterberg mit dem Maxim unter den Hereros wüteten und die Namas - sie nannten sie in deutsch-nationaler Einfalt die Stotterer, die Hottentotten - bis aufs Letzte bekämpften? Nicht selten zählen sie zu den Abkömmlingen deutscher Missionare. Erwiesen sich jene Männer in Schwarz nicht als Vortrupp betrügerischer Händler und Landräuber? An Plätzen mit gutem Wasser sesshaft geworden, verkündeten sie die Botschaft Gottes, tauften Schwarze im Dutzend, steckten Hereroweiber, damit sie ihre Blöße bedecken mögen, in weit ausladende, viktorianische Kleider, hämmerten Kindern das Alphabet ein. Und ließen Schnapshändler, Mädchenschänder, Viehdiebe ziehen. Dieses im Kopf, springen dem eiligen Gast Zeichen rückwärts gewandter Gesinnung heutiger Südwester sogleich ins Auge. Das über der Stadt thronende Denkmal des deutschen Reiters in Windhoek, die Brötchen aus der Dampfbäckerei Maier Omaruru, mit Schmucknarben verziert - Hakenkreuze auf der Morgenschrippe zu Hitlers Geburtstag -, das Antiquariat, das schon immer Hans Grimm führte, und den Raubdruck »Mein Kampf«.
Und es schien, als wären sie stolz, die Deutschen zwischen Wüste und Meer, auf diese Reliquien, wie anderen Orts Bürger auf Eifelturm, Freiheitsstatue, Brandenburger Tor. Mit einem an Verbitterung grenzenden Ernst bodenständig, eingegraben bis zur Hüfte in diesen fließenden, wehenden Sand, den sie »Deutsche Erde« nannten oder »Tirol«. Solitäre mit sonnengegerbten Gesichtern, Greifwerkzeug ähnlichen, welken Händen. Die vierte Generation schon hier geboren mit ängstlich wachgehaltenem Rest von Illusionen. Den Blick voraus - bis zum Horizont. Und der Horizont verschmolz über die Jahre mit den Schwebehölzern des letzten Kampzaunes der eigenen Scholle. Deutsch-Land, karges Mutterland.
Dann das Jahr 1989. Kaum merklich sickerten Namenlose der Squattercamps - Kinder, Frauen und Männer aus dem Township Katutura - ein in die weiße Stadt, kamen die einstigen Underdogs legal und selbstbewusst über die Grenze nach Hause, platzierten sich an Verhandlungstischen. Und hissten im Jahr darauf ihre Fahne. Die Republik Namibia war geboren, zur Überraschung der Südwester, der meisten jedenfalls.
Irgendwann blieben die Hakenkreuzbrötchen aus, war das letzte Exemplar des Raubdrucks verkauft. Auch deutsche Zungen schmeckten den neuen Worten nach. National reconcilation, nationale Aussöhnung, war das von den Siegern tatsächlich ernst gemeint? Affirmative action, werden nur noch Schwarze und Coloureds studieren dürfen?
In dieser Zeit kam ich nach Windhoek. Ich stand da, verstört, mit meiner eigenen, in Frage gestellten Identität. Mein Land war in den Westen gegangen. Der kalte Wind der veränderten Realität traf mich unerwartet heftig. Schuppen lösten sich aus dem Panzer. Ein Nerv lag plötzlich frei. Im Chaos des Umbruchs entdeckte ich sie plötzlich neu, die einstigen Südwester. Leicht verletzbar und auf eine besondere Art empfindsam geworden, schärfte sich mein Blick für jene gleicher Sprache und Haut, die sich unter der Last der Geschichte schon ein halbes Leben lang fragten: wer bin ich. Ich hasste diese Beunruhigung, dieses aufkommende Gefühl der Annäherung, rührte es doch an meine längst verinnerlichten, weil nicht selten bestätigten Vorurteile vom Menschen weißer Haut inmitten der African community der schwarzen Freunde.
Es waren die Monate, in denen meine Landsleute Bücher in Braunkohlenrestlöcher verkippten, Bilder von Wohnzimmerwänden nahmen. Plötzlich schätzten sie auch ihrer eigenen Hände Arbeit nicht mehr. Fuhren von nun ab Yamaha statt MZ Zschopau, griffen sich Thomy-Senf, übersahen den eben noch begehrten aus Bautzen, schmähten Spreewälder Gurken und verfütterten Finkenheerder Konfitüre an Schweine, die sie eigentlich auch gleich abschaffen wollten.
Diese so plötzlich und so würdelos einsetzende Demut vor den neuen Herren widerte mich an. Ich suchte nach einer Nische, über der ein Stück Himmel rein war. Und fand mich wieder, immer noch gläubig, im frei gewählten Parlament.
In jenen Wochen wurde ein Deutscher aus Swakopmund, Südwestafrika, so stand auf dem amtlichen Umschlag der Treuhand, nach Zittau gerufen. Er möge sich das Rückübertragene anschauen. Jörg Henrichsen, Bürgermeister in Swakopmund und Geschäftsführer des Supermarktes Woermann & Brock im gleichen Orte, reiste und überschrieb die verrußte Schlosserei den dort im tiefen Osten lebenden Angestellten der Firma. Dem neugierigen Kaufmann entgingen die im Abseits stehenden Gurken aus dem Spreewald nicht, nicht die vorzügliche Konfitüre aus Finkenheerd, nicht die auf Wacholder geräucherte Salami aus Eberswalde. Die Nachlassverwalter waren froh, die Lager räumen zu können. Bayrisches musste her und Buntes aus Westfalen. Henrichsen schloss sich für eine lange Stunde im Hotelzimmer ein und orderte. Zwei Fünf-Fuß Container erreichten Wochen später über Hamburg Walfish Bay, die Filiale Woermann & Brock in Swakopmund. Spreewälder Gurken, Dauerwurst, Konfitüre. Für ein Handgeld. Am Deutschen Tag, dem großen Sonderverkauf von Spezereien aus dem unbekannten Teil Deutschlands im Supermarkt, standen wir uns gegenüber. Verkosten von Spreewälder Meerrettich.
Wir schrieben dieses merkwürdige Datum im April. Im Morgengrauen war Henrichsen, von einem atemlosen Polizeiposten alarmiert, in den Woermannturm gestiegen, hatte die Hakenkreuzfahne heruntergerissen, die irgendwann zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens dort gehisst worden war. Auf einem öffentlichen Gebäude, zu des Führers Geburtstag. In jedem Jahr das gleiche Ritual. Ein Irgendjemand hisst, vernagelt die Turmluke, keiner will das Hämmern gehört haben. Die Polizei alarmiert, mit zeitlichem Abstand. Henrichsen steigt in den Turm. Am Tag danach grinsende, weiße Gesichter.
Wir verabredeten uns für den kommenden Abend. Aufführung des Städtischen Amateurtheaters: »Der zerbrochene Krug« in der Regie von Jörg Henrichsen.
Gestrauchelt bin ich hier; denn jeder trägt / Den leid’gen Stein zum Anstoss in sich selbst. Henrichsen gab auch gleich noch den Dorfrichter Adam. - Wir werden uns über die Jahre immer wieder begegnen, ausführlich Möglichkeiten erörtern, die Störtebeker-Aufführung von Ralswiek am Strand von Swakop als Volksfest aufleben zu lassen. Vielleicht 2002, sechshundert Jahre nach der Hinrichtung des vitalen Bruders aus dem Norden.
Die Henrichsens waren seit 1897 im Lande. Kaufleute von Anfang an, stets mit Sinn für ungewöhnliche Lösungen. So hatte Emil Henrichsen in Argentinien preiswertes Futtergetreide bestellt. Auf unsicherer Route Südamerika - Swakopmund. Ein kühner, belächelter Entschluss. Die Zweifler rieben sich ungläubig die Augen, als das Schiff dann doch vor der Stadt lag. Hoch und stolz ragten die Aufbauten gegen den Abendhimmel. Mit der Ladung aus Buenos Aires aber gingen auch Tausende Ratten in Swakopmund von Bord. Häme und Entsetzen waren nicht zu überhören; in Swakop gab es keine Katzen. Henrichsen senior schickte Depesche um Depesche nach Südafrika, nach Angola.
Acht Tage später wurden sie behutsam an Land gehievt, einhundert Hauskatzen aus Kapstadt. Der Urgroßvater gehörte zu den Gründern der ersten deutschen Schule in der Hafenstadt. Auch war er ein Freund des kühlen, selbstgebrauten Bieres.
In den Wintermonaten, wenn der Nebel weit in die Wüste vordrang, erreichten sanfte Wellen von Melancholie auch den ersten Bürger der Stadt. Er schaute dann versonnen von seinem Büro auf die Scharen von alten Männern aus Europa. Säbelbeinig, in frisch gebügelten Khakishorts, wieselten sie durch die Stadt, krochen in jeden Winkel, ließen sich unter Straßenschildern fotografieren, auf denen Bismarck oder Leutwein zu lesen war. Ihm schien, als seien mit jedem Tag neue Expeditionen unterwegs, um ihr Leben im Leben der Deutschen in Namibia zu erkunden.
Ihr gebt vor, euch für unser Schicksal zu interessieren, aber vielleicht sucht ihr euch nur selbst, sinnierte er. In der Stille, die schmerzt, sucht ihr euch, in der Weite flirrender Hitze, wogender Grasflächen, in der man sich plötzlich wieder als Einzelner entdeckt. Oder sucht ihr ein Deutschland, das es nicht mehr gibt, nun, in der zweiten Hälfte des Lebens, in der es so schwer wird, das Neue, das Andere zu verstehen, mit ihm zu leben? Ihr urteilt messerscharf - der da, der ist ja ein Buschnazi! Eine Vermutung, die euch fröhlich stimmt, kann man nun sagen, seht doch, seht, die sind ja noch viel schlimmer als die Burschen, die bei uns daheim wieder die Köpfe heben.
Vielleicht ist es eine Mischung aus allem.
Damals, als es hier mit uns Deutschen begann, fuhr man nach Studium der Lüderitzer Diamanten- und Kupferwerte auf einem der Woermanndampfer über den Äquator, rüstete sich in Lüderitzbucht mit Sandsieb, Schaufel und Diamantlupe aus und erkundete den abgesteckten Claim. Der lag bei Kolmannskuppe oder im Bismarckfeld. Den Blick fest auf den Boden, auf der Suche nach Diamanten. Nun sind die deutschsprachigen Weißen selbst Gegenstand der Erkundung geworden. Gleich Fischen im Aquarium sind wir für manchen der Deutschländer nur in der Kolonialsuppe schwimmend vorstellbar, mokiert der Bürgermeister. Angelockt vom Versprechen, hier einen afrikanischen Traum in deutsch zu finden, kommt ihr, euren Meridian nicht verlassend, versichert, mit der Apotheke im Gepäck, von weit her. Und reist bald wieder ab. Geschäfte daheim. Business.
Der Fremde aus Hamburg, Berlin, Hannover erzählt von der Ladung Katzen aus Kapstadt, vom Dampfross Martin Luther, zeigt die immer wiederkehrenden Fotos von Löwen, Oryx, Elefanten. Fragt er sich, ein wenig irritiert, in stiller Stunde, mein Gott, wie sind sie denn nun wirklich, die Germanen zwischen Wüste und Meer?
Selbstverständlich hat er sie gesehen, ihre noch sichtbaren Spuren. Jugendstilhäuser in Lüderitzbucht, das Schloss Duwisib, die Christuskirche in Windhoek, die Feste Namutoni in der Etosha. Selbstredend Woermannturm und Amtsgericht bei uns, in Swakop. Ja und die Eisenbahn natürlich, den Leuchtturm, die berüchtigte Dampfbäckerei, das Elektrizitätswerk. Er hörte seine Muttersprache in klarer Diktion und Grammatik, aber auch sächsisch eingefärbt, mit dem Slang der Anhaltiner. Merkwürdig. Faszinierend. Und er ahnte die unsichtbaren Spuren, fand scheinbar lose Fäden des Geflechts, das in jeden Winkel des Landes reicht. Sah das Land durchwoben von deutschen Lebenslinien, die jene der Damara, der Ovambo, der Herero, der Nama und der anderen berührten und noch berühren, sich verschlungen mit ihnen durch die Jahre ziehen. Qualvoll manchmal. Aber auch in Lust und stiller Heiterkeit. Weiße Afrikaner deutscher Zunge.
Ob du verstehst, was ich meine? Im Guten wie im Bösen? Warum willst du uns herausheben aus all den anderen Völkerschaften am Kunene, am Swakop, am Oranje, fragte er mich. Sind wir wichtig für dich? Warum? Suchst auch du eine neue Heimat? - Wir Deutschen hier, wir mit unserem schwierigen Humor, mit unserer nur noch rudimentären Fähigkeit zur Selbstkritik, wir werden dich beschimpfen. Falsch zitiert. Missverständlich wiedergegeben das Gespräch. Sätze aus ihrem Zusammenhang gerissen. Das willst du dir aufladen?
Im ruhigen Gespräch zu zweit schätzte der Bürgermeister das direkte Wort, scheute Schnörkel und Pirouetten. Auf Barschemeln hockend, in Kückis Pub, lehrte er mich das Austernschlürfen. Wir stellten fest, unter dem gleichen Stern geboren zu sein, die Jahre unserer Geburt lagen nur wenig auseinander. Und die Kormorane beobachteten wir lange und mit Whisky im Bauch an der alten Brücke am Fluss.
Bis über der Wüste der Morgen aufstieg. Ich versäumte es ihm zu erklären: Ich möchte herausfinden, nun endlich nach all den Jahren, warum sie vor euch geflohen sind. Zu Tausenden, die Schwarzen. Wer seid ihr, was habt ihr angestellt, dass sie alles stehen und liegen ließen und sich in den Norden durchschlugen, die Grenze nach Angola suchten. Vinzenz, seine Familie, die anderen, zu Tausenden. Vorbei an den Sperren der Südafrikanischen Wehrmacht. Den Heimatschutz der Farmer umgehend, die Städte und ausgebauten Straßen meidend. Flüchtlinge im eigenen Land.
Als ich soweit war, mit ihm auch darüber zu reden, ihm von Vinzenz zu erzählen, vom Camp in Kwanza Sul, fand ich seinen Platz im Büro von einem anderen Manne besetzt. Im Kaokoveld sei es passiert, mit dem Landrover. Eine Haarnadelkurve auf der gravel road, der Schotterstraße. Die Schlucht maß mehr als hundert Meter Tiefe. Henrichsen war tot. Ich tapperte in der Stadt herum, umstrich unsere gemeinsamen Orte, fuhr gegen jede Vernunft noch am Nachmittag in den Norden.
Die Wüstenpad bis Uis Myn passierte ich noch vor der Dämmerung. Hinter Fransfontein wechselte ich, nun schon im Licht der Handlampe, den rechten hinteren Reifen. Eine Bauklammer im Geröll der Pad. Der erste Schakal dieser Nacht schleifte ein Perlhuhn über die Piste und verschwand unter den Mopanebüschen. Schattengleich, für einen Augenblick nur, durchschnitt ein Kudubulle das Scheinwerferlicht, ich sah sein Auge blitzen, schreckte zusammen. Ungleichmäßig fassten die Bremsen, der Wagen schleuderte über Schotter und Kies. Der Kudu hatte längst den zweiten, dritten Kampzaun übersprungen. In der Dunkelheit haben Deutschländer auf der Pad nichts mehr zu suchen, Henrichsens Worte!
Ich zog den Wagen in einen Seitenweg, hängte das Tor der Farmumzäunung aus und beendete in sicherer Entfernung von der gravel road meinen Tag. Kudu und Perlhuhn begleiteten meine unruhigen Träume. Ich werde von Kudus gerammt, Perlhühner picken mir die Augen aus, dann wieder liege ich gefesselt unter einer dicken Matte, ringe nach Luft. Im ersten Licht des Tages schäle ich mich aus dem Schlafsack. Das Schild am Kampzaun nennt den Namen der Farm: Paderborn.
Paderborn nun auch am Rande des Damaralands. Ich widerstehe der ersten Regung, kehrt zu machen, der Fahrspur zum Farmhaus zu folgen, mich einladen zu lassen zu Spiegelei, Kaffee und selbstgemachter Feigenkonfitüre. Warum eigentlich? Warum will ich sie heute nicht kennen lernen, die von Paderborn?
In den ersten Jahren, zu Zeiten des Emil Henrichsen, war die deutsche Gemeinde noch überschaubar. Jeder wusste von jedem. Ja, der siedelt in Bethanien, angekommen mit der »Tabora«, und der, der ist samt Familie in den Norden, wahrscheinlich. Gelandet sind sie mit der »Hellopes«, über Port Nolloth kommend. Stürmische Überfahrt, waren halb tot. So wird es geheißen haben. 1891 sollen es dreihundertzehn gewesen sein. Am ersten Januar 1903 zählten die Behörden 2.998 Deutsche unter den 4.640 im Lande Lebenden weißer Haut. Mit dem Ausgang des Ersten Weltkrieges waren es 14.229. Die Südafrikaner, die Sieger, die Jaapies, die Schlappohren, wie sie von den Deutschen verächtlich genannt wurden, richteten sich ein und schickten ehemalige Schutztruppler, Beamte und auch andere unliebsame Personen deutscher Zunge nach Deutschland zurück. Deportation. 1921 werden noch 7.855 Deutsche im Mandatsgebiet, so der neue Name von Deutsch Südwest, gezählt. Fünfzig Jahre später spricht die Statistik von dreißigtausend Deutschen im Land zwischen Oranje und Kunene. Im Jahr 2003 sollen es so um die fünfundzwanzigtausend sein, von denen, so halblaut kommentiert, vierzehntausend neben dem namibischen auch noch den deutschen Pass in der Tasche tragen.
Sie sind aus ganz unterschiedlichen Gründen in dieses wüste Land gekommen, die Deutschen. Und aus verschiedenen Gegenden. Viele aus dem armen Norddeutschland. Auch aus Ostpreußen, damals. Welcher Landstrich, welche Gegend über die Jahre am meisten vertreten war, ist heute schwer zu sagen. Wer sollte sie auch gefragt haben, die Ankömmlinge?
Hilde Kaske, Plätterin, kam aus Berlin, zum Beispiel. Oder der Schäfereigehilfe Emil Winter, der aus Neustrelitz. Oder August Stauch, Eisenbahner, dem allgemein nachgesagt wird, er habe in Südwest die Diamanten gefunden, der kam aus einem Nest nahe Eisenach. Bleiben wir bei Hilde Kaske. Hilde Kaske aus der Simon-Dach-Straße in Berlin-Friedrichshain. Das ist in der Nähe des Bahnhofs Warschauer Straße. Vom Bahnhof über die Brücke und dann rechts in die Revaler, vorbei an der Libauer, dann nach links. Hilde war Arthur und Gertrude Kaskes Tochter. Sie war die einzige. Hildes Mutter litt an einer unbekannten Krankheit. Trudchen, so nannten sie Nachbarn und Freunde, lebte hinter zugezogenen Vorhängen, schlief am Tage, las nachts verkeilt in dicke Sofakissen ziegelschwere Romane und schwor auf die heilende Wirkung des Magermilchquarks, selbstgemacht im Leinenbeutel, aus Milch der Friedrichshainer Kühe. Jeden zweiten Dienstag kurz vor drei am Nachmittag kam Elfriede Persicke von der Libauer Straße herüber, Trudchens Freundin aus der Realschulzeit. Sie brachte manchmal ein zerlesenes Heft der »Gartenlaube« mit oder Wurstbrühe vom Schlächter aus der Revaler Straße; hantierte, Verse von Wilhelm Busch in freier Rede deklamierend, am Lager der Freundin mit Brennschere und Kamm. Beieinander zu sein, darum ging es den beiden wohl vor allem, und es ging auch um Trudchens Stolz: das war ihr Haar.
Trudchens Haar, in der Farbe mehr löwengelb als blond, war voll und fest und kaum zu bändigen. Es hieß, Arthur träumte selbst auf dem Kutschbock von der erregenden Fülle, nicht nur des Haupthaars seiner Frau. Und möglicherweise hing sein Tod, wie auch die Flucht der Tochter nach Südwest, mit den gewaltigen Mähnen der beiden Frauen dieser Familie zusammen. War das Haar frisch gelockt und unter einem ausladenden Turban sicher, wechselten Gertrud und Elfriede in die Küche. Dort, hinter verschlossener Tür, nahmen die Frauen in der Zinkwanne ein gemeinsames Bad. Einander Brust und Rücken, Schenkel und Achsel waschend, gossen sie immer wieder warmes, auf der Gasflamme erhitztes Wasser nach und noch nackt, mit hochgestecktem Haar, beschnitt Elfriede ihrer Freundin die Fußnägel.
Eingewachsene Fußnägel waren eine Erbkrankheit der Familie, die schon dem Großvater die Teilnahme am deutsch-französischen Krieg verdorben hatte. Als es losging, brach er nach dem zweiten Tagesmarsch Richtung Paris zusammen. Der Leutnant überstellte ihn in das nächste Lazarett, er kam nach Pasewalk. Blut im Stiefel in Folge eingewachsener Fußnägel: Unguis incarnatu - an den großen Zehen beider Füße. Für einen Soldaten des Kaisers eine Schande! Hilde indes erfreute sich einer rundum wohlgeratenen Gestalt, das Haupthaar und jenes in verborgenen Winkeln des Körpers eingeschlossen. Sie erfreute sich auch wohlgeratener Zehen. Der zweite der Zehen war sogar etwas länger als der große, was Mutter Gertrud in besonderen Stunden die Bemerkung entschlüpfen ließ, Hildchens Füße hätten antikes Format. Antikes Format - eine Ablagerung nächtlicher Romanlektüre, in der »Gartenlaube« kam solches nicht vor.
Hildes Vater war ein hochgewachsener, breiter Kerl, der von den Spielen der zärtlichen Freundinnen nichts wusste, denn auch Hilde schwieg. Sie wurde mit einer Mark pro Woche für Eis und heiße Schokolade und Besuche im Panoptikum für ihr Schweigen belohnt. Geld, das der Rollkutscher mühsam und unter Gefahren, wie Hilde gesehen hatte, verdiente. Arthur war stolz auf seinen dunklen, buschigen Schnauzbart und auf seine Kraft, die er jedem, der es wollte, vorführte. Nägel verbiegen, Hufeisen strecken, am steifen Arm drei Mann, das war das Repertoire. Und im Zirkus, hinter dem Steuerhaus an der Landsberger Allee, rang er mittwochs und freitags für Geld mit dem Bären Jonathan. Mit Gebrüll und ausladenden Gesten fiel er über das am Maul gefesselte Tier her. Die Frauen schlugen sich auf die Schenkel und kreischten vor Vergnügen. »Sie werden nass, die Weiber, wenn ich Jonathan aufs Kreuz lege«, soll seine stehende Rede gewesen sein. Hilde riss beim Angriff des Vaters auf den Bären die Hände vors Gesicht. Einmal nur war sie im Zirkus gewesen, weil der Vater sie immer wieder eingeladen hatte. Sonst war er Kutscher in der Schultheiss-Brauerei Schönhauser Allee. Die Frauen blieben stehen, wenn er, die Lederschürze geschickt lüftend, sich auf den Kutschbock schwang, elegant die Zügel freigab.
An einem dritten September dann war alles vorbei. Flach fiel das milde Licht in die Schlucht der Grünbergerstraße, tat der Brust gut und den geprellten Knien. Arthur hatte den Mützenschirm weit heruntergezogen. »Die Stumpfe Ecke« war noch mit fünf Fass zu bedienen, weiter zur »Bierschwemme«, hier nur drei Fass, und dann zurück in den Hof, er war im ersten Licht des Morgens aufgebrochen. Ein langer Tag mit vier Mal zwanzig Fass Pils. Nun müde, träumte er sich in die Arme seines ausgeruhten, mütterlichen Trudchens mit der Löwenmähne, spürte schon ihre Hand im Hosenbund, an den geschundenen Lenden zwischen den Beinen. In der warmen Welle, die ihn durchfloss, übersah er die Kraftdroschke, die in schneller Fahrt von der Warschauer her kam. Die Pferde gingen durch. Die Deichsel brach und auch die vordere Achse.
Begraben unter den Bierfässern der letzten Fuhre war sein Leben plötzlich zu Ende.
Hilde musste in eine feste Anstellung. Vorbei die stundenweise Aushilfe in der Schneiderei gleich nebenan. Sie war nun der Ernährer der kleinen Familie. Miete, Gasgroschen, Milch und Käse und Brot. Mindestens das. Elfriede Persicke wusste Rat. Sollte dieser Kerl aus der Wäscherei sich ruhig erkenntlich zeigen. Achtzehn Jahre alt und proper gebaut, bemerkte der Prokurist Alois Schimmelpfennig von der Dampf- und Weißwäscherei Schulze, als er Hilde in das Belegschaftsbuch eintrug:
»Na dann wollen wir 'mal, junge Frau.« Der Prokurist ließ sie nach einer Woche schon ans Bügelbrett in die Weißwäscherei holen. Er schnurrte und war voller Bewunderung für ihr flachsblondes Haar. Hilde hatte nie Flachs gesehen, aber sie genoss die Schmeichelei des jungen Herrn - ihr erstes Kind blieb sechs Monate vor der Geburt auf dem Küchentisch der verschwiegenen Elfriede Persicke.
Das Wachsen des zweiten in ihr sah man Hilde nicht an. Man trug die Röcke weit ausgestellt und sie hatte, von Gott gegeben, schon immer ein wunderbar breites Becken. Für die Geburt zog sie sich eine Stunde vom Bügeltisch weg in das Dämmerlicht der Großen Wäschekammer zurück: Moritz kam an einem Sonnabend im September kurz nach zehn Uhr zur Welt. Alois Schimmelpfennig brachte ihn zu einer Amme nach Jüterbog. »Es ist mein Sohn«, schrie er, »und du halt's Maul!« Hilde brüllte und schlug um sich. Zu Haus.
In der Dampfwäscherei musste sie lachen und schweigen. Das flachsblonde Haar verlor seinen Glanz. Und im dunklen Zimmer wartete die Mutter auf den Tod. Vier Wochen, sechs Wochen. Acht Wochen. Auf dem Parochialfriedhof wollte Gertrude Kaske ihren endgültigen Platz. Unbedingt dort. Das sei die Tochter ihr schuldig. Das war viel verlangt von Hilde. In ihrem Zustand.
Ohne Kind, ohne Hoffnung, ohne Geld. Elfriede Persicke kannte den Herrn Gemeindepfarrer vom Friedhof, dort an der Boxhagener Straße. Gerade den kannte sie, welch ein Glück.
Es wurde eine schöne Beerdigung. Der Geiger vor dem Gebet am offenen Grab. Und beim Herablassen des Sarges ein Trompeter. Wieder war September, und wieder fiel das Licht so mild und im flachen Winkel zwischen den Häusern ein.
Hilde machte schon an der Friedhofspforte der kommende September Angst und auch der, der diesem folgen würde. Als die Haushälterin des Pfarrers, mehr beiläufig, von tapferen jungen Frauen sprach, die den vom deutschen Siedlungswillen beseelten Männern in Südwest zur Hand gehen sollten, zögerte sie nicht lange. Weg, nur weg von hier! Der aufmerksame Blick des Pfarrers bei der Rede seiner Hausfrau war ihr entgangen.
Schon am nächsten Tag lernte sie eine ältere Dame kennen. Mechthild Ziegler vom Kolonialverein. Ohne Aufhebens vermittelte Frau Ziegler eine medizinische Untersuchung und beschleunigte das Ausfertigen der Reisepapiere. Schimmelpfennig atmete auf, er kaufte das Schiffsbillet. Einzelkabine. Mittschiffs.
Dazu zweitausend Mark für den Anfang. Geschenkt, betonte der Prokurist. Wenn sie wegbleibt und alles unterlässt, um Moritz zu sehen. An Bord, mit Einzelkabine und halbem Schleier am zierlichen Hut, ging sie als Lady aus gutem Hause durch.
Nach zweiunddreißg Tagen Seereise Ankunft in Lüderitzbucht, Deutsch Südwestafrika. Dort traf sie auf die, die schon immer dort waren, die Schwarzen und die Gelben und auf jene, die vor ihr Deutschland oder gar England verlassen hatten, um im afrikanischen Sand das Glück zu suchen. Sie traf sie nacheinander. Herr Becker von der Schiffsagentur Lüderitzbucht kam mit einem Boot längsseits und begrüßte Hilde persönlich. Er sah nicht anders aus als die Männer in Berlin. Die vier Hafenarbeiter, die Hildes Gepäck wortlos im Boot verstauten und sie mit Becker und drei anderen Passagieren an Land ruderten, ohne auch nur ein Wort zu sprechen, waren dunkel und von kräftiger Gestalt. Es waren die ersten Schwarzen, die sie in der neuen Heimat sah. Stumm und gleichmäßig zogen sie die Ruder durchs Wasser. Die Mützen hatten sie tief ins Gesicht gezogen.
»Keine Sorge«, raunte Herr Becker, und presste Hildes Hand. Die Kru-Leute kennen die Tücken der Brandung, deshalb haben wir sie extra aus Nigeria hierher geholt. Hilde fühlte sich unbehaglich. Schwarze, unnahbare Gestalten. Sie hatten nichts von den freundlichen Mohren, die ihr aus dem Zirkus in der Landsberger Allee noch gut in Erinnerung waren. Und da war auch noch Beckers feuchte Hand.
Ein hochgewachsener, rotblonder Mann, in festem Ölzeug steckend, half ihr in der Brandung aus dem Boot, stellte sich mit Tom Smith, einst Kapstadt, heute Lüderitz, vor. Ein junger Engländer mit breiten, sanft zupackenden Händen.
Die Deutschen in Lüderitzbucht betrachteten sie als eine der ihren. Sie hatte die Kleidung gut gewählt und traf vom ersten Tag an den rechten Ton. Und das Schreiben der Mechthild Ziegler mit dem Preußenadler machte Eindruck. Die stellvertretende Vorsitzende des Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft, Abteilung Lüderitzbucht, Klara Weinhold, führte sie am zweiten Tag nach der Ankunft durch die Bismarckstraße zur hölzernen Landungsbrücke hinunter, und von dort arbeiteten sie sich tapfer durch den Sand zu Hildes neuer Arbeitsstätte, der Apotheke. Die Sonne stand noch flach über dem Horizont, vom Meer her wehte ein gleichmäßiger Wind. Hilde genoss mit klopfendem Herzen die Blicke der Männer, deren angedeutete Verbeugungen.
In dieser Nacht lag Hilde lange wach. Warum hatte Klara Weinhold sich soviel Zeit genommen, war mit ihr den beschwerlichen Weg durch den Sand hinunter an den Strand gegangen. Es schien, als sei es ihr Herzensbedürfnis gewesen, Hilde vor Männerbekanntschaften zu warnen. Sie sprach auch von den Ovambos, die aus dem Norden kommend auf den Diamantfeldern arbeiteten, hier ohne ihre Frauen lebten und jedem Rock mit Stielaugen nachsahen. In Windhoek, so Karla Weinhold im Ton der Erleichterung, hatten die deutschen Siedler schon vor vier Jahren klare Verhältnisse geschaffen. Sie waren sich darin einig geworden, Mischlinge und auch Weiße mit farbigen Ehepartnern aus der Schulgemeinde, ja aus allen Vereinen auszuschließen. An dieses Gespräch mit der Weinhold wurde Hilde erinnert, als sich ein Jahr später ihrem Arbeitsplatz gegenüber, an der Anschlagtafel des Kasinos, den Tag über immer wieder Leute versammelten, einen dort angebrachten Aushang fixierten und manchmal mit Gelächter, aber auch kopfschüttelnd auseinander gingen. Wohlan! Der Gouverneur hatte das längst fällige Machtwort gesprochen, hieß es dunkel in der Apotheke. Hilde konnte den Abend kaum erwarten, um endlich zu erfahren, was dort angeschlagen war. Der Kaiserliche Gouverneur hatte am 27. Juli 1911 bekannt gegeben:
Wie ich höre, ist es vorgekommen, dass die hiesigen Prostituierten SICH SOGAR ReHOBOTH-BaSTARDS HINGEGEBEN HABEN. ICH ERSUCHE DAS hiesige Bordell daraufhin zu kontrollieren und den Prostituierten ERÖFFNEN ZU LASSEN, DASS SIE SOFORT DES LANDES VERWIESEN WERDEN, WENN SIE SICH MIT EINGEBORENEN EINLASSEN.
Ihre Anstellung in der Reichs-Apotheke, Diazstraße, dem Kasino gegenüber, war von freundlichen Worten begleitet. Zu Hildes Überraschung hörte man ihr zu, suchte gar ihren Rat. Sie war ja eben von drüben gekommen, mit dem Neuesten der alten Heimat vertraut. Dabei hatte sie sich nie mit chirurgischen Gummiwaren, mit elastischen Binden, Verbandswatte, mit Gall- oder Fleckseifen befasst. Es ging vor allem um preußische Ordnung, um Pünktlichkeit und Fleiß. Das verstand sie schon in den ersten Tagen. Ihr bisheriges Leben war durch Anweisungen gelenkt und geregelt worden. Nun konnte sie selbst in das Leben anderer eingreifen: Der Posten Verbandmull in dieses Regal. Die Kiste Seife ins Woermann-Haus. Komme sofort zurück. Unmerklich nahm sie in der Hierarchie des Hauses ihren Platz ein, lernte jeden Tag mehr die schwarzen Gesichter zu unterscheiden. Versuchte nach und nach die Sprache der Namafrauen, die auch in der Apotheke Hottentottenweiber genannt wurden, zu verstehen. Und endlich war sie nicht mehr die vom Prokuristen begrabschte Plätterin im fensterlosen Raum der Dampf- und Weißwäscherei. Endlich.
Hildes Gepäck war schmal, als sie in den Süden reiste, in jeder Hinsicht. Gleich anderen Siedlern wusste sie wenig von dem, was sie wirklich erwartete. Es wird sich alles finden. Für uns Deutsche sowieso. So die freundliche Dame vom Kolonialverein. Unter der Schale eifriger Überlegenheit aber pochte die Angst vor dem Fremden. Beim Soldaten nicht anders als beim Händler, dem Farmer oder der Zugehfrau. Die Angst sich in diesem riesigen Land zu verlieren, die Angst vor den Menschen, die sich in Dunkelheit plötzlich aufzulösen schienen und deren Sprache man nicht verstand. In Furcht vor unaussprechlichen Krankheiten versagte sie sich das Natürlichste: Berührung Haut an Haut. Aber die Neugier nagte. Wie fasst sie sich an, die schwarze Haut? Ist sie kühl im Zorn, ist sie feucht vom Schweiß der Erregung? Selbstverständlich waren sie anders, die Schwarzen, aber eigentlich wollte man nicht wirklich wissen, worin das Anderssein bestand. Und dann die Sorge vor den anderen Deutschen zu versagen, in der Gemeinschaft von Leuten, denen Pflichterfüllung alles war.
Bei einem unverfänglichen Plausch wurde Hilde Kaske nach Vater und Großvater gefragt, ja wo diese denn gedient hätten. Frontabschnitt, Regiment. Kaiserliche Flotte gar oder Artillerie? Das war den Männern wichtig.
Sie zögerte mit der Antwort, was als vornehme Art des Nachdenkens gedeutet wurde. Hilde erinnerte sich der süffisanten Rede, mit der man jüngst in der gleichen Runde über einen Südwester Artilleriehauptmann - in Abwesenheit, versteht sich - hergefallen war. Dieser Baron von Wolff hatte vor knapp fünf Jahren im Kampf mit einer Hottentottenabteilung den Kürzeren gezogen. Er löste sich vom Feinde, das heißt, er und seine Männer suchten das Weite und ließen ihre Kanone in Ermanglung von Zugpferden im Felde stehen. Von Wolff, der allein das Kommando hatte, musste vor das Kriegsgericht. Die Entschuldigung, die er dem Kriegsgerichtsrat vortrug, lautete: sein Vater, so keck der Baron, habe 1871, im deutsch französischen Kriege, gleich ihm, ein Geschütz zurückgelassen. Er, Hansheinrich von Wolff, sei erblich belastet, daher unschuldig.
Zähneknirschend hatte das Kriegsgericht die Sache begraben. Die Richter wussten von der Protektion des Hauptmanns daheim, zudem galt der Baron als recht unkonventioneller, häufig wirrer Kopf, manche schimpften ihn gar agent provocateur. Es war sein Vorschlag gewesen, die Ochsen der ländlichen Gespanne mit Namen ehemaliger Gouverneure oder Staatsbeamten zu belegen. Die Farmer könnten dann ihren Unmut gegenüber Staatsdienern an den Ochsen auslassen, was das Klima untereinander verbessern und die Gerichte entlasten würde. Meinte der Baron.
Hilde war klar, dass sie unmöglich in dieser Runde von der Erbkrankheit, von Unguis incarnatu, die Großvater aus dem Krieg 1870/71 raushielt, sprechen konnte, da hätte sie gleich verloren. Und so erinnerte sie sich der Heldengeschichten, die sie in der Wäscherei von den Frauen gehört hatte, und ließ den Großvater bei der Rheinüberquerung ertrinken, verpasste dem Vater einen Lungenschuss linksseitig, knapp am Herzen vorbei. Die Männer hatten ihre Pflicht getan, so wie sie nun ihre Pflicht tun wird. Die Kaffeerunde zeigte sich zufrieden.
Die großen Kaufmänner und Makler, die in Südwest von Bord der Schiffe gingen, hatten einen Plan, der nicht selten mit politischen Freunden ausbaldowert worden war. Ihre eigenen ehrgeizigen Ziele ließen sich im Windschatten der großen Politik aufs Angenehmeste verwirklichen. Sie empfanden sich als Pioniere, sahen sich im Einklang mit der Welt, in der sie lebten, in Einklang mit ihrem Staat, mit Deutschland. Pflichterfüllung war ihnen höchstes Gebot. Pflichterfüllung rechtfertigte alles. Wer seine Pflicht tat, sündigte nicht. Und die Pflicht gegenüber dem Staat kam zuerst. Mit dieser Haltung ließ sich akzeptabel leben, solange der Staat akzeptabel war. Die Grenzen dieser zur Religion erhoben Pflichterfüllung wurden für manchen Deutschen in Südwest sichtbar, als ihre Interessen mit denen, die schon immer im Lande waren, kollidierten und man nicht mehr zur Feder, sondern zum Messer griff.
Die Mehrzahl der Siedler aber waren einfache Leute. Sie stiegen vom Schiff, geprägt durch lebenslanges Streben nach Tugenden, die man auch in Hildes Wäscherei die preußischen nannte. Hingabe an die Sache. Dienen als oberste Pflicht. Streben nach Leistung. Aufeinander verlassen können. Prompte Erfüllung der übernommenen Aufgabe. Mangel an Genauigkeit, an Pünktlichkeit wurde als Pflichtvergessenheit getadelt. Diese Wimpel voran, drang man ein in die fremde Kultur, drückte dem Land seinen Stempel auf. Ein solches, den eigenen Lebensplan prägendes, geistiges Gerüst rechtfertigte die Landnahme ebenso wie das Auspeitschen mit dem Schambock - im Interesse der Sache, Dienen als oberste Pflicht.
Der einstige Leutnant der Schutztruppe übernahm die Poststelle in Karibib, sein Korporal die winzige Schule in Mariental. Denen werden wir mal die Hammelbeine lang ziehen. Den deutschen Knaben und Mädchen. Und der vierte Sohn des schlesischen Kossäten sah einen Flecken Land am Omaruru als Chance.
Der Glaube an ein halbwegs gesichertes Leben in seiner schlesischen Heimat war ihm nach und nach abhanden gekommen. Das Übersiedeln nach Südwest war für ihn keine Flucht in den Reichtum. Er lief der Armut davon. Und so führte er mit zusammengebissenen Zähnen eine Farm im Wüstenland. Friedeberg schrieb er mit ungelenker Schrift ans Tor, oder Hochfeld. Nicht nur den Namen hatte er mitgebracht vom alten Zuhause. Sondern auch seine Erfahrungen. Gemacht als Knecht auf dem Gutshof, als Reiter unter der Wüstensonne, in den Niederungen militärischer Hierarchie sich mühsam behauptend. Er oder ich. Nun als Siedler aber war er nicht mehr der Letzte. Denkbar, dass er sich im Nebel schwüler Träume des Gutsherren Recht der ersten Nacht bei den Mägden im Schlesischen erinnerte. Was konnte er wissen von denen, in deren Lebenskreis er, einem Unwetter gleich, so plötzlich eingedrungen war, was vom Charme mündlicher Erzählung, nach vier Jahren Holzpantinengymnasium in der Volksschule eines schlesischen Gutsbezirkes?
Auch Hilde tröstete sich: Was kann deNN DIESER Mohr dafür / dass ER SO WEISS N ICHT IST, WIE WIR.
Zwei Männer wird Hilde abweisen, den dritten heiraten. Die Ehe blieb kinderlos. Als nach dem Ersten Weltkrieg im Kriegsgefangenlager Aus unter den Männern der ehemals Deutschen Schutztruppe die Grippe wütet, eilt sie den Sanitätern zur Hilfe. Ihr Angetrauter betrügt sie indes mit der Ersten Verkäuferin von Krabbenhöf & Lampe, was sie nie erfahren wird.
Als im November 1949 Sohn Moritz, inzwischen vierzigjährig, über Walvis Bay in Lüderitz eintrifft, um nach seiner Mutter zu suchen, ist sie längst schon nach Südafrika abgereist. Ziel unbekannt. Mit drei großen Koffern. Für immer. Gleichzeitig verschwand, wie der Polizeiposten Bethanien später feststellte, eine gewisse Elisabeth Negumbo aus dem Distrikt.
Es hält sich das Gerücht, dass Hilde Sattler, geborene Kaske, in den Armen ihrer lesbischen Freundin Elisabeth 1973 verstarb. Eingeschlafen in großer Ruhe. Über sieben Jahre hatten die beiden Frauen die Zuneigung füreinander geheim halten können, hatten sich auf dem Friedhof in Aus getroffen, im Haus eines erblindeten Walfischfängers am Stadtrand von Lüderitz und an anderen verborgenen Orten. Begegnet waren sie sich in aller Öffentlichkeit. Elisabeth sammelte für die Apotheke nahe Aus und Bethanien Teufelskralle, dazu kleinblättriges, nach Minze duftendes Kraut und brachte ab und zu in einer verzierten Kalebasse frischen Saft der seltenen Koichab Aloe mit in die Stadt. Hilde begutachtete die Lieferung und ließ das Geld dem internierten Farmer, in dessen Lohn Elisabeth stand, gutschreiben. Die Frau des Farmers durfte ihr Plot seit 1942 wegen fortgesetzter nationalsozialistischer Propaganda nicht verlassen. Dann kam der Farmer aus Südafrika zurück, 1947 war das. Er forderte alte Rechte gegenüber dem farbigen Hausmädchen Elisabeth ein. Als Hilde ihre Liebe in Lüderitz verstecken wollte, flog die Beziehung der Frauen auf. Auch Jahre danach mögen nur wenige darüber sprechen. Eine Weiße trieb es mit einer Schwarzen! In Kapstadt gab es einen sehr alten deutschen Arzt, der sich gut erinnerte. Aber kaum jemand in der Bucht kennt ihre Geschichte. Vom Wind mit dem Sand durch die Stadt getrieben und hinausgeweht. Es gäbe ein Doppelgrab aus weißem Marmor, das zwei Engel in verfänglicher Pose zeigt, wispert man, irgendwo auf einem einsamen Friedhof Südafrikas zwischen Paarl und Stellenbosch.
Der Erste Weltkrieg siecht für die Südwester dahin. Eines Tages ist er ganz einfach vorbei. Nach der Kapitulation von Khorab, am Kilometer fünfhundert der Eisenbahn zwischen Otavi und Tsumeb, sieht sich die deutsche Gemeinschaft mehr und mehr bedrängt. Der Sieger hält Hof und wer nicht deportiert wird, möge nun doch applaudieren. Bar jeder Illusion kehrten die Männer 1919 aus der Kriegsgefangenschaft und eine Generation später aus der Internierung zurück. Die Deutschen als Wiederholungstäter. Die sechsjährige Internierung nach Weltkrieg zwei unter südafrikanischer Flagge hatte tiefe Wunden gerissen. Bei den Männern, bei den Frauen, bei den Kindern.
Aber hatte der Südafrikaner Malan mit seiner Nationalen Partei sich letzten Endes nicht freundlich gezeigt gegenüber den Deutschen, gegenüber den Internierten? Waren sie und die Weißen in Südafrika, umzingelt von einer kommunistisch unterwanderten schwarzen Bevölkerung, nicht eigentlich Verbündete? Welchen Prinzipien sollten wir nun folgen, fragten sich die eben noch geächteten Deutschen, wem uns anschließen? Eine Erfahrung aber saß tief - Hände weg von der Politik. So sahen sie sich vor allem als deutsche Patrioten, ohne es laut zu benennen, denn die Weißen der südafrikanischen Administration verringerten merklich den Abstand zu ihnen, den emsigen, nun abgestraften Germans in Südwest. Der Kern der einstigen Ordnungsmacht, hatte er doch mit seiner Reservatspolitik auf begrüßenswerte Weise den Grund für eine nach Rassen getrennte Entwicklung gelegt.
Mangels einer politischen Idee machten die deutschen Südwester das Nationale, wie sie es empfanden, an der Sprache, an äußeren Merkmalen fest. Pflegten die alten Farben, sangen die alten Lieder. Nach außen hart, weich nach innen, trotzig summend ihre Hymne, das Südwesterlied:
Hart wie Kameldornholz ist unser Land / Und trocken sind seine Riviere / Die Klippen sind von der Sonne verbrannt / Und scheu SIND im Busch die Tiere ... Doch uns're Liebe ist teuer bezahlt, / Trotz ALLEM, WIR LASSEN DlCH NICHT / WEIL UNSERE SORGE ÜBERSTRAHLT / Der Sonne hell leuchtendes Licht ... Und kommst Du selber in unser Land / Und hast seine Weiten gesehen, / Und hat uns're Sonne ins Herz Dir gebrannt, / Dann kannst Du nicht wieder gehen!
Das Lied entstand 1937. Sein Schöpfer Heinz Klein Werner, deutscher Angestellter bei der Minengesellschaft in Tsumeb. Der Mann traf mit seiner Naturromantik die deutschen Patrioten von Südwest mitten ins Herz. Im Refrain setzt der Dichter noch eins drauf:
Und solltest Du uns fragen / Was hält Euch DENN hier fest? / Wir können nur sagen: / Wir lieben Südwest.
Des Poeten Material, das ist unser Land, ist der Busch, das sind die Tiere in gewaltiger Natur. Von den anderen im Lande, von denen, deren Schicksal zu teilen die Deutschen oft auf fatale Weise gezwungen worden waren, ist nicht die Rede.
Es schien, als plagten Rinderpest und Dürre, Krieg und Entbehrung nur die Deutschen. Ja, als wäre es wirklich und schon immer ihr Land. Heinrich Heines Wort scheint den Kern zu treffen:
Der Patriotismus der Deutschen besteht darin, dass sein Herz enger wird, dass es sich zusammenzieht wie Leder in der Kälte, dass er das Fremdländische hasst, dass er nicht mehr Weltbürger, sondern nur noch Deutscher sein wollte ...
Und immer wieder hatten die Südwester Hoffnung auf eine neue Führung im Lande gesetzt. Segen von oben. Ihrem preußischen Ideal der Staatstreue folgend. Personen an der Spitze wurden ausgewechselt - die Deutschen ballten die Faust in der Tasche, einmal mehr einmal weniger, und redeten sich ein, darauf keinen Einfluss zu haben. Geändert hat sich aus ihrer Sicht nichts, ihre Probleme blieben ungelöst. Land- und Wasserrechte, Teilhabe an der Verwaltung. Deutsch als Unterrichtssprache. In allen Zeiten aber wehten Schübe von Hoffnung durch Südwest. Nach Versailles - Hoffnung auf die Deutsch Nationalen. Danach auf die Nationalsozialisten. Nach dem zweiten großen Krieg war es die Nationale Partei des Dr. Malan aus Pretoria, auf die man, nun Mandatsgebiet des weißen Südafrikas, setzte. Hoffnungsträger dann die kräftige, gesunde Bundesrepublik. Die 68er in Deutschland, über die man ohnehin nur über die Interpretation des Rundfunks etwas erfuhr, das waren Wirrköpfe. Deutlich zu erkennen, wohin der Verfall der Sitten führt. Nicht wenige der Deutschen sahen sich nun erst recht als Glaubensflüchtlinge, als Hüter des wahren Deutschen. Dann sprach Franz Joseph Strauß vor dem Tintenpalast in Windhoek, das setzte eine Welle von Mutmaßungen in Gang. Und Egon Bahr dachte öffentlich darüber nach, ihnen, den Deutschen dort im Süden, ähnlich den Russlanddeutschen wieder feste Rechte in der alten Heimat einzuräumen. Plötzlich aber sahen sie sich von aller Welt verlassen. Es gab sogar Verräter in ihrer eigenen IG, in der Interessengemeinschaft Deutschsprachiger Südwester. Deutsche Männer mit guter Reputation im Lande machten sich mit den Terries, mit den schwarzen Buschkriegern, gemein, grübelten über die gemeinsame Zeit danach. Es kam die UNO, und Guerillas übernahmen die Macht im Staate.
Die grünen Nummernschilder der regierungseigenen Fahrzeuge begannen mit den Buchstaben GRN. Die Bierrunde im Thüringer Hof zu Windhoek kolportierte: »GRN - Guerillas Regieren Namibia«. Das war deutscher Humor, war böse gemeint, aber adelte die einstigen Krieger. Dabei gab es erstmals in der Geschichte der Deutschen in Südwest die Chance, mit sich und dem Land, das ihre Heimat war, ehrlich ins Reine zu kommen, sich von alten Ängsten zu befreien. Den Wert der eigenen Biografie offen verteidigen aber hieß auch, sich bis auf den bitteren Grund fragen, wie war das nun damals mit Großvater am Waterberg, 1904, und wo war mein Platz, als am ersten April 1989 das Land ins Chaos abzugleiten drohte? Hatten sie doch nicht widersprochen, als Heinrich Vedder, ihr deutscher Vertreter zur Zeit des südafrikanischen Mandats, 1958 im Senat der Union von Südafrika nicht ohne Stolz sich andiente: »Südwestafrika ist das einzige Land der Welt, wo Apartheid in steigendem Maße seit fünfzig Jahren besteht.«
Wieder hatten die meisten von ihnen auf der falschen Seite gestanden. Wieder wurden ihre Lebenswege in Frage gestellt, so mancher hätte gern Teile seiner Biografie nächtens entsorgt. Bei soviel Enttäuschung liegt die Flucht ins Vergangene, ins tatsächlich und scheinbar Bewährte nahe. Besinnung auf das Deutschtum als des Farmers letzte Rettung, als festes Bollwerk, wenn die Wellen zu hoch schlugen. Schwarz-Weiß-Rot hielt sich zu lange, um es nur Mode nennen zu können. Der Gipfel waren extreme Augenfälligkeiten wie Hakenkreuzbrötchen und Raubdruckeditionen, die im Grunde nur von einer unbeugsamen, mehr und mehr verdrossenen Südwester Elite akzeptiert wurden. Es waren wohl vor allem jene, die unbeirrbar an ihren Vorstellungen festhielten, allen neuen Verheißungen widerstanden und vom gleichen Ziel besessen waren. Aus ihrem Kreis rekrutierten sich Kommandeure der Heimatschutzkommandos, sie hatten die besten Kontakte zur Südafrikanischen Wehrmacht. Sie sahen sich vor allen anderen als Bewahrer deutscher, ja weißer Kultur in all ihren Verästlungen. Wer, wenn nicht wir - so hätte auf ihrem Banner stehen können.
Sie haben es nun am schwersten. Das Leben als Summe verpasster Möglichkeiten, das können sie nicht akzeptieren. Und sie können sich selbst und den anderen Deutschen im Lande so schwer nur verzeihen. Selbstbewusste, vom gelebten Leben im Wüstenwind zerzauste Leute. Frauen und Männer, die im Abendlicht ihres afrikanischen Daseins sitzen. Die Hand in den Boden verkrallt, schauen sie mit müden Augen in die Arena. Es gibt Stunden, da möchten sie über ihren Schatten springen, aber selbst die eigene, alterskrumme Silhouette ist zu hoch.
Nicht selten werde in der alten Heimat das Bild von reichen deutschen Farmern gezeichnet, so die häufige Klage. Die haben es geschafft, lassen die Schwarzen schwitzen und halten ihre Bäuche in die Sonne. Die Wahrheit ist wohl, dass sie den Cent drei Mal umdrehen bis sie ihn ausgeben. Und die meisten von ihnen sehen sich ehrlichen Herzens verantwortlich für ihre Leute. Nicht nur aus ökonomischem Kalkül.
Denkbar, dass in der Aufopferung für die anderen, für die aus ihrer Sicht Schwächeren und ihnen von Gott Anvertrauten, ein Stück Selbstrechtfertigung ihrer Herrschaft über jene liegt die sie »ihre Leute« nennen. Sie selbst begreifen das, was sie jeden Tag tun, was sie Vorleben, als Erfüllung ihrer Pflicht und sehen darin das moralische Fundament ihres Lebens.
Manchmal treffen sie sich weit draußen auf dem Lande, die Farmer der Region Grootfontein oder Outjo oder auch die anderen Orts. Wenn der Farmer-Verein ruft, wenn die Landwirtschaftsunion die neuen Fleischpreise diskutieren will. Es ist erhellend, sie in solchen Stunden zu erleben. Man muss nichts von Milchquoten verstehen, von Landbankkrediten. Sie vorfahren zu sehen, ihren Slang zu hören, zu erleben, welch Respekt man einander entgegenbringt, das allein ist den Abend wert: »Bitte schön, ist es recht so, warte, ich hole dir einen Stuhl, komm', ich nehme dir die Tasche ab, kannst du das Bein ausstrecken, dein Hüftgelenk wieder in Ordnung, soll ich dir ein Bier mitbringen oder einen Kaffee ...« Nicht Floskeln, eine Art kantige Behutsamkeit als Umgangsform. Vertrautheit, ohne allzu große Nähe zu zeigen. Zärtlichkeiten wären absolut unschicklich. Die Alten und die nicht mehr Jungen sind versammelt. Der Saal summt und ich frage mich, wie mag deren Kindheit, wie deren Jugend gewesen sein?
Sie scharren mit den Stühlen, warten auf den Redner, heiter, gelassen, ins Gespräch mit dem Nachbarn vertieft. Generationen von Internatskindern, sie tragen jetzt, als Erwachsene, die German community in Namibia. Mit dem Eintritt ins schulpflichtige Alter, im sechsten, siebenten Lebensjahr, wurden sie von der Mutter, von den Spielgefährten auf der Farm getrennt. Gegen ihren Willen. Aus Vernunftgründen. Schulbesuch. Die Pflicht ruft und die Schule ist dreihundert Kilometer entfernt. Eben noch selbstbestimmtes Leben. Mit den Landarbeiterkindern im Kraal spielen, auf dem Donkey, dem Esel reiten, die eigenen Schafe füttern, Miliepap ablehnen oder auch nicht, alles vorbei. Das Getrenntsein von der Liebe der Mutter, von der natürlichen Heimat, von den Steinen, die man kannte, dem alten Baum, dem Feuer auf der Werft. Alle haben gesagt, dass es bald so weit sei, haben davon erzählt, nun war er da, dieser schlimme Tag. Abschied. Von der Mutter wurde man geliebt, einfach so, weil man ihr Kind war, die Liebe der Mutter ist an keine Bedingung geknüpft. Davon plötzlich abgeschnitten zu sein, lässt eine erste diffuse Angst entstehen. Auch der Vater war fern, dessen rissige Hand die ungelenken Finger seines Kindes um den Hammerstiel legte, ihm den Gebrauch der Sichel, des Messers, des Motorrads lehrte, ihm das Fenster zur Welt der Dinge aufstieß, jeden Tag von neuem. Der Umgang mit den eigenen Gefühlen, das Einüben sozialer Regeln, die Siebenjährigen mussten selbst damit zurechtkommen. Gewiss, es gab die Lehrer in der Schule, die Erzieher im Internat. Oft der hagere asketische Typ Mensch, der streng mit sich selbst und mit den ihm anvertrauten Zöglingen war. »Stell Dich in die Ecke«, »Schreibe Deinen Namen an die Tafel!« Zehn Jahre Internat. Manchmal noch ein Jahr dazu. Das Lernen, das Spielen, das Vergnügen, der Kummer - das schöne, grimmige Leben, alles vollzieht sich unter Aufsicht der Erzieher. Jahr für Jahr. Kinder wie Eltern sind ihnen ausgeliefert. Ihr Urteil gilt, sie sind ja immer mit den Kindern zusammen. Und sie wollen immer das Beste für die Kinder. Das Beste, so wie sie es verstehen. Mit ihrem Wissen, mit ihrem Talent. Schmetterlinge, Schmetterlinge. Schmetterlinge zart und bunt. / Raupen, Puppen schlagt sie tot, sie ALLE FRESSEN FARMERS BROT.
Aus Anlass des zwanzigjährigen Bestehens der Deutschen Schule Otjiwarongo wird ein ehemaliger Schüler seinen alten Lehrern sagen: »Wir Kinder hatten die Freiheit, die wir für eine gesunde Entwicklung brauchten. Der Rahmen unserer Wertevorstellungen von Gut und Böse war fest umrissen, bekam allerdings seine ersten Risse, nachdem die bis dato unangezweifelten Ideale des Nationalsozialismus in Frage gestellt wurden.« Er sagte es seinen Lehrern, es klang, als lauschte er in die Vergangenheit zurück.
Der Eintritt der Farmkinder in die Schule war von ahnungsvollen Reden der Eltern und älteren Geschwister begleitet. Für die Stadtkinder in Windhoek oder Swakopmund, die den Ort ihrer Kindheit mit der Aufnahme in die erste Klasse nicht verließen, war die Einschulung der gefeierte Beginn eines neuen Lebensabschnittes, so werden die Eltern es gesehen haben. Für die Farmkinder war mit dem ersten Schultag nichts mehr am alten Platz. Von einer Farm mit zehntausend Hektar kommend, war hier der Raum, der Horizont begrenzt, wer sollte sonst für die körperliche Unversehrtheit der Kinder garantieren? Möglichkeiten, die wachsenden Körperkräfte zu erproben, erwiesen sich bald als dürftig. Da gab es Regeln. Und einmal im Jahr das Sportfest. Schreiend, verletzend ungerecht war nicht selten das Urteil der kleinen Gemeinschaft. Gleichzeitig aber bot sie auch Schutz. Im Internat, in der Schule, selbst auf der Heimfahrt. Die Gruppe mit ihrer bestimmten und vor allem ihrer ungeschriebenen Hierarchie, die Gruppe als Organismus. Ein Organismus, der das Kranke abstößt, damit die anderen geschützt werden. Was aber geschieht, wenn Schwäche schon als krank gilt? Die Angst als schwach zu gelten. Gut sichtbar heute noch an ehemals deutschen Schulen, hoch am Giebel die Aufforderung: »Bauet am Erbe«. Was du ererbst von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Beste deutsche Tradition. Damit war der Wertekanon vorgegeben, die Messlatte geeicht.
Und es war die Verheißung, auch hier geliebt zu werden. Die Schule tritt in die Rolle des Vaters, des Weltenerklärers, von dem man geliebt wird, weil man seine Erwartungen erfüllt, die davon gespeist sind, nur das Beste für die Tochter, für den Sohn zu wollen. Und Religion als Trost für ungestillte Sehnsucht, für fehlende Wärme, als Beistand im Wechsel des Schicksals. Umgeben von religiösen Zeichen und Ritualen - »Gott kann Dich sehen, wo immer Du bist.« - schleicht sich Angst tiefer ein in das Leben der Kinder. Diese Angst zu zeigen aber ist ungehörig, ist Schwäche, und die Gruppe kann Schwäche nicht dulden, ja es ist verpönt Schmerz und Verzweiflung überhaupt wahrzunehmen. Nur wer den gültigen Anforderungen entspricht, erfüllt seine Pflicht und kann erwarten, geliebt zu werden. »Bauet am Erbe, erfüllt eure Pflicht.« - das ist der Stern, dem es zu folgen gilt. Der sanfte Druck der Gemeinschaft. Der nicht eingestandene Zwang zur Selbstverleugnung - und im späteren Leben kann man über das Glücksverlangen anderer guten Gewissens hinweggehen, weil man sich selbst das Glücklichsein versagt. Das Land hat uns hart gemacht. Die Hitze, die Wüste, die Einsamkeit. Sagen die Alten. Und nehmen sich immer noch in die Pflicht.
Germans zwischen Wüste und Meer. Konsequenter Fall von Vaterlandsliebe
Der Portugiese hieß einfach der Portugiese. Den gab es in jeder Ecke der Stadt. In Klein-Windhoek, in Olympia, im Erospark, in Katutura, es gab ihn praktisch überall. Familienbetriebe, die ihren Shop, ihren Laden, ihre loja vierundzwanzig Stunden am Tage offen hielten und für die Freundlichkeit und eine gewisse sympathische Unordnung das Typische waren. Zum Portugiesen fuhren die Leute, wenn sie am Sonntag Zahnseide brauchten, Irische Butter für das Abendessen, Eis für den Sundowner auf den Klippen der Auasberge. Oder bacalhau, diesen auf heißen Blechdächern oder schlicht an der Wäscheleine getrockneten Kabeljau. Der konnte natürlich erst für den nächsten Tag sein, denn Trockenfisch musste gewässert werden.
Es war Sonntag. Ich hatte für den Sprung nach Swakopmund ein Drei-Kilo-Netz Orangen gekauft, stand mit Paolo, meinem Portugiesen, um die Fünfzig, schweres schwarzes Haar, olivenfarbene Haut, die an Brust und Armen von einem kuscheligen Pelz überwuchert war, an der Kasse. Der filho war damit beschäftigt, steife Fischleiber aus einem klapprigen Lieferwagen in die Tiefe des loja depovo, zu schleppen. Demonstrativ keuchend, sich auf dem Rückweg zum Wagen die Lenden massierend. Paolo übersah es und lächelte. Es roch sehr stark und ich fragte mich, wie lange die Fische schon unterwegs waren. Eben erst hatte ich Paolo gelobt, denn der Fisch am letzten Wochenende, bei ihm gekauft, hatte vorzüglich geschmeckt, obwohl die Zubereitung eine Tortur war. Unglaublich der Gestank beim Kochen. Paolo zuckte mit den Schultern, ich sei offensichtlich von Geburt her extrem empfindlich, eben ein Mensch vom flachen Lande und keiner vom Meer, und er riet mir, die Hände immer fleißig mit Zitrone abzureiben, wenn ich mit Fischen contacto hatte. Auch Milchtrinken hilft, muito leite.
Was mich bei Paolo einkehren ließ, waren die vorzüglichen Orangen, der bacalhau und der Wohlklang seiner Sprache. Er sah es mir nach, dass ich dieses wunderbare Portugiesisch nur recht und schlecht beherrschte. Wir plauderten miteinander, es gab die unausgesprochene Verabredung, in seinen vier Wänden zu meiner Übung nur in seiner Sprache zu sprechen: »Bom dia! Como vai? Bern obrigado! O que deseja o senhor? Por favor, eu queria - duas paozinhos, cinco ovos, mateiga e queijo ...« so ungefähr. Dem schlossen sich Bemerkungen zum Wetter in Namibia, Portugal und Deutschland an. »Muito frio, muito calor.« Begleitet von Paolo, folgte ich dem Gang an den Regalen vorbei, bei dem mir die Grundlagen portugiesischer Küche vermittelt wurden, sich mein Einkaufswagen füllte und ich so ganz nebenbei erfuhr, wie schwierig es war, in seiner katholischen Familie den Verkauf von Kondomen hier im loja durchzusetzen. Seit vierzehn Tagen gab es nun doch in der Kosmetikecke ein bananenähnliches Gebilde, dem man ein Kondom übergestreift hatte. Darunter ein handgemaltes Schild auf dem in Englisch, Portugiesisch, Französisch, Afrikaans, Herero, Oshivambo, Damara zu lesen war: »Mach es mit!« Deutsch fehlte. »Wenn ein Deutscher zur Frau geht, hat er alles bedacht«, erwiderte Paolo, »wenn ihr auf dem Bahnhof Revolution machen wollt, kauft euer Anführer doch vorher eine Bahnsteigkarte, oder?«
Bevor wir uns an der Ladentür voneinander verabschiedeten, warfen wir stets einen Blick hinüber zur Tankstelle, an der Linda das Regiment führte. Sie war die schlanke, hoch gewachsene Tochter eines dänischen Ingenieurs und einer Krankenschwester aus dem Ovamboland. Linda hatte in Porto Pädagogik studiert und steckte zur Geschäftszeit in einem BP-grünen Overall, der sie auf äußerst attraktive Weise ins Bild setzte. Sie war eine sanfte und sehr schöne Frau. Nach einem Stimmbandriss während eines Rockkonzertes draußen in Katutura, musste sie als Lehrerin aufhören und war hier gelandet. Zu ihrer Familie nach Ondangwa, zurück ins Ovamboland, wollte sie nicht. Ihre achtjährige Tochter besuchte in der Stadt die Deutsche Höhere Privatschule, und Linda nahm mittwochs und freitags Unterricht bei einem bekannten Grafiker, entwarf Plakate und Kinderkleider. Sie ward mit Blumen und Heiratsanträgen überschüttet. Sogar Diplomaten sollen ihr die Ehe angetragen haben. Darunter ein gronelandes, ein Grönländer, sagt Paolo.
Immer das gleiche Ritual. Wir treten vor den Laden, reden, mit dem Blick zur Tankstelle, über Belangloses. Paolo zieht den Bauch ein, stopft verstohlen das Hemd in die Hose, und dann warten wir gespannt auf eine Geste von Linda.
An diesem Vormittag wurden wir durch zwei Herren gestört. Der eine, nicht sehr groß, schlank, ohne jedes Gramm Unterfett, mit dem säuerlichen Gesicht eines Magenkranken, die Stirnglatze in der Farbe eines Pavianarsches. Fest hielt seine Faust den Griff eines flachen Aluminiumkoffers umfasst. Sein lindgrünes Hemd mit handtellergroßen stilisierten Nashörnern zierte am Kragen ein Button aus Zeiten der Antiapartheidbewegung: »SWAPO - Solidarity + Freedom + Justice«. Über der Schulter trug er eine signalrote Segeltuchtasche. Er hatte sich eine Plastiktüte unter den Arm geklemmt, aus der ein Baguette ragte. Der Gefährte des Drahtigen, ein mittelgroßer, dicker Mensch, war mit bauchigem Lederkoffer, Typ Landarzttasche, und einem Seesack, auch aus Leder, ausgerüstet. Paolo hatte offensichtlich mit den Männern schon gesprochen. Sie kamen aus Deutschland, hatten Pech mit einem geliehenen Chevrolet gehabt, waren an Lindas Tankstelle gestrandet und mussten nun dringend zu einem Termin nach Walvis Bay. Mich dauerte der hagere Kerl. Der Traum Afrika und gleich die Stirn verbrannt, welch schlimme Nächte. Gleichzeitig störte mich dieser Aluminiumkasten mit Verstärkungsbügeln, überhaupt ihr auffälliges Gepäck. Und während der Schmale, Dreitagebart und braune Zähne, in angeschmuddelten Jeans steckte, umspannten den breiten Hintern des Ledertaschenmanns akkurat gebügelte Khakihosen, die im Schritt ebenso durchnässt waren wie Brust- und Rückenpartie seines stramm sitzenden Safarihemdes. Von Kopf bis Fuß das Teuerste, und nach den Falten zu urteilen offensichtlich so neu, dass irgendwo noch ein Preisschild hing. Paolo sah mich bittend an. Nimm sie mit, sollte das heißen, wenigstens bis Swakop. Weiß der Teufel, was er ihnen für Hoffnungen gemacht hatte. Sonntagvormittag per Anhalter nach Walvis Bay! Vierhundert Kilometer. Vom Kinn des Ledertaschenmannes rann ein Tropfen Schweiß den Hals herab, verlief sich im Geflecht der Goldkette, die einen schmalen, sonnengeschützten Streifen auf der Brust hinterlassen hat. Der Mann seufzte und wischte sich den Nacken. »Avante, meus senhores, para oceano atlantico«, entschied ich und öffnete die hintere Tür. Warum sollte ich Paolo nicht den Gefallen tun und ihm hilflose Kunden vom Halse schaffen.
Der Beifahrersitz war mit Paolos Orangen und den Zeitungen von gestern belegt. Erlöst schoben sich die beiden auf die Sitzbank. Paolo reichte ihnen noch einen Six-pack Windhoek Lager durchs Fenster und schlug befreit auf das Wagendach. »Contra a sol. Vamos.« Die Ampeln blinkten an diesem späten Morgen gelb. Ohne Halt rollten wir über die Independence Avenue. NBC übertrug Fußball aus Keetmanshoop. Ein heiterer Sonntagvormittag. Ich kramte die Sonnenbrille aus dem Handschuhfach. In vier Stunden werden wir in Swakop sein. Sie bemühten sich, beim Finden der treffenden Begriffe einander ins Wort fallend, mir zu erklären, dass sie TV-Producer aus Germany seien und einen großen Dokumentarfilm über die Schlacht am Waterberg vorbereiteten. In Deutsch versuchten sie es und in Englisch. Hereros gegen Schutztruppen am Waterberg. Davon wollen sie erzählen.
Deshalb seien sie hier. Nicht um sich zu erholen. Ich mühte mich, mein Unbehagen gegen Goldkettchen, aufgepeppte Afrikareisende und Aluminiumkoffer zu verdrängen, spürte von Minute zu Minute, wie Ärger mich ankroch. So beschloss ich Portugiese zu bleiben, ihr Gerede zu ignorieren und mich auf das abendliche Gespräch mit dem Ex-Minister von Wietersheim dort am Meer einzustimmen.
Schon hinter Katutura, als wir auf die Fernverkehrsstraße Richtung Okahandja einkurvten, schienen sie davon überzeugt zu sein, der Mann am Steuer sei ein sturer Hund, mit dem man nur Portugues palavern konnte oder Russo oder Oshivambo oder um poco Ingles. Nach einem letzten Versuch, doch noch ein freundliches Gespräch anzustiften, beide waren dicht an meinen Sitz herangerückt, ich roch ihren verbrauchten Atem, lehnten sie sich erschöpft zurück. Der Hagere zuckte mit den Schultern und öffnete die erste Flasche Bier. »He«, stieß der Dicke mich sanft an, »he, nimm doch wenigstens ein Bier. Piwo, beer, biere, Pilsner, comrade.«
»Obrigado, senhor, eu motorista.«
»Da, da«, schrie er plötzlich, hieb mir auf die Schulter, »da, Affen, sieh doch mal, Affen, ein ganzes Rudel!« Eine Pavianfamilie hockte am Straßenrand, fraß unbeeindruckt von den Autos aus einem Abfallkübel. »Ja, das ist Afrika. Und wir mittendrin«, der Dicke knuffte den Hageren vergnügt in die Seite. Aus der Einkaufstüte zog er eine Plastiktüte mit Biltong. Er stopfte sich zwei Streifen Dörrfleisch in den Mund. Dann verschwand er aus dem Rückspiegel. Sein Versuch, das Land über den Gaumen zu erkunden, stimmte mich milder. Es müssen ja nicht gleich die Omahungu, die gerösteten Mopaneraupen sein. Mit Pfeffer und Salz oder mit Curry. Omahungu, bei dessen erstem Verzehr es mich würgte und ich zum Nachspülen mehr Maisbier in mich hineingoss, als es in Anwesenheit des Hererochiefs schicklich war. Aber Biltong, unter afrikanischer Sonne getrocknetes Fleisch, das ist ein guter Anfang. Biltong konnte man getrost als Souvenir in die Villa nach Zehlendorf schleppen oder nach Oldenburg. Fleisch vom Kudu, vom Oryx, vom Springbock. Es war anders und doch nicht irritierend fremd. Es war hygienisch verpackt und doch sah man die Spuren der Messer. Werde den einstigen Landwirtschaftsminister fragen, welches Wild sie bevorzugen für Rauchfleisch, für Biltong, dort im Süden auf der Farm Gras. Ob Hartebeest sich besser eignet als Blessbock und Eland. Und ob es stimmt, dass Zebra für Dörrfleisch nichts taugt.
Wir waren uns das erste Mal durch einen Zufall begegnet, dieser wuchtige, freundliche Mensch mit Barbarossabart, von Wietersheim, und ich. Im Norden, im Ovamboland, irgendwo bei Oshakati. Pastor Wiesenmüller hatte mir seine Flaschenhäuser gezeigt. Rundhütten, deren Wände aus Flaschen, die mit den Hälsen nach innen für das Rondavel durch Lehm zusammengehalten wurden. Dickes Grasdach, weißgetüncht, Schlafhütte für drei Personen. Nicht besonders komfortabel, aber ein Dach über dem Kopf und das beste, was man aus den Saufhinterlassenschaften der Army machen konnte, meinte Wiesenmüller. Wir waren im Begriff, uns zu verabschieden, da stoppte ein Jeep und vom Beifahrersitz schob sich ein untersetzter Mann mit Vollbart und buschigen Augenbrauen ins Freie, kam auf Wiesenmüller zu. Das war er, der Landwirtschaftsminister. Er war unterwegs zu Mahangopflanzungen, die neu angelegt worden waren und wollte mit dem Pfarrer über Bohrlöcher sprechen. Im gleichen Sommer sah ich ihn dann auch als Flieger mit seiner Cessna. Am Rande der schmalen Schotterpiste hatte er die Triebwerksverkleidung geöffnet und reinigte den Luftfilter mit Flugbenzin, den er aus dem Tragflächentank in eine Blechbüchse laufen ließ. In Kamanjab war das. Oder war es in Outjo? Es ist lange her.
Anton Gusinde von Wietersheim, den die alten Südwester einen »weißen Neger« schimpften, weil er schon zu südafrikanischen Zeiten den Ausgleich zwischen Schwarz und Weiß gesucht hatte. Einer der ihren saß nun in der Regierung, aber sie mochten ihn nicht. Gerüchte wurden lanciert. In Katima Mulilo in die Welt gesetzt, erreichten sie über Grootfontein, Omaruru, Swakopmund am Abend des nächsten Tages Windhoek. Ein Buschflieger konnte nicht schneller sein. »So war das also«, raunte man an der Kaffeetheke des Supermarktes. Kampfpilot eines Puma-Helikopters sei er gewesen, South African Air Force. Jetzt hocke er mit denen zusammen, die er damals als Terries gejagt hat. Im Tiefflug mit Raketen, mit dem Maschinengewehr. Deutsch und tapfer. Aber leider als Offizier bei den Jaapies, bei der falschen Armee.
An der öffentlichen Toilette in Okahandja stiegen wir aus. »Ja, das ist gut«, freute sich der Dicke und verschwand mit kurzen Schritten im Häuschen. Eine Reisegruppe und ihr Fahrer. Eine Pause gegenüber, im deutschen Café, versagten sie sich. Walvis Bay wartet.
Okahandja, Hereroland, hier hatte alles begonnen, damals 1904. Wem gehört das Hereroland? »Uns gehört das Hereroland!«, riefen die Frauen und die Kinder und die Hereromänner, als der Aufstand losbrach. Sie schrien es hier an der eben erbauten Eisenbahnstation und auf den Farmen. Sie schrien es auf Deutsch, was die Missionare mehr entsetzte als die Beamten. »Uns gehört das Hereroland!« Sie hatten den Landraub satt und den Schnaps, der die Jugend vergiftete, und das Betatschen ihrer Frauen durch die Deutschen wollten sie nicht länger hinnehmen. In den ersten Tagen des Januars 1904 erschlugen die Krieger mehr als einhundert Deutsche. Mit dem Kirri, mit der Axt, mit dem Knüppel. Farmer, Beamte, Soldaten. Auf Befehl ihres Häuptlings Samuel Maharero schonten sie Frauen und Kinder. Nach der Schlacht am Waterberg werden in dieser Gegend von den einst achtzigtausend nur noch sechszehntausend Hereros gezählt.
Der Einsatz des neuentwickelten Maschinengewehrs, so heißt es in einem der Berichte an den Deutschen Generalstab, hat sich im offenen Felde ausgezeichnet bewährt.
Ich war überzeugt, die beiden würden aus professionellem Interesse zu den Gleisen hinübergehen, sich zwischen die Schienen hocken, dem Wind der Geschichte lauschen, Stimmen hören, einen Stein aufheben, der damals schon dort gelegen hatte. Sie aber mussten weiter. Walvis Bay!
Bevor die Eisenbahnlinie außer Sicht geriet, war der Schlaf über die Fernsehleute gekommen. Das Bier, die Hitze und der Singsang der Reifen. Weit hinter Karibib schreckte der Hagere auf. Augenblicklich begann er auf den Dicken einzureden: »Ein solches Projekt, in einem Land mit diesen Entfernungen.« Er meldete vorsichtig Zweifel an. »Es gibt Handys und Flugzeuge, und wir bringen die richtigen Leute mit«, versuchte der Dicke zu besänftigen, Ungeduld war herauszuhören. Der Hagere ließ nicht locker. »Zu weit ab von der Basis, totale fremde Gegend.« Er verschränkte die Arme vor der Brust, unterstrich auf diese Weise seine Bedenken. »Schau dir diesen Slogan an, dort, dort auf dem Acker, die haben doch Humor«, lenkte der Dicke ab, »nicht nur Coca Cola.« Gut sichtbar stand im Treibsand der Namib ein scheunentorgroßes Schild: »Keep the desert clean!«, Bewahrt die Wüste. Haltet die Wüste rein. »Die meinen solche wie uns«, knurrte der Hagere und schaute durch die Heckscheibe der verschwindenden Bretterwand nach. Nun kam der Dicke in Fahrt: »Deinen Sarkasmus in Ehren, aber ich sage Dir, wir werden einen Film machen, der sich gut verkauft. Deutsche Farmer mit traurigen Hundeaugen. Tanzende Weiber. Wippende Titten. Sonnenuntergang und irgendwo Löwengebrüll. Archivbilder, die frei sind. Biwak der tapferen Schutztruppe, Soldaten aus Mainz, aus Berlin am Maxim. Vielleicht finden wir sogar noch ihre Gräber. Und irgendeinen alten Verwandten, der um den Südwester Großvater trauert. Und ein ordentlicher Sprecher muss her, einer, der die Sache zusammenhält. Eine Kurzfassung für die Schulen. Rechne mit acht- bis zehntausend Stück. VHS und DVD. Kenne da jemand in der Kultusministerkonferenz. Spitze wäre eine schwarze Band. Soundtrack. Afrikanisch-europäisch-amerikanisch. Das wär’s!«
Sein verschwitztes Gesicht verschwand aus dem Rückspiegel. Ich hörte ihn eine Bierflasche öffnen. Wohliges Aufstöhnen nach dem ersten Schluck. Er ließ nicht locker: »Der Höhepunkt - Event am Waterberg. War doch dein Vorschlag! Weltpremiere auf Großleinwand. Alle werden da sein, und wir werden dieses Waterbergmassiv mit einer Million Lux anstrahlen. Mit dem letzten Bild. Bevor die Wirkung des Films verpufft. Peng! Mit einem Schlag Licht über Afrika. Aber zuvor, zuvor mein Lieber, am Vorabend des Tages, an dem die Schlacht vor hundert Jahren begann, werden Flakscheinwerfer, ja, ja, Flakscheinwerfer, an den einstigen Orten unserer Schutztruppen-Heliografen stehen und, am Waterberg beginnend, die Botschaft nach Windhoek blitzen. Über zwei, drei Zwischenstationen. Sieg! Sieg! Sieg! Morsealphabet. Kurz-lang-kurz. Striche, Punkte. Kennst du doch vom Bund. Dit-da-dit-dit, ich liebe dich, da-da-dit-da, Quark, Quark macht stark oder dit-dit-da-dit, ficke du sie. Die werden hier denken, der Teufel ist niedergefahren. Und in der Loge am Fuße des Berges sitzt der Mister Präsident mit dem Sektglas in der Hand. Sie werden uns die Tapes aus der Hand reißen! Alle werden die Bilder kaufen. CNN, Reuter, RTL, SAT, sogar die Säcke von den Öffentlichen werden angekrochen kommen.«
Der Dicke schnappte nach Luft. Mit gespieltem Kopfschütteln und einem Seufzer legte er seinen Arm um die Schulter des schweigenden Gefährten. Es roch nach Zwiebel, Schweiß und Bierfurzen. Paolo hat Recht, mein Geruchssinn ist offensichtlich extrem ausgeprägt.
Der Hagere wagte eine vorsichtige, befreiende Regung. »Dieses Sandfeld dort, am Waterberg«, entgegnet er kaum vernehmbar, »das ist ein Leichenplatz. Tausende. Kinder, Frauen, Pferde. Auch deutsche Soldaten.« Der Dicke wandte sich energisch mit einer ungeduldigen Bewegung dem Hageren zu. »Das ist es ja gerade! Wir haben den Mut, wir, du und ich, wir beide haben den Mut, die Vergangenheit anzunehmen. Als Vergangenes. Und mit den Schwarzen nach vorn zu schauen. Die Toten werden nicht mehr lebendig, und an Dollars fehlt es doch hier an jeder Ecke. Du wirst nun sagen, da gibt es noch den deutschen Soldatenfriedhof. Richtig. Am Fünfzehnten habe ich einen Termin bei der Kriegsgräberfürsorge. Die sind immer knapp bei Kasse. Zufrieden?«
Nun öffnet sich auch der Hagere eine Flasche, versuchte einen letzten müden Einwand: »Wir agieren in einem Naturschutzgebiet«, stellte er vorsichtig fest, «mit Scheinwerfern, Hubschraubern. Waterberg Plateau Park. Verstehst du! Nashörner, und so weiter.«
»Ja doch! Ich habe Zeitung gelesen, Radio gehört. Aber hier gibt es keine Müslifresser, keine Grünen. Hier schätzt man gutes Grillfleisch und Erfolg bei der Jagd. Die Viecher am Berg kommen wieder, wenn alles vorbei ist. Damals sind sie ja auch wiedergekommen. Trotha lesen, mein Lieber.«