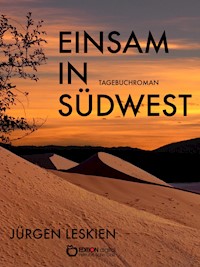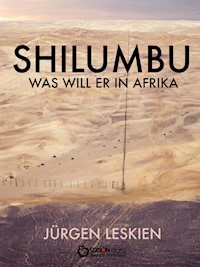8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ondjango. Was bedeutet eigentlich dieser Titel? Ende der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren wieder Deutsche nach Angola gekommen, diesmal mit blauen Hemden und mit Werkzeugkästen in den Händen. Vom ersten Tag an waren sie den Angolanern companheiros. Mit der Ablösung dieser Männer kam auch Jürgen Leskien für ein Dreivierteljahr nach Angola, um dort zu leben, zu helfen und – Tagebuch zu führen. Seine Aufzeichnungen nehmen den Leser mit in die Zeit kurz nach dem Erringen der Unabhängigkeit des Landes 1975, erlauben Einblicke in die Geschichte des Landes und in das gegenwärtige Leben in Hauptstadt Luanda. Wir nehmen teil an der Fahrt durch den Regenwald, treffen ein am Stützpunkt der FDJ-Brigade in der Stadt Uige, wo sie W 50-LKWs aus der DDR reparieren und jungen Leuten aus Angola zeigen, wie das geht. Jürgen Leskien ist angekommen in Afrika. Er wird noch viel hören und sehen und noch viel aufschreiben von diesem Afrika, von diesem Angola, damals Ende der siebziger Jahre. Geschrieben hat er damals übrigens mit der Schreibmaschine … Ondjango. Dieses Wort bezeichnet eine etwas größere runde Hütte mit kegeligem Grasdach, die gewöhnlich in der Mitte des Dorfes steht und der nach Sonnenuntergang ein Feuer brennt. Dann wird in dem Ondjango über alles geredet, was wichtig ist. Der Ondjango ist der Treffpunkt der Leute im Dorf: „Sie sitzen und reden miteinander. Der Alte auf der Matte, in der Nähe seine Kinder und Kindeskinder. Erzählen, zuhören, einander in die Gesichter schauen und darin lesen. Die Bedeutung der Pausen zwischen den Worten erspüren, der Melodie der Sprache lauschen wie einem Lied. Sich hineinsenken in die Gedankenwelt des anderen. Zueinander sprechen, einander zuhören - die ursprünglichste, wichtigste Form des Umgangs der Menschen miteinander. Für uns müssen wir sie erst wieder entdecken.“ Das angolanische Tagebuch von Jürgen Leskien ist wie ein solcher Ondjango.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Jürgen Leskien
Ondjango
Ein angolanisches Tagebuch
Für Christine und Johannes
ISBN 978-3-86394-743-9 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1980 im Verlag Neues Leben Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Johannes Leskien
© 2014 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.com
27. September
Ein Berg kommt nicht zum anderen, aber die Menschen treffen sich
Sprichwort aus dem Umbundo
Nun ist es so weit.
Erst habe ich es geträumt. Dann habe ich es mir schreibend, als Vision, ins Zimmer geholt, anderen, als Traumbild, davon erzählt. Dann habe ich es gewollt, ganz heftig habe ich es gewollt und fand Freunde, die mich in dieser Sehnsucht sehr gut verstanden.
Was ich hatte tun können, hatte ich dafür getan.
Nun ist es so weit.
Eine Insel des Lichts und der Farbe, dieses Flughafengebäude inmitten der Spätsommernacht.
Ich trete durch das Portal. Piktogramme fordern auf, sich auf den sachlichen Vorgang der Abfertigung zu konzentrieren. Der Einzelmensch wird auf den Begriff PASSAGIER reduziert. Es geht darum, die richtigen Leute in die richtigen Flugzeuge zu sortieren.
An einem Schalter reiche ich den Angestellten meine Papiere. Sie sehen nicht mich, sie sehen mein Passbild, und sie sehen mein Gesicht. Sie vergleichen und sind zufrieden. Weiter in der Reihe. Jetzt werde ich für die Statistik interessant und für den zweiten Flugzeugführer unserer Maschine, der mein Lebendgewicht zur Kenntnis nehmen muss, um es in der Summe des Startgewichts dem Kommandanten zu melden, es dem Navigator mitzuteilen, damit dieser aus der Tabelle die rechte Abhebegeschwindigkeit unseres Aeroplans herausliest.
So unbedeutend ist der Einzelne also doch nicht, und es wäre vermessen, sich zu wünschen, dass die Hostessen gerade heute Engelsflügel tragen, frauliche Sanftheit zeigen, sich für mich ein besonderes Lächeln zurechtgelegt haben. Für mich, speziell für mich, der ich das erste Mal nach Afrika fliege.
Man fliegt hier andauernd irgendwohin. Das ist der Sinn der Einrichtung. Emotionale Beteiligung dieser jungen Frauen an meinem Unternehmen zu erwarten, jetzt nachts kurz vor eins, in einer Zeit also, in der man gewöhnlich noch oder wieder in den Armen eines Mannes liegt, in der man endlich seinen Dormutil-Schlaf gefunden hat, in der man, traum- und problemlos, in den neuen Tag hineingleitet - das ist wohl recht verstiegen.
Und doch gab es bei einer ein Blitzen im Auge, einen verzögerten Lidschlag. Die Schlanke war es, die mit den Bordkarten in der Hand.
Im Blechgehäuse ein Gedränge wie in der Siebzehnuhrstraßenbahn. Die alten Füchse sitzen schon auf den richtigen Plätzen. Nicht vor dem Lärm der Triebwerke, hüte dich vor einem Platz über den Tragflächen, dann kannst du auch gleich mit der U-Bahn fahren ...
Dann klemme ich in meiner Sitzmulde, vor den Tragflächen sogar.
Zwei Uhr fünfzehn - Start. Zuvor das Übliche. Begrüßung, Ermahnung, die Gurte. Dankeschön.
Vier Triebwerke schieben das Silberschiff durch die Nacht. In ihm aufgereiht fast zweihundert Leute, die nach Algier wollen, nach Lagos oder Luanda. Zum anderen Kontinent, der zwischen dem Atlantischen und dem Indischen Ozean schwimmt.
Wieder die Frage, wie wird es sein, dieses Afrika, dieses Angola? Heiß sicherlich und groß, voller schwarzer, fremder Gesichter, mit Palmen, so zahlreich wie bei uns die Kiefern, und mit merkwürdigen Sitten und Gebräuchen.
Angola, Land in revolutionärer Bewegung, unabhängig, mit den frischen Narben des Befreiungskampfes.
Irgendwo in den Sitzreihen ein gutes Dutzend junger Männer, die wie ich nach Luanda wollen, von dort weiter nach Uige, in die nördliche Kaffeeprovinz.
Ich schaue mich um. Man döst vor sich hin und raucht.
Die Aufforderung zum Anlegen der Gurte weckt mich.
Algier. Landung nach drei Stunden Flugzeit.
Afrika empfängt uns mit Regen und mit neunzehn Grad. Ich stecke fröstelnd die Nase in den Flugplatzwind und ziehe mich in den Transitraum zurück. An unserem Flugzeug wird gearbeitet. Zwischen den Wolken der umgekippte Mond, mit den Spitzen nach oben. Wenigstens er zeigt uns das Anderssein dieses Stückchens Erde an.
Mit neunhundertfünfzig Kilometern in der Stunde hat es uns von Europa nach Afrika geschleudert. Italien haben wir in Wadennähe des Stiefels überflogen (ich denke mir, das war in weniger als fünfzehn Minuten erledigt), und Sardinien war nicht mehr als ein Ansteuerungspunkt in der Luftstraße zur nordafrikanischen Küste.
Ich mag dieses übergangslose Verpflanzen nicht. Ein von Menschen ausgedachter Apparat bringt uns in nicht sehr menschengemäße Zwänge.
Ich aber möchte Veränderungen, wenn ich sie schon nicht selbst mit herbeiführen kann, wenigstens sehen, sie hören, sie schmecken, sie fühlen, um sie als solche zu begreifen.
Vollendete Tatsachen wie dieser schmale Mond, das ist mir zu wenig, da fühle ich mich unterfordert, als Mensch nicht ernst genommen.
Nur: Gegen wen renne ich an?
Denkbar wäre eine Fahrt mit dem Ruderboot von Trieste nach Algier mit Landschaften steuerbords und backbords (sehen!), mit Wind (hören!), mit Gischt der Wellen im Gesicht (schmecken!) und mit dem Sonnenuntergang vor Cap Boutgaraun (fühlen!). Aber das würde dauern, und mir scheint, es gibt Wichtigeres.
Kurz nach sieben Start. Die Sonne steht hoch am Himmel. Den Horizont zieren die ersten Gewitterwolken.
Rote Maurersocken mit der Aufschrift INTERFLUG werden ausgegeben. (Wie weit käme man damit in der felsigen Nordsahara?)
Ich tausche Schuhe gegen Füßlinge, ziehe die Beine an und schaue ins Wörterbuch.
Guten Tag - bom dia
guten Abend - boa noite
danke sehr - muito obrigado
bom dia - boa noite - muito obrigado.
Ärger über meine Unfähigkeit, mir den Mantel einer anderen Sprache kleidsam überzuziehen, es reicht immer nur zum Feigenblatt.
Das nationalistische Trostpflästerchen lockt: Wer spricht schon PORTUGIESISCH?
Immerhin: Portugal und Brasilien, Angola, Mocambique, Guinea-Bissau, Sao Tomé und Principe; Goa, Daman und Diu, Macao und Osttimor.
Immerhin beherbergt dieser Sprachraum annähernd so viel Menschen wie die deutschsprachigen Länder DDR, BRD, Österreich und die Schweiz zusammen.
Die Falten des Atlasgebirges. Schattenlos gleiten wir über die Schründe. Denkbar wäre: Die Sonne projiziert die Kondensstreifen unseres Flugzeuges in die Täler dieses Gebirges. Die vierzeilige Handschrift unseres Jahrhunderts mischt sich mit den Felszeichnungen unserer Vorfahren, dort unten an den granitenen Wänden.
Charles Darwin: Afrika, die Urheimat der Menschheit.
Erst jüngst neu belegt. Die 1968 in der Nähe des Victoriasees entdeckten menschlichen Fossilien werden auf ein Alter von über zwei Millionen Jahren geschätzt.
Nun ja, zwei Millionen Jahre.
Lang gestreckte Sanddünen, scholliges Land, sattes Ocker. Überfliegen von In Salah. Trotz der Höhe ist das Flugfeld zu erkennen. Ob Exupéry von hier die lebenswichtigen Funksignale empfing, als er vor fünfzig Jahren unterwegs war auf seiner Posttour von Toulouse nach Dakar? (Weiter westlich zwar, über Marokko, dem Aufstandsgebiet, wie er es nannte, um sich zweimotorig ausgerüstet nach Senegal durchzuschlagen.)
Atollartig heben sich Dünen aus der Ebene - riesige leere Staubbecken.
Ja, es stimmt, die Sahara ist blond, mitunter ist sie blond.
Mit den rechten Tragflächen haben wir Mali gestreift und überfliegen nun Niamey.
Unter uns der Niger, breit wie die Donau bei Dunakeszi. Über Benin weiter in Richtung Nigerias Hauptstadt Lagos.
Sinkflug. Wolken, aber zwischen den Wolken kräftig grüne Flächen. Nun schon einzelne Bäume. Ja, es sind Palmen!
Neben der Landebahn, an der Schwelle der Piste ein Zelt, eine Flak, deren Mündung sich die anfliegenden Maschinen beguckt. Kein gutes Gefühl.
Landung. Lagos. Das Luftkreuz von Nord nach Süd, Oase auf dem langen Ritt der Jets von Südamerika über den Atlantik zu den Küsten des Indischen Ozeans. Chaotisches Flugzeuggewimmel auf dem Terminal.
Große Silbervögel, die das Heck neunzig Grad zur Seite klappen, um die Container besser schlucken zu können. Dazwischen zweistrahlige Westentaschenflugzeuge, mit denen man gleich mal nach Accra hinüberspringen kann.
Flugzeuge, wie Hängebauchschweine, in knalligem Orange. (Dass die Dicken sich immer so falsch kleiden!) Nebenan die dunkelgrüne Eleganz eines arabischen Großtransporters.
Auf und unter, neben und in den Flugzeugen die Mechaniker der NIGERIA AIRWAYS. Wir bleiben auf unseren Bänken, gleich geht’s weiter.
Nach einer Stunde auch für uns Start. Zwei Stunden und vierzig Minuten bis Luanda werden uns geweissagt, und das in elftausenddreihundert Meter Höhe. In eine Wolldecke gehüllt, lehne ich mich in den Sitz zurück. Ich erwache auf der südlichen Halbkugel.
Kein fliegender Drache, der die Äquatortaufe zelebrierte (Pappflügel auf den Rücken der Stewardessen hätten durchaus genügt), kein Sektkorkenknall. Mein Nachbar will ein Aufjaulen der Triebwerke beim Überfliegen des Äquators gehört haben ...
Nur Präzision, nur Sachlichkeit - so steuert die Besatzung unser Blechgehäuse nach Luanda.
Schon im Sinkflug. Ich erkenne Cabinda, den Kongo und bald auch die ersten Häuser von Luanda.
Landung um fünfzehn Uhr zwei. Vor zwölf Stunden und siebenundvierzig Minuten hatte sich das Fahrwerk unserer IL-62 von der Betonpiste in Schönefeld gelöst. Neuntausend Kilometer von Berlin entfernt stehen wir ein wenig hilflos auf dem Flugfeld herum, man versucht ein Lächeln, tritt von einem Bein auf das andere und schwitzt.
Vamos ver - wir werden sehen, das ist das erste, was ich höre. Ein junger Mann mit Menjoubärtchen tritt an mich heran.
„Grüß dich, ich bin Paul, der Basisleiter in Uige.“
(Immer stören mich diese Menjoubärte. Warum eigentlich? Mir gefällt, wie er zufasst.)
Fahrt durch die Stadt zu Ilha, zur Insel.
Hohe, moderne Häuser. Breite Straßen, irgendwo auf einem weiten Platz ein Schützenpanzerwagen mit dem angolanischen Stern am hohen Sockel. Eine Markthalle.
Die Freude über den Sieg ist von den Häuserwänden abzulesen. An Kirchen und Hotels, an den Fassaden der Geschäftsstraßen, die wir durchfahren, und an den Mauern der schmalen Seitengasse in kräftigen Ölfarben: VIVA MPLA, VIVA AGOSTINHO NETO, VIVA FAPLA.
Kinder, die uns winken, und Berge, ja Berge von verschrotteten Autos. Müllhaufen an den Straßenrändern und blitzblanke Szuzuki-Motorräder, auf denen junge Burschen an uns vorbeijagen.
Schwarze Haut und krauses Haar überall. Wie sollte es auch anders sein!
Die Ilha. Durch einen Straßendamm ist sie mit der Stadt verbunden, schließt die Bucht zum natürlichen Hafenbecken. Sieben Kilometer lang, erklärt man uns, zwischen hundert und fünfhundert Meter breit.
Übernachtung im Seglerheim, einem ehemaligen portugiesischen Jachtklub. In der Nachbarschaft das beste Ausländerhotel der Stadt, Hotel PANORAMA.
Im Hof des Seglerheims wie Schnittholz gestapelte Jollen. In der Bucht zum Hafen hin die Leiche einer Hochseejacht. Auf dem Vorplatz der Slipanlage verstreute Akten, Karteikarten der ehemaligen Klubmitglieder. Junge Leute lächeln mich von Passbildern an. Ich stochere im Papierberg, nur hellhäutige Gesichter, kein Krauskopf dabei.
Vor dem Balkon meines Zimmers der OCEANO ATLANTICO, im Rücken der Überseehafen von Luanda.
Erster Spaziergang am Strand. Eine Fischerfamilie.
Die Männer sind dabei, einen eben gefangenen Hai zu zerlegen. Sie nicken mir freundlich zu, und ich hocke mich zu ihnen in den Sand. Sie lächeln, als ich vorsichtig mit den Fingerspitzen die Zähne des Fisches berühre. Als das Gröbste geschafft ist, setzen sie sich auf den Rand des im Sand liegenden Einbaumes und rauchen. Sie reden, und die Melodie ihrer Sprache gefällt mir.
Paul am Abend zu mir: Die Fischer gehören zu den AXILUANDA, einer ethnischen Gruppe, die hier auf der Insel vor der Stadt ein mit den Traditionen sehr eng verbundenes Leben führen. Der Name der Stadt Luanda wurde von ihrem Namen Axiluanda, was in Kimbundo so viel wie Netzwerfer heißt, abgeleitet.
Abendessen im CACULA, Fisch und Reis und drei Glas Bier.
Im Seglerheim macht der Doppelkorn die Runde. Nach der dritten Lage ziehe ich mich zurück.
Blättere in meinen Aufzeichnungen, Zetteln und Notizbüchern. Am 13. Juli 1937 berichtete der Konsul des faschistischen Deutschlands aus Luanda an das Auswärtige Amt in Berlin: Dank den gemeinsamen Interessen, die Deutschland und Portugal in der Entwicklung eines neuen Gesellschaftsideals und in der Bekämpfung des Kommunismus haben, ist es mir möglich geworden, in der Frage der kommunistischen Betätigung engere Fühlung mit den hiesigen höchsten maßgebenden Stellen zu finden ...
Und der deutsche Konsul lobte die scharfe Aufmerksamkeit, die die portugiesischen Behörden der kommunistischen Gefahr in diesem Teil Afrikas schenkten, und äußerte sich anerkennend über den schnellen Zugriff der Polizei.
Fast auf den Tag genau, vierzig Jahre nach diesem Bericht des deutschen Konsuls, waren wieder Leute deutscher Zunge in Luanda.
Die da kamen, trugen das blaue Hemd und hatten Werkzeugkästen in den Händen. Vom ersten Tag an waren sie den Angolanern companheiros.
Wir sind die Ablösung dieser Männer im Blauhemd, und das ist mein erster Abend unter afrikanischem Himmel. Ich gehe hinaus.
Natürlich suche ich das Kreuz des Südens. Ich habe es nicht gefunden.
Ich zerfließe auf meinem Laken, und alle Moskitos des südlichen Afrikas scheinen sich bei mir versammelt zu haben.
Das Wissen, Chlorochin zur Malariaprophylaxe genommen zu haben, hält meinen Unmut in Grenzen.
Nach Mitternacht dann doch an die Luft auf den Balkon. Verschwitzt und zerstochen finden wir uns zusammen, Moses aus Merseburg, Lutz aus Greiz, Ossy aus Leuna, Jürgen aus Neubrandenburg. Durch die Bank Kfz-Schlosser, Spezialisten mit Schweißerpass.
Wir schwatzen und rauchen, und jemand sagt, von dort, von dort sind wir gekommen, und zeigt mit einer unsicheren Bewegung nach Norden.
28. September
Ein Tag bleibt uns für Luanda.
Von der Ilha her erkennt man es gut: Die Stadt ist in zwei Stockwerken angelegt. Die niedere Etage um die Bucht herum, mit dem Fort im Süden, dem Gebäude der Nationalbank, dem der Volksbank (ein Riese unter den Häusern, der auf seinem Haupt die Buchstaben BPA - Banco Populär de Angola - wie eine Krone trägt) und dem alles überragenden Glas-Beton-Klotz des Hotels PRESIDENTE. Nicht weit davon der Hafen.
Der kühne Schwung der Bucht vom Fort zum Überseehafen. Ausgezirkelt die Uferstraße, die Marginal, mit den Königspalmen. Das ist sie, die CIDADE BAIXA, die untere Stadt. Hier mögen wohl auch die ersten Häuser gestanden haben, als Luanda 1575 mit dem Namen Sao Paolo de Assuncao de Luanda gegründet wurde. Der natürliche Hafen und die zentrale Lage zu den beiden Königreichen Angola und Kongo mögen für die Wahl des Platzes ausschlaggebend gewesen sein.
Wir klettern mit dem Auto in die obere Stadt. Die CIDADE ALTA, eine Mischung aus mehrstöckigen Wohnhäusern und modernen Bürobauten, Hotels. Betonfassaden, und doch nicht eintönig. Villen, umgeben von üppigen Gärten. Ein Botschaftsviertel mit Blick zum Hafen. Ganz in der Nähe qualmt eine Müllkippe.
Breite Straßen führen zum Flugplatz, zu den Industriezentren Viana und Mulemba.
Unter zehn Autos entdecke ich nicht zwei gleichen Typs. Alle Fahrzeugmarken der Welt scheinen versammelt.
Auf Spruchbändern, an Säulen und Portalen - Losungen:
A LUTA CONTINUA - A VITÓRIA É CERTA Der Kampf geht weiter, der Sieg ist gewiss
PRODUZIR PARA RESISTIR Produzieren, um zu widerstehen
TRABALHADORES ANGOLANOS, UNI – VOS Werktätige Angolas, vereint Euch!
DE CABINDA AO CUNENE UM SÓ POVO UMA SÓ NACÁO Von Cabinda bis Cunene, ein Volk, eine Nation
Die überladenen Busse des Stadtverkehrs gehen mit beängstigender Krengung in die Kurven. Wenn eine Scheibe fehlt, ist es üblich, durch das Fenster ein- oder auszusteigen. An den Haltestellen die Wartenden diszipliniert in Reihen.
Shiguli-Taxis. Wer dran ist, steigt ein. Wer es sehr eilig hat, darf nach vorn. Kein Zank, kein Gekreisch um den Vorrang.
Auf dem Bürgersteig das ungewohnte Bild verkrüppelter Menschen, Kinder vor allem, Halbwüchsige. Sie bewegen sich auf Brettern, an denen Kinderwagenräder befestigt sind. Andere schleifen, Polster an den Ellenbogen, flach auf dem Boden die Beine wie Fremdkörper hinter sich her.
Die Kinderlähmung gehört hier zu den noch stark verbreiteten Krankheiten.
Bis zur Erringung der Unabhängigkeit 1975 gab es im Lande für sechs Millionen Einwohner nur vierhundertfünfzig Ärzte. Wer in der Stadt wohnte und bezahlen konnte, wurde behandelt.
In der oberen Stadt: Skelette halb fertiger Hochhäuser ragen in den Himmel. Als die Portugiesen im Herbst 1975 das Land verließen, haben sie nicht nur auf der Uferstraße Fahrzeuge, die sie nicht mit dem Schiff außer Landes bringen konnten, gegen die Königspalmen gesetzt, sie nahmen auch die Bauunterlagen für die begonnenen Häuserriesen an sich.
Nun gehen Regen und Sonne über die Gerippe. Experten aus der DDR und Kuba sind dabei, die Statik dieser Kolosse neu durchzurechnen, irgendwann muss weitergebaut werden.
Und wieder die Müllhaufen. Aufgerissene Fußwege vor vernagelten Schaufenstern. Ein großer Teil der Geschäfte ist geschlossen.
Hier geht der Winter gerade zu Ende, sagt man mir, Frühling also. Vormittags um zehn zeigt das Thermometer siebenundzwanzig Grad im Schatten. -
In Seitenstraßen Einfamilienhäuser. Auf den Balkons hängt Wäsche, und in den Vorgärten wirbeln Kinder umher. Frauen schwatzen, auf dem Bürgersteig sitzend.
Wir fahren in die Vorstadt, in die musseques, in die Slums.
In der Stadt wohnt eine Million Menschen, mehr als ein Drittel davon in den Vorstädten. Die ersten Siedler in diesen Vierteln waren entlassene oder geflüchtete Sklaven. (1836 wurde zwar der Sklavenhandel in Angola verboten und 1869 die Aufhebung der Sklaverei und die Freilassung der Sklaven im Lande verfügt, aber 1948 entdeckte man im Osten Angolas, auf dem Planalto, noch antike Formen der Sklaverei.)
Hoch thronen wir auf den Sitzbänken unseres Lastwagens, der sich langsam durch die unbefestigten, aschroten Gassen zwängt.
Ich möchte alles sehen, und doch möchte ich mich vor Scham verkriechen.
Wir besichtigen das Elend. Die Hellhäutigen gehen mit Distanz unter das Volk.
Die Jungen übertreffen sich im Eifer, alles zu fotografieren. Die winzigen Höfe mit den am Feuer sitzenden, Pfeife rauchenden Frauen; Schweine, die im Abfallhaufen wühlen, und darüber die Pepsi-Reklame; das Mädchen mit dem straffen, unbedeckten Busen über dem Wassereimer und die Fische, die auf den rostigen Wellblechdächern trocknen.
Besonders Gierige trommeln ärgerlich auf das Dach des Fahrerhauses, wenn es zu schnell weitergeht.
Die Angolaner lächeln - unverbindlich. Die Kinder klatschen und jubeln. (Wann kommt hier schon mal ein solch großes Auto vorbei?)
Manchmal ist ein altes Gesicht zu sehen. Die Alten schauen an uns vorbei.
Es ist schlimm. Beides. Die Hütten aus Blechabfällen und Lehm, der Gestank und die Fotografen auf dem safarigelben W 50.
Deutlich für jeden: Netos Revolution ist für die Leute der Wellblech- und Kanisterstadt die einzige Chance. Auch wenn es noch dauern wird.
Es gibt auf dem Auto Stimmen, die von mangelhaft entwickelter Zivilisation aus Unvermögen der Slumbewohner sprechen.
Fähigkeiten, politische Zusammenhänge herzustellen, werden sichtbar. Politisches Denken in der Konfrontation mit der Wirklichkeit muss trainiert werden.
Bisher haben unsere Jungen vor allem in Sonneberg, Halle oder Gera geübt, jetzt werden die Dimensionen ein wenig größer. Die Kontraste scheinen unvereinbar. Der qualmende Abfallkübel und daneben ein Halbwüchsiger mit einem japanischen Kofferradio. Das mit Ausschlag übersäte kleine Kind auf dem Arm der hell gekleideten Mutter. Eine zur Straße hin offene Schneiderwerkstatt, vor der Kinder spielen, deren Blöße kaum bedeckt ist. Die altersschiefe Lehmkate, vor der ein Soldat sitzt, das amerikanische Schnellfeuergewehr auf den Knien. Wir rollen an ihm vorbei, und er spuckt uns an die Reifen.
Seit dem 11. November 1975, dem Tag der Proklamation der Unabhängigkeit, sind über zweidreiviertel Jahre vergangen. Vierunddreißig Monate Freiheit stehen gegen Zustände nach fünf Jahrhunderten Portugiesenherrschaft.
Es ist still auf dem Auto während der Rückfahrt durch die Stadt.
Dieser Vormittag rüttelte uns näher zusammen.
Am Nachmittag ein erstes ausführliches Gespräch im Versammlungsraum der DDR-Botschaft. Erfrischungsgetränke werden gereicht. Freundlichkeit. Fragen und Antworten zur Arbeit. Über Land und Leute wird geredet.
Der „Leitarzt“ für unsere Basen hier im Land erhebt die Stimme. Er spricht ausführlich über den Jahrestag der DDR, der sich in dreizehn Monaten ereignen wird. Kurz auch zur Hygiene in den Tropen.
Uns Neulingen empfiehlt er eine zusätzliche Impfung. Zwei Stunden später stehen wir in seinem Behandlungszimmer. Fünf Männer fasst der Raum. Er heißt uns in einer Reihe aufstellen. Wir lassen unsere Hosen bis in Kniehöhe herunter. Hintern raus. Die Stellung ist ziemlich unbequem. (Jetzt fällt mir ein: In ungefähr dieser Pose wurde ich irgendwann in den fünfziger Jahren auf Haben oder Nichthaben von Hämorrhoiden untersucht.)
Zack, zack, zack, zack, zack. Fertig. Die nächsten fünf! Bitte! Und keiner muckt auf.
30. September
Viertel nach zehn Abfahrt vom Hotel in Richtung Uige. Vor uns etwa dreihundert Kilometer. Wir werden von einem Kommando der angolanischen Volksarmee, der FORCAS _ ARMADAS POPULARES PARA A LI BERTACAO DE ANGOLA, der FAPLA, begleitet. Ihr LKW fährt voraus. In unserem Bus nehmen hinter dem Fahrer drei Soldaten und vier auf der hintersten Sitzbank Platz. Heitere Burschen, die kräftig zulangen, als die Raucher ihre erste Runde eröffnen.
Die Wellblechdächer der Vorstadt treten zurück. Baumwollfelder bis zum Horizont. Eine Straßensperre. Unsere Marschpapiere werden geprüft. Der Soldat, der mich um eine Zigarette bittet, trägt sein Gewehr an einem Draht über der Schulter.
Graues Land. Der Frühling ist noch sehr jung.
Schnurgerade wurde das Asphaltband in die Sukkulentensavanne gerollt.
Schachtelstämmige Kakteen heben ihr fleischiges Geäst, Armen jüdischer Leuchter gleich, in den Himmel. Haushohe Wächter im flachen Dorngrasland.
Ein Affenbrotbaum tritt uns in den Weg.
Baobab - der Riese, der Urvater unter den Bäumen. Die Straße weicht ihm aus. Ich staune. Wir halten an. Acht Männer breiten ihre Arme aus. Acht mal zwei Hände legen sich auf die graue Haut des Stammes. Erst als der neunte hinzukommt, berühren sich unsere Fingerspitzen. Ich schaue in das kräftige, knorrige Geäst und lausche. Noch verstehe ich nicht die Sprache des Baumes, aber ich ahne etwas von dieser neuen geheimnisvollen Welt, in der alle Dinge Wesen sind, in der solch ein Baum von Geistern bewohnt wird und selbst das Gras Bedeutendes erzählen kann.
Camarada Mavinga, unser Busfahrer, legt mir eine der felligen Früchte dieser Riesen in die Hände. Rehbraun, Form und Größe die eines Rugbyballes.
Wir brechen sie auf. Cremefarbenes korkiges Mark unter der harten Schale. Es schmeckt säuerlich.
Das Land wölbt sich. An den lang gestreckten Steigungen jault der Motor im niedrigen Gang. Regenwald faltet sich über uns. Dämmriges Licht. Die Straße wehrt sich gegen den Ansturm von so viel sattem Grün.
Plötzlich Schüsse. Unsere Begleitung springt ins Freie. Mavinga steuert den Bus in die Deckung des Armee-LKW. Ängstliche Augen. Es stellt sich heraus, dass die anderen auch FAPLA-Soldaten sind, nur unsere uniformierten Begleiter nicht so schnell identifizieren konnten.
Es geht weiter.
Mittags Rast in einem Dorf, in Ucua. Unsere Autos werden umringt. IFA muito bom, höre ich, was soviel wie „der IFA ist gut“ heißt. (IFA, so wird hier der Lastwagen W 50 aus Ludwigsfelde genannt.) -
Abseits, am Fuß einer Mauer zusammengekauert, schläft eine Frau. Der Stofffetzen auf ihrer Schulter kann die leer getrunkenen Brüste kaum bedecken.
Die Sonne steht senkrecht über uns. Wir sind Männer ohne Schatten und stehen in Afrika herum. Jede kräftige Lebensäußerung ertrinkt im Schweiß.
Weiter durch Regenwald, durch Hohlwege. Das Rot der Erde nun doch sehr auffällig. Tropische Roterde, bedeckt mit dem Grün der Pflanzen. Nackt nur an den Einschnitten der bewaldeten Hänge, auf den von Wind und Sonne frei gebissenen Plätzen. Rot und fest und im Bunde mit Wasser ein Segen für die Menschen, deren Füße und deren Hütten sie trägt.
Und die Hütten selbst - rot. Quader, aus der Erde gewachsen. Auf dem Haupt noch das Gras. Tot nun, als Dach nicht mehr grün.
Und die Flüsse tragen das Rot ins Meer.
Wir sind in etwa tausend Meter Höhe, erklärt Paul. Und er zeigt uns die Kaffeesträucher.
Angola - einst drittgrößter Kaffeeproduzent in der Welt. (Einst, das hieß bis 1975: Fünfhundertfünfzig in europäischem Besitz befindliche Fazendas beschäftigten hundertdreißigtausend Angolaner. Hundertdreißigtausend Angolaner brachten achtzig Prozent der Gesamternte des Kaffees - für die Europäer. Die großen Gesellschaften wurden von der französischen Bank RALLET ET COMPAGNIE kontrolliert. Und die Ausfuhr des Kaffees erfolgte über die südafrikanische Gesellschaft INEX-CAFÉ.)
Wir entdecken noch Reste des Blütenschnees an den Zweigen und schon die ersten blassroten Kaffeekirschen, deren Fruchtfleisch die begehrten Bohnen umschließt.
Das hier sind ROBUSTA-Sorten, bemerkt Paul (für robuste Mägen oder robust im Verhältnis zu den sie umgebenden Bedingungen?). Arbeit in den Kaffeeplantagen ist vor allem Handarbeit. Pflanzen, pflegen, pflücken.
Mühsam das Pflücken. Die Kirschen an einem Strauch sind nie gleichzeitig reif. Die Pflückerkolonnen ziehen mit den Körben mehrmals durch die Kulturen. Eine verzögerte Ernte bringt sauren Kaffee. Dem Pflücken folgt das Trocknen auf den Sammelplätzen. Danach wird das Fruchtfleisch von der Bohne geschält. Das erledigen Maschinen.
Wir in der DDR kippen jährlich um die fünfundfünfzigtausend Tonnen Kaffee in uns hinein. Hauptlieferant: VR Angola.
Nach zwei Stunden Fahrt Aufregung unter den Soldaten. Eben haben wir das Büchsenbrot miteinander geteilt, nun legen sie alles aus den Händen.
Der Leutnant im Fahrerhaus des LKW vor uns bringt seine Waffe in Anschlag. Der Fahrer erhöht die Geschwindigkeit.
Aus dem Autoradio ein Bericht über den Dritten Kongress der angolanischen Gewerkschaft. Dazwischen europäische Musik. „Petite fleur“ und die unruhigen Augen unserer uniformierten Begleiter. Mir selbst ist die Situation nicht einerlei.
Der Regenwald wird lichter. Ein Dorf nahe der Straße, auf einem Hügel, zeigt an schlankem Mast die Fahne der MPLA-Partei der Arbeit. Rotschwarz, in der Mitte zur Hälfte auf Rot, zur Hälfte auf Schwarz blüht ein gelber fünfzackiger Stern.
Wir lachen wieder. Ich nehme einen kräftigen Schluck aus der Teeflasche.
Die letzte Rast vor Uige. Ein schmaler Bach kriecht durch ein Betonrohr auf die andere Seite der Straße. Das Wasser in der Farbe blassen Kakaos. Es ist kühl. Ein Genuss für Hände und Füße. Der Wald ist gerodet bis auf die hohen Bäume mit dichtem Geäst. Zu den Füßen der Schattenbäume als Unterholzpflanze eingemietet - Kaffeesträucher. Kaffeeanbau als extensive Sammelwirtschaft.
Siedlungen werden häufiger. Die Hütten rechteckig in ihrem Grundriss. Ohne Fenster, mit Dächern aus Gras.
Unsere kleine Kolonne fährt von der Hauptstraße hinunter. Ein Schlagbaum, ein freundlicher Soldat öffnet.
Rechts und links der Asphaltstraße Ziersträucher, Ölpalmen, Oleander. In exakten Reihen dahinter hohe Kaffeesträucher, eigentlich schon Bäume.
Asphaltierte, von kniehohen, aus behauenen Steinen errichteten Mauern umgebene Flächen in der Größe von Tennisplätzen. Ein Teil davon bedeckt mit Kaffeekirschen. Trockenplätze. Flache, bungalowähnliche Gebäude. Eine ehemalige Kaffeefarm, eine Fazenda. Drei der zu ihr gehörenden Häuser zurzeit Unterkunft der FDJ-Brigade Uige.
Im Hauptgebäude Speisesaal, Küche, ein Teil der Zimmer für uns.
Zur Linken des Hauptgebäudes ein bescheidenes Ananasfeld. Hinter dem Haus ragt ein Wald von Bananenpflanzen in die Höhe. Unter einem pilzförmigen Schattendach Bänke und roh gezimmerte Tische. An den kräftigen Mittelpfosten ein Brett genagelt. Dort eingebrannt: Magdeburg 10 000 Kilometer.
Nach Magdeburg müsste man also erst durch das Ananasfeld, dann den Hügel hinunter und weiter durch die Berge ...
Die Zimmer unseres Bungalows liegen mit den Türen nach außen. Spartanische Einrichtung. Eisenbett, Regal und Tisch aus Kistenbrettern.
Mit Klaus beziehe ich unsere Zweimannzelle. Auf den mittelgrau gestrichenen Wänden die fünffingrige Handschrift unserer Vorgänger. Ich stoße die Läden der beiden kleinen Fenster auf. Ohne Übergang ist es dunkel geworden. An der Decke baumelt eine Fünfundzwanzigwattbirne. Ihr Licht treibt die Kakerlaken in die Ecken, dafür reicht’s. Wir hocken auf den Eisenschienen unserer Bettgestelle.
Du, ich bin wirklich kein Trinker, sagt Klaus und reicht mir Doppelkorn.
Paul kommt wortlos ins Zimmer und schließt die Fensterläden. Er zeigt auf die Lampe. Ein Schwarm Moskitos flirtet mit dem Licht. Alles dicht machen. Vor allem die Fenster. Mit Handtüchern und Lappen. Die Mücken kriechen durch jede Ritze. Moskitonetze gibt es nicht.
Klaus zieht ein Päckchen Chlorochin aus der Tasche und knallt es auf den Tisch. Paul zuckt mit den Schultern und geht. Bis nach Mitternacht schrubben wir uns die Wut an den Ölwänden aus dem Leib. Die Luft ist zum Schneiden dick. Um halb eins immer noch fünfundzwanzig Grad.
1. Oktober
Wenn du die Füße des Elefanten vor dir siehst, zählt kein Alter
Sprichwort aus dem Umbundo
Sonntag. Im Speisesaal - U-förmig angeordnete Tische aus Fahrzeugplanken. Außer Reis, Fisch und Bananen zu den Hauptmahlzeiten wird es alles andere aus der Büchse geben. Die Leberwurst, die Butter, die Marmelade, das Brot.
Zu den Frühstücksbroten trinken wir Limonade. Wasser kommt erst nach zehn Uhr.
Erster Gang durch die Stadt. Uige - die Portugiesen nannten es Carmona - war aus einem Militärposten entstanden, den die Portugiesen zur Sicherung ihres Gebietes südlich des Kongos errichtet hatten. Das war 1917. In den Jahren 1948/49 ließen sich Händler in der Nachbarschaft der Militärs nieder, und erst seit 1956 spricht man von einer Stadt mit wichtigen kommerziellen Einrichtungen inmitten des nördlichen Kaffeeanbaugebietes Angolas. Fünfundvierzigtausend Leute leben in Uige.
Wenige Schritte von der Straße entfernt eine Hütte aus roten Lehmquadern mit einem Wellblechdach, daneben ein winziger Gemüsegarten. Im Schatten der Hütte, auf einer Matte, ein junges Paar. Er hat seinen Kopf in ihren Schoß gelegt, und sie liest ihm aus einem Buch vor. Ihr Haar ist zu unzähligen kleinen, borstig abstehenden Zöpfen geflochten. Als ich vorbeigehe, blickt sie lächelnd auf.
Uige, eine Stadt nach dem Ausnahmezustand. Nur wenige Geschäfte sind geöffnet. Im Zentrum moderne mehrstöckige Gebäude. Herausgerissene Türen, zerschlagene Fensterscheiben. Müll in den Hausfluren.
Im Hotel in Luanda hatte ich in einer alten Zeitung ein Foto gefunden. Das Bild zeigte den Führer der Terrororganisation FRENTE NACIONAL PARA A LIBERTACAO DE ANGOLA - der Nationalen Front zur Befreiung Angolas -, FNLA, Holden Roberto, an der Seite seiner chinesischen Berater in den Straßen der Provinzstadt Uige. Nun stehe ich neben dem Gebäude, vor dem 1975 das Foto gemacht wurde. Damals, im Herbst, unmittelbar vor der Befreiung der Stadt durch die Soldaten der MPLA.
Fünfunddreißig Grad im Schatten treiben mich aus der Stadt in den Bungalow zurück.
Hinter unserem Haus stürzte am Nachmittag ein Junge von einer Palme, lakonischer Kommentar eines Brigadisten: Mir scheint, hier ist eben ein Brikett vom Baum gefallen. Dann saß er aber auch schon im Auto und fuhr das Kerlchen ins Krankenhaus.
Am Abend unter dem Schattenpilz. Endlich eine Erklärung zu den Merkwürdigkeiten unserer Fahrt von Luanda hierher.
Die von uns befahrene Straße wird häufig von der FNLA belagert, Fahrzeuge werden geplündert und die Kraftfahrer verschleppt. Terroraktionen, die Unsicherheit verbreiten sollen und mit denen man den nationalen Wiederaufbau stören will.
Gegen Mitternacht liege ich im Bett. Nach einer halben Stunde ist das Laken nass geschwitzt. Mein Schlafdefizit vergrößert sich.
2. Oktober
Um acht beginnen wir mit der Arbeit in der Werkstatt. Domingo, der angolanische Werkstattmeister, freut sich über die vielen kräftigen brigadistas da RDA.
In der nach drei Seiten geschlossenen Reparaturhalle die Fahrzeuge, andere stehen auf dem Hof. Neben der Werkstatt, fast schon unter den Kaffeesträuchern, Wracks ausgeschlachteter Lastwagen.
Ich stelle mit den beiden Lehrlingen Alfredo und Eduardo die Bremsen eines W 50 ein.
Von zwölf bis zwei Mittagspause.
Dann endlich halb sechs - Feierabend.
Jose, unser angolanischer Karosserieklempner, nimmt mich zur Seite und zeigt mir stolz das von ihm reparierte Fahrerhaus.
Eine Arbeit, wie sie von uns niemand besser erledigen könnte. Müde und durstig steigen wir den Hügel hinauf zur Unterkunft.
Um sechs stürzt die Sonne vom Himmel. Mit der Dunkelheit kommen die Geräusche. Die Nacht scheint mir lauter als der Tag. Wir sitzen vor dem Haus. Unzufriedenheit über die fehlenden Werkzeuge, über die mangelhafte Grundausrüstung der Werkstatt. Waschpaste, Putzlappen müssen her. Gut gesagt, was bei uns als Putzlappen gilt, tragen hier unsere angolanischen Schlosserkollegen manchmal auf dem Leib.
Plötzlich strömt es vom Himmel. Ja, es ist Regenzeit.
Als der Himmel aufklart, gehe ich noch einmal vor die T ür. Es tropft von den hohen Schattenbäumen in der Kaffeeplantage. Dunstschwaden liegen über der Asphaltstraße zur Stadt. Verhalten lockt im nahen Dorf eine Trommel, von der anderen Seite des Hügels wird ihr geantwortet.
Ich bin angekommen, in Afrika, in Angola, in Uige!
4. Oktober
Meine Schreibmaschine steht auf einer hochkant gestellten Verpflegungskiste am Fenster. Blick auf das Ananasfeld und auf unseren Wirtschaftshof.
Die erste Reportage für den Rundfunk ist fertig geworden. Habe sie den Jungen vorgelesen.
Die Arbeit unserer Vorgänger kann sich sehen lassen. Gemeinsam mit den angolanischen Schlossern wurden über zweitausend Reparaturen an Fahrzeugen, stationären Motoren und Kaffeeschälmaschinen durchgeführt. Ein knappes Hundert companheiros wurde auf dem LKW 50 eingewiesen. Und wenn wir die Orangenlimonade DUSOL ohne Bezahlung bekommen, dann liegt das daran, dass die Brigadisten hier in Uige die Limonadenfabrik, die die ganze Provinz beliefert, nach Abzug der Portugiesen wieder in Gang brachten.
Am Nachmittag in der Werkstatt. Arbeit am Bremsventil und am Pressluftbehälter. Anschließend Probefahrt.
Auf der Straße außerhalb der Stadt ein Mann mit einem Hund. Ich muss wegen des Hundes bremsen. Als ich zurückkomme, hält das Herrchen das Tier an den Vorderpfoten. Den Hund schützend, dreht er der Straße den Rücken zu. Über die Schulter schaut er uns entgegen. Ich sehe, es ist ein sehr alter Mann.
Kurz vor Feierabend rollt ein W 50 mit eingedrücktem Fahrerhaus und zersplitterter Frontscheibe auf den Hof.
José geht mit dem 32-er Maulschlüssel in der erhobenen Faust auf den Kraftfahrer los.
Wir halten ihn zurück.
Man muss es ihnen erklären, dass die Autos jetzt uns gehören und dass sie kein Spielzeug sind. Man muss es ihnen erklären, und wenn sie nicht verstehen wollen, dann hiermit!
Er hält uns das schwere Werkzeug unter die Nase und fügt hinzu: Wenigstens drohen! Das ist doch erlaubt, oder?
Unser Dolmetscher redet auf José ein. Der aber lässt uns einfach stehen, schiebt die Mütze ins Genick und geht sich kopfschüttelnd den Schaden begucken.
José, dreiundzwanzig Jahre alt, Haupternährer der sechsköpfigen Familie. Der Vater ist vor drei Jahren bei den Kämpfen gegen die FNLA im Busch nahe der Stadt gefallen.
Es ist die Wahrheit, die temperamentvolle Fahrweise der motoristas, der Kraftfahrer, bringt ihnen nicht selten schlimme Blechschäden ein. Mit großem Spaß lenken die Kraftfahrer die großen Autos, in denen ihnen zur Zeit der Überseeprovinz Portugals bestenfalls der Beifahrersitz zukam. Der Bedarf an Kraftfahrern ist groß. Die VR Angola, zwölfmal so groß wie die DDR, verfügt nur über dreitausendsiebenhundertzwanzig Kilometer Eisenbahnstrecke. Das sind vier Linien, die nicht miteinander verbunden sind. Sie führen von der Küste ins Landesinnere.
Der Landtransport muss vor allem mit Kraftfahrzeugen organisiert werden. Das Land schreit nach Kadern. Wenn aber von zehn Angolanern nur zwei lesen und schreiben können, werden die, die wenigstens vier Klassen abgeschlossen haben, oft schon in leitende Funktionen eingesetzt. Ein Kraftfahrer muss jetzt noch mit weniger Bildung auskommen. Und noch ist zu wenig Zeit, um das Zusammenwirken der einzelnen Systeme des Kraftfahrzeugs jedem Kraftfahrer genau zu erklären.
Der Kaffee muss von den Fazendas in die zentralen Aufbereitungsanlagen. Maschinen, Getreide, Zement müssen von Nord nach Süd, von Ost nach West, von den Häfen in die Dörfer des Hochlandes. Wer das Fahrzeug einigermaßen sicher führen kann und die wichtigsten Gesetze des Straßenverkehrs beherrscht, bekommt sein „Papier“. Kraftfahrzeugtechnisches Wissen muss nachgeholt werden. Um dabei zu helfen, auch deshalb sind wir hier.
5. Oktober
Als die Jungen aus dem Haus sind, setze ich mich an die Schreibmaschine. Das Geklapper lockt Pedro, unseren Koch, und Enrico, seinen Gehilfen, an. Sie schauen ins Fenster, und wir versuchen ein Gespräch miteinander.
Pedro spricht neben Portugiesisch Kikongo. Das ist eine im Norden Angolas stark verbreitete Sprache, die Sprache der Bakongo.
Um die vierzehn Prozent der angolanischen Bevölkerung sprechen dieses Kikongo.
Enrico spricht Kimbundo und ist sehr stolz darauf. Die Hauptgebiete dieser Sprachgruppe liegen im nordwestlichen Mittelangola. Also in der Gegend um Uige bis hinunter nach Luanda. Rund ein Viertel der Bevölkerung spricht Kimbundo.
Zum Schwatz findet sich dann auch noch Julia ein. Sie lässt die Wäsche stehen und setzt sich zu uns. Während der Arbeit trägt sie ihren dreijährigen Bernardo auf dem Rücken. Julia ist guter Dinge, sie erzählt, dass sie im siebenten Monat schwanger ist. Wir kommen auf Geld zu sprechen. Pedro als Koch verdient im Monat fünftausend Kwanza, Enrico dreitausend und Julia zweitausend. Unsere Schlosser in der Werkstatt bekommen dreitausend Kwanza. Ein Kraftfahrer geht monatlich mit acht- bis zehntausend Kwanza nach Hause.
Nach der Mittagspause in der Werkstatt.
Kurz vor Feierabend rollt ein blauer BEDFORD auf den Hof. Mürrisch knallt der Kraftfahrer steinharten Gefrierfisch auf die Betonplatte. Dreißig Kwanza das Kilo.
Die Frauen unserer Schlosser kommen.
Zufrieden tragen sie die mit Fisch gefüllte Schüssel auf dem Kopf nach Hause.
Am Abend trifft der „Leitarzt“ aus Luanda ein.
Einweisung in die Benutzung des Schlangenbestecks. Also: Bissstelle zum Körper abbinden, Bissstelle mit dem Messer aufritzen, damit die Gewebeflüssigkeit einen Teil des Giftes ausspült, die erste der hellen Ampullen aufziehen und dicht an der Bissstelle spritzen, die zweite der hellen Ampullen aufziehen und ins Gesäß spritzen, die Kanüle stecken lassen, die Biampullen nacheinander aufziehen und ins Gesäß spritzen, die Wunde mit Sepso versorgen und verbinden, schnellstens zum Arzt. Die Chance zu überleben hängt vom Zeitpunkt der Behandlung ab. Sagt er.
Nur zwei dieser Bestecke sind an der Basis, gearbeitet aber wird an drei voneinander entfernten Orten: die Schlossergruppe, die über Land fährt, um Kaffeeschälmaschinen und stationäre Motoren in den Fazendas zu reparieren, Julia und die anderen im Hauptgebäude und wir in der Werkstatt.
Die Gefährdung durch Schlangen ist ziemlich groß. In den Bananenstauden hatte Pedro am Vormittag eine grüne Bananenschlange entdeckt. Sie kommen bis auf die warmen Steinstufen des Hauses. (An den Tagen, an denen es kein Wasser gibt, muss der weitläufige Bananenhain den Abtritt ersetzen. Bevor man sich hinhockt, wird mit einem starken Knüppel der Boden abgeklopft.)
Vor einigen Tagen wand sich eingeklemmt zwischen den Zwillingsreifen eines LKW in der Werkstatt ein beachtliches Exemplar dieser Tiere.