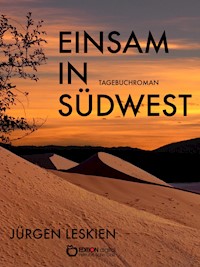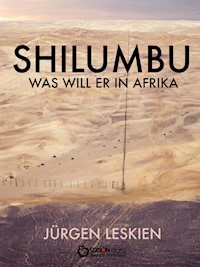6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diesen Sommerabend wird der Jagdflieger Lindner sobald nicht vergessen. Als er von seiner Freundin Inge zurückkommt, erwartet ihn sein Vorgesetzter. Nun weiß er wieder: Er hatte Befehl, die Wohnung während des Bereitschaftsdienstes nicht zu verlassen. Aber da war der beunruhigende Anruf, da war die Sorge um Inge, die verunglückt sein sollte, und er war ohne Zögern zu ihr gefahren. Lindner begreift an diesem Abend, dass er nicht nur Inges Vertrauen aufs Spiel gesetzt hat. Er schweigt, aber es fällt ihm schwer, mit einer Lüge zu leben. Als er endlich redet, ist es fast zu spät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
Jürgen Leskien
Sturz aus den Wolken
ISBN 978-3-96521-016-5 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1972 im Verlag Neues Leben Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
2020 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
1. Kapitel
Die Kleinbahn verabschiedete sich mit einem sparsamen Pfiff. Der Lokführer war ein freundlicher Mann, er winkte mir zu. Sicher stieg hier selten jemand aus.
Der Haltepunkt „Forsthaus" sah recht bescheiden aus, eben wie ein Haltepunkt. Der Zug muss halten, man kann ein- oder aussteigen. Mehr nicht. Keine hübsche Fahrkartenverkäuferin, keine Bahnhofsuhr, kein Mitropabier. Eine verwitterte Bank war der einzige Komfort. Ich nahm noch einmal den Brief aus der Tasche „… vom Bahnhof links den ausgefahrenen Waldweg entlang, 4,6 km bis zur großen Lichtung. Von da am Rand des Jagens 91 in nördlicher Richtung 1000 m bis zum alten Forsthaus. Dort sehen Sie schon unsere Zelte." Ein Soldat marschiert in einer Stunde 6 Kilometer. Da ich Urlaub hatte, nahm ich mir Zeit, zumal die Mittagssonne mich ins Schwitzen brachte. Jeder Schritt wirbelte Staub auf, der über dem Boden hängen blieb. Die Schuhe waren grau überpudert. Der Mund war trocken, auch auf den Lippen spürte ich Staub. Die anderen werden jetzt im Schwimmbad sein, die haben's gut.
Der hohe Kiefernwald duftete würzig. Ein Teil der Bäume war angezapft. Unter den gleichmäßig geschnittenen Kerben, die wie Fischgräten zusammenliefen, hingen Glastöpfe.
Nach zwanzig Minuten knöpfte ich die Uniformbluse auf und streifte die Ärmel hoch. Die Mütze hatte ich nach dem Aussteigen gleich in der Hand behalten.
Hinter mir hörte ich ein Schnaufen, ich drehte mich um und sah, dass ächzend ein Pferdefuhrwerk näher kam.
Natürlich könne ich mitfahren, meinte der Alte freundlich. Wir hatten den gleichen Weg. Ich stieg auf. Der Kutscher schnalzte, und die Pferde zogen an. Vielsagend meinte der Alte: „Zum Forsthaus also!" Er sah aus wie ein guter Großvater, der seinen Enkeln mit einem Jagdmesser aus dicker Borke Schiffchen schnitzt. Sein Gesicht war von silbergrauen Bartstoppeln übersät. Und dann die Mütze! Es war eine alte Sportmütze, eine, mit der man sich den Schweiß abwischen kann und die vor der Sonne schützt. Den Schirm hatte der Alte tief in die Stirn gezogen. Er war ein wenig speckig, jedenfalls an der Oberseite. Unter dem Schattendach des Mützenschirmes blitzten zwei flinke Augen. „Da sind hübsche Mädchen, Studentinnen, Soldat."
„Sie kennen das Zeltlager?"
Der Alte nickte.
Er dachte sicher, ich fahre zu irgendeiner Freundin, bestimmt dachte er das.
Studentinnen? Das gefiel mir, die sind im Allgemeinen geistreich, manchmal ein wenig verrückt, auf jeden Fall sind es junge Leute. Offiziersschüler Lindner, der Tag fängt gut an!
„Eine Pioniergruppe hat mich eingeladen."
Der Alte sah auf meine Mütze und beäugte die Uniformbluse.
„Kommst wohl von den Fliegern?"
Als ich nickte, meinte er, da sei ich ihm besonders sympathisch. Er klopfte mir mit seiner harten Hand auf die Schultern.
Ich bedankte mich für die Sympathieerklärung und sagte, dass manche Leute, wenn sie uns sehen, zuerst an den Lärm denken, den wir mit unseren Flugzeugen machen.
Er funkelte mich ärgerlich an. „Geschwätz! Meine Braunen heben auch den Schwanz, und was liegen bleibt, dampft, und man macht sich die Stiefel daran schmutzig. Aber guck sie dir an, wie sie ziehen!“ Er ließ die Zügel auf die Pferderücken klatschen.
Fast wäre ich rücklings in den Wagenkasten gefallen.
„Verstehst du was von Pferden?"
„Nein, höchstens von Pferdebuletten, die habe ich heimlich in Mutters Bratpfanne gebraten."
Er konnte nicht begreifen, warum ich das heimlich tun musste, denn Pferdebuletten seien doch in Ordnung, zugegeben, etwas trocken, aber das Pferd sei das sauberste Tier.
Ich erklärte ihm, dass ich die Buletten angebraten vom Pferdeschlächter holte und dass Mutter von diesem Mann und von seinen Rezepten ihre besondere Meinung hatte.
Der Alte sagte: „So", und reichte mir die Zügel.
Vom autogenen Training her kannte ich die Kutscherhaltung als eine gelöste und lockere Art zu sitzen. Ich hielt das doppelt genähte Leder fest in den Händen. Nach einer Weile war mir der rechte Arm eingeschlafen. Der Alte stopfte sich in aller Ruhe seine Tabakspfeife. Er brannte sie an, sog an ihr, dass es knisterte, und stopfte den Tabak vorsichtig mit dem rissigen Daumennagel nach. Die Pfeife hatte einen Deckel mit Löchern. Den Deckel klappte er herunter. Ein Ofen in Jackentaschenformat.
„Da hat nämlich einer von den Fliegern den Waldbrand entdeckt. Hier in der Nähe. Das muss ein kluger Bursche gewesen sein."
Ich hatte immer noch die Zügel in der Hand. Die Pferde gingen in ruhigem, gleichmäßigem Tritt.
Es waren auf den Tag genau zwei Wochen vergangen seit dem Waldbrand. Es war heiß damals, so heiß wie heute. Die Hitze flimmerte über der Betonbahn. An der Außenhaut der abgestellten Flugzeuge konnte man sich die Finger verbrennen. Während eines Streckenfluges hatte ich aus einem dunkelgrünen Waldfleck dichten Qualm steigen sehen, ganz gerade nach oben. Ich hatte die Karte zur Hand genommen und meine Beobachtung gemeldet. Fünf Tage danach war ich zum Kasernentor gerufen worden. Ein junger Mann in Försterkluft hatte mir mit ausgestrecktem Arm eine Wildente entgegengehalten. An die Pfoten war ein Zettel gebunden: „Guten Appetit. Vielen Dank nochmals!" Der Förster sagte: „Ein Gruß von unserem Alten. Heute geschossen!" Aus der Hosentasche zog er einen Briefumschlag. „Von ihm persönlich. Besuch uns mal!" Der Oberförster lobte mich, dass es fast peinlich war. Es lag auch Geld im Briefumschlag, für Bücher.
„Von ganz oben, da muss man das Feuer gut sehen. Manchmal habe ich auf dem Feuerturm Wache. Da sieht man ja alles. Natürlich nicht so gut wie ihr Flieger." Der Alte lachte, verschluckte sich und hustete.
Das ist das Rauchen, Graubart! Ich fragte, ob der Brand bald gelöscht worden sei.
„Freilich, schnell sogar. Du hast noch keinen Waldbrand gesehen? Es faucht und heult. Das Wild musst du sehen! Es ist ein Jammer. Das vom Flieger, das stand in der Zeitung."
Während der Alte sprach, fuchtelte er mit der Pfeife herum. Das konnte er sich nur mit solch einer Deckelpfeife erlauben.
Den Artikel hatten mir die Pioniere geschickt. Von der Zeitungsredaktion wussten sie meine Anschrift. Wenn ich dem Alten jetzt sagte, dass ich dieser Flieger bin, Karl-Heinz Lindner, Offiziersschüler und zukünftiger Jagdflieger! Der Alte würde mir schmunzelnd auf die Schultern klopfen und sagen: „Schon gut, mein Junge, schon gut."
Vor uns tauchte die Lichtung auf, ich wollte absteigen.
„Geduld, Soldat, ich bringe die Post zu den Zelten." Der Alte zeigte zum Wagenkasten hin. Neben Päckchen und Körben lag eine Tasche. „Jeden Tag einen Packen Briefe. Die Erzieherinnen bekommen viel Post."
Das war nicht ungewöhnlich. In den Ferien erledigt man seine Briefschulden. Und sicher hatten die Mädchen Freunde, waren vielleicht schon Ehefrauen. Was hatte ich Nora Grogmann für Briefe geschrieben! Da hatte nur noch „Du mein Lieb …' und „Herzblatt" gefehlt. Als ich sie kennenlernte, war auch Sommer. Ich verlebte einen Wochenendurlaub bei meinen Eltern. Die Kleingärtner feierten ihr Laubenfest. Nora waltete über die feinen Sachen der Laubenpiepertombola. Sie war Stenotypistin, zwei Jahre älter als ich und rabenschwarz. Sie trug ein buntes Sommerkleid mit einem gewagten Ausschnitt. Freundlich und flink nahm sie die Lose entgegen, bückte sich nach einer Klapper oder einer Zahnbürste oder stellte sich auf Zehenspitzen, um eine Flasche Wein herunterzuangeln. Viele Männer hofften, eine Zahnbürste zu gewinnen. Ich hatte schon fünf Mark investiert und verteilte an die herumstehenden Kinder Papierblumen und Seife. Am späten Abend reichte Nora mir eine Flasche Sekt herüber. Sie lächelte vielsagend, denn für die Losnummer 227 gab es eigentlich nur einen Taschenspiegel. Im Stadtpark tranken wir den Sekt, und am nächsten Tag saß ich bei der Familie Großmann am Kaffeetisch.
Herr Großmann sprach über seine Militärzeit. Dabei rauchte er starke Zigarren, deren Spitzen er abbiss und unter dem Protest seiner Frau auf den Teppich spuckte. Dann lobte er meinen Entschluss, Flieger zu werden.
„Sehr geschickt, junger Mann, sehr geschickt. Flieger werden überall gebraucht. Das ist eine Sache von Bestand. Ich habe da einen Bekannten, der ist geschäftlich mit der Lufthansa liiert." Dabei brachte er, und das war mir deutlich in Erinnerung geblieben, die Zigarre und die beringten Finger in Position. Als ich endlich zu Wort kam, entführte Nora mich in den Garten. Hier entwarf sie das Bild der Familie: Der Vater ging kegeln, war Büromensch in der Gemüsebranche, trug weiße Hemden und beschimpfte seine Frau, wenn sie zum Ersten Mai die Fahne nicht richtig gebügelt hatte. Wir gingen spazieren. Nora brachte mich ganz durcheinander und schickte mich um neun nach Hause. Ja, und dann die Briefe! Sie schrieb über Charlestonröcke, äußerte ihre Empörung über das Bananenangebot. Es war von Freundinnen die Rede, die mit ihren Freunden irgendwelche Partys veranstalteten. Das ging so bis Weihnachten. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sollte ich Nora besuchen.
Ihre Eltern waren verreist. Als ich in Noras Zimmer trat, lag sie auf der Couch. Ihre Bluse war zart und durchsichtig. Lange hatte ich auf sie gewartet. Ich nahm Nora in die Arme, küsste und streichelte sie, bis sie sagte: „Aber Karl-Heinz, beherrsche dich bitte."
In der Gaststätte fand ich einen Leidensgefährten. Wir tranken, weil es grüne Weihnachten waren, Pfefferminzlikör. Mutter machte mir am Tage danach kalte Umschläge. Seitdem verband sich der Name Nora mit der Vorstellung von Pfefferminzlikör, und wenn ich bei irgendeiner Feierstunde das giftgrüne Zeug auch nur sah, weckte es peinliche Erinnerungen.
In vier Monaten war wieder Weihnachten, und ohne den Graubart mit der Posttasche im Wagenkasten wäre ich kaum auf Nora Großmann gekommen.
Was schreibt man einer zukünftigen Lehrerin? Zum Beispiel einer zukünftigen Deutschlehrerin? Der Satzbau muss stimmen und auch die Interpunktion. Der Stil muss leicht, frei und locker sein. Leicht, frei und locker, wenn links der Duden liegt und jeder Gedanke in Haupt- und Nebensätze zerhackt werden muss. Das wäre nichts für mich. Bei mir muss sich der Stoff anhäufen, ein wenig gesetzt haben. So lange, bis die Gedanken nicht mehr zu bändigen sind, förmlich nach Papier schreien. Dann habe ich rote Ohren, so sagen die anderen, und bin nicht mehr ansprechbar. Wenn solch ein Werk einer zukünftigen Deutschlehrerin in die Hände gefallen wäre! „Mein lieber Karl-Heinz, mit der Verabredung bin ich einverstanden und freue mich auf Sonntag, aber in der Form und in der Interpunktion kommst Du auch diesmal nicht über eine Drei hinaus. Damit bleibst Du sechs Zehntel hinter deinem Vorgänger zurück. In Liebe Deine Rosemarie."
„Soldat, du schweigst und schmunzelst, erzählst dir wohl selbst Geschichten?“
„So kann man auch sagen. Wie weit ist es noch?“
Der Alte deutete mit der Hand nach vorn. Abseits vom ausgefahrenen Waldweg, auf einer Lichtung, hielten die Pferde ohne Kommando. An einem Mast hing unbeweglich die Pionierfahne. Am Rande der Lichtung, halb im Wald versteckt, lag eine Baracke in der Nachmittagshitze. Dahinter im Schatten standen die Zelte. An der Schmalseite der Lichtung konnte man hinter den Kiefern einen See erkennen.
Der Alte quälte sich vom Bock herunter. Meine Hilfe lehnte er mit einer energischen Handbewegung ab. Vom See her kam ein Mädchen, der Alte ging ihr entgegen. „Komm her, Soldat, stell dich vor!"
Das Mädchen nahm die Badekappe vom Kopf und fuhr sich mit der linken Hand flüchtig durch das kurze blonde Haar. Ihr Name sei Inge Borgmann, und „herzlich willkommen!" sagte sie.
Mir gefielen die großen blauen Augen, aufmerksame Augen. Ihre Hand war angenehm kühl. Ich glaube, ich hielt ihre Hand einen Augenblick zu lange, dann murmelte ich meinen Namen so leise, dass sie es als Unhöflichkeit auffassen musste. Wir gingen hinunter zum See. Inge zeigte mir den Steg.
Sie war tatsächlich Studentin und leitete die Gruppe, die mich eingeladen hatte. „Die Pioniere kommen erst in der Nacht zurück. Sie besuchen ein Nachbarzeltlager. Ich bin sozusagen die Diensthabende", sagte sie. Dann brachte sie mich zur Baracke, wo Frau Schneider, die Köchin, mir vom Mittagessen übrig gebliebene Bohnensuppe aufwärmte, und verschwand. Nach dem Essen ging ich wieder ans Wasser.
Solange ich auf dem Badesteg saß, und das war schon eine geschlagene Stunde, hatte sich die „Diensthabende" nicht sehen lassen. Wie sprach man sie überhaupt an? Mit „Inge" nach dem Motto „Wir sind ja alle in der FDJ" oder mit „Fräulein Borgmann"? Das klang angestaubt. Ich hätte mir gern die Zelte angesehen und mich mit Inge unterhalten. Aber Inge ließ sich nicht blicken.
Die Sonne stand tief auf der anderen Seeseite. Die Augen schmerzten, wenn man auf die ruhige Wasserfläche sah. Solch einen See hatten wir uns als Kinder immer gewünscht: So breit, dass einem bei dem Gedanken hinüberzuschwimmen bange wurde, und so klar, dass man die Stichlingsbrut beobachten kann. Der See hier schien nicht tief zu sein. Flache Seen sind warm und geeignet, schwimmen zu lernen. Man kann mit einem Bein immer noch den Grund berühren, und das ist beruhigend. Der See war so flach wie der Tümpel, in dem ich schwimmen gelernt hatte. Nur dass hier der Hals sauber blieb und drei hastige Schwimmbewegungen nicht genügten, um das andere Ufer zu erreichen.
Die Sonne ruhte noch einen Moment auf den Baumwipfeln aus. Die Schatten lagen lang auf dem Wasser, als wollten sie sich zur Nachtruhe noch einmal strecken. Auf dem Steg stand plötzlich Inge, einen Bademantel über dem Arm.
„Hier, nehmen Sie den Mantel, es ist kühl, wenn die Sonne weg ist", sagte sie.
Welch eine Sorge, aber es wäre dumm gewesen, den Mantel nicht zu nehmen.
Der Mantel war rau, und er roch nicht nach Veilchen. Es fuhr mir auch keine Haarnadel unter die Fingernägel, als ich in die Tasche griff. Inge setzte sich zu mir auf den Steg. Sie schlappte übermütig mit den Sandalen. Mich störte das Schlappen, denn ich hätte ja ins Wasser steigen müssen, wenn die Sandalen hineinfielen. Sie erzählte von der Gruppe, die sie betreute. Es waren zehn Jungen, die zwei der kleinen Zelte bewohnten, prima Burschen. Fleißig, mit Ideen, und ansonsten würde ich sie ja selbst kennenlernen. Inge fragte mich nicht nach dem Überschallknall und nicht nach dem Waldbrand, sondern wollte wissen, wie mir der erste Tag in der Armee bekommen sei. Gerade der erste! Aber ich erzählte trotzdem, wahrheitsgemäß.
Wir hatten auf der Bekleidungskammer nicht nur die Uniform empfangen, sondern auch unsere Stiefel, Socken, den Stahlhelm, schlenkrig lange Unterhosen und Unterhemden. Unterhemden, die vorn groß und schwarz mit „NVA" gekennzeichnet waren. Ich, Lindner, sollte nun diese Buchstaben vor mir hertragen. Jeder bekam eine Zeltbahn, musste sie zu einem Sack zusammenknüpfen. Darin wurde die Ausrüstung verstaut. Bis zur Unterkunft war es ein Stück zu laufen. Auf dem Schotterweg platzten die Knöpfe von meiner Zeltbahn, und alles rollte in den Staub. Ich klaubte die Sachen zusammen, schleppte den Kram auf das Zimmer. Ich musste zweimal gehen.
Der Stacheldraht der Kasernenumzäunung führte dicht an unserem Fenster vorbei. Hinter dem Zaun lag ein hässliches Stück Ödland. So hatte ich mir das alles nicht vorgestellt. Ich kam mir vor wie ein Gefangener, nicht wie ein Freiwilliger. Ich ging nicht zum Abendessen, sondern legte mich gleich ins Bett. Das war mein erster Tag bei der Armee.
Ich erzählte Inge von der Zitrone, die während eines Eilmarsches von Mann zu Mann gereicht wurde. Alle erfrischten sich, und es blieb sogar noch etwas für den Letzten und Kleinsten übrig. Inge sagte nicht, dass das unhygienisch sei, das hieß, sie konnte sich unseren Durst vorstellen. Ich erzählte Inge auch, dass ich aus eigenem Entschluss zur Armee gegangen war.
Langsam, wie die Zapfen in den Tropfsteinhöhlen mit jedem Tropfen wachsen, so war auch meine Entscheidung gewachsen.
Ich war wohl acht Jahre alt, und ich hatte mir ein herrliches Schwert geschnitzt. Im Garten schlug ich damit dem Unkraut und auch den Blumen die Köpfe ab. Der Vater sah das.
„Mit solchen Sachen spielt man nicht", sagte er. Über seinem Knie splitterte das helle Holz. Er durchsuchte mein Zimmer und fand das Buch mit der Nibelungensage. Am nächsten Tag lag auf dem Nachttisch „Tom Sawyers Abenteuer". Zwei Tage rührte ich das Buch nicht an, dann blätterte ich darin, ohne es vom Tisch zu nehmen. Am Abend las ich schon. Der Tom war ein kluger und tapferer Bursche. Ich las bis in die Nacht hinein.
Ein oder zwei Jahre danach hatte ich einen guten Geschichtslehrer. Durch ihn wusste ich, dass nicht alle Russen Russen sind und was ein Schienenwolf ist. Dieser Lehrer war es, der mich aus dem Klassenzimmer zerrte. Im schummrigen Flur öffnete er mir durch kräftigen Druck mit Daumen und Zeigefinger den Mund. Mit langen Fingern fischte er den Westkaugummi heraus. Ich hatte ihn gerade in der großen Pause gegen ein Kugellager eingetauscht. In derselben Stunde fragte ich, ob es denn gerecht sei, wenn man bei den Bauern für einen Sack Kartoffeln ein Fahrrad hingeben müsse. Ich wusste, er stammte aus einem Dorf. Ich muss sagen, dass er es fabelhaft erklärt hat. Damals hörte ich nur mit halbem Ohr hin, weil ich mit Fritz Lindemann flüsterte. Ich glaube, ich erzählte ihm, wie ich beim Ährenlesen immer in die aufgestellten Puppen kroch und dort von innen die Ähren abknipste. Durch meinen Geschichtslehrer wusste ich auch von der Hammurabi-Stele mit den zweihundertzweiundachtzig eingemeißelten Gesetzen. Der Basaltblock mit den für die Sklaven todbringenden Sonnengottgesetzen hatte lange unsere Gemüter bewegt. Fritz war mein Freund, aber als er zum Kostümfest als Sklavenhalter erschien, verprügelte ich ihn. An meinen Geschichtslehrer erinnere ich mich gern, weniger gern denke ich an den Mathelehrer Dietrich. Unaufmerksamen Schülern warf er sein Schlüsselbund zu. Herr Dietrich pflegte seinen Kaninchenstall, sein Fahrrad und seinen Holzschuppen mit riesigen Vorhängeschlössern zu sichern. Die Schlüssel dazu trug er neben den Hof-, Lehrertoiletten-, Keller- und Wohnungsschlüsseln alle an einem Schlüsselring. Die Narbe über meiner linken Augenbraue wies mich damals bei Kennern als einen mittelmäßigen Rechner aus.
Und dann erzählte ich Inge von dem Tag der Schulentlassung. Vater hatte mir erlaubt, Schnaps und Bier zu trinken. Das stand sonst unter Strafe, und ich nippte höchstens einmal vom Rest, der sich in der ausgetrunkenen Flasche auf dem Boden gesammelt hatte. Vater bot mir auch eine Zigarre an. Die Folge war, dass ich bei Sonnenuntergang im Bett lag.
Das Buch, das die Eltern mir geschenkt hatten, war groß und schwer und in grobes Leinen gebunden. Es war ein Buch mit Bildern aus dem Krieg. Flugzeuge zeigten mit ihren Schnauzen auf Flüchtlingskolonnen, tote Soldaten, deren Beine steif in den Winterhimmel ragten, lagen im Schnee.
„In solchen Flugzeugen waren unsere Motoren", sagte der Vater bei einem der Bilder. Er war blass, fuhr sich mit der Hand über die Augen, und seine Stimme zitterte. Mich fror, als ich die Bilder sah. Vater setzte sich schwer in den Stuhl. „Sieh dir jede Seite genau an", sagte er, „Krieg ist das Schlimmste, was es gibt. Junge!"
Immer wieder blätterte ich in dem Buch. Ich begann zu verstehen, warum Vater mein Schwert zerbrochen hatte.
Der Beginn der Lehre wurde zu einem ganz besonderen Ereignis. Ich wurde, so wie ich es wollte, Maschinenschlosser. Wir waren die ersten Lehrlinge in einem schönen, hellen Lehrkombinat. Stolz nähten wir uns das Abzeichen des Lehrbetriebes an die Jacken. Es störte uns nicht, dass die Mädchen über die großen, ungeschickten Stiche kicherten. Im Wohnheim gab es zweimal in der Woche Makkaroni mit Tomatensoße, an manchen Tagen Schnitzel. Schnitzel gab es selten, denn wir waren über dreihundert Lehrlinge. Über hundert Mädchen übrigens, unter ihnen auch zukünftige Maschinenschlosser.
Es muss im zweiten Lehrjahr gewesen sein, als wir einen alten Wehrmachtskübelwagen geschenkt bekamen. Wir strichen ihn blau an und malten das FDJ-Emblem an die Türen. Bei der ersten Probefahrt überholte uns das linke Hinterrad. Wir warfen uns alle auf die andere Seite, bis die Geschwindigkeit herunter war. Ich sehe noch heute den Schreck und die Angst in den Augen der anderen. Es war die erste gemeinsam erlebte Angst. Und wenn es später galt, etwas Riskantes zu unternehmen, dann sah ich uns im Kübelwagen hocken, erlebte noch einmal, wie wir ihn abbremsten, wie wir das Fahrzeug beherrschten. Das machte mich sicherer.
Das Feilen des Kreuzstrichs war ein Plage. Die Lehrausbilder sagten uns, das muss sein, die Blasen an den Händen sind etwas Normales.
Die Kreuzstrichtage gingen vorbei. Wir hatten Spaß an der eigentlichen Maschinenschlosserei, an der Bedienung der Dreh- und Fräsmaschinen und der Schweißgeräte. Hier vollbrachte Fritz auch seine Heldentat, indem er die Explosion eines Acetylenentwicklers verhinderte. Fritz Lindemann war überhaupt ein pfiffiger Bursche. Er wollte Schlosser werden wie ich. Er war fleißig wie wir alle und doch ganz anders. Er trug grüne Stiefelhosen, und seine Kunsthonigstullen transportierte er in einer Polizeimeldetasche. Fritz stimmte die Lieder an und sang, wenn nötig, die Zwischentexte. Als ich das erste Mal ein Luftgewehr wie ein Stück Aas in den Händen hielt, schnauzte er mich an: „Hab dich nicht so!"
Als er merkte, dass meine Abneigung gegen Waffen ebenso stark war wie unsere gemeinsame Antipathie gegenüber dem Kreuzstrich, nahm er sich Zeit mit mir.
Geländespiele organisierte natürlich Fritz. Er übertrieb die Sache manchmal. So ließ er uns zum Beispiel einen Schützengraben ausheben. Am Rande des Grabens wachsen jetzt Pilze mit braunen Samtkappen, und ich würde noch die Stelle wiederfinden, an der Gisela, auch ein Schlosserlehrling, mich flüchtig geküsst hat. Die Anwesenheit Giselas beim Geländespiel war überhaupt entscheidend für meine Teilnahme. Und wenn Fritz brüllte: „Vorwärts!", versuchte ich Giselas Hand zu erwischen.
Zur gleichen Zeit, fast am selben Tag, als wir die Lehre beendeten, zog Fidel Castro siegreich in Havanna ein. Vor Begeisterung hätten wir beinahe die Ausgabe der Facharbeiterzeugnisse verpasst. Man muss die verjagen, die Kriege machen. So wie Fidel sie verjagt hat. Man muss das Gewehr in Ordnung halten, denn sie werden wiederkommen wollen. Das hatten wir verstanden.
Unser Entschluss stand fest: Wir werden Soldat.
„Zur Armee wollt ihr, Jungs? Arbeitet erst einmal, dann werden wir weitersehen", sagte der Lehrmeister.
Ein paar Wochen später machte eine Karte in der Mittagspause am Segelflughang die Runde, rings um Potsdam waren Kreuze eingezeichnet. Unsere Zeitungen hatten Angriffspläne der NATO veröffentlicht. Fritz Lindemann hatte die Landeflächen für Luftlandetruppen auf die Karte übertragen. Wir wussten, was das hieß, „Luftlandetruppen".
Mit einem alten LKW fuhren wir, fünf Segelflieger, in die Kreisstadt. „Wehrkreiskommando" stand an der Tür, an die wir klopften. Es waren schon andere da. Bald waren wir miteinander bekannt, mit dem Egon, dem Holger und wie sie alle hießen. Wir wollten zu den Fliegern, am liebsten gleich morgen, natürlich, gleich morgen. Als wir vor dem schwitzenden Offizier mit den geflochtenen Schulterstücken saßen, war ich nicht mehr so sicher. Ich hatte weder mit Mutter noch mit Vater über meinen Entschluss gesprochen. Ich zögerte, als ich meinen Namen unter das Papier schrieb.
Wir redeten über Knobelbecher und Urlaubsscheine, wir waren zu fünft, die Unsicherheit schwand. Doch auf dem Weg nach Hause klopfte mir das Herz.
Es gab Kohlrabieintopf an diesem Abend. Vater löffelte ihn mit Genuss, die Fettaugen glitzerten im Licht der Küchenlampe. Ich beobachtete Vaters Bewegungen, ich hatte noch immer nichts gesagt. Ohne Einleitung platzte ich heraus: „Habe mich freiwillig zur Armee gemeldet." Vater hielt seinen Löffel für einen Moment in der Luft, patschte ihn dann in den Teller, dass die Suppe spritzte und Mutter nach dem Wischlappen lief.
„Ich möchte keine Uniform hier im Hause sehen!", sagte er leise, aber mit hochrotem Gesicht. Dann stand er auf und ging wortlos im Zimmer auf und ab …
Es kam kühl vom See herauf. Ich schlug den Kragen des Bademantels hoch und schwieg.
„Erzählen Sie weiter", bat Inge.
Für ein ganzes Jahr lang wünschte mein Vater mich nicht in der Wohnung zu sehen. Ich erschrak. Seine Haltung zum Krieg kannte ich aus nächtelangen Gesprächen. Ich hätte wissen müssen, wie ernst es ihm mit der Ablehnung alles Militärischen war. Aber ich hatte nicht erwartet, dass er mir den Stuhl vor die Tür setzen würde. Ich war völlig durcheinander. Ich lief in der Stadt umher. Bekannten ging ich aus dem Weg, aus Angst vor der Frage: „… und was sagt dein Vater?" Das Herumlaufen endete im Bahnhofsrestaurant, und ich trank mehr Bier, als ich vertrug. Dabei war mein Vater für unsere neue Ordnung. Er ging zu Versammlungen, hörte sich an, was da gesagt wurde, und las. Er las viel, und trotzdem konnte er manches nicht begreifen.
Für Außenstehende war Vater sehr zurückhaltend. Man verstand ihn, schließlich hatte er fleißig Flugmotoren für Nazibomber gebaut, sie gewissenhaft geprüft, so manchen Fehler entdeckt. Er war zu schade gewesen, obwohl eigentlich wenige zu schade gewesen waren, neben der Panzerfaust zugrunde zu gehen. Er war als hoch spezialisierter Monteur bei den Motoren geblieben. Bis zum Schluss, als einer der wenigen deutschen Fachleute unter all den verschleppten Polen, Russen, Franzosen, die an den Motoren arbeiten mussten. Das Ende war für den Vater nicht plötzlich gekommen. Es hatte sich angekündigt durch Materialmangel, Treibstoffknappheit, durch zunehmende Willkür der ihm vorgesetzten Volksgenossen, durch versteckte und offene Drohungen. Noch am zehnten April 1945 war Vater unter den an den Verankerungen zerrenden 12-Zylinder-Motor gekrochen, hatte die Befestigung geprüft, den Öldruck gewissenhaft eingestellt. Wenn er hinter die Panzerglaswand trat und die Messwerte registrierte, sahen ihm die Männer der Geheimen Staatspolizei über die Schulter.
Das Ende kam. Die Verschleppten hatten plötzlich Waffen. „Hände hoch, Artur!", rief sein bester Mann in gebrochenem Deutsch. Es war der polnische Ingenieur. Und von Vaters hoch erhobenen Händen, die gerade im Kurbelgehäuse eines defekten Motors hantierten, liefen Ölspuren in den Ärmel seines Schlosseranzuges.
Mutter war krank geworden. Zu essen gab es wenig. Fett und Zucker waren Kostbarkeiten. Da bekam Vater einen Essnapf voll Leinöl geschenkt. Der Soldat auf dem Panjewagen meinte: „Nimm, nimm!" Die Kolonne war weitergezogen.
Der Blechnapf steht heute in der Vitrine neben den Bowlegläsern. So ist der Vater.
Und nun wollte ich zur Armee. Es war unfassbar für ihn.
Ich schrieb den Eltern ausführliche Briefe. Mutter erwähnte Vater in ihren Briefen nie. Während des ersten Urlaubs besuchte ich die Mutter in der Nachtschicht am Montageband. Ihre Hände waren warm, als sie mir über das Gesicht strich, ich spürte, wie sie zitterten. Mutter war schmal geworden. Sie sah mich an, mit Mühe hielt sie die Tränen zurück. Sie fragte, ob die Wäsche und das Kuchenpaket angekommen seien. Dann erzählte sie hastig von Vater. Ich wartete darauf, dass sie sagte, ich solle nach Hause gehen, aber sie sagte es nicht. Sie hielt mich nicht zurück, als ich mich verabschiedete, fragte nicht, wohin ich gehe. Ich ging zu dem Haus, in dem wir wohnten. Ich sah von Weitem, dass die Stehlampe im Wohnzimmer brannte. Vater war also daheim. Mit dem letzten Zug fuhr ich zurück.
Zwei Monate bemühte ich mich nicht um Urlaub. Die freundlichen Briefe der Mutter übermittelten mir nur selten Grüße von Vater.
Dann hielt ich es nicht mehr aus. Ich beantragte Urlaub, fuhr nach Hause. Am Abend kam ich an. Mutter drückte mich immer wieder. Vater kam spät, ich saß schon im Schafwollpullover am Tisch.
„'n Abend, Junge", sagte er, weiter nichts. Wir spielten beide lange Schach an diesem Abend. Mutter war im Sessel eingenickt.
„Mach dem Jungen eine Wärmflasche, sein Bett wird ausgekühlt sein", sagte Vater zu ihr. Als sie aufstand, lächelte sie mir zu.
Das war nun fast zwei Jahre her.
Ich schwieg. Mir war es plötzlich peinlich, Inge das alles erzählt zu haben, ihr, einem Mädchen, das ich erst seit ein paar Stunden kannte.
Sie blies mir ein Haar von der Schulter und sagte: „Ich habe gern zugehört."
Der See war glatt. Am Schilfgürtel sprangen Fische. Die sachten Wellen pflanzten sich bis an den Steg fort. Die Fliegerei schien Inge nicht zu interessieren. Vielleicht wäre ihr einer von den rückwärtigen Diensten lieber gewesen? Einer, der sich auskannte in neuen Stoffarten: knitterarm, pflegeleicht, das Neueste aus der Retorte.
Ich fragte Inge, warum sie Lehrerin werden wolle, obwohl ich Lust hatte, sie nach dem ersten Schultag zu fragen. „Mir macht es Spaß, Kindern etwas beizubringen, als kleines Mädchen war das schon so."
Mit dem Beibringen ist das so eine Sache. Stahlverformen, dem Stahl eine Biegung oder einen Vierkant „beizubringen", ist einfach. Den Stahl kennt man, ganze Generationen haben sich mit Stahl beschäftigt. Zugegeben, wenn der Vierkant im Schmiedefeuer lag, dachte ich nicht an Atomgitter und an Kristallgefüge. Ich wusste, so um die tausend Grad muss das Stück erreichen, und das hieß: warten, bis es hellrot im Feuer wurde. Dann auf den Amboss, und mit einigen gezielten Schlägen erreichte man die gewünschte Form. Es gab kaum Überraschungen. Man konnte mit Sicherheit sagen, es macht Spaß, dem Stahl irgendwelche Formen beizubringen. Das ist erlernbar, Übungssache, Korrekturen sind leicht möglich.
Mir schien ihre Antwort zu einfach.
„Ich habe einen Freund, der ist Maurer. Er meint, es sei der schönste Beruf, helle Häuser und breite neue Straßen zu bauen. Selbst wenn das Haus noch in der Baugrube hockt, kommen die Leute und fragen: ,Sagt mal, baut ihr die neuen Verbundfenster ein?' Sie wollen einen Grundriss vom Kinderzimmer, auch wenn die Kellerfenster erst über die Erde schielen. Und dann die große Freude beim Einzug! Wieder steht ein Denkmal für Bauleute. Es passiert, dass Putz von der Fassade abfällt. Nach vier Wochen schon, und ein Stück, so groß wie ein Gartentor. Aber das kann man reparieren. Wie ist es bei Ihnen?"