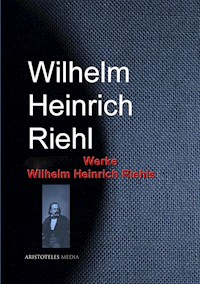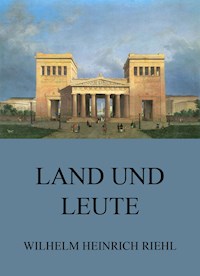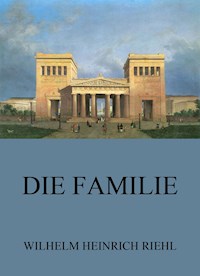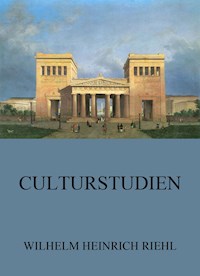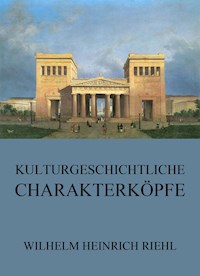Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist eine Sammlung der kulturhistorischen Novellen des deutschen Kunsthistorikers, die sich durch tausend Jahre der Geschichte ziehen. Aus dem Inhalt: Abendfrieden Liebesbuße. König Karl und Morolf Im Jahr des Herrn Das Buch des Todes Der alte Hund Die Gerechtigkeit Gottes Die Ganerben Damals wie heute Der Dachs auf Lichtmeß Der stumme Ratsherr Das Spielmannskind Die vierzehn Nothelfer Vergelt's Gott! Die zweite Bitte Die Lehrjahre eines Humanisten Mein Recht Jörg Muckenhuber Wanda Zaluska Der Fluch der Schönheit Gräfin Ursula Die Werke der Barmherzigkeit Die rechte Mutter Fürst und Kanzler Reiner Wein Die Hochschule der Demut Ungeschriebene Briefe Rheingauer Deutsch Amphion Der Leibmedikus. Ovid bei Hofe. Die Lüge der Geschichte. Demophoon von Vogel. Der Stadtpfeifer. Burg Neideck. Der Hausbau. u.v.m.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2617
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Durch tausend Jahre
Wilhelm Heinrich Riehl
Inhalt:
Wilhelm Heinrich Riehl – Biografie und Bibliografie
Durch tausend Jahre
Abendfrieden
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Älteste Zeit
Liebesbuße.
I.
II.
III.
IV.
V.
König Karl und Morolf
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Im Jahr des Herrn
Das Buch des Todes
I.
II.
III.
IV.
V.
Der alte Hund
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Romantisches Mittelalter
Die Gerechtigkeit Gottes
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
Die Ganerben
Damals wie heute
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Der Dachs auf Lichtmeß
Der stumme Ratsherr
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Das Spielmannskind
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Die vierzehn Nothelfer
Reformation und Renaissance
Vergelt's Gott!
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Die zweite Bitte
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Reformation und Renaissance
Die Lehrjahre eines Humanisten
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Mein Recht
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Jörg Muckenhuber
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Wanda Zaluska
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Zeit des 30jährigen Krieges
Der Fluch der Schönheit
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Gräfin Ursula
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Die Werke der Barmherzigkeit
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Die rechte Mutter
Rokokozeit
Fürst und Kanzler
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX
X.
XI
XII.
XIII
Reiner Wein
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Die Hochschule der Demut
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Ungeschriebene Briefe
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Rheingauer Deutsch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Amphion
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Rokokozeit
Der Leibmedikus.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Ovid bei Hofe.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Die Lüge der Geschichte.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Demophoon von Vogel.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Der Stadtpfeifer.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Burg Neideck.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Der Hausbau.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Meister Martin Hildebrand.
I. In der Herberge
II. Beim Wildhüter
III. Auf der Grenze
IV. Fastnacht
V. Hohe Flut
Revolutionszeit
Der Zopf des Herrn Guillemain.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Gespensterkampf.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Die glücklichen Freunde.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Das Quartett.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Trost um Trost.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
19. Jahrhundert
Seines Vaters Sohn
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Der verrückte Holländer
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Gradus ad Parnassum
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Der Märzminister
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Das Theaterkind
Warnung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Am Quell der Genesung
I.
II.
III.
IV.
Das verlorene Paradies
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Die Dichterprobe
Als Epilog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Der Dichter über sein Werk
Zu den »Kulturgeschichtlichen Novellen« (1856)
Zu den »Geschichten aus alter Zeit« (1863/64)
Zu den Novellen »Aus der Ecke«
Zu den Novellen »Am Feierabend« (1880)
Zu den »Lebensrätseln« (1888)
Nachwort des Herausgebers
Durch tausend Jahre, W. H. Riehl
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849633929
www.jazzybee-verlag.de
Wilhelm Heinrich Riehl – Biografie und Bibliografie
Namhafter kulturhistorischer Schriftsteller, geb. 6. Mai 1823 in Biebrich a. Rh., gest. 16. Nov. 1897 in München, studierte in Marburg, Tübingen, Bonn und Gießen, redigierte seit 1846 mit Giehne die »Karlsruher Zeitung«, begründete dann mit Christ den »Badischen Landtagsboten« und gab, nachdem er zum Mitgliede der deutschen Nationalversammlung gewählt worden, 1848 bis 1851 die konservative »Nassauische allgemeine Zeitung« heraus, während er zugleich mit der musikalischen Leitung des Hoftheaters in Wiesbaden betraut war. Nachdem er 1851–53 bei der Redaktion der Augsburger Allgemeinen Zeitung tätig gewesen, folgte er 1854 einem Ruf als Professor der Staats- und Kameralwissenschaften nach München, wo er 1859 die Professur der Literaturgeschichte übernahm und 1862 Mitglied der Akademie der Wissenschaften ward. 1885 wurde er zum Direktor des bayrischen Nationalmuseums ernannt. Er schrieb: »Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik«, in 4 Bänden: Band 1: »Land und Leute« (Stuttg. 1853, 10. Aufl. 1899), Band 2: »Die bürgerliche Gesellschaft« (1851, 9. Aufl. 1897), Band 3: »Die Familie« (1855, 12. Aufl. 1904; Band 1–3 auch in Schulausgaben von Th. Matthias, Stuttg. 1895 bis 1896), Band 4: »Wanderbuch« (1869, 4. Aufl. 1903); »Die Pfälzer« (das. 1857, 2. Aufl. 1858); »Kulturstudien aus drei Jahrhunderten« (das. 1859, 6. Aufl. 1903); »Die deutsche Arbeit« (das. 1861, 3. Aufl. 1884); »Musikalische Charakterköpfe« (das. 1853–77, 3 Bde.; Band 1 u. 2 in 8. u. 7. Aufl. 1899); »Kulturgeschichtliche Novellen« (das. 1856, 5. Aufl. 1902); »Geschichten aus alter Zeit« (das. 1863–65, 2 Bde., u. ö.); »Neues Novellenbuch« (das. 1867, 3. Aufl. 1900); »Aus der Ecke, neue Novellen« (Bielef. 1875; 4. Aufl., Stuttg. 1898); »Am Feierabend«, 6 neue Novellen (Stuttg. 1880, 4. Aufl. 1902); »Lebensrätsel«, 5 Novellen (das. 1888, 4. Aufl. 1906), die letztern 6 Werke auch gesammelt als »Geschichten und Novellen« (das. 1898–1900, 7 Bde.); »Freie Vorträge« (das. 1873, 2. Sammlung 1885); »Kulturgeschichtliche Charakterköpfe, aus der Erinnerung gezeichnet« (das. 1891, 3. Aufl. 1899); »Religiöse Studien eines Weltkindes« (das. 1894, 5. Aufl. 1900) und eine Reihe kulturgeschichtlicher Abhandlungen in den Denkschriften der Münchener Akademie und der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Auch veröffentlichte er zwei Hefte Liederkompositionen u. d. T.: »Hausmusik« (Stuttg. 1856, 2. Aufl. 1859) und »Neue Lieder für das Haus« (Leipz. 1877). Unter Riehls Leitung erschien 1859–67 die »Bavaria«, eine umfassende geographisch-ethnographische Schilderung Bayerns in 5 Bänden. 1870–79 gab er das von Raumer begründete »Historische Taschenbuch« heraus. Nach seinem Tod erschien noch sein (einziger) Roman: »Ein ganzer Mann« (Stuttg. 1897, 4. Aufl. 1898). Vgl. Simonsfeld, Wilh. Heinr. R. als Kulturhistoriker (Münch. 1898). – Seine Tochter Helene machte sich als Landschaftsmalerin bekannt.
Durch tausend Jahre
Abendfrieden
Eine Novelle als Vorrede
Erstes Kapitel.
Wir Biebricher hatten den prächtigsten Schulweg, da wir als zehnjährige Knaben das Pädagogium (die Lateinschule) zu Wiesbaden besuchten. Früh morgens halb sechs Uhr sammelten wir uns in den Gassen; wer nicht bereits marschfertig vor der Türe stand, der wurde mit dem Appell des nassauischen leichten Bataillons aus dem Hause gepfiffen, und dann stürmte die kleine Rotte lustig vom Rheine durchs Dorf und durch Mosbach über den Berg nach Wiesbaden, fast fünfviertel Stunden Wegs, in jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter.
Im Winter war's besonders schön, da brachen wir erst um halb sieben auf, traten gar manchmal die erste Spur in den frischen Schnee und fanden es weit vernünftiger, bis an den Leib durch die Schneewehen des Chausseegrabens zu waten, als mit den andern Leuten oben auf dem Fußpfad zu gehen; mein besonderer Stolz aber war dann eine kleine Laterne, welche ich im Dunkel voranleuchten und trotz Morgenrot und Sonnenaufgang bis zu den römischen Ruinen der neuen katholischen Kirche fortbrennen ließ, um, wie man sagt, dem Tage die Augen auszubrennen. Jene Kirche im Stile des Pantheon war übrigens, nebenbei bemerkt, von einem scharfen Theoretiker gebaut, welcher klar bewies, daß Fundamente ein höchst kostbarer Überfluß seien; er brachte auch den stolzen Säulenbau fast ohne alles Fundament nahezu bis ans Kreuz auf dem Dache; da hatte die Kirche eines Nachts das Unglück, zusammenzufallen.
Auf dem Rücken trugen wir kleinen Wanderbursche allesamt ein Ränzchen, unten mit Büchern gefüllt, oben mit Milchbrötchen, Äpfeln, Birnen, Nüssen, Kirschen, in der ganz schlechten Zeit aber bloß mit zwei doppelten Butterbroten – zur Aufbesserung des Mittagstisches im Wiesbadener Kosthause, welcher uns für acht Kreuzer die spartanische Blutsuppe pädagogisch veranschaulichte. Und leichteren Herzens und mit erleichtertem Tornister pilgerten wir dann um vier oder fünf Uhr abends dieselbe Straße weit langsamer wieder heim.
Kinder laufen durchs Land wie die Hunde: sie sehen und behalten unglaublich scharf das Nächste, was an und auf dem Wege liegt; für die Fernen haben sie keinen Blick. Darum bekümmerten wir uns denn auch weit weniger um die herrliche Aussicht ins Rheintal hinab als um die großen Apfelbäume an der Landstraße; die kannten wir alle und nannten sie alle mit Namen. Allein wir sahen bloß nach den Äpfeln und griffen nicht danach; denn es ging die Sage, wer bei den Äpfeln erwischt werde, der müsse nach nassauischem Feldrecht alle unersetzt gebliebenen Flurfrevel des ganzen Jahres bezahlen, und sei solchergestalt ein armer Metzgerbursche für einen einzigen Apfel um hundertzwanzig Gulden gestraft worden.
Doch nicht bloß, daß uns dieses Obst zu teuer dünkte, wir hatten überhaupt viel wichtigere Dinge zu tun, als nach Äpfeln zu werfen. Die Straße war uns morgens Lernplatz, abends Spielplatz; in der Frühe zeigte sie uns ihr Werktagsgesicht und ihr Sonntagsgesicht am Abend.
Sowie wir beim Ausmarsch früh morgens das letzte Haus von Mosbach im Rücken hatten, trat einer von uns vor und sprach laut die Versregel, welche aus Zumpts Grammatik, oder die Fabel, welche aus Wagners »Lehren der Weisheit und Tugend« für den laufenden Tag auswendig zu lernen war, und die andern sprachen's taktfest im Chore nach. Mochte uns der Märzsturm da droben auf der Höhe packen und zausen, wir schrien seinem Geheule kräftigst entgegen:
»Viele Wörter sind auf is Masculini generis«
und beschworen ihn mit »panis, piscis, crinis, cinis« wie mit einer Zauberformel; mochten die Regenwolken in ganzen Geschwadern vom Binger Loch herüberziehen und uns auf die Haut durchnässen, das galt uns alles gleich, wenn wir nur unsere »Hausaufgaben« in den Kopf trocken unter Dach brachten.
In diesen Morgenstunden war die Landstraße außer von Spatzen und Goldammern gewöhnlich nur von Leuten belebt, welche durch ihr Geschäft zur Stadt geführt wurden, oder von Bauern, welche in den Acker gingen; wir gingen auch in den Acker, aber in einen lateinischen, und wie viel stolzer war unser Schritt, der nach Zumpts, Gellerts und Pfeffels Rhythmen einherschwebte! Da zogen die Gunsenheimer Gemüsweiber an zwanzig Mann hoch zu Markte; sie hatten ihre schweren Körbe bereits im Nachen über den Rhein gefahren und in Biebrich allesamt auf einen Wagen geladen, den der Hammartin, ein hinkender Fuhrmann, mit einem lahmen Gaule führte, und liefen neben dem Wagen her und schnatterten durcheinander wie eine Gänseherde: wir aber übertönten sie weitaus, Lichtwers »Tier' und Menschen schliefen feste« im Chor sprechend. Was wußten die armen Weiber, was wußte der Hammartin von Lichtwer! Oder es kamen Biebricher Handwerker, welche in die Stadt gingen, Rohstoffe einzukaufen; wir erzählten uns, einer dem andern das Wort aus dem Munde nehmend, die Geschichte von Cyrus und Astyages, damit wir sie um zehn Uhr in der Geschichtsstunde wiedererzählen konnten. Was war diesen Schustern und Schneidern Astyages, ja was war ihnen Cyrus! Wir fühlten uns als die wahren Herren der Landstraße, und höchstens sank uns der Mut, wenn früh morgens ein Hase über den Weg sprang: da hemmten wir unsere Lichtwerschen Trochäen und gingen erschrocken dreimal drei Schritte rückwärts; denn hätten wir solchergestalt nicht den bösen Angang zunichte gemacht, so würde uns sicher Strafarbeit im Laufe des Tages geblüht haben.
Außer den Hasen vermochte nur eines noch unsere Studien zu unterbrechen: der Mainzer Schauspielerwagen. Wann der kam, dann hielten wir allemal inne und schauten auf. Es war ein großer Omnibus, schwer befrachtet mit schönen Damen und Herren, mit der ganzen Oper oder Tragödie, welche heut abend über die Wiesbadener Bretter gehen sollte; denn Mainz und Wiesbaden hatten damals gemeinsames Personal für ihre zwei stattlichen Schauspielhäuser, und die dramatische Kunst fuhr so herüber und hinüber, einen Tag um den andern, und nur im Winter beim Eisgang blieb sie so lange an einem Orte liegen, bis der Rhein entweder eisfrei oder so fest gefroren war, daß er den Thespiskarren tragen konnte. Den Mainzer Schauspielerwagen aber ignorierten wir nicht vornehm wie den Gunsenheimer Gemüsewagen; wir begrüßten ihn mit lautem Jubel und Hurra, denn warum soll die Wissenschaft die Kunst nicht begrüßen? Diese Frauenzimmer, welche so artig aus den Wagenfenstern blickten, fuhren auch zu ihrem Tagewerke, allein dasselbe war gleich dem unsrigen den Musen geweiht, und also achteten wir die Passagiere des Theaterwagens für die einzige ebenbürtige Gesellschaft, welche sich morgens mit uns auf der Straße bewegte.
Der Heimweg am Abend sah nun aber ganz anders aus; nicht nur unser Sinn und Gemüt, auch die Chaussee mit ihren Menschengestalten war völlig verwandelt. Zu jener Tageszeit ging es da ziemlich stille zu; denn im Sommer war der schattenlose Weg zu heiß, und im Winter hatte ohnedies halb Wiesbaden Feierabend. Geschäftlose, friedesuchende Menschen schlenderten vereinzelt des Weges, pensionierte Beamte auf ihrem täglichen Gange, alte Damen, die sich ohne männlichen Schutz bis zu den zwei großen Birnbäumen an der »Umkehr« wagen konnten; vielleicht ritt auch ein Reiter bedachtsam vorbei, der wegen chronischer Unterleibsleiden im fünfzigsten Jahre zum erstenmal ein Pferd bestiegen hatte. Das bunte, aufregende Gewimmel der großen Kurwelt flutete nach einer ganz anderen Seite, nach den malerischen Pfaden des Sonnenberger und Nerotales, und nicht einmal die Kuresel mit ihren feuerroten Satteldecken kamen heraus auf unsere Straße. Höchstens, daß im Winter ein einsamer Croupier dort müßig ging, der in der kalten Jahreszeit nichts zu tun und vielleicht auch nichts zu essen hatte, eine wandelnde Elegie auf die Vergänglichkeit der Sommerpracht; denn in jenen vormärzlichen Tagen war die Roulette während des Winters geschlossen, und erst das Jahr achtundvierzig brachte mit anderen Errungenschaften den Fortschritt des »Winterspieles«. Zwar rollte auch mitunter eine glänzende Equipage oder eine Extrapost ins Rheingau vorüber, allein das waren zur Stunde unseres Heimweges doch nur Ausnahmen; charakteristisch herrschten die schleichenden, stillen Feierabendgestalten und unter ihnen die Krone von allen, der Kasteler Franz, der armseligste von den damals wegen ihrer Armseligkeit weit berühmten Kasteler Einspännern: er hatte sein »neues Pferd«, an dessen Hüftknochen man den Hut aufhängen konnte, für drei Brabanter Taler auf dem letzten Hochheimer Markt gekauft, und es galt für ein Wagnis, bei ihm einzusteigen, nicht wegen des Durchgehens, sondern weil verschiedene Fahrgäste schon mit dem Boden seiner Kutsche durchgebrochen waren. Der Franz verstand keinen Spaß und hatte trotz seines Schneckenschrittes den wahren Feierabendfrieden allerdings noch nicht gefunden, und doch hätte jedes fühlende Herz wenigstens der keuchenden Mähre und dem wackeligen Marterkasten so gerne den ewigen Feierabend gegönnt.
Unter allen diesen friedlichen oder friedebedürftigen Gestalten schwärmten wir kleinen Wanderburschen nun anfangs recht wild und ruhelos umher. Auch wir fanden gleich dem Kasteler Franz den Feierabend in uns selber noch ganz und gar nicht. Die Freude über den vollendeten Schultag mußte ausgetobt sein, und da lief dann der eine vor, der andere blieb zurück, man trieb allerlei Mutwillen, neckte sich, stritt, kriegte und balgte, kurzum, beim Friedensscheine der Abendröte fehlte jene einträchtig gemütliche Kameradschaft, zu welcher uns Zumpt, Wagner und Kohlrausch doch in dem viel aufregenderen Morgenlichte unvermerkt verbündet hatten. Wir ärgerten uns, daß es des Morgens fast schöner war auf der Chaussee als am Abende, wo doch die Chaussee von Rechts wegen am allerschönsten hätte sein sollen. Aber keiner wußte den Grund von dieser verkehrten Welt.
Nun geschah es eines Tages, daß einer der Genossen den Rinaldo Rinaldini mitbrachte, welchen er von ungefähr zu Hause gefunden hatte. Der glückliche Finder begann auf dem Heimwege den Roman vorzulesen, gleichsam als Gegengewicht gegen Wagners »Lehren der Weisheit und Tugend« beim Morgengange. Allein er kam nicht weit. Wir fanden das Buch grausam langweilig, hatten bei einem Räuberromane gleich auf Seite 1 ganz andere und zwar recht haarsträubende Dinge erwartet, und der Vorleser verstummte alsbald mißmutig, weil ihm niemand mehr zuhörte. Wir waren offenbar noch nicht reif für Vulpius.
»Da könnt' ich euch ganz andere Geschichten erzählen, weit schönere!« rief ich übermütig, als Rinaldo wieder in den Ranzen seines Besitzers gewandert war. Die Kameraden staunten, freudig überrascht, und nahmen mich beim Wort; denn sie wollten heute abend nun einmal etwas »Schönes« hören, und ich besann mich auch nicht lange und begann.
Was für eine Geschichte ich darauf erzählte, das weiß ich freilich nicht mehr. Allein sie muß gefallen haben, besser als Rinaldo Rinaldini; denn ich war von nun an der ausgemachte Rhapsode unserer Schar und erzählte monatelang allabendlich auf dem Heimwege lauter selbsterfundene Geschichten, gezeugt und geboren, erdacht und vorgetragen im nämlichen Augenblicke auf der Chaussee, einzelne oft acht bis zehn deutsche Meilen lang, mit »Fortsetzung folgt« von heute auf morgen, Geschichten mit lauter Handlung, lauter Abenteuern, und auf jedes Dutzend Apfelbäume, welches wir abliefen, kam mindestens ein Szenenwechsel.
Es muß damals wunderlich genug in meinem kleinen Kopfe ausgesehen haben. Gelesen hatte ich noch gar keinen Roman, aber zerstreute Bilder und Charaktere aus dem Robinson, aus Märchen, Sagen, Reisebeschreibungen, Volksbüchern, aus den Historien des Straßburger hinkenden Boten und aus Mengeldorffs »Exempelbuch der alten Zeit« schwirrten und tanzten vor meinem inneren Gesichte, und ich verwob die bunten Bruchstücke zum seltsamsten Ganzen, schuf mir neue Helden, indem ich die alten nach Lust und Laune umbildete, und ersann mir meine eigenen langen Romane, bevor ich irgend Geduld und Ausdauer besaß, auch den kürzesten fremden Roman gedruckt zu lesen. Das ist nun gerade nicht merkwürdig, aber daß meine Kameraden die Geduld besaßen, lieber jenes tolle Zeug monatelang anzuhören, als sich im Chausseegraben zu balgen oder den Chaisen nachzulaufen, das dünkt mir heute noch ein merkwürdiges Rätsel.
So berichtete ich denn naturgetreu, als wäre ich selber dabeigewesen, von Schiffbrüchen an wüsten Inseln, von Räubern, die in Höhlen oder auf hohen Eichbäumen wohnten, von tapferen Rittern, besonders Kreuzfahrern, von eingemauerten Mönchen und Nonnen, am liebsten aber von unermeßlichen Schlachten, und immer gelangte mein Hauptheld durch unsägliche Kämpfe und Nöte zuletzt zu höchsten Ehren. Meine Geschichten führten stets in weit entlegene Zeiten oder Länder. Ahnet das Kindergemüt nicht auch bereits den verklärenden Zauber der Ferne, kraft dessen »alte Geschichten« an sich schon ein Stück unverdienter Poesie vor modernen voraushaben? Dazu spielte die Handlung womöglich durchaus im Freien (Türme, Rittersäle und Verließe abgerechnet); denn alles, was unser tägliches Leben schön und abenteuerlich schmückte, das fanden wir ja auch im Freien, nämlich zwischen den Apfelbäumen der Wiesbadener Landstraße.
Liebschaften und Frauenzimmer hielt ich für langweilig, sie kamen gar nicht vor in meinen Geschichten. Damit jedoch auch den zarteren Regungen des Herzens ihr Recht werde, lebte mein Held etwa in wahrer Bruderschaft mit seinem Pferde oder hatte einen großen Hühnerhund zum Busenfreunde oder noch besser einen gezähmten, auf den Mann dressierten Löwen, der sich ihm des Nachts im Walde in Ermangelung einer Matratze dienstwillig als weiches und sicheres Lager unterbreitete.
Indem wir nun aber so erzählend und hörend heimwärts zogen, bekam die Landstraße ein völlig neues Gesicht; sie sah ganz sonntäglich aus, obgleich es doch immer nur Werktag war. Vordem zerstreut umherschwärmend, schlossen wir uns nun zur geordneten Gruppe wie am Morgen, einträchtig, als gemütliche Kameraden; keiner blieb mehr zurück oder lief vor, keiner zerrte und neckte mehr den anderen, wir hatten Feierabend für uns und hatten Friede geschlossen mit allem, was auf der Landstraße lebte und webte. Die Spatzen auf dem Wege, die Mäuse im Graben wurden nicht mehr gescheucht und verfolgt, der Kasteler Franz nicht mehr verspottet und selbst der fünfzigjährige Gesundheitsreiter hatte jetzt Ruhe auf seinem frommen Pferde, welches wir früher durch unser Springen und Schreien öfters um ein Haar scheu gemacht hätten. Eine Geschichte hören oder erzählen, das war uns Friede und Feierabend. Die Epik ist die Poesie des Friedens, selbst wo sie uns den Trojanischen Krieg erzählt. Man denkt sich ans Herdfeuer, zu der Lampe, an den Lehnstuhl der Großmutter, wenn von dem seligen Frieden der Geschichten, Märchen und Sagen die Rede ist, aber das Herdfeuer an sich bringt doch den Frieden nicht, sondern die Geschichte bringt ihn. Kocht die Mittagssuppe auf dem Feuer, dann dünkt uns der Herd nicht so gar friedlich, wohl aber am Abende, wann die Kohlen verglühen: bei den Geschichten ahnen wir die Flamme der Leidenschaften in der stillen Glut der verglimmenden Kohle; die Geschichte hat den Frieden, weil alles bereits geschehen und vollendet ist und in der Ferne verschwebt; mag sie auf den heißesten Tag zurückblicken, sie kann es doch nur am Feierabend, oder sie verdient nicht den Namen einer Geschichte. Darum fanden wir den heimlichen Zauber des Herdfeuers und der Lampe auf der offenen Landstraße, weil wir dort mit den Geschichten den Feierabend gefunden hatten.
Und wann wir nun so mit meinen Helden unter den syrischen Palmen umherirrten oder in den Urwäldern Amerikas und in altdeutschen Eichenhainen, dann deutete wohl einer und der andere fragend auf die fernen Waldhöhen des Taunus, ob die nicht auch noch solche Urwälder hegten, oder auf den weitab im blauen Duft verschwimmenden Donnersberg, ob dort nicht auch noch eine ungeheure Wildnis sei. Oder wir spähten sehnsüchtig zu den Burgtürmen von Sonnenberg hinüber und zum Mainzer Dome, dessen Fenster im roten Abendscheine leuchteten, als seien Lichter ohne Zahl im Schiff der Kirche angezündet: wir sahen unseren Weg plötzlich umlagert von tausend weit entrückten Geheimnissen, umkränzt von schönen, seltsamen, rätselhaften Erscheinungen, während es uns bis dahin das nüchternste und selbstverständlichste Ding von der Welt gewesen, daß man auf der Wiesbadener Chaussee den Rhein und den Taunus und Mainz und Sonnenberg sieht. Indem die Geschichten geträumte Fernen uns naherückten und offenbar machten, ahnten wir zum erstenmal den Zauber der Schönheit und des Geheimnisses, welcher die wirklichen Fernen umschleierte, die uns täglich vor Augen lagen.
Da aber kam urplötzlich jener bekannte Blitz aus heiterer Luft, der so oft aus dem blauen Himmel der Bücher niederfährt, ob er gleich, wie ich glaube, am echten blauen Himmel noch gar nicht entdeckt worden ist, und schlug zerschmetternd in den Abendfrieden meiner Geschichten.
Zweites Kapitel.
Dies geschah an einem weichen, blütenduftigen Maitage. Die Sonne stand noch hoch, als wir um vier Uhr unseren Heimweg antraten. In lieblicher Pracht wogten die frisch aufsprossenden, treibenden Saatfelder zu dem breiten Silberstreifen des Rheines hinab; wir Knaben fühlten den beseelenden Frühlingsodem gleich dem anderen jungen Volk der Vögel und Mücken, welches uns umschwirrte, wir waren heute ganz besonders aufgeregt und wußten nicht warum.
Ich erzählte wieder, und auch in meiner Geschichte trieb und gärte der Frühling gleich dem Wein im Fasse, wann die Traube blüht, das heißt, ich häufte Abenteuer auf Abenteuer, ich ließ meinen Helden wie einen Halbgott einherschreiten und die erhabensten Taten vollbringen: kein Wunder, daß er auf einmal grausam ins Gedränge kam. Er ist abgeschnitten von den Seinigen, in zwanzigfacher Übermacht sitzt ihm der Feind auf dem Nacken, und vor ihm und seinem todmüden Rappen gähnt eine fünfzig Fuß breite turmtiefe Felsenkluft. Der bedrängte Ritter aber besinnt sich nicht lange, befiehlt Gott seine Seele, schließt die Augen, spornt, daß es blutet, und im Fluge setzt das Roß über die Kluft und noch ein paar Ellen weiter; die Feinde aber, welche ihm nachsprengen wollen, purzeln einer nach dem anderen in den Abgrund wie Bleisoldaten, wenn man sie mit der Hand vom Tische streicht, und unten am Boden lag ein ganzer Klumpen.
Ich verschnaufte eine Weile; der große Sprung hatte mich etwas außer Atem gesetzt.
Da rief mein Nebenmann, es sei unmöglich, daß ein todmüder Rappe über eine fünfzig Fuß breite Kluft setze; er wisse auch, wie weit Rappen springen könnten, denn sein Oheim habe einen solchen im Stall.
Ich fuhr auf – das war die erste literarische Kritik, welche ich in meinem Leben erduldete! – und entgegnete fest und ernst, so recht lehrhaft: »In den Ritterzeiten sind eben die Pferde viel stärker gewesen; das Roß des Eppelein von Gailingen hat zu Nürnberg einen noch weit größeren Satz getan als vorhin mein Rappe, des rabenschwarzen Pferdes der vier Haimonskinder gar nicht zu gedenken, und Karl der Große ist in drei Tagen von Ungarn nach Oberingelheim geritten; übrigens« – so schloß ich mit trotzig gehobener Stimme – »übrigens habe ich mir den Ritter samt dem Rappen selbst gemacht und lasse meine Ritter so viele Heiden totschlagen, als mir beliebt, und meine Rappen springen, so weit ich will!«
Die anderen begriffen meine Rede nicht; sie fragten, ob denn die fünfzig Fuß wirklich im Buche stünden. Da regte sich zum erstenmal der Autor in mir, und ich erwiderte: »Im Buche steht gar nichts, meine Geschichten stehen überhaupt in keinem Buche, sondern bloß in meinem Kopfe und sind alle miteinander hier auf der Chaussee gewachsen.«
Diese Erklärung wirkte wie ein Donnerschlag, und der Schlag entfesselte einen Sturm, eine Windsbraut. Meine Kameraden glaubten, was ich ihnen da seit Monaten erzählte, das stehe alles irgendwo gedruckt und sei folglich wahr und wirklich geschehen: nun fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen, und sie hielten sich für belogen und schändlich angeführt. Vergebens warf ich ihnen entgegen, daß ich ja niemals vorgegeben habe, gedruckte Geschichten zu erzählen, daß ich nur gesagt, ich wisse etwas »Schöneres« als den Rinaldo Rinaldini, der doch auch vielleicht nicht wahr sei, – das blieb alles in den Wind gesprochen, sie hatten keine Ahnung von dem Schöpferrecht der Phantasie und hielten Dichten und Lügen für gleichbedeutend. Der eine rief, ich dürfe niemals wieder eine Geschichte erzählen, der andere, ich müsse aber auch für die bereits erzählten einen exemplarischen Denkzettel erhalten: – »Da liegt der Denkzettel schon!« schrie der dritte und brachte ein schweres Holz herbei, das am Graben lag; den Klotz sollte ich bis Biebrich schleppen zur Strafe für meine ungedruckten Geschichten. Die anderen fielen dem Vorschlage jubelnd bei; ich protestierte, wehrte mich, es kam zum Handgemenge: – ich war auf dem Punkte, der Übermacht zu erliegen.
Da kam ein leerer vierspänniger Leiterwagen, ein herzogliches Fuhrwerk, hinter uns her gerollt; ich reiße mich los und springe dem Wagen nach, ein paar Hausknechte, die oben standen und wahrscheinlich das Abladen der Fracht in Wiesbaden besorgt hatten, sahen meine Not, winkten mir herbei, es gelang mir, mich an dem rasch dahinsausenden Wagen hinten festzuklammern, die Männer packten mich unter den Armen, zogen mich hinauf, und ehe ich noch selber recht wußte, was geschehen, stand ich oben, rückwärts gekehrt, und fuhr wie ein Triumphator vierspännig davon, indes meine Widersacher mit dem Klotze verblüfft auf der Straße standen und ihre Nachrufe im Gerassel der Ketten und Räder verhallten.
Einen Augenblick schwelgte ich in dem süßen Gefühle, welches jeder kennt, der einmal bei eben ausbrechendem Platzregen ganz unverhofft noch ins Trockene gekommen ist. Aber bald wich dieses Behagen einer anderen Stimmung. Ich trug einen neuen Kittel von naturgrauem Linnen mit schwarzlackiertem Ledergürtel und stand am Hinterrade, wider die Leiterwand des Wagens gelehnt. Da zupfte es mich ganz leise hinten am Kittel; ich schaute um und sah niemand. War das etwa die unsichtbare Hand des bösen Gewissens, welche einen so von hinten am Kittel zupft? Ich hatte der Mutter fest versprochen, auf dem Schulwege niemals einem Wagen nachzulaufen, viel weniger mich anzuhängen, ja nicht einmal auf Einladung eines Kutschers mitzufahren. – Es zupfte schon wieder, merklich stärker. Siedend heiß lief mir's über das Gesicht. Das Versprechen war besonders feierlich gewesen, ohne alle Klausel, denn die Mutter ängstigte sich sehr wegen der Fährlichkeiten der Landstraße. Bisher hatte ich aufs strengste Wort gehalten und war vorhin doch auch nur im drängenden Triebe der Rettung dem Wagen nachgesprungen, – aber mein Wort hatte ich nun doch gebrochen! – Jetzt zupfte es zum drittenmal, so derb, daß ich fast umgefallen wäre, und krach! tat's einen Riß durch meinen ganzen Kittel: ein großer Fetzen der schönen neuen Leinwand hing am Wagenrade. Das Kleid war von einem hervorstehenden Splitter der Radspeiche erfaßt worden, und ohne die feste Rücklehne der Wagenleiter würde ich wohl selber mit hinabgezogen und unters Rad gekommen sein.
Den zerrissenen Kittel sehen und denken: das ist die Sündenstrafe für das gebrochene Wort, und blind vom Wagen springen, – dies alles war die Sache eines Augenblickes.
Da lag ich dann auf der Chaussee im dicksten Staube, die Arme weit ausgestreckt, ein echter Büßer; denn bei dem jähen Sprunge war ich der Länge nach hingefallen. Vergebens baten mich die Hausknechte, wieder aufzusteigen: kein Demosthenes und kein Cicero hätte mich wieder auf den Wagen hinaufgeredet, geschweige ein Hausknecht.
Nachdem die Leute dann gesehen hatten, daß ich mich weiter nicht verletzt, fuhren sie davon; ich aber schlich einsam meine Straße und starrte bald in den Himmel, bald auf meinen zerrissenen Kittel. Es war die erste zerknirschende, bewußte Reue, welche jetzt mein kindliches Herz durchschnitt; ich war im Innersten betrübt, nicht weil ich Strafe fürchtete, sondern weil ich klar erkannte, daß ich gesündigt hatte. Da droben hinter den lichten Flockenwölkchen, die gegen den Donnersberg hinüber das endlose Blau anmutig unterbrachen, glaubte ich, sehe jetzt Gott hervor, nicht der liebe Gott, sondern der HErr GOtt, wie er mit zwei großen Anfangsbuchstaben so strenge in der Bibel gedruckt steht, und halte Gericht über mich, und von irgendeiner anderen Ecke des Himmels schaue mein unlängst verstorbener Großvater herab, den ich sehr lieb gehabt, und ärgere sich über die dummen Streiche seines Enkels.
So sind wir großen und kleinen Kinder: als ich oben auf dem Wagen stand in der Blüte meiner Sünde, dachte ich nicht, daß Gott mich sehe; erst als ich heruntergefallen war, hatte er mich augenscheinlich entdeckt.
Ich verwünschte meine schönen Geschichten, die doch allein zuletzt das Unheil herbeigerufen hatten. Der Abendfrieden des Erzählens schien mir auf immer zerrissen und verweht, und hinter jener fünfzig Fuß breiten Schlucht, über welche der unselige Gaul gesprungen war, lag ein verlorenes Paradies.
Drittes Kapitel.
Zu Hause bekannte ich sofort mein Vergehen, von welchem ja der zerrissene Kittel schon klar genug zeugte. Nur den mildernden Umstand, daß ich auf der Flucht vor beschimpfender Gewalttat dem Wagen nachgelaufen war, verschwieg ich standhaft. Daran waren wieder die verhängnisvollen Geschichten schuld. Denn hätte ich den ganzen Hergang im Zusammenhange gebeichtet, so mußte ich doch auch meiner selbstgemachten Geschichten erwähnen, und das wollte ich um keinen Preis: ich schämte mich, etwas anderes gekonnt zu haben als meine Kameraden, es war mir, als habe ich mit vieler Würde einen großen Zylinderhut getragen, während Schuljungen doch eigentlich bloßköpfig oder mit der Mütze gehen. So brachten mir die Geschichten, welche ich draußen erzählt hatte, das Unglück und die Geschichten, von welchen ich daheim schwieg, die Strafe.
Meine Eltern besaßen einen schönen Garten unterhalb Biebrich am Rheinufer, und es war uns Kindern immer ein besonderes Fest, wenn wir abends dort spielen durften und dann in dem kleinen Gartenhäuschen das gemeinsame Abendbrot verzehrten. Heute gingen alle hinaus, man hatte nur auf meine Ankunft gewartet, mich mitzunehmen, und nun mußte ich zur Strafe ganz allein daheim bleiben. Das war mir leid genug; doch in den Schmerz über die blind dareinfahrende Strafjustiz mischte sich bitterer Groll, während jene freie Buße, wie ich sie vorhin einsam in mir selber durchgerungen, unsäglich qualvoller gewesen war, aber ohne Bitterkeit.
Als die anderen fortgegangen waren, hielt es mich darum auch gar nicht lange in der Stube; ich schlüpfte vor die Tür, ich brauchte Luft, um meine wallende Empfindung auskochen und ausdampfen zu lassen, nur einen kleinen Raum zum Vertoben, so ganz in der Nähe, wie man's bei milder Deutung einem Hausarrestanten nachsehen kann.
Nun wohnten wir aber in einem Nebengebäude des Schlosses ganz nahe der Hauptauffahrt, welche aus dem Dorfe durch eine kleine Ecke des Herrengartens zu den herzoglichen Gemächern führt. Rechts von dieser Auffahrt stand eine Bank, beschattet von zwei Kastanienbäumen; dort pflegte allerlei müßiges Hofgesinde zu sitzen, Stallknechte, Frotteure, Lakaien, Haus- und Küchenmägde, und weil die Bank von jenen Leuten so besucht war als der bequemste Platz, die Aus- und Eingehenden zu beobachten und zu bekritteln, nannte man sie die »Lästerbank«.
Ich schlich um die Kastanienbäume hinter der Bank, scheu versteckt, denn da mein neuer Kittel zerrissen war, so hatte man mir ein verwachsenes und verwaschenes Kittelchen vom vorvorigen Jahre angezogen, eine Art Zwangsjacke zum Hausarrest; meine Hände aber starrten bis weit über die Knöchel aus den eng anliegenden Ärmeln, also Grund genug, zu Hause zu bleiben oder doch nur heimlich spazierenzugehen. Indem ich nun so hinter den Bäumen ganz stille meinem Groll und Kummer, Trotz und Reue nachhing und die roten Kastanienblüten, welche am Boden lagen, aufhob und zerpflückte, kam ich unvermerkt ganz nahe an die Lästerbank. Sie bot sonst Raum für viele, eben jedoch saßen nur zwei Leute dort: ein Frotteur – das ist der gefährliche Mann, welcher die Parkettböden glatt wichst und also veranlaßt, daß man bei Hofe so leicht ausgleitet und fällt, – und sein Schatz, das Eschborner Klärchen, die Küchenmagd; eine höchst korpulente Person, deren eindrucksvolle Figur mir's in späteren Jahren, als ich Goethe zu lesen begann, recht schwer machte, Egmonts Klärchen ohne Fettsucht mir vorzustellen.
Ich horchte nicht auf das Gespräch der beiden, aber plötzlich vernahm ich, wie der Frotteur sich selbst unterbrach und mit erhobener Stimme dem Klärchen zurief: »Da kommt ein Mann, den müssen wir grüßen! – aufstehen! Front machen!«
Was mochte das wohl für ein hoher Herr sein? Ich schaute auf. Durch das Portal des Gartens schritt ein fremder alter Mann, eine stattliche, aber gebeugte Gestalt, gestützt auf den Arm einer schönen jungen Dame, beide schlicht und einfach, doch fein und vornehm in Tracht und Haltung. Nur mühsam und mit dem rechten Fuße hinkend, konnte der alte Herr sich fortbewegen und hielt alle paar Schritte inne zum Ausruhen, so daß ich die Nahenden lange und scharf ins Auge zu fassen vermochte.
»Das ist der Walter Scott mit seiner Tochter«, sagte der Frotteur zum dicken Klärchen; »der Walter Scott, welcher alle die schönen Geschichten gemacht hat, den Ivanhoe und Quentin Durward; steh auf, den müssen wir grüßen!«
Ich erwachte wie aus einem Traume. So also sehen berühmte Männer aus! Denn dies war der erste Mann, der viele Bücher geschrieben, der erste so eigentlich berühmte Mann, welchen ich in meinem Leben erblickte, und ob ich gleich noch keines dieser Bücher gelesen, wußte ich doch, daß die kleinen gelben Bändchen Walter Scott, wie sie alle vierzehn Tage auf Subskription in die Häuser kamen, durch ganz Biebrich und stellenweise sogar in Mosbach von alt und jung verschlungen wurden; ja ich hatte sogar bemerkt, daß sich die Dienstboten Sonntagnachmittags zusammensetzten, um den Walter Scott zu lesen, welchen sie ihrer Herrschaft gestohlen hatten.
Ohne darum an meinen alten Kittel zu denken noch an den Frotteur und sein Klärchen, trat ich vor und stellte mich in die Reihe neben die beiden. Walter Scott kam ganz nahe an die Lästerbank. Ach, er sah so krank und müde aus, und über seinen großen Augen lag es wie ein Schleier, als ob sich die neu ergrünenden Kastanienbäume mit den roten Blütenbüschen gar nicht mehr recht hell darin spiegeln könnten! Doch als er mir gegenüberstand, blickte er auf und lächelte gar gutmütig; wie ein Lichtschimmer zuckte es über die dämmernden Augen, die schlaffen Züge bewegten sich, ja ich glaube sogar, er hat gelacht. Ich ahnte stracks weshalb und errötete bis über die Ohren; in dem verwachsenen, verwaschenen Kittel machte ich neben dem dicken Klärchen eine äußerst drollige Figur, und dazu trug ich eine abscheuliche Kappe von Roßhaarzeug, grau und weiß gesprenkelt, eine sogenannte Kümmel-und-Salz-Kappe, die hatte ich im Anstarren aufbehalten und riß sie nun ganz erschrocken vom Kopfe, als mir der berühmte Mann ins Gesicht sah. Er warf mir grüßend ein paar freundliche Worte zu, allein in meiner Scham und Bestürzung verstand ich sie nicht und blieb stumm und vergeistert, indes der Dichter lächelnd weiterschlich.
Der Frotteur erklärte mir hierauf, daß Walter Scott sich eben auf der Rückreise aus Italien befinde und daß der Herzog ihn zu Gast geladen habe. Doch den kranken Dichter, der im Süden vergebens Genesung gesucht, zog es ruhelos zur Heimat, und wer mit dem Tod um die Wette reist, daß er noch eine Stunde früher nach Hause komme, der muß selbst fürstliche Gastfreundschaft dankend ablehnen, und so hielt nur die notwendige Rast eines Nachtlagers den müden Mann in Biebrich zurück.
Nachdem mir der Frotteur also in der Kürze erläutert, wie Walter Scott so plötzlich zu uns in den Biebricher Herrengarten geraten sei, fügte er hinzu: »Diesen Engländer grüßt die ganze Dienerschaft, weil er uns schon so oft erfreut hat, mag er nun im übrigen hoffähig sein oder nicht. Als hingegen neulich der alte Baron Rothschild zur Tafel geladen war, da grüßten ihn etliche Bediente nicht, und es gab großen Skandal darüber, ja ein Küchenjunge rief dem hebräischen Baron Spottverse nach, wofür er mit Schimpf und Schande fortgejagt wurde. Das geschah ihm recht, denn so weit darf man's nicht treiben, und zuletzt stammen wir doch alle von den Juden ab.« (Weil nämlich Adam und Eva im Alten Testamente stehen, hielt der Frotteur die Ureltern des Menschengeschlechtes für Juden.) »Den Rothschild habe auch ich nicht gegrüßt, aber den Walter Scott«, so schloß er mit epischem Refrain, »grüßt die ganze Dienerschaft.«
Als der Dichter zwischen den Bäumen und Büschen verschwand, kämpfte ich unschlüssig in mir selber, was ich nun tun solle. Ich wäre ums Leben gern ganz sachte nachgeschlichen, hätte hinter den Büschen gelauscht und sah im Geiste schon, wie der Herzog aus dem Schlosse treten, den Dichter höflichst unterm Arm nehmen und in seine Gemächer führen werde, um ihm dann wenigstens die Marmorsäulen im großen Rondell und die neue Stukkaturdecke in der Galerie zu zeigen. So ungefähr dachte ich mir die Sache. Und der Mann hatte auch Geschichten erzählt wie ich, und war ihm doch nicht so schlimm dabei ergangen! Übrigens dünkte mir's fast merkwürdiger, daß die ganze Dienerschaft den Walter Scott grüße, als daß ihm der Herzog das große Rondell zeige. Denn Lakaien sind weit spröder und vornehmer gegen irreguläre Größen, welche kometenhaft durch die Sternenbahnen des Hofes fahren, als die Fürsten selber; das wußte ich als geborener Biebricher auch schon mit zehn Jahren.
Sollte ich nun nachschleichen und lauschen? Es war mir überhaupt verboten, in jenem Reviere unmittelbar vor den Türen der Herrschaft umherzustreifen, und vollends heute abend! Den Hausarrest hatte ich ohnehin schon halb gebrochen und mich gar an der Lästerbank aufgepflanzt, was mir ein für allemal untersagt war: sollte ich mir durch Ungehorsam über Ungehorsam ein zweites Strafgericht auf den Kopf ziehen, schlimmer noch als das erste? Die Reue von der Landstraße wirkte nach, das Gewissen zupfte mich wieder ganz leise, diesmal am verwachsenen Kittel und ohne Riß: ich überwand mich und ging langsamsten Schrittes nach Hause.
Aber den »großen Unbekannten« wollte und mußte ich heute abend doch noch näher ins Auge fassen und suchte sofort nach den kleinen gelben Bändchen – mit den fürchterlichen Lithographien und den zahllosen Druckfehlern; Stuttgart bei Gebrüder Franckh. Ein blinder Griff brachte mir den Guy Mannering in die Hände. Ich setzte mich in die Fensternische und las.
Gleich der Anfang gefiel mir nicht übel, denn er spielte im Freien, ganz wie meine eigenen Geschichten, und der junge Engländer, welcher bei einbrechender Nacht in den Mooren von Dumfries irrereitet, erinnerte mich genau an unsere Winterabende auf der Wiesbadener Chaussee; denn obgleich wir nicht ritten, uns nicht verirrten, auch keine Engländer waren und die Chaussee kein Moor, so war es doch in beiden Fällen dunkel. Nur ging mir die Geschichte viel zu langsam, und ich wäre beinahe, ähnlich dem Reiter in jenem Moore, völlig steckengeblieben, wenn mich's nicht immer aufs neue gereizt hätte, Worte gedruckt zu lesen, die ein Mann verfaßt, welchen ich soeben erst mit eigenen Augen gesehen hatte. Es war mir vorher nur ein einziger Mensch zu Gesicht gekommen, und zwar in einem Wirtshause in Schierstein, den ich als gedruckte Berühmtheit staunend angeschaut, das war Theodor von Haupt gewesen, welcher das Textbuch der »Stummen von Portici« und den »Hochverratsprozeß der Minister Karls X.« ins Deutsche übersetzt hat. Aber was war Theodor von Haupt gegen Walter Scott, was waren sämtliche Minister Karls X. gegen den einen Guy Mannering; was war ein Autor, welcher übersetzt und in Schierstein einkehrt, gegen einen Autor, der übersetzt wird und den der Herzog zu Gaste lädt!
Diese Gedankenkette brachte mich wieder in Zug, die Erzählung gedieh zu rascherem Flusse, sie packte mich fester und immer fester, schon schüttelte mich jenes Lesefieber, in welchem man Zeilen und Seiten nur so mit den Augen verschlingt, – – da klopfte mir mein Vater auf die Schulter, den ich samt der übrigen Familie in meiner Selbst- und Weltvergessenheit gar nicht hatte hereintreten hören.
Er fragte, wie ich denn zu diesem Buche komme. »Weil ich vorhin den Walter Scott selber gesehen habe.« Ein strafender Blick traf mich; denn der Vater, welcher von der Anwesenheit des Dichters in Biebrich nichts ahnte, hielt die unlogische Antwort für eine mutwillige Schnurre. Doch fragte er unwillkürlich: »Wo hast du ihn gesehen?« – »An der Lästerbank.« – »Und wie durftest du dich zur Lästerbank wagen?« – »Weil ich meine Strafe verdient und doch auch unverdient erhalten hatte; das konnte ich im Hause nicht zusammenreimen und bin also nur ein klein wenig vor die Tür gegangen, ob sich's draußen etwa besser reime.«
Jetzt sah ich eine gewaltige Ohrfeige heranziehen, die mir ohne Zweifel den Kopf aufräumen sollte, daß ich statt solch verworrenen und trotzigen Geredes vernünftigere Antworten gebe. Allein ich wich mit geschickter Wendung links aus und rief: »Jetzt will ich alles erzählen«, – und nun kam ich erst recht in Fluß und berichtete die Erlebnisse des ganzen Abends von Anfang an, und ob nun gelacht wurde über meine selbsterfundenen Romane oder nicht und über die kritischen Bedenken meiner Zuhörer obendrein, das war mir jetzt völlig gleich. Walter Scott hatte ja auch über mich gelacht, und doch hätte ich in diesem Augenblicke schon jenes Lachen um keinen Preis wieder hergeben mögen.
Meinen Vater ergötzte die Sache in der wunderlichen Art, wie ich sie vortrug, so sehr, daß er zuletzt selber ins Lachen kam und mir alles verzieh.
Mir war ein schwerer Stein vom Herzen genommen, ich hatte Generalbeichte getan und Generalablaß erhalten; ich fühlte wieder jenen Abendfrieden, der mir verlorengegangen war, da ich vom Leiterwagen fiel. Allein es war mir, als habe doch eigentlich schon der kranke, gebeugte Dichter, wie er mich so freundlich lächelnd anblickte und unverstandene Worte sprach, den ersten Schimmer jenes Friedens mir wiedergegeben.
Nun hätte ich gar zu gerne noch fortgelesen im Guy Mannering. Die Uhr hatte neun geschlagen, und ich mußte ins Bett. Doch ins Bett zwar kann einen die väterliche Gewalt zwingen, aber nicht zum Schlafen. Und so schwebte dann vor meinen wachen Sinnen ein seltsamer Reigentanz von allerlei Schlüssen und Folgerungen auf und nieder. Ich war versöhnt mit meinen Geschichten, die ich vor wenigen Stunden noch verwünschte; denn hätten sie mir nicht die Püffe des kritischen Handgemenges und den drohenden Klotz eingetragen und den zerrissenen neuen Kittel dazu, so würde ich ja heute abend in unseren Garten gegangen sein und den Walter Scott nicht gesehen haben; ich war auch versöhnt mit dem verwachsenen alten Kittel und der Kümmel-und-Salz-Kappe, denn beiden verdankte ich's ohne Zweifel ganz allein, daß der Verfasser des Waverley über mich gelacht und mir vermutlich einen schönen guten Abend gesagt hatte; zu alledem aber war meine Schuld gesühnt und vergeben, und die ganz regelrechte friedliche Novelle, welche ich an diesem Abend durchlebt, schloß in der denkbar friedlichsten Weise nicht mit der Heirat, sondern mit dem Einschlafen des Helden.
Als ich nach einigen Tagen mit den Kameraden wieder unsere Landstraße heimwärts zog, faßte ich im Drange meiner gehobenen Stimmung einen großherzigen Entschluß. Ich bot den Kritikern, die mich zum Klotztragen verdammt und mir alles weitere Erzählen verboten hatten, aus freien Stücken eine neue Geschichte an, und zwar eine gedruckte, und erzählte nun, da sie mir freudig zufielen, den Guy Mannering, wie ich ihn eben in den späten Abendstunden zwischendurch selber las. Und als ich nach Wochen endete, gestanden mir alle, die Geschichte sei viel schöner als meine früheren selbstgemachten samt und sonders. Das freute mich ungemein; hätten jenen meine eigenen Erfindungen besser gefallen als mein Walter Scott, so würde mich's tief verstimmt haben. Denn weit leichter ertragen wir's, daß die Welt uns selber gering ansieht, als daß sie uns einen vergötterten Freund herabsetze.
Den großen schottischen Dichter hatte ich seit jener Stunde, wo er mir in den Büschen vor dem Schlosse entschwunden war, völlig aus dem Gesicht verloren. Nach Jahr und Tag las ich im »Pfennig-Magazin« feuchten Auges, daß Walter Scott vom Rheine eilends nach London zurückgereist, daß er dort mit fürstlichen Ehren empfangen worden sei, allein wie er sich der herrlichen Natur Italiens und des Rheines entrissen hatte, so entfloh er auch der Huldigung seines Volkes in der Weltstadt, – er eilte in die stille Heimat seines geliebten Abbotsford und kam dort gerade noch recht zum Sterben. Sein Bild aber blieb mir für immer umgeben von jenem Friedenszauber des milden Maiabends im Biebricher Schloßgarten; und wie die plötzliche Erscheinung des Mannes den ersten Seelenkampf meines kindlichen Alters zum versöhnten Ausgange gewendet hatte, so ruhte mir der Geist eines Friedebringers auch fort und fort verklärend über seinen Dichtungen. Gar reiches, buntes Leben, oft derb und breit, mitunter auch ungleich und unfertig gezeichnet, gar mancher Kampf, gar manches dunkle Schicksal zieht über die Bühne seiner erdichteten Welt, allein der Abendfriede des gemütlichen Erzählers ruht doch versöhnend und heiter erhebend auf allen diesen Schöpfungen. Dies ist das Wahrzeichen des echten Epikers.
Was ich auf der Wiesbadener Landstraße begonnen, das habe ich seitdem in Büchern fortgesetzt: ich habe am Feierabend erzählt. Im ernsten Tagewerke scheue ich den Kampf nicht; in der Novelle suche ich den rein und heiter abgeschlossenen Stoff, das still anregende, nicht das wild aufregende Spiel des Lebens, und mir dünkt, eben wenn die Kämpfe des Menschenherzens vor den Sinnen des Hörers am heißesten entbrennen, dann soll er doch in Ton und Stimme des Erzählers schon die kommende Versöhnung ahnen. Andere mögen anderes in der Novelle erstreben; es sind ja auch nicht alle Novellisten von Biebrich nach Wiesbaden zur Schule gegangen. Mich hat der Heimweg am Feierabend zur Novelle geführt und der nachwirkende Eindruck, welchen der größte Erzähler der neuen Zeit meinem Kindesherzen machte, da ich ihn mit Augen sah, als er eben auch den Heimweg zum Feierabend ging und in seinen erlöschenden Zügen doch das heitere Lächeln des Humoristen noch nicht verloren hatte.
In dieser Kindergeschichte liegt der Schlüssel zum Verständnis meiner Novellen. Und wenn mich die Leute manchmal fragen, warum ich so dann und wann immer wieder »Geschichten« schreibe und unzeitgemäße alte Geschichten obendrein und nichts Gescheiteres tue, so antworte ich: weil ich des Vergnügens in Frieden zu erzählen nicht entbehren will und weil ein jeder seinen Feierabend nach seiner Weise haben darf.
Älteste Zeit
Liebesbuße.
1862
I.
In einem kleinen, nun gerade tausend Jahre alten Büchlein erzählt uns der Diakonus Gozbert:
Zur Zeit Pipins des Kleinen war Otmar Abt von St. Gallen, ein Held der Demut und Entsagung wie wenige. Stand ein Fasttag im Kalender, so machte er für sich zwei daraus und aß auch am folgenden Tage nichts, über dem Beten vergaß er oft den Schlaf und jeden Wechsel der Stunde, daß ihn die Brüder wohl des Morgens noch an demselben Platz vor dem Altare fanden, wo sie ihn am Abend verlassen hatten. Er geizte nach Armut wie andere nach Reichtum; statt nach der meisten Äbte Art auf stolzem Rosse zu reiten, bestieg er nur einen armseligen Esel. Als er einmal den König Pipin besucht und dieser ihm siebzig Pfund Silber gespendet hatte, verschenkte er fast all das Silber auf dem Heimwege, verschenkte den Esel und auch seinen Mantel dazu und kam fast nackt zu Fuß nach Hause. Nur zwei Gulden von jenem Silber hatten die begleitenden Brüder in der Reisetasche zurückzuhalten vermocht; hierfür erkaufte er ein Stück Land abseits des Klosters und baute dort ein Spital für Aussätzige. Er selber aber pflegte und wusch diese Kranken, die jedermann floh. Denn lieber hätte er andere für sich essen lassen, als daß er's anderen statt seiner überließ, den Armen zu helfen und die Kranken zu warten.
Jedes Gut gab Otmar gerne her; nur das Grund- und Stammgut des Klosters nicht. Warin und Rudhart, zwei Grafen im Thurgau und in der Baar, griffen nach allerlei Ländereien von Otmars Kloster, die ihnen besonders bequem lagen. Da zog der Abt, der alles wegschenkte, aber sich nichts nehmen ließ, noch einmal zum König Pipin und verklagte die Grafen. Der König forderte die Grafen vor und drohte ihnen mit seiner Ungnade, wenn sie den geraubten Besitz nicht zurückgäben.
Den beiden Grafen aber, damals gewaltig in ganz Alemannien, waren die fetten Güter mehr wert als des Königs Gnade, und vom Bodensee war es weit bis zu Pipins Hof. Sie behielten darum, was sie hatten, und nahmen noch den Abt dazu.
Von ihren Dienstleuten gefangen und gebunden ließen sie ihn vor die versammelten Edeln und Freien des Volkes führen und hielten Gericht über ihn. Lantpert, ein Klosterbruder von St. Gallen, trat als Kläger auf und berichtete, erkauft von den Grafen, daß Otmars Beten, Fasten und Almosengeben nur eines Heuchlers Mantel sei, unter welchem er insgeheim das üppigste und lüderlichste Leben führe. Otmar schwieg anfangs wie Christus vor dem Hohenpriester. Da man aber in ihn drang, sich zu verteidigen, sprach er: »Ich habe viele Sünden begangen, nur gerade die einzige nicht, deren man mich anklagt.«
Seine Entlastungszeugen konnte er nicht in den Ring des Gerichtes stellen, nämlich die Armen, denen er unerkannt geholfen, die Kranken, die er geheilt, die Toten, welche er begraben, und als Hauptzeugen unseren Herrgott selber, der in der verschwiegenen Zelle sein Beten und sein Geistesringen gesehen. Also schwieg er heiteren Gesichtes nach jenem Wort und ließ sich ruhig verdammen und im Dorfe Bodmann einsperren.
Dort würde er verhungert sein, hätte er vordem das Fasten nicht so gründlich gelernt, denn man gab ihm mehrere Tage weder Brot noch Wasser, bis ihm Perahtgotz, einer seiner Klosterbrüder, des Nachts heimlich Speise brachte. Später aber führten die Feinde den gefangenen Abt auf die Rheininsel bei Stein, unfern des Bodensees. Dort sah und hörte er keinen fremden Menschen mehr und vollendete den ganzen Rest seines Lebens einsam in geistiger Beschauung.
So etwa berichtet Gozbert, der Diakonus.
II.
Aber die Sage umrauscht jene Insel und flüsterte dem Erzähler ins Ohr, daß Otmar doch noch einmal fremde Menschen gesehen, von denen Gozberts altes Büchlein nichts weiß.
In stürmischer Märznacht ruderte ein Kahn vom Untersee herab. Der einzige Mann, welcher den schmalen Einbaum führte, ward nur mit Not des Windes und der Wogen Herr; eine zweite Gestalt, in einen weiten Mantel verhüllt, saß schweigend dem Fergen gegenüber. Kein Wächter hinderte, daß sie anlegten und die Insel betraten; denn Otmar war jetzt steinalt und seines Verbannungsortes so gewohnt, daß er ihn auch unbewacht nicht mehr verließ. Gebeugt, zögernd und doch gebieterisch schritt die verhüllte Gestalt voraus, deren Wuchs fast einem Manne gehören konnte, doch verriet der Gang das Weib. Als sie zur Klause kamen, winkte sie dem Fährmann, ihrem Knecht, daß er an die Türe klopfe.
Voll Staunen erschien der alte Abt. Doppelt aber wuchs sein Staunen, da er beim Licht seiner Lampe, das grell in die dunkle Nacht hinausfiel, ein stolzes, schönes Frauengesicht aus dem verhüllenden Mantel hervorglänzen sah und ein reiches Gewand, glitzernde Spangen und einen goldverzierten Gürtel. Er winkte, erschreckt zurückweichend.
Die Frau aber sprach: »Bleibe du unter der Türe, heiliger Mann, und laß mich hier im Freien stehen als eine Bittende, die nur Rat und Trost von dir begehrt.«
Otmar gewährte, was er nicht wohl weigern konnte, und die Frau begann draußen, indes ihr Gewand und Haar im Sturmwind flatterte, mit lauter, tiefer und doch weicher Stimme:
»Ich bin Hildegard, die Frau Arnulfs, des Centrichters. Ich liebe meinen Mann mit der ganzen Kraft meiner Seele und habe ihm zwei Söhne geboren. Arnulf liebte mich ebenso stark und heiß. Da nahmen wir vor einem Jahre meine jüngere Schwester Tagalint ins Haus, damit mein Gemahl sie unter seine Munt stelle und ihr einen Mann suche, denn unsere Eltern waren gestorben. Von dem Tage an aber wich Arnulfs Liebe ganz leise von mir und zog sich langsam und leis zu Tagalint. Die Schwester hat ein zahmes Reh. Sonst mochte Arnulf so zahmes Wild gar nicht ansehen; jetzt aber streichelt er das Reh, beschaut es oft viertelstundenlang und sagt, die sanfte Tagalint sehe dem zarten Tierlein gleich. Ich habe ein feuriges weißes Roß, das war vordem auch Arnulfs Freude, und besonders freute es ihn, daß niemand das Tier bändigen konnte außer mir, und er verglich des edeln Rosses Art mit der meinigen und sprengte gern an meiner Seite durch Feld und Wald. Jetzt achtet er mein Roß keines Blickes und geht lieber zu Fuß neben der schüchternen Tagalint. Die Frauen unserer Hörigen, welche unter meiner Obhut in der Halle sitzen und spinnen und weben, lächeln sich verstohlen an, wenn Arnulf am Herdfeuer nur auf Tagalint sein Auge heftet oder ihr die schönste Jagdbeute zu Füßen legt. Der Schwester einen Mann zu suchen, kommt ihm aber gar nicht in den Sinn, und wenn ich ihn mahne, meint er, das habe noch gute Weile. So heiß wie meine Liebe ist nun auch meine Qual; ich möchte vergehen vor Scham und Gram und kann doch nicht kalt sein gegen den kalten Mann, ja ich muß ihm meine Liebe immer heftiger kundgeben, je mehr er sich zur Schwester wendet, die doch nur gesenkten Auges hinnimmt, was er sagt und tut, ohne ihm je mit gleichem Wort und gleicher Miene zu begegnen.
Nun sinne ich Tag und Nacht über meine Not, und da fand ich, daß dein Los, ehrwürdiger Vater, im Grunde dem meinigen gleich sei. Der Spruch sagt: womit jemand sündiget, damit wird er auch gestraft. Du aber bist vielmehr mit deiner besten Tugend gestraft worden. Denn weil du ein so fester Abt warst, erregtest du den Zorn der Gaugrafen, und weil du so demutsvoll, fromm und mildtätig, den Neid des Bruders Lantpert, der falsch wider dich zeugte; weil du deine guten Werke vor den Menschen verbargst, wurdest du verdammt und duldest die Strafe eines Schlemmers, Heuchlers und Wüstlings, da doch niemand ehrlicher gefastet und sich kasteiet hat als du. So fliehet mich Arnulf um meiner besten Tugend willen und wird um so kälter, je heißer er meine Liebe sieht; ich muß die Strafe leiden, die ein liebloses, ungetreues Weib verdient, – und doch liebt keine ihren Mann so tief und treu wie ich. Tausend Sünden habe ich begangen ungestraft, und nur da, wo ich niemals sündigte, muß ich büßen, daß mir das Herz zerbrechen möchte.
Gangolf, der treue Knecht, der mich hierher geführt und den du einst als einen verlassenen Kranken in St. Gallen gepflegt, enthüllte mir deine wahre Geschichte und daß auch du gestraft worden seiest nicht mit deiner Sünde, sondern mit deiner besten Tugend und für dieselbe. Darum machten wir uns heimlich in dieser Sturmnacht auf, damit du mir das Rätsel deiner und meiner Buße lösest und mir Hilfe brächtest oder doch den Trost, welchen du für mich gefunden hast.«
Otmar erwiderte: »Niemand wird mit seiner Tugend gestraft. Unbemerkt steckt in unserer besten Tugend oft unsere größte Sünde, die Selbstsucht. So bin ich, obgleich der demütigste Mensch, doch gerade in meiner Demut vielleicht der hoffärtigste gewesen, nicht vor anderen, aber vor mir selbst und vor Gott, und zur Strafe für diese geheimste Hoffart ward ich ein Märtyrer der Demut. Auch in deiner Liebe mag Selbstsucht stecken, und doch ist die Liebe nur voll und rein, wenn sie alle Selbstsucht in sich verschlungen und vernichtet hat. Prüfe dich! Der Arzt heilt die Blutwunde mit einem glühenden Eisen: versuche diese Heilart an deiner Liebesqual. Du mußt deine Liebe verbergen, dann sieht sie dein Gemahl; je mehr du sie dagegen offenbar machst, je weniger wird er sie sehen. Beginne mit dem leichtesten Versuch: verbirg deine Liebe vor der Schwester, zumal in Arnulfs Gegenwart. Und hast du dies in Monatsfrist vermocht, dann komme wieder hierher und erzähle, ob dir geholfen ist.«
III.
Hildegard befolgte des Abtes Rat. Wäre sie freilich nicht ein so festes Weib gewesen bei all dem wilden Feuer, das ruhelos in ihrer Brust loderte, so würde sie schon bei diesem ersten Versuch erlegen sein. Allein sie bezwang sich.
Arnulf, von der Jagd heimgekehrt, saß des Abends am Herdfeuer, die Frau und die Schwägerin zu seiner Seite, die beiden Knaben spielten in den dunkeln Winkeln der Halle. Der müde Jäger mochte in solch traulicher Stunde gerne den Frauen lauschen, wenn sie in einer Rede, die halb Gesang, alte Verse sprachen, uralte Sagenlieder, und die Spindel schnurrte und das Feuer knisterte begleitend mit. Tagalint sang und sagte gar süß, aber auch Frau Hildegard war Meisterin in dieser Kunst. Nur fügte es sich seltsam, daß die sanfte Tagalint jetzt zumeist von Helden und Kämpfen und wilden Abenteuern sang, indes die stolze Hildegard in zarten Minnesagen den Schmerz ihrer Seele zu lösen suchte und im Bilde fernher tönender Geschichten verstohlen um die Liebe ihres eigenen Gemahles warb. Denn Frauenminne, die den Mann verehrt, lag jener harten Zeit noch eigener im Sinne als Männerminne, die den Frauen huldigend begegnet. Aber Arnulf hatte bis dahin des sanften Mädchens rauhe Sagen lieber gehört als die rührenden Kunden der stolzen, gebeugten Frau.
So erzählte Tagalint denn heute die Sage vom »Türst und der Sträggelen«, die vom Luzerner See herübergewandert war zum Bodensee. Die Sträggelenjungfrau zog zur Jagd wie ein Mann, und wenn sie mit Hörnerklang und Hundegebell des Sonntags durch den Wald fuhr, dann sprach sie wohl, sie höre jetzt auch ihre Messe. Da kam zur Weihnacht ein Jäger zu der Jungfrau, das war der böse Türst, in liebliche Gestalt verkappt, und bat das Mädchen, daß sie auch mit ihm einmal zur Jagd ziehe. Aber als sie nun zusammen den Hirsch hetzten und beim Weidwerk spotteten über das Pfaffenwerk am Christtag und die Glocken von der Kirche zum Tann herübergeklungen und verklungen waren, ließ der Türst den Hirsch laufen und faßte die Jungfrau, die er sich zum Weibe erjagt hatte, und wuchs auf zu seiner ungeheueren Riesengestalt, und die Sträggelenjungfrau und der Hund wuchsen mit ihr über alle Bäume hinaus und rasten zusammen jagend weiter durch den ganzen Tag und den Abend und die Nacht bis zum nächsten Morgen: da versanken sie mit Flammen in der Erde.
Arnulf lauschte mit brennendem Auge dem Mädchen, dessen leiser Mund so schaurig zu erzählen verstand. Da hätte Hildegard gern mit ihrem vollen, tiefen Ton eine andere Mär berichtet, welche aus noch viel älterer Zeit und viel weiterer Ferne vom Norden herübergekommen war zu den Alpen, die Märe von der edeln Frau, die über der Leiche ihres erschlagenen Mannes so heiße Tränen weinte, daß die Seele des Gefallenen im Himmel der Sehnsucht des Weibes nicht widerstehen konnte und herabkam, sie zu trösten, als die Tränen auf die kalte Brust der Leiche fielen.
Aber eingedenk der Mahnung Otmars schwieg diesmal Hildegard und spann nur im stillen Sinn ihre Märe, indes Tagalint von dem wilden »Türstengejäg« erzählte, und sowie die Spindel schnurrte und das Feuer knisterte und die Schwester so leis und schaurig sang, war es ihr, als sei auch Arnulf ein Gestorbener und ihre Tränen müßten auf seine kalte Brust fallen, daß seine Seele den Weg wieder zu ihr zurückfände und sie tröstete.
Als Tagalint geendet hatte, sah Arnulf, wie Hildegard inwendig erzitterte, und glaubte, das gelte der Sträggelenjungfrau und ihrem grausigen Ausgang. Hildegard ließ ihn bei diesem Glauben: mit ihrer alten Sage verbarg sie ihre Liebe.
So trieb sie's alle Tage. Schmückte sich Tagalint, so ging sie im schlichten Kleide; sie wollte nicht mehr wetteifern mit der Schwester. Schritt Arnulf mit Tagalint ins Gespräch versunken im Hofe auf und ab, so führte sie ihnen nicht, wie sie sonst wohl getan, die