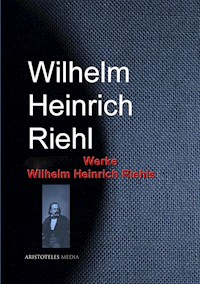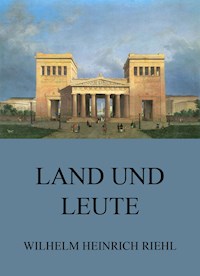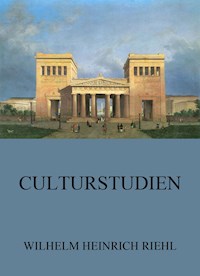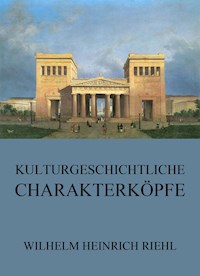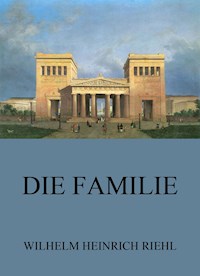
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Riehls berühmtestes Werk ist die "Naturgeschichte des deutschen Volkes als Grundlage einer deutschen Socialpolitik", in dem geographische Faktoren, soziale Verhältnisse und deutsche Kultur- und Lebensweise hervorgehoben werden. Im dritten Band, "Die Familie" (1855), analysierte er die Familie als die Basis für alle sozialen Entwicklungen und als Keimzelle der Gesellschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Familie
Wilhelm Heinrich Riehl
Inhalt:
Wilhelm Heinrich Riehl – Biografie und Bibliografie
Die Familie
Vorwort
Erstes Buch. Mann und Weib.
Erstes Kapitel. Die sociale Ungleichheit als Naturgesetz.
Zweites Kapitel. Die Scheidung der Geschlechter im Processe des Culturlebens
Drittes Kapitel. Die Emancipirung von den Frauen
Viertes Kapitel. Zur Nutzanwendung.
Zweites Buch. Haus und Familie.
Erstes Kapitel. Die Idee der Familie.
Zweites Kapitel. Das ganze Haus
Drittes Kapitel. Die Familie und die bürgerliche Baukunst.
Viertes Kapitel. Verläugnung und Bekenntniß des Hauses.
Fünftes Kapitel. Die Familie und der gesellige Kreis
Sechstes Kapitel. Zum Wiederaufbau des Hauses.
Die Familie, W. H. Riehl
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849633936
www.jazzybee-verlag.de
Wilhelm Heinrich Riehl – Biografie und Bibliografie
Namhafter kulturhistorischer Schriftsteller, geb. 6. Mai 1823 in Biebrich a. Rh., gest. 16. Nov. 1897 in München, studierte in Marburg, Tübingen, Bonn und Gießen, redigierte seit 1846 mit Giehne die »Karlsruher Zeitung«, begründete dann mit Christ den »Badischen Landtagsboten« und gab, nachdem er zum Mitgliede der deutschen Nationalversammlung gewählt worden, 1848 bis 1851 die konservative »Nassauische allgemeine Zeitung« heraus, während er zugleich mit der musikalischen Leitung des Hoftheaters in Wiesbaden betraut war. Nachdem er 1851–53 bei der Redaktion der Augsburger Allgemeinen Zeitung tätig gewesen, folgte er 1854 einem Ruf als Professor der Staats- und Kameralwissenschaften nach München, wo er 1859 die Professur der Literaturgeschichte übernahm und 1862 Mitglied der Akademie der Wissenschaften ward. 1885 wurde er zum Direktor des bayrischen Nationalmuseums ernannt. Er schrieb: »Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik«, in 4 Bänden: Band 1: »Land und Leute« (Stuttg. 1853, 10. Aufl. 1899), Band 2: »Die bürgerliche Gesellschaft« (1851, 9. Aufl. 1897), Band 3: »Die Familie« (1855, 12. Aufl. 1904; Band 1–3 auch in Schulausgaben von Th. Matthias, Stuttg. 1895 bis 1896), Band 4: »Wanderbuch« (1869, 4. Aufl. 1903); »Die Pfälzer« (das. 1857, 2. Aufl. 1858); »Kulturstudien aus drei Jahrhunderten« (das. 1859, 6. Aufl. 1903); »Die deutsche Arbeit« (das. 1861, 3. Aufl. 1884); »Musikalische Charakterköpfe« (das. 1853–77, 3 Bde.; Band 1 u. 2 in 8. u. 7. Aufl. 1899); »Kulturgeschichtliche Novellen« (das. 1856, 5. Aufl. 1902); »Geschichten aus alter Zeit« (das. 1863–65, 2 Bde., u. ö.); »Neues Novellenbuch« (das. 1867, 3. Aufl. 1900); »Aus der Ecke, neue Novellen« (Bielef. 1875; 4. Aufl., Stuttg. 1898); »Am Feierabend«, 6 neue Novellen (Stuttg. 1880, 4. Aufl. 1902); »Lebensrätsel«, 5 Novellen (das. 1888, 4. Aufl. 1906), die letztern 6 Werke auch gesammelt als »Geschichten und Novellen« (das. 1898–1900, 7 Bde.); »Freie Vorträge« (das. 1873, 2. Sammlung 1885); »Kulturgeschichtliche Charakterköpfe, aus der Erinnerung gezeichnet« (das. 1891, 3. Aufl. 1899); »Religiöse Studien eines Weltkindes« (das. 1894, 5. Aufl. 1900) und eine Reihe kulturgeschichtlicher Abhandlungen in den Denkschriften der Münchener Akademie und der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Auch veröffentlichte er zwei Hefte Liederkompositionen u. d. T.: »Hausmusik« (Stuttg. 1856, 2. Aufl. 1859) und »Neue Lieder für das Haus« (Leipz. 1877). Unter Riehls Leitung erschien 1859–67 die »Bavaria«, eine umfassende geographisch-ethnographische Schilderung Bayerns in 5 Bänden. 1870–79 gab er das von Raumer begründete »Historische Taschenbuch« heraus. Nach seinem Tod erschien noch sein (einziger) Roman: »Ein ganzer Mann« (Stuttg. 1897, 4. Aufl. 1898). Vgl. Simonsfeld, Wilh. Heinr. R. als Kulturhistoriker (Münch. 1898). – Seine Tochter Helene machte sich als Landschaftsmalerin bekannt.
Die Familie
Vorwort
Dieses Buch über die » Familie« bildet den Schlußstein meiner » Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Socialpolitik« und zwar, wie mir scheint, nicht bloß den Schlußstein als den zuletzt eingefügten, sondern auch als den eigentlich schließenden Stein, der das Gewölbe erst zusammenhält und den festen Mittelpunkt ausmacht, darin der Gegendruck aller Pfeiler und Mauern seine Stütze findet.
In »Land und Leute« legte ich die Methode meiner naturgeschichtlichen Volksstudien dar und bezeichnete zugleich in der ethnographischen Dreigliederung Deutschlands die natürliche Vorbedingung der Verschiedenheit des Volkslebens wie der socialen Standpunkte. Die »bürgerliche Gesellschaft« sucht die großen Naturgruppen des Volkes auf, welche durch Stand und Beruf, Sitte und Lebensart gegeben sind, den Staat und sein Rechtsleben noch nicht voraussetzen, dennoch aber im Staate als Stoff und Inhalt für die plastische Staatskunst berücksichtigt werden müssen. Es gibt aber noch andere, noch ursprünglichere Gruppen im Volksleben, die gleichfalls den Staat nicht voraussetzen, trotzdem aber seine höchste Beachtung heischen, und ihrerseits vom Staate vorausgesetzt werden. Diese Gruppen sind die Familien.
Die Familie ist der Urgrund aller organischen Gebilde in der Volkspersönlichkeit. Daher konnte ich in diesem Buche viele Begriffe erst wissenschaftlich entwickeln und feststellen, die in den beiden andern Bänden als gegeben vorausgesetzt sind. In dem Gegensatz von Mann und Weib z.B. läßt sich erst die sociale Ungleichheit als ein ewiges Naturgesetz im Leben der Menschheit erweisen. Der Begriff der Sitte und ihre Bedeutung für das Rechtsleben des Staates hat hier erst seine erschöpfende Darstellung gefunden. Die theoretische Scheidung und das in der Praxis unlösbare Sich-durchdringen der Gebiete des Staates, der Familie und der Gesellschaft konnte hier erst mit der rechten Klarheit erörtert werden. An dieses und anderes dachte ich, als ich oben das Bild vom »Schlußstein« gebrauchte.
Nun wird man aber fragen, warum ich denn bei den vorliegenden drei Bänden den Stiel nicht geradezu umgekehrt habe und also der inneren Logik der Sache gemäß zuerst die »Familie« geschrieben, dann die »bürgerliche Gesellschaft« und zuletzt meine Methode in »Land und Leuten« gerechtfertiget und auf die bestehenden deutschen Zustände angewandt?
Darauf habe ich zweierlei zu erwidern.
Erstlich ist das ganze Werk nicht nach einem vorgefaßten symmetrischen Plane gemacht worden, sondern es ist binnen Jahr und Tag mit dem Verfasser gewachsen. Das System lag in dem Bewußseyn des Verfassers, aber nicht um ein System darzustellen, schrieb er die drei Bücher, sondern um Thatsachen, in denen sein System verborgen steckt, reden zu lassen für die Art der politischen Forschung und Erkenntniß, welche nun einmal mit seiner ganzen Persönlichkeit unauflösbar verwoben ist. So bearbeitete er also die drei großen Stoffe in der Reihenfolge, wie sie ihm durch das persönliche Bedürfniß, sich dieser Dinge quitt zu machen, eingegeben ward, nicht nach einem vorgefaßten systematischen Gesammtplane.
Zum Andern meint er aber, es sey dennoch gut, daß er gerade diese, scheinbar verkehrte, Reihenfolge gewählt. Und in der That, wenn ich jetzt, wo die Resultate dieser fünfjährigen Arbeit schwarz auf weiß und übersichtlich vor mir liegen, noch einmal das Ganze zu schaffen und neu zu ordnen hätte, würde ich eben die Bände doch gerade so folgen lassen, wie sie gegenwärtig vorliegen. Es scheint mir nämlich, ein richtiger Instinkt habe mich geleitet, in der Reihenfolge der Stoffe genau denselben Weg einzuschlagen, der meine ganze Methode der politischen Forschung und Darstellung charakterisirt. Ich gehe von der Anschauung des Besondern aus, um durch Vergleichung und Schluß von da den Weg zum Allgemeinen zu finden. Nach derselben Logik folgen sich die drei Bände dieser Naturgeschichte des Volkes. »Land und Leute« enthält die individuellsten Untersuchungen, wie ich sie in einzelnen Gauen unsers Vaterlandes, bei ganz bestimmten Stammespersönlichkeiten angestellt habe. Die »bürgerliche Gesellschaft« geht schon zum Allgemeineren über; sie sucht aus den örtlichen Anschauungen zu schließen auf die einheitlichen Grundlagen der großen socialen Volksgruppen der ganzen deutschen Nation. Die »Familie« endlich behandelt die universellste aller Gliederungen der Volkspersönlichkeit; die allgemeinsten Grundlagen des organischen Volksthumes sind in ihr dargestellt, und der Socialpolitiker wird hier häufig sogar über den Gesichtskreis der Nation hinaus auf die Kulturgeschichte der Menschheit blicken müssen. Man sieht also, die Reihenfolge dieser drei Bände war eine zufällige und ist doch für mich eine innerlich nothwendige gewesen, indem sie aus meiner Art, politisch zu denken, mir selber unbewußt, hervorgewachsen ist. Und so sind die drei Bücher mit mir gewachsen und ich mit den Büchern, und in der, nach dem System verkehrten, nach meiner analytischen Methode aber doch wieder überwiegend praktischen Reihenfolge der Bände mag sich wiederum die Persönlichkeit des Autors unverhüllt spiegeln.
Abgesehen von den wissenschaftlichen Lesern wünsche ich mir namentlich für die »Familie« auch noch einen Leserkreis anderer Art. Ich möchte, daß das Buch auch als ein kleines Kunstwerk erfunden würde – nennt's meinetwegen ein Idyll vom deutschen Hause – und so als Hausbuch sich einbürgere in dieser und jener Familie, namentlich auch bei deutschen Frauen.
In bangen Tagen häuslicher Angst und Sorge hat mich die Bearbeitung gerade dieses Gegenstandes, der ja so ganz besonders im deutschen Gemüth anklingt, getröstet und muthig erhalten. Vielleicht fühlen es einige Leser, vorab dem zweiten Theile, an, daß dieses Buch dem Autor während des Schaffens wie zu einem Trostgedicht wurde, und verspüren wohl gar unter ähnlichen Umständen eine annähernd ähnliche Wirkung des Buches. Wenn man nun eine Arbeit solcher Art vollendet hat, dann empfindet man zwar wohl auch jenen Abendfrieden, der den Menschen beim Abschluß jedes Tagewerks in geheimer Wonne überschleicht; aber andererseits ist es Einem auch, als ob man von einem lieben Freunde scheide, einen langgewöhnten, belebenden Umgang aufgebe. Wie man sich langsam einem Freunde nähert, so lebt man sich auch langsam in ein Werk des Geistes ein, und die Freundschaft wird meist dann erst recht fest geschlossen seyn, wenn man just dem Verkehr ein Ende machen muß. Da verspürt man eine Leere, die nicht so bald wieder ausgefüllt seyn wird. Aber der Kern, die tragende Idee solchen Verkehrs bleibt doch fest in uns sitzen nach dem Abschiede vom Buche wie vom Freunde. Und ich glaube fast, dieses Buch würde von allem, was ich geschrieben, die größte, praktische, politische Wirkung üben, wenn es ihm gelänge, auch nur bei wenigen verwandten Geistern die gleiche Begeisterung zu festigen, die es bei mir selbst gefestigt hat, nämlich die Begeisterung für das große, unser Volk veredelnde und zur sittlichen Einheit verbrüdernde Kleinod des deutschen Hauses und der deutschen Familie.
München, am 14. December 1854. W. H. R.
Vorwort zur dritten Auflage.
Der rasche Eingang, den dieses Buch von der »Familie« in der deutschen Lesewelt gefunden, mag wohl ein Zeichen seyn, wie tief das Interesse für das Haus und die Sehnsucht nach einer Erneuerung und Vertiefung des Familienlebens in unserem Volke wurzelt.
Es hat mich die auch in tausend andern Dingen offenbar werdende Theilnahme für den Wiederaufbau des Hauses bestimmt, ein weiteres Werk, welches ich nicht jetzt geschrieben, sondern welches seit Jahren mir unter der Hand aufgewachsen ist und seinen Ursprung recht eigentlich dem Bedürfniß meines eigenen Hauses verdankt, als eine Art künstlerischer Illustration zur »Familie« zu veröffentlichen. Unter dem Titel » Hausmusik« wird nämlich binnen Kurzem im J. G. Cotta'schen Verlage eine Sammlung meiner Liedercompositionen erscheinen. Dieselbe wurden geschrieben für das Haus und die Freunde des Hauses, als schlichte, sinnig anregende, in den Formen möglichst streng und keusch gehaltene Musik. Aus Opposition gegen die üppige, überreizte Tonkunst unseres Concerts und unserer Salons lebte ich mich ein in diese Hausmusik, zugleich begeistert von dem Vorbilde jener großen Meister des achtzehnten Jahrhunderts, die ich in der »Familie« als die ächten Hausmusiker bezeichnet habe. Es ist dieses Liederbuch ebensogut ein Stück von mir, und vielleicht noch mehr, wie das vorliegende Werk. Ich glaubte daher wohl in dem Vorwort zu den Liedern sagen zu dürfen, daß sie sich zur »Familie« verhalten wie ein Bilderatlas zu einem naturgeschichtlichen Werke. »Was ich hier in Worten untersucht und dem Verstande vorgelegt, das wollte ich dort im Tonbilde veranschaulichen, ich wollte es Gläubigen und Ungläubigen ins Herz hinein singen. Ich glaube darum fast, wer meinen Büchern Freund ist, der wird es auch meinen Liedern werden, und wer meine Bücher nicht leiden mag, dem werden auch meine Lieder nicht gefallen; denn beide verkündigen ganz das gleiche Bekenntniß.«
München, am 27. Juli 1855. W. H. R.
Erstes Buch. Mann und Weib.
Erstes Kapitel. Die sociale Ungleichheit als Naturgesetz.
Wäre der Mensch geschlechtlos, gäbe es nicht Mann und Weib, dann könnte man träumen, daß die Völker der Erde zu Freiheit und Gleichheit berufen seyen. Indem aber Gott der Herr Mann und Weib schuf, hat er die Ungleichheit und die Abhängigkeit als eine Grundbedingung aller menschlichen Entwickelung gesetzt.
Es ist der verwegenste Gedanke des modernen Radikalismus, daß das Verhältniß der Ungleichheit und Abhängigkeit auch zwischen Weib und Mann, wie es die Natur gegeben, wie es die Sitte von Jahrtausenden weitergebildet und in die ehernen Tafeln aller Gesetzgebungen eingeschrieben hat, ein Ausfluß barbarischer Tyrannei, ein bloßes Siegeszeichen der rohen physischen Gewalt sey.
Die älteste Satzung des widerrechtlichen socialen Despotismus steht diesen freien Geistern in den Eingangskapiteln der Genesis, wo zum Weibe gesagt ist: »Dein Wille soll deinem Manne unterworfen seyn und er soll dein Herr seyn.«
Bedeutungsvoll aber ist es Jehovah selber, der dort mit eigenem Worte diese Satzung aufstellt. Und zwar unmittelbar nach dem Sündenfalle.
Trifft sich's hierbei nicht seltsam, daß gerade radicale deutsche Socialphilosophen, die kleinen Jünger eines großen Meisters – Hegels – auf den Satz pochen, daß in dem Sündenfall der Mensch erst Mensch geworden, während er vorher als zahme Bestie im Paradies, zu deutsch im Thiergarten, umhergewandelt sey? Wohlan! wir halten euch beim Wort. Unmittelbar mit diesem »Menschwerden« hing die Unterordnung der weiblichen Persönlichkeit unter die männliche in der Familie zusammen, aus welcher, naturnothwendig wie aus dem Saatkorn die Pflanze, aufgesproßt ist die ungleichartige Gliederung der bürgerlichen und politischen Gesellschaft. Prophetisch sind in jenem Kapitel der ältesten Urkunde des Menschengeschlechts die zwei mächtigsten Hebel zur Herausbildung eines öffentlichen Lebens neben einander gestellt, jene Hebel, über welche sich gerade jetzt die sociale Theorie am meisten den Kopf zerbricht: die natürliche organische Gliederung der Gesellschaft in ihrem Grundbau, der Familie, und die Berufung zur mühevoll erobernden individuellen Arbeit. Denn unmittelbar nachher heißt es: »Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brod essen.« Und beides ist ausgesprochen in der Form eines göttlichen Fluches, das heißt eines Fluches dessen geheime Frucht ein Segen ist.
Es ist scheinbar ein kleines, ja ein eitles Ding, zu reden von dem Gegensatz zwischen Weib und Mann, und stecken doch so große Folgerungen darinnen. Es ist dieser Gegensatz ein Ding, welches sich von selbst versteht, und doch ist derjenige der Weiseste, welcher zur rechten Zeit immer gerade die Dinge zu sagen weiß, die sich von selbst verstehen.
In dem Buche von »Land und Leuten« habe ich gezeigt, wie mit den Verschiedenheiten der Bodenbildung, selbst innerhalb eines einzelnen Landes, die größte Mannichfaltigkeit nicht nur der gesellschaftlichen Zustände, sondern selbst der Anschauung und Parteiung des Gesellschaftslebens gegeben seyn müsse. Also schon die Landes- und Volkskunde legt Protest ein gegen die Ausebnung der Gesellschaft.
Hier gehe ich aber noch viel weiter zurück: die beiden Begriffe »Mann und Weib« führen uns auf den Punkt, wo die Gesellschaftskunde in die Anthropologie hinübergreift, wo der natürliche Gegensatz der menschlichen Geschlechter ein naturwissenschaftlicher wird, wo der Anatom für uns den Beweis antritt, daß die Ungleichartigkeit der ursprünglichen und buchstäblichen »organischen« Gliederung des Menschengeschlechtes eine unvertilgbare, von Gott gesetzte, bis auf Nerven-, Blut- und Muskelbildung durchgeführte sey. In dem Gegensatz von Mann und Weib ist die Ungleichartigkeit der menschlichen Berufe und damit auch die sociale Ungleichheit und Abhängigkeit als ein Naturgesetz aufgestellt. Wer Mann und Weib nicht wieder zur Geschlechtseinheit zurückführen kann, der vermesse sich auch nicht, das Menschengeschlecht zur socialen und politischen Einheit und Gleichheit zu führen.
Ein tiefsinniges, oft sehr gedankenlos gebrauchtes Wort des Volksmundes sagt: » Vor Gott sind alle Menschen gleich.« Allerdings vor Gott, und nur vor Gott, und eben darum nicht vor den Menschen. Die Urparagraphen des göttlichen Sittengesetzes sind als die gleichen in unser aller Herzen geschrieben. Also nur das Göttliche ist das allgemein Menschliche. Es gibt vielerlei richtige Staats- und Gesellschaftsverfassungen, wie es Männer und Weiber gibt, Mongolen und Kaukasier, Binnenland- und Küstenbewohner, aber es gibt nur ein einiges und gleiches Grundgesetz der Religion für Alle. Indem sich die Menschheit besondert, bildet sie erst den Staat und die Gesellschaft. Eine einheitliche menschliche Universalgesellschaft bestand nur im Paradiese und auch da nur – bevor Eva geschaffen war. Sie wird wiederkommen nach dem jüngsten Tag, wo auch nicht mehr Mann und Weib seyn, wo nicht mehr gefreit werden wird, das heißt, wo die Menschen eben aufhören sollen Menschen zu seyn.
Es stehet geschrieben, daß bis dahin Ein Hirt und Eine Heerde werden soll, nämlich in göttlichen Dinge; es stehet aber nichts geschrieben von Einem König und Einem Volk. Ein Universalstaat widerspricht der Idee des Staates: denn dieser ist gegründet auf die Besonderungen von Land und Volk, von Stand und Beruf, von Mann und Weib. Unser Staat ist männlichen Geschlechts, der Universalstaat aber müßte generis neutrius seyn; denn so lange die Männer blos direct das staatliche Leben schaffen, die Frauen aber nur mittelbar in der Familie dafür wirken, ist eben auch der rechte Universalstaat noch nicht da.
Consequent ist darum auf der einen Seite nur der Socialpolitiker, der die Idee der Menschheit nur in der Summe der mannigfaltigst abgestuften, von Natur ungleichartigen Thatsachen der Familien, Volksgesellschaften und Staaten verwirklicht sieht, und auf der andern Seite der Socialist, der sich nicht scheut seinen Traum eines Universalstaates auch durch den Traum einer in sich gleichen Universalgesellschaft zu begründen, und schließlich den Muth besitzt zu sagen: auch der unterschiedliche Beruf von Mann und Weib ist nur eine willkürliche, barbarische Satzung der finsteren Vorzeit.
Wenn im Universalstaate nicht Mann und Weib eben so gleich berufen sind, wie Edelmann und Bettelmann, dann wäre der Universalstaat doch wieder ein Sonder-Staat der Männer. Man muß darum den tollen Muth dieser Consequenz der Socialisten bewundern, welche den beiden Geschlechtern trotz aller leiblichen und seelischen Ungleichartigkeit doch die gleiche politische und sociale Berufung zusprechen und ganz resolut ein Gesetz der Natur entthronen wollen, um ein Gesetz der Schule und des Systems an seine Stelle zu setzen. Périsse la nature plutôt que les principes!
Nicht zu Ehren eines Principes, wohl aber zu Ehren der Natur hielten die beiden Wetterauischen Gemeinden Kirchgöns und Pohlgöns noch im sechzehnten Jahrhundert folgenden in unvordenklicher Zeit geschlossenen Pakt aufrecht. Wenn eine Frau ihren Mann geschlagen, dann brachen die Nachbarn dem Manne, der sich solches hatte gefallen lassen, die First vom Dache ab, und die Mannschaft des verbündeten Dorfes kam solenniter herbeigezogen mit einem Esel, auf welchen die Frau gesetzt und im Orte herumgeführt wurde, »damit die Männer nach Gottes Gebot Herren bleiben und die Oberhand behalten sollen.« Der Mann der sich's hatte gefallen lassen, wird so gut gestraft wie die Frau, welche den Frevel verübt, und nur durch Spendung einer Ohm Bier an die verbündeten Gemeinden konnte sich das straffällige Ehepaar von der Strafe loskaufen. Gottes Gebot und dem Gesetze der Natur zu Ehren, wird man dann die Ohm Bier ausgetrunken haben. Die Kirchgönser und Pohlgönser waren also praktische Social-Politiker, keine Socialisten. Wie aber ein Mann gestraft würde, der seine Frau geprügelt, darüber scheint nichts pactirt gewesen zu seyn. Durch Letzteres wäre das Recht und die Sittlichkeit verletzt gewesen, und deßhalb kam es dem Pfarrer und dem Amtmann zu, solche Gemeinheit zu strafen; prügelte aber das Weib den Mann, so war dadurch noch obendrein eine offene Empörung gegen ein Naturgesetz der Gesellschaft verkündet, und die Gemeinden als sociale Körperschaft traten zusammen, nicht um dem Pfarrer oder Amtmann ins Handwerk zu greifen, sondern lediglich um diese Empörung niederzuschlagen. Das Haus des geprügelten Mannes ist von innen heraus zerstört, und zum Wahrzeichen dessen wird ihm die First vom Dache gerissen.
Klüglich hat man sich bisher begnügt, die sogenannte Emancipation der Frauen vorzugsweise poetisch zu verherrlichen. Die Lehre von der Ausgleichung des Geschlechtsgegensatzes gehört bis jetzt mehr der Novellistik an als der wissenschaftlichen Literatur. Sie klingt einleuchtender in Poesie als in Prosa, und fast nur, wo sie gereimt behandelt wurde, entging sie dem Schicksale, ungereimt zu erscheinen. Auch war es den Socialisten selten recht geheuer, wenn sich die Gelegenheit ergab, einmal thatsächlich zuzugreifen und die Frauen als gleichberufene Mitarbeiterinnen einzuführen in das politische Leben. Die Kirchgönser und Pohlgönser sind in ihrer Vertheidigung von Gottes Gebot und dem Gesetze der Natur weit zuversichtlicher aufgetreten. Es gibt gewisse Wahrheiten, die nur wahr sind, wenn man sie gleich der Decorationsmalerei aus einiger Entfernung und bei künstlichem Licht betrachtet. So erwies sich die Lehre von dem gleichen Beruf der beiden Geschlechter berechtigter in der Poesie als im System, aber immer noch berechtigter im System als in der That.
Die Frauen sind, um ein Bild aus dem Feudalwesen zu nehmen, noch »Wildfänge« in dem großen Lehensreiche der conservativen Staatspraxis. Es gilt, diese herrenlose Sippe in einen festen Unterthanenverband zur Staatspraxis zu bringen, ihnen die Vergunst der Theilnahme zu schaffen an kaiserlichem Recht und Landrecht der social-politischen Wissenschaft. Die politische Würdigung des Gegensatzes von Mann und Weib aus dem Gesichtspunkte der Naturgeschichte des Volkes ist eben die Aufgabe dieses Abschnittes.
Wie uns die Socialisten zu Untersuchungen über das Proletariat zwangen, so haben sie uns auch die Untersuchung über Mann und Weib zur Gewissenspflicht gemacht. Denn wer den Feind schlagen will, der muß sich auf Feindes Gebiet begeben und nicht warten, bis er zu ihm herüberkommt. So lange uns die Socialisten nicht aus der behaglichen Beschränkung aufgestört hatten, daß die Politik lediglich das angewandte Staatsrecht sey, war die Erörterung des Geschlechtsgegensatzes und seiner politischen Folgen kaum flüchtiger staatsmännischer Betrachtung würdig. Jetzt aber ist sie zu einem Eckstein des ganzen Systems der Naturunterschiede der Gesellschaft und damit auch des Staates geworden. Das Staatsrecht erscheint uns nunmehr bloß als die Formenlehre der Politik; ihr gegenüber steht die Lehre von den politischen Stoffen, die ich als die »Wissenschaft vom Volke« bezeichne. In dieser Wissenschaft wird auch der Gegensatz der beiden Geschlechter nach seiner politischen Bedeutung zu untersuchen seyn.
So gewiß Stoff und Form im Staatsleben sich fortwährend durchdringen, so gewiß müssen sie doch theoretisch gesondert behandelt werden. Dem Aesthetiker gesteht es Jedermann zu, daß er Inhalt und Form des Kunstwerkes scheidet und gesondert betrachtet, obgleich es niemals ein Kunstwerk gegeben hat, welches bloß aus Form oder ein anderes, welches bloß aus Inhalt bestanden hätte. Aus der Durchdringung beider geht erst das Kunstwerk hervor, wie der Staat erst aus der Durchdringung des gesellschaftlichen Stoffes und der Rechtsformen. Warum soll denn dem Politiker verwehrt seyn, was dem Aesthetiker nicht nur erlaubt ist, sondern sogar als wissenschaftliche Schärfe von ihm gefordert wird?
Die Lehre von der » bürgerlichen Gesellschaft« bildet die eine Halbschied der Gesammtlehre von den politischen Stoffen. Die Lehre von der » Familie« gibt die andere Hälfte.
Staatsrecht und Gesellschaftskunde berühren nur beiläufig den Gegensatz von Mann und Weib, sie haben ihn nicht in der ganzen Breite seiner Thatsachen und Folgerungen zu erforschen. In einem System der »bürgerlichen Gesellschaft« wird man bei Aufstellung der einzelnen Gruppen nicht etwa wieder gesondert behandeln müssen den Bauer und die Bäuerin, den Bürger und die Bürgersfrau etc. Im Gegentheil ist gerade die höhere Einheit dieses Unterschiedes das »Bauernthum,« das »Bürgerthum,« der eigenste Gegenstand der Gesellschaftskunde. Der Staat ist männlichen Geschlechtes und die Gesellschaftsgruppen sind generis neutrius: wo bleiben da die Frauen? Sie sollen bleiben in der »Familie,« die ja die vorwiegende Signatur der Weiblichkeit schon in ihrem Geschlechtsartikel aufzeigt.
In der Lehre von der Familie ist die ursprünglichste natürliche Gliederung des Volkes, wodurch dasselbe dem Geschlechte nach in Männer und Frauen gespalten wird, zu erörtern und abzumachen. Die Familie setzt nur das Individuum voraus; Staat und Gesellschaft aber setzen bereits die Familie voraus, und haben es darnach im Allgemeinen nur mit dem öffentlichen Stellvertreter der Familie zu thun, mit dem Manne.
Mit dieser »Voraussetzung« der Familie meine ich es aber ernstlich. Die Lehre von der Familie muß eben so gut wie die Gesellschaftskunde als ein selbständiger Wissenschaftszweig bearbeitet werden, oder unsere ganze Staatswissenschaft steht in der Luft. Mit dem bloßen Familienrecht ist es hier nicht gethan. Die Lehre von der Familie ist eine sociale Disciplin, ein Theil der Volkskunde.
Wie für die Wissenschaft, so muß auch für die Staatskunst die Lehre von der Familie erst noch erobert werden. Familienleben und Staatsleben bedingen sich nicht in ihrem Princip, wohl aber in ihren Wirkungen. Weit gründlicher denn der Staat hat die Kirche seit alten Zeiten die Macht der Familie ausgenützt. Und doch handelt es sich hier um eine wahre Naturmacht zur Stütze der erhaltenden Staatskunst, um einen am Anfang der Tage aus dem Boden gewachsenen Felsenpfeiler, nicht um künstlich gefugtes Mauerwerk. Ueber der unmittelbaren Beziehung das Mannes zum Staate wird die in der Familie vermittelte des Weibes vergessen. Freilich handelt der Mann auf der politischen Bühne, während die Frau nur eine ruhende Macht im Staate ist. Der aber weist sich als einen schlechten Logiker aus, der die ruhende und leidende Kraft für gleichbedeutend nimmt mit einer nicht vorhandenen. In der That, die Frauen könnten sich beschweren darüber, daß man sie vergißt im öffentlichen Leben. Ich bin ein Mitkämpfer für die verrufene »Emancipation der Frauen,« indem ich kämpfe für eine bedeutend erweiterte Geltung und Berücksichtigung der Familie im modernen Staat. Denn in der Familie stecken die Frauen. Sie sollen wirken für das öffentliche Leben, aber man soll ihrer dabei nicht ansichtig werden, denn sie sollen zu Hause bleiben. Diese Wirksamkeit im Hause aber ist den Frauen zur Zeit noch sehr verkümmert, und wird es bleiben, so lange die Lehre von der Familie das Aschenbrödel unter den Disciplinen der Volkskunde bleibt.
*
In dem Gegensatz von Mann und Frau sind gar manche Grundzüge der natürlichen Gliederung der Gesellschaft bereits vorverkündet. Andererseits wirkt Standesart und Standessitte eben so sehr bestimmend auf das Gepräge des Weibes oder Mannes, wie die Standessitte wiederum so oft mit der Familiensitte untrennbar zusammengewachsen ist.
Auf den untersten Stufen der Gesellschaft ist die Charakterfigur von Mann und Weib noch nicht in ihren vollen, bestimmten Umrissen herausgezeichnet. Das Gegenbild wird erst fertig mit der steigenden Gesittung. Denn die ächte Civilisation sondert und gliedert, die schlechte ebnet aus. Das Bauernweib ist in jeder Beziehung, bis auf das allgemeine körperliche Gepräge hinab, noch ein Halbmann: erst im höheren Culturleben tritt das ganze Weib dem ganzen Mann in jedem Zug charakteristisch gegenüber. Von dieser merkwürdigen Thatsache und ihren Folgen wird das nächste Kapitel ausführlich handeln.
Hier beschäftigt uns der Gegensatz von Mann und Weib noch in seiner Allgemeinheit. Und da erscheint dann dem Social-Politiker jene doppelte Naturmacht in demselben verborgen, die in der einfachsten Hauptgliederung der Gesellschaft schon bestimmter zu Tage tritt: eine Macht des »socialen Beharrens« und der »socialen Bewegung,« der That und der ruhenden Kraft.
Der Mann strebt in der Familie doch schon wieder über die Familie hinaus, aus den Familien gestaltet er die größern Kreise der Gesellschaft und des Staates, und so wird der Staat als die letzte, dem Manne eigenste Frucht dieses Strebens zuletzt ein rein männliches Wesen. Das Weib nimmt nur insofern Antheil an den Entwickelungen jener Kreise, als es dieselben auf die Familie zurückbezieht, es beharrt in der Familie; nicht umsonst stempelt die Sprache die Familie als weiblich; sie ist des Weibes ursprünglichster Besitz. Der Mann also stellt in der Familie die Potenz dar, welche das Bürgerthum hauptsächlich in der Gesellschaft vertritt; das Weib die Potenz der Aristokratie. Adel und Bauern beharren im Stande, der ihr eigenster Besitz ist, sie beziehen Gesellschaft und Staat auf den Stand zurück; das Bürgerthum aber sucht hinauszugehen über den Stand, es sucht denselben zur Gesellschaft zu erweitern.
Wo Staat und Gesellschaft stille stehen, da wuchert darum die Weiberherrschaft auf, nicht minder ein ausschließendes Regiment der Mächte des socialen Beharrens. Der Acker »junkert,« sagt der Bauer, wenn das Land nur noch Halme und Aehren erzeugt, aber keine Samenkörner darin, welche die Aussaat hundert- und tausendfältig weiter tragen. So wie die absoluten Staaten des Orients stille standen und junkerten, brach die Weiberherrschaft durch, sie brach durch trotz des Harems und im Harem. Und obgleich im Orient das Haus zugleich der Kerker der Frauen ist, wußten sie doch in der Zeit der politischen Stagnation die Thüre zu finden, durch welche man in den Thronsaal schlüpft. Als Frankreich junkerte, beherrschten Mätressen mit dem Schlage ihres Fächers das Land. Aber auch nur, wo das Beharren im Staatsleben den Gegensatz der Bewegung verliert, ist ächtes Weiberregiment möglich. Elisabeth von England und Maria Theresia führten kein Weiberregiment: sie waren Männer in Frauenkleidern.
Das Weib ist von Haus aus conservativ, und wo es radikal wird, ist es radikal – aus Aristokratismus. Es stehet vorwiegend unter dem Zauberbanne der Sitte gleich den Gesellschaftsgruppen der Bauern und der Aristokratie. Ganz wie bei letzteren ruht seine gesellschaftliche Geltung mehr in dem was es ist und darstellt, als in dem, was es thut. Ein Hinwegsetzen über die Sitte, welches bei dem Manne vielleicht noch als Originalität oder harmloser Eigensinn passiren könnte, bezeichnet der Sprachgebrauch mit scharfem Verständniß bei dem Weibe bereits als »unweiblich«.
Bei dem Stande, der in seiner ganzen Lebensführung zumeist dem Naturtrieb der Sitte folgt, bei den Bauern, sind vorzugsweise die Frauen die Hüterinnen dieses Triebs. Die Frauen sollen aber überhaupt sorgen, daß das heilige Feuer des häuslichen Herdes niemals erlischt, das heißt, ihr Beruf ist es ganz besonders, die Sitte des Hauses zu pflegen, zu schirmen und fortzubilden. Schon darin ist ihnen ein positiver politischer Beruf gegeben. Unsere besten volksthümlichsten Sitten sind uns bewahrt worden durch Frauenhände. Solche Sitten aber sind wesentliche Züge unserer Nationalität! unsere Nationalität würde unendlich mehr sich abgeschliffen haben, wenn die Frauen nicht gewesen wären.
Die altherkömmlichen Festesherrlichkeiten des Bauernvolks haben sich nur da frisch und leidlich ganz erhalten, wo eine Feier der Familie gilt, das heißt wo die Frauen mitthun dürfen. Das Haus ist die Citadelle der Sitte. Während die Festgebräuche des Schwerttanzes, des Hahnenschlags etc., überhaupt alle die bäuerlichen Kampf- und Festspiele, bei welchen auf Kirmessen und an andern Jubeltagen der Mann allein prunken konnte, fast durchweg abgekommen oder bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschrumpft sind, haben sich die alten Bräuche bei Verlobungen, Hochzeiten, Kindtaufen etc., soweit die Frauen dabei die Hand im Spiele haben, viel lebendiger erhalten. Es ist hier sogar ein Uebermaß der festlichen Bräuche zeitweilig eingetreten, namentlich sind die deutschen Hochzeitsitten zu einer so üppigen Mannichfaltigkeit angewachsen, daß sie der Culturhistoriker gar nicht mehr übersehen und ordnen kann. Mit ihren unmäßigen Hochzeiten, Polterabenden, Kindsbieren, Vor- und Nach-Kindtaufen etc., haben die Frauen zuletzt die Polizei ins Haus gerufen und durch das Unmaß der häuslichen Sitte auch die Ertödtung ächter und berechtigter Sitten leider fördern helfen.
Bei der Ausstattung der Mädchen herrscht bei norddeutschen Hofbauern noch häufig die alte deutschrechtliche Auffassung der Aussteuer als einer Absteuer, d.h. einer standesmäßigen Abfindung, die nach dem Stand der Eltern und nicht nach ihrem Privatbesitz bemessen wird. Es ist dieß ein uraltes Verfahren, das außerdem nur noch bei hohen Potentaten annähernd vorkommt, und bloß die Mädchen, die conservativen Frauen haben bei jenen Hofbauern für sich daran festgehalten: denn bei den Jungen ist mitunter das romanistische Gleichtheilungsprincip schon durchgedrungen, wo bei den Mädchen noch eine Absteuer und keine Aussteuer stattfinden.
In Gegenden, wo bei den Männern die Volkstracht durchaus verloren gegangen ist, tragen doch häufig die Weiber noch das altmütterliche Kleid. Aber kein einziges Beispiel des umgekehrten Falles ist mir bekannt. Es mögen leicht zwei Drittel der noch florirenden bäuerlichen Originaltrachten Weibertrachten seyn. Unter diesen letzteren sind aber mehrere noch ächt mittelalterlich, während die männlichen deutschen Bauerntrachten kaum je über das siebzehnte oder achtzehnte Jahrhundert hinaufgehen. Man kann wohl einen Bauernburschen des neunzehnten Jahrhunderts sehen, der in dem Sonntagsrocke des achtzehnten seine Braut, die in einem bürgerlichen Festkleid des fünfzehnten prangt, zum Altare führt. Dieses Bild ist eine Illustration zur Geschichte der Frauen. Der zähe, beharrende, conservative Geist des weiblichen Geschlechts spiegelt sich darin.
Die Frauen allein zeichnen in allen Ständen noch Jungfrauen, Frauen und Wittwen durch bestimmte Schattirungen der Tracht aus. Diese Symbolisirung der verschiedenen Stufen der Familienglieder fand gewiß auch ursprünglich in der männlichen Tracht statt. Allein die beweglicheren Männer haben die Abzeichen jener Stufen weggeworfen und Junggesell, Ehemann und Wittwer gehen in dem gleichen Rock daher. Die Familie ist die Welt der Frauen, darum kündet die Frau auch gleich durch ihre Haube aller Welt, wie sie in der Familie steht.
Die kargen Reste von Volkstrachten im Bürgerstande, soweit sie in Deutschland noch erhalten sind, fallen meines Wissens ausschließlich den Bürgerinnen zu. Bürgersfrauen tragen in Eger noch den schwarzen, mit Gold verbrämten, innen mit Scharlach gefütterten Faltenmantel des siebzehnten Jahrhunderts, und in den bayerischen Städten tragen die Bürgersfrauen noch die Riegelhauben, die alten Mieder mit den Silberketten, während bei dem städtischen Mannsvolk keine Spur der entsprechenden Tracht mehr vorhanden ist.
Die Mägde vom Lande, welche in der Stadt dienen, hängen, wenn nur einmal die erste Anfechtung abgeschlagen wurde, länger und zäher an ihrem heimatlichen Kleid, als die Knechte. Es ist solche Beharrlichkeit um so höher anzuschlagen, als die bäuerlich gekleidete Magd der Verspottung um ihres Rockes willen wehrlos preisgegeben ist. Um der Sitte ihrer alten Umgebung treu bleiben zu können, muß sie gegen die Sitte ihrer neuen Umgebung verstoßen. Darin liegt für das weibliche Naturell ein tiefer tragischer Conflikt, den ich manchmal mitempfand, wenn ich sah, wie der städtische Pöbel in sündlicher Frivolität die Bauerndirne wegen ihres Rockes verhöhnte, wegen der treuen Anhänglichkeit an die überlieferte heimische Sitte.
Die Tracht ist überhaupt ein höchst wichtiges Ding, wo es sich um die Familie und ihre Sitte handelt. Die große Hauptscheidung der Tracht in männliche und weibliche findet sich bei allen Völkern, und in allen Perioden der Geschichte. Hier ist ein wahrer consensus gentium. Die Civilisation hat diesen Unterschied nicht entfernt auszugleichen vermocht. Die besondere Frauentracht ist der handgreifliche Protest aller Nationen, gegen die Berufung von Frauen und Männern zu gleichem Wirken. Die Frauen halten nicht mit Unrecht so viel auf ihr Kostüm: es ist das Wahrzeichen ihrer Eigenartigkeit; und ein ächter Socialist muß beim Anblick jedes Weiberrockes in die Zähne knirschen, denn solange es noch besondere Weiberröcke gibt, ist es auch noch nichts mit einem folgerechten Socialismus.
Hat aber das Weib erst einmal den Bann des alten Herkommens in Sitte und Tracht durchbrochen, hat es den natürlichen Conservatismus seines Geschlechts erst einmal verleugnet, dann wird es auch weit zügelloser, radikaler, neuerungssüchtiger in der Mode als der Mann. So wird die Großmutter ihre alten Geschichten und Sprüche treuer und vollzähliger den Enkeln überliefern als der Großvater, und doch konnte man wiederum mit Grund den Frauen zur Last legen, daß sie z.B. jene zur Zeit der Kreuzzüge beginnende Verwälschung unserer Sprache durch eingeflickten fremdländischen Wortflitter hauptsächlich angestiftet hätten, indem sie bei der damaligen weiblichen Liebhaberei des Sprachstudiums nichts Eiligeres zu thun hatten, als mit jedem neugelernten fremden Worte sofort die altüberlieferte deutsche Redeweise neu aufzuputzen.
Hier zeigt es sich, daß der Stab der strengen Sitte dem Weibe eben ein wahres Naturbedürfniß ist. Es wird haltlos sobald es diesen Stab von sich wirft. Darum liegt ein tiefer Sinn in jener altisländischen Rechtssatzung, kraft deren das Aufgeben der landesüblichen Tracht der Frau als ein Ehescheidungsgrund geltend gemacht werden konnte.
Man sollte nun meinen, die Modesucht der städtischen Frauen stehe in geradem Widerspruch zu dem Beharren der Bauernweiber, bei der überlieferten Tracht. Dieß ist aber keineswegs der Fall. Der bestimmende Grund für die Modesucht der Städterin ist durchaus nicht jener Drang nach gesellschaftlicher Nivellirung, welcher den Bürger sein besonderes standesmäßiges Kleid mit dem möglichst form- und farblosen, gleichsam allgemeinen Rock der gebildeten Welt vertauschen heißt. Aus Vornehmthuerei, nicht aus Liberalismus, aus dem falschen aristokratischen Gelüsten einen ganz bestimmten und zwar möglichst hohen Rang repräsentiren zu wollen, hascht die Frau nach jeder neuen Mode: aus einem ächten Aristokratismus hält die Bauernfrau an dem ererbten Kleide fest. So alt wie unsere Volkstrachten ist daher auch die Klage, daß die Dienstmägde in Schleiern einhergehen, »geschmückt wie Hofjungfrawen,« denn sie wird bereits im sechzehnten Jahrhundert erhoben. Jener eigentümliche Stolz der Gelehrten, der die Geringschätzung der äußeren Abzeichen des Ranges durch eine möglichst nichtssagende und nachlässig geordnete Tracht ausdrückt, wird bei dem Weibe niemals Wurzel fassen. König Salomo war ein Mann, darum prunkt er mit jenem Bettlerstolz, der, indem er fortwährend ausruft: »Alles ist eitel,« eben darin sich selbst als den Allereitelsten bekundet.
Das Weib weiß recht wohl, daß der äußere Rang – ganz im Sinne der Aristokratie – bei ihm viel strenger berechnet wird, als beim Manne. Einem bedeutenden Manne öffnen sich alle Schranken der vornehmen Geselligkeit; er kann hoffähig werden bloß um seines Talentes willen. Die geistvollste Frau dagegen wird niemals hoffähig werden, weil sie geistvoll ist. Sie steht in ihrem einmal angeborenen oder angeheiratheten Rang, über den sie durch eigene Kraft nicht hinaus kann. Darum wacht sie um so eifersüchtiger über denselben, und sucht sich wenigstens in ihrem Putz zeitweilig in einen höheren Rang hinaufzuträumen.
Der Mann kann seinen Lebensberuf wählen, er kann ihn wechseln, er kann sich selbst im reiferen Alter noch neue Berufe schaffen. Der Frau wird der Beruf angeboren und sie muß in ihm verharren. Das allein gibt den Frauen schon ein aristokratisches, conservatives Gepräge.
Es legten in den letzten Revolutionsjahren viele deutsche Frauen den entschiedensten politischen Freisinn zur Schau. Aber nirgends verfuhren sie wie jene demokratischen Männer, welche den Rock mit dem Kittel vertauschten, sich wie Tagelöhner kleideten, um Volksmänner zu werden, und geradezu renommirten mit der Maske einer möglichst niedrigen bürgerlichen Stellung. Diese unächten Blousenmänner wollten ausebnen, indem sie alle Gesellschaftsgruppen herabzogen zu der unreifsten und untersten des vierten Standes. Dergleichen fällt keiner Frau ein. Keine einzige vornehme Demokratin hat sich, um volksthümlich zu werden, den Schurz einer Küchenmagd umgebunden. Die weiblichen Radikalen wollten nur insofern nivelliren, als sie gern alle Stände gleich vornehm gemacht hätten. Die Männer wollten alle Stände gleich gering machen. Das ist der Gegensatz von Mann und Frau. Wenn die Demokratinnen alle Welt gleich vornehm zu machen sich vermaßen, so übersahen sie den Widerspruch, der in den Wörtern »gleich« und »vornehm« liegt. Aber gerade derselbe Widersinn ist ja auch angedeutet in dem Wort, daß die Frauen nur aus Aristokratismus radikal werden. Von dem Augenblicke an, wo die Londoner Schenkmädchen im Bloomercostüm paradirten, war diese neumodische Tracht auch für die freisinnigste Dame »unmöglich« geworden; sie ist von nun an ein weiblicher Taglöhnerkittel, sie stellt nichts vornehm apartes mehr dar.
Es ist also derselbe Geist des Beharrens, welcher bei der weiblichen Landbevölkerung sich beugt unter die Alleinherrschaft der Sitte als einer unwandelbaren, und in der Stadt unter die Despotie der Mode, als der rastlos wechselnden. Die frei sich bewegende Selbstbestimmung fehlt hier wie dort. Im Begriff der weiblichen Modesucht selbst liegt es schon, radikal zu seyn aus Aristokratismus.
Der Mann ist im Allgemeinen gleichgültiger gegen die Mode, weil er es auch gegen die Sitte ist. Die Unabhängigleitserklärung von der Herrschergewalt der Sitte kündigt hier, wie bei den Gruppen der bürgerlichen Gesellschaft, die Macht der Bewegung an. Darum nennen wir es weibisch, wenn Laffen und Stutzer jeden Wechsel der Mode mitmachen, wie es andererseits auf die noch nicht vollständig vorhandene Durchbildung des Geschlechtsgegensatzes deutet, wenn bei abgeschlossenen Bauerschaften Männer und Weiber gleich treu an der alten Kleidersitte hängen. Männer, welche jeder Mode nachlaufen, gehören übrigens merkwürdig genug meist solchen Berufsweisen an, deren Arbeit ebensogut in Weiber- als in Männerhänden seyn könnte, wie z. B. Schneidergesellen, Ladendiener, Schauspieler u.s.w.
Deutschland besitzt kein revolutionäres Proletariat unter den Frauen. Unsere armen Taglöhnerinnen stecken noch viel zu tief in der Weiblichkeit um revolutionär seyn zu können. Die weiblichen Demagogen sind gebildete Frauen, Blaustrümpfe, die ihr Geschlecht verläugnen, vornehme Damen, die Monate lang in den Logen der Parlamente zuhörten, weil sie zu Hause nichts zu thun hatten. Eine Frau, die an die Gleichstellung ihres Geschlechtes mit den Männern denkt, muß bereits sehr viele confuse Bücher gelesen haben. Von selber verfällt eine deutsche Frau noch nicht auf den Gedanken der »Emancipation der Frauen.« Die wenigsten Frauen verstehen den Sinn dieser Theorie: die ganz wenigen aber, welche selbige verstehen, haben sie mißverstanden.
Das Weib hält die natürlichen Stufenfolgen im Familienleben und den Gesellschaftsgruppen streng auseinander, nicht aus politischem Bewußtseyn sondern aus Instinkt. Es hat die Selbstbeschränkung auf einen engen Kreis im Hause kennen gelernt; es wird nur vollgültig, indem es sich eins weiß mit einem Mann; es existirt nicht für sich, sondern nur in und mit der Familie; es kann mit Anstand nicht einmal allein spazieren gehen; es lernt also von Jugend auf seine Persönlichkeit einem höheren Ganzen unterordnen. Das Weib beurtheilt die Gesellschaft nach dem Hause; es begreift die Gliederung der Gesellschaft als eine Naturnotwendigkeit, der man seinen persönlichen Eigensinn ebensogut beugen müsse wie der Idee der Familie, während der Mann noch nach Beweisen für die Vernünftigkeit dieser Gliederungen sucht. Auch darum sind die Standesschranken für das Naturell des Weibes weit fester gefugt, als für den Mann, oft sogar zu fest und unübersteiglich. Es läßt sich recht gut eine Naturgeschichte der Gesellschaft für Frauen schreiben, nicht aber eine Philosophie der Gesellschaft.
Ein Bauernbube kann es weit eher zum vornehmen Herrn bringen, als ein Bauernmädchen zur Dame. So sahen wir wohl, daß im Jahr 1848 Geheimräthe, dieweil ihnen der Angstschweiß auf der Stirne stand, mit Proletariern Brüderschaft tranken, nicht aber daß die gleich heftig erschreckten Geheimräthinnen mit den Marktweibern smollirt hätten. Man würde es geradezu » unweiblich« nennen, wollte eine Bürgersfrau die Sitten einer Bäurin annehmen. » Unmännlich« wäre der entsprechende Schritt des Mannes wenigstens nicht.
Es ist sogar eine erbliche Schwachheit des weiblichen Geschlechts, die gesellschaftlichen Unterschiede bis ins verderbliche Extrem festzuhalten. Das Weib verknöchert weit eher in seinem Standesbewußtseyn, gleich dem Aristokraten und dem Bauern, als daß es gleich dem Bürger in den umgekehrten Fehler der Gleichgültigkeit gegen alles gesellschaftliche Leben, in das »sociale Philisterthum« verfiele. Es liegt ein erstaunlicher Drang zum körperschaftlichen Zusammenhalten in der weiblichen Natur, und sollte sich derselbe auch nur in der Art äußern, wie bei jenen Württembergerinnen, welche Anno 1848 einen Aufruf erließen, daß alle schwäbischen Mädchen sich verbinden möchten, keinen Reaktionär mehr zu heirathen!
Eine heillose Verwirrung ist bei uns eingerissen im Gebrauch der Wörter » gesellig« und » gesellschaftlich« (social). Wenn man von den Formen des persönlichen Umganges, von den öffentlichen und häuslichen Lustbarkeiten einer Stadt spricht, nennt man das wohl gar das »gesellschaftliche« oder »sociale Leben« – zur Verzweiflung social-politischer Ohren. Diese Verwechselung des »Geselligen« und »Gesellschaftlichen« muß wohl von den Frauen aufgebracht worden seyn. Denn sie schauen die Gesellschaft ja fast nur im Spiegel des geselligen Lebens; sie erstarren so tief im socialen Standesbewußtseyn, daß sie auch im geselligen Leben, wo gerade vor der Gleichheit der Bildung und des Strebens alle Standesunterschiede fallen sollten, den Rang nicht vergessen können, der ihnen angeboren oder mit ihrem Manne angetraut ist.
Der Mann gibt dem Hause und der Familie Namen und äußere Gestaltung: er vertritt das Haus nach außen. Durch die Frau aber werden die Sitten des Hauses erst lebendig: so haucht sie in der That dem Hause den Odem des Lebens ein.
Die eigenste Weise des Hauses, sein individueller Charakter wird fast immer bestimmt durch die Frau. Auch hier springt das beharrende, aristokratische Wesen der Frauen hervor. Wenn sich eine Norddeutsche nach Süddeutschland verheirathet, so hält sie in der fremden Gegend ihre heimathlichen Sitten dennoch fest, impft sie dem Hause ein, und die Kinder werden trotz der süddeutschen Umgebung schwer davon loskommen können. Der Mann fügt sich allmählich den fremden Bräuchen der Frau. Zieht der Mann in einen fremden Gau und gründet sich dort eine Familie, so wird man von seinen mitgebrachten Sitten im neuen Hause kaum etwas verspüren; er selber wird vielmehr sehr rasch umgemodelt werden und der häuslichen Art seiner Frau ganz folgen. Der weibliche Geist des häuslichen Beharrens ruht nicht über ihm. Wenn die Großmutter oder Urgroßmutter eines mitteldeutschen Hauses eine Schwäbin war, dann findet man immer noch etwas schwäbische Küche, allerlei schwäbische Ausdrücke und Sprüchwörter, einigen schwäbischen Aberglauben und ein klein wenig Schwabentrotz in der Familie überliefert. War aber bloß der Großvater ein Schwabe, dann wird man im mitteldeutschen Hause kaum mehr etwas Schwäbisches aufspüren können. Diese Thatsache ist von großer Wichtigkeit für den Ethnographen, der die Bewegung und Verbreitung der Sitten erforscht. Er wird hier zu einem paradoxen Satze kommen: Gerade dadurch, daß die Frauen am zähesten aushalten bei den ererbten häuslichen Sitten, tragen sie am meisten zur Verschmelzung und Bindung der Volkseigenthümlichkeiten bei. Der Mann, der, wenn er auswandert, seine heimische Sitte rasch mit der fremden vertauscht, fördert dadurch das starre Abschließen der Volkscharaktere. Ursache und Wirkung kreuzen sich also hier in diagonaler Entgegensetzung.
Es ist uns nunmehr schon nahe gelegt, den öffentlichen und nationalen Beruf der Frauen zu begreifen. Sie bewahren das instinctive Leben, das Gemüthsleben des Volkes, welches sich kundgibt in der nationalen Sitte, und eben damit den eigentlichen Genius des Volkes, die verborgensten, dunkelsten, aber eigensten Kräfte, aus welchen in dem männlichen Staatsleben seine bewußte Seelenthätigkeit, sein politisches Schaffen entspringt. Der politische Volks charakter ruht in letzter Instanz bei dem Weibe, die politische That bei dem Mann. Ueber die unermeßliche Wichtigkeit dieser Vorbildung des Staatslebens in der häuslichen Sitte, werde ich im ersten Kapitel des zweiten Buches dieser Schrift eingehender reden, und dabei möge man sich erinnern an den hier angedeuteten politischen Beruf der Frauen.
Unsere Religionsbegriffe lernen wir bei den Männern; beten aber lernen wir bei der Mutter. Die Mutter lehrt uns die Selbstbeschränkung, der Vater öffnet uns den ersten Blick in die Welt. Ein einseitiges Muttersöhnchen wird daher leicht zum Stubenhocker, der in sich hinein verkrüppelt. Die Großmutter wird uns am schönsten die Mährchen und Sprüche des Hauses erzählen, der Großvater aber die Geschichte der Zeit, die er selber durchgelebt.
Fühlt man nicht klar in diesen wenigen weltbekannten Zügen den Gegensatz männlicher und weiblicher Natur?
Aber auch die praktischen Folgerungen sollte man herausfühlen.
Die sociale Tugend ist es, deren Grund zuerst von Frauenhänden in uns gelegt wird; zur politischen bedarf es der Lehre und des Beispiels der Männer. Wie von fernher dämmert uns in dem Naturunterschiede der Geschlechter bereits ein Schattenbild des großen Doppelreiches von Gesellschaft und Staat entgegen. Die Sitte, die bewegende Kraft der Gesellschaft wird gehegt und bewahrt vom Weibe, das Weib steht im Naturleben der Sitte; der Mann erst schafft aus dem Rechtsbewußtseyn das Gesetz, die bewegende Kraft des Staates. Gesellschaft und Staat aber werden erst in ihrer gegenseitigen Durchdringung ein lebendiges Ganze, wie Weib und Mann zusammen erst einen ganzen Menschen ausmachen.
Dann wiederholt sich im innern Kreise der bürgerlichen Gesellschaft dasselbe Gleichniß, welches doch auch wieder mehr als ein Gleichniß, welches eine Thatsache ist.
In Weib und Mann sind uns hier die Mächte des Beharrens und der Bewegung vorgebildet. Die Mächte des socialen Beharrens aber, Aristokratie und Bauernthum, sind die reinsten gesellschaftlichen Mächte. In den Mächten der socialen Bewegung, namentlich im Bürgerthum, wird die Gesellschaft schon über sich hinausgeführt zum Staate. Die Macht des Bürgerthums am Ausgange des Mittelalters weissagt den Sturz des feudalen, des aristokratischen Gesellschaftsstaates. Man hat mir vorgehalten, ich habe in meinem Buch von der »bürgerlichen Gesellschaft« die Mächte des socialen Beharrens mit besonderer Vorliebe behandelt. Das ist ganz richtig, aber auch natürlich. Denn in ihnen lebt eben das gesellschaftliche Element am reinsten, vollsten, mächtigsten. Wer dagegen ein Buch vom Staate schreibt, der wird am ausführlichsten in die Ideen und Thaten des Bürgerthums eingehen müssen, denn dieß ist der am meisten staatliche Stand. So behandle ich auch in diesem Abschnitt von »Mann und Weib« das Weib mit der größeren Liebe und Ausführlichkeit. Ihm gilt fast immer mein Hauptsatz, dem Mann nur der erläuternde Gegensatz. Denn das Weib bildet das vorzugsweise familienhafte Geschlecht, es ist ganz erfüllt von der Idee der Familie, während der Mann, selbst sofern er in der Familie steht, doch auch schon wieder über die Familie hinausgreift.
Man hat in unsern Tagen gar oft die Forderung einer politischen Volkserziehung gestellt. Seltsam genug aber verstand man darunter die Einführung des Volkes in das Studium der politischen Parteilehren. Wenn aber das Volk seine Parteigrundsätze nicht erlebt, dann wird es sie gewiß auch nicht erlernen.
Der erste Schritt zu einer politischen Erziehung des Volkes scheint mir vielmehr darin zu suchen, daß man das weibliche Geschlecht wieder gründlicher in seine eigene Art zurückführt. Denn von der Erziehung des weiblichen Geschlechts hängen unsere socialen Zustände in weit höherem Maße ab, als man wohl wähnen mag. Man bilde die jungen Mädchen wieder zu Hüterinnen der Sitte, man lehre sie wieder Selbstbeschränkung im Hause finden, man gebe ihre Erziehung, die viel zu viel der Schule zugefallen ist, der Familie wieder mehr anheim, und die Anerkennung der Sitte und die Selbstbeschränkung im gegebenen Lebenskreise, als die beiden socialen Nationaltugenden werden auch bei den Männern allmählig wieder einziehen.
Statt dessen suchen wir, wunderlich genug, die jungen Mädchen mit jedmöglicher künstlerischer und wissenschaftlicher Bildung auszustatten, mit einer durchaus männlichen Bildung, und sind nachher erstaunt, daß die Sitte des deutschen Hauses schwindet, daß unsere Kinder den inneren socialen Halt und die rechte Selbstbeschränkung im Hause nicht mehr eingepflanzt erhalten! Der Unterschied von Mann und Weib konnte nicht dadurch ausgeglichen werden, daß wir die Frauen wie Männer erziehen, aber die Grundfesten der Gesellschaft wurden erschüttert.
Weiter unten werde ich reden über die Emancipirung von den Frauen. Diese ist nöthig geworden eben durch die Mißachtung der natürlichen Berufe beider Geschlechter in der Erziehung. Die Frauen werden in allerlei männlicher Kunst und Wissenschaft aufgezogen und haben in Folge dessen unser Geistesleben weibisch gemacht, statt daß sie, in den Mysterien des deutschen Hauses herangebildet, unserem Familien- und Gesellschaftsleben den ächten weiblichen Grundton hätten geben müssen. So gehen die Wirren der socialen Frage bis auf den verkannten Unterschied von Mann und Weib zurück.
Das Mittelalter machte mit feinfühligem Sprachsinne eine Abstufung in den Wörtern »Weib« und »Frau.« »Weib« bezeichnet einmal den allgemeinen Geschlechtsgegensatz, und so mußte ich dieses Buch wohl überschreiben: »Mann und Weib.« Anders gefärbt wird aber die Bedeutung dieses Wortes, wenn man es dem Worte »Frau« gegenüberstellt. Dann wurde die bewegliche, unstäte, schmiegsame Naturseite des andern Geschlechts, welche radikal macht aus mißverstandenem Aristokratismus, in dem Ausdruck »Weib« zusammengefaßt. »Frau« war das treu beharrende, in der Selbstbeschränkung große, in der Zucht der Sitte gefestete Wesen, das Idealbild des andern Geschlechts. Von einer »Würde der Frauen« konnte Schiller singen, aber nicht von einer »Würde der Weiber.« So sagt Walther von der Vogelweide zum Lobe seiner Landsmänninnen, daß in Deutschland die »Weiber« noch besser seyen als anderwärts die »Frauen.«
In dieser sprachlichen Unterscheidung liegt eine klare Erkenntniß des Berufes der Frauen angedeutet, wie die Willkür, mit welcher wir jetzt oft beide Wörter zusammenwerfen, und gar noch die französische »Dame« dazu nehmen, ein Beweis mehr ist, wie sehr diese Erkenntniß im modernen Leben verdunkelt wurde.
Die Socialisten appelliren an die Weiber, wir wollen an die Frauen appelliren.
Es ist nun zunächst meine Aufgabe, darzustellen, wie die höhere Gesittung naturgemäß zu einer immer tieferen Ausprägung des Charakteristischen bei beiden Geschlechtern führen muß, also zur immer bestimmteren Unterscheidung von Mann und Frau. Daraus ergibt sich, daß das Streben, den Frauen den gleichen Beruf mit den Männern zu überweisen, keine That des Fortschrittes, sondern der wahrhaften Reaction, der Rückkehr zur ursprünglichen Rohheit wäre. Das leitet uns denn zu dem Kapitel über die Emancipation von den Frauen. Mit dem Versuch eines solchen Rückschrittes, der ein durchaus widernatürlicher ist, würde aber den »Frauen« die Schmach angethan, daß man sie als zu »Weibern« entartet voraussetzte.
Zweites Kapitel. Die Scheidung der Geschlechter im Processe des Culturlebens
Bei fast allen Bildnissen berühmter weiblicher Schönheiten aus vergangenen Jahrhunderten überraschen uns die bestimmt geführten Conturen und Züge; es dünken uns diese Köpfe zu männlich gegenüber dem Urbild weiblicher Schönheit, welches uns Modernen vorschwebt.