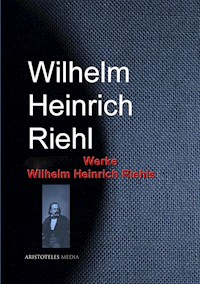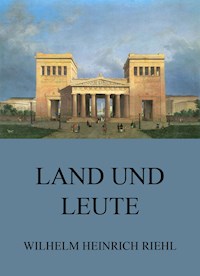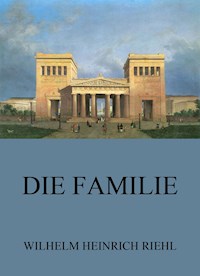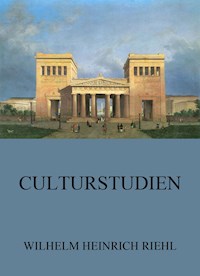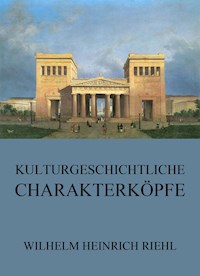
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Nicht bloß für den Maler, auch für den Schriftsteller gibt es eine Kunst des Porträts. Sie wird von beiden freilich nicht in gleicher, sondern nur in annähernd verwandter Weise geübt. Der Schriftsteller kann eine Persönlichkeit in ihrer ganzen Entwickelungsgeschichte erzählend schildern, und so steigert sich das Porträt zuletzt zum Lebensbilde, zur Biographie. Der Porträtmaler malt keinen Lebenslauf; er vermag die Erscheinung nur in einem gegebenen Augenblicke festzuhalten. Ist er aber der rechte Künstler, dann wird sich in diesem Augenblicksbilde doch zugleich ein ganzes durcharbeitetes Leben des Dargestellten spiegeln. Dieser Band beinhaltet biographische Aufsätze zu Die Idylle eines Gymnasiums. Moriz von Schwind. Ein vormärzlicher Redakteur. Emilie Linder. Der moderne Benvenuto Cellini. Eine Rheinfahrt mit Viktor Scheffel. König Maximilian II. von Bayern. Eine Fußreise mit König Max. Ludwig Richter. Richard Wagner.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kulturgeschichtliche Charakterköpfe
Wilhelm Heinrich Riehl
Inhalt:
Wilhelm Heinrich Riehl – Biografie und Bibliografie
Vorwort.
Die Idylle eines Gymnasiums.
Moriz von Schwind.
Ein vormärzlicher Redakteur.
Emilie Linder.
Der moderne Benvenuto Cellini.
Eine Rheinfahrt mit Viktor Scheffel.
König Maximilian II. von Bayern.
Eine Fußreise mit König Max.
Ludwig Richter.
Richard Wagner.
Kulturgeschichtliche Charakterköpfe, W. H. Riehl
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849633905
www.jazzybee-verlag.de
Wilhelm Heinrich Riehl – Biografie und Bibliografie
Namhafter kulturhistorischer Schriftsteller, geb. 6. Mai 1823 in Biebrich a. Rh., gest. 16. Nov. 1897 in München, studierte in Marburg, Tübingen, Bonn und Gießen, redigierte seit 1846 mit Giehne die »Karlsruher Zeitung«, begründete dann mit Christ den »Badischen Landtagsboten« und gab, nachdem er zum Mitgliede der deutschen Nationalversammlung gewählt worden, 1848 bis 1851 die konservative »Nassauische allgemeine Zeitung« heraus, während er zugleich mit der musikalischen Leitung des Hoftheaters in Wiesbaden betraut war. Nachdem er 1851–53 bei der Redaktion der Augsburger Allgemeinen Zeitung tätig gewesen, folgte er 1854 einem Ruf als Professor der Staats- und Kameralwissenschaften nach München, wo er 1859 die Professur der Literaturgeschichte übernahm und 1862 Mitglied der Akademie der Wissenschaften ward. 1885 wurde er zum Direktor des bayrischen Nationalmuseums ernannt. Er schrieb: »Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik«, in 4 Bänden: Band 1: »Land und Leute« (Stuttg. 1853, 10. Aufl. 1899), Band 2: »Die bürgerliche Gesellschaft« (1851, 9. Aufl. 1897), Band 3: »Die Familie« (1855, 12. Aufl. 1904; Band 1–3 auch in Schulausgaben von Th. Matthias, Stuttg. 1895 bis 1896), Band 4: »Wanderbuch« (1869, 4. Aufl. 1903); »Die Pfälzer« (das. 1857, 2. Aufl. 1858); »Kulturstudien aus drei Jahrhunderten« (das. 1859, 6. Aufl. 1903); »Die deutsche Arbeit« (das. 1861, 3. Aufl. 1884); »Musikalische Charakterköpfe« (das. 1853–77, 3 Bde.; Band 1 u. 2 in 8. u. 7. Aufl. 1899); »Kulturgeschichtliche Novellen« (das. 1856, 5. Aufl. 1902); »Geschichten aus alter Zeit« (das. 1863–65, 2 Bde., u. ö.); »Neues Novellenbuch« (das. 1867, 3. Aufl. 1900); »Aus der Ecke, neue Novellen« (Bielef. 1875; 4. Aufl., Stuttg. 1898); »Am Feierabend«, 6 neue Novellen (Stuttg. 1880, 4. Aufl. 1902); »Lebensrätsel«, 5 Novellen (das. 1888, 4. Aufl. 1906), die letztern 6 Werke auch gesammelt als »Geschichten und Novellen« (das. 1898–1900, 7 Bde.); »Freie Vorträge« (das. 1873, 2. Sammlung 1885); »Kulturgeschichtliche Charakterköpfe, aus der Erinnerung gezeichnet« (das. 1891, 3. Aufl. 1899); »Religiöse Studien eines Weltkindes« (das. 1894, 5. Aufl. 1900) und eine Reihe kulturgeschichtlicher Abhandlungen in den Denkschriften der Münchener Akademie und der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Auch veröffentlichte er zwei Hefte Liederkompositionen u. d. T.: »Hausmusik« (Stuttg. 1856, 2. Aufl. 1859) und »Neue Lieder für das Haus« (Leipz. 1877). Unter Riehls Leitung erschien 1859–67 die »Bavaria«, eine umfassende geographisch-ethnographische Schilderung Bayerns in 5 Bänden. 1870–79 gab er das von Raumer begründete »Historische Taschenbuch« heraus. Nach seinem Tod erschien noch sein (einziger) Roman: »Ein ganzer Mann« (Stuttg. 1897, 4. Aufl. 1898). Vgl. Simonsfeld, Wilh. Heinr. R. als Kulturhistoriker (Münch. 1898). – Seine Tochter Helene machte sich als Landschaftsmalerin bekannt.
Kulturgeschichtliche Charakterköpfe
Vorwort.
Nicht bloß für den Maler, auch für den Schriftsteller gibt es eine Kunst des Porträts. Sie wird von beiden freilich nicht in gleicher, sondern nur in annähernd verwandter Weise geübt.
Der Schriftsteller kann eine Persönlichkeit in ihrer ganzen Entwickelungsgeschichte erzählend schildern, und so steigert sich das Porträt zuletzt zum Lebensbilde, zur Biographie. Der Porträtmaler malt keinen Lebenslauf; er vermag die Erscheinung nur in einem gegebenen Augenblicke festzuhalten. Ist er aber der rechte Künstler, dann wird sich in diesem Augenblicksbilde doch zugleich ein ganzes durcharbeitetes Leben des Dargestellten spiegeln; wir ahnen in dem Gemälde ein Stück Biographie, mir erschauen den »Charakter« eines uns vielleicht persönlich ganz unbekannten Mannes.
Kann auch die Feder des Schriftstellers solche Bildnisse zeichnen, die uns nur eine Episode geben, nur ein andeutendes Augenblicksbild, und die doch den ganzen Charakter des Porträtierten erraten lassen, ja denselben in ein neues Licht setzen? Sie kann es. Viele Autoren haben dergleichen schon mit Glück versucht, und ich versuche es auch in den folgenden Studienköpfen.
Nach der Art ihrer Ausführung bilden sie verschiedene Gruppen. Einige sind wie mit flüchtiger Kreide oder Kohle nur ganz leicht hingeworfen; eine Anekdote, eine zufällige Begegnung gab den Anlaß. Andre sind in volleren Farben gemalt; die Beobachtungen andauernderen und tieferen Verkehrs liegen zu Grunde. Ein fürstliches Porträt erscheint sogar zweimal, in zwiefachem Gewande. Fürsten lieben es ja, demselben Künstler öfters zu sitzen. Zu den realistischen Bildnissen gesellt sich das Idealporträt eines Mannes, der ein echtes Kind unsrer Zeit sein würde, wenn er überhaupt bereits geboren wäre, der mehrfach vorhanden und eben darum so einfach nicht zu finden ist, wie ich ihn dargestellt habe. Also recht eigentlich ein »kulturgeschichtlicher« Charakterkopf.
Neben berühmten Persönlichkeiten stehen unberühmte, neben altbekannten vergessene. Die Neigung, zwischendurch auch letztere zu skizzieren habe ich bereits in meinen »Musikalischen Charakterköpfen« gezeigt. Sie hängt mit einem andern eigentümlichen Zuge meines Wesens zusammen: Ich hatte stets eine gewisse Vorliebe für die Ueberzeugung der Minderheiten, indem ich mich sofort fragte, was ist denn die verhüllte Wahrheit ihres Strebens? und eine gewisse Abneigung gegen große und herrschende Mehrheiten, indem sich mir sofort die Frage aufdrängte, was hier das offenbar Verkehrte sei? Vielleicht wird man jene sehr unzeitgemäße Vorliebe am stärksten in der Studie über den heute berühmtesten Kopf meines Cyklus, über Richard Wagner, ausgesprochen finden.
Der kulturgeschichtliche Hintergrund war mir in diesem Buche ebenso wichtig wie die dargestellten Personen, und so sind alle diese Skizzen zugleich Beiträge zur Kulturgeschichte und zwar zumeist zur Kulturgeschichte einer Zeit, die uns heute am allerfernsten liegt – und das ist die nächstvergangene Zeit. Wir pflegen sie nebenbei am ungerechtesten zu beurteilen, weil wir uns von ihr zu befreien trachten. Auf einem weiten Umweg bin ich zu diesem Buch gekommen. Ich begann vor mehreren Jahren die Erinnerungen meines eigenen Lebens zu schreiben. Da aber gegenwärtig jedes Jahr etliche Bücher bringt, in welchen große und kleine Größen ihre eigenen Memoiren niedergelegt haben, so erkannte ich es für überflüssig, auch mich noch diesem stets wachsenden Reigen anzuschließen.
Ich gab es auf, darzustellen, wie ich mich selbst erlebt habe und schilderte vielmehr, wie ich andre Leute erlebt hatte, dann aber auch, wie ich im Bilde andrer meine Zeit erlebte.
Dieses »Buch der Erinnerung«, wie ich es anfangs taufen wollte, mag dann immer noch an den ursprünglichen, später aufgegebenen Plan erinnern, und so kam es, daß zwischen den neun Charakterköpfen, die hier vorgeführt werden, überall noch ein zehnter hervorlugt, der aber nicht genannt ist.
Starnberg, 16. August 1891.
W. H. R.
Die Idylle eines Gymnasiums.
I.
Es ist heutzutage bedenklich, über ein Gymnasium und gar über einen Gymnasialdirektor zu schreiben, weil so entsetzlich viel über Gymnasien geschrieben wird. Der Leser fürchtet, gelangweilt zu werden, wenn der Schriftsteller sein Thema friedlich behandelt, oder geärgert, wenn er polemisch kritisch schreibt. Ich hoffe das eine nicht zu thun und wünsche das andre zu vermeiden. Denn ich erzähle von einer fernen, märchenhaften Zeit, wo es noch ein Vergnügen war, Gymnasiast zu sein, und wo ein Gymnasium noch für ein Ding galt, welches sich von selbst verstand. Das Gymnasium war noch keine »Frage«. Vielleicht ist es dann auch ein Vergnügen, von der Idylle eines Gymnasiums jener Zeit zu lesen.
Ort der Handlung ist Weilburg an der Lahn; Zeit der Handlung 1837–41, d. h, die Zeit, da ich selber dort auf den Schulbänken saß. Das Weilburger Gymnasium war damals viel vornehmer als heutzutage; denn es war das einzige im ganzen Herzogtum Nassau. Als das nassauische Gesamthaus noch in verschiedene Linien geteilt war, hatte es auch mehrere nassauische Gymnasien gegeben, allein nachdem die weilburgische Linie zum Alleinbesitz der alten Stammlande gekommen, gab es nur noch das »Landesgymnasium« in Weilburg. Es bestand nur aus den vier Oberklassen, und da sich die Unterklassen in den »Pädagogien« (Lateinschulen) andrer Städte befanden (in Wiesbaden, Dillenburg und Hadamar), so waren die Weilburger Gymnasiasten lauter junge Herren. Das Land besaß keine Universität, folglich war das Gymnasium die höchste wissenschaftliche Anstalt des Herzogtums und sein Direktor die höchste gelehrte Autorität im Staatskalender. Konkurrierende Realgymnasien existierten ebenfalls nicht, und die Streitfrage über das innere Recht und die äußere Berechtigung beider Schularten war noch ungeboren.
Wenn keine Universität im Lande war, dann pflegte schon vor Jahrhunderten das Gymnasium sich etwas akademischer auszuwachsen, wie wir in den alten Reichs- und Hansastädten sehen, deren stolze Bürger vordem die Gründung von Universitäten lieber benachbarten Fürsten überließen, dafür jedoch ihre Gymnasien um so reicher ausstatteten und höher hinauf trieben.
Aehnliches galt auch von unsrer Schule; denn wenn Weilburg auch keine Reichsstadt war, so wog doch das ganze Herzogtum etliche Reichsstädte auf, und seine Gymnasiallehrer durften wohl ebensogut ein kleines Stück Universität vorwegnehmen wie ihre Kollegen im alten Nürnberg oder im alten und neuen Hamburg.
Unser altmodisches Schulgebäude von 1780 trug über seinem Haupt-Eingang auch nicht etwa die bureaukratische Aufschrift: »Herzoglich Nassauisches Landesgymnasium«, sondern die akademische: Sapere et fari.
Von zweien unsrer Lehrer sagte man, daß sie bei günstigerem Geschick wohl würdig gewesen wären, das Katheder einer Universität zu zieren. Kein Wunder, daß sie beim Unterricht ihrer Primaner mitunter verfuhren, als ob sie Studenten vor sich hätten, und daß dann diese Primaner sich selbst auch als halbe Studenten betrachteten. Nur verfielen wir dabei nicht in die äußerliche Nachahmung studentischer Sitten, weil wir in der abgelegenen Lahnstadt deren Vorbild nicht vor Augen hatten. Wir trugen keine farbigen Bänder und Mützen und bildeten keine heimlichen Korps, die bereits in Fühlung mit den Verbindungen irgend einer Hochschule gestanden hätten, wie dies bei den Gymnasiasten einer Universitätsstadt zu geschehen pflegt. Wir wollten Gymnasiasten sein, aber – sehr gelehrte Gymnasiasten.
Ein weiterer Umstand wirkte mit, den Schülern ein gewisses Bewußtsein studentischer Selbständigkeit zu geben. Nur die wenigsten hatten ihr Elternhaus in dem Städtchen, welches etwa 2400 Einwohner zählte; die weit überwiegende Mehrzahl war aus allen Teilen des Landes herbeigeströmt und wohnte bei kleinen Bürgersleuten, mehr noch bei Beamtenwitwen, die selbst wieder von nah und fern nach Weilburg gezogen waren, um zur Verbesserung ihres bescheidenen Daseins »Gymnasiasten zu halten«. Ein neu ankommender Gymnasiast war ein ebenso gesuchter Mann in der Gymnasialstadt, wie ein neu ankommender Student in der kleinen Universitätsstadt. Man stellte zwar noch nicht statistisch fest, wie viel Geld die hundert fremden Gymnasiasten alljährlich nach Weilburg brachten, aber die jungen Leute ahnten doch, daß sie der Stadt etwas wert seien und in ihr eine Rolle spielten, und wurden auch demgemäß von den Bürgern behandelt. Sie erfreuten sich eines viel unabhängigeren Lebens als zu Hause und atmeten auch in diesem Sinne bereits etwas akademische Luft, wenn sie mit 14 oder 15 Jahren zum erstenmal zu den Thoren der Musenstadt einzogen.
Man erzählte sich, daß früher selbst Ausländer, zum Teil aus weiter Ferne, durch den gelehrten Ruf der Schule nach Weilburg geführt worden seien. Allein diese Tage waren vorbei, und zu meiner Zeit galten nur noch zwei Schweizer als Vertreter des »fernen Auslandes«.
Zu allen diesen Besonderheiten gesellte sich der überaus eigenartige Charakter der Stadt.
Die Altstadt liegt auf einem mächtigen Felsenrücken, der auf drei Seiten von der Lahn umflossen ist und nur auf der vierten Seite durch einen schmalen Grat mit den angrenzenden Höhenzügen zusammenhängt. Die Neustadt jenseit des Flusses bestand vor 60 Jahren nur erst aus wenigen Häusern. Also eine Stadt auf Felsen, eine Stadt auf einer Halbinsel! und Fels und Wald ringsum. Man war zugleich in der Stadt und auf dem Lande. Man konnte an sechs Tagen sechs Nachmittagsspaziergänge machen und jedesmal bequem eine andre Burgruine erreichen. Welche Fülle der Romantik für jugendliche Gemüter!
Die Stadt ist architektonisch beherrscht von dem alten Fürstenschlosse mit seinem »Lustgarten«, der sich auf Terrassen über dem Felsenboden erhebt. Von der oberen Lahnseite erscheint das Schloß wie eine verfallende deutsche Burg und von der unteren wie ein französischer Fürstensitz aus den Tagen Ludwigs XIV. Aehnlichen Doppelcharakter zeigen die alten Gassen der Stadt und der Marktplatz. Und die Landschaft weithin stimmt gleichfalls dazu: beim kürzesten Gange wechselt die Scene, bald lieblich, bald grotesk romantisch; jedes Thal, jede Höhe überrascht mit einer ganz neuen Ansicht, und selbst die Gesteinsarten, die dem Boden entsteigen, reihen sich in bunter Vielgestalt hart aneinander: Marmor und Basalt, Porphyr, Grünstein, Schalstein, Grauwacke, Thonschiefer. Auch die sozialen Zustände der Kleinstadt gaben das Bild bunter Mannigfaltigkeit auf engstem Raum. Weilburg hatte damals noch gar keine Industrie, aber das Land ringsum wimmelte von kleinen Eisen- und Braunkohlengruben, und in weiterem Ringe sandten stattliche Hüttenwerke ihre Rauchsäulen in die Luft. Die Stadt war nicht bloß Gymnastalstadt, sie war auch Militärstadt, mit einem Bataillon Infanterie auf 2400 Einwohner, Beamtenstadt, eine Stadt des kleinbürgerlichen Gewerbes, und vor allem die alte, erst seit zwanzig Jahren verwaiste Residenzstadt, die sich schon von fernher durch die majestätischen Lindenalleen ankündigte, welche zu ihren beiden Thoren führten.
Es war die Welt im kleinen, welche uns Gymnasiasten so vielseitig anregend umgab. Ich halte es für ein günstigeres Geschick, wenn wir in jungen Jahren die Welt im kleinen kennen gelernt haben, als wenn die große weite Welt schon frühe unsre Augen verwöhnt und blendet. Zur persönlichen Physiognomie eines Gymnasiums trägt nicht nur der Genius des Ortes bei, in welchem die Anstalt wurzelt, sondern auch ihre Geschichte. Und das Weilburger Gymnasium hatte seine Geschichte. Im Jahre 1540 gegründet, zählte es zu jenen Schulen, die von der Melanchthonischen Verbindung des Humanismus mit Luthers Reformation ihren Ausgang nahmen. Wir rüsteten uns, das 300jährige Jubelfest der Anstalt zu begehen, und wenn wir auch im einzelnen nur wenig von ihrer wechselnden Geschichte wußten, so schien uns dieses Wenige um so merkwürdiger, und wir waren stolz, einer Schule anzugehören, die auf althistorischem Boden stand.
Man rühmt mit Recht die innere Mannigfaltigkeit der deutschen Universitäten, deren jede ihr eigenes Gesicht hat und ihren eigenen Geist, und die darum doch allesamt eine gewisse Familienähnlichkeit nicht verleugnen.
Aehnlich war es früher bei den deutschen Gymnasien. Welcher Unterschied zwischen solchen Anstalten, die aus einer althumanistischen oder altprotestantischen Stiftung hervorgewachsen waren; aus einer Jesuiten- oder Benediktiner-Schule; zwischen solchen, die der pietistischen oder der rationalistischen Zeit des vorigen Jahrhunderts entstammten; zwischen den Gymnasien einer Universitätsstadt oder Reichsstadt, eines großen oder kleinen Landes! wozu sich dann wieder die nachhaltig maßgebenden Einflüsse epochemachender Schulmonarchen gesellten. Die lebenskräftige Vielgestalt der deutschen Bildung ist und war ebensosehr durch die scharfgeschnittenen Charaktertypen unsrer Gymnasien wie unsrer Universitäten bedingt.
Es würde eine prächtige Aufgabe sein, die deutschen Gymnasien in ihrer so fein und tief unterschiedenen historischen Persönlichkeit mit Geist und Beobachtungsgabe darzustellen und dann wieder die Einzelporträte zu großen Gesamtgruppen zu vereinigen. Der rechte Mann dazu wird nur schwer zu finden sein, und er müßte bald sich finden. Denn mit unwiderstehlicher Wucht sucht hier die staatliche Nivellierung alles Sonderleben auszutilgen und alle Gelehrtenschulen des einzelnen Staates und wo möglich des ganzen Reichs über den gleichen Kamm zu scheren. Wir haben viele Rechte gewonnen, nur das Recht des Individuums und des Individuellen geht uns mehr und mehr verloren.
II.
Nachdem ich den Hintergrund gemalt, wende ich mich zur Ausführung des Porträts, dem diese Studie gewidmet ist.
An der Spitze des Weilburger Gymnasiums stand »zu meiner Zeit« der Oberschulrat und Direktor Friedrich Traugott Friedemann, eine höchst merkwürdige Erscheinung.
Ein geborener Sachse, hatte er auf der Fürstenschule zu Meißen und auf der Universität Wittenberg jene gründlichen philologischen und theologischen Studien gemacht, durch welche sich viele seiner Landsleute damals auszeichneten, die da und dort in Deutschland höhere Lehrstellen bekleideten. Seine Laufbahn in jungen Jahren war eine staunenswert rasche: schon mit 20 Jahren wurde er Konrektor am Gymnasium in Zwickau, mit 27 Rektor des Wittenberger Gymnasiums, dann kam er in gleicher Eigenschaft nach Braunschweig, und als er 1828 in seine dritte Direktorstelle nach Weilburg berufen wurde, zählte er erst 35 Jahre. Er erschien aber nach Aussehen, Haltung und Wesen älter als er wirklich war. Es ist sehr günstig für rasches Fortkommen in der Welt, wenn man in jüngeren Jahren älter und in älteren Jahren jünger aussieht als man ist. Die Leute vertrauen uns dann mehr in der Jugend und mißtrauen uns weniger im Alter.
Allein trotz seines ernsthaften Gesichtes war der neue Direktor den Nassauern doch noch zu jung gewesen, zumal man glaubte, ein alter verdienter Lehrer, Johann Philipp Krebs, ein Schüler Friedrich August Wolfs und Verfasser des bekannten »Antibarbarus«, sei um seinetwillen zurückgesetzt worden. Krebs (aus Halle) war gleichfalls ein Sachse, zwei Lehrer, welche in Weilburg privatim eine vorbereitende Lateinschule hielten, stammten aus Sachsen, und als nun gar wieder ein Direktor aus Sachsen berufen wurde, schien dies denn doch zu viel des Sächsischen.
Der neue »Ausländer« fand alsbald viele Neider und Gegner. Aber die persönliche Gunst des Herzogs Wilhelm stützte ihn, wodurch er freilich nicht populärer wurde. Im nassauischen Domänenstreite stand Friedemann als Mitglied des Landtags auf Seiten der Regierung und hatte sich dadurch den Haß der Liberalen zugezogen.
Der tüchtige Mann, welcher sich eifrigst bemühte, seine Schule neu und reicher auszugestalten, und der namentlich, was ja den Nassauern hätte schmeicheln sollen, den akademischen Charakter des »Landesgymnasiums« fest ins Auge faßte, wurde doch allmählich einer der bestgehaßten Männer des Landes, und die Weilburger »Idylle« mochte ihm wohl nicht sehr idyllisch erscheinen. Man hatte kein Verständnis für sein entschiedenes, mitunter etwas schroffes norddeutsches Wesen, und er selbst vermochte nicht die rechte Fühlung mit der ungebundeneren mittelrheinischen Art zu finden. In einem kleinen Lande ist der kleine Klatsch öffentlichen Persönlichkeiten weit gefährlicher als in großen Staaten, und Friedemann hatte unter solchem Klatsch bedenklich zu leiden. Viele Schüler brachten schon aus dem Elternhause die Vorurteile gegen ihren Direktor mit.
Hierzu kam, daß auch die Lehrerschaft dem Direktor mehr Kritik und stille Abneigung als anerkennendes Wohlwollen entgegenbrachte. Dieser Lehrkörper war geradeso individuell und bunt in seiner Zusammensetzung wie ganz Weilburg nebst Umgegend.
Nur eines war allen Lehrern gemeinsam: sie wollten nichts andres sein als was sie waren, und murrten nicht über ihre Stellung, während man heutzutage definieren kann: ein Gymnasiallehrer ist ein Mann, der eigentlich etwas andres sein möchte als ein Gymnasiallehrer.
Unsre älteren Lehrer hatten in den stürmischen revolutionären und kriegerischen Zeitläuften ihre Studien gemacht, wo das Alte sich auflöste, die jüngeren in der folgenden Zeit, wo das Neue sich erst zu bilden begann. Kein Wunder, daß fast ein jeder nach seinen Kenntnissen wie nach seiner Methode ein Original war, einige recht altmodisch und andre ganz neumodisch. Von der gleichförmigen modernen Schablone der Lehrerbildung, des Schulplans und der Lehrweise war noch wenig zu spüren. Es herrschte eine Art akademischer Lehrfreiheit, und wenn wir Schüler in eine höhere Klasse aufrückten, dann kamen wir in eine neue Welt und mußten uns erst in den neuen Lehrer hineinlernen.
Für talentvolle und fortgeschrittenere Schüler war dieser Wechsel nützlich, für Schwachköpfe gefährlich. Allein man basierte das damalige freie Lehrsystem so wenig wie heute das gebundene auf die Schwachköpfe unter den Schülern.
Vermutlich litt der Direktor am meisten unter dieser Mannigfaltigkeit seiner Lehrkräfte, zumal er selber wieder ganz anders geartet war als alle miteinander. Und wir Schüler waren ja auch nicht blind gegen die Kontraste in den Charakteren unsrer Lehrer; wir machten unwillkürlich Charakterstudien an ihnen, erspähten mit dem Scharfblick junger Augen die Einseitigkeiten und Schwächen eines jeden und gaben jedem epigrammatisch seinen Spitznamen. Doch letzteres war damals allgemeine Sitte in Nassau, berechtigte Volkseigentümlichkeit, jedermann führte seinen Spitznamen, nur die allerlangweiligsten Menschen ausgenommen. Und gerade über die besten Lehrer, die wir doch im stillen ganz gern hatten, räsonnierten wir laut am allermeisten. Genau so machten es ja auch unsre Väter im öffentlichen Leben. Der echte Nassauer sprach: »Ich verehre meinen Herzog, ich liebe meinen Herzog, ich lasse mich totschlagen für meinen Herzog: – dafür will ich aber auch über ihn räsonnieren dürfen.«
Aus alledem ersieht man, daß Direktor Friedemann in Weilburg weniger auf Rosen gebettet war als auf Dornen. Dennoch wußte er die Zügel fest zu führen und der Anstalt seinen Geist einzuprägen. Er konnte sehr gewinnend liebenswürdig sein, aber auch sehr grob. Seine Gegner behaupteten, das erstere sei Kunst, das letztere Natur. Allein er war doch nur grob, weil er ein so überaus eifriger, ja leidenschaftlicher Schulmann war; seine Schule lag ihm am Herzen, darum kam ihm auch seine Grobheit so recht von Herzen, und wir Schüler ahnten dies selbst dann, wenn er uns alle miteinander »Flegel« nannte, was bei der geringsten Unart zu geschehen pflegte.
Die so vielfach zerklüftete Anstalt war dennoch fest zusammengehalten durch ein ideales Band: durch die gemeinsame Begeisterung für die humanistische Bildung, für das Studium des klassischen Altertums, als der unantastbaren Grundlage alles höheren wissenschaftlichen Strebens. Hierin lag dann auch die Wurzel der Autorität, welche Friedemann bei Lehrern und Schülern besaß. Seine klassischen Kenntnisse waren äußerst vielseitig, und er wußte mit ihnen nach jeglicher Richtung anzuregen. Nicht vergebens war er ein Freund und Mitarbeiter des genialen frühverstorbenen Spohn gewesen, der sich ebenso eifrig »mit der alten Geographie wie mit der Litteratur des augusteischen Zeitalters, mit der Mythologie der Völker des Ostens und Nordens wie mit der Schrift und Sprache der alten Aegypter« beschäftigte. Der Universalismus lag in der Luft der Zeit, und wenn Friedemann auch nicht so weit griff wie Spohn, so imponierte er doch durch seinen Universalismus.
Die klassische Philologie war für ihn die Wissenschaft der Wissenschaften, das Zentrum, zu welchem er immer wieder zurückkehrte. Die Philologie war ihm freilich nicht bloß Sprachforschung, sie umschloß ihm die ganze antike Welt mit ihrer Philosophie und Geschichte, mit Kunst und Leben. Darum zählt er in seiner »Philologischen Handbibliothek« auch Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Klopstock, Lessing, Herder, Wieland und Schiller zu den »Philologen«. Nur Goethe fehlt, obgleich er doch der klassischeste unsrer Klassiker ist, der Genius, den Griechenland hervorzubringen vergessen hatte.
Friedemann eiferte dagegen, wenn man die alten Sprachen »tote Sprachen« nannte: sie lebten und sollten uns lebendig sein. Darum verfolgte er auch das Lateinische gerne bis ins Mittelalter und noch lieber über das Mittelalter hinaus zur Wiedergeburt der Wissenschaften. Da sah man ja, daß die Sprache des alten Rom weltbeherrschend fortlebte und sich immer wieder erneuert hatte.
Es steckte in Friedemann noch etwas von der Art der holländischen Philologen des 17. und 18. Jahrhunderts, die damals der gelehrten Welt noch weit näher lagen als heutzutage; war doch der letzte derselben, Wyttenbach, erst 1820 gestorben. In der Schule lasen wir selbstverständlich nur die alten Klassiker, aber wir mußten die »Briefe« und kleinen Aufsätze eines Hemsterhuis, Ruhnken, Wyttenbach, Valckenaer aus dem Deutschen ins Lateinische zurückübersetzen, damit wir lernten, wie sich moderne Thatsachen und Gedanken in ciceronianischem Gewande ausnehmen. Das Elogium Hemsterhusii und die Vita Ruhnkenii wurden uns zur Privatlektüre empfohlen, und wir lasen diese anmutigen Schriften gern. So kamen wir dazu, neben Horaz und Virgil auch Gedichte von Sarbievius, Lotichius, Eobanus Hessus und Jakob Balde zu Hause zu lesen, und wir kümmerten uns nicht darum, daß Eobanus von Luther der Rex poetarum genannt worden und Balde der Rex poetarum der Jesuiten gewesen war. Hatten doch beide so reine, schöne Verse geschrieben und das Porträt des Jesuiten Balde hing sogar in einem Klassenzimmer des Gymnasiums, dessen Ursprung in der Reformation wurzelte. Uebrigens machte der Weilburger Direktor selber gute lateinische Verse und schien uns schon um deswillen hoch über dem Rektor des Wiesbadener Progymnasiums zu stehen, der nur deutsche Verse machte, die nicht immer gut waren. Friedemann hatte den Gradus ad Parnassum von Sintenis neu herausgegeben, und so mußten denn auch wir fleißig lateinische Verse machen, unter Umständen sogar griechische, ja es war der Stolz Friedemanns, daß einer seiner besten Primaner Schillers Verse: »Das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Uebel größtes aber ist die Schuld« in eine wohlgelungene hebräische Parallelstrophe übersetzt hatte.
Friedemann war keine schöpferische, sondern eine überwiegend sammelnde und aufnehmende Natur, allein er wußte unablässig und geschickt wiederzugeben, was er aufgenommen hatte. Ein rechter Buchgelehrter, las und excerpierte er hundert Bücher, wenn er ein kleines Büchlein schreiben wollte, worin es dann von Citaten und Anmerkungen wimmelte. Manche seiner Schriften sehen wie eine einzige große Anmerkung aus. Die meist sehr langen Vorreden sind mit Noten gespickt, und man wundert sich nur, daß nicht auch das Titelblatt Anmerkungen zeigt. Dies unterblieb vermutlich wegen Mangels an Raum; denn mir liegt ein Friedemannscher Buchtitel vor, welcher 23 Druckzeilen zählt. Der langen Vorrede entspricht dann öfters ein ebenso langer »Nachtrag« am Schluß des Buches, in welchem der Autor noch eine Aehrenlese von Citaten aus solchen Büchern gibt, die ihm während des Druckes erst zu Gesicht gekommen waren. Uns Schülern kam diese unerschöpfliche Buchgelehrsamkeit zwar etwas »sächsisch« vor, wir bewunderten sie aber dennoch.
Wer immerfort liest, indem er schreibt, der kann nicht eigentlich schreiben, und so schrieb auch Friedemann eher langweilig als fesselnd, während er doch so fesselnd zu reden und zu lehren verstand.
Er trieb uns fortwährend zum Bücherlesen. Beim Beginn seines Jahreskurses in den oberen Klassen pflegte er durch mehrere Stunden eine Art Anleitung zur Bücherkunde zu geben und uns eingehend darzulegen, welche Schätze die Schulbibliothek für uns berge und namentlich, was an neuen Büchern hinzugekommen sei. Die Bereicherung dieser Bibliothek lag ihm sehr am Herzen, und er verfuhr dabei durchaus nicht einseitig. Auch die Bücherei eines Gymnasiums war in jener universalistischen Zeit keine bloße Fachbibliothek.
Ich bin kein Philologe geworden und nichts weniger als ein Bücherwurm; trotzdem hat Friedemann einen sehr bestimmenden Einfluß auf mich geübt: er weckte und reizte in mir die Neigung zu einer Vielseitigkeit, die vom Kleinen und Einzelnen ausgehend, immer weitere Kreise zieht, um zuletzt doch immer wieder zu einem idealen Centrum zurückzukehren.
Friedrich Thiersch, der ehrwürdige Praeceptor Bavariae, hat im Jahre 1838 ein dreibändiges Werk herausgegeben: »Ueber den gegenwärtigen Stand des öffentlichen Schulwesens im westlichen Deutschland etc.«, welches großes Aufsehen erregte, aber auch sofort heftige und bedeutende Gegner fand. In diesem Buche kommt unser armes Weilburger Gymnasium ganz besonders übel weg. Thiersch war bei seiner Studienreise zwar bis Amsterdam und Paris, aber nicht bis Weilburg vorgedrungen, und er selbst berichtet, daß er sich das Weilburger Gymnasium nur von Wiesbaden aus betrachtet habe. Weilburg liegt 14 Stunden Wegs von Wiesbaden entfernt, und das ist doch etwas weit, selbst für scharfe Augen. Nach Schulplänen, Programmen und amtlichen Berichten, die man sich im Regierungsbureau erbittet, konnte man eine so individuell lebendige Anstalt wohl kaum charakterisieren.
Thiersch tadelt besonders die Ueberzahl der Lehrstunden und das Uebermaß des Lehrstoffs. Er tadelt das Gleiche bei den Volksschulen, beim Lehrerseminar, bei den Pädagogien: die Nassauer lernen ihm überall zu vieles und zu viel und darum vermutlich sehr wenig. Aus einem Programm von 1833 weist er nach, daß ein Weilburger Primaner wöchentlich 48 Schulstunden habe, wobei es ihm dann noch freistehe, Italienisch, Englisch, Holländisch, Zeichnen u. dgl. privatim zu lernen. Das wäre ja eine entsetzliche »Idylle eines Gymnasiums« gewesen, wenn wir Tag für Tag acht Stunden hätten auf den Schulbänken sitzen müssen! Es gibt nichts Trügerischeres als Ziffern. Thiersch rechnet nämlich, daß Nebenfächer, von denen das eine im Sommer, das andre im Winter gelehrt wurde, während des ganzen Jahres vorgetragen worden seien, und kommt so zu der ungeheuerlichen Summe. Es ging eben wie beim Heidelberger Faß, auf dem bekanntlich 50 Paare tanzen können, – wenn eines nach dem andern tanzt, und so erfreuten wir uns sogar sehr vieler Freistunden, die durch Hausaufgaben wenig beschränkt waren, und die wir zum Umherschweifen in Feld und Wald weidlich benützten. Dies waren dann zugleich unsre Turnstunden, solange das Turnen noch verpönt blieb, weil es für einen Fallstrick zur Demagogie galt. Erst in den letzten Jahren von Friedemanns Direktorat wurde dieser Bann über den Turnunterricht gebrochen.
Begründeter konnte Thierschs Vorwurf erscheinen, daß zu vielerlei gelehrt werde. Ob vielerlei oder wenigerlei in einem Gymnasium gelehrt wird, erscheint mir freilich ziemlich gleichgültig, sofern man dabei nur etwas weniges lernt, nämlich: Denken, Reden und Schreiben.
Wenn neben den beiden alten Hauptsprachen noch Deutsch und Französisch steht, dann Religion, Geschichte, Geographie, Mathematik und Naturkunde, so wird man dies wohl kaum zu viel nennen. Wir hatten aber auch noch Literaturgeschichte, philosophische Propädeutik und für das Schlußjahr als Wegweiser zur Universität akademische Hodegetik, die sich naturgemäß zu einer Encyklopädie der Wissenschaften gestaltete. Das war offenbar des Guten zu viel. Aber merkwürdigerweise regten uns gerade diese »überflüssigen« Fächer ganz besonders an und reizten den Eifer selbst der Trägeren. Heutzutage würden sie dies kaum mehr thun, damals aber entsprachen sie dem philosophischen Geiste der Zeit. Jede Philosophie ist universalistisch; der Specialismus tritt erst in den Vordergrund, wenn die Philosophie zur Seite geschoben wird. Die überflüssigen Fächer entsprachen auch dem eingangs geschilderten akademischen Charakter des »Landesgymnasiums«. Denn es gibt keine Anstalt, wo mehr »Ueberflüssiges« gelehrt wird, als eine deutsche Universität, und doch ruht die Kulturmacht unsrer Universitäten ganz besonders in diesem Ueberfluß!
Schon im Jahre 1790 hatte man geglaubt, daß in Weilburg zu viel Philosophie getrieben werde, und dem entgegen zu arbeiten gesucht durch einen ausschließend philologischen Lehrplan, war aber später doch wieder zu einigen philosophischen Studien in den Oberklassen zurückgekehrt. Und wir Schüler waren nicht böse darüber.
Gefährlicher noch, weil viel zerstreuender als das Philosophieren ist das Musizieren, und Friedemann ließ sich die Pflege der Musik unter seinen Gymnasiasten sehr angelegen sein. Das ist Thiersch entgangen.
Die Singstunden waren obligatorisch für alle; wer gar nicht singen konnte, der mußte wenigstens Choräle singen. Es wurden aber nicht bloß protestantische Choräle gesungen, sondern auch katholische Hymnen. Das Gymnasium war auf protestantischer Grundlage dennoch konfessionell gemischt, weil es ja das einzige war. Man hielt große Stücke auf Toleranz, und als eine Art Toleranzlied sangen wir Luthers »Ein' feste Burg« mit neuem Texte, welcher anhob: »Den Vater, Brüder, betet an, er hat der Kinder viele«, und mit den Worten schloß:
»Nicht was du glaubest gilt; Was aus dem Glauben quillt: Es gilt dein Thun, dein Handeln!«
Wenn Luther das gehört hätte! er würde uns alle miteinander zum Tempel hinausgejagt haben, den Direktor voran.
Wir sangen auch schöne Volkslieder und, wenn wir ganz besonders brav waren, einzelne Chorsätze aus Opern, die eigens in usum Delphini zurecht gearbeitet waren. Unvergeßlich bleibt mir das Adagio der Agathen-Arie aus dem Freischütz: »Leise, leise, fromme Weise« als Chor für vier Männerstimmen mit der Überschrift: »Gebet«. Der Text hatte nur eine Variante von drei Buchstaben: statt »vor Gefahren ihn zu wahren« sangen wir etwas egoistischer »vor Gefahren uns zu wahren, sende deiner Engel Scharen!« Mich erbaute dieses Gebet in hohem Grade; als ich später die Originalfassung von der Bühne hörte, konnten mir die berühmtesten Agathen die wundervolle Stelle nicht ganz zu Dank singen: ich hatte mir sie doch noch viel unschuldsvoll frömmer gedacht.
Aber die Hauptaufgabe der erlesenen Hälfte unsers Chors lag nicht in solchen Liedern: wir sangen fleißig Psalmen und Motetten des strengen Stils; es erschloß sich uns ein gutes Stück jenes reichen protestantischen Motettenschatzes, der früher auch in den Kirchen gehört wurde und damals in die Schule verbannt war. Ich lernte Motetten von Rolle, Schulz, Bergt, Berner, Häring, Schicht, Schnabel, Rink kennen, die jetzt fast kein Mensch mehr kennt, dazu von Bernhard Klein, Spohr, Mendelssohn, ja wir wagten uns sogar an einen sechsstimmigen Psalm von Heinrich Schütz. (Sebastian Bach und die Motettenmeister des 16. Jahrhunderts lagen damals noch in sagenhafter Ferne.)
Unser tüchtiger Gesanglehrer Heinrich Droes hatte eine dreibändige Sammlung solch ernster und leichterer Gesangmusik für den Schulgebrauch herausgegeben, und Friedemann hatte drei Vorreden dazu geschrieben, die sowohl durch ihre citatenreiche musikalische Gelehrsamkeit, welche von Ambrosius und Gregor bis Meyerbeer reichte, wie durch ihre weitgreifenden pädagogischen Winke Aufsehen erregten und der Biographie unsers Philologen sogar einen Platz im Tonkünstler-Lexikon verschafften, obgleich Friedemann, wenigstens als Direktor, sicherlich nicht gesungen oder gegeigt oder auch nur Klavier gespielt hat. Dennoch hatte er mehr Verdienste um das musikalische Leben in Nassau als mancher Kapellmeister.
Aber das war doch eine Sünde gegen die magere geistige Diät der Schüler, wie andre sie forderten. Und Friedemann sündigte noch weiter gegen diese Diät: wir trieben nicht nur Vokalmusik, sondern auch Instrumentalmusik, wir hatten unser eigenes Orchester, freilich nur in Form eines Vereins; allein dieser Verein war von oben angeregt, geordnet und gefördert, die Aula war unser Musiksaal. Da der Beitritt zum Verein freiwillig war, erfolgte er um so zahlreicher. Geiger und Cellisten fanden sich leicht unter den Schülern, und der längste Gymnasiast spielte den Kontrabaß. Schwieriger waren die Bläser zu beschaffen. Allein da wir wußten, daß diejenigen, welche sich für ein seltenes Instrument, wie Hoboe, Horn, Fagott, Trompete, opferten, eine ebenso seltene Gunst beim Direktor gewannen, da überdies jene Instrumente vom Gymnasium angekauft waren, und Nachhilfe-Unterricht gratis erteilt wurde, so kam doch auch ein Blaschor zusammen. Im Notfall mußten etliche Militärmusiker aushelfen, ja sie halfen selbst da, wo es nicht not war. Unser Dirigent liebte es nämlich, die veraltete Orchestrierung eines Händel, Haydn, Gluck oder Mozart durch den Zusatz von Klarinetten, Posaunen, Piccolos u. dgl. aufzufrischen. Das ist die Erbsünde der Musiker aller Zeiten, daß sie immer die Werke älterer Meister haben verbessern wollen, sei es durch Zusätze oder durch Striche. Die moderne Instrumentation Rossinis war doch selbstverständlich ein »Fortschritt« gegenüber der alten Mozartischen. Um daher den Ausdruck antik-römischer Großheit echt modern zu steigern, bereicherte unser Dirigent Mozarts Titus-Ouverture mit einer großen Trommel, mit Becken und Triangel. Ich hatte einmal in dem variierten Andante einer Haydnschen Symphonie eine Solovariation auf der Viola zu spielen und hatte sie fleißig eingeübt. Da erschien in der Generalprobe plötzlich ein dicker Militärposaunist neben mir und blies die ganze Variation auf einer Altposaune mit, wodurch meine Kunstleistung natürlich völlig totgedrückt wurde. Vielleicht rührt mein Widerwille gegen die allzu »klangkräftige« Häufung des Blechs in der »neudeutschen« Musik noch von daher.
Wenn auch das Anhören unsers Orchesters meist ein sehr fraglicher Genuß sein mochte, so hatten wir doch um so größeren Genuß beim Spielen. Wir schmückten die Schulfeste mit unsern Symphoniesätzen und Ouvertüren. Sie hätten dieses Schmuckes vielleicht entbehren können, aber wichtiger war, daß Proben und Konzert uns selbst zum Feste wurden, und daß wir Liebe und Verständnis für eine Kunst gewannen, die dem klassischen Altertum so fern lag, und deren Meisterwerke in Symphonieen und Streichquartetten uns doch als echtest klassische Leistungen des modernen Geistes erschienen.
Jedenfalls gehört der Rückblick auf unsern Chor und unser Orchester zu den sonnigsten Erinnerungen meiner Gymnasialjahre.
Man kann und wird immer streiten über Zahl und Wahl der Lehrfächer eines Gymnasiums. Man wird den Lehrstoff beschränken, um zuletzt einseitig zu werden aus lauter Gründlichkeit; man wird ihn erweitern und hinterdrein oberflächlich werden aus Vielseitigkeit. Die Extreme werden sich gegenseitig jagen und stürzen, hier wie anderswo.
Aber einen Fehler müßte man doch unter allen Umstanden vermeiden: man soll die Schüler nicht ausschließend oder überwiegend nach ihren grammatischen Kenntnissen in den alten Sprachen beurteilen, man soll das Gymnasium nicht zu einer Specialschule der einseitigsten Sprachgelehrsamkeit machen.
Wir leben in der Zeit der Schulreform: wenn sie auch nur diesen einzigen Mißgriff beseitigte, dann würde sie schon ein großer Segen sein. Gegenwärtig kommt in der Regel nur derjenige gut durchs Gymnasium, dem der rechte grammatische Schulverstand angeboren oder angeschulmeistert ist. Die Gottesgaben der lebendigen Beobachtung und der schöpferischen Phantasie verwandeln sich dem damit Begnadeten gar oft in ein Danaergeschenk. Schiller wäre auf einem modernen Gymnasium höchst wahrscheinlich, Goethe ganz gewiß zum öfteren sitzen geblieben und schließlich wohl gar als talentlos ausgemustert worden. Wir erleben es jetzt unzähligemal, daß geistig sehr angeregte Söhne gebildeter Eltern die wissenschaftlichen Studien aufgeben, weil sich ihnen Klasse für Klasse eine unübersteigliche Mauer vorschiebt, während beschränkte Bauernjungen das Gymnasium mit bester Note absolvieren. Jene steckengebliebenen jungen Herren sollen sich darum nicht einbilden, daß sie sämtlich verkannte Schiller und Goethe seien. Die mannigfachen Bildungsinteressen, welche ihnen schon im Elternhause angeflogen waren, die bunten Anregungen, welche sich frühe schon Geist und Sinnen aufdrängten, ließen sie eben nicht zur ausschließlichen Hingabe an die alleinseligmachende Grammatik kommen, ihr jugendlicher Ehrgeiz griff bereits über das höchste Ziel guter Noten hinaus, und so brachten sie es nur zu schlechten Noten; sie konnten die Lücken ihrer Befähigung nicht ergänzen, hatten aber noch weniger Gelegenheit, die Vorzüge derselben zu entwickeln. Der beschränkte Bauernjunge dagegen tritt in eine höhere Welt, sowie er auf die lateinische Schule kommt: eine Weisheit, die all seinen Angehörigen verschlossen blieb, winkt ihm geheimnisvoll, sein größter Ehrgeiz ist der Schulehrgeiz, schulfremde Kenntnisse und Anschauungen zerstreuen ihn nicht; er lernt, er »ochst«, ja er »büffelt« sich glorreich durch alle Klassen. Auf der Universität wird er freilich ein mittelmäßiger Student, den der »gebildete Sohn gebildeter Eltern«, wenn er überhaupt zur Universität gekommen wäre, nunmehr bald überholt haben würde. Er »paukt« sich aber auch hier durchs Examen und wird zuletzt ein höchst mittelmäßiger, aber immer noch bureaugerechter Beamter. Vielleicht bleibt dann später sein Sohn auf dem Gymnasium stecken, weil der Vater doch schon wieder etwas zu gebildet gewesen war.
Ich zeichne hier Extreme, welche niemals die Regel sind; allein gerade aus den Extremen begreifen wir den Ingrimm, der heutzutage so viele hochgebildete Väter und Mütter gegen das ganze Gymnasialwesen erfüllt.
Der junge Mensch soll individuell, d. h. aus sich selbst heraus erzogen werden; nirgends wirkt es verderblicher als bei der Erziehung, alle Individualitäten über einen Leisten zu schlagen. Und doch jagen wir so eifrig nach diesem besten Leisten; man nennt ihn Schulorganisation.
Zum Abschluß der Idylle des Weilburger Gymnasiums muß ich noch ein besonderes Glanzlicht aufsetzen: wir lebten nicht in der Furcht des Examens, denn wir hatten keins zu bestehen. Das Resultat unsrer Leistungen wurde am Schlusse jedes Monats durch die einzelnen Lehrer festgestellt, am Jahresschluß durch die Lehrerkonferenz zusammengefaßt und so ergab sich zuletzt beim Abgange von Prima ein Gesamtresultat, welches von der Lehrerkonferenz erwogen und im günstigen Falle in Form eines Maturitätszeugnisses beurkundet wurde, das uns die Pforten der Universität erschloß. Es wurden zwar auch mündliche Klassenprüfungen am Schlusse jedes Schuljahres vor einem Regierungskommissär abgehalten. Diese waren aber ganz bedeutungslos, ein bloßes Schauturnen, mehr eine Prüfung der Lehrer, die ihre Kunst zeigten, immer gute Antworten zu erhalten, als der Schüler, die nur dann »daran kamen«, wenn sie voraussichtlich etwas wußten, so daß es die schlechtesten immer am besten hatten. Sie wurden gar nicht belästigt.
Im vorigen Jahrhundert hatten in Weilburg noch Abgangsprüfungen für die Universität bestanden; sie erschienen uns als eine zopfige, ganz veraltete Einrichtung, und wir beklagten unsre Kameraden auf den benachbarten preußischen Gymnasien, über deren Häuptern noch das Damoklesschwert des Maturitätsexamens schwebte. Wir beneideten sie dann auch gar nicht darum, daß sie in den Oberklassen von ihren Lehrern mit »Sie« angeredet wurden, während uns alle Lehrer »Du« nannten bis zu dem Augenblick, wo wir das Maturitätszeugnis eingehändigt bekamen. Denn wir dachten: lieber »Du« ohne Examen als »Sie« mit Examen.
Uebrigens scheint unsre Einrichtung auch in Nassau nicht lange mehr Bestand behauptet zu haben. Als im Frühjahr 1848 überall »Volksforderungen« aufgesetzt und durch Sturmdeputationen der Regierung überreicht wurden, verfaßten auch die Schüler des inzwischen neugegründeten Wiesbadener Gymnasiums als Teil des souveränen Volkes ihre Volksforderungen. Da heißt es nun § 13: »das Maturitätsexamen werde aufgehoben!« Also war es mittlerweile doch wieder eingeführt worden.
Ganz abgesehen von diesen Volksforderungen halte ich die Einrichtung, wie sie zu meiner Zeit in Weilburg bestanden hatte, für sehr gut. Sie war vielleicht nur allzugut für diese schlechte Welt. Wir machten kein Examen, weil wir acht Jahre lang fortwährend im Examen gesessen hatten. Wenn ein ganzes Lehrerkollegium einen Schüler jahrelang täglich beobachtet und seine Arbeiten prüft, dann wird es doch ein tieferes und richtigeres Urteil über dessen Talente und Fortschritte gewinnen, als aus den Antworten, die während der kurzen Angststunden eines Examens abgegeben werden. Gegenüber völlig Unbekannten ist das Examen freilich notwendig, – ein notwendiges Uebel. Wird dagegen das Examen als entscheidend gefordert bei völlig bekannten Schülern, so ist es zunächst ein Mißtrauensvotum gegen die Lehrer, weil es Parteilichkeit verhüten soll, dann aber auch ein Ausfluß unsrer »statistischen Krankheit«, die alles auf gleiches Maß und gleiche Zahl, auf die gleiche ziffernmäßige Schablone zurückführen will. Ein jeder Mensch trägt aber seinen eigenen Maßstab in sich.
Begünstigt war die Methode, welche vor 50 und mehr Jahren in Weilburg herrschte, freilich auch durch die kleine Schülerzahl der Anstalt. Die Prima zählte nur 20–25 Köpfe, das ganze Gymnasium nur etwa 130. Thiersch berechnet danach, daß für das Herzogtum auf je 25000 Einwohner nur je ein Universitätsstudent alljährlich gekommen sei. Das war in der That erstaunlich wenig, und von dem jetzt so schwarz gemalten übermäßigen Zudrang zum wissenschaftlichen Studium konnte man damals bei uns gewiß noch nicht reden.
Allem nicht bloß die kleine Zahl, auch die sociale Zusammensetzung der Schülerschaft war bemerkenswert. Die meisten waren Söhne studierter Väter, wenige entstammten dem übrigen Bürgerstand, Bauernsöhne kamen fast nur als künftige katholische Geistliche vor, und ein hoher Adel war fast gar nicht vertreten. Das heißt: wir erschienen als eine nach der Familienbildung ziemlich gleichartige Gesamtheit. Die Vorbildung aber, welche ein Jüngling aus dem Elternhause mitbringt, ist kaum minder wichtig als seine Vorbildung aus den niederen Schulen. Bei dieser Gleichartigkeit der kleinen Zahlen konnten die Lehrer den einzelnen weit persönlicher beobachten und behandeln, als es heute bei überfüllten und aus den verschiedensten Elementen zusammengesetzten Klassen möglich ist. Die Ungleichartigkeit der Lehrer wurde zum Teil durch die Gleichartigkeit der Schüler ausgeglichen, und wenn man etwa glaubt, wir hätten zu viel Freiheit und einen zu vielgestaltigen, zerstreuenden Unterricht gehabt, so muß man auch dagegen halten, daß uns die Lehrer viel mehr beratend, fördernd und eindämmend zur Seite standen, als es bei der heutigen Massenpädagogik möglich ist.
Im August 1839 starb Herzog Wilhelm, der unwandelbar treue Gönner und Beschützer des Direktors Friedemann. Nicht lange nach des Herzogs Tode kam die überraschende Kunde nach Weilburg, daß Friedemann seines Amtes huldvollst enthoben und zum Direktor des Landesarchivs in Idstein befördert worden sei.
Die Nachricht ging wie ein politisches Ereignis durch das Land, sie verkündete neben anderm eine neue Aera. Viele atmeten auf, nicht wenige jubelten. Der Direktor war ein Diktator gewesen, nicht bloß seiner Schüler, sondern auch seiner Lehrer und des ganzen nassauischen höheren Schulwesens; denn auch ein Regierungsreferent, ein oberster Schulrat oder dergleichen, der ihm von oben her Schranken gesetzt hätte, war nicht, oder doch nur dem Namen nach vorhanden. Sein Sturz galt nicht dem allzu gelehrten Philologen oder dem allzu originalen Pädagogen, sondern der mißliebigen Persönlichkeit.
Der »alte Friedemann«, der übrigens noch gar nicht alt war, fand sich rasch in den neuen, ganz fremdartigen Beruf beim Archive. Es war, als ob er durch die That beweisen wolle, daß die klassische Philologie in allen Sätteln reiten lehre, und so schrieb er denn in Idstein noch viel citatenreichere archivalische Abhandlungen als früher philologische bis zu seinem im Jahre 1853 erfolgten Tode.
Der neue Direktor unsres Gymnasiums war durchaus das Gegenteil seines Vorgängers, ein wohlwollender, gutmütiger Mann, den die Last der Gelehrsamkeit nicht drückte, liebenswürdig gegen seine Kollegen, freundlich gegen die Schüler, ein wirklicher Mann des Friedens, während Friedemann nur so hieß, ohne jemals ein Friedensmann gewesen zu sein.
Der alte Direktor hatte die wissenschaftliche Aufgabe des Gymnasiums etwas zu hoch gegriffen, und das mochte ein Fehler sein; der neue griff sie zu niedrig, und das war ein noch weit größerer Fehler. Der alte Direktor hatte uns Flegel geheißen, aber wir hatten doch eine stille Neigung für ihn, indem wir ihn fürchteten und über ihn räsonnierten; der neue Direktor behandelte uns wie seine lieben, braven Kinder, wir fürchteten ihn nicht, gewannen aber auch keine stille Neigung für ihn und räsonnierten über den neuen Direktor noch mehr als über den alten. Es schien anfangs, als sei nunmehr eine Zeit des reinen, wolkenlosen Sonnenscheins für das Weilburger Gymnasium angebrochen. Doch selbst in einer Idylle wird der reine, wolkenlose Sonnenschein auf die Dauer langweilig.
III.
Vor 50 Jahren gab es noch eine gemeinsame Grundlage, ein gemeinsames und unantastbares Ideal der deutschen Gymnasien. Das war nichts Neues, sondern ein Erbstück der Jahrhunderte seit dem Beginne der Renaissance.
Heute sind diese Grundlagen erschüttert, und man sucht nach neuen Idealen.
In einem philosophischen Zeitalter wurden wir noch erzogen im Geiste des Humanismus. Sprache, Litteratur, Kunst und Lebensweisheit des klassischen Altertums erschienen uns als die gemeinsame Grundlage aller höheren Geisteskultur, die Zeitalter überbrückend, alle gesitteten Völker verbündend.
Das Leben ist ein Traum – auch das Leben der Menschheit. Und wenn wir dann auch jenes Ideal nur geträumt hätten, so war es doch ein edler und großartiger Traum.
Es gab für uns nicht nur eine göttliche, sondern auch eine menschliche Autorität, über allem Wandel der Zeit erhaben.
Homer und Sophokles, Xenophon und Platon erschienen uns wie eine weltliche Bibel: wir bemühten uns, die Schönheit und Größe ihrer Werke zu ahnen, zu erfassen, und zweifelten nicht, daß sie unantastbar und unvergänglich schön und groß seien. Es gibt einen wissenschaftlichen und künstlerischen Glauben, ohne welchen niemals Großes geleistet worden ist. Die heutige Jugend sucht und hat diesen Glauben auch, sie sucht ihn nur anderswo als wir.
Wenn uns der alte Sophokles ärgerte, weil er seine Chöre so schwer gemacht hatte, und weil sie uns so viele Uebersetzungsfehler eintrugen, so zweifelten mir doch nicht an ihrer Erhabenheit und hofften sie später einmal besser verstehen zu lernen. Weil das Wenige, was wir verstanden, so schön war, so glaubten wir, daß das Uebrige, was wir nicht verstanden, noch viel schöner sei. Würden wir auch nur diese Selbstbescheidung gelernt haben, so hätten wir doch schon sehr viel gelernt.
Mit unserm klassischen Autoritätsglauben fühlten mir uns im Gemeinbewußtsein mit allen wahrhaft Gebildeten. Wir lasen damals noch nicht in den Zeitungen, daß Odysseus im Grunde ein Erzspitzbube gewesen sei, für den sich kein guter Deutscher zu interessieren brauche, daß Cicero als Staatsmann ein politischer Waschlappen gewesen und als Redner ein virtuosenhafter Phrasendrechsler, daß Virgil, der sich gegenwärtig Vergil schreibt, doch eigentlich nur für einen glatten akademischen Versemacher gelten könne. Wir lasen das nicht in den Zeitungen, einmal weil wir überhaupt keine Zeitung lasen, dann aber auch, weil dergleichen noch nicht darin stand. Heute lesen die Gymnasiasten Zeitungen und finden dort öfters ähnliche Aussprüche eines kraftbewußten modernen und realistischen Geistes.
Es fiel uns im Traume nicht ein, zu fragen, was uns denn überhaupt jenes kleine, ferne Land Hellas angehe und jenes fremde, längst versunkene Volk der Hellenen, da die Griechen doch keine Deutschen gewesen seien, und Attika nicht im Herzogtum Nassau liege.
Wir sahen Griechenland als unsre zweite Heimat an; denn es war der Stammsitz der Kalokagathie – es war die Heimat des harmonischen Menschentums. Ja wir glaubten sogar, daß das alte Griechenland eigentlich zu Deutschland gehöre, weil die Deutschen unter allen neueren Völkern das tiefste Verständnis für den hellenischen Geist, für hellenische Kunst und Lebensharmonie gewonnen hätten. Wir glaubten dieses nicht im Gefühle nationaler Schwäche, sondern im Ueberschäumen eines nationalen Uebermutes, kraft dessen wir die Deutschen überall für das erste Kulturvolk der modernen Welt, für die modernen Hellenen erklärten. Wir behaupteten, daß hellenische Kunst und Art in der neuen deutschen Poesie und Musik vollendeter wiedergeboren morden sei als bei irgend einem andern Volke der Gegenwart, und dachten dabei an Schiller und Goethe, an Haydn, Mozart und Beethoven in ihren schönsten Werken. Wir begeisterten uns für unser Vaterland, indem wir uns für Griechenland begeisterten. Dabei blieben wir jedoch gute Christen und sind keine Heiden geworden. Sonst hätten ja auch Luther und Melanchthon Heiden werden müssen, die von der erziehenden Kraft des Altertums im Geiste ihrer Zeit nicht geringer dachten als wir im Geiste der unsrigen.
Die Jugend ist sentimental, und der Kultus des klassischen Ideales entbehrte nicht des sentimentalen, ja des romantischen Zuges. Wir sehnten uns zurück zum klassischen Altertum wie zu einem verlorenen Paradiese und klagten mit Schiller in den »Göttern Griechenlands«: »Da ihr noch die schöne Welt regiertet, wie ganz anders, anders war es da!« Jenes klassische Altertum war das Jünglingsalter der europäischen Menschheit gewesen, und wenn man älter wird, sehnt man sich zurück nach dem verlorenen Paradiese der Jugend. Wir selber waren zwar noch gar nicht alt, aber die Menschheit begann sichtbar alt zu werden, und neben Platon und Perikles kamen uns Hegel und Fürst Metternich doch schon wie recht alte Leute vor. So sehnten sich die Romantiker zurück zum Mittelalter; denn die Zeitläufte des Mittelalters waren die Flegeljahre der europäischen Menschheit gewesen, und aus einer Entfernung von etlichen Jahrhunderten nahmen sich auch diese Flegeljahre beneidenswert liebenswürdig aus.
Die griechische und lateinische Grammatik machte uns manche Beschwerden. Aber wir überwanden dieselben doch gerne, weil sie uns den Schlüssel zu den Geheimnissen einer versunkenen schönen Welt erringen ließen. Die Lehrer lehrten die Grammatik nicht um der Grammatik willen, sondern damit wir die alten Dichter und Denker im Urtext lesen lernten, und damit wir uns aus diesem Urtext mit dem künstlerischen und philosophischen Geist der Antike erfüllten.