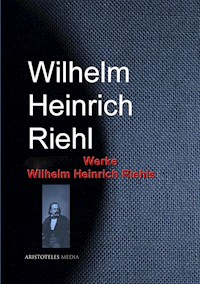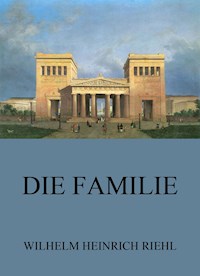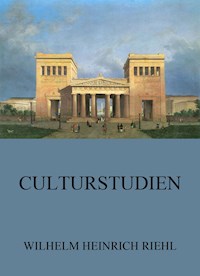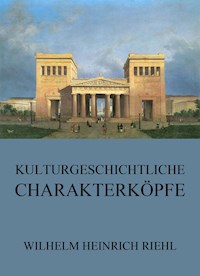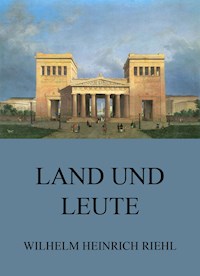
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Riehls bekanntestes Werk ist die "Naturgeschichte des deutschen Volkes als Grundlage einer deutschen Socialpolitik"(4 Bände, 1851-1869), in dem geographische Faktoren, soziale Verhältnisse und deutsche Kultur- und Lebensweise hervorgehoben werden. Im ersten Band "Land und Leute" (1854) setzte Riehl den Nationalcharakter der europäischen Völker in eine unmittelbare Beziehung zu der sie umgebenden Umwelt: Charakteristische Landschaften der Engländer und Franzosen seien der gezähmte Park und das gerodete Feld, deren Gegenbild er in der Wildnis des deutschen Waldes sah.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Land und Leute
Wilhelm Heinrich Riehl
Inhalt:
Wilhelm Heinrich Riehl – Biografie und Bibliografie
Land und Leute
Zur Einleitung
Vorwort zur zweiten Auflage.
Vorwort zur fünften Auflage.
Erstes Kapitel. Das Volk in Bild und Schrift.
Zweites Kapitel. Die vier Fakultäten.
I. Feld und Wald
II. Wege und Stege
III. Stadt und Land.
IV. Die Dreitheilung in der Volkskunde Deutschlands
V. Individualisirtes Land.
VI. Centralisirtes Land.
VII. Das Land der armen Leute.
VIII. Volksgruppen und Staatengebilde.
IX. Die kirchlichen Gegensätze
Land und Leute, W. H. Riehl
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849633950
www.jazzybee-verlag.de
Wilhelm Heinrich Riehl – Biografie und Bibliografie
Namhafter kulturhistorischer Schriftsteller, geb. 6. Mai 1823 in Biebrich a. Rh., gest. 16. Nov. 1897 in München, studierte in Marburg, Tübingen, Bonn und Gießen, redigierte seit 1846 mit Giehne die »Karlsruher Zeitung«, begründete dann mit Christ den »Badischen Landtagsboten« und gab, nachdem er zum Mitgliede der deutschen Nationalversammlung gewählt worden, 1848 bis 1851 die konservative »Nassauische allgemeine Zeitung« heraus, während er zugleich mit der musikalischen Leitung des Hoftheaters in Wiesbaden betraut war. Nachdem er 1851–53 bei der Redaktion der Augsburger Allgemeinen Zeitung tätig gewesen, folgte er 1854 einem Ruf als Professor der Staats- und Kameralwissenschaften nach München, wo er 1859 die Professur der Literaturgeschichte übernahm und 1862 Mitglied der Akademie der Wissenschaften ward. 1885 wurde er zum Direktor des bayrischen Nationalmuseums ernannt. Er schrieb: »Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik«, in 4 Bänden: Band 1: »Land und Leute« (Stuttg. 1853, 10. Aufl. 1899), Band 2: »Die bürgerliche Gesellschaft« (1851, 9. Aufl. 1897), Band 3: »Die Familie« (1855, 12. Aufl. 1904; Band 1–3 auch in Schulausgaben von Th. Matthias, Stuttg. 1895 bis 1896), Band 4: »Wanderbuch« (1869, 4. Aufl. 1903); »Die Pfälzer« (das. 1857, 2. Aufl. 1858); »Kulturstudien aus drei Jahrhunderten« (das. 1859, 6. Aufl. 1903); »Die deutsche Arbeit« (das. 1861, 3. Aufl. 1884); »Musikalische Charakterköpfe« (das. 1853–77, 3 Bde.; Band 1 u. 2 in 8. u. 7. Aufl. 1899); »Kulturgeschichtliche Novellen« (das. 1856, 5. Aufl. 1902); »Geschichten aus alter Zeit« (das. 1863–65, 2 Bde., u. ö.); »Neues Novellenbuch« (das. 1867, 3. Aufl. 1900); »Aus der Ecke, neue Novellen« (Bielef. 1875; 4. Aufl., Stuttg. 1898); »Am Feierabend«, 6 neue Novellen (Stuttg. 1880, 4. Aufl. 1902); »Lebensrätsel«, 5 Novellen (das. 1888, 4. Aufl. 1906), die letztern 6 Werke auch gesammelt als »Geschichten und Novellen« (das. 1898–1900, 7 Bde.); »Freie Vorträge« (das. 1873, 2. Sammlung 1885); »Kulturgeschichtliche Charakterköpfe, aus der Erinnerung gezeichnet« (das. 1891, 3. Aufl. 1899); »Religiöse Studien eines Weltkindes« (das. 1894, 5. Aufl. 1900) und eine Reihe kulturgeschichtlicher Abhandlungen in den Denkschriften der Münchener Akademie und der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Auch veröffentlichte er zwei Hefte Liederkompositionen u. d. T.: »Hausmusik« (Stuttg. 1856, 2. Aufl. 1859) und »Neue Lieder für das Haus« (Leipz. 1877). Unter Riehls Leitung erschien 1859–67 die »Bavaria«, eine umfassende geographisch-ethnographische Schilderung Bayerns in 5 Bänden. 1870–79 gab er das von Raumer begründete »Historische Taschenbuch« heraus. Nach seinem Tod erschien noch sein (einziger) Roman: »Ein ganzer Mann« (Stuttg. 1897, 4. Aufl. 1898). Vgl. Simonsfeld, Wilh. Heinr. R. als Kulturhistoriker (Münch. 1898). – Seine Tochter Helene machte sich als Landschaftsmalerin bekannt.
Land und Leute
Zur Einleitung
Wir lesen in den Geschichtsbüchern, daß die Fürsten und ihre Räthe in alter Zeit ihre Residenzen und Kanzeleien wechselnd bald in diesem, bald in jenem Theile des Landes aufgeschlagen haben. Sie absolvirten bei diesem Wanderleben ihre politischen Studien; denn sie lernten Land und Leute kennen. Auch auf ihren Jagdzügen fanden sie manchmal die Staatskunst und Waidmannskunst nebeneinander.
Heutzutage ziehen die Fürsten nicht mehr von Burg zu Burg, und die Minister reiten auch nicht mehr regierenshalber durch das Land. Da nun die Staatsmänner nicht mehr auf die Wanderschaft gehen können, so sollten es wenigstens die politischen Schriftsteller für sie thun.
Diese Erwägung trieb mich seit Jahren hinaus, die schönen deutschen Gaue zu durchstreifen, um im unmittelbaren Verkehr mit dem Volke diejenige Ergänzung meiner historischen, staatswissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Studien zu suchen, die ich in den Büchern nicht finden konnte.
Ich ging bei dieser gleichsam naturgeschichtlich analytischen Untersuchung unserer öffentlichen Zustände nicht von einem vorgefaßten politischen Parteistandpunkte aus. Erst aus der Summe der eigenen Anschauungen entwickelte sich mir ein social-politischer Conservatismus, der mir nun aber auch um so sicherer bestimmend wurde für meine ganze Lebenspraxis. Zuerst ward ich Fußwanderer und nachher politischer Schriftsteller. Wenn ja etwas Eigenes und Neues in meiner Art der Behandlung von Gesellschafts- und Staatswissenschaft steckt, dann habe ich es diesem Umstande zu danken.
Als ich mein Buch über die »bürgerliche Gesellschaft« schrieb, ging ich nicht entfernt von der Absicht aus, eine neue Schutzrede für die ständische Gliederung im Volke zu liefern. Ich wollte lediglich aus einem künstlerischen Trieb das deutsche Volksleben nach seinen allgemeinsten Gruppen zeichnen und fand die natürliche ständische Gliederung am Wege, ohne daß ich sie suchte. Ja zuerst galt es mir nur, eine einzelne Volksgruppe zu skizziren, die Bauern, und der Plan ein Gesammtbild der Gesellschaft zu entwerfen, rührte ursprünglich gar nicht von mir her. Er ward in mir erst angeregt durch den Freiherrn von Cotta, als ich demselben meine Arbeit über »die Bauern« für die Deutsche Vierteljahrsschrift vorlegte. Die Idee des ganzen Buches wurde zwischen uns in mündlichem und brieflichem Verkehr mannichfach erörtert, und viele Winke des mit unsern gesellschaftlichen Zuständen gründlich vertrauten Mannes, dessen Förderung meines ganzen literarischen Strebens ich mit Freuden öffentlich anerkenne, sind beim Ausarbeiten jener Schrift nicht unbenutzt geblieben.
Wie ich nun aber bei der Skizze des einzelnen Standes der Bauern nicht hatte stehen bleiben können, sondern allmählich zu einem Gesammtbilde der bürgerlichen Gesellschaft gekommen war, so konnte ich auch bei diesem wiederum nicht stehen bleiben. Das eben ist die wunderbare Wirkung eines in's Einzelne sich versenkenden Studiums, daß uns die Erforschung der Einzelthatsachen immer weiter treibt zum Nachweis ihres Zusammenhanges mit einem immer größeren, reicheren Ganzen.
In der bürgerlichen Gesellschaft ist das Volk in seinen allgemeinsten Beziehungen durch sich selbst, in seiner von den örtlichen Besonderungen losgelösten Gliederung, in seinen Ständen geschildert. Will man die naturgeschichtliche Methode der Wissenschaft vom Volke in ihrer ganzen Breite und Tiefe nachweisen, dann muß man auch in das Wesen dieserörtlichen Besonderungen des Volksthumes eindringen. In der Lehre von der bürgerlichen Gesellschaft ist das Verhältniß der großen natürlichen Volksgruppen zu einander nachgewiesen: hier sollen diese Gruppen nach den örtlichen Bedingungen des Landes, in welchem das Volksleben wurzelt, dargestellt werden. Erst aus den individuellen Bezügen von Land und Leuten entwickelt sich die culturgeschichtliche Abstraction der bürgerlichen Gesellschaft. So stehet das vorliegende Buch meinem Buche von der bürgerlichen Gesellschaft, welches sich als zweiter Band in zweiter neu überarbeiteter Auflage anschließen wird, gegenüber als der Entwurf zu einer socialen Volkskunde Deutschlands, einer allgemeinen Systematik der Gesellschaft dieses Landes. Das Ganze aber wird zusammengehalten und getragen von dem Gedanken, daß die naturgeschichtliche Untersuchung des Volkslebens zur Gesellschaftswissenschaft, zur socialen Politik führe, und daß es noch früher oder später möglich werden müsse, auf der Grundlage solcher naturgeschichtlichen Untersuchungen ebensowohl einen Kosmos des Volkslebens, einen Kosmos der Politik zu schreiben, wie die naturgeschichtliche Untersuchung des Erd- und Weltorganismus einen ihrer höchsten Triumphe in dem Werke eines deutschen Gelehrten feiert, welches wir jetzt mit einem stolzen Worte den »Kosmos« schlechthin nennen.
Bei meinem Buche über die bürgerliche Gesellschaft erlebte ich die Freude, daß es mir zwar nicht die lärmschlagende Gunst der politischen und literarischen Parteien gewann, wohl aber eine große Zahl persönlicher Freunde und eifriger Anhänger in den verschiedensten Gauen Deutschlands. Ich schloß aus dieser Erfahrung, daß man wohl aus dem Buche herausgefühlt haben müsse, es sey kein gemachtes, es sey ein erwandertes und erlebtes Buch, welches nicht blos zufällige Ansichten, sondern die Persönlichkeit, den Charakter seines Verfassers spiegele.
Der hochverehrte Mann, dessen Namen ich an die Spitze dieser Widmung gestellt, ist ein solcher Freund, dessen befruchtender persönlicher Umgang, dessen unermüdliche Förderung meines bescheidenen Strebens mir lediglich durch jenen ersten größeren literarischen Versuch gewonnen worden ist. Ich hielt es darum für meine Pflicht, Ihnen, hochverehrter Herr Graf, ein kleines Wahrzeichen meines Dankes auch öffentlich aufzustellen. Und wenn je eine Gelegenheit mir passend hierzu erschien, dann däuchte sie mir bei diesem Buche gegeben zu seyn, zu dessen Ausarbeitung Sie mir in den vergangenen Frühlingstagen einen so köstlichen Mußesitz eingeräumt hatten, in Ihrem Thurnau, dessen freundliche Natur einst Wilhelm von Humboldt fesselte und dessen unvergleichliche Lindenallee Jean Paul für würdig erklärte, daß Fichte in ihr als dem stolzesten Laubdome seine Reden an die deutsche Nation gehalten hätte. Augsburg, am 18. September 1853.
W. H. Riehl.
Vorwort zur zweiten Auflage.
Diese neue Auflage nennt sich eine vermehrte. Es sind nämlich, außer mancherlei kleinen Erweiterungen, zwei neue selbständige Kapitel hinzugekommen.
Das eine, ein Einleitungskapitel, führt die Ueberschrift: »Die vier Fakultäten.« Es soll nicht blos in den vorliegenden Band, sondern in das ganze Werk einführen, welches sich nunmehr in drei Bänden abgeschlossen in den Händen des Publikums befindet. Indem ich den Widerstreit zeichnete, in welchem die von der naturgeschichtlichen Analyse des Volkes ausgehende Volks- und Staatswissenschaft mit unserm altüberlieferten System der Fachwissenschaften steht, konnte ich zugleich Andeutungen geben über einen neuen organischen Bau der gesammten Staatswissenschaften, wie ich ihn in meinen Universitätsvorlesungen in strenger Systematik durchzubilden suche, und auch später, so Gott will, in ausgeführter wissenschaftlicher Form der lesenden Gelehrtenwelt vorzulegen gedenke.
Das zweite neu eingefügte Kapitel ist überschrieben: »Thesen zur deutschen Landes- und Volkskunde. « Meine Idee der ethnographischen Dreitheilung Deutschlands ist fast auf jeder Seite des Buches veranschaulicht, erläutert und in Einzelzügen ausgemalt. Sie ließe sich aber ebenso gut in ganz trocken statistischer Weise, ja tabellarisch und chartographisch, überall mit Zahlen und positiven Thatsachen belegt, darstellen. Das Material dazu liegt größtentheils zu andern Zwecken ausgearbeitet vor mir; ich hätte es nur abdrucken zu lassen brauchen und würde solchergestalt das Buch mit einem sehr gelehrt dreinschauenden Kapitel ausstaffirt haben, welches aber nur sehr Wenige lesen würden. Um daher die künstlerische Einheit in der Schreibart des Buches nicht zu zerreißen, schob ich nur einzelne Thesen ein, in denen sich die weiteren Ausführungen concentrirt vorgebildet finden, Thesen, aus welchen man erkennen wird, daß ich nicht versäumt habe, meinen Grundgedanken nach allen Seiten zu erwägen und am positiven Material zu prüfen, Thesen, die zugleich mithelfen sollen, die vielen überallhin abschweifenden skizzenhaften Ausführungen des Buches etwas mehr in's Blei zu stellen und das Ganze einheitlich in Rand und Band zu halten. Denn lieber wollte ich die doch in der Regel ziemlich wohlfeile Gelehrsamkeit von Citaten und anderswoher abgeschriebenen statistischen Notizen preisgeben, als die künstlerische Freiheit der Darstellung. Wie ich durch ein luftiges Wanderleben erst in's Bücherschreiben hineingewandert bin, so sollen auch meine Bücher allerwege lustig zu lesen seyn; die Gelehrsamkeit soll darin stecken, ohne sich selbstgefällig zu präsentiren, und wenn der Autor auch mühselig und langsam, prüfend und zaudernd gearbeitet hat, so wünscht er doch, die Leser möchten gar nichts merken von dieser Mühsal, sondern meinen, das Buch sey nur eben so von selber geworden, nur so von ungefähr hingeschrieben, rasch und unverzagt wie auf der Wanderschaft und immer mit gutem Humor, und ohne daß je der Autor vorher den gelehrten Schlafrock angezogen habe.
München, am 18. März 1855.
W. H. R.
Vorwort zur fünften Auflage.
Die dritte Auflage hatte ich mit folgenden Worten eingeleitet: »Viele der im vorliegenden Buche gegebenen Beispiele und Einzelzüge sind aus den unmittelbaren Eindrücken der Zeit geflossen, in welcher die ersten Skizzen zu den meisten Kapiteln entworfen wurden; es waren dies die Jahre 1850-52. Vieles würde ich in dieser Beziehung jetzt anders geben, namentlich in der zweiten Hälfte des Buches. Manche der hier angezogenen Thatsachen haben sich auch inzwischen wesentlich geändert. Was damals als eine unmittelbar aus dem Leben des Tages gegriffene Anschauung galt, ist mitunter bereits ein historisches Exempel geworden. Da mir aber in diesem Bande nicht sowohl die Darstellung bestimmter Thatsachen, als die an deren Behandlung zu erweisende Methode das Wesentliche war, so mögen jene Specialitäten immerhin in der Form stehen bleiben, wie sie der Zeitpunkt der ersten Abfassung eingab. Der feinfühlige Leser wird selber schon merken, wo die so zahlreich eingestreuten Einzelzüge aus unserm socialen und politischen Leben eine Erweiterung, wo eine Einschränkung erfahren müßten, wenn ich das Buch heute neu zu schreiben hätte. Dennoch wollte ich nicht ohne diese Gewissensverwahrung mit einem unveränderten Wiederabdruck vor das Publikum treten.»
Den hier dargelegten Grundsatz hielt ich auch bei allen Verbesserungen der fünften Auflage fest und tastete das Wesen des Buches nicht an. Nur in Sprache und Ausdruck suchte ich sorgsam die letzte Feile anzulegen und, indem ich den Text freier und fester sprachlich ausrundete,
Erstes Kapitel. Das Volk in Bild und Schrift.
Durch Poesie und bildende Kunst geht seit Jahrhunderten der rastlose Drang nach Erweiterung des Kreises der darzustellenden Stoffe. Es will uns nicht mehr genügen an Einzelfiguren und Gruppen. War früher das Volk als Gesammtperson höchstens nur leicht angedeutete Staffage oder ein Schmuck des Hintergrundes, dann wird es jetzt mehr und mehr eine selbständige, ja eine Hauptfigur, die sich flott durchgearbeitet in den Vordergrund von Bildern und Dichtwerken stellt. Die Gegenwart sucht entschiedener als irgend eine frühere Zeit das Volk als Kunstobject zu fassen.
Mit dem Ausgange des Mittelalters, da die großen socialen Neugestaltungen begannen, in denen wir noch fortweben, gewinnt das Volk den Reiz eines neuen Stoffes für die Künstler und Poeten. Die weitschichtigen, gleichsam episch in's Breite gehenden Geschichtsbilder der deutschen Malerschulen aus dem 15. und 16. Jahrhundert wurden damals äußerst figurenreich. Mit einzelnen bildsäulengleichen Heiligen hatte man begonnen, war fortgeschritten zur Gruppe, dann zum Gruppengewimmel und durch dieses zum Charakterbilde der Massen. Das deutsche Volk wird nun derb leibhaftig mitten in die Scenen aus der biblischen Geschichte, aus dem Leben der Heiligen und Märtyrer gestellt. Dürer, Holbein, Kranach waren nicht bloß insofern volksthümliche Maler, als sie in ihrem Styl den deutschen Volksgeist in einer bis dahin nicht gekannten Freiheit und Naturfrische versinnbildeten; sie waren auch mit ihren unmittelbaren Vorgängern, Genossen und Nachfolgern die ersten, welche das deutsche Volk als Volk malten. Sie machten freilich trotzdem das Volk noch nicht zum Mittelpunkte ihrer historischen Bilder; sie stellten es nur in die Peripherie derselben, erläuternd, füllend, schmückend, daß es manchmal fast auftritt wie der Chor in der griechischen Tragödie. So getreu auch die Einzelfiguren und Köpfe in den Volksgruppen der altdeutschen Maler aus dem Leben gegriffen, ja oft in ihrer naturwüchsigen Gemeinheit geradezu von der Straße aufgelesen sind, so hat doch die Gesammtfigur des Volkes vorwiegend nur einen typischen Sinn. Im Einzelnen wechselt die reichste Charakteristik der Köpfe; im Ganzen sind es immer dieselben niederrheinischen, fränkischen, schwäbischen Bürger und Bauern, die auf den Bildern der niederrheinischen, fränkischen, schwäbischen Schule gegensatzlos, in stehenden, überlieferten Formen wiederkehren. Allein der Anstoß war gegeben, die Selbsterkenntniß des Volkes im Bilde geweissagt.
Aehnliches zeigt die damalige Poesie. In der Volksdichtung, die sich am Ende des Mittelalters und zur Reformationszeit ausbildet, greifen die Dichter ihre Stoffe unmittelbar aus dem Volksleben. Die niederen Stände erschauen sich im Gesammtorganismus des Volkes ebenso klar wie weiland die höheren: das ist in den Volksbüchern und den satyrischen Lehrgedichten des 15. und 16. Jahrhunderts mit wahrhaft epochemachender Neuheit, Kraft und Tiefe ausgesprochen. Hier an den Pforten der neuen Zeit ahnten die Leute mit einemmale, welch ein wunderbares Kunstobject das Volk sey. Die Reformationszeit ist auch in diesem Stücke Spiegel und Seitenbild der Gegenwart. Sebastian Brandt geißelt in seinem Narrenschiff die Schwächen und Gebrechen der ganzen bürgerlichen Gesellschaft. Er macht bereits die moralische Gesammtperson des Volkes zum Stoff seines Lehrgedichtes. Die Satyriker jener Zeit beginnen überhaupt das Volk naturgeschichtlich zu zerlegen; freilich nicht zu politischem Zweck, sondern der Moralpredigt halber; aber die Thatsache dieser Untersuchungen bleibt darum nicht minder bedeutsam. Es ist nur erst der Theologe Gailer von Kaisersberg, der sich den Text zu seinen Predigten aus Brandt's satyrischer Naturgeschichte des Volks nimmt; im 19. Jahrhundert werden die Staatsmänner ihre Texte in den naturgeschichtlichen Analysen des Volkes suchen müssen.
Sowie die sociale Romantik des Mittelalters verblaßt, wird der Gegensatz des gemeinen Mannes zum vornehmen mit einemmale lebendig in der Literatur. Volkslieder und Volksbücher verdrängen die Königslieder und Heldenbücher. Narren predigen die neue Weisheit; in dem Humor seiner Schwänke und Spottlieder erkennt das Volk als Gesammtcharakter sich selbst in seiner Eigenart und Naturkraft, und Eulenspiegel wird ein Prophet der socialen Revolution. Die »grobianische Literatur,« in welcher das geringe, das arme, gedrückte Volk als das »eigentliche« Volk gedacht ist, fordert die ausgesungene höfische und ritterliche Poesie zum Knüttelkampfe heraus und fährt siegreich mit ihrem Prügel darein. Ein Stück des Volkes wenigstens wird solchergestalt Kunstobject, ein wunderliches Stück, die göttliche Grobheit der Sprache und Sitte des gemeinen Mannes soll ihre poetische Naturkraft bekunden; bei Spott und Hohn auf den modischen Anstand und das eigensinnige Herkommen der höheren Stände fühlen sich die Volksschriftsteller kannibalisch wohl. Dieselben von der Straße aufgelesenen Gestalten mit den gemeinen Gesichtern, welche theilweise auf den Historien- und Kirchenbildern den typischen Chor des Volkes bilden, pflanzen sich in dem Vordergrund der Spott- und Lehrgedichte auf. Sie drohen hier als eine Schaar der Rache, welche den Muth und die Faust hat, das Unrecht der Zurücksetzung hinter Fürsten, Ritter und Pfaffen – nicht bloß in der Kunst, sondern auch in der Politik - wieder wett zu machen.
Wie in der Dichtkunst die Sehnsucht nach der Natur erst dann bei allen Sängern widerklingt, wenn die Menschen sich der Natur entfremdet haben, so kann auch die künstlerische Selbstschau des Volkes, der poetische Genuß an dem rohen Volksleben, erst da eintreten, wo der sociale Stand der Unschuld bereits gebrochen ist, wo die Entfremdung einer verfeinerten Welt von volksthümlicher Sitte und Art bereits sociale Nervenleiden, Blutarmuth und Muskelschwäche erzeugt hat, gegen die man in dem Schlammbad einer naturwüchsigen Rohheit und Flegelei Hülfe sucht.
Die »grobianische Literatur« vom Ausgange des Mittelalters ist in unserer Zeit in den Dorfgeschichten, mehr noch in den Mysterien des großstädtischen Proletariats wieder aufgelebt. Solche Erscheinungen, die das Volk in seiner ungebrochenen, unverhüllten Natürlichkeit als Kunstobject nehmen, sind entscheidend für den Fortschritt der Naturgeschichte des Volkes. Was der Poet ahnt und schildert, das soll der Social-Politiker durchforschen und anwenden.
Wie im einzelnen Menschen, so zeigt auch im Volke dieses ruckweise Vorschreiten der Selbsterkenntnis jedesmal einen bevorstehenden Umschlag im Organismus an. Der Bauernkrieg machte der Lust an den Dorfgeschichten des 16. Jahrhunderts ein Ende. Da waren mit einemmale die »Grobiane« aus dem literarischen Rahmen herausgetreten und hatten wirkliche Arme und Fäuste bekommen. Der Dämon, welcher im Bild, im Lied und in der Satyre längst gegeistet und in abenteuerlichen Gesichten sich vorverkündet hatte, stieg endlich auch leibhaftig an's Tageslicht.
Das 16. Jahrhundert malte nicht bloß das Volk und sang von dem Volke, es beschrieb auch dasselbe mit ganz besonderem Behagen. In »Weltbüchern« und »Kosmographien« schilderte der populäre Gelehrte das Volk nach Stand und Beruf, nach seinem Zusammenhang mit dem Lande und ergötzte die Leser mit der Kunde von allerlei wunderlichen Sitten, die er in der eigenen Heimath versteckt gefunden. Neben den Holzschnitten von Meerfräulein, Menschenfressern und fabelhaften Völkern mit Hundeköpfen sehen wir in Sebastian Münster's »Kosmographey« den Allgäuer Bauer am Spinnrocken, den Landsknecht, den Ritter, den Zigeuner, den Juden. Wie diese derben Holzschnitte ist auch das Konterfei der mittelaltrigen vier Stände fest und treuherzig in Worten gezeichnet. Wer vermag heute sociale Charaktergruppen zu malen, die sich an Dürer'scher Kraft der Umrisse mit Sebastian Frank's Prachtstücken der Schilderung messen könnten? Und an diesen Spiegelbildern ihrer selbst konnten sich die Leute des 16. Jahrhunderts nicht satt sehen. Die Selbsterkenntnis des Volkes war mit nie gekannter Macht erwacht: dieß ist eine der wichtigsten Thatsachen der Reformationszeit. Mit gutem Griff hat darum Kaulbach in seinem großen Reformationsbild zu den Humanisten, zu den Entdeckern und Naturforschern auch einen Forscher von Land und Leuten, den alten, ehrlichen Münster mit seiner langen Forschernase, in den Vordergrund gestellt.
In der Kunstthätigkeit des 17. und 18. Jahrhunderts tritt das Volk als Kunstobjekt wieder in den Hintergrund. Die Zopfzeit hatte keine sociale Politik. Wo es nur Unterthanen, keine Bürger gibt, da wird freilich das Studium des Volkes überflüssig. Während selbst der typische Chor der Volksgruppen von den Historienbildern verschwindet, sind es nur noch die republikanischen Holländer, welche Art und Sitte des gemeinen Volkes behaglich vor unsere Sinne bringen. Sie führen die erloschene grobianische Literatur der früheren Zeit mit dem Pinsel fort; Teniers, Ostade, Jan Steen boten dem verschnörkelten Wesen der vornehmen Welt Trumpf, indem sie in unvergleichlicher Naivetät Studien zur Naturgeschichte des Volkes malten.
Allein so groß auch die Rückschritte waren, die man seit dem dreißigjährigen Krieg in der Erkenntniß und Würdigung des Volkslebens machte, so ist doch die Brücke zwischen den Volksstudien des 16. Jahrhunderts und der Gegenwart niemals ganz abgebrochen gewesen. Im Simplicissimus und den Gesichten des Philander von Sittewald wird noch einmal, wenn auch mit roher Hand der Versuch gewagt, ein unverhülltes Naturbild des Volkes poetisch zu gestalten. In diese traurige Zeit, wo die Politik vorzugsweise zu scholastischen staatsrechtlichen Formen zusammenschrumpfte, wo von wirklichen Originalzöpfen die Grundsteine zu der modernen, alle Naturkräfte im Volksleben übersehenden politischen Schulmeisterei gelegt wurde, fallen trotzdem höchst wichtige Anfänge einer social-politischen Tages-Literatur. Als man auf Bildern, in Lehrgedichten, Satyren, Romanen und Weltbüchern keinen Raum mehr hatte für die Zeichnung des Volkes, warf man wenigstens noch auf fliegende Blätter Skizzen zur Naturgeschichte des Volkslebens hin. Die Gelehrten hatten sich einseitig des Staatsrechtes bemächtigt; populär aber blieben die wenn auch noch so dürftigen Fragmente zur Gesellschaftswissenschaft. In der Wissenschaft des Staates und des Rechtes ging Griechenland und Rom voran; aber die Wissenschaft vom Volke in ihrer ausgeprägtesten, naturgeschichtlich zerlegenden Form, ist ein Eigenthum der modernen und vorab der germanischen Welt. Es lag unserem Volksgeiste seit Urwalds Zeiten näher, die individuelle Sitte auszubilden als das völkerverschmelzende Recht, das Sonderleben der Gesellschaft aufrecht zu halten neben und über der ausgleichenden Gewalt des Staates. Die Deutschen sind geborene Social-Politiker und von diesem Standpunkte aus sind sie stets ein politisch wunderbar strebsames und rühriges Volk gewesen. Die Glanzperiode unserer weltbeherrschenden volksthümlichen Herrlichkeit, das Mittelalter, war die Zeit des einseitig socialen Staates. So beleuchten jene fliegenden Blätter des 16. und 17. Jahrhunderts, die Vorläufer der modernen Tagespresse, die gesellschaftlichen Zustände ihrer Zeit von allen Seiten; von den politischen im engern Sinne sprechen sie nur da, wo der religiöse Zwiespalt mittelbar auch so etwas wie politische Parteigruppen beim Volke eingeschwärzt hatte.
Es fallen ganz neue Schlaglichter auf die Geschichte unsers öffentlichen Lebens, wenn wir die Entwickelung der deutschen Journalistik rückwärts bis zu ihren Ursprüngen verfolgen, und dabei untersuchen, inwiefern dieselbe vorzugsweise die Interessen der Gesellschaft oder des Staates durchgesprochen hat. Wir kommen dann zu dem culturgeschichtlich bedeutsamen Ergebniß, daß unsere sociale und culturpolitische Journalistik reich war seit alten Tagen, unsere rein politische fast immer bettelarm. Für die Geschichte und Politik der Gewerbe, des Handels und Ackerbaues, für die Zustände der Aristokratie und des Bürgerthums, ja des Proletariats bieten jene fliegenden Blätter immer noch eine reichlich strömende Quelle; für die Kunde des staatlichen Lebens eine ganz dürftige. In einer Flugschrift des 16. Jahrhunderts, dem liber vagatorum (1510), sind die Proletariergruppen jener Zeit, bereits gezeichnet und in Reih und Glied gestellt, daß es sich schier wie ein erster kindischer Versuch zu einer Naturgeschichte der Gesellschaft ausnimmt. Man besaß damals bereits ein Lexikon der Gaunersprache, aber noch lange kein Staatslexikon. Als sittengeschichtliche Merkwürdigkeit finde ich, daß in jenem Wörterbuch kaum je Synonyma des wortkargen Kauderwelsch vorkommen. Nur bei einem Wort überrascht der Ueberfluß von vier Synonymen; es ist das Wort Bordell; man sieht, die Zeit begünstigte in allen Stücken das corporative Genossenleben, und das Laster war in selbigen Tagen noch eben so grob wie die Tugend.
In der ungeheuren Masse des Stoffes zur Gesellschaftskunde, welcher in der Literatur der beiden größten germanischen Kulturvölker, der Deutschen und Engländer aufgehäuft ist, liegen reiche nationale Schätze geborgen, welche nur der hebenden und ordnenden Hand bedürfen. Eine Geschichte dieser Vorstudien zur Gesellschaftskunde zu schreiben, wäre eine geistige That, die ganz neue Schlaglichter auf die Geschichte unserer politischen Entwicklung werfen würde. Welch reicher und stetiger Fortschritt in der eingehendsten Untersuchung des Volkes von jenem mageren liber vagatorum bis zu dem Riesenwerke »London labour and the London poor,« in dessen drittem Theil eben Henry Mayhew die nämliche Gesellschaftsgruppe der vagatores für die einzelne Stadt London systematisch und mit schwindelerregender Ausführlichkeit zu behandeln begonnen hat, und nicht minder bis zu Avé-Lallement's meisterhaftem Buche über das deutsche Gaunerwesen; von jenem Gaunerlexikon auf wenigen Duodezblättern bis zu Dr. Pott's neuesten grammatischen und lexikalischen Untersuchungen über die Gauner- und Zigeunersprachen. Wie arm ist die Literatur der Franzosen, Italiener und Spanier an solchen socialen Vorstudien gegenüber der deutschen und englischen!
In Frankreich tritt der epochemachende Meister einer Construction der Gesellschaft auf: Rousseau. Nicht die Untersuchung des Volksorganismus als einer historischen Thatsache, sondern das Phantasiebild eines »Gesellschaftsvertrags« stellt er an die Spitze seiner neuen Gesellschaftswissenschaft. Die sociale Politik wird zur socialistischen. So ist es bis auf unsere Tage in Frankreich überwiegend geblieben; die Franzosen haben bis jetzt stets nur eine verneinende, ausebnende, nicht aber eine positive, aufbauende sociale Politik gewinnen können. Montesquieu hatte das Zeug zu einem ächten Social-Politiker: gerade darum ist er dem deutschen Geiste verwandter, als irgend ein damaliger Staatsschriftsteller unter den Franzosen. Seine Landsleute haben seine Weisheit mehr bewundert als aufgenommen und weitergebildet. Gerade so erging es durch viele Jahrhunderte mit Aristoteles, neben Plato, dem großen Erzvater der socialen Politik.
Man hält nach einer landläufigen Auffassung die Deutschen für besonders idealistische Politiker, für geborene Doctrinäre vom reinsten Wasser. Allein gerade in der socialen Politik, wo sich die Franzosen fortwährend in ihrem Phantasiebau einer aus der Luft gegriffenen neuen Gesellschaft verrennen, sind sie ohne Vergleich unpraktischer und idealistischer als der Deutsche, dem es wenigstens noch möglich ist, die tatsächlichen Volkszustände zu begreifen und zu schätzen.
Als französische Sitte, französische Sprache und Kunst Deutschland beherrschte, da war es, wo der geniale Meister der politischen Schule, Montesquieu, und der Ahnherr der socialen Schulmeister, Rousseau die deutschen Anschauungen vom Volke auch in dem französisirten Deutschland in das Joch französischer Abstraktion schlugen. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist die Erkenntnis, und Erforschung des Volkslebens in Deutschland am armseligsten und verachtetsten gewesen. Es war aber auch diese Zeit politisch weit trostloser, als selbst jene des dreißigjährigen Krieges.
Voltaire sagt: »Es gibt Hunde, die man kämmt, die man liebkost; die man mit Bisquit füttert, denen man schöne Hündinnen zum Privatvergnügen hält; es gibt andere Hunde, die man aushungern läßt, die man tritt und schlägt, die zuletzt ein Anatom an den Pfoten auf den Tisch nagelt, um sie bei lebendigem Leibe langsam zu seciren. War es das Verdienst oder die Schuld dieser Hunde, daß sie glücklich oder unglücklich gewesen sind?« Solch wohlfeile Epigramme über das Naturrecht der Gesellschaft schlugen ihrer Zeit tiefer ein als die gründlichsten Untersuchungen über die Naturgeschichte derselben. Die gewaltige Frage von der natürlichen Ungleichheit der Gesellschaftsgruppen, die nicht trotz der ewigen Menschenrechte, sondern mit und in denselben besteht, läßt sich nicht mit allgemeinen moralischen Schlagsätzen abfertigen. Ja es liegt sogar ein frevelnder Leichtsinn in jenem scheinbar von der gerechtesten sittlichen Entrüstung eingegebenen Voltaire'schen Spruch! in den mit Rohheiten und Gemeinheiten gespickten Werken dagegen, in welchen die deutschen Satyriker des 15. und 16. Jahrhunderts das Naturrecht des niedergehaltenen Volkes naturgeschichtlich feststellen wollten, liegt gar oft ein tiefer sittlicher Ernst.
Die ersten deutschen Wochen- und Monatschriften im achtzehnten Jahrhundert waren den englischen nachgebildet. Ihr politischer Inhalt war verzweifelt gering, und dieses kleine Procent politischen Stoffes, welches sie brachten, ging wiederum vollständig auf in den Berichten über Land und Leute, nicht über den Staatsorganismus. Je selbständiger sich diese deutschen Zeitschriften entwickelten, desto einseitiger wandten sie sich dem reinen Literaturleben der Nation zu. Die historisch merkwürdigste deutsche Zeitschrift, die Horen, war ein Literaturblatt, aber nicht ohne mittelbare politische Tendenz. Man wollte den Staatsbürger ästhetisch wieder zum politischen Menschen erziehen und kam auf dem Umweg der Literaturgeschichte wieder zur Naturgeschichte des Volkes. In Goethe's Götz und Egmont war das Volk wieder Kunstobject geworden, durch die Begeisterung für Shakespeare ward man wider Willen zu socialen Studien geführt. Den Franzosen erschien Corneille als der Poet der Staatsmänner, den deutschen Shakespeare. Corneille hat aber, gegen Shakespeare gehalten, das Volk gar dürftig als Kunstobject ausgebeutet, und die Franzosen haben keine sociale Politik.
Der größte deutsche social-politische Journalist des 18. Jahrhunderts war Justus Möser. Es ist ganz unmöglich, sich einen französischen Justus Möser zu denken. Er steht im Gegentheil häufig den englischen Schriftstellern näher, als den schreibenden Zeitgenossen Deutschlands. Die französischen Encyklopädisten wollten nichts für wahr nehmen, als was sie mit ihren fünf Sinnen angeschaut! Möser's größte Vorzüge wurzeln gleichfalls darin, daß er stets seine fünf Sinne offen hielt: der Unterschied ist nur, daß die Encyklopädisten mit ihren fünf Sinnen das vorgefaßte naturrechtliche System in die Volkszustände hineinschauten, während Möser die naturgeschichtliche Eigenart des Volkes klar und rein herauszuschauen wußte. Darum ist er auch unser einziger politischer Zeitungsschreiber, dessen Artikel theilweise wirklich volksthümlich geworden sind, ein Eigenthum der ganzen Nation, aufgestellt nicht nur in dem literarischen Pantheon unseres klassischen Volksschriftenthums, sondern auch in dem buchhändlerischen der Groschen- und Volksbibliotheken. Möser ist der ärgste Widersacher einer abstract naturrechtlichen Politik, durchweg Historiker und Staatsmann, ein Mann, der, wie seine Tochter sagt, nichts gründlicher haßte, als die Spieler und Schreiber, obgleich er selbst nichts leidenschaftlicher that, als – spielen und schreiben. Er schrieb zu einer Zeit, wo die Politik im engern Sinne für unsere Tagespresse noch gar nicht existirte, er schrieb seine für das Localblatt eines abgelegenen Winkels von Deutschland, und als er diese kleinen, meist an ganz beschränkt örtliche Fragen anknüpfenden Artikel zu einem Buche sammelte, befürchtete er, sie möchten dem großen deutschen Publikum wenig munden wegen des »erdigen Beigeschmacks,« den sie aus dem Stift Osnabrück mitbrächten, und ließ sich's gewiß nicht träumen, daß sie nach hundert Jahren noch in den »Groschenbibliotheken der deutschen Classiker« umgehen würden. Worin liegt nun der Zauber der Möser'schen Phantasien? Vor allen Dingen darin, daß Möser unser Volk aus dessen eigenster Natur heraus erschaut, daß er der große Ahnherr unserer social-politischen Literatur gewesen. Er hat nur Fragmente hingeworfen, aber in allen diesen Fragmenten ist der Gedanke von dem Recht der Gesellschaft neben dem Recht des Staates, von der tiefen Bedeutung der geschichtlich überlieferten Sitte neben dem allgemeinen Vernunftrecht der leitende. Als eine naturgeschichtliche Schilderung von Land und Leuten schrieb er seine »Osnabrückische Landesgeschichte« und wies dadurch der Ortesgeschichtschreibung und Topographie, die jetzt schon für die Begründung einer deutschen Social-Politik so unermeßlich wichtig geworden ist, einen neuen Weg. Die »Patriotischen Phantasien« sind die vom politischen Standpunkt genialsten naturgeschichtlichen Studien aus dem deutschen Volksleben, welche wir besitzen; sie sind die Weissagung des achtzehnten Jahrhunderts auf die sociale Wissenschaft des neunzehnten. Möser war nichts weniger denn ein Künstler, aber das Volk behandelt seine plastische Hand recht als ein Kunstobject. Der moderne, historisch forschende und aufbauende Socialpolitiker wird immer wieder auf Möser zurückgreifen müssen, wie der Aesthetiker auf Shakespeare, wie der Theolog auf die Bibel. Und es sprüht in der That ein Shakespeare'scher Geist aus der Gedankenschärfe, dem gesunden Mutterwitz dieses Mannes, aus dem wunderbaren Blick für die Beobachtung und Erfassung jeder lebendigen Thatsache, für die Enthüllung der natürlichen und freiwüchsigen Grundstoffe im Volksleben, wie aus dem vernichtenden Spott, mit welchem er die Verkehrtheiten alter und neuer Gesellschaftszustände geißelt.
Möser konnte von seiner eigenen Literatur-Epoche nur halb verstanden werden, denn sie war die Epoche der poetischen und künstlerischen Befreiungskämpfe; diesem derben, urrealistischen Niedersachsen aber fehlte der Sinn für das tiefere Erkennen des Kunstlebens. Noch ferner lag Möser der nächstfolgenden Periode, denn sie war eine wesentlich philosophische. Hätte Deutschland jemals Beruf zur naturrechtlich construirenden Politik gehabt, so müßte es in dieser Periode gewesen seyn, die einen Möser nothwendig vergessen mußte. Die geistige Grundrichtung unserer Tage ist, im Gegensatze zu jener philosophischen Epoche von Kant bis Hegel, eine historische. Für uns ist der prophetische Patriot von Osnabrück wieder von den Todten erstanden. Er steht mitten in den social-politischen Kämpfen der Gegenwart. Striche man das äußere, rein seiner Zeit angehörende Beiwerk in seinen patriotischen Phantasien weg, man könnte sie heute wieder als schlaghaft wirkende Leitartikel neuesten Datums in unsere Zeitblätter einführen.
Die Blüthezeit unserer modernen philosophischen Literatur, die Zeit von Kant bis Hegel, war, wie gesagt, im Allgemeinen keine günstige für die Pflege der Wissenschaft vom Volke. Die welterschütternden Ereignisse der Revolutionszeit und der napoleonischen lenkten den Blick vom inneren Weben der einzelnen Völker auf die große Politik Europa's. Wenn die Soldaten Politik machen, verstummt der Social-Politiker. Deutschland war damals eben erst heraus getreten aus dem gräulichen Wirrsal lebensunfähiger politischer und socialer Besonderungen, die das deutsche Reich in seiner letzten Periode zu einem so mißgestalteten Körper gemacht hatten. Der äußere Neubau der Staaten war viel wichtiger geworden, als die Vertiefung in das Kleinleben des Volksthums. Es geht durch diese Zeit ein mächtiger Zug zum Aufbau des Allgemeinen, Einheitlichen, zur ausebnenden, uniformirenden Politik, zur theoretischen Construction in der Wissenschaft. Es war weit mehr eine Zeit der Systeme, als der stofflichen Forschung. Selbst in der Kunst, namentlich der bildenden, war die Läuterung der äußeren Formen und ein verständigendes Wort der allgemeinen ästhetischen Grundsätze weit dringender geboten, als ein Hinabsteigen in die unendliche Fülle neuer Stoffe.
Aber trotzdem machen sich in dieser Zeit der Vorarbeit zum Aufbau neuer Staatskörper und neuer Staatsideale bei vielen bedeutenden Männern die Zeichen bemerklich, daß sie die Wichtigkeit einer naturgeschichtlichen Analyse des Volksthums wohl begriffen oder geahnt haben. Als einen merkwürdigen Arbeiter in dieser Richtung will ich beispielsweise nur Einen Mann hervorheben, den Philosophen Johann Jacob Wagner. Er wird uns vielfach in einem ganz anderen Lichte erscheinen, als seinen Zeitgenossen, denn wie mir dünkt, beruht das Auszeichnende dieses Mannes weniger in dem geschlossenen Bau seines Systems, als in den allseitigen Anregungen, mit welchen er die wissenschaftlichen Ziele einer Zukunft, die uns nunmehr zur Gegenwart geworden ist, vorgedeutet hat. Er ist ein Prophet unter den Philosophen seiner Zeit gewesen, wie Möser unter den Publicisten. So hat er die wissenschaftlichen Grundzüge der Nationalökonomie bereits zu einer Zeit systematisch geordnet, wo für das Stoffliche dieses Faches, wenigstens in Deutschland, noch wenig oder nichts gethan war, wo man sich namentlich den selbständigen Aufschwung der Volkswirthschaftslehre, wie sie jetzt Schule und Leben beherrscht, noch nicht entfernt träumen ließ. Er ging sogar noch weiter, als wir gegenwärtig gehen, indem er den originellen Gedanken durchfühlte, als Seitenstück zur Nationalökonomie ein System der Privatökonomie zu schreiben, in welchem die Wirthschaft der Familie in ähnlicher Weise auf ihre allgemeinen wissenschaftlichen Grundsätze zurückgeführt ist, wie in der Nationalökonomie die Wirthschaft des Volkes. Der Versuch mag auf den ersten Anblick seltsam erscheinen, allein für die Lehre von der bürgerlichen Gesellschaft hätte namentlich eine historisch begründete Kenntniß der Privatwirthschaft unserer einzelnen Volksstämme einen unberechenbaren Werth. Hunderte der praktischen Versuche, die jetzt zur Lösung der socialen Wirren gemacht werden, schlagen in das Gebiet der Privatökonomie ein, ohne daß wir uns immer wissenschaftlich dessen bewußt sind. Es wird diese Disciplin nicht allezeit so brach liegen bleiben, wie gegenwärtig; sie hat ihre Zukunft, und wäre es auch nur, weil sie sich ergänzend in die allgemeine Sittenkunde einreihen muß.
Noch überraschender tritt uns der prophetische Standpunkt J. J. Wagners entgegen, wenn wir sein Buch vom Staate zur Hand nehmen. Hier sind namentlich über den materiellen Inhalt des Staatslebens, über die Unterscheidung der Familie, der Gesellschaft und des Staates, über die Gruppen und Glieder des Volkes, über das Verhältniß der Volkswirthschaft zur Staatsverwaltung und vieles Aehnliche so neue Gedanken gegeben, daß wir oft keineswegs glauben, das Buch eines Philosophen vor uns zu haben, dessen Blüthezeit bereits um mehr als ein Menschenalter hinter uns liegt, sondern die Untersuchung eines Praktikers aus der Gegenwart, dessen Geist von den modernen Thatsachen der socialen Politik erfüllt ist.
In den Urstaaten des Orients fiel die Staatswissenschaft mit aller übrigen Weisheit zusammen in der Theologie. »Theologie war die Eine Wissenschaft, Cultus die Eine Kunst.« Hiervon befreiten sich die Griechen, indem sie die politische Philosophie schufen. Aehnlich erscheint in der auf das Mittelalter unmittelbar folgenden Periode die Staatswissenschaft als aufgegangen in der Rechtswissenschaft. Sie aus dieser verwandten Disciplin selbständig herauszuarbeiten, ist die noch keineswegs vollendete That der neuesten Zeit. In einzelnen Zweigen wird freilich die Staatswissenschaft immer mit der Jurisprudenz verwachsen bleiben, wie nicht minder mit der Theologie und Philosophie. Es kommt nur darauf an, denjenigen Theil, der ihr ächtestes Eigenthum ist, auch für sich festzuhalten und durchzubilden, und dieser ist, im Gegensatze zu dem formellen Theile, dem Staatsrecht, der materielle, die Wissenschaft vom Volke. Die Erkenntniß dieser Thatsache blickt aus allen Ausführungen des Wagner'schen Buches vom Staat hervor.
Gegenüber jener Periode der wissenschaftlichen Systeme, der staatsrechtlichen Constructionen, der ästhetischen Theorien, der theologischen Streitfragen, ist nachgerade ein ungeheurer Realismus in unser literarisches Schaffen eingezogen, ein Vorherrschen der Beobachtung des thatsächlichen Lebens, daß man uns zu Kant's und Fichte's Zeit darob Barbaren gescholten haben würde. Der philosophischen Epoche ist eine wesentlich historische gefolgt. Die unerhörten Triumphe, welche die Naturkunde auf dem Wege der Analyse gewann, haben alle anderen Wissenschaften auf denselben Weg fortgerissen. Da mußte die Zeit auch wieder günstig werden für die naturgeschichtliche Untersuchung des Volkes. Ein unübersehbarer Stoff ist in dieser Richtung seit Jahrzehnten von tausend Händen mit wahrem Ameisenfleiße aufgehäuft worden. Leichtfertige Touristen und ernste Forscher wetteiferten, des deutschen Volkes Art bis ins Kleinste zu erkunden und zu schildern. Es erstand eine Wissenschaft der deutschen Sage, der deutschen Sitte, eine neue Wissenschaft der Statistik. Was dem modernen Geschichtschreiber die unmittelbare Quellenforschung, nicht in Büchern, sondern in Archiven, das ist dem Manne der Volkskunde das Anschauen des Volkes, wie es lebt und webt, mit eigenen Augen.
Aber die unendlichen Massen des rohen Stoffes liegen großentheils noch formlos und ungeordnet durcheinander. Es gilt die gesammelten Einzelkenntnisse aus der Naturgeschichte des Volkes nutzbar zu machen in der Lehre für die Idee des Staates, nutzbar in der Praxis für die Weiterbildung unseres Verfassungs- und Verwaltungswesens, für den Wiederaufbau der zerrütteten bürgerlichen Gesellschaft: es gilt diese naturgeschichtlichen Thatsachen zu benutzen als Schild und Schwert wider einseitig politische Parteilehren, die unser politisches Leben nach einmal vorgezeichneter Schablone zurechtschneiden wollen. Dieß nenne ich sociale Politik. Es gilt, auf den Grund dieser naturgeschichtlichen Thatsachen, die Staatswissenschaft zu erweitern und einen selbständigen Theil derselben als Gesellschaftswissenschaft neben das Staatsrecht und die Verwaltungskunde zu stellen. Denn es ist staatsrechtlich ganz gleichgültig und theilweise auch gleichgültig für die Verwaltungslehre, ob der Bauer einen Kittel trägt oder einen städtischen Rock, ob er seine Volksmundart spricht, oder nicht, ob er in seinem Familienleben die alten Sitten bewahrt, oder mit neuen vertauscht hat, ob der Verkehr eines Landes sich auf Eisenbahnen bewegt oder auf Kunststraßen oder auf Knüppeldämmen und Feldwegen, ob die Stammes- und Charakterzüge des Volkes sich nach großen Massen sondern, oder nach kleinen Gruppen, ob das Land, in dessen Gränzen die Staatseinrichtungen zur Geltung gebracht werden sollen, Bergland oder Flachland, Feldland oder Waldland, Küsten- oder Binnenland ist. Das öffentliche Recht sucht die allgemeinen Grundsätze auf, welche über diesen natürlichen Besonderungen von Land und Leuten stehen. Es wird aber doch eine todte, unpraktische Abstraction bleiben, wenn es nicht zugleich auf das berechtigte Wesen dieser Besonderungen selbst gegründet ist.
Die sociale Politik, indem sie von dem gesammten Culturbild einer Volkspersönlichkeit ausgeht, ruht darum auch auf weit breiterer Basis, als die bloße Volkswirthschafts-Politik. Die Nationalökonomie ist nur ein Hülfsfach zur Wissenschaft der Gesellschaft, denn sie untersucht wohl die Arbeit des Volkes, allein das ideale Moment der volksthümlichen Sitte, welches in und mit der Arbeit erwächst, liegt außerhalb des Kreises ihrer Studien. Die unwägbare, unmeßbare, trotzdem aber doch als eine gewaltige politische Macht vorhandene Sitte des Volkes bildet den eigensten Stoff der Untersuchung für die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer socialen Politik. Im Gegensatz zu einer früheren Zeit, welche die feste Basis des Zählens, Messens und Wägens im Staatshaushalt über Gebühr vernachlässigte, scheint aber der an sich so löbliche Eifer, mit welchem man jetzt diese Dinge betreibt, bald wieder ins Extrem überschlagen zu wollen, indem die ganze Kunst der Staatsverwaltung in die einseitige Function einer kaufmännischen Buchführung verkehrt zu werden droht. Und vor den ungeheuren Zahlenreihen, welche gegenwärtig unsere Zeitungen wie unsere publicistischen Schriften erfüllen, darf man wohl zu Zeiten erschrecken: denn hinter ihnen lauert oft der trügerische Gedanke, daß mit diesen Ziffern zugleich die Kenntniß der öffentlichen Zustände gegeben sey: hinter ihnen verbirgt sich bereits nicht selten die politische und sittliche Ketzerei, welche die Mehrung des materiellen Nationalwohlstandes als einziges Ziel des Volks- und Staatslebens setzt. Man verwechselt eben hier die Wirthschaftspolitik mit der socialen. Dem entspricht auch die einseitige Richtung, welche die Statistik genommen hat. Denn der große und ruhmwürdige Eifer, mit welchem in den letzten Jahren diese Wissenschaft in Deutschland selbständiger herausgearbeitet worden ist, hat zumeist entweder der Ergründung der Staatshaushalte, oder der Kunde vom Handels- und Gewerbewesen, der Volkswirthschaft im allgemeinen Sinne gegolten. Dagegen ist für die in beglaubigten Zahlen und zeitgeschichtlichen Schilderungen festgestellte Kunde des Volkslebens nach seinen örtlichen Gruppen, des Gemeindewesens, der Gestaltungen der Stände und Berufe im Kleinen und Einzelnen noch weit weniger geschehen. Das heißt: wir besitzen wohl gute Anfänge zur Statistik des Staates, aber noch keineswegs zur Statistik der bürgerlichen Gesellschaft, zur Statistik der Volkswirthschaft, aber nicht der Naturgeschichte des Volkes. Denn die Wirthschafts- und Finanzstatistik ist für die Wissenschaft vom Volke zwar eine unentbehrliche, aber keineswegs die einzige Quelle. Soll diese erst in ihrer Frühblüthe entwickelte Wissenschaft einen urkundlich beglaubigten Boden der Thatsachen erhalten, dann muß sich zu der wirtschaftlichen Zahlenstatistik eine geistige Statistik der Sitten gesellen.
Wie die Landesgeschichte in der Ortsgeschichte gründet und sich ergänzt, so muß auch die sociale Statistik bis zum Dorf und Gehöfte sich verzweigen. Wir verlangen von ihr beispielsweise: Tabellen über Ab- und Zunahme der Bevölkerung der einzelnen Völker, Gauen und Gemeinden, nicht bloß aus der Gegenwart, sondern wo möglich auch aus der alten Zeit! Aufzeichnung über Stand, Beruf, Charakter, Sitten und Gebräuche der Bewohner der Gemeinden oder Gemeindegruppen; das Wesentliche vom Gemeindevermögen, Güterreichthum und Güterreintheilung, Nutzungen, Gerechtsamen und Lasten; eine Skizze der Flurmarkungen, Proben merkwürdiger Flurnamen; Angaben über die kirchlichen Zustände etc. Unsere geschichtlichen Topographien gehen selten bis auf die neueste Zeit, geben meist nur die politische, nicht die Culturgeschichte der einzelnen Städte und Dörfer, und wenn sie auch alles dieß vereinigten, so ist doch bis jetzt in den meisten deutschen Ländern die Statistik des Besitzstandes der einzelnen Gemeinden und seiner Formen, der Gerechtsame, Lasten u. dgl. nur in den Akten, nicht in Büchern zu finden gewesen. Und endlich von einem bis auf einzelne Gemeinden heruntergehenden gesellschaftlichen Charakterbild ist überall noch kaum eine Spur vorhanden. Auf solcher Ortsstatistik aber beruht hauptsächlich die »Landeskunde« in der vollwichtigsten Bedeutung des Wortes und eine solche urkundliche und ins Einzelste gehende Landeskunde ist wiederum die reichste und reinste Quelle für die Wissenschaft der Gesellschaft.
Trotz aller Lücken sind in den letzten Jahrzehnten die Vorarbeiten zur Naturgeschichte des Volkes und zur Gesellschaftskunde wie ein mächtiger Strom über uns hereingebrochen. Fast jeder Literaturzweig hat in allerlei Form sein Theil dazu gespendet. Als die belletristische Presse des jungen Deutschlands die ästhetischen Schulfragen sattsam durchgearbeitet hatte, stahl sich mit der socialen Frage die Politik in die Schöngeisterei hinein. Als die junghegel'schen Philosophen mit ihren religiös-philosophischen Folgerungen zum äußersten Rande gekommen waren, wandten sie sich zu den socialen und culturpolitischen. Die Armuth und das Elend des Volkes hat die Männer der Kirche zu reichen naturgeschichtlichen Studien des Volkslebens geführt, und die »innere Mission« ist nicht bloß eine Mission der Kirche, sondern auch der aufbauenden Socialpolitik. Deutschland war der theoretischen Constructionen müde: da fing man an, sich wieder für die großen materiellen Interessen zu begeistern, für Zoll- und Handelsfragen, Industrie, Volkswirthschaft, Regelung der Auswanderung, Abhülfe der Armennoth. Aber überall lauerte die sociale Frage im Hintergrunde; man förderte die naturgeschichtliche Analyse des Volksthumes oft ohne daß man es merkte. Die sociale Frage war das eigentliche Salz auf diesem trockenen Brode der materiellen Interessen. Darin bekundete sich recht der mächtige Zug der Zeit, daß selbst ganz fernstehendes wissenschaftliches und literarisches Wirken doch wieder zuletzt der Gesellschaftskunde dienstbar werden mußte. Mit dem Studium der deutschen Grammatik brach für die Erforschung unserer Sitten, Sagen und Rechtsalterthümer ein neuer Morgen an. Die Finanzwissenschaft führte zur Nationalökonomie, die Nationalökonomie zur Wissenschaft vom Volke. Die Socialisten wollten die historische Gesellschaft theoretisch vernichten und bewirkten dadurch, daß die Untersuchung dieser selben historischen Gesellschaft erst recht im Geiste der empirischen Analyse aufgenommen wurde.
Der moderne Roman mußte sich mehr und mehr zur Charakterzeichnung und den Geschicken des Volkes und der Volksgruppen wenden, wo früher nur von den einzelnen Helden die Rede war. Das Volk spielt wieder eine entschieden größere Rolle als Kunstobject denn je zuvor. Kaulbach malt Völkergeschichte, wie man vordem einzelne historische Personen und Gruppen gemalt hat. So verstand auch Rottmann, der größte Landschaftsmaler unserer Zeit, den Charakter eines ganzen Landstrichs auf seinen großartigen Landschaftsfresken darzustellen, wo man sich vordem mit einem kleinen Bruchstück aus einer solchen Charakteristik begnügt haben würde. In der Oper ist der Chor, das Volk, musikalisch gleichberechtigt worden mit dem einzelnen Helden, und die Ensemblenummern wetteifern in ebenbürtiger Dramatik mit dem Sologesang. Das Volk in seinen Gruppen und Gliedern wird zum ästhetisch bedeutsamsten Helden in der ganzen modernen Kunst.
Die gefeiertsten Männer der Wissenschaft haben es nicht verschmäht, in der Journalistik unserer Tage die großen socialen Culturfragen fleißig zu erörtern. Die sociale Politik beginnt allmählig der ganzen deutschen Zeitungspresse einen eigenthümlichen Charakter zu geben. Bis etwa gegen das Jahr 1844 handelte man hier die Vorstudien zur Gesellschaftskunde noch ziemlich kühl und sparsam ab; die literarischen und religiösen Zeitfragen standen obenan; aber mit jenem Zeitpunkt bricht das bestimmte social-politische Interesse entschieden durch, bis es im Jahr 1848 plötzlich wieder wie weggefegt erscheint. Es war aber auch nur ein Schein, denn gleichviel welche Partei in jenen Revolutionstagen gesiegt haben würde, wir wären doch durch den innern Lebenstrieb unsers Nationalcharakters zuletzt wieder auf dem Weg angekommen, wo wir durch die Reform der Gesellschaft den Staat zu reformiren und neuzubauen gesucht hätten; aber nie und nimmer umgekehrt nach französischer Art die Gesellschaft durch den Staat.
In den Jahren 1848 und 49, wo das Staatsrecht von allen Dächern gepredigt wurde, war die deutsche Journalistik verhältnißmäßig minder einflußreich als vorher, obgleich sie zum Erschrecken in die Länge und Breite gewachsen war. Die Macht der Presse war an die Parlamente und Volksversammlungen übergegangen. In England oder Frankreich würde ohne Zweifel das Umgekehrte eingetreten, die Macht der Presse würde gewachsen seyn mit der Macht der Parlamente. Die »Deutsche Zeitung« von Gervinus ging zu Grunde, weil sie sich drei Jahre lang ausschließlich mit der reinen Politik beschäftigen wollte. Nicht das angewandte Staatsrecht, sondern die angewandte Sittengeschichte gibt der deutschen Journalistik ihren eigenthümlichen Reiz, ihren wahrhaft nationalen Farbenton. In den wildbewegten Tagen einer gewaltigen großherzigen Aufwallung des ganzen deutschen Volkes konnte der »Rheinische Merkur« als rein politisches Organ eine nationale Macht seyn. Hätte man ihm aber Lebensfrist für ruhigere Zeiten gegönnt, er wäre gewiß an demselben organischen Herzfehler gestorben wie später die »Deutsche Zeitung« – er wäre langweilig geworden. In Frankreich wird man es nicht begreifen können, warum ein politisches Blatt zu Grunde gehen müsse, lediglich weil es ein rein politisches Blatt sey. Aber in dem centralisirten Frankreich ist der Staat der hundertarmige Riese, die Gesellschaft der Zwerg; in Deutschland ist es umgekehrt.
Die Deutschen sind kein unpolitisches Volk; sie sind ein entschieden social-politisches. Der alten Schule, die bloß von Verfassungsfragen einerseits, andererseits vom dunkeln Räthselspiel der hohen Politik zehrt, will das freilich nicht in den Kopf. Die alte Schule erkennt nur eine Politik des Rechtes oder der Diplomatie (wie man in den kleinen Staaten noch häufig glaubt, nur ein Jurist oder Diplomat könne Minister werden), keine Politik der Sitte. Belauschet aber das deutsche Volk bis zum bildungslosesten gemeinen Mann abwärts, und ihr werdet finden, daß Kleinbürger, Bauern und Tagelöhner in den Fragen der Wirthschaftsinteressen, des Gewerbelebens, der Gesellschaftsgliederung durchschnittlich ein gesundes Urtheil, ja sogar einen vorweg festgeprägten Parteistandpunkt haben. Die Naturgeschichte des Volkes fassen sie mit ahnendem Verständnis trefflich auf. Social-politische Parteien gibt es im deutschen Volke sehr entschiedene nach rechts und links, nicht künstlich eingeimpfte, sondern naturwüchsige. Das rein politische Parteiwesen ist dagegen noch niemals bei unserm gemeinen Mann angeschlagen, und wer sich nicht durch die deutlichen Winke in der neuesten Entwicklung unserer gesammten Wissenschaft, Kunst und Literatur von der Wahrheit des Satzes überzeugen lassen mag, daß der Deutsche ein geborener Social-Politiker sey, der kann sich in jeder Stadtschenke und Dorfkneipe darüber belehren lassen. Dort kannegießern die Leute bloß, sofern es sich um eine Frage des Staatsrechtes oder der äußern Staatsmacht handelt, dagegen über die socialen Gebrechen, Bedürfnisse und Forderungen ihres Standes und Gewerbes, über die großen Tagesfragen der Arbeit, der Genossenschaften und Vereine, der Gemeindeverfassung, der Familienzucht, der Sitte im öffentlichen Leben, über die naturgeschichtliche Eigenart der sie umgebenden Volksgruppen sprechen solche deutsche Naturalisten der Social-Politik nicht selten wie ein Buch und oft auch gescheidter wie ein Buch.
Man wähne nicht, es mangle unserm Volke am Sinn für die großen Probleme des Staats- und Völkerrechtes, weil es zur Zeit noch viel tieferes Verständnis für Arbeit und Sitte als für Rechtszustände zeigt, und es sey wohl gar dieser Mangel ein künstliches Produkt unserer inneren Unfreiheit und äußeren Ohnmacht! Der Weg zum Recht führt durch die Sitte, der Weg zur Freiheit durch die Selbsterkenntnis, der Weg zur Macht durch das liebevolle Umfassen unserer nationalen Eigenart. Solch ein Weg ist langsam, aber sicher, und eine gute Krümm' »führt nit üm.«
Die Erfassung des Volkes als Kunstobject soll in dieser gegenwärtigen Zeit nicht bloß dem Schriftsteller, Lehrer und Künstler gewonnen seyn, sondern in noch weit reicherem Maße dem Staatsmann. Hat sich der Politiker in des Volkes Wesen nicht eingelebt, wie der Künstler in seinen Stoff, weiß er sich die Charaktere des Volksthumes nicht als ächte Kunstobjekte plastisch abzurunden, dann wird er in aller seiner Staatsweisheit doch immer nur mit der Stange im Nebel herumschlagen. Die naturgeschichtliche Analyse des Volkslebens aber führt dazu, daß uns das Volk zuletzt in seiner plastischen Persönlichkeit recht wie ein harmonisches Kunstwerk erscheinen muß. Wie aller naturwissenschaftlichen Untersuchungen höchste Aufgabe dahin geht, das Weltall als einen in sich vollendeten harmonischen Gesammtbau zu erkennen, als einen Kosmos, so müßte es auch zuletzt mit allen naturgeschichtlichen Untersuchungen des Volkes geschehen. Es ist eines der stolzesten Ziele der Gegenwart, die Welt als ein in sich selbst befriedigtes, freies, harmonisches Kunstwerk zu begreifen; so wird es auch eines der stolzesten Ziele der Gegenwart werden, denselben gewaltigen Gedanken in unserm engeren Kreise zu wiederholen und auch das Volk allmählig naturgeschichtlich zu begreifen und darzustellen als ein geschlossenes Kunstwerk, als den Kosmos der Politik.
Zweites Kapitel. Die vier Fakultäten.
Alle Dinge wechseln; nur die vier Fakultäten scheinen für die Ewigkeit gebaut. Kaiser und Reich ist vergangen, Deutschland ward zweigetheilt in seinem christlichen Bekenntniß, große wissenschaftliche Revolutionen loderten auf und verglommen wieder in ihrer eigenen Asche, die Epoche der sogenannten Wiedergeburt der Wissenschaften, die Epoche der Renaissance und des Zopfes, die Epoche der dicken holländischen Gelehrsamkeit, des leichtsinnigen französischen Encyklopädismus und der tiefsinnigen deutschen Philosophie – Alles ging vorüber; nur die grauen vier Fakultäten sind geblieben.
Die letzten zwei Jahrhunderte haben nur Eine Kunst wahrhaft neu geschaffen: die Musik; dagegen aber ganze Kreise neuer Wissenschaften. Diese neuen Wissenschaften mußten hineinwachsen in die unsterblichen vier Fakultäten der Theologie, der Jurisprudenz, der Medicin und der Philosophie, statt daß sie mit ihrem selbständigen Wachsthum ein neues System der Fakultäten hätten heraustreiben müssen. Sie wurden zerstückelt oder verkrüppelten in ihren schwächeren Zweigen durch den Bann jenes alten Gemäuers, oder wo sie ihre Schößlinge mit unbesiegbarer Lebenskraft trieben, da wuchsen sie in wilden Ranken hinaus über dasselbe.
Aber was kümmern uns hier die vier Fakultäten? Sie kümmern uns nicht wenig; denn sie tragen eine Hauptschuld, daß die Wissenschaft vom Staate so lange verkrüppelt blieb, daß die Wissenschaft vom Volke noch so gar jung und unentwickelt ist.
Wer eine Naturgeschichte des Volks schreiben will, der muß dieselbe Stellung einnehmen, wie der Mann der eigentlichen modernen Naturwissenschaft: er muß Kampf bieten den vier Fakultäten und trachten, daß die vier Fakultäten zersprengt werden, oder die mittelalterliche Maschine der vier Fakultäten wird seine Wissenschaft in Stücke reißen. An den vier Fakultäten möchte ich zeigen, was die Volks- und Staatskunde werden kann und was sie nicht geworden ist.
Also zurück zu den vier Fakultäten.
Als in den letzten traurigen Zeiten des römischen Reiches die antike Wissenschaft erstarrte, ward der Grundstein zu den vier Fakultäten gelegt. Man begann die Theile der Wissenschaft zu zergliedern, wie man eine Leiche zergliedert, und als anatomische Präparate gingen daraus hervor die »sieben freien Künste,« die wir sammt ihrer Scheidung in das Trivium und Quadrivium bereits bei dem Grammatiker Macrobius finden. Die sieben freien Künste aber sind der Grundbau zur späteren philosophischen Fakultät.
Die Wissenschaften erschienen nunmehr als fertige, abgeschlossene Dinge, vergleichbar den sogenannten »todten Sprachen.« Alle Weisheit wird eingefügt in das Fachwerk der Schulwissenschaften. Was zu lange ist, wird abgeschnitten, was zu kurz, ausgereckt, bis es in das System paßt.
Die neu erstehenden germanischen und romanischen Völker des Mittelalters bringen keine neue Wissenschaft mit. Sie borgen vorerst nur die Wissenschaft der erstarrten antiken Welt, und das Schulsystem der sieben freien Künste nehmen sie natürlich auch mit in den Kauf.
So bleibt die Wissenschaft wesentlich etwas Geschlossenes, Gemachtes durch das ganze frühere Mittelalter. Auch die Kunst befand sich anfänglich in dem gleichen Bann. Aber der künstlerische Schaffenstrieb dieser Zeit ist ungleich mächtiger als der wissenschaftliche, und aus der verdorbenen Antike und dem Byzantinismus wächst rasch ein im innersten Wesen neuer romanischer und germanischer Kunststyl auf.
Mit den sieben freien Künsten plagen sich die Gelehrten Jahrhunderte lang. Da wird gegrübelt, wie man die eigenthümlichste Wissenschaft der Zeit, die Theologie, zusammenkuppeln könne mit diesen Künsten. Sie gehört zur Geometrie, weil die Arche Noä und der Tempel Salomonis nach geometrischen Grundsätzen aufgebaut waren; zur Arithmetik, weil Gott alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet; zur Rhetorik, weil die Priester auch predigen sollen; zur Dialektik, weil mit deren Waffen die Ketzer im geistlichen Turnier zu Boden geschlagen werden müssen. So sucht das Mittelalter die einzelnen Wissenschaften an einander zu fesseln; die neuere Zeit hingegen sucht sie frei zu machen.
In todte Formen eingehegt, waren die Wissenschaften nicht nur vergleichbar den todten Sprachen, sie redeten auch durch das ganze Mittelalter in der todten Sprache der alten Welt. Eine wahrhaft lebendige Wissenschaft aber kann niemals in einer todten Sprache ihre Vollendung finden. Sie schafft sich selber ebensowohl ihre neue Sprache, wie neue Gesammtgruppen, darin sich das Verwandte wiederfindet, das heißt eben neue »Fakultäten.«
Mit dem Aufblühen der hohen Schulen wird jene todte mittelalterige Wissenschaft über sich selbst hinausgeführt, sie wird zum Leben erweckt. Eine erste Vorbedingung dazu war es aber, daß die Schranken der »sieben freien Künste« fallen mußten. Jetzt erheben sich die vier Fakultäten als ein Wahrzeichen der lebendig gewordenen mittelalterigen Gelehrsamkeit. In der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ersteht auf der Pariser Hochschule zuerst die theologische Fakultät, welcher sich rasch die drei andern gegenüberstellten – nicht um die Wissenschaft einzuzwängen, sondern um sie frei zu machen. Das Eindringen der Ordensgeistlichen in die Hochschulen führt zur theologischen Fakultät; deren Uebermacht aber wollen die andern brechen durch die neue Macht, die facultas ihrer eigenen Wissenschaftsgruppen. Es war ja überhaupt die Zeit, wo Wissenschaft und Kunst überging aus der ausschließlichen Pflege der Geistlichen in die Pflege alles Volkes. Die Mediciner und Juristen, die schon in Salerno und Bologna die Selbständigkeit ihrer Wissenschaft erkannt hatten, trotzten dem Clerus mit der Gründung eigener Fakultäten, und indem man zuletzt die Summe der bisherigen sieben freien Künste in der philosophischen Fakultät zusammenfaßte, schloß sich das vierblättrige Kleeblatt ab.
So wurden die vier Fakultäten für das spätere Mittelalter Werkzeuge der heilsamen geistigen Reibung, Grundpfeiler des Fortschrittes und der wissenschaftlichen Befreiung.
Allein mit dem Anbruch der neuen Zeit wurde auch den Wissenschaften eine neue Welt entdeckt. Neue Stoffe wurden gefunden, die bisher weitab gelegen hatten dem gelehrten Forschen. Die vier Fakultäten blieben. Schon im sechzehnten Jahrhundert begannen die Wissenschaften mächtig aus diesem alten Fachwerk herauszuwachsen. Namentlich erheben sich zwei große Wissenschaftsgruppen immer selbständiger, für welche die vier Fakultäten nicht Raum noch Namen hatten: die Naturwissenschaften und die Staatswissenschaften. Die wissenschaftliche Naturforschung war ja vom Mittelalter nur geahnt, nicht begriffen worden, und aus den für die eigene Zeit verhüllten mittelalterigen Staatsideen konnte noch keine Staatswissenschaft hervorwachsen. Seit der Wiedergeburt des klassischen Alterthums wurde es anders. Die Naturforschung begann sich auf die eigenen Füße zu stellen; aber sie blieb die Magd der Medicin; denn wo wäre sonst Raum für sie gewesen in den vier Fakultäten? Das wunderliche und wunderbare Charakterbild des Paracelsus zeigt uns, wie die Naturwissenschaft ringt, sich frei zu machen, und immer wieder zurückfällt in die Knechtschaft des Schulsystems. Die Staatswissenschaft blieb die Magd der Jurisprudenz.
So haben also die vier Fakultäten seit dem Ausgange des Mittelalters ganz dieselbe traurige Rolle übernommen, welche beim Beginn dieser Epoche den sieben freien Künsten zugefallen war. Sie trugen die erstarrten Formen einer abgelebten Zeit in die neue herüber und durchschnitten und hemmten die natürlichen neuen Gliederungen der Wissenschaft.
Man darf die culturgeschichtliche Wucht dieser Thatsache wahrlich nicht gering anschlagen.
Beispiele mögen reden.
Mit den großen Länderentdeckungen des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts erschließt sich eine ganz neue Weltkunde. Die Geographie wird zu einer selbständigen Wissenschaft, gerüstet mit einer Fülle und Tiefe des Inhalts, wovon das Alterthum, geschweige das Mittelalter, sich nichts träumen ließ. Aber diese neue Geographie, in welcher der erwachende Geist der modernen Zeit mit seine ersten und größten Triumphe feiert, kann nirgends recht zünftig werden. Sie paßt nicht in das Fachwerk der alten Fakultäten. Sie bildet sich vereinsamt aus, lange Zeit fast zusammenhangslos mit der eigentlichen Schulgelehrsamkeit. Sie stiehlt sich wohl ein in die philosophische Fakultät, allein sie muß sich seitab in den Winkel kauern; aus Gnaden decken ihr die Philosophen ein Katzentischchen, sie darf nicht mitsitzen an der großen Tafel der alten Schulwissenschaften. Noch im achtzehnten Jahrhundert ist man in Verlegenheit, unter welche gangbare Rubrik man die Geographie reihen soll und stellt sie daher unter die Geschichte! Die Folge dieser Heimathlosigkeit eines so wichtigen Wissenschaftszweiges war dann, daß er weder überall in den befruchtenden Zusammenhang mit den übrigen Wissenschaften gebracht wurde, noch den vollen Einfluß auf die allgemeine Bildung üben konnte.
Noch schlimmer erging es bei den Staatswissenschaften. Zuerst kam die Praxis, dann die Theorie: aus der Medicin lösen sich allmählig die Naturwissenschaften selbständig ab, aus der Jurisprudenz die Staatswissenschaften. Die praktische und historische Untersuchung der Rechtssätze führte zuletzt zu einer Theorie des Staates als der allgemeinsten Rechtsanstalt. So ward die juristische Fakultät das Geburtshaus der Wissenschaft vom Staate. Mancherlei Vorzüge, aber auch mancherlei Einseitigkeit, die wir noch lange nicht alle abgeschüttelt, verknüpfte sich mit diesem Ursprung. Das Staatsrecht verschlang jeden andern Zweig der politischen Fächer. Die Kunst der Staatsverwaltung konnte bis tief in's achtzehnte Jahrhundert nur handwerksmäßig, nicht wissenschaftlich erlernt werden, weil die juristische Fakultät keinen Raum bot zur selbständigen Durchbildung der Verwaltungwissenschaften. Der künftige Staatsbeamte mußte von Kanzlei zu Kanzlei in die Lehre gehen, wie der angehende Schneider von einer Schneiderwerkstatt zur andern. So erstarrten denn auch die Verwaltungswissenschaften in der rohesten Praxis. Ausgeschlossen aus den vier Fakultäten fehlte jene befruchtende Wechselwirkung des allgemeinen Wissenschaftsverbandes. Kein Zweig der Gelehrsamkeit war im siebzehnten Jahrhundert und im Anfange des achtzehnten so strohdürr, wie sämmtliche Fächer der Politik mit Ausschluß des Staatsrechts. Die Staatswirthschaft galt noch als die Lehre »von dem Erwerb und den Einkünften der Fürsten.« Die Summe der Kameralwissenschaften ward für gleichbedeutend genommen mit der Kenntniß des Steuerwesens, und man bestimmte wohl gar die Kameralwissenschaft als die Unterweisung, welche lehre, »wie dem Bürger am schicklichsten Geld abgenommen werden könne, ohne daß er es allzu sehr spüre.« Wer als ein aufgeklärter Kopf Front machte gegen die juristischen Fakultätszöpfe, der schob allenfalls die Politik als »Klugheitslehre« in den weiten Sack der Philosophie. Die Polizei ging dann auch mit darein bei der Philosophie, und die gesammte unermeßliche Wissenschaft der Nationalökonomie galt wohl gar als ein kleiner Sprößling der Polizei, den man verstohlenerweise eben auch noch den Philosophen in die Tasche stecken konnte. Ein großer Fortschritt war es schon, daß die allgemeine Staatslehre als »Naturrecht« – also immer noch die Eierschale ihres Ursprungs aus der juristischen Fakultät hintennach ziehend, – in der philosophischen Fakultät ein anständiges Unterkommen fand.
Man muß nicht meinen, daß solch ungeheures Wirrsal etwa in dem Wesen der politischen Wissenschaften begründet sey, oder daß diese Fächer damals an sich noch zur Ausbildung unfähig gewesen. Ihre schiefe Stellung, ihre Heimathlosigkeit in dem weiten Reiche der gelehrten Welt war schuld daran, die vier Fakultäten waren schuld daran.