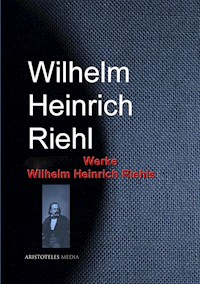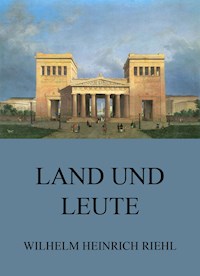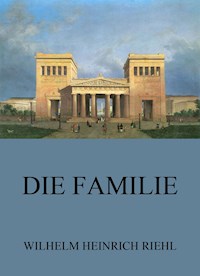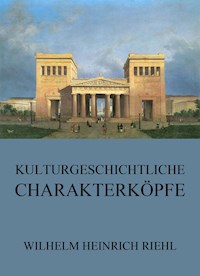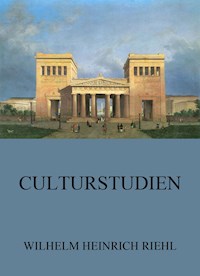
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wilhelm Heinrich Riehl war ein deutscher Journalist, Novellist und Kulturhistoriker. In seinen Werken betonte er früh soziale Strukturen und gewann so Einfluss auf die Entwicklung der Volkskunde im 19. Jahrhundert, als deren wissenschaftlicher Begründer er gilt. Dieser Band bietet seine Kulturstudien aus drei Jahrhunderten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Culturstudien
Wilhelm Heinrich Riehl
Inhalt:
Wilhelm Heinrich Riehl – Biografie und Bibliografie
Culturstudien
Erstes Buch - Historisches Stillleben.
Der Homannische Atlas
Studien in alten Briefstellern.
Volkskalender im achtzehnten Jahrhundert.
Das landschaftliche Auge.
Das musikalische Ohr.
Alte Malerbücher als Quellen zur Volkskunde
Der Kampf des Rococo mit dem Zopf.
Die Napoleonische Kunstepoche.
I.
II.
Samuel Amsler
Zweites Buch - Zur Volkskunde der Gegenwart.
Die Volkskunde als Wissenschaft.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Der Geldpreis und die Sitte
I.
II.
III.
Augsburger Studien.
I. An vier Flüssen
II. Der Stadtplan als Grundriß der Gesellschaft
III. Das Pompeji der Renaissance
IV. Aus der Zunftstube
V. Antiquarische Privatstudien
VI. Verfall und Wiederaufbau
VII. Die kirchliche Parität
Drittes Buch - Zur ästhetischen Culturpolitik.
Unsere musikalische Erziehung.
Briefe an einen Staatsmann.
Erster Brief
Zweiter Brief
Dritter Brief
Vierter Brief
Fünfter Brief
Sechster Brief
Siebenter Brief
Achter Brief
Neunter Brief
Zehnter Brief
Elfter Brief
Culturstudien, W. H. Riehl
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849633912
www.jazzybee-verlag.de
Wilhelm Heinrich Riehl – Biografie und Bibliografie
Namhafter kulturhistorischer Schriftsteller, geb. 6. Mai 1823 in Biebrich a. Rh., gest. 16. Nov. 1897 in München, studierte in Marburg, Tübingen, Bonn und Gießen, redigierte seit 1846 mit Giehne die »Karlsruher Zeitung«, begründete dann mit Christ den »Badischen Landtagsboten« und gab, nachdem er zum Mitgliede der deutschen Nationalversammlung gewählt worden, 1848 bis 1851 die konservative »Nassauische allgemeine Zeitung« heraus, während er zugleich mit der musikalischen Leitung des Hoftheaters in Wiesbaden betraut war. Nachdem er 1851–53 bei der Redaktion der Augsburger Allgemeinen Zeitung tätig gewesen, folgte er 1854 einem Ruf als Professor der Staats- und Kameralwissenschaften nach München, wo er 1859 die Professur der Literaturgeschichte übernahm und 1862 Mitglied der Akademie der Wissenschaften ward. 1885 wurde er zum Direktor des bayrischen Nationalmuseums ernannt. Er schrieb: »Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik«, in 4 Bänden: Band 1: »Land und Leute« (Stuttg. 1853, 10. Aufl. 1899), Band 2: »Die bürgerliche Gesellschaft« (1851, 9. Aufl. 1897), Band 3: »Die Familie« (1855, 12. Aufl. 1904; Band 1–3 auch in Schulausgaben von Th. Matthias, Stuttg. 1895 bis 1896), Band 4: »Wanderbuch« (1869, 4. Aufl. 1903); »Die Pfälzer« (das. 1857, 2. Aufl. 1858); »Kulturstudien aus drei Jahrhunderten« (das. 1859, 6. Aufl. 1903); »Die deutsche Arbeit« (das. 1861, 3. Aufl. 1884); »Musikalische Charakterköpfe« (das. 1853–77, 3 Bde.; Band 1 u. 2 in 8. u. 7. Aufl. 1899); »Kulturgeschichtliche Novellen« (das. 1856, 5. Aufl. 1902); »Geschichten aus alter Zeit« (das. 1863–65, 2 Bde., u. ö.); »Neues Novellenbuch« (das. 1867, 3. Aufl. 1900); »Aus der Ecke, neue Novellen« (Bielef. 1875; 4. Aufl., Stuttg. 1898); »Am Feierabend«, 6 neue Novellen (Stuttg. 1880, 4. Aufl. 1902); »Lebensrätsel«, 5 Novellen (das. 1888, 4. Aufl. 1906), die letztern 6 Werke auch gesammelt als »Geschichten und Novellen« (das. 1898–1900, 7 Bde.); »Freie Vorträge« (das. 1873, 2. Sammlung 1885); »Kulturgeschichtliche Charakterköpfe, aus der Erinnerung gezeichnet« (das. 1891, 3. Aufl. 1899); »Religiöse Studien eines Weltkindes« (das. 1894, 5. Aufl. 1900) und eine Reihe kulturgeschichtlicher Abhandlungen in den Denkschriften der Münchener Akademie und der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Auch veröffentlichte er zwei Hefte Liederkompositionen u. d. T.: »Hausmusik« (Stuttg. 1856, 2. Aufl. 1859) und »Neue Lieder für das Haus« (Leipz. 1877). Unter Riehls Leitung erschien 1859–67 die »Bavaria«, eine umfassende geographisch-ethnographische Schilderung Bayerns in 5 Bänden. 1870–79 gab er das von Raumer begründete »Historische Taschenbuch« heraus. Nach seinem Tod erschien noch sein (einziger) Roman: »Ein ganzer Mann« (Stuttg. 1897, 4. Aufl. 1898). Vgl. Simonsfeld, Wilh. Heinr. R. als Kulturhistoriker (Münch. 1898). – Seine Tochter Helene machte sich als Landschaftsmalerin bekannt.
Culturstudien
Erstes Buch - Historisches Stillleben.
Der Homannische Atlas
1853.
Wenn man in Nürnberg die malerische Straße zur alten Reichsburg hinaufwandelt, dann liegt uns zur Linken das stattliche Haus weiland Johann Baptist Homanns. – Suae Caes. Majestat. Geographus, des römischen Kaisers Geograph, pflegte sich der merkwürdige Mann zu unterschreiben, der dem Kloster und der Notariatsstube entronnen war, um seinem Stern zu folgen und der erste deutsche Landkartenverleger seiner Zeit zu werden. Dieses Haus ist jetzt ein stilles Privathaus; vor hundert Jahren dagegen hatte eine staunenswerthe Betriebsamkeit ihren Sitz darin aufgeschlagen.
Homann hatte ein gutes inneres Recht auf seinen Ehrentitel eines Geographen der kaiserlich römischen Majestät, denn für die Aussaat geographischer Kenntnisse unter allem Volk des heiligen römischen Reiches hat Keiner so durchgreifend und andauernd fast ein Jahrhundert lang gewirkt, als er und seine Erben und Geschäftsnachfolger, das »Homannische Haus.«
Der Homannische Atlas, diese Landkartensammlung ohne Ende, war seiner Zeit ebenso zum Sprüchwort geworden, wie bei den vorhergegangenen Geschlechtern Adam Riesens Rechenbuch. Auch dieses hatte seine ungeheure Verbreitung durch das ganze Reich, zahlreiche Nachdrücke ungerechnet, hauptsächlich den Nürnberger Pressen zu danken. Adam Riesens Rechenbuch lebt im Volksliede fort, und in dem populären Epos vom und für den deutschen Philister des achtzehnten Jahrhunderts, in der Jobsiade, ist dem Homannischen Atlas ein Denkstein in Knittelversen gesetzt.
Heeren bezeichnet die Chartographie der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts als die holländische Periode, der zweiten Hälfte als die französische, die erste Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts aber als die deutsche Periode, und zwar letztere wegen des herrschenden Einflusses der Homann'schen Offizin. Vom rein fachwissenschaftlichen Standpunkte kann man es bezweifeln, ob Homann ebenbürtig sei, gleich einem Mercator und Cassini an die Spitze einer Epoche der Landkarten-Geschichte gestellt zu werden. Im Sinne des Culturhistorikers aber hat Heeren Recht. Die volksthümliche Breite deutscher Bildung und jene verschmelzende Kraft, womit sie den besten Besitz fremder Nationen sich stets eigen zu machen weiß, spricht epochemachend aus Homanns Kartenblättern. Sein Atlas ist ein fortlebendes Zeugniß für die allgemeine Liebhaberei der geographischen Studien, welche das achtzehnte Jahrhundert auszeichnet. Mit der französischen Revolution war dem friedlichen geographischen Dilettantismus und zugleich der Epoche des Homannischen Atlasses ein Ende gemacht. Als die Jakobiner kamen, vergaßen die deutschen Reichsstände die Kartenaufnahme ihrer Duodezgebiete, vergaß das große Publikum die Wilden und ihre Palmwälder und den Traum von dem idyllischen Leben der Naturvölker, dem es am warmen Ofen, eingenickt im weichen Polstersessel moderner Civilisation, so behaglich sich hingegeben hatte.
Mit den Landkarten ging zugleich eine ganze Schule von Kartenzeichnern aus dem Homannischen Hause hervor. Ausgezeichnete Mathematiker und Geographen, wie Tobias Mayr und Johann Matthias Haas legten den Grund praktischer und technischer Tüchtigkeit bei Homann. Der Erstere versuchte sich im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts sogar schon mit einem historischen Atlas und einem kleinen Kartenwerk zur biblischen Geographie. Ueberall regt sich wimmelnde Emsigkeit, Bild und Grundplan von Land und Meer recht gemeinnützig zu machen. So werden unter Anderem auch die Reliefkarten, welche man schon im siebzehnten Jahrhundert erwähnt, aber inzwischen wieder vergessen hatte, hundert Jahre später neu ersonnen und praktisch ausgebeutet, und zwar zunächst in dem Lande, welches von Natur das meiste Relief besitzt, in der Schweiz.
Einzelne Züge aus der Lebensgeschichte von Kartenzeichnern der Homann'schen Periode bekunden, wie man die Kunst der Landkarten damals mit einer Begeisterung ergriff, die eben nur in Tagen des jugendlichen Aufschwunges solcher Betriebsamkeit vorzukommen pflegt, und entzündet an der neu erwachten begeisterten Vorliebe aller Gebildeten für das geographische Studium. Es ist als hätten jene Kartenzeichner mitgeahnt, daß sich die Wissenschaft vorerst des Bodens, auf dem wir stehen, versichern müsse, um gegen den Abend des Jahrhunderts die Welt zu bewegen. Wie Homann der äußeren Bestimmung zur Kanzlei und zum Kloster entflieht, damit er der inneren Berufung zu den Landkarten folge, so arbeitete sich Martin Hieronymus Mair vom Zimmermann zum Kartenzeichner, Mathematiker und Landgeometer hinauf. Sein Landsmann, Matthäus Seutter von Augsburg, ein Schüler und nachgehends ein Nebenbuhler Homanns, begann mit der Bierbrauerei; aber auch ihn trieb sein Genius aus dem Brauhause in das Atelier des berühmten Kartenzeichners, und der zum Brauer bestimmte Knabe beschloß sein Leben – gleich seinem Lehrmeister – als kaiserlicher Geograph und geschmückt mit einer kaiserlichen goldenen Gnadenkette.
Die Geographie war durch das ganze achtzehnte Jahrhundert ein Lieblingsstudium der gebildeten Welt. In den Köpfen der Masse begann es licht zu werden, wenigstens in Betreff der größern Erkenntniß der Erdkunde. Die Aufklärung wollte nicht blos in den theologischen Himmel hineinschauen; sie blickte nicht minder neugierig über die Erde hin. Die großen Weltumsegler in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ließen den fünften Welttheil, den die Holländer gefunden, während wir uns im dreißigjährigen Kriege herumschlugen, jetzt erst in vollen und bestimmten Umrissen vor den staunenden Augen Europa's aus dem Meere aufsteigen. Wer damals in den Volkskalendern, in Unterhaltungsbüchern und Jugendschriften recht interessant werden wollte, der führte die Leser – nicht mit Fabeln wie vordem – sondern mit dürrer geographischer Weisheit – auf irgend eine Insel des stillen Oceans; und in einem ABC-Buch aus Großvaters Zeit wird beim O in rührenden Versen geklagt, daß Cook auf »Owaihi« erschlagen worden.
Die »Kinderfreunde« und Fibeln der Nationalisten und Philanthropen predigen von der kulturgeschichtlichen Macht des Homannischcn Atlasses. Das Gewicht der geographischen und Reiselitteratur in der Aufklärungsperiode ist vergleichbar dem Einfluß, mit welchem die Naturwissenschaft jetzt den Geist der Zeit zu beherrschen beginnt. Physik und Chemie klopfen bereits an die Thüren der Frauengemächer und sie werden noch weiter dringen. Wie vor siebenzig Jahren die Reisebeschreibung das Kindermährchen, die Robinsonade Fabeln, Sagen und Legenden in Schule und Haus verdrängte, so wird man in dreißig Jahren physikalische Miniaturapparate als Nürnberger Spielzeug verkaufen und chemische Präparate eigens für Experimente in den Puppenküchen der achtjährigen Kinder herrichten.
Die eigentlichen gelehrten System- und Schulzöpfe schauten vor hundert Jahren die Erdkunde noch ebenso sehr über die Achsel an, wie später ihre Nachfolger die Naturwissenschaften und heute die Volkskunde. Es half aber nichts und wird nichts helfen. In den Encyklopädien ließ man die Erdbeschreibung gar nicht als eine besondere Wissenschaft gelten, man rubricirte sie meist wie einen zufälligen Anhang unter die Geschichte.
Dieser stillen Verachtung gegenüber beurkundet sich aber der allgemeine geographische Heißhunger unserer Groß- und Urgroßväter um so lauter in dem wunderbaren Eifer, womit man sich plötzlich auf die populäre geographische Litteratur warf.
Selbst die allgemeinen Bestimmungen der mathematischen Geographie, die wir nach den Schuljahren wieder vergessen wie unsere Schulfreundschaften, fesselten damals durch den Reiz der Neuheit. Unter den Homannischen Karten findet sich eine Planiglobentafel von 1746, worauf die Erdhalbkugeln eigens für den Standpunkt der Nürnberger gezeichnet sind: der Halbkreis der Erdoberfläche, wie er sich ausnimmt, wenn Nürnberg im Mittelpunkte steht, eine eigene Antipodenkarte von Nürnberg und ein hemisphaerium sphaerae obliquae pro horizonte Norimbergensi. Der Nürnberger ließ sich damals seinen Gulden nicht gereuen, um nicht blos im Wort, sondern auch im Bilde zu erfahren, wo eigentlich die Leute zu finden sind, deren Fußsohlen sich genau der St. Lorenzkirche zukehren und die unter seinen eigenen Fußsohlen umherlaufen, wie die Mücken an der Stubendecke.
Solche chartographische Experimente waren unsern Vorfahren eben so neu und anziehend, wie uns das Verbrennen eines Diamants.
In dem alten »Antiquarius des Rheinstroms« (von 1740) ist noch bei jedem kleinen Neste dessen geographische Länge und Breite nach Graden und Minuten pflichtlich angegeben. Diese Bestimmungen, die schier bis zu den Dörfern hinabgehen, waren großentheils gewiß nur so auf's Ungefähr gegriffen, ein wohlfeiler gelehrter Hokuspokus. Es gehörte aber einmal zur feinen Bildung, daß ein mit der Perücke gekrönter Stadtbürger wisse, unter wie viel Graden longitudinis et latitudinis sein vaterstädtisches Rathaus liege. Von den Gebildeten in Dachau wird es aber heutzutage wohl kein Einziger mehr an den Fingern herzählen können, wie viel Grade und Minuten Dachau von der Insel Ferro und vom Aequator entfernt ist, und von den Gebildeten in München wissen auch nicht mehr Viele die Lage ihrer Stadt auswendig zu bestimmen. Kämen unsere Urgroßväter aus dem Grabe zurück, sie würden das für einen bedeutenden Rückschritt in der geographischen Volksbildung erklären. Die alten holländischen Kartenzeichner überragten unsern Homann in der Feinheit und wissenschaftlichen Genauigkeit ihrer Platten, und bedeutende Kartenwerke, welche um die Mitte des Jahrhunderts in Paris und London erschienen, kamen jenen klassischen Mustern von Amsterdam sehr nahe. Selbst in Rußland that sich die Staatsindustrie der Akademie von St. Petersburg mit glänzenden chartographischen Thaten hervor, und mit den alten Karten der Berliner Akademie kann der Homannische Atlas ebensowenig nm den Preis wissenschaftlicher Gediegenheit ringen. Aber er ist unvergleichlich in der naiven Universalität seines Gesammtinhaltes. Denn er verbreitete nicht nur die geographische Bildung überall hin, sondern er nahm auch die Mittel dazu höchst ungenirt überall her, wo er sie am besten fand. Da nämlich die Homann'sche Offizin nicht bloß Originalkarten lieferte, sondern auch holländische, französische, englische, russische und selbst italienische Blätter bis auf den Punkt nachstach, so bildet der vollständige Homannische Atlas eine Art Encyklopädie der Kartenzeichnung aller Nationen damaliger Zeit. Die Augsburger Kartenverleger waren dann flugs wieder hinter den Homannischen Blättern her und stachen die Nachsuche noch einmal nach. Oder es traf sich wohl auch umgekehrt, daß sich das Nürnberger Haus die Originalplatten aus dem rivalisirenden Augsburg zu Nutzen machte. Denn die Arbeiten von Seutter, Lotter u. A. in Augsburg konnten mit dem Homann'schen Fabrikat wohl in die Schranken treten, aber sie beherrschten nicht durch ihre Masse den Markt gleich jenen.
Wir sehen uns eben hier noch einem Culturzustande gegenüber, wo der mangelhafte Schutz des litterarischen Eigenthums nicht verderblich wirkt, sondern fördernd. Je tiefer die Bildung in's Volk dringt, um so strenger muß jenes Eigenthumsrecht begränzt werden. Hätten wir zu Homanns Zeit internationale Verträge zum Schutz des Landkartenverlags besessen, so würde der deutsche Kartenstich, so plump und fehlerhaft, wie er war, noch lange stehen geblieben sein. Währt dann aber diese Schutzlosigkeit noch fort, wenn Kunst und Handel bereits auf den eigenen Beinen steht, dann wird sie beides eben so sicher zerstören, wie sie es früher fördern half. Darum ist es ganz natürlich, daß der Begriff eines litterarischen Eigenthumsrechtes erst spät und bei hochentwickelter Cultur zur klaren Ausbildung kommt.
Geistliche Fürsten, Grafen, Herren und Städte, deren Gebiet nicht groß genug war, daß der Verleger auf eigenes Wagniß, eine Karte hätte stechen mögen, setzten wohl ein gutes Stück Geld daran, auf daß eine recht große Specialkarte in Folio auch von ihrem Lande in der berühmten Nürnberger Werkstatt entworfen und dem Homannischen Atlas einverleibt werde. Es war das eine Standes- und Ehrenausgabe. Indem der kleine Herr sein kleines Land in gleich großem Format neben den großen Ländern in dem klassischen Atlas prangen sah, hatte er eine Urkunde gestiftet seiner souveränen Herrlichkeit, die wohl im Maß, nicht aber in der Art von jener der großen Herren verschieden war.
Dadurch ist eine Masse der kleinsten Aufnahmen in die Homann'sche Sammlung gekommen, wie sie die ältere Chartographie wohl keiner anderen Nation aufzuweisen hat. Ja wir finden dort Specialkarten von Ländchen und Stadtgebieten, die wir selbst heute höchstens für eine Amts- ober Gemeinderegistratur, nicht aber für die Öffentlichkeit ausarbeiten würden. Nur der deutsche Particularismus machte es möglich, daß sich die alte Landkartenzeichnung so in's Kleinste und Einzelste ergeben konnte. Allein er stiftete damit ein gutes Wert. Unsere Vorfahren wären gewiß nicht so leidenschaftliche Geographen geworden, hätten die Kartenzeichner nicht dem damaligen dreihundertfältigen Lokalpatriotismus so wohl gethan, indem sie jedes Reichsland, das anderthalb Mann zur Reichsarmee zu stellen hatte, so groß und stattlich mitten unter die Weltkarten setzten.
Durch ein seltsames Spiel des Zufalls fehlt in meinem Homannischen Atlas trotz der vielen Specialkarten winziger Reichsländer – eine Karte von Deutschland. Statt ihrer ist eingefügt eine französische Karte de l'Empire d'Allemagne, und zwar, wie die Titelvignette sagt, entworfen zum Handgebrauch des Herzogs von Burgund (1787). Diese Karte ist in der That interessanter, als wenn selbst Tobias Mayr's damals weltberühmtes Blatt von Deutschland die Sammlung zierte. Der Pariser Zeichner hat zur Instruktion des französischen Prinzen ein Großdeutschland an den Westgrenzen herausgezeichnet, wie es allerdings hätte sein sollen, wenn man im deutschen – nicht aber im französischen – Geiste des Reiches Vollbestand gewahrt hätte. Ganz Elsaß, Lothringen und die Schweiz erscheint nämlich hier noch mit einbegriffen in der Haute-Allemagne, Holland in der Basse-Allemagne, gewiß nicht um die Macht Deutschlands, sondern vielmehr dessen Ohnmacht als eines bloßen geographischen Begriffs zu versinnbilden. Zugleich mochte die Ausdehnung des deutschen oberrheinischen Kreises bis an die Quellen der Saone, Marne und Maas an die alte Theorie der Reichsstandschaft Ludwigs XIV. erinnern, der deutscher Reichsstand war, wenn er in unsere Angelegenheiten drein reden, und souveräner König von Frankreich, wenn er drein schlagen wollte.
Die populäre Karte im achtzehnten Jahrhundert sollte über das Allgemeinste belehren, sie sollte ein gezeichnetes Handbuch der Geographie sein: aber sie vermaß sich noch nicht eines wissenschaftlich genauen Bildes der Landesoberfläche. Darum genügt ihr noch eine bloß symbolische Bergzeichnung, wo wir bereits zur bildlichen Schraffirung aufgestiegen sind; bei den Städten und Dörfern dagegen, wo wir jetzt lediglich ein symbolisches Zeichen setzen, versucht sie ihrerseits ein kleines Abbild aus der Vogelperspektive, wobei es nicht darauf ankam, wenn ein Kirchthurm etwa zwei Stunden Wegs weit in's Land hineinragte. Nach dem Muster der großen französischen Kartenwerke fügte man am Rand gern allerlei belehrende Weisheit bei. Wußte man kein besonderes Terrain in die Länder fremder Welttheile einzuzeichnen, so schrieb man eine gedrängte historische Abhandlung auf den weißen Raum der terra incognita, wie dann etwa Hoch-Asien und Inner-Afrika zu solchen Excursen ein treffliches Papier bot. Erst allmählig schwinden diese Schulübungen aus den Kinderjahren der Chartographie – ein Fortschritt, der sich im Verlauf des Homannischen Atlasses sehr anziehend beobachten läßt.
Politisch-statistische Volkskunde konnte man aus seinen Blättern viel besser lernen als wissenschaftliche Landeskunde. Darum ward auch die Specialkarte hier kaum noch als Reisekarte angelegt, während sie jetzt immer ausschließlicher Reisekarte wird. Die Menschen des achtzehnten Jahrhunderts kannten das beneidenswerthe Glück des modernen Fußwanderers noch nicht, nach einer in genauer Terrainschraffirung wissenschaftlich durchgearbeiteten Specialkarte ein fremdes Land sicher zu durchstreifen, ohne jemals einen Bauer um den Weg zu fragen, ja die Eingebornen zu veriren, indem man ihnen zeigt, daß man als Fremder kraft der guten Karte oft ebensoviel und mehr von der Plastik ihres Landes weiß als sie selber, mit einem gewissen Feldherrnbewußtsein am Morgen seine Marschdispositionen selber zu treffen und am Abend wie Cäsar quasi re bene gesta, zur vorbestimmten Stunde pünktlich in's Quartier einzurücken. Der Fußwanderer gewinnt eine solche Specialkarte lieb wie seinen besten Freund: sie räth und hilft ihm in den Zweifeln des Marsches, und in den leeren Stunden einsamer Rast braucht er ihr nur recht genau in das treue Gesicht zu sehen, so belehrt sie ihn über Landes- und Volkskunde oft besser wie ein Professor und repetirt mit ihm theoretisch die praktischen Studien des Tages.
Solche Wanderkarten suchte man freilich auch in den fleißigsten Blättern des Homannischen Atlasses noch nicht; eher verlangte man Forst- und Jagdkarten. Es gibt dergleichen im Homannischen Atlas, wo kaum die Landstraßen angedeutet sind, desto genauer aber die Waldgränzen, ja wohl gar allerlei Notizen über den Wildstand. Das war zur selben Zeit, da Johann Elias Niedinger nur Hirsche, Rehe und Wildschweine zu stechen brauchte, um der populärste deutsche Kupferstecher zu werden. Auch kam es bei einer Specialkarte der kleinen reichsunmittelbaren Territorien weniger darauf an, daß Berge und Flüsse und derlei Nebensachen, als daß alle Galgen des Gebietes genau eingetragen waren. Denn der Galgen auf der Landkarte war das stolze Symbol der eigenen Gerichtsbarkeit, und gerade die kleinen Reichsunmittelbaren ließen sich die seltene Gelegenheit, einen überführten Sünder auf eigenem Gebiet köpfen oder henken zu lassen, am ungernsten entschlüpfen, weil sie hierbei eines der kostbarsten Attribute ihrer souveränen Würde öffentlich beurkunden konnten. Darum war es viel sicherer, in großer Herren Ländern ein Spitzbube zu sein. Reisekarten waren überhaupt noch nicht sehr nöthig in einer Zeit, wo man sich, um als Tourist zu reisen, am sichersten und bequemsten an einen Frachtfuhrmann anschloß. Bei gutem Wetter spazierte der Wanderer mit Muße neben dem Wagen her, und bei schlechtem kroch er in das unter demselben schaukelnde Schiff, wo jetzt allenfalls des Fuhrmanns Spitzhund sein Mittagschläfchen hält.
Wenn auch die alte Karte das Land nicht abbildete, so versinnbildete sie es wenigstens im weitesten Sinne. Darum durfte die Vignette mit den Wappen der regierenden Häuser nicht fehlen und mit den allegorischen Figuren, welche gleichsam eine bildliche Landesstatistik darstellen: dazu mit Städteansichten und Prospekten der merkwürdigsten Gebäude, die wo möglich auf einem von schwebenden und purzelnden Engeln entrollten Tuche an den Rand gezeichnet sind. Ueber diese Gruppen im Homannischen Atlas könnte man ein ganzes Kapitel schreiben: denn in ihnen spiegelt sich die damalige Auffassung von Land und Leuten. Niemals ist das Volk allegorisch dargestellt, sondern immer nur das Regiment des Landes, in Wappen und Wappenhaltern, Kronen und Bischofshüten, dazu dann die Industrie und die Landesprodukte. Das achtzehnte Jahrhundert kannte noch nicht den modernen Begriff der socialen Volkskunde: es faßte und zeichnete bloß die Herrschaft und das Land als eine allegorische Figur, nicht die Leute. Jene dürftigen Allegorien sind hier ein so getreues Bild ihrer Zeit, daß sie uns stolz machen könnten auf die unsrige. Norwegen ist z. B. im Homann'schen Atlas allegorisch dargestellt durch zwei Tritone, deren einer eine Schüssel voll Seekrebse darreicht, während der andere in der Linken das Muschelhorn hält und in der Rechten einen naturgetreuen Stockfisch. Man sieht, unsere modernen Gedankenmaler könnten auch Studien machen im Homannischen Atlas. Die Lausitz präsentirt sich durch einen Merkur, der als Ladendiener ein Stück Tuch abmißt und ausschneidet! Dänemark ist durch feiste Ochsen vertreten, Hessen-Kassel durch eine Schafschur, Italien durch einen Arion, der als Opernkastrat auf den Wogen trillert; die böhmische Industrie ist nur erst durch Fasanen und wilde Schweine angezeigt und die unterösterreichische durch eine Schüssel voll Safran neben einem Fasse Wein. England allein hat eine politische Vignette: das Bild einer Parlamentssitzung.
Nicht wenige dieser Vignetten sind so reich componirt und so groß angelegt, daß sie gut ein Drittheil der ganzen Karte einnehmen, und es scheint, nicht sowohl die geographische Zeichnung als der allegorische Schmuck sei die Hauptsache am Blatt. Dies war auch bei den auf Bestellung gefertigten Karten der kleinen reichsgräflichen, bischöflichen und städtischen Gebiete sicher der Fall; denn sie sollten vielmehr zu Prunk und Schau als zu einem wissenschaftlichen Zwecke dienen. Wie die vornehmen Herren damals gerne ihr Porträt gegenseitig austauschten, so hielten sie es wohl auch mit den pomphaft aufgeputzten Porträten ihrer Territorien, und manche standesherrliche Familie besitzt heute noch ebensowohl eine Sammlung solcher Tauschkarten, wie Tauschporträte die Ahnengallerien unseres Adels erst voll und reich gemacht haben.
Für die Erkenntnis; des künstlerischen Handwerks im achtzehnten Jahrhundert sind diese Vignetten nicht unwichtig. Mochte die magere Zopfzeit auch noch so arm geworden sein an reiner und hoher Kunstübung: im phantastischen und künstlerisch individuellen Schmuck der Erzeugnisse des Handwerks bewahrte sie noch lange das reiche Erbe des üppigen Rococo. Erinnern diese prunkenden, oft von wirklichen Künstlern gezeichneten Vignetten mit einer mittelmäßigen Landkarte neben dran, nicht an jene mit so wunderbarem Fleiß und Geschmack ausgemalten Anfangsbuchstaben mittelaltriger Manuscripte, bei denen oft der erste Buchstabe mehr werth ist als das ganze nachfolgende Buch? Gerade beim künstlerischen Handwerk mag man erkennen, wie unendlich viel Mittelalter noch im Rococo und Zopfe steckt. Mag der Schnörkel sich hier zusammenringeln, den man früher lang hinauszog, mag die Fischblase zur Schnecke, der Spitzbogen zum Halbkreis und das symbolische Heiligenbild zum allegorischen Götterbild geworden sein: die Lust so liebevoll und zugleich so phantasievoll überflüssig zu ornamentiren bleibt doch bis tief in's achtzehnte Jahrhundert, sie bleibt, solange man in Galla den Brustharnisch zur Perücke trägt. Heutzutage haben wir ohne Vergleich bessere Kartenwerke als das Homannische; aber so reich geschmückt mit guten und schlechten, überflüssigen und doch charakteristischen Bildern machen wir längst keine Karten mehr. Denn so naiv zu spielen und zu prunken wie Mittelalter, Renaissance und selbst der Zopf, haben wir ganz gründlich verlernt.
Auf den ältesten nach holländischen Mustern gestochenen Blättern des Homannischen Atlasses ist von Australien nur erst die Westküste nebst einzelnen Punkten der Süd- und Nordspitze mit unsichern Strichen angedeutet: Gestalt und Ausdehnung des fünften Welttheils ist noch ganz unbekannt. In der reichen Inselwelt der Südsee sieht es noch wüst und leer aus. Von Neuseeland ist blos eine kleine Küstenlinie punktirt, und man weiß nicht, ob ein neuer großer Continent oder eine bloße Insel dahinter steckt. Als dagegen die letzten Homannischen Karten erschienen, konnten sie – nach englischen Forschungen und Stichen – die ganze vielgestaltige neue Welt des indischen Oceans und der Südsee als in ihren Hauptumrissen festbestimmt, in ihren zahllosen Inselgruppen wesentlich entdeckt bezeichnen. In diesem ungeheueren Fortschritt der Erdkunde, der sich in der Geschichte eines einzelnen Kartenwerkes darstellt, liegt zugleich die entsprechend riesige Umwandlung des ganzen europäischen Geistes angedeutet, die zwischen Anfang und Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts fällt.
Der größten religiösen Bewegung der neueren Zeit ist die Entdeckung des vierten Welttheiles vorangegangen; der größten politischen und socialen die Entdeckung des fünften.
Wenn sich eine neue physische Welt vor unsern Augen aufthut, dann ist es nicht möglich, daß die alte geistige im alten Geleis bliebe. Nicht die Philosophen, die in sich hineinschauen, bereiten Revolutionen vor, sondern die Männer der Weltbeobachtung, die aus sich herausschauen.
Der große Haufe kümmerte sich doch wohl gar wenig um Rousseau's Phantasien vom Urzustand und den Urrechten der Menschheit. Aber an dem abenteuerlichen Gemisch von neuer Wahrheit und alter Dichtung, das ihm über die »glückseligen Inseln« im stillen Ocean erzählt wurde, spann er die eigenen naturrechtlichen Träume weiter. Während der kleine Bube im ABC-Buch Verse über Cook's Reisen buchstabirte, machte sich der Vater mit dem Gedanken vertraut, daß es noch eine wirklich neue, eine jungfräuliche Welt gebe, wo nicht bloß nackte Menschen wohnen, sondern auch der nackte Mensch, wo Natur und Mensch noch herrlich seien wie am ersten Tag, wo es keinen Staat und keine Regierung gebe, keinen Homannischen Atlas voll Kronen und Bischofsmützen, keine Steuern, Zölle, Zehnten, Frohnden, keine vornehmen und geringen Leute, keine Sklaven und Schergen. Die arkadischen Schäferspiele der höfischen Welt wurden zu einer geographischen Phantasie des Volkes. Die Bewohner der »Freundschaftsinseln« (schon bei dem bloßen Namen rann den damaligen Empfindsamen eine »Zähre der Zärtlichkeit« über die Wangen) zeichnete man in Volkskalendern, als seien sie Kinder Apolls und der Grazien, halb nackt, halb in griechischem Gewand einhergehend, mit Rosenketten spielend, nichts sinnend und thuend als lauter liebes und gutes.
Hinter dem Eiswall des südlichen Polarmeeres aber suchte ein damals noch weit verbreiteter Volksglaube das wirkliche Paradies mit seinem ewig blauen Himmel, den biblischen Wundergarten, wo der Baum der Erkenntniß noch mitten inne stehe, gerade so wie ihn Adam und Eva verlassen.
Wenn man nun von dem seligen Naturleben der Südseeinsulaner phantasirte, dann lag die Frage nahe: warum man denn nicht auch diesseit des großen Wassers statt der dämonischen Cultur, statt der gehaßten Reste mittelalterlicher Gesellschaftszustände solch ein Kinderleben der Gleichheit und Unschuld zurückführen könne?
Das waren Rousseau's Lehrsätze im Volkston. Und während man von den idealen nackten Menschen in der neuesten Welt träumte, brach in der neuen Welt, in Amerika, der Kampf um die Menschenrechte wirklich los. Der Homannische Atlas hatte nicht umsonst Geographie gelehrt und dem Weltbürgerthum gezeigt, wie sein Vaterhaus, die Welt, ungefähr eingerichtet ist. Als die Amerikaner den Hafen von Boston sperrten und den ersten Congreß nach Philadelphia beriefen, war das für den deutschen Philister nicht mehr weit hinten in der Türkei. Er hatte seinen Homann getauft, er wußte recht gut wo Boston und Philadelphia lag. Er war dort so gut zu Hause wie auf den Freundschaftsinseln und vielleicht noch etwas besser als in der Ortsgemarkung seiner Vaterstadt.
Nicht bloß die Gelehrten, auch das Volk war im achtzehnten Jahrhundert aus sich herausgetreten in seiner geographischen Weltanschauung: so trat es schließlich auch aus sich heraus in seiner politischen. Nicht blos durch die Bücher der Encyklopädisten, auch durch die zahllosen Reisebeschreibungen, die der große Haufe heißhungrig verschlang, wenn sie gleich großentheils zäh und trocken waren wie altes Sohlenleder, auch durch den ehrsamen Homannischen Atlas ging der Weg zur Revolution.
Die Landes- und Volkskunde ist die wichtigste Hülfsdisciplin der Staatswissenschaft: in ihrer populären Fassung ist sie aber auch zugleich der mächtigste und ausdauerndste Hebel politischer Agitation. Verwandte man diesen Hebel im achtzehnten Jahrhundert zum Niederreißen, so zeige das neunzehnte, wie herrlich man ihn auch zum Aufbauen gebrauchen kann.
Der Abstand der spätesten Homannischen Karten der Küsten und Inseln des fünften Weltheils von der australischen Karte der Gegenwart ist bereits nicht minder groß geworden als er zwischen jenen frühesten holländischen und den letzten englischen Blättern im Homannischen Atlas selber war. Jetzt werden jene Küsten und Inseln erforscht und colonisirt, wie sie damals entdeckt wurden. Wo im Homann an den australischen Küsten nichts weiter geschrieben steht, als etwa: »hohes unfruchtbares Land,« »niedriges überschwemmtes Land,« »weder Wasser noch Einwohner« u. dgl., da hat jetzt eine neue wimmelnde Welt ihre Pforten geöffnet, und neue Träume spinnt das alte Europa über das Paradies mit den goldenen Bergen, welche man dort entdeckt – nicht bildliche goldene Berge, sondern von wirklichem, gediegenem gelbem Gold. Und wie eine naivere Vergangenheit bei den angeblichen unschuldvollen Urmenschen der Südsee sich neue politische Ideen holte, so gräbt die realistischere Gegenwart neue volkswirthschaftliche Ideen mit den australischen Goldklumpen aus. Die Zukunft aber wird lehren, ob diese goldschimmernden Lehren zusammt den wirklichen australischen Goldstufen nicht das Gold der Kobolde im Mährchen sind, das sich alsbald in glühende Kohlen verwandelt, die das Haus, wo man sie aufgesammelt, in Brand stecken.
Studien in alten Briefstellern.
1854.
Es ist nicht allezeit gewesen wie heute, wo ein gebildeter Mann sich schämt, einen Briefsteller auf sein Bücherbrett zu stellen. Im siebzehnten Jahrhundert noch gehörte mehr Bildung dazu, einen Briefsteller zu lesen, als gegenwärtig einen zu schreiben. Dieser höchst populäre Literaturzweig, dessen Sprößlinge zuletzt Geschwisterkinder mit den Quedlinburger Complimentirbüchern geworden sind, erscheint dermalen wie eine heruntergekommene Sippschaft aus altem, weiland gutem Hause, Selbst in der Geschichte der Buchdruckerkunst wird der Ahnherr der deutschen Briefsteller mit Ehren genannt. Wenige Jahrzehnte nach der Erfindung Guttenbergs druckte der berühmte Meister Anton Sorg in Augsburg bereits den ersten deutschen Briefsteller. Dieses Buch war also ein wahrer Vorder- und Flügelmann in der langen Front der sogenannten gemeinnützigen Bücher, die sich allmählich breit über unser ganzes literarisches Schlachtfeld gepflanzt hat.
In diesen stolzen, gelehrten, alten Briefstellern möge man mit mir eine Weile behaglich blättern, und die gravitätischen Herren und Frauen der alten Zeit werden aus den kleinen Pergamentbänden leibhaftig vor unsern Augen aufsteigen, die bedächtigen frommen Urväter, die noch mit einer gewissen Feierlickkeit Briefe schrieben, kein Datum darunter setzten, außer mit einem: Laus Deo, keine Wechsel ausstellten, außer mit der Schlußformel: »Gottes Schutz eingeschlossen,« die einen Frachtbrief etwa mit den Worten anhuben: »Unter dem Geleit Gottes und des Fuhrmanns N. N. übersende ich beifolgend drei Tonnen Häringe,« die einen Ehevertrag nicht wie ein gerichtliches, sondern wie ein kirchliches Aktenstück begannen, mit der feierlichsten Anrufung: »Im Namen der heiligen und untheilbaren Dreieinigkeit,« und die in einem soliden Briefsteller gar keine Formularien zu Liebesbriefen duldeten, sondern nur zu Hochzeits- und Gevattersbriefen.
Die Briefsteller sind jetzt ein Hausbuch der Ungebildeten, früher im Gegentheil der Gebildeten: sie waren kleine Encyklopädien der Kanzleigelehrsamkeit, summarische Staatsadreßkalender, Musterbücher für die gangbarsten Formularien und Aktenstücke aus dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit, kaufmännische Geschäftshandbücher; ja in unsern ältesten Briefstellern sind sogar die ersten naiven Versuche zu einer gemeinfaßlichen deutschen Grammatik und Rechtschreiblehre für das große Publikum niedergelegt. Solche Bücher wurden dann auch nicht fabrikmäßig gemacht, sondern von gelehrten Leuten, namentlich von Juristen, Notarien und Kanzleibeamten mit sonderlichem Fleiß ausgearbeitet. In unsern Tagen pflegt der Autor eines Briefstellers seinen Namen verschämt zu verschweigen. Vor zweihundert Jahren dagegen durfte auch ein gelehrter Mann noch stolz darauf sein, einen Briefsteller geschrieben zu haben. Ich besitze einen solchen, im Jahre 1663 herausgegeben von dem kaiserlichen Notar Alhard Moller, der sich hinter der Vorrede von seinen Freunden und Brüdern in lateinischen Distichen und deutschen Alexandrinern besingen läßt, für das ruhmreiche Werk, den nachfolgenden Briefsteller geschrieben zu haben. Es gemahnt das an gefeierte Sängerinnen, die nach ächtem Komödiantenbrauch ihre sämmtlichen Lorbeerkränze im Vorzimmer aufhängen. Aber unser kaiserlicher Notar geht noch weiter. Denn nachdem er die sämmtlichen Lobgedichte seiner Freunde im Vorzimmer des Buches aufgehangen, singt er selber auch noch in lateinischen Versen Ad Librum seinen eigenen Briefsteller an, und dann erst öffnet er uns die Thüre, die zunächst zu der Untersuchung über den »Begriff einer Epistel« führt.
Im siebzehnten Jahrhundert mußte ein Briefsteller mit griechischen und lateinischen Citaten fett gespickt seyn, wie ja damals auch die schlichteste Predigt solcher Ornamentik nicht entbehren durfte, und wenn sie auch vor einer Bauerngemeinde gehalten wurde. Den meisten Menschen sind überhaupt die Dinge am erbaulichsten, die sie nicht verstehen. Auch that der Handwerker damals immer wichtiger mit den Zunftgeheimnissen, je mehr Zunft und Handwerk verfiel: das lateinische Citat aber war das Zunftgeheimniß des gelehrten Handwerks.
Je unfruchtbarer die Gelehrsamkeit geworden war, um so mehr citirte und classisicirte sie. Weil man die lebendige Fülle der wissenschaftlichen Gestalten nicht mehr zu fassen vermochte, suchte man von denselben möglichst sauber das Skelett herauszuschälen. Wer ein jeglich Ding in die meisten Arten und Unterarten zerfällte, der hatte den Preis der Gelahrtheit. So soll nach den Briefstellern des siebzehnten Jahrhunderts ein einfacher, aber ächter und gerechter Brief aus zwölf Theilen bestehen, als salutatio, exordium, narratio, confirmatio, petitio etc.; der letzte »Theil« ist sigilli impressio. Diese zwölf Theile werden dann wieder dreifach gruppirt als »wesentliche,« »mitfolgend-nothwendige« und »willkürlich-beliebige.« Die Gliederung der Briefarten selbst aber spaltet sich vollends ins Unendliche. Am ergötzlichsten wird dieser maßlose Formalismus der Zopfzeit in einer besonderen Gattung von Briefen, die man »Grußbriefe« nannte. Dies waren nämlich solche Briefe, die man ohne einen bestimmten Stoff des Schreibens blos wechselte um sie zu wechseln, eine Correspondenz um der Correspondenz willen. Die alten Briefsteller geben nicht nur reichliche Anleitung zu derlei Briefen, sondern sie zweigen auch hier wieder Unterarten ab, und lehren z. B. wie Einer, der auf einen Grußbrief, welcher nichts enthielt, keine Antwort bekommen hat, einen zweiten Grußbrief abfassen solle, der nun einen Inhalt gewinnt, indem er das Bedauern ausspricht, daß auf den ersten inhaltlosen Brief eine Antwort nicht erfolgt sei. Es wird dann wieder unterschieden zwischen Grußbriefen im bürgerlichen Ton und im Hofton, von denen namentlich letztere eine wahre Fundgrube sind für das Studium der grammatischen und logischen Sinnlosigkeit und des rhetorischen Ungeschmacks jener traurigen Zeit. Ich will zur Probe einen solchen Grußbrief mittheilen, und zwar den kleinsten, den ich finde und der »zufolge jetzt üblichem Hof- stylo eingerichtet« und ganz besonders kurz und dumm ist: »Groß geneigt-sehr-werther Herr! Alldieweilen eine herztreugemeinte Freundschaft erfordert, einen liebwerthen Herrn dann und wann schriftlich heimzusuchen, so habe zu Bezeugung dienstschuldigster Aufwärtigkeit mich kraft dieses verschreiben wollen, daß meines Herrn Gebieten mein Erbieten sein und verbleiben solle, inmaßen ich lebenslangwierig verbleibe – meines Herrn treu- und dienstwilliger Knecht N. N.«
Solche Grußbriefe schreiben wir nun zwar nicht mehr, aber wir machen noch eben so inhaltlose Grußbesuche »zufolge jetzt üblichem Hof- stylo,« und haben darum kein sonderliches Recht, uns über die Briefschreiberei der Vorfahren lustig zu machen.
Einen Hauptbestandtheil der alten Briefsteller bildet das sogenannte »Titularbuch.« Im späteren Mittelalter noch hatten die Titel und Höflichkeitsprädikate auf einer natürlichen und principiellen Grundlage geruht, als Zeichen des Berufes und Standes; im siebzehnten Jahrhundert dagegen waren sie bloß Zeichen eines bald wirklichen, bald nur angeschmeichelten Ranges geworden, und eben dadurch ein willkürliches Formelwesen, Dennoch sprach man gerade in dieser Zeit, wo der Titel seine sociale Währung und eben damit seinen vernünftigen Sinn verloren hatte, von einer »Titelwissenschaft,« und ein damaliger Autor classificirte dieselbe sofort als die »vornehmste unter den Wissenschaften zweiten Ranges.« Wo man aber einer eigenen »Titelwissenschaft« bedarf, da müssen die natürlichen Gliederungen der Gesellschaft bereits zerstört sein: denn in einer gefunden und lebenskräftig gegliederten bürgerlichen Gesellschaft muß alles, was über den Titel wissenschaftliches zu sagen wäre, in der Lehre von Stand und Beruf zu suchen sein. Je mehr sich daher in der neueren Zeit eine neue und bessere sociale Gliederung zu entwickeln beginnt, um so lächerlicher ist auch der bloße Gedanke an eine »Titelwissenschaft« geworden. Was Jeder ist, das soll er auch heißen: dies muß die Summe aller Titelwissenschaft werden.
»Wohlgeboren« war im Mittelalter ein Prädicat des Adels gewesen; gleichbedeutend mit freigeboren war es mehr als eine Höflichkeitsphrase, es hatte einen socialen und staatsrechtlichen Sinn. Als man später »Hochwohlgeboren« daraus machte, weil der inzwischen social emancipirte Bürgerstand sich mit gutem Grund nun gleichfalls wohlgeboren nannte, war ein in seiner sprachlichen Zusammensetzung sinnloser Rangtitel aus dem alten Standesprädicat geworden. Im achtzehnten Jahrhundert trieb man nun gar mit Hülfe der »Titelwissenschaft« die logische Confusion so weit, daß man das ursprünglich dem »Wohlgeboren« gleichbedeutende »Edelgeboren« den ganz geringen Bürgern und Proletariern zuwies, die nicht vornehm genug erschienen, daß man sie noch wohlgeboren hätte nennen mögen!
Noch im vierzehnten Jahrhundert hatten Grafen und Fürsten die Worte »Ehrsam« oder »Ehrbar« als vornehmen Standestitel geführt. Schon nach zweihundert Jahren war derselbe zum untersten Rangtitel, zum Titel der Bauern herabgesunken, der sich z. B. in Altbayern bis auf diesen Tag erhalten hat, indem die Bauern ihren Verstorbenen auf den Grabkreuzen das Prädicat »Ehrsam« oder »Ehrengeachtet« beizulegen pflegen. Unter diesem »Ehrsam« war aber ursprünglich keineswegs die sittliche Achtbarkeit gemeint, sondern es galt dem adeligen, zu ritterlichen Ehren geborenen Mann. In diesem Sinne finde ich in einem Briefsteller des siebzehnten Jahrhunderts die ganz treffende Bemerkung: daß der Bauer, indem man ihn »ehrbar« nenne, nunmehr »zu einem unschuldigen Edelmann gemacht worden sei.«
Wie die gesellschaftlichen Neubildungen, welche aus der zertrümmerten Welt des Mittelalters aufwuchsen, durch viele Menschenalter noch schwankend und wandelnd waren, so ging es auch mit der an dieselben sich anrankenden Schmarotzerpflanze des Titelwesens. Selbst nach dem dreißigjährigen Krieg noch klagte man, daß in den letztverflossenen Zeiten fast je alle zwanzig Jahre neue Titel aufgekommen seien. Erst gegen das Ende des siebzehnten Jahrhunderts festigten sich die neuen Rangtitel und blieben im wesentlichen bis zur französischen Revolution. Die meisten altadeligen Häuser waren binnen kurzer Frist zum Reichsfreiherrn- und Reichsgrafentitel gekommen, Grafen waren Fürsten geworden; der »Jungherr« war zum Prinzen avancirt und alle Söhne des Adels zu Junkern; jeder Edelmann hieß nun »gestreng,« während vordem nur gestreng geheißen, wer auch wirklich gestreng sein, d. h. in eigener Gerichtsherrlichkeit seinen eigenen Galgen aufpflanzen konnte.
Dieses große Avancement im Titel ging hinauf bis zum Kaiser: denn erst durch den Vorgang Karls V. ward es allgemein, Kaiser und Könige, die sich bis dahin meist mit »Hoheit« und »Gnaden« begnügt hatten, »Majestäten« zu nennen. Natürlich. Die großen Münzen waren im Curs gefallen; nun mußte man neue prägen, um hohe Werthe auszudrücken. Es ist aber äußerst komisch, daß nun Alle wähnten, vornehmer geworden zu sein, in der That aber waren sie Alle im alten Range verblieben; denn der Rang des Einzelnen ist ja immer nur etwas Relatives, er mißt sich an dem Range der Anderen, und wenn Alle gleichmäßig vorrücken, so bleibt Jeder in der Kette des Ganzen doch eigentlich wieder auf demselben Fleck. Keine Periode ist so reich an komischen Selbsttäuschungen wie die Uebergangsjahrhunderte vom Mittelalter zur modernen Zeit. Es beruht darin eine der reichsten Quellen jener Selbstironie von Rococo und Zopf, wie sie so viele humoristische Dichter und Maler geahnt haben, indem sie ihren Stoff mit Vorliebe aus den Tagen der Puderköpfe nehmen. Ein alter Briefsteller kann uns die Ahnung dieser Selbstironie zum klaren Bewußtsein erheben.
Zu früh hatte man schon im siebzehnten Jahrhundert das baldige Ende des Titelwesens prophezeit, und vergeblich die Geißel der Satire über demselben geschwungen. Zu früh hatte man selbst in den radicalen Tagen der französischen Revolution gejubelt. Jeglicher spottet über die Titelnarren und doch trägt Jeder auch heute noch immer ein ganz gehöriges Stück von dieser Narrheit in sich.
Im siebzehnten Jahrhundert war man systemastischer, haarspaltender mit den Titeln verfahren, die Subtilität, mit welcher man sie nach Arten und Unterarten abstufte, erreichte ihren Gipfel. Dagegen nahm man in der folgenden Zeit den Mund noch weit voller mit großtönenden Prädicaten; was quantitativ vereinfacht worden war, wurde qualitativ mit Zinsen wieder eingebracht. Rococozeit und Zopfzeit verwechselten hier ihre Rollen. Denn die erstere hatte ihre Freude am Classificiren der Titel, die letztere an deren willkürlich phantastischer Verschnörkelung. Im siebzehnten Jahrhundert z.B. hütete man sich sehr, einem Doctor der Philosophie oder Medicin denselben Titel zu geben, wie einem Doctor der Rechte. Dieser war Wohledelgeboren, die andern dagegen nur Edelgeboren. Es deutet das zurück auf den alten höhern Rang der Juristen, die schon im fünfzehnten Jahrhundert das Vorrecht erhielten, Wappen und Siegel zu führen, welches sonst nur dem erblichen Adel zugestanden hatte. Selbst bei den Studenten war ein Unterschied zwischen angehenden und älteren im Titel gesetzt. Ein Fuchs wurde blos »Ehrenvester und Gelehrter« angeredet, ein altes Haus dagegen »Ehrenvester, Vorachtbarer und Wohlgelehrter.« Ganz titellos waren nur die Juden. »Als Christi Erz- und Herzfeinde« sollte man sie – wunderlich genug – höchstens »mein Freund« anreden. Das Prädikat des höchsten Vertrauens galt für ein halbes Schimpfwort, lediglich weil es kein Titel war. Den Bauersmann redete man mit hoffärtiger Herablassung schon etwas klangreicher als »ehrbarer, lieber und guter Freund« an.
Solche subtile Unterschiede schwanden allmählich im folgenden Jahrhundert, die Titel wurden aber im allgemeinen noch weit vollwichtiger. Im siebzehnten Jahrhundert war der Dorfpfarrer noch »Ehrwürden,« im achtzehnten ward er »Hochehrwürden;« der hochwohlgeborene Graf ward hochgeboren, der hochgeborene Erlaucht. Ja unsere Zeit, die sich so bequem lustig macht über das Titel- und Ceremonienwesen der alten Zeit, hat hier in vielen Stücken erst recht den Gipfel der Devotion und Schmeichelei erstiegen. Der Briefsteller des siebzehnten Jahrhunderts schreibt noch vor, daß man in Sendschreiben an Kaiser und Könige »zur Bezeugung unterthäniger Demuth und demüthiger Unterthänigkeit« zwei Daumen breit Raum lasse zwischen der Anrede und dem Anfang des Briefs, bei hohen Staatsbeamten nur anderthalb Finger breit. Heutzutage würde sich aber ein hoher Staatsbeamter sehr beleidigt fühlen, wenn man ihm keinen größern Respectsraum als den weiland kaiserlichen von nur zwei Daumen Breite gönnte.
Vor mehr als fünfzig Jahren schrieb Herder: »Im geselligen Umgange sogar ist Jemanden bei seinem Namen zu nennen Schimpf; Titel und Würden bei Männern und Weibern dürfen allein genannt werden: dem Ohr wie dem Auge wollen wir nur in der Livrei erscheinen. Wie leicht haben sich andere Nationen dies alte Joch gemacht oder es gar abgeworfen: der Deutsche trägt's geduldig.« Er trägt es auch heute noch. Ja nicht nur von Andern bei unserm bloßen ehrlichen Namen titellos angeredet zu werden, dünkt uns eine halbe Beleidigung: wir schämen uns sogar unsern eigenen Namen ohne Titel selber auszusprechen; es wird uns dabei zu Muthe, als ob wir uns nackt sähen, und wenn wir uns bei dem besten Freunde melden lassen, so halten wir angesichts des meldenden Hausknechtes verschämt das Feigenblatt des Titels vor.
Doch zurück zu meinen alten Briefstellern.
In der Zeit da sich Deutschland politisch, social und literarisch am tiefsten unter französischem Einfluß beugte, blühten in Frankreich – wie in Italien und England – classische Muster eines feinen, wohlgeglätteten Briefstyls. Allein bei allem Hang zur Ausländerei ahmte man das Ausland nur in diesem lobenswerthen Punkte nicht nach. Unsere Philologen schrieben damals die zierlichsten lateinischen Briefe, aber deutsche Briefe konnten die Deutschen des siebzehnten Jahrhunderts durchaus nicht schreiben. Man ist wohl in keinem andern Literaturzweig zu selbiger Zeit plumper und unbehülflicher gewesen. Die Schnörkel der Etikette umstrickten und erstickten als wucherndes Schlingkraut jeden Versuch eines gesunden und einfachen Briefstyls. Es ist sehr bedeutsam, daß wir während der ganzen Rococozeit keinen ordentlichen Brief schreiben lernten. Die Deutschen fanden sich am schwersten in die damaligen neuen Formen des gesellschaftlichen und geselligen Lebens, und sind später am leichtesten wieder herausgekommen. Die deutschen Familienbriefe aus dem Zeitalter Ludwigs XIV. sind ein oft wahrhaft rührendes Zeugniß dafür wie hart es uns ankam, den französischen Ton in das Heiligthum des bürgerlichen Hauses aufzunehmen. Trotz allen Modephrasen spricht aus ihnen der Geist des patriarchalischen Hausregiments. Mann und Frau behandelten sich in ihren Briefen noch mit einer altväterlich treuherzigen Etikette, gleich als sei ihre eheliche Stellung mit einer öffentlichen Würde umgeben. In jenen Tagen, wo die eheliche Treue ziemlich rar zu werden begann, war es wenigstens in den deutschen Briefen noch der Brauch, daß der Mann ein Schreiben an seine »hochgeliebte Hausehre« mit den Worten begann: »Eheliche Lieb und Treu zuvor.« Die Frau redete ihren Mann noch an als ihren »vielwerthen Eheherrn,« und die Kinder wagten es nicht, im brieflichen Verkehr ihre Eltern anders als »Herr Vater« und »Frau Mutter« zu nennen. Es waren das Ueberlieferungen einer früheren Zeit, die bis tief in's achtzehnte Jahrhundert hinein ragen. Die Welt der Familie blieb in Deutschland noch lange die alte, als die sociale Welt schon längst eine neue geworden war. Dem feierlichen Ton im Familienverkehr suchte man dann andererseits wieder durch die übertriebensten Zärtlichkeitsworte eine herzlichere Farbe zu geben. Die Meisten würden sich heutzutage schämen, ihre Braut mit so süßen Liebesausdrücken zu überhäufen, wie sie vor zweihundert Jahren der würdevolle Eheherr gleichsam officiell an seine Frau schreiben mußte. Welch wunderliche Mischung von Förmlichkeit und verrücktem Schwulst kam aber dann erst in dem damaligen Briefe eines Bräutigams an die Braut zu Tage, der – laut dem Briefsteller – etwa die Anrede führte: »Hochedelgeborene, großehrenreiche Jungfrau, schönste und hochtugendseligste Nymphe.« – (Man sieht übrigens, diese Anrede hat kein Ausrufezeichen, ist also doch wieder in einem etwas trockeneren Tone gedacht, als wir es jetzt bei Briefüberschriften zu halten pflegen. Das geschriebene Pathos der vielen, wohl gar doppelten und dreifachen, Frage- und Ausrufezeichen ist ein Erbtheil aus dem litterarisch so aufgeregten achtzehnten, nicht aus dem trocken schwülstigen siebzehnten Jahrhundert.)
Nur die Männer der kosmopolitischen, social ausgleichenden Geldmacht, die Kaufleute, wagten es mitten in der Perücken- und Zopfzeit, sich aller müßigen Titel und Prädikate in ihren Geschäftsbriefen zu enthalten. Sie copirten zuerst den italienischen, dann den holländischen und englischen Briefsteller mit wahrhaft barbarischer Treue. So zeichnete sich der Brief des deutschen Kaufmanns sehr frühe schon durch jene gedrungene Kürze aus, die häufig durch Fremdwörter und allerlei technische Barbarismen erkauft werden muß, und ist sich während der letzten drei Jahrhunderte merkwürdig gleich geblieben. Selbst mancherlei willkürliche Formeln sind hier sehr alten Ursprungs. Es galt z.B. schon vor 250 Jahren die heute noch nicht ganz erloschene Regel, daß man in kaufmännischen Briefen das Datum an den Anfang, in Höflichkeitsbriefen aber an den Schluß des Schreibens setzen solle. Auch die Unsitte, deutsche und in Deutschland laufende Briefe aus Renommage mit französischen Adressen zu versehen, wird schon vor zweihundert Jahren gerügt. Doch soll sie damals vorzugsweise bei Kaufleuten und Gelehrten im Schwange gewesen sein, während sie heutzutage in der Regel nur noch von Frauenzimmern geübt zu werden pflegt.
Der nach dem dreißigjährigen Krieg erwachte Eifer für Sprachreinigung klingt selbst in den damaligen Briefstellern durch. In solchen Werken des litterarischen Handwerks zeigen sich aber die Tendenzen der Zeit in der Regel weit mehr in ihrer ganzen Naivetät, d.h. auch in ihrer ganzen Schwäche, als in den höheren Erzeugnissen der schriftstellerischen Kunst. Ein durchaus puristischer Briefsteller, welcher mir vorliegt, enthüllt gerade den steifen schulmeisterlichen Zopf der damaligen Sprachreiniger anschaulicher, als es sämmtliche Acten von Zesen's »deutschgesinnter Genossenschaft« zuwege bringen könnten. Während der Geist der Sprache so undeutsch wie nur möglich ist, wird fortwährend über den Glanz der »Haupt- und Heldensprache des auf diesem großen Fußschemel Gottes wallenden Japhetischen Geschlechtes der hochedlen Deutschen« declamirt. Selbst die directe Fehde wider die Gegner der deutschgesinnten Genossenschaft, die höchst zierlich bezeichnet werden als »ihr selbstes Herz abnagende Schlangenköpfe,« spielt sich bis in den Briefsteller hinab. Gegenüber diesem gereinigten Deutsch kommt es einem freilich vor als ob die mit Fremdwörtern ganz durchspickte, aber doch bündige und verständige Sprache der kaufmännischen Briefmuster erst das eigentliche reine Deutsch sei. Man sieht ein, wie nothwendig die Verwälschung der deutschen Sprache war, damit sie aus diesem Schlammbad nicht blos rein, sondern auch gekräftigt wieder hervorgehe. So mußte die deutsche Musik des achtzehnten Jahrhunderts ihren Durchgang durch die italienische nehmen, auf daß sie nicht vor der Zeit steif und verknöchert würde im contrapunktischen Scholasticismus.
Beim Anblick der schwindelerregend unerschöpflichen modernen Bücherproduction mag uns wohl der Gedanke beschleichen, als sei das doch noch eine idyllische, eine wahrhaft arkadische Zeit gewesen, wo ein Briefsteller noch eine Encyklopädie von einem halben Dutzend Wissenschaften war, wo Marpergers »allzeit fertiger Handelscorrespondent« im Vorbeigehen die ganze Nationalökonomie, Finanz- und Handelswissenschaft als Zugabe zu den Briefformularien tractirte, wo man den König David noch als ältesten Classiker des Briefstyls hinstellte, weil er den Uriasbrief geschrieben, und dann eine Geschichte der Epistolographie von David bis auf die Gegenwart noch auf zwei bis drei Octavseiten abzuhandeln pflegte. Die gemeinnützige Litteratur der Haus- und Handbücher, die jetzt eine so ungeheure Ausdehnung gewonnen hat, war zu unserer Urgroßväter Zeiten in drei bis vier Bücher keimartig zusammengedrängt. Aus dem Kalender brachen die Lokalzeitungen hervor zusammt dem Heer der tagesgeschichtlichen Flugschriften; aus dem Briefsteller stiegen Geschäftshandbücher aller Art auf, Staatskalender und genealogische Taschenbücher, Sprachlehren und Encyklopädien, und nur als Hefe blieb der moderne Briefsteller zurück. Wo jetzt der Mann des gebildeten Mittelstandes eine bändereiche »Weltgeschichte für's deutsche Volk« in seiner Hausbibliothek aufstellt, da begnügte sich der Urahn mit der einzigen Acerra philologica, dem merkwürdigen Schatzkästlein »nützlicher, lustiger und denkwürdiger Historien,« welches noch in Goethe's Jugenderinnerungen eine Rolle spielt, und fast durch ein Jahrhundert als eines der gelesensten Hausbücher vorgehalten hat. Wo gegenwärtig hundert gemeinnützige Schriften erscheinen, da erschien vordem kaum eine, ward aber bei gutem Glück hundert Jahre gangbar, während von jenen hundert Büchern ein Theil nur wenige Jahre geht, die andere Hälfte aber überhaupt niemals gehen lernt. Trotz dem schützenden Privilegium kaiserlicher Majestät griffen auch die Nachdrucker fleißig zu bei den alten Hausbüchern. Der mangelnde Rechtsschutz förderte die Concentrirung dieser Litteratur. Schon Luther mußte wider den Nachdruck seiner Schriften eifern. Der Verleger der Acerra philologica, stellt den Teufel als Executor der gerechten Strafe des Nachdrucks unmittelbar hinter das kaiserliche Privilegium, gleichsam als einen Succurs für die in der Execution säumigen Juristen, indem er die Vision Philanders von Sittewald aushebt, der in der Hölle einem Buchdrucker begegnet, welchem ein nachgedrucktes Buch feuerglühend im Halse steckt, daran er fort und fort in alle Ewigkeit würgen muß, und kann es niemals hinunterschlucken.
Als die Hausbücher noch so compact waren, daß der Briefsteller allein eine ganze Encyklopädie von allerlei Wissenschaften darbot, waren auch die Persönlichkeiten compacter als gegenwärtig. Sie lebten sich ein in ihre wenigen, oft sehr naiven und rohen Bücher, behielten dabei aber auch Sammlung, sich in sich selber einzuleben. So hängt ein Stück des eigentlichen Seelenlebens vergangener Geschlechter an jenen für sich vielleicht ganz bedeutungslosen alten Scharteken, und nicht ohne Rührung, ja nicht ohne Ehrfurcht kann man manche dieser Noth-Hülfsbücher betrachten, aus denen unsere Vorfahren manchmal durch hundert Jahre sich den bescheidenen Schatz ihrer Kenntnisse sammelten, um sich dann im Vertrauen auf Gott und ihren Mutterwitz im praktischen Leben oft weiter zu bringen, als wir mit unserer bändereichen Gelehrsamkeit.
Volkskalender im achtzehnten Jahrhundert.
1852.
Volkslitteratur ist heutigen Tages eine vornehme Liebhaberei geworden, und der Kalendermacher ist nicht mehr sprüchwörtlich der letzte unter den Bücherschreibern: litterarische Aristokraten schreiben Kalender, und Volksbildungsvereine von reichen Leuten geben Kalender für die Armen heraus. Vor hundert Jahren war es anders, und unsere heutigen Kalender dürfen nicht ahnenstolz sein auf ihre löschpapiernen Vorfahren. Dafür sind aber die letzteren doch wenigstens in ihrer Wirksamkeit wahre Volkskalender gewesen und getreue Spiegel der damaligen Volksbildung und Volkssitte. Die meisten der heutigen Volkskalender zeigen, was die gebildete Welt aus dem Volk machen möchte, die alten, was das Volk damals wirklich war.
Das deutsche Volkskalenderwesen des achtzehnten Jahrhunderts theilt sich, entsprechend dem letzten Satze, in zwei Perioden. Die erste reicht beiläufig bis zu den achtziger Jahren. Bis dahin war der Kalender in der Regel ein historisches Volksbuch, welches in seinen Monatstafeln die Geschicke des künftigen Jahres prophezeite, in dem gegenüberstehenden fortlaufenden Texte aber einen Geschichtsabriß des vorigen Jahres gab. Auf dem Standpunkte der bildungslosen Masse selber stehend, befriedigte also der Kalender wesentlich deren Aberglauben und Neugierde. Mit den achtziger Jahren aber bringt die Tendenz der Aufklärung und Volksbelehrung einen merklichen Umschwung in diese Kalenderlitteratur. Statt der zeitgeschichtlichen Berichte sind jetzt die Blätter mit moralischen Anekdoten und nützlichen Belehrungen, statt der astronomischen Zeichen und Verse, statt der Wetterregeln und »Erwählungen« mit altklugen, gemachten Sittensprüchen erfüllt, und während die Tafel des Aderlaßmännleins bis dahin den Kalender beschloß, beschließt ihn nun das große Einmaleins und die Zinstabelle. Der Kalendermacher hatte vordem mitten im Volk gestanden als ein Herold seines Aberglaubens, als sein Prophet, als sein Hof- und Leibhistoriograph. Jetzt tritt er vor und über das Volk und wird sein gestempelter und privilegirter litterarischer Schulmeister. Früher hatten wir darum nur Eine Art des Volkskalenders, entsprechend der in den großen Zügen gleichartigen Physiognomie der bildungslosen Masse; jetzt haben wir deren unzählige, denn jeder Litterat will nach seiner Individualität diese Masse bilden.
Die volksbildenden Kalender, wie sie gegen Ende des vorigen Jahrhunderts aufkamen, schufen allmählig einen Ablagerungsplatz für einen ungeheuren Lehr- und Agitationsapparat, den wir jetzt kaum mehr an den Mann zu bringen wüßten, wenn uns plötzlich die Kalender ausgingen. Aber erst als man die Bedeutung der in jeder Volksgruppe ruhenden politischen und socialen Macht zu ahnen begann, konnte man es der Mühe werth halten, durch Kalender auf sonst literarisch unzugängliche Kreise zu wirken. Was lag der ächten Rococo- und Zopfzeit daran, ob dem gemeinen Mann auch noch außerhalb der Kirche und Schule Bildungsstoffe zugeführt würden! er war ja nur eine ruhende Potenz, die man darum getrost auf sich beruhen und für sich selber sorgen ließ. Die gänzliche Umgestaltung der Volkskalender seit länger als einem halben Jahrhundert ist ein Siegeszeichen der socialen Politik. Wir haben jetzt Volkskalender der politischen Parteien, mehr noch der kirchlichen; die Regierungen lassen Kalender schreiben, weil sie wissen, daß sie mit ihren officiellen Zeitungen niemals bis zu den Bauern durchdringen können, und die Opposition säumt dann auch nicht, ihrerseits mit Kalendern in's Feld zu rücken. Nationalistische und orthodoxe Kalender werben um Land und Leute; protestantische Traktatengesellschaften lassen aus ihren Traktätchen Volkskalender zusammenstellen, und katholische Kleriker streiten in Kalendern »für Zeit und Ewigkeit« mit dem Eifer und der Derbheit mittelalterlicher Predigermönche für ihren Kirchenglauben. Man schreibt Bauernkalender, die niemals ein Bauer liest, um Dorfgeschichten zu ediren, und illustrirte Kalender, welche Pfennigmagazin und Conversationslexikon zugleich ersetzen sollen; dazu landwirthschaftliche Kalender, statistische Geschäftskalender, Jugendkalender und Gott weiß was sonst noch. Die Geschichte aller dieser Kalender bildet eine wesentliche Ergänzung zur Geschichte der Journalistik.
Ich bin so glücklich, in mehreren starken Quartbänden eine Sammlung der verschiedenartigsten, in Nürnberg, Frankfurt, Straßburg, Berlin und Wien erschienenen Volkskalender zu besitzen, die irgend ein Kuriositätenliebhaber, vermuthlich in den neunziger Jahren, aus fast allen Jahrzehnten seines Jahrhunderts zusammengetragen hat. Da mein Sammler auch die schlechteste Scharteke nicht verwarf, so bot sich mir hier ein Material, wie man es wohl schwerlich auf einer Bibliothek oder bei einem Antiquar wiederfinden wird, und indem ich seit meinen Jugendjahren mich häufig an der Betrachtung der barbarischen Holzschnitte und der Lektüre des wunderlichen Textes ergötzte und später noch vergleichende Studien anderswoher hinzuzufügen suchte, ward es mir in diesem wenig betretenen Grenzwinkel der Litteratur fast so heimisch, wie es Einem bei öfterem Fußwandern selbst in einer Wüstenei werden kann.
Die alten Kalendermacher waren unstreitig meist die Hefe der damaligen schreibenden Welt, und das will viel sagen; sie waren aber doch so einflußreich wie unsere besten heutigen Volksschriftsteller. Noch in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts war der Kalendermacher eine geheimnißvolle, magische Person, ein halber Hexenmeister. Ja man kann sagen, diese Leute, die in ihrer Mehrheit eine Körperschaft von miserablem literarischem Gesindel bildeten, sind die letzten »Seher« des deutschen Volkes gewesen. Darum sagt der Bauer heute noch, wenn Einer träumend und sinnend dreinschaut, man meint »er mache Kalender.«
Als der poesiereiche uralte Volksaberglaube von der nüchternen gebildeten Welt des achtzehnten Jahrhunderts nicht mehr recht verdaut wurde und in dem gelehrten Bücherwesen nirgends mehr eine Freistatt fand, da verbarg er sich zu allerletzt noch in den grauen Löschpapierblättern der Volkskalender.