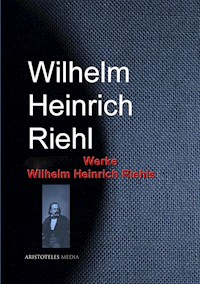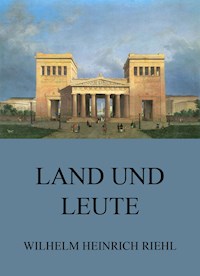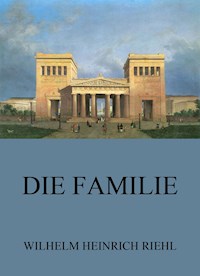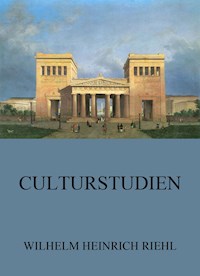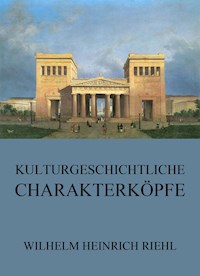Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dies ist Band 2 der berühmten "Naturgeschichte des deutschen Volkes als Grundlage einer deutschen Socialpolitik", die Riehl ca. Mitte des 19. Jahrhunderts verfasste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die bürgerliche Gesellschaft
Wilhelm Heinrich Riehl
Inhalt:
Wilhelm Heinrich Riehl – Biografie und Bibliografie
Die bürgerliche Gesellschaft
Vorwort.
Vorwort zur dritten Auflage.
Einleitung.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Erstes Buch – Die Mächte des Beharrens.
I. Die Bauern
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel
II. Die Aristokratie.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Zweites Buch – Die Mächte der Bewegung.
I. Das Bürgerthum
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel.
II. Der vierte Stand
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Die bürgerliche Gesellschaft, W. H. Riehl
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849633943
www.jazzybee-verlag.de
Wilhelm Heinrich Riehl – Biografie und Bibliografie
Namhafter kulturhistorischer Schriftsteller, geb. 6. Mai 1823 in Biebrich a. Rh., gest. 16. Nov. 1897 in München, studierte in Marburg, Tübingen, Bonn und Gießen, redigierte seit 1846 mit Giehne die »Karlsruher Zeitung«, begründete dann mit Christ den »Badischen Landtagsboten« und gab, nachdem er zum Mitgliede der deutschen Nationalversammlung gewählt worden, 1848 bis 1851 die konservative »Nassauische allgemeine Zeitung« heraus, während er zugleich mit der musikalischen Leitung des Hoftheaters in Wiesbaden betraut war. Nachdem er 1851–53 bei der Redaktion der Augsburger Allgemeinen Zeitung tätig gewesen, folgte er 1854 einem Ruf als Professor der Staats- und Kameralwissenschaften nach München, wo er 1859 die Professur der Literaturgeschichte übernahm und 1862 Mitglied der Akademie der Wissenschaften ward. 1885 wurde er zum Direktor des bayrischen Nationalmuseums ernannt. Er schrieb: »Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik«, in 4 Bänden: Band 1: »Land und Leute« (Stuttg. 1853, 10. Aufl. 1899), Band 2: »Die bürgerliche Gesellschaft« (1851, 9. Aufl. 1897), Band 3: »Die Familie« (1855, 12. Aufl. 1904; Band 1–3 auch in Schulausgaben von Th. Matthias, Stuttg. 1895 bis 1896), Band 4: »Wanderbuch« (1869, 4. Aufl. 1903); »Die Pfälzer« (das. 1857, 2. Aufl. 1858); »Kulturstudien aus drei Jahrhunderten« (das. 1859, 6. Aufl. 1903); »Die deutsche Arbeit« (das. 1861, 3. Aufl. 1884); »Musikalische Charakterköpfe« (das. 1853–77, 3 Bde.; Band 1 u. 2 in 8. u. 7. Aufl. 1899); »Kulturgeschichtliche Novellen« (das. 1856, 5. Aufl. 1902); »Geschichten aus alter Zeit« (das. 1863–65, 2 Bde., u. ö.); »Neues Novellenbuch« (das. 1867, 3. Aufl. 1900); »Aus der Ecke, neue Novellen« (Bielef. 1875; 4. Aufl., Stuttg. 1898); »Am Feierabend«, 6 neue Novellen (Stuttg. 1880, 4. Aufl. 1902); »Lebensrätsel«, 5 Novellen (das. 1888, 4. Aufl. 1906), die letztern 6 Werke auch gesammelt als »Geschichten und Novellen« (das. 1898–1900, 7 Bde.); »Freie Vorträge« (das. 1873, 2. Sammlung 1885); »Kulturgeschichtliche Charakterköpfe, aus der Erinnerung gezeichnet« (das. 1891, 3. Aufl. 1899); »Religiöse Studien eines Weltkindes« (das. 1894, 5. Aufl. 1900) und eine Reihe kulturgeschichtlicher Abhandlungen in den Denkschriften der Münchener Akademie und der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Auch veröffentlichte er zwei Hefte Liederkompositionen u. d. T.: »Hausmusik« (Stuttg. 1856, 2. Aufl. 1859) und »Neue Lieder für das Haus« (Leipz. 1877). Unter Riehls Leitung erschien 1859–67 die »Bavaria«, eine umfassende geographisch-ethnographische Schilderung Bayerns in 5 Bänden. 1870–79 gab er das von Raumer begründete »Historische Taschenbuch« heraus. Nach seinem Tod erschien noch sein (einziger) Roman: »Ein ganzer Mann« (Stuttg. 1897, 4. Aufl. 1898). Vgl. Simonsfeld, Wilh. Heinr. R. als Kulturhistoriker (Münch. 1898). – Seine Tochter Helene machte sich als Landschaftsmalerin bekannt.
Die bürgerliche Gesellschaft
Vorwort.
In dem Vorwort zur ersten Auflage dieses Buches schrieb ich vor zwei Jahren Folgendes:
»Das vorliegende Buch ist nicht in Einem Zuge geschrieben worden, sondern in sehr allmählichem Wachsthum entstanden. Der Leser wird die Mängel einer solchen Entstehungsart, vielleicht auch einige Vorzüge derselben, dem Werke vorweg auf die Stirn geschrieben finden. Aber lieber wollte ich, daß das Ganze etwas allzu wildwüchsig erscheine, als einer äußerlich systematischeren Haltung die individuelle Farbe der einzelnen Abschnitte zum Opfer bringen.«
»Ueber die Folgerungen und Beweisführungen des Verfassers wird sich das Urtheil je nach den Parteien sehr verschieden gestalten. Aber in zwei Punkten wenigstens wünscht er auch bei den principiellen Gegnern Anerkennung zu finden: in der treuen und liebevollen Hingabe, mit welcher er in die Erkenntniß des deutschen Volkslebens einzudringen gestrebt, und in der Unabhängigkeit seiner Ueberzeugung, kraft deren er das von ihm für wahr Erkannte überall offen ausgesprochen hat, obgleich er recht gut weiß, daß seine Ansichten nirgends ganz in die bestimmten Formen der herrschenden Parteigruppen passen, und daß in diesem Buche einer jeden Partei gar vieles wider den Strich gehen wird.«
Ich habe diesen Worten nur wenig hinzuzufügen. Diese zweite Auflage erscheint in vielen Partien erweitert und hoffentlich auch verbessert. Wesentliche Aenderungen sind in dem Abschnitte vom »vierten Stande« eingetreten. Durch die schärfer durchdachte Bestimmung seines Begriffes, die ich S. 343 ff. neu eingefügt habe, bin ich mehrfach gezwungen worden, auch meine daraus abgeleiteten Schlußfolgerungen umzubilden. Ich glaube, daß diese neue logischere Fassung noch mehr Widerspruch finden wird, als die frühere; ich fand aber bei reiflicher Prüfung, daß es entweder gar keinen socialen vierten Stand gibt, oder daß derselbe eben dieser Stand der gesellschaftlichen Verneinung ist, wie ich ihn hier geschildert habe. Die für den Nationalökonomen so wichtige Berufsgruppe der Lohnarbeiter, der »eigentlichen Arbeiter,« die man wohl auch den vierten Stand nennt, ragt nur mit einzelnen Theilen in den hier gezeichneten socialen vierten Stand herein; einen nothwendigen Bestandtheil bildet sie nicht; am allerwenigsten aber ist sie ein und dasselbe mit diesem vierten Stand.
Den Schlüssel zum Verständniß dessen, was ich sociale Politik nenne, glaube ich in dem einleitenden Bande von »Land und Leuten« niedergelegt zu haben. Einer weiteren Vorrede bin ich dadurch überhoben. Weitere Ausführungen nach einer anderen Seite hin habe ich in den beiden größeren »social-politischen Studien« gegeben, die in der »Deutschen Vierteljahrsschrift« von 1852 und 1853 unter dem Titel: »die Frauen« und »die Sitte des Hauses« erschienen sind. So Gott will, soll aus diesen Aufsätzen später einmal ein Buch über » die Familie« werden als Gegenstück zu den vorliegenden naturgeschichtlichen Untersuchungen über die bürgerliche Gesellschaft.
Obgleich die erste Auflage der bürgerlichen Gesellschaft an concreten Einzelausführungen bereits keinen Mangel litt, so habe ich doch auch in diesem Stücke in der zweites Auflage noch manches hinzu gethan. Wenn ich dabei überhaupt den erlebten Beispielen aus unmittelbarer Nähe den Vorzug vor erlesenen gab, so glaube ich doch, daß das hierdurch entstehende örtliche Kolorit den allgemeinen Folgerungen keinen Eintrag thut. Es galt mir vor allen Dingen um eine frische Anschaulichkeit und hierbei ergeht es mir allezeit wie jenem Maler auf dem Hogarth'schen Kupferstich, der keine Bierflasche für ein Wirthshausschild malen mochte, außer man stellte ihm eine wirkliche Flasche Bier neben seine Staffelei.
Augsburg, am 31. October 1853.
W. H. R.
Vorwort zur dritten Auflage.
Diese Auflage ist ein unveränderter Wiederabdruck der zweiten. Nicht weil ich etwa glaubte, daß alles gut sey, habe ich das Buch hier in der Ueberarbeitung der zweiten Auflage unverändert stehen lassen, sondern im Gegentheil, weil für mich des Aenderns kein Ende wäre, wenn ich nunmehr wieder anfinge, die »bürgerliche Gesellschaft« neu zu überarbeiten. Denn es sind weniger die einzelnen Ausführungen, als die Architektonik des Ganzen, welche ich jetzt neu gestalten möchte. Daraus würde aber nicht eine neue Auflage, sondern ein neues Buch werden. Wenn meine »Naturgeschichte des Volkes« überhaupt einigen Nutzen gestiftet hat, so geschah dies doch wohl zumeist durch die Anregungen, die in dem Einzelwerk dieser Bücher und in der Grundidee des Ganzen liegen mögen. Systematische Schriften sind sie nicht und geben sich auch für solche nicht aus.
*
Ich hielt es darum auch nicht für gerechtfertigt, das System der Staatswissenschaft, welches mir allmählich aus den in der »Naturgeschichte des Volkes« niedergelegten Vorstudien aufgewachsen ist, nachträglich in diese ganz naiven Vorarbeiten hineinzuzwängen. Es wird vielmehr eine meiner nächsten Aufgaben seyn, jenes System selbständig und in voller wissenschaftlicher Schärfe auszuarbeiten. Diese Bücher der Vorstudien mögen dann bleiben, wie sie sind, und die Unbefangenheit der Ausführung mag auch fernerhin die Mängel des Gesammtbaues gut zu machen suchen.
München, am 29. August 1855.
W. H. R.
Einleitung.
Erstes Kapitel.
Zeichen der Zeit.
(Geschrieben im Jahre 1851 und 1853.)
Als Kaiser Maximilian I. im Wendepunkt der alten und neuen Zeit einen Reichstag auf den andern berief, um viele wichtige Reformen der deutschen Reichsverfassung zu entwerfen, einige auch zu vollführen, da däuchte wohl den Meisten zweifellos, es sey der Schwerpunkt der Kämpfe einer bereits ahnungsvoll bewegten Gegenwart auch für eine unabsehbare Zukunft in diesen Ring des neu sich aufraffenden Verfassungslebens festgebannt. Und doch bedurfte es nur eines kleinen Anstoßes nach kleiner Frist, und der welterschütternde Geistersturm brach auf einer ganz andern Seite los: die entscheidende That Luthers durchzuckte die Welt, und mit diesem Einen Schlage war alle Voraussicht der Staatsweisheit betrogen; – die gefürchtete politische Umwälzung ward zu einer kirchlich-religiösen, verbunden mit einer bürgerlich-socialen. Neue, kaum geahnte Lebensmächte rückten in den Vordergrund, neue Menschen, neue Götter. Die neue Welt war über die Träumer gekommen wie der Dieb in der Nacht.
Auch wir stehen im Wendepunkte einer alten und neuen Zeit; wir sind gleich unsern Vorvätern am Ausgange des Mittelalters seit einer Reihe von Jahren gewohnt, die großen und kleinen Verfassungskämpfe als den Schwerpunkt unsers öffentlichen Lebens anzusehen. An das neue Gebilde einer Gesammtverfassung Deutschlands knüpften sich seit 1848 die kühnsten Hoffnungen, wie später die bitterste Enttäuschung, lauter Jubel und stilles Zähneknirschen, die volle Gunst, der volle Haß der Parteien. Wie war es möglich, daß auf so viel glutheiße Leidenschaft so rasch kaltes Entsagen gefolgt ist? Das gemahnt an jenen Vorabend der Reformation. Die Wogen werden auch diesmal nicht auf dem Punkte durchbrechen, auf welchen aller Augen gerichtet waren. Seitab dem politischen Leben im engeren Sinne liegt jetzt das sociale Leben, wie vor vierthalbhundert Jahren seitab das kirchliche Leben lag. Die politischen Parteien werden matt: die socialen halten den glimmenden Brand unter der Asche lebendig. Die sociale Reformation wartet auf ihren Luther, über dessen Thesen man die kühnsten Entwürfe eines deutschen Verfassungswerkes, auch Großdeutschland und Kleindeutschland mitsammen, vergessen wird, wie man damals ewigen Landfrieden und Reichskammergericht, ja Kaiser und Reich selber über den Wittenberger Augustinermönch vergaß. In unsern politischen Kämpfen ist heute oder morgen ein Waffenstillstand möglich: in den socialen wird kein Waffenstillstand, geschweige denn ein Frieden eintreten können, bis längst über unserm und unserer Enkel Grabe Gras gewachsen ist.
Jedes Zeitalter findet ein paar große Wahrheiten, ein paar allgemeine Sätze, mit denen es sich seine eigene Welt erobert. Ein solcher Satz, neben anderen, ist für unsere Epoche darin gefunden, daß die »bürgerliche Gesellschaft« durchaus nicht gleichbedeutend sey mit der »politischen Gesellschaft,« daß der Begriff der »Gesellschaft« im engeren Sinne, so oft er thatsächlich hinüberleiten mag zum Begriffe des Staates, doch theoretisch von demselben zu trennen sey. Nicht blos vom Staatsrecht, als der obersten Blüthe des öffentlichen Lebens, will man fürder reden, sondern auch vom Stamm und der Wurzel, von des Volkes Art und Sitte und Arbeit. Die politische Volkskunde ist das eigenste Besitzthum der Gegenwart, die Quelle von tausenderlei Kampf und Qual, aber auch die Bürgschaft unserer politischen Zukunft.
Alle Parteien von den Männern des mittelalterlichen Ständestaates bis zu den rothen Communisten haben – bewußt oder unbewußt – den Satz feststellen helfen, daß die bürgerliche Gesellschaft zu unterscheiden sey von der politischen. Nur allein die polizeistaatliche Büreaukratie nicht. Würde sie aufhören jenen Unterschied und sein Resultat, die selbständige Volkskunde, zu übersehen, so würde sie sich selbst in ihrem innersten Wesen vernichten. Darum die auffallende Thatsache, daß unsere social-politischen Parteien, die in sonst nichts einig sind, einzig und allein sich Bruderschaft geschworen haben in ihrem Haß gegen die Büreaukratie.
Auf dem Grundgedanken, daß zu unterscheiden sey zwischen der bürgerlichen Gesellschaft und der politischen, erbaut sich die "sociale Politik." Der moderne Geist hat sie zu seinem Eigenthum gestempelt. Die beiden widerstreitendsten Ansichten vom öffentlichen Leben, nämlich die social-demokratische und die ständisch-aristokratische, begegnen sich in dem Punkt, daß beide den Gedanken einer socialen Politik am entschiedensten ausgebildet haben. Die Extreme, nicht deren Vermittelungen und Abschwächungen, deuten aber die Zukunft vor.
Man schaue auf die Zeichen der Zeit.
Will man heutzutage eine Partei, weil trockene Beweisgründe wirkungslos abprallen, am Gewissen packen, so geht man ihr mit Schlagwörtern der socialen Politik zu Leibe. Noch vor kurzem war dem nicht also. Zum Exempel: Die Freihändler schoben den Schutzzöllnern vor der Märzrevolution in's Gewissen, bald daß sie politische Demagogen, bald daß sie politische Reactionäre seyen. Will die freihändlerische Partei heute einen gleich hohen Trumpf gegen ihre Widersacher ausspielen, so rückt sie ihnen vor, entweder sie seyen Communisten oder umgekehrt Männer eines ständisch-privilegirenden Zunftwesens.
Die alten Gegensätze der Radikalen und Conservativen verblassen von Tag zu Tage mehr, die Gegensätze der Proletarier, Bürger, Junker etc. gewinnen dagegen immer frischere Farbe.
Die kleinen Dinge bilden das Maß für die großen. Ich will solch ein kleines Ding erwähnen. Jüngst erschienen die »Neuen Gespräche« eines berühmten Staatsmannes, deren vornehmster Inhalt auf eine Ueberschau der politischen Parteien in den zuletzt durchgefochtenen Verfassungskämpfen Deutschlands zielt. Die Tagespresse jeglicher Farbe griff sofort einen und denselben Satz des Buches als den merkwürdigsten, als den Kernpunkt heraus/hier mit dem Eifer der Genugthuung, dort mit dem Eifer des Aergers, den Satz: daß die ständische Monarchie gegenwärtig nur noch zu den edeln Wünschen, nicht mehr zu den Möglichkeiten gehöre. Bei dem dämonischen Scharfblick, welchen dem Verfasser die Gegner, bei dem genialen, welchen ihm die Freunde zuschreiben, hatte man im Voraus förmlich gelauert auf seinen Ausspruch in dieser Sache, und die Hast, mit der man überall gerade über den einen Satz herfiel, zeigt, daß derselbe den empfindlichen Punkt trifft, in welchem alle Nervenfäden unseres Parteilebens zusammenlaufen. Weit weniger berühren die Staatsrechtsfragen diesen Punkt, als was hinter ihnen steckt – die sociale Frage.
Die kirchlich Conservativen schlossen in neuester Zeit ein Bündniß mit den social Conservativen. Beide Richtungen erstarkten dadurch wunderbar. Die strenggläubigen Protestanten und Katholiken wetteifern, die Kirche als die erste, ja als die einzige Retterin aus unsern gesellschaftlichen Nothständen erscheinen zu lassen. Dies ist ein Ereignis von unabsehbarer Tragweite. Der Satz, daß das organische Naturgebilde der Gesellschaft eine göttliche Ordnung sey, hat rasch tausende von Bekennern gewonnen. Viele derselben würden vor zehn Jahren nur ein mitleidiges Lächeln dafür gehabt haben, wenn man ihnen die Gesellschaft als von Gott geordnet hätte aufbauen wollen.
In unsern Tagen wächst der Industrialismus zu einer socialen Macht, die in dieselbe Rolle eintreten könnte, welche vordem bald die Büreaukratie, bald die Demokratie gespielt hat. Der einseitige Industriemann kennt nur eine Wirthschaftspolitik, keine sociale. Die Gesellschaft ist für ihn ein Phantasiestück. Er weiß von keinen andern natürlichen Ständen als von denen der Erzeuger und Verzehrer, der Reichen und Armen. Grundsätzlich will er von den großen Naturgruppen des Volkes nichts wissen, thatsächlich fürchtet er sich aber doch vor jeder socialen Gleichmacherei. Der wirklich politische Industrielle dagegen wird eine solche Philisterphilosophie verschmähen. Er wird jeder Volksgruppe ein eigenartiges fröhliches Gedeihen gönnen, ohne daß ihn darum gleich Furcht befällt vor der Rückkehr mittelalterlichen Ständezwanges; er wird sich durch die analytische Gesellschaftskunde willig belehren lassen, daß die sociale Macht der Industrie noch nicht allein die Welt beherrscht.
Der Kampf der Parteien über die Stellung Oesterreichs und Preußens im deutschen Staatenverbande würde 1850 nicht so maßlos erbittert geführt worden seyn, wenn den Streitern dabei nicht weit mehr die sociale als die politische Zukunft des Vaterlandes vorgeschwebt hätte.
Die große Masse derer, welche nicht mehr von Bauern und Bürgern und Edelleuten reden wollen, sondern nur noch von Staatsbürgern, höchstens von armen und reichen, gebildeten und ungebildeten Klassen, hielt zu Preußen. Preußens größter König hatte dem heiligen römischen Reich deutscher Nation den letzten zertrümmernden Stoß gegeben, Preußen hatte den modernen Gedanken der Staatsgewalt am entschiedensten ausgebildet, es hatte die Herrschaft des Staates, oft mit despotischem Nachdruck, über die innere Selbstherrlichkeit der Stände gesetzt. Solch gründliches Aufräumen mit den verwitternden Resten des alten Reiches war ein Gebot der Zeit gewesen, und Preußen erfüllte in ihm seinen nationalen Beruf. Die folgerecht durchgeführte Idee eines allgemeinen Staatsbürgerthums haben wir vorab Preußen zu danken. Aber die Einseitigkeit, in welcher thatkräftige preußische Fürsten das Recht des Staates über die gesellschaftlichen Mächte durchsetzten, zog zugleich den modernen nivellirenden Polizei- und Beamtenstaat groß. Preußen unterschätzte in verschiedenen Zeitläuften das Recht der natürlichen Volksgruppen, wie es sehr wohl bei straffer Staatseinheit bestehen kann. Die politischen Mächte: Fürstenthum, Diplomatie, Heer, Beamtenthum gewannen ihr eigenthümlichstes Gepräge in Preußen. Unsere Constitutionellen verfielen oft genug in die Einseitigkeit, die natürlichen Mächte des Volkslebens zu vergessen über einer abstrakten Staatsrechtsschablone und glaubten dann ihre Stütze bei Preußen suchen zu müssen.
Aber die geradeaus gegenüberstehende Partei, die streng ständisch-monarchische, hoffte merkwürdiger Weise gleichfalls auf Preußen. Und mit nicht minderem, ja wohl gar mit noch viel größerem Recht. Preußen kann bei dem vorwiegend verneinenden und aufräumenden socialen Beruf, welchen es seit länger als einem Jahrhundert erfüllt, nicht mehr stehen bleiben. Es ist auf dem Scheidepunkte angekommen, wo es entweder das Aufgehen der vielgliedrigen Gesellschaft in ein nivellirtes Bürgerthum zur positiven That erheben, oder nicht minder positiv auf Grund der historisch erwachsenen Gesellschaftsgruppen sich politisch verjüngen muß. Die sogenannte neupreußische Partei suchte ihre Stütze in der persönlichen Politik des Königs, wie die constitutionelle in der Ueberlieferung des letzten Jahrhunderts preußischer Geschichte. Beide Parteien konnten die Sympathien eines Theiles der Bevölkerung für sich aufweisen, und jede behauptete des entscheidenden Theiles. So geschah es, daß die feindseligsten Richtungen gleicherweise an Preußens Beruf, an die Geschichte und an das Volk appellirten und doch zum ganz entgegengesetzten Ergebniß kamen. Beide schrieben sogar seltsam genug den Namen eines und desselben Mannes, Friedrichs des Großen, als des rechten Vorfechters und historisch verklärten Urbildes ihres Parteistrebens gleichzeitig auf ihr Banner!
Bei all diesen Kämpfen wurde nur Eines vergessen: daß man politisch sehr constitutionell und doch zugleich social sehr ständisch gesinnt seyn kann. Es läßt sich eine ächt constitutionelle Volkskammer denken, gegründet auf Ständewahlen. Das Volk nach seinen natürlichen Gruppen – Ständen – wählt; der Abgeordnete aber vertritt, von dem Augenblicke an, wo er die Schwelle der Kammer überschreitet, nicht seinen Stand, sondern das Volk. Vollends aber ist eine freisinnige und volksthümliche Verwaltungspolitik gar nicht denkbar ohne liebevolle Rücksicht auf alle natürlichen Besonderungen im Volksleben, und das sind ja eben die »Stände«. Man scheue nur nicht gar zu blind vor diesem ehrlichen deutschen Wort! Ein Polizeibeamter, der Sitte und Art der einzelnen Volksgruppen – der Stände – nicht kennt und beachtet, wird ein Polizeityrann. Die Polizeiwissenschaft findet ihre einzige gediegene Grundlage in der wissenschaftlichen Volkskunde; diese aber geht aus und führt zurück auf die Erkenntnis der historisch erwachsenen Unterschiede im Volksleben. Allein das Alles übersieht man, wähnend, mit dem bloßen Wort »Stände« sey auch schon das ganze Mittelalter wieder heraufbeschworen! Die mittelaltrigen Stände sind ja aber doch längst todt und begraben. Neue Stände wachsen heran an ihrer Statt und der modern constitutionelle Staat erstand als ein Sohn des feudalen Ständestaates. Glaubt man denn nur dadurch den Sohn ehren zu können, daß man den verstorbenen Vater schmäht? Und will man läugnen, daß dem Sohne doch gar viele Züge des Vaters aus dem Gesichte schauen? Man glaubt sociale Politik sey schlechthin eine Politik des Rückschrittes. Ich möchte gegentheils in diesen Büchern zeigen, daß sociale Politik, d. h. eine Staatskunst, welche auf das naturgeschichtliche Studium des Volkes in allen seinen Gruppen und Ständen gegründet ist, vielmehr eine vorschreitende, ächt volksfreundliche Politik sey.
Oesterreich hat keine so scharf bezeichnete Vergangenheit einer socialen Politik hinter sich liegen wie Preußen. Es ist darum auch nicht gleich diesem hier auf den äußersten Punkt der Entscheidung gedrängt. Weder in dem persönlichen Bekenntniß der Regierenden noch in der Volksstimmung fanden die beiden social-politischen Hauptparteien so bestimmte Stützpunkte wie bei Preußen. Nichtsdestoweniger spielte bei dem Widerspruch der streng constitutionellen Partei Norddeutschlands gegen den Gesammteintritt Oesterreichs in den deutschen Bund das social-politische Bedenken wenigstens negativ seine Rolle. Denn das Eine wußte man doch bestimmt, daß Oesterreich durch Natur, Bildung und Geschichte seiner Völker gezwungen ist, ein so straffes sociales Zusammenfassen des allgemeinen Staatsbürgerthums nicht eintreten zu lassen, wie dasselbe in Preußen durch das lange ausgleichende Wirken des büreaukratischen Regiments allerdings möglich geworden ist. Andererseits begrüßten die Freunde einer aus Arbeit und Beruf des Volkes sich heraufarbeitenden socialen Reform um so lauter die Fortschritte in der Ordnung des Gemeindewesens in Oesterreich, in der Umformung der Justiz, in der Grundentlastung, und vor allen Dingen die Bestrebungen des österreichischen Handelsministeriums durch eine großartige, dem Handel und der Industrie zugewandte Gunst dem Bürgerstand zu Kraft und Gedeihen zu verhelfen. Sie hielten sich durch diese Thatsachen zu der Hoffnung berechtigt, daß Oesterreichs Staatsmänner begriffen hätten, wo ihres Landes Zukunft liege, daß sie es für Oesterreichs Beruf erkannt, da anzufangen wo Preußen aufgehört, nämlich die Gesellschaft wieder in ihr Recht einzusetzen, nicht mehr über, sondern neben dem Staat und eine neue sociale Politik aus der möglichst eigenthümlichen Durchbildung des Bauernthumes, des Bürgerthumes, der Grundaristokratie heraus zu schaffen, ohne dabei in das für Preußen weit näher gerückte Extrem einer altständischen Restauration zu verfallen.
So wirkte das sociale Motiv bestimmend auf alle politische Parteien, und kreuzte und zerbröckelte dieselben dabei zum wunderlichsten Wirrsal. Die social-demokratische Partei aber, welche weder auf Preußen noch auf Oesterreich hoffte, stand zur Seite und rieb sich bei ihrer Neutralität schadenfroh die Hände. Es hätte den gemäßigten Männern dieser Farbe nichts im Wege gestanden, sich mit den Liberal-Constitutionellen zu verbinden, wenn die grundverschiedene sociale Weltanschauung nicht zur unübersteiglichen Kluft für beide geworden wäre.
Welch ungeheurer Gegensatz zeigte sich zwischen den ersten Eindrücken, die sofort nach der Februar-Revolution aus allen Ländern kund wurden, und der gleichgültigen Aufnahme der politisch ebenso folgenschweren napoleonischen Staatsstreiche! Bei jenem ersten Anlaß war halb Europa im Augenblick wie von einem Wetterstrahl entzündet; nachgehends war es – Frankreich voran – wesentlich nur verblüfft. Ludwig Bonaparte hatte die Parteien verwirrt, namentlich auch in Deutschland. Weder die conservative noch die liberale Presse war augenblicklich einig darüber, wie sie die Staatsstreiche aufnehmen sollte. So ging es auch bei anderen entscheidenden Anlässen. Die Gegensätze von conservativ und liberal sind eben in ihrer Allgemeinheit nur noch eine todte Abstraction. Die Parteien der historisch gewordenen oder der schulmäßig aufgebauten Gesellschaft, die Parteien des positiven Kirchenthums oder der zertrümmerten Kirche dagegen leben. Es ist weit mehr als mangelnde Partei-Disciplin, wenn den alten Parteigruppen im entscheidenden Augenblicke überall das rechte Stichwort fehlt. Hinter der Verwirrung der Begriffe und Standpunkte lauert eine tiefe Ironie: das Bekenntniß, daß eben jene hergebrachten Parteigruppen bloße Schatten, todte Formeln geworden sind, die keine Macht mehr haben angesichts der Ereignisse.
Waren die Eindrücke der Pariser Katastrophe des 2. Decembers 1851 nicht fast merkwürdiger, überraschender als die Katastrophe selbst? Fast die gesammte deutsche Presse bewies sofort die Rechtlosigkeit des Staatsstreiches. Wer zweifelte überhaupt an derselben? Und doch wünschten damals die großen Massen auch des deutschen Publikums, daß dieser unverantwortliche Staatsstreich, da er einmal geschehen, vollends gelingen möchte. In dieser Ansicht, die sich über den Bruch alles öffentlichen Rechtes so rasch hinwegsetzte, mußte doch mehr liegen als der starre Respect vor der vollendeten Thatsache: mehr als die Kurzsichtigkeit des Philisters, dem die verkehrslähmende Spannung auf den Mai 1852 zu lange gewährt hatte, der aber doch auch jeden gründlichen Entscheid, weil er ihn aufgerüttelt haben würde, verschoben wissen wollte, dem die Frist bereits zu lange gedauert, und der doch wiederum nur Frist begehrte, Frist um jeden Preis, was man auf deutsch Galgenfrist nennt – der sich freute, er könne nunmehr, kraft des 2. Decembers, im nächsten Jahre sichere Geschäfte machen und nur bedauerte, daß den Parisern ihr Weihnachtsmarkt so arg gestört worden war, und daß die armen Pariser Zuckerbäcker ihre Marzipanausstellungen zur Hälfte umsonst gemacht hatten. Es mußte einen tieferen Grund der Gleichgültigkeit geben, mit welcher man zusah, wie das politische Rechtsbewußtseyn in's Herz verwundet wurde.
Conservative wie radicale Stimmen begegneten sich damals in der richtigen Erkenntnis dieses tiefern Grundes. Die Theilnahme für das Staatsleben, das Verfassungsleben, für die eigentlich politische Politik ist lahm geworden gegenüber der gewaltigen Aufregung, mit welcher Europa in Zagen und Hoffen den Entwickelungen des socialen Lebens folgt. Ja es ist dabei eine Gleichgültigkeit gegen das öffentliche Recht an den Tag gekommen, die man auf's tiefste beklagen muß. Hier jagen sich die Extreme. Das französische Verfassungswesen und was ihm in hundertfacher Variation in Deutschland nachgebildet ist, muß sich festigen durch eine gesellschaftliche Basis, es muß zurückgreifen auf die Naturgeschichte des Volks, oder es hat sich überlebt, und die deutschen Kammern werden machtlos wie die französische Nationalversammlung und der Sinn für das Verfassungsrecht überhaupt wird im Volke immer bedauerlicher verdunkelt werden.
Jedes Zeitalter hat sein eigenes Gespenst, und unter Zittern und Zähneklappern vor demselben erziehen sich die Völker. Was dem Mittelalter die Furcht vor dem Posaunenschalle des jüngsten Gerichtes war, das ist dem neunzehnten Jahrhundert die Furcht vor den Posaunen der großen socialen Umgestaltung. Auf diese Furcht hat der andere Napoleon seinen Kaiserthron gegründet wie der erste Napoleon den seinigen auf die Schrecken der ersten Revolution. Diese Furcht treibt gegenwärtig die Leute, sich an jeglichen Strohhalm von Friedenshoffnung anzuklammern, wenn auch die Mächte schon seit Monaten die Hand am Schwert haben, denn einem europäischen Krieg könnte die sociale Revolution in Europa auf dem Fuße folgen. Ein ganzer Centner Verfassungsrecht wiegt kein Loth, wenn der gesammten historischen Gesellschaft das Messer an der Kehle sitzt. Mag dieser Ausspruch ein höchst gefährlicher und trügerischer seyn, nur möglich bei wirklich verdunkeltem politischem Rechtsgefühl: – er erscheint der Mehrheit des Volkes jetzt als eine Wahrheit. Die Proclamation des Präsidenten Bonaparte vom 2. December 1851 ist unstreitig ein Meisterstück gewesen, ein Meisterstück um deßwillen, weil jener schlaue Mann das allgemeine Stimmrecht, das wirksamste unter allen Reagentien des socialen Gährungsprocesses, damals hinwarf, um diesen Gährungsproceß selber – vorerst – niederzuschlagen. Und die Welt zerbrach sich den Kopf nicht über der theologischen Streitfrage: ob man denn wirklich den Teufel auch bannen könne durch Beelzebub; sie beruhigte sich in dem Gedanken, daß jene neue Revolution vorerst ja nur eine politische sey! daß sie das jüngste Gericht im Volksglauben des neunzehnten Jahrhunderts, die sociale Revolution wieder auf Jahre, vielleicht auf Jahrzehnte zurückgedrängt habe.
So sehen wir in den räthselhaften ersten Eindrücken jenes Staatsstreiches ein neues Zeugniß für die Wahrheit: daß das politische Interesse gegenwärtig wesentlich verschlungen ist von dem socialen. Das Zeitalter wird keine Ruhe, keine Fassung mehr gewinnen für die Verfassungspolitik, wenn nicht die Reform der Gesellschaft vorangegangen ist. Den Streich gegen ein historisch bestehendes Staatsrecht konnte Ludwig Bonaparte mit augenblicklichem Erfolg führen, und die großen Schaaren seiner Gegner blieben zugleich seine Zuschauer. Wäre am 2. December ein gleich entscheidender Streich gegen historische Rechte der Gesellschaft geführt worden, wären es die Socialdemokraten gewesen, welche mit gewaltsamer, siegreicher Hand in die bestehende Ordnung eingegriffen hätten, dann würde halb Europa sofort nicht auf dem Schauplatze, sondern auf dem Kampfplatze gestanden haben.
Napoleon III. gründete sein Regiment auf eine wenigstens scheinbare sociale Macht. Er griff die Soldaten heraus, das Soldatenthum, er formte aus ihnen den gesellschaftlichen Kern, mit welchem er der ermatteten Aristokratie, dem eingeschüchterten Bürgerthum ihren gesellschaftlichen Beruf vorläufig abnehmen konnte gegenüber dem Andringen der Socialdemokratie. Er verkündete den Frieden, aber er privilegirte das Soldatenthum. Die Soldaten stimmten zuerst ab; sie waren eine Weile die allein social und politisch bevorrechtete Aristokratie in Frankreich. In diesem kecken Versuch, der sich gleichsam eine neue sociale Macht schaffen wollte, weil die alten nicht mehr Stich hielten, lag ebensowohl die Gewähr des augenblicklichen Gelingens als der Keim des früher oder später eintretenden Sturzes der napoleonischen Herrschaft. Denn eine Aristokratie des Soldatenthums wird sich in unserer Zeit nur so lange halten können, als die Ohnmacht der natürlichen Gruppen der historischen Gesellschaft gegenüber dem demokratischen Proletariat fortdauert.
Wir sehen einen Kaiser, der keinen weiteren Rechtstitel hat, als eine durch die Furcht vor dem Gespenste der socialen Revolution dictirte Volksabstimmung und – seinen Namen, seinen sehr kurz beisammen gepackten Stammbaum. Und doch war es der Zauber dieses Namens, dieses gesellschaftlichen historischen Anrechtes, welcher ihm, der kein Held und kein Feldherr ist, die Stimmen der Armee gewonnen hat! Das ist wieder einer der großen scheinbaren Widersprüche unserer Zeit. Der Instinct für eine gesellschaftliche Tradition, für die Aristokratie der Geburt, schafft aus einem verspotteten Abenteurer einen Helden des Tages – und doch soll ja diese Tradition der Geburtsaristokratie längst in Luft zerronnen, soll die Ausebnung aller überlieferten gesellschaftlichen Gegensätze das Ideal der Gegenwart seyn!
Ludwig Napoleon ist der Namenserbe des großen Soldaten, darum erschien sein Adel als der älteste und beste, der eigentlich fürstliche in einer Republik, in welcher das Soldatenthum sich berufen hielt, von nun an wiederum die hohe Aristokratie Riehl, die bürgerliche Gesellschaft zu bilden. Man kann diese Thatsachen gleicherweise sehr lustig und sehr ernst finden. Aber sie bleiben eine inhaltschwere Mahnung, daß man die sociale Politik begreifen und schätzen möge als die eigentlich entscheidende Politik der Gegenwart.
So erscheint auch der gefahrvolle Versuch, daß Ludwig Napoleon die Proletarier in Schaaren von vielen Tausenden nach Paris zieht, um ihnen zu zeigen, daß er den Arbeitern Arbeit und Verdienst nach Belieben aus dem Aermel schütteln kann, als ein Zeugniß für die unwiderstehlich in unser öffentliches Leben einziehende sociale Politik. Mit der entschlossensten, verwegensten, verzweifeltsten Gesellschaftsgruppe, dem vierten Stand, soll die übrige Gesellschaft in Schrecken gehalten werden, damit der Kaiser einstweilen ruhig auf seinem Throne sitzen könne. Indem die Proletarier die Straßen von halb Paris niederreißen, bauen sie die unsichtbare Burg der kaiserlichen Macht. Die sociale Politik ist hier aber ein Hazardspiel, nicht ein Ausfluß besonnener Staatskunst. Vielleicht gelingt es dem Hazardspieler einmal die Bank zu sprengen, aber zuletzt wandert er doch in den Schuldthurm oder schießt sich eine Kugel durch den Kopf.
Weit leichter läßt es sich gegenwärtig annehmen, daß Einer die politische Partei aus reiner, freier Ueberzeugung wechsle, als daß er ein sociales Glaubensbekenntniß umtausche. Denn das letztere ist nicht blos ein Product des verständigen Urtheils, es ist uns zur Hälfte angeboren, mit Abkunft, Erziehung, Weltstellung untrennbar verwachsen. Der Sohn des individualisirten Mitteldeutschlands denkt von Haus aus ganz anders über die socialen Fragen, als der Nord- oder Süddeutsche, weil er von Jugend auf von ganz anderen socialen Thatsachen umgeben ist. Man sollte darum gerade hier nicht so rasch seyn, dem Gegner niedrige Beweggründe unterzuschieben, denn beim Urtheil über sociale Zustände ist ein jeder zugleich Richter in eigener Sache.
Die politischen Maßregeln unserer jüngsten revolutionären Krisis sind nach Ablauf weniger Jahre zu Hunderten wieder in Nichts zerronnen. Es hat sich als viel leichter erwiesen, zwei, drei neue Verfassungen in einem Athem hinter einander einzuführen, als eine einzige Maßregel socialer Natur wieder rückgängig zu machen, wie beispielsweise die auf eine höhere gewerbliche Selbständigkeit des Handwerkerstandes, auf Entlastung des Grundeigenthumes zielenden Reformen.
Darum ist mir nicht leicht eine ärgere politische Ketzerei vorgekommen, als wenn ich Männer, die für staatklug gelten wollten, in den Kammern und der Presse solche Maßregeln, die den nächsten – wenn auch scheinbar noch so geringfügigen – Interessen der bürgerlichen Gesellschaft galten, für kleinlich ausschreien hörte, gegenüber den lärmenden Debatten der formellen Politik. Auch die kleinste Maßregel zur Hebung der Selbständigkeit der bürgerlichen Gesellschaft neben der Staatsgesellschaft ist groß, und wer die, wenn auch noch so bescheidene, Pflege der gesellschaftlichen Interessen gering ansiehet, der begehet eine Todsünde wider den Geist der Zeit.
Zweites Kapitel.
Sondergeist und Einigungstrieb im deutschen Volksleben.
Im Wein ist Wahrheit. Auch eines Volkes geheimste Gedanken belauscht man wohl in den kurzen Augenblicken seligen Trunkenseyns, nicht in den langen nüchternen Tagen des ruhigen Gewohnheitslebens.
So ein glücklicher Moment des Rausches war das Jahr 1848. Kommende Geschlechter beneiden gewiß den Culturforscher, dem es damals vergönnt war, mit Mappe und Bleistift zuzuschauen und Skizzen zu Dutzenden für künftige Ausarbeitung auf's Papier zu werfen. Denn ein Rausch des Volkes mag wohl rasch wiederkehren, aber schwerlich ein so gutartiger, der von allen guten und schlechten Geheimnissen des Volkslebens so arglos den Schleier heben wird. Es sind bereits so viele Sittenzeichner aufgetreten, welche aus den Scenen des Jahres 1848 einen Höllenbreughel zusammengesetzt haben: warum nicht lieber einen Ostade, ein Bildchen, wo der Wein so recht als ein Verklärer, das ist ein Klarmacher, auf jedem Lächeln, jedem Blinzeln, jedem Stirnrunzeln der Zechgenossen leuchtet, und auch der unglückselige Mann nicht fehlt, der seitab sich in den Winkel stiehlt, weil es ihm übel wird? In jenem dem Beobachter so günstigen Jahre des großen Volksrausches konnte man eine zwiefache Thatsache wahrnehmen. Zuerst, daß sich alle Welt, Rang und Stand vergessend, brüderlich in die Arme fiel – und wer nicht aus dem Seelenjubel der Begeisterung mitmachte, der that es wenigstens beim Zähneklappern der Furcht. Zum andern aber, daß gleichzeitig der Sondergeist, der Drang nach corporativer Selbständigkeit der einzelnen Berufe und Gesellschaftsgruppen nicht minder gewaltig hervorsprang.
Da sahen wir, wie schon in den ersten Märztagen das Handwerk sich zusammenschaarte, um sich zu erretten von dem Fluch der schrankenlosen Gewerbfreiheit, der Patentmeisterschaft ec, um die Ordnung der gewerblichen Angelegenheiten der Büreaukratie ab und in die eigene Hand zu nehmen. Es wurden hier und dort förmliche Zunftordnungen extemporirt, nicht von den Regierungen, sondern von den Handwerkern selber. Meister- und Gesellenvereine wucherten auf. Altersmatt gewordene Gewerbevereine gewannen neues Leben. Bei einzelnen Gewerbszweigen wurde die Selbstherrlichkeit der Körperschaft bis zu einem Grade ausgedehnt, daß der Staat nicht mehr ruhig zusehen konnte. Ich erinnere nur an die Buchdruckergehülfen, welche mit ihrem straffen Zusammenhalten im Sommer 1848 der norddeutschen Polizei nicht wenig Kummer bereitet haben. Man nannte aber, beiläufig bemerkt, diese Fanatiker des Corporationswesens radical, nicht reactionär.
Die ›Arbeiter‹ schaarten sich zu umfassenden Vereinen mit klar ausgesprochener socialer Tendenz, um ihre Rechte als "Stand" kämpfend. Eigene Arbeiterzeitungen wurden gegründet. Die Schullehrer wie die Geistlichen gruppirten sich zu besonderen Vereinen, hielten Versammlungen ab, stifteten Schul- und Kirchenblätter. Jeder wollte das Interesse seines Standes und Berufes wahren und festigen. Die Kirche machte von dem Vereinsrecht den großartigsten Gebrauch. Der Katholicismus gewann durch das musterhaft organisirte Vereinswesen eine sociale Macht, wie er sie, wenigstens in den Ländern gemischten Glaubens, vielleicht seit der Reformation nicht mehr besessen hatte. Es wurden auch kirchliche Vereinszeitungen geschaffen neben den eigentlichen Kirchenzeitungen. Ueberall Sonderung, überall eine ganz von selbst entstehende Gliederung der Gesellschaft. Ja die Lust, alle möglichen Angelegenheiten genossenschaftlich zu behandeln, überstürzte sich bis zum Unsinn, und mancher sonst arbeitsame Bürgersmann ist dazumal vor lauter Corporation, ständischem selfgovernement und Vereinswesen ein Lump geworden.
Die freie Gemeindeverfassung, was ist sie in ihren Grund- und Stammsätzen anders als ein Corporationsstatut, halb socialer, halb politischer Natur? Das Recht, die eigenen Angelegenheiten des Gemeindehaushaltes selber zu ordnen, das Recht der Gemeinde, demjenigen die Niederlassung zu wehren, den sie für ein verderbliches Subject hielt, wie es im Mittelalter die Städte besaßen, beanspruchte jetzt jedes Dorf. Ich habe nicht gehört, daß irgendwo in der Weise Mißbrauch von der freien Gemeindeverfassung gemacht worden wäre, daß eine Gemeinde ihre Thore dem Zuzug jedes Straßenläufers geöffnet hätte, wohl aber gar häufig umgekehrt, daß die freie Gemeinde in engherzigstem Sondergeist auch dem tüchtigsten Einwanderer die Niederlassung versagte. Die Bürger der Städte, der eigentliche Mittelstand, thaten sich zusammen in Bürgervereinen, constitutionellen Vereinen, Vereinen für Gesetz und Ordnung u. dgl. Es war in der Regel nicht geradezu ausgesprochen, daß diese Vereine das corporative Interesse des Bürgerstandes als solchen vertreten sollten. In der That und Wahrheit thaten sie dies aber doch, und wesentlich nur dies. Absichtslos bekundete sich hier der Sondergeist des Bürgerthums nur um so auffallender.
Der Adel wurde schon durch die Bedrängniß der Zeit zu strafferem Zusammenhalten getrieben.
Die Bauern allein versuchten keine neuen Corporationen zu gründen, weil sie glücklicherweise noch in dem beneidenswerthen Zustande leben, daß sie von allen Gruppen der bürgerlichen Gesellschaft am naturgemäßesten gegliedert sind, ohne es selber recht zu wissen.
In all diesen Thatsachen lag eine Wahrheit, jene naive Wahrheit, welche aus dem Rausche spricht. Es war den Leuten nicht von oben her befohlen worden, sich nach Standes- und Berufsinteressen in Vereinen zusammenzuthun, sie waren ganz von selber auf den Einfall gekommen, der Instinct des fessellosen Volkes hatte die Wahrheit entdeckt und ausgebeutet, daß nur aus der gesonderten Pflege des Individuellen die allgemeine Größe hervorsteige.
Gerade in Mitteldeutschland, wo wahrlich wenig mittelalterliche Rückgedanken im Volke mehr leben, wo aber hier und da eine zügellose Gewerbefreiheit die Leute allmählich mürbe gemacht hatte, sah die freisinnige Partei den letzten Rettungsanker des Handwerkes in einer neuen corporativen Organisation des Gewerbestandes. Im deutschen Süden besaß man zum Theil noch zu viel von den alten Resten des Zunftwesens, man hat aber selbst wirklich veraltete Gebilde derart nicht geradezu über Bord geworfen. Der Norddeutsche begreift diese Thatsachen nicht, weil er sie nicht bei sich selbst erlebt hat. Es würde staunenswerthe Resultate zeigen, wenn man das Alles zusammenstellen könnte, was der Gewerbestand einzelner Gegenden 1848 Alles gethan hat, um sich in wirthschaftlichen und socialen Körpern zu Schutz und Trutz abzuschließen. Wohl hat man in norddeutschen Städten die Gewerbefreiheit gewahrt; in anderen Gegenden aber ist man gerade da mit dem stürmischsten Angriff gegen dieselbe vorgeschritten, wo man sie am ausgedehntesten genossen hatte. Hier verläugnete der Liberale sein eigenes liberales Princip, um dem in der Nation wehenden Sondergeiste ein Genüge zu thun, welcher eben da, wo das Volk sich in seiner Natürlichkeit zeigte, wo es am meisten sich gehen ließ und nach eigenem Gutdünken wirthschaftete, am entschiedensten hervorbrach. Diese wichtige Thatsache wird man nicht antasten können.
Aber freilich war auch gleichzeitig dem Einigungstrieb keine Schranke gestellt. Man gab sich unbefangen den Sonderinteressen von Stand und Beruf hin, weil man die Sonderungen des Ranges ein für allemal aufgehoben wähnte. Man fühlte sich einig als Nation, und nahm es darum für unverfänglich sich in den socialen Sonderinteressen ganz gründlich zu vereinzeln. Man fühlte sich gleich und einig in der Bildung, denn keiner glaubte an politischer Reife dem andern nachzustehen und jeder Eckensteher war ein Staatsmann: darum wahrte man um so eifriger den Vortheil der einzelnen abgeschlossenen Stufen der bürgerlichen Existenz sammt der damit verknüpften Mannichfaltigkeit der speciellen Bildung. Hätte man freilich den Leuten laut gesagt, daß sie durch ihr Vereinswesen etc. lediglich den unvertilgbaren Trieb zur ständischen Gliederung bekundeten, so würden sie Einem die Fenster eingeworfen haben. Daß sie unbewußt dem Sondergeist im Volksleben ihre Huldigung darbrachten, macht darum diese Huldigung selbst nicht bedeutungsloser.
Die Scheidewand der alten Gesellschaftsgruppen ist durch den Einfluß einer immer mehr sich verallgemeinernden Geistesbildung, durch die Macht des modernen Industriewesens, durch die staatsrechtliche Thatsache eines gleichberechtigten und gleichverpflichteten allgemeinen Staatsbürgerthums so gründlich niedergeworfen worden, daß man für die Kraft des socialen Einigungstriebes in unserer Zeit nicht erst den Beweis anzutreten braucht. In einer Epoche, wo der Adel social herrschte, zweifelte niemand an der ständischen Gliederung der Gesellschaft: so zweifelt jetzt, wo der Bürgerstand den entscheidendsten Einfluß im socialen Leben übt, niemand an dem Gemeinbewußtseyn, an der höheren Einheit aller Gesellschaftsgruppen. Aber gerade darum ist es jetzt um so nothwendiger darauf aufmerksam zu machen, daß auch der sociale Sondergeist durchaus nicht erloschen, daß er nur in die zweite Linie getreten ist, daß er statt der alten Bildungen neue geschaffen hat, und wahrlich als ein vollwichtiger Factor in der socialen Politik die höchste Beachtung verdient.
Ich zeigte vorhin im Spiegel einer Volksbewegung, wie mächtig der unbewußte Sondergeist im Volke noch walte. Als Seitenstück tritt uns die gleiche Erscheinung auch im Spiegel der modernen Literatur gegenüber. An dem Grundsatze festhaltend, daß im Kleinen der Maßstab für Großes gegeben sey, greife ich einen literarisch noch minder bedeutenden, aber um der Ueppigkeit des in ihm wuchernden Triebes für den Culturforscher um so bedeutsameren Zweig unseres Schriftthumes heraus: den sogenannten "socialen Roman." In dem Maße als uns das durch lange Zeit fast ganz abgestorbene Bewußtseyn des Lebens in der bürgerlichen Gesellschaft wieder lebendig wurde, keimte auch die reiche Saat der socialen Romane auf. Das 18. Jahrhundert konnte keine Literatur des socialen Romans haben, denn der moderne Begriff der Gesellschaft fehlte ihm. Wenn aber ein künftiger Historiker die socialen Geburtswehen unserer Tage zu schildern unternimmt, dann wird er ein eigenes Capitel ausarbeiten über dieses Phänomen der socialen Romane: er wird da reden von Sealsfield, von Dickens, selbst schon von Walter Scott, von Eugen Sue und von all den künftigen großen deutschen Romanschreibern, die jetzt noch als Quintaner in den Gymnasien sitzen. Die Zeit ist da, wo Staatsmänner zu ihrer Instruction auch Romane lesen müssen.
Ist dies nicht eine wichtige Thatsache, daß unsere Poeten den Einzelnen gar nicht mehr anders zu malen vermögen als in den Localtönen eines bestimmten Gesellschaftskreises? daß der allgemeine Liebhaber, Held, Intriguant etc., wie man ihn ehedem zeichnete, stereotypen Figuren ganz anderer Art Platz gemacht, gesellschaftlich individualisirten Figuren, als da sind: Bauern in allerlei Natur und Unnatur, Edelleute und Emporkömmlinge, Bürger, Bourgeois und Philister, Handwerker, Arbeiter und Proletarier? Diese festen Charakterrollen, die dem modernen Roman ausschließlich zu eigen gehören, bezeichnen einen Triumph der historischen socialen Weltansicht über die philosophisch ausebnende. Wenn sich der großentheils politisch freigesinnte Kreis der Romandichter den modernen Menschen gar nicht mehr anders poetisch individualisiren kann als im Gewand eines besonderen Standes, dann müssen diese Gruppen der Stände doch wohl mehr seyn als das bloße Trugbild reactionärer Politiker. Gar viele sociale Romane sind im conservativen Interesse geschrieben, ohne daß sich's der Autor hat träumen lassen. Es war eine wahrhaft verhängnißvolle Verkehrtheit des vormärzlichen Standpunktes, daß nicht die Staatsmänner ein Auge hatten auf den socialen Roman, sondern die Polizeibeamten. Diese Gattung von Poesie bildete das erste Capitel in der polizeilichen Literaturkunde, und noch heute denken von zehn Leuten gewiß neune bei einem »socialen« Roman stracks an einen »socialistischen.«
Man halte die dichterischen Sittenbilder des Bauernlebens, welche Jung Stilling und Hebel mit so liebenswürdigem Griffel entworfen, gegen die Art wie Immermann, Auerbach, Jeremias Gotthelf dasselbe Thema behandeln. Jene älteren Dorfnovellisten malten uns den Bauersmann als ein einzelnes Charakterbild in seiner privaten Gemüthlichkeit, als Staffage eines kleinen Genrestückes; diese neueren dagegen fassen ihn vorweg als Glied der Gesellschaft, sie setzen ein Bauernthum voraus, der sociale Grundton dringt durch, auch wo keine Tendenz sich breit macht.
So geht es durch alle Zweige der Romandichtung. Auch das ästhetisch flachste und gleichgültigste Werk gewinnt aus diesem Gesichtspunkte oft Werth für den Culturhistoriker. So z. B. die aristokratischen Frauenromane. Eine spätere Zeit wird in denselben viel lehrreichen Stoff zur Erkenntniß der Schwächen unserer Aristokratie finden, wenn es der Literarhistoriker langst nicht mehr der Mühe werth hält einen Blick in dieselben zu werfen. Die Gräfin Hahn hat ihre Bücher Romane »aus der Gesellschaft« genannt. Sie denkt sich freilich unter der Gesellschaft etwas ganz anderes als wir, aber wir können sie immerhin auch in unserm Sinne beim Wort fassen: es sind in der That sociale Romane, sehr verunglückte freilich. Indem in den meisten dieser aristokratischen Frauenromane der Cultus gerade des Außenwerks der Aristokratie, in seiner Poesielosigkeit, auf die Spitze getrieben ist, werden sie förmlich zu destructiven Schriften, die eine richtige Erkenntniß und Würdigung des Wesens der Aristokratie weit mehr beeinträchtigen als gar manche polizeilich verbotene, von bärtigen Literaten geschriebene Bücher.
Zwei fremde Romanschriftsteller haben in neuerer Zeit in Deutschland einen wahrhaft beispiellosen Erfolg gehabt: Walter Scott in den zwanziger, Eugen Sue in den vierziger Jahren. Sie vertreten die beiden äußersten Pole des socialen Romans. Wer jetzt, nachdem wir die großen Lehrjahre unserer kleinen Revolution durchgemacht, Scotts Romane wieder zur Hand nimmt, der staunt gewiß darüber, wie er dieselben heute mit so ganz anderem Auge liest als vordem. Welchen grundverschiedenen Sinn haben diese Schilderungen der altenglischen Aristokratie und des Bürgerthums wie der patriarchalischen Zustande Hochschottlands jetzt für uns gewonnen, wo wir mitten im socialen Kampfgetümmel stehen! Jetzt merkt man erst, daß nicht das historische Beiwerk, sondern der sociale Kern den eigentlichen Grundcharakter dieser Romane bildet. Jetzt fühlt man erst, wie lächerlich es war, daß man vordem bald diesen bald jenen deutschen Romandichter den deutschen Walter Scott genannt, wo wir doch erst das Bewußtseyn eines fest historisch gegliederten Gesellschaftslebens wie das englische wiedergewinnen müßten, um deutsche sociale Romane von innerer Verwandtschaft mit diesen englischen schaffen zu können. Der sociale Inhalt wurde bei den Romanen Sue's von der großen Masse viel rascher herausgefunden als bei Walter Scott, weil er sich dort als Verneinung der bestehenden Gesellschaft darstellt. Man glaubte jetzt erst den socialen Roman gewonnen zu haben, den man doch längst besaß. Den Deutschen fängt mehrentheils die Politik immer erst da an, wo die Opposition anfängt, darum ist eine erhaltende und aufbauende Politik für so viele geradezu das classische »hölzerne Eisen« der logischen Lehrbücher. In einer Zeit, die von großen sittlichen und socialen Gährungen kaum minder trüb aufbrauste als de unsrige, hat Rubens den wilden Jubel der Sinnenlust, den entfesselten Dämon des irdischen Menschen, den Rausch der geilen Lüsternheit in unverhüllter Nacktheit ungleich kecker gemalt als je einem französischen Neuromantiker gelungen ist; aber wir dürfen nicht vergessen, daß er neben diese nahezu unsittlichen Bilder – das jüngste Gericht und den Sturz der bösen Engel gestellt, und daß ihm die hier zum Abgrund niederstürzenden Teufel, wie sie sich vergeblich zähnefletschend gegen die Lanzen der Erzengel aufbäumen, gerade am trefflichsten gelungen sind. Auch der sociale Roman der Franzosen malt die Sünde möglichst nackt, aber das Gericht, welches der Dichter daneben stellt, ist kein jüngstes Gericht, und die poetische und sittliche Gerechtigkeit wird darin schneidender verletzt als in dem koketten Abbild der Unzucht und Niedertracht selber. Rubens, der im Style seiner Zeit sociale Romane malte, war auch ein Staatsmann. Sollen wir Victor Hugo, Sue, G. Sand ec, die ja auch auf kurze Frist Staatsmänner neueren Styles gewesen sind, mit dem alten Maler als Staatsmann vergleichen? Nirgends haben die Franzosen Aberwitzigeres zu Tage gefördert als in den praktischen Lösungsversuchen der socialen Frage, und kein Literaturzweig ist bei ihnen entsprechend zu ärgerem ästhetischem Aberwitz ausgewachsen als der sociale Roman.
Man zeige mir einen wirklichen Dichter, der einen modernen Roman geschrieben hat, ohne dessen Charaktere als in den Unterschieden der verschiedenen Stände gewurzelt zu entwickeln, und ich will daran glauben, daß ein Unterschied der Stände auch nicht mehr in der Natur und in dem Bewußtseyn des Volkes wurzele. Ein Mensch, der keiner besonderen Gesellschaftsgruppe angehört, sondern nur dem allgemeinen Staatsbürgerthum, ist für den Romandichter eben so sehr ein Unding als ein allgemeiner Baum, der nicht Eiche, nicht Buche, nicht Tanne für den Maler. Und nicht bloß im Wein ist Wahrheit – auch in der Poesie.
Für das Studium der Volkssitten ist in den letzten Jahrzehnten in Deutschland erstaunlich viel gethan worden. Meint man, der überreiche ungeordnete Stoff, der hier zusammengetragen ist, habe blos den Werth einer Curiositätensammlung, oder blos antiquarischen Werth, sofern er den letzten Widerschein einer versinkenden Welt festhält? Für uns hat die Fülle dieser Studien zu allererst eine großartige sociale Bedeutung. Denn die noch fortlebende Sitte des Volkes, deren stärkste Triebkraft gerade in den unteren Volksschichten sitzt, ist uns Brief und Siegel für das noch keineswegs erstarrte Schaffen und Weben des Sondergeistes im Volke. Diese derben Unterschiede der Volkssitten werden sofort erlöschen, so wie eine organische Gliederung der Gesellschaft aus der Natur des Volkslebens verschwunden ist. Alsdann wird es Zeit seyn an das ewige Reich des Socialismus zu denken. Nur die nivellirte äußere Kruste der Gesellschaft, die den modernen abstracten Bildungsmenschen in sich faßt, hat jetzt schon keine eigenthümliche Sitte mehr.
Das vielfach bis zur äußersten Grenze getriebene Sonderthum des Volkslebens ist der tiefste Jammer und zugleich die höchste Glorie Deutschlands. Unser Bestes und unser Schlechtestes wurzelt in demselben, nicht seit heute oder gestern, sondern seit es eine deutsche Geschichte gibt. Hier die Eigenart und Frische unseres geistigen Schaffens, der Ameisenfleiß unseres industriellen Lebens, jene zähe, elastische, verjüngende Kraft, welche unsere Nationalität nie ganz zerknickt werden ließ, welche wirkte, daß der deutsche Geist, wenn er in einem Punkte gebrochen schien, in zehn andern gleichzeitig um so gewaltiger in die Höhe strebte. Auf der andern Seite Zwietracht, Zersplitterung, der Jammer des ebenfalls niemals auf allen Punkten zugleich niederzubeugenden Particularismus. Schon geographisch ist Sondergeist und Einigungstrieb im deutschen Volksleben dargelegt in dem »individualisirten und centralisirten Land,« wie ich es in dem ersten Bande dieses Werkes geschildert habe, Zu jenen örtlichen Gruppen, deren bunte Mannigfaltigkeit ich am gedachten Orte nur andeuten, nicht ausmalen konnte, gesellen sich die ideellen Besonderungen der Gesellschaftskreise. Es kann dem Blick wohl schwindeln, wenn sich ihm dieses Gewimmel des Einzellebens aufthut. Wie den deutschen Volksstämmen der Stempel der gesonderten Volkspersönlichkeiten schärfer eingeprägt ist, als den Gliedern irgend einer andern Nation Europa's, so geht auch die Sonderung der Gesellschaftsschichten bei uns noch am tiefsten. Aber zugleich besitzen wir auch den stärksten Hebel, unberechtigte sociale Schranken niederzuwerfen: die allgemeine Geistesbildung. Eine Nation von Dutzenden von Stämmen, Stätchen, und Gesellschaftsgruppen, und zugleich eine Nation von Gelehrten! Dieser Gegensatz bildet das Tragische im deutschen Nationalcharakter. Der auf die Spitze gestellte Widerstreit eines natürlichen, angestammten Sondergeistes mit einem uns nicht minder angeborenen Einigungstrieb hat unser sociales Leben zu dem interessantesten und lehrreichsten, zugleich aber auch zum kummervollsten gemacht. Es ist deutsche Art, die eigenen Schmerzen darüber zu vergessen, daß man an ihnen physiologische Studien über die Natur des Schmerzes macht. Die socialen Kämpfe werden bei uns am tiefsten ausgekämpft werden. Mag Frankreich den Ausgangspunkt kommender socialer Revolutionen bilden, Deutschland wird doch der Centralherd derselben werden, das Schlachtfeld, wo die Entscheidung geschlagen wird. Wir wollen jeden redlichen Streiter in diesem Kampfe ehren, nur soll man uns nicht wegläugnen, daß das letzte Recht für beide Parteien in der eigensten Art des deutschen Volkes wurzele: der sociale Sondergeist nicht minder als der sociale Einigungstrieb. Der Zug der Zeit wird bald den einen, bald den andern in den Vordergrund schieben, ausrotten wird er weder den einen noch den andern. Der unbefangene Staatsmann aber wird beiden ihr Recht zu wahren wissen. Die Vorrechte einzelner Stände sollen Corporationsrechte aller Stände werden. Ich sage Corporationsrechte; denn nur aus dem Individuellen keimt ein gesundes Leben. Diese vom modernen Staats- und Rechtsbewußtseyn wie von der Humanität gleicherweise geforderte Gleichheit herzustellen, nimmt der ausebnende Liberalismus die corporativen Rechte Allen weg. Ich möchte sie Allen geben, Jedem nach seiner Art, weil ich nicht bloß den Drang nach socialer Ausgleichung, sondern auch den Sondergeist im Volke erkenne und ehre.
Das entartete, übercivilisirte römische Alterthum am Vorabend seines Zerfalles konnte sich eines gründlichen Respectes vor den deutschen Barbaren nicht erwehren, als es wahrnahm, auf welche tief sittliche Grundlage das Familienleben bei diesem Volke gebaut war. Mit der im engen Kreise fest beschlossenen Familie haben wir unsere erste sittliche Ehre auf dem Schauplatze der Weltgeschichte eingelegt. Die Familie ist aber die oberste Voraussetzung der Gesellschaftsgruppe. In dem Idealbilde des mittelalterlichen deutschen Adels krystallisirte sich das Familienbewußtseyn zum Standesbewußtseyn. Die engere Gruppe der bürgerlichen Gesellschaft im Gegensatz zu dem fessellos in's weite schweifenden vereinsamten Individuum trägt bei uns die historische Weihe. Sie warb uns unsere erste Ehre, sie sollte uns billig auch unsere letzte werben.
Das genossenschaftliche Leben ist uralt beim deutschen Volke, aber eine Kaste hat es bei uns nie gegeben, wie bei den Orientalen, nicht einmal eine Priesterkaste. Auch eine politisch bevorzugte, herrschende Aristokratie gehört wenigstens nicht der Urzeit unserer Volksgeschichte an. Sondergeist und Einigungstrieb ergänzte sich in jenen grauen Tagen, wo die Sittentiefe deutschen Familienlebens den Römern Respect einflößte. Wie heute die allgemeine Bildung einigend wirkt, so wirkte dieß damals das Gemeingut der Volkspoesie in Sitte und Sage, Lied und Spruch. Merkwürdigerweise brachte just das Zeitalter des Zopfes, wo das sociale Bewußtseyn überhaupt am ärgsten getrübt, am tiefsten erschlafft war, die Fabel von einer altdeutschen »Bardenzunft« auf, welche die Volksdichtung standesmäßig in Pacht gehabt hätte. Höhere Bildung ist gewiß nicht jedermanns Sache; ihre Pflege füllt darum einen Beruf, nicht aber einen gesellschaftlichen Stand. Es mag uns als ein Wahrzeichen gelten, daß die Gelehrten gerade damals einen eigenen Stand, eine besondere Kraft usurpirten, als der gesunde korporative Geist am tiefsten in Deutschland gesunken war. Und am Ausgange des Mittelalters, wo sich das Ständewesen durchaus veräußerlicht hatte, thaten sich vollends sogar die Poeten zu einer wirklichen Zunft zusammen.
Ein anderes Wahrzeichen tröstlicherer Art möge dem gegenüberstehen. Es ist die der Gegenwart eigenthümliche Freude der höheren Stände an der Poesie und dem Gesang des gemeinen Mannes, am Volkslied. Sie ist ein sociales Phänomen, ein Triumph des Einigungstriebes der durch alle Stände geht, und des edelsten Sondergeistes gleicherweise. Für den Genius gibt es keine gesellschaftliche Schranke, im Gegentheil, er überbrückt dieselbe, wo er sie vorfindet, und der große moderne Doppelstand der Gebildeten und der Bildungslosen zieht sich als ein dicker Querstrich unbarmherzig mitten durch alle Standesgruppen. So beugt sich der vornehme Mann, indem er das arme kleine Lied des Bauern als ein köstliches Kleinod in den Schatz seiner Bildung aufnimmt, vor dem künstlerischen Genius im Volke. Der Volksgesang, der jetzt in allen Prunksälen heimisch wird, ist gleich einem Regenbogen des Friedens, der sich Über alle Stände spannt. Das Reale ist die gesellschaftliche Sonderung, das Ideale die Einigung. Dem gemeinen Mann, der im Schweiße seines Angesichtes sein Brod ißt, gab Gott, daß er singe, damit im Verständniß dieser schlichten Lieder die übersättigte vornehme Welt auch wieder einmal einfältig sich fühlen könne wie geringe Leute. Gemahnt dies nicht an das Wort der Schrift: »Und den Armen wird das Evangelium gepredigt?«
Drittes Kapitel.
Die Wissenschaft vom Volke als das Urkundenbuch der socialen Politik.
Das Studium des Volkes sollte aller Staatsweisheit Anfang seyn und nicht das Studium staatsrechtlicher Systeme. Die Staatsmänner früherer Jahrhunderte reichen gewiß durchschnittlich in gründlicher Schule den unsrigen das Wasser nicht, schauten aber alltäglich frischeren Auges in das leibhafte Volksleben und führten darum ihr Regiment mindestens mit einer praktischen Sicherheit, die jetzt gar selten geworden ist.
Die »Wissenschaft vom Volke« gehört zu den noch nicht existirenden Hülfszweigen der Staatswissenschaften. Ist das nicht seltsam? Das Volk ist der Stoff, an welchem das formbildende Talent des Politikers sich erproben, das Volksleben das natürliche Element, dem er als Künstler Maß und Ordnung setzen soll. Wie läßt sich da eine Wissenschaft der Politik denken, die nicht begönne mit der Naturgeschichte des Volkes? Es wird aber noch eine Zeit kommen, wo man auf den Universitäten Collegien lesen und im Staatsexamen Noten ertheilen wird über die »Wissenschaft vom Volke.«
In dem ersten Bande dieses Werkes habe ich Grundzüge und probeweise Ausführungen zu einer socialen Volkskunde von Deutschland zu geben versucht. Auf die sociale Volkskunde, die das Volk darzustellen hat nach seinen gesellschaftlichen Zuständen in der Begränzung eines bestimmten Landes, eines bestimmten Zeitraumes baut sich die wahre Gesellschaftswissenschaft erst auf. Die naturgeschichtliche Beobachtung von Land und Leuten ist der Stein, den die Bauleute der theoretischen Construction so lange verworfen hatten, den aber die Gegenwart wieder zum Eckstein macht.
Mit einer oft wahrhaft komischen Leichtfertigkeit nimmt heutzutage jede Partei die Zustimmung des Volks für sich in Anspruch. Und doch besitzen von Hunderten, die also Berufung einlegen, gewiß nicht zehn eine weitere gründliche Kenntniß als von dem sie zunächst umgebenden winzigen Bruchtheil des Volkes. Das Studium des Volkes als einer socialen und politischen Persönlichkeit macht sich nicht so im Vorübergehen; es fordert die volle Forscherkraft eines ganzen Menschenlebens.
Wo sind die Organe des Volkes? Die Tagespresse ist nur das Organ eines beschränkten Theiles desselben, wenn wir recht weit greifen wollen, der gebildeten Schicht. Die Kammern sprechen noch viel weniger das in's Individuelle gezeichnete Charakterbild des Volkslebens aus, denn die Abgeordneten gerade der originellsten und interessantesten Volksgruppen, der unteren Schichten, sprechen in der Regel gar nichts. Nur durch förmliche unermüdliche Entdeckungsreisen unter allen Classen des Volkes, durch ein immer waches Auge für all die kleinen Wahrzeichen, welche im täglichen Leben, in jeder Regung einer öffentlichen Meinung hervorbrechen, wird man allmählig auf den Grund gehende Resultate über die bürgerliche und politische Natur bestimmter Volksgruppen zu gewinnen im Stande seyn.
Clemens Brentano hat ein wunderschönes Wort gesprochen von den Mysterien des Naturlebens, die nur dann den Wanderer »befreundet anschauen,« wenn er überall hin ehrfurchtsvolle Hingabe mitbringt. Und der Dichter sagt von sich:
»Weil ich alles Leben ehre, Scheuen mich die Geister nicht!«
So schauen uns auch die Mysterien des Volkslebens nur dann befreundet an und seine Geister scheuen uns nicht, wenn wir alles Leben ehren. Ein Jeglicher will aber gemeiniglich nur das Leben im Volke ehren, was in die fertige Form seiner vorgefaßten Schulsätze paßt, darum fliehen ihn die Geister, und Famulus Wagner sieht nichts als einen großen Pudel.
Ist es nichts auffallend, daß die demokratische Partei, welche doch das »Volk« am meisten im Munde führt und den allgemeinen Begriff des Volkes mit Wucherzinsen ausbeutet, in ihrer Presse so wenig thut, das Volks- und Gesellschaftsleben in seinen Einzelzügen zu durchforschen? Ueber ihrer Theorie vom Volke sind ihr die Thatsachen des Volkslebens abhanden gekommen. Darum sind unsere Bildungsdilettanten viel besser aufgelegt für die demokratische Lehre, als der ungebildete gemeine Mann. Im Gegensatz zu dieser schulgerechten Demokratie, die so wenig auf wahre Volkssympathien rechnen kann als der schulgelehrte Konstitutionelle oder Absolutist, bleibt es ein großer Ruhm der engeren Fraction der sogenannten Social-Demokraten, daß sie auf die Enthüllung der Zustände einer wenigstens vereinzelten Gesellschaftsgruppe mit der begeisterten Liebe des Forschers eingegangen sind. Daher auch ihre praktischen Erfolge. Die Social-Demokraten blieben freilich in der Einseitigkeit stecken, daß sie die verhältnißmäßig kleine Schicht des städtischen und Fabriken-Proletariates als gleichbedeutend mit der Gesammtheit der »arbeitenden Classen« oder wohl gar des »Volkes« nahmen. Auch sie vermochten es nicht, alles Leben zu ehren. Aber sie gaben doch unzweifelhaft den Anstoß, daß über die sociale Natur dieser einzelnen Proletariergruppe weit umfassendere Aufschlüsse zu Tage gefördert wurden, als über fast irgend ein anderes Glied der Gesellschaft. Durch die umfangreiche Polemik, welche sie hier angeregt, geschah es, daß wir auf diesem einzelnen Punkte fast ausschließlich genügenden Stoff zu einem Capitel der Wissenschaft vom Volke vorbereitet finden.
Um so mehr ist es aber zu verwundern, daß die Social-Demokraten, da sie doch ein bestimmtes Bruchstück der Gesellschaft in seiner Besonderheit studirt haben, als beispielsweise das Pariser Arbeiterproletariat, nun eine Theorie entwickeln, welche stillschweigend für diese kleine Gruppe der Pariser Proletarier die Gesellschaft von ganz Europa, ja des ganzen Erdballes unterschiebt. So gaben sie die beste Frucht ihrer Erforschung der bestimmten Volkspersönlichkeit der Proletarier, die doch nur im Gegensatz zu anderen individuellen Gebilden der Gesellschaft sich selbständig abhebt, freiwillig wieder verloren. Je tiefer man in die Einzelkenntniß der Gesellschaft eindringt, desto mehr wird man erkennen, daß eine sociale Politik, welche für alle gesitteten Völker gelten soll, ein Widerspruch in sich selber ist. Die deutschen Gesellschaftszustände sind ganz andere als die französischen, die englischen etc., das Volk ist in allen Stücken individuell.
Aus dem Individuellen heraus, auf der Grundlage der Wissenschaft vom Volke, muß die sociale Politik aufgebaut werden. Jede gesellschaftliche Reform hat nur dann für uns einen Werth, wenn sie die natürliche Frische und Eigenart des Volkslebens nicht antastet. Denn diese Eigenart bedingt die Kraft des Volkes. Bei den höheren Ständen zeigte es die neuere Zeit eindringlich genug, wie die sociale, und sittliche Erschlaffung mit dem Verblassen der Originalität Hand in Hand geht. Die bäuerlichsten Bauern, die bürgerlichsten Bürger, die wahrhaft adeligen Edelleute sind auch immer die Tüchtigsten gewesen. Ihr klagt, daß die ganzen Männer, die originellen Naturen, deren es zu unserer Väter Zeit noch weit mehr gab, im Aussterben begriffen sind! Aber solche Naturen erhalten sich nur bei gewissen festgeschlossenen, socialen Gruppen. Wer den Ständen ihre Originalität abschleifen will, der muß auch auf die Originalität bei den einzelnen Charakteren Verzicht leisten. Und doch sind diese bereits halbwegs ausgestorbenen Originalfiguren von jeher die wahren Flügelmänner der gediegenen Ehren und guten Sitten gewesen in den breiten Frontreihen der bürgerlichen Gesellschaft.
Ich habe in diesem Buche kein sociales System aufstellen, keine neue oder alte Lehre der socialen Politik. Ich bescheide mich, anspruchslose Beiträge zusammenzureihen zur Wissenschaft vom Volke als dem Quellenbuche aller ächten Staatskunst. Die Zustände der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland sind dabei fast ausschließlich in Betracht gezogen worden; denn auch für das sociale Leben gilt die Schranke der Nationalität. Aus dem Kleinen, Beschränkten und Einzelsten heraus arbeitend, möchte ich in einer möglichst großen Fülle von