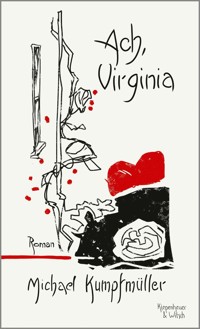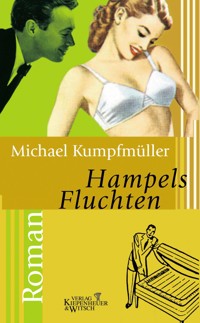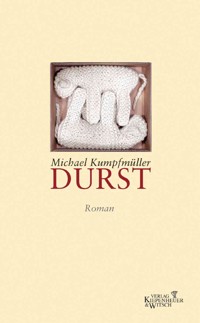
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Töten, ohne Hand anzulegen: Nach Motiven eines authentischen Falles erzählt Michael Kumpfmüller von einer ungeheuerlichen Tat. In der Hitze des Hochsommers, als selbst die Grünflächen in ihrer Wohnsiedlung versteppen, versucht eine junge Frau, aus ihrem Leben zu fliehen. Sie packt einen Rucksack und macht sich davon. Zurück bleiben ihre beiden kleinen Kinder und ein paar Päckchen Saft. Die Frau will nicht lange fortbleiben, und obwohl sie nicht weit kommt, findet sie nicht mehr zurück. In seinem zweiten Roman lässt sich Michael Kumpfmüller auf ein Thema ein, vor dem sich die Gesellschaft mit Abscheu und Dämonisierung schützt: eine Mutter, die tötet. Die Frage nach dem Naheliegenden leitet die Erzählung: Was, um alles in der Welt, treibt diese Frau, während in ihrer Wohnung das Entsetzliche geschieht? Mit kühlem, niemals anklagendem Blick begleitet Michael Kumpfmüller seine Figur dreizehn schwere Tage lang. In einer klaren, protokollartigen Sprache beschreibt er ihre ziellosen Wege, ihre ruppigen Liebschaften und ihre Einkaufstouren, die sie auch in Spielwarenabteilungen zu den Kuscheltieren führen. Und wie an unsichtbaren Fäden zieht es sie immer wieder in die Nähe ihrer Wohnung. Tag für Tag setzt sie neu an, doch sie ist zu schwach, um heimzukehren. Schichtweise wird ihr mörderisches Versagen freigelegt, und wir ahnen voller Unbehagen, dass es mit Schwäche und Angst viel mehr zu tun hat als mit seelischen Defekten. Michael Kumpfmüller beweist mit diesem Buch, wozu die Literatur im besten Fall im Stande ist – Erkenntnis zu schaffen abseits von schieren Fakten und Psychologie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Ähnliche
Inhalt
CoverTitelZitatKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13BuchAutorLesetippsImpressum[Menü]
Zitat
Alle Buchstaben und Zahlen sind hier, alle Farben des Spektrums, alle Stimmen und Geräusche, alle Schlüsselworte und zeremoniellen Floskeln. Es ist nur eine Frage des Entzifferns, des neu Ordnens, des Abschälens der Schichten von Unaussprechlichem.
[Menü]
1
◊MITTWOCH◊ Eines Tages im Sommer um die Mittagszeit, als es schon sehr heiß war, wusch sich eine junge Frau über dem Waschbecken die Haare und dachte über ihr Leben nach. Sie schaute sich das Leben an, wie es geworden war, auch die Gründe, dass sich alles von Grund auf ändern musste, sie wusste nur nicht, wie. Sie war früh aufgestanden und hatte die Kinder versorgt; die Kinder waren im Hof und spielten. In der Nacht hatte sie bei offenem Fenster nur wenig geschlafen, schwitzend und immer knapp unter der Oberfläche ihrer Erschöpfung, matt, aber auch zornig, der ganze Körper überzogen mit einem langsam verkrustenden Glanz. Sie war ein bisschen weich für ihr Alter, ein Gesicht ohne genaue Erfahrung, die hellen Haare sehr fein, aber an den Spitzen brüchig und wie vergilbt, als lebte sie seit Jahren in Wind und Hitze, in der Nähe salziger Gewässer. Manchmal achtete sie ganze Wochen kaum auf sich, merkte ihre Gerüche nicht oder betrachtete sie wie teure Stoffe, die sie kleideten, und wusste von den Männern, wie sie die Fährte immer gleich aufnahmen, als müssten sie ihr bloß folgen, kämen an ein Ziel, das sich lohnte. Sie trocknete sich das Haar und ging zum Fenster, sah unten im Hof die Kinder: Hinten bei den Mülltonnen stritten sie um eine sinnlose Beute, mitten auf den versteppten Wiesen, über die gerade ein Wind zog, über die weite fahle Steppe, in die sie Vorjahren gefallen war. Die Frau versuchte, sich etwas zu wünschen. Eine Weile stand sie am Fenster und schaute, lauschte, aber mehr nach innen als nach außen, wo es für ein paar Augenblicke totenstill war, doch auch drinnen war es vorläufig ganz still, die Geräusche ihrer Seele wie unter Glas, mehr gedämpft als wirklich erstickt; es fielen ihr auf Anhieb keine Wünsche ein.
Der Sommer hatte gerade erst begonnen. Sie spürte, wie etwas sie anfasste, nackt und nichtswürdig, wie sie war. Vielleicht hatte es schon vor Tagen begonnen, mit diesem Licht, das so hell war wie eine lang ersehnte Wut, der Beginn des Aufstands. Die Frau hatte böse Gedanken. Etwas Leuchtendes hatten die bösen Gedanken, deshalb schaute sie immer wieder dort hin. Der dicke Albert fiel ihr ein, dass er immer lachte, wenn er gemein gewesen war, von seinen Gemeinheiten lebte er. War man böse, wenn man gemein war? Jemanden vergessen, nicht an ihn denken, obwohl man könnte: Das war böse. Etwas kaputtmachen, obwohl man weiß, der andere hängt daran. Ein Mord war böse, eine Vergewaltigung; einen Geschlagenen schlagen, vielleicht. Kam darauf an. Auch bei einem Mord kam es darauf an; niemand hatte Erfahrungen damit. Jemanden totschlagen, einfach so kaputtmachen wie ein Ding, das man mit den Füßen wegkickt, mit einem Messer totschneiden oder verletzen, wer weiß. Im Grunde konnte sie sich das nicht vorstellen. Sie wusste, der dicke Albert hatte mit Tieren manchmal etwas gemacht, da war sie nicht dabei gewesen, im letzten Winter, als er einem Hund die Augen, mit einem Messer angeblich die Augen bei lebendigem Leib. Die Frau hatte ihn lange anschauen müssen, später, als die Mädchen es erzählten. Sie war sich nicht sicher gewesen, ob man ihm etwas anmerkte, ob da eine Spur war in seinem Gesicht, ein Stolz, ein Erschrecken.
Die Frau ging in die Küche und trank ein Glas Wasser, kam zurück zum Fenster: Die Kinder saßen noch immer da, fast regungslos, wie Tiere, im Schatten eines großen Baums die verwilderte Brut, ihre beiden Söhne, drei und vier Jahre alt, die sie manchmal für Stunden verließ und die sie bei ihrer Rückkehr vielleicht nicht immer gleich erkannten. Sie sah, was alles war, wollte es verwerfen, das, was man so leicht nicht loswurde: Geschichten von früher, die widerspenstigen Dinge, die sich um sie herum zu Landschaften türmten, verstreute Spielsachen, die Schuhe, Kleider, Windeln, der Müll und der Schmutz der unverbundenen Tage, die heiligen Dinge der Männer, wenn sie ihr etwas hinterließen. Wie ein Fluch waren die Dinge und wie ein Trost. Sie dachte an die Momente, in denen sie stumm war wie ein Ding, ihre Stummheit als Geliebte oder in der Küche beim Essen mit den Kindern, wenn sie sich bei laufendem Radio versteckte und auf ihre Fragen lange nicht antwortete: als hätten sie auf nähere Bekanntschaft mit ihr kein Recht. Sie versuchte sich vorzustellen, wie das wäre, wenn sie tot wäre, wie dann alle anderen noch immer lebten, auch die Kinder. Sie flüsterte. Beim Denken hatte sie die ganze Zeit geflüstert, wie bei einem nächtlichen Geständnis, ohne genaue Absicht, als würde sie etwas suchen, eines Tages, wenn sie endlich wüsste, wer sie war.
Sie ging vom Fenster weg und war einen Augenblick unschlüssig, ob sie wirklich gehen sollte, suchte endlich die Schlüssel und fand sie auch, verließ die Wohnung. Das Nachmittagslicht war gleißend und von einer Wucht, dass sie sich duckte. Sie hörte die Stimmen der Kinder, fern und beruhigend, drüben bei den hinteren Sandkästen saßen sie und gaben sich erstaunt, dass sie gekommen war; sie wandten sich gleich ab, versunken in ihre Beschäftigungen. Obwohl sie alles sah, konnte die Frau den Sinn ihrer Beschäftigung auf Anhieb nicht begreifen, nur irgendwelche Grabungen sah sie, einen verqueren Handel mit Stöcken und Blättern, zu kostbaren Steinen geschliffene Glasscherben, Müll aus Plastik, verschiedene Deckel und Verschlüsse, aber auch Insekten, Käfer und Ameisen, die sie getötet hatten oder in gläserne oder metallene Gefängnisse sperrten, in ein paar alte Flaschen, eine leere Dose von Nivea. Sie versuchte sich zu erinnern, wie sie selbst als Kind gespielt hatte; sie konnte sich an nichts erinnern. Sie sah sich als Kind in diesem Sand und dann noch einmal jetzt, als Frau, wie sie da stand und von ihren Kindern nicht mehr begriff als von irgendwelchen Bälgern, als wären es wirklich Fremde, mit eigenen Bräuchen, Regeln, ihren Gewohnheiten, hier in dieser Wüste, in der sie lebten, als wär’s nur auf Abruf und als müssten sie eine wie sie verachten. Sie musste daran denken, wie sich das anfühlte, wenn sie selbst jemanden verachtete, und sie dachte über ihre Kinder: Wie hässlich sie sind, denn alles, was nicht von ihr war, erschien ihr auf einmal sehr hässlich.
Später würde sie sich an all das erinnern: Wie sie da stand und die Kinder betrachtete, als seien sie ihr zugelaufen, ohne die geringste Ahnung, welch unglaublichem Zufall sie ihr Leben verdankten, und dass sie es nur ihr verdankten, den beiden Männern, die sie geschwängert hatten, ihren Vätern, die sie nicht kannten. Alles in Ordnung?, fragte sie und wartete, ob da etwas käme; doch es kam nichts, nur Schweigen. Ich geh jetzt kurz weg, in einer Stunde bin ich zurück, seid brav. Da sah der Kleine sie an und wollte nicht, dass sie ging, stand auch gleich auf und wollte mit. Nicht weg, sagte er, und darauf sie: Es dauert nicht lang, bleib hier, ich kann euch nicht brauchen. Aus Erfahrung wusste sie, man durfte keine Zeit verlieren bei Abschieden, das machte alles nur noch schlimmer, deshalb wandte sich schnell ab, doch der Kleine folgte ihr, rief und wollte sich klammern. Sie machte sich los und beschimpfte ihn. Dann beschleunigte sie ihre Schritte, drehte sich auch gar nicht mehr um, hörte, wie er ihr folgte, merkte, wie er stürzte, an seinem neuen Schreien erkannte sie’s, der kurzen Stille, während er noch stutzte: als könne er den neuen Schmerz nicht glauben. Die Frau ging zurück und sah, er hatte ein blutendes Knie. Wieder beschimpfte sie ihn, nannte ihn ein dummes Kind, begann ihn widerwillig zu trösten. Nicht mal ein Taschentuch habe ich, sagte sie und bedeckte das Knie mit Küssen, verwischte mit ihrem Ärmel das Blut, bis es trocknete; der Ältere beobachtete es voller Staunen. So, sagte sie, nun können wir gehen, denn das wollt ihr doch. Ja ja, sagte der Ältere und begann zu plappern, plapperte etwas von seinem Knie, zeigte, wo sein Knie war, und ganz tief drinnen und unter der Haut war das Blut, nur wenn man sehr böse war wie der Bruder, kam es heraus und machte alles nass. Der Kleine schniefte. Sie versprach ihm etwas und zog ihn hinter sich her auf die Straße in Richtung Paradies.
Sie folgten den Blocks und schwiegen. Es war nicht schön, in dieser Hitze zu gehen. Die Kinder kamen nur schleppend hinterher; sie hätte ihnen nicht nachgeben sollen. Erst, als sie in der Ferne die Fahnen des Paradieses sah, entspannte sich die Frau. Wie immer schloss sie im ersten Moment die Augen, wie um ganz sicher zu sein, dass es wirklich da war und auf sie wartete, als war es überhaupt nur für sie. Sie wusste, es gab Dinge, die waren gar nicht da, obwohl man sie sah, dann waren es Spiegelungen in der Luft, oder weil man sich etwas sehr wünschte, auch deshalb nahm sie sich vor ihren Wünschen in Acht. Die Frau, vielleicht, weil sie noch sehr jung war, vertraute lieber ihren Sinnen. Sie wollte sich die Dinge nicht nur einbilden, ob etwas kalt war oder heiß, mit welcher Stimme einer zu ihr redete, wie er sie anfasste, wie er vorher roch und wie nachher: auf alles wollte sie sich verlassen. Das Paradies war nicht weit, ein verwinkelter Palast mit über dreißig Läden auf zwei Etagen, hell und licht, aber auch zweifelhaft, eine Zauberbude der einfältigen Wünsche, die kostbaren Dinge links und rechts gestapelt bis unter die Decken; man konnte fast alles mit Händen greifen. Angenehm kühl war es in den Passagen, zu dieser Stunde fast still. Sie kaufte etwas zu essen und zu trinken, für sich und die Kinder, war froh, dass sie da aß und trank und nur so für sich herumging, beim Herumgehen sich wappnete, die Kinder immer irgendwo in der Nähe. Sie sah ein paar CDs durch und fand nichts, probierte verschiedene Sommersandalen, versuchte die Dinge, die in Frage kamen, zu orten. Ein Lippenstift kam in Frage, irgendetwas Kleines, das man wie nebenbei in die Tasche fallen lassen konnte. Es war ganz leicht. Ein Kinderspiel. Auch diesmal war es ganz leicht.
Danach war sie wie immer aufgekratzt, zugleich erschöpft von der Erregung, wie nach der gelungenen Berührung eines Mannes, aber viel haltbarer, gültiger, weniger zweideutig, als es Berührungen waren. Die Kinder kamen und gingen, standen lange wie blöde vor allen möglichen Spielsachen, dann wieder liefen sie ihr ständig vor die Füße, wollten ihre Hand oder auf den Arm, zogen und zerrten, pressten ihr Geschenke ab, liefen mit ihren Geschenken weg und waren minutenlang nicht zu sehen. Sie hatte ihnen ein Eis versprochen. Ja, ein Eis, sagte der Jüngere und wollte wieder auf ihren Arm. Na komm, sagte sie, und das Kind noch einmal: Arm, bis sie es endlich nahm und trug; das Kind war federleicht. Da, sagte das Kind und zeigte auf etwas, bis der Ältere erklärte, was es war, er sagte es ganz falsch: ein Wuftballon. Ich auch Eis, sagte er, während der Kleine nur immer schaute, den Dingen einen Namen gab oder sie nach Namen fragte, die neuen Worte gleich probierte, eins nach dem anderen. Es wäre ganz leicht, dachte die Frau und sah ihren Kindern zu, wie sie sich mit kleinen bunten Plastiklöffeln das Eis in den Mund schoben, nicht immer richtig trafen, aber beharrlich das Eis und den Löffel und die Frau im Blick behielten, ihr von Zeit zu Zeit klebrige Hände entgegenhielten, oder wenn etwas danebenging, ein Tropfen Eis auf der Hose, dann musste sie ihnen das abwischen. Sie wusste nicht, was reden, aber es war auch gar nicht nötig, die Kinder waren auf ihre Gedanken nicht neugierig. Ich könnte einfach aufstehen und gehen, dachte die Frau. Ich könnte sagen: Kommt, wir müssen los, ich zeig euch was, und dann, nach Einbruch der Dunkelheit, wie Albert seine Hunde, werfe ich die Brut in den Fluss. Sie wusste, dass sie das nicht könnte. Vielleicht könnte sie es. Sie wüsste gar nicht, wen zuerst. Sie wüsste noch nicht mal eine Stelle. Auf hohen Brücken schwindelte ihr. Waren Kinder in den ersten Jahren nicht wie Fische? Am Ende ertranken sie gar nicht, schwammen einfach weg und tauchten, für Minuten unter Wasser bis ans andere Ufer, wo sie eine Weile nicht wüssten, schlotternd vor Kälte, aber entschlossen, für alle Zeiten unverwundbar.
Der Vierjährige war inzwischen fertig. Hast du genug, fragte die Frau, und darauf er: Nein mehr, ich will mehr. Der Jüngere, der noch beschäftigt war, bezog die Frage auf sich und versuchte zu antworten; die Antwort war ganz unverständlich. Bauch, verstand sie, das Wort Eis kam vor. Ich versteh dich nicht, red deutlich, was willst du, warum weinst du, denn jetzt begann der Kleine zu weinen, zornig, weil man ihn nicht verstand, warf seinen Körper im Zorn wieder und wieder nach hinten, weit über die Lehne. Da hatte die Frau Mitleid. Du dummes Kind, sagte sie und war ratlos, doch dann auf einmal verstand sie, begriff, was es hatte sagen wollen, das Eis in meinem Bauch, schau, ich bin satt, nicht mehr. Sie sagte dem Kind, dass sie verstanden hatte, das Kind beruhigte sich. Der Ältere bestand auf einem zweiten Eis; sie bestellte es ihm. Dann bezahlte sie. Etwas strenger, ungehaltener wurden jetzt ihr Ton, ihre Handlungen; sie verlor die Geduld. Wollte nicht warten, bis die beiden von selbst aus ihren Stühlen kletterten, sondern zerrte sie da weg, schleifte sie mit, machte viel zu große Schritte. Ihr fiel ein, dass sie noch etwas zu essen brauchten, und machte mit ihnen die Einkäufe. Etwas Milch, ein paar Tetrapacks Orangensaft, dazu zwei Kindermilchschnitten, vier Minisalamis und einen Nudelsnack mit Tomaten für den Abend. Als sie an der Kasse stand, hörte man von draußen Sirenen, die Kinder waren gleich außer sich und riefen: Polizei Polizei, Tatütata Polizei. Die Frau dachte: wie Automaten. Denn das kannte sie schon, dass sich ihnen die Wunder immer wiederholten und mit jeder Wiederholung nur immer kostbarer und zugleich vertrauter wurden: als bestünde die ganze Welt aus Wundern. Da, da, rief der Ältere und war sehr ungeduldig, weil es doch möglich war, dass sie einen Streifenwagen verpassten oder eine Feuerwehr, zog sie gleich fort in Richtung Ausgang, denn da wollte er hin. Langsam, sagte die Frau und ließ die beiden gehen, sah sie laufen, Hand in Hand, bis nach draußen vor die Tür des Einkaufszentrums, wo sie nun standen und schauten und sie in ihrem Eifer vergaßen.
So weit folgte sie ihnen, dass sie sehen konnte, wie sie hofften, das Blaulicht käme bald wieder, oder ein neues sollte kommen, an dieser Hoffnung hielten sie lange fest. Sie hätte sich zu ihnen stellen können, aber stattdessen ging sie an ihnen vorbei in Richtung Diskothek und beobachtete sie von dort. Sie wollte sehen, was geschähe, wenn sie sie nicht fänden. Doch lange geschah überhaupt nichts; sie vermissten sie nicht. Erst nach Minuten drehte sich der Kleine hin und wieder um und suchte nach ihr, hatte aber den Bruder und die Hoffnung auf ein neues Blaulicht, die ihnen nicht vergehen wollte, dann endlich verging sie. Erst jetzt suchte auch der Ältere, begann nach ihr zu rufen, sorglos, dann allmählich mit einem Ton zunehmender Beunruhigung. Wie angewurzelt standen sie beide da und riefen in alle Richtungen, drehten sich mehrmals um die eigene Achse, wie Tanzende. Seltsam fand sie, dass der Große zuerst weinte, anstatt einfach nach ihr zu suchen, denn er hätte sie ja suchen können mit seinen vier Jahren, aber er weinte nur. Ein älterer Mann ging zu ihnen hin und fragte etwas, darauf schüttelten sie den Kopf. Auch der Mann schüttelte den Kopf, aber so, als wäre er böse auf die Verlassenen, er ging gleich weiter. Die Frau mit den beiden Söhnen dachte: Wenn der Kleine weint, gehe ich hin, hoffentlich weint er gleich. Doch der Kleine stand einfach nur da und begann nun sogar zu lachen, machte dem Bruder einen Vorschlag für ein Spiel, jedenfalls begannen sie beide auf einmal zu spielen, bewarfen sich mit Gras, das sie aus der Erde rissen: als wären sie wirklich unverwundbar.
Die Frau ging ein Stück weiter, bis sie ihre Kinder nicht mehr sah. Noch einmal sagte sie sich: Es wäre so leicht. Wenn ich es könnte, wäre es ganz leicht. In die Straßenbahn setzen, zum Bahnhof fahren, in einen Zug steigen, aus und vorbei. Leider konnte sie es nicht. Aber jetzt rannte sie. Erst ein paar Straßen weiter bemerkte sie, dass sie gerannt war, ganz außer Atem war sie, also war sie richtig gerannt und geflohen: als wären die Kinder ihre Feinde. Sie war erleichtert, als sie wieder denken konnte, dass das doch keine Feinde waren: ihre beiden Kinder, drei und vier Jahre alt. Trotzdem war sie froh, ihnen entkommen zu sein, rief von einer Telefonzelle eine Freundin an und überfiel sie mit einer Folge von atemlosen Sätzen. Die Freundin hatte leider Besuch. Den von neulich, den Schmalen? Ja, ganz süß sei der, sie könne jetzt leider nicht sprechen. Das verstand die Frau und beneidete die Freundin, dass sie einen wie den Schmalen im Zimmer hatte. Sie fragte sich, ob sie gerne tauschen würde mit der Freundin, und kam zu dem Schluss, dass sie mit ihr nicht tauschen wollte. So ein Leben kannte die Frau gar nicht, dass sie es hätte mit ihrem tauschen wollen, da musste sie sich schon eins erfinden, weit weg musste sie sich denken, mindestens in die nächste Stadt, wo es andere Häuser gab und andere Zimmer in diesen anderen Häusern, andere Bewohner. Die Frau dachte kurz an die Städte, die sie kannte, die Zimmer in diesen paar Städten, in denen sie gewesen war, und da wusste sie gleich, dass man da nicht wieder hin musste, also dahin ganz sicher nicht.
Mit den Kindern war es seltsam. Obwohl sie fast gar nicht an sie dachte, musste sie sich doch bemühen, so wenig wie möglich an sie zu denken, also waren sie im Grunde noch immer da. Darüber ärgerte sie sich. Sie fand, die Kinder hatten jetzt kein Recht, sich in ihren Gedanken aufzuhalten, trotzdem nahmen sie sich’s, selbst wenn man ihnen befahl: Geht weg, ich will euch nicht; sie blieben. Eben das hatte aber ihre Strafe sein sollen: Dass man so tat, als hätten sie ein Recht, und dann ganz plötzlich ließ man sie stehen und zerstörte ihnen den Glauben. Die Frau dachte: Es wird ihnen eine Lehre sein. Dann wieder: Sie sind zu dumm, sie begreifen nichts, ihr Glauben ist unzerstörbar. Ich muss nach Hause, dachte sie, es hat keinen Zweck, und wollte nach Hause. Sie ging den Weg zurück, den sie gegangen war; die Kinder waren nicht mehr da. Ihre Bewegungen bekamen etwas Fahriges. Hastig suchte sie die Gegend um den Eingang ab, ging zurück in die Passage, suchte in den Geschäften, in denen sie gewesen waren, fragte in der Zoohandlung. Ja, in der Zoohandlung hatte man vor kurzem zwei Kinder gesehen. Sie schöpfte Hoffnung, suchte weiter und fand sie endlich bei den Blumen. Fast war sie enttäuscht, dass sie einfach da standen, als wäre nichts, als hätten sie an ihr Verschwinden nie geglaubt. Sie war noch nicht ganz bei ihnen, da drehte sich eines der Kinder um und entdeckte sie, winkte ihr zu, zufrieden, dass sie wieder da war, so konnten sie endlich nach Haus. Was lauft ihr einfach weg, das dürft ihr nicht, sagte die Frau und sah für einen Moment, wie die Kinder sahen, nebeneinander vier große Eimer Sonnenblumen, eine neue Lieferung, die Blumenverkäuferin hatte Mühe, die Blumen auf die vier Eimer zu verteilen. Der Ältere fragte: Mama, darf die Frau die Blumen essen, und da musste sie auf einmal sehr lachen, über sich und die Kinder, dass sie so dumm waren, wie es eigentlich kam, dass sie wussten, zu wem sie gehörten, ob sie es wollte oder nicht.
Auf dem Weg nach Haus im Gehen probierte sie den Lippenstift. Sie merkte, wie ein Mann sie dabei beobachtete, mit einem missbilligenden Staunen, als täte sie mitten unter all diesen Leuten etwas Ungehöriges, aber auch anerkennend, so, als wüsste er ein für alle Mal über sie Bescheid. Sie brachte die Einkäufe nach oben in die Wohnung, die Kinder ließ sie im Hof. Erst eine Stunde später ging sie die beiden holen. Die Sonne stand noch immer ziemlich hoch, deshalb begann sie sofort zu schwitzen, im Schatten eines mit bunten Schriften übersäten Durchgangs ruhte sie sich aus. Sie hörte die Stimmen der Kinder, rief sie ein paar Mal beim Namen, da wollten sie wie immer nicht kommen, wollten, dass man sie fände, waren wie immer nicht bereit. Sie sah, der Jüngere hatte von der Sonne ein ganz rotes Gesicht, der Ältere war schon ein bisschen braun, eine neue Windel brauchten sie, sie wollten es beide lange nicht einsehen. Erst als sie laut wurde, setzten sie sich Bewegung. Sie nahm zwei Stöcke und trieb sie wie eine Herde über die weite Steppe nach Hause in die Wohnung. Sie setzte sie in die Wanne und wusch ihnen Haare und Körper, gab ihnen zu essen und noch einmal zu trinken, brachte sie lange vor Einbruch der Dunkelheit ins Bett.
Als sie endlich schliefen, prüfte sich die Frau. Sie war ganz ruhig und fühlte sich fast versöhnt, als hätte sie sich nur durch diesen einen Nachmittag verändert, oder als sei sie da auf einer Spur, von der sie noch nicht wusste, ob es sich lohnte, ihr zu folgen. Sie rief noch einmal die Freundin an; die Freundin ging nicht ans Telefon. Ihre Mutter, als sie anrief, wurde von ihr gleich abgefertigt; sie wollte mit der nicht reden. Sie wäre am liebsten wieder los und mit den anderen um die Blöcke gezogen. Die Kinder schliefen. Es waren ungewöhnlich heiße Tage. Sie ging in das Zimmer, wo sie lagen, und schlug die Decken zurück. Später stellte sie ihnen den abgepackten Orangensaft auf den Tisch und die Milch und das Essen. Sie sollten nicht erschrecken, wenn sie nachts aufwachten und etwas brauchten, oder morgen früh, falls sie noch nicht zurück war, weil der kleine dicke Holzfäller wieder einmal etwas mit ihr angestellt hatte. Sie rief ihn gleich an; der böse Albert war nicht da. Sie schwankte. Sie fand, sie hatte ein Recht auf ein paar Stunden. Hätte sie erst einmal diese paar Stunden, würde sie es nachher leichter ertragen, dass es nur immer diese paar Stunden waren. Sie schaltete den Fernseher ein und hatte nicht die geringste Ahnung, bei wem sie bleiben könnte. Sie war noch jung, Anfang zwanzig, das Leben würde ihr eines Tages schon noch gefallen. Wie eine weite flache Landschaft lag es vor ihr, unterbrochen von ein paar Hügelketten, das Gebirge sehr fern am Horizont, wo es gerade dämmerte, milchig und verschwommen das Licht, sehr friedlich.
[Menü]
2
◊DONNERSTAG◊ An einem Donnerstag früh am Morgen erwachte eine junge Frau von einer Bewegung in ihrer Nähe, irgendwo in den tieferen Schichten ihres Schlafes von einem Geräusch, dem Tuscheln ihrer beiden Söhne, drei und vier Jahre alt. Sie standen vor ihrem Bett und wollten, dass sie sich kümmerte. Die Frau war in der Nacht mehrfach aufgestanden, weil sie im Schlaf schrien oder durstig waren, trotzdem blieb sie im ersten Moment ganz ruhig, schickte sie weg zum Spielen, sie müsse noch ein bisschen schlafen, stand kurz auf und schloss die Tür, verschärfte, als sie kurz darauf wiederkamen, den Ton, versuchte es ihnen zu erklären, nur eine halbe Stunde. Die Kinder gingen zurück in ihr Zimmer. Eine Zeit lag sie wach und lauschte, konnte aber nicht einschlafen, dann, als es ihr beinahe gelang, hörte sie in der Ferne, wie sie stritten. Sie wartete, ob sie sich von selbst beruhigten, und wusste, dass es nicht möglich war. Endlich kam der Kleine und stand heulend in der Tür, sie sollte ihm gegen den Großen helfen. Gereizt, aber nach außen freundlich, begann sie ihn zu trösten, nahm den Kleinen auf den Arm und brachte ihn zurück zu seinem Bruder. Sie wollte gar nicht wissen, was gewesen war. Sie gab den beiden zu trinken und ein paar Kekse, schaltete den Fernseher ein, ermahnte erst den Großen, dann den Kleinen, sie wolle in der nächsten halben Stunde absolut nichts hören. Habt ihr verstanden? Ich muss jetzt schlafen. Lasst mich verdammt noch mal schlafen. Dann ging sie zurück in ihr Bett und war hellwach, obwohl nun alles ganz still war, nur in ihrem Inneren, weil sie schon ganz zermürbt war, begann etwas zu toben und zu rasen und erfüllte sie binnen Minuten mit einer Wut, sehr hell und sehr alt. Sie dachte: Wenn sie jetzt kommen, brülle ich sie an, dann schlage ich sie windelweich, und tatsächlich wartete sie jetzt ganz ungeduldig, dass sie kämen, mit der ganzen Wucht ihres Hasses unter den beiden Kissen, mit denen sie sich vergeblich vor ihnen schützte und noch einmal hoffte, dass der Schlaf zurückkäme, aber er kam nicht.
Wütend über den verpfuschten Anfang stand sie endlich auf und suchte nach einem Ventil. Sie begann die beiden zu beschimpfen, obwohl sie ganz friedlich vor dem Fernseher saßen, zerrte sie vom Fernseher weg ins Bad zum Wickeln, weil sie stanken, legte sie aber nicht hin, sondern riss ihnen im Stehen alles vom Leib, die viel zu kleinen Schlafanzüge, die schmutzigen Windeln, mit absichtlich rohen Bewegungen, begleitet von ihren bösen Reden. O Mann, bin ich müde, ihr habt ja keine Ahnung, wie müde ich bin, wie ich das alles hasse. Die Kinder ließen alles über sich ergehen, wie eine gerechte Strafe oder ein vorübergehendes Wetter, auch als sie sich hinkniete und einen nach dem anderen schüttelte, als wären sie ganz dumm oder taub. Das aber brachte sie noch mehr auf, dass sie alles längst kannten und sich nicht wirklich fürchteten, auch als sie die frischen Windeln nicht gleich fand und wusste, sie waren in irgendwelchen Haufen, drüben in ihrem Zimmer, weil sie sich immer alles nahmen und es dann vergaßen, als wäre alles nur für sie. Noch einmal brüllte sie die beiden an, schubste sie ungeduldig weg in Richtung Küche und fragte, ob sie Hunger hatten, ganz nackt und ohne Windel, wie sie waren. Wollt ihr oder wollt ihr nicht. Ja, Milch, sagte der Kleine; der Große wollte Tee. Wieder wurde sie sehr grob, setzte sie auf ihre Stühlchen, dort sollten sie warten und keinen Mucks machen, sie habe für heute genug. Kinder, bitte, sagte sie, weil sie fühlte, dass sie auf einmal ganz schwach war, doch die Kinder stiegen von ihren Stühlchen wieder herunter und wollten auf sie nicht hören. Sie liefen aus der Küche ins Bad und wieder zurück, ihr immer zwischen den Beinen, vier oder fünf Mal, als wäre sie gar nicht da.
Sie machte sich eine Tasse Kaffee und saß ein paar Minuten am Tisch, war froh, dass sie lange nicht kamen und spielten, zwischen den Bergen von Wäsche, den vergessenen Dingen, irgendeines ihrer dummen Spiele. Sie setzte Wasser für den Tee auf, holte einen Topf für die Milch; die Milch war aus. Sie strich zwei Brote mit Marmelade und dachte an den Tag, der vor ihr lag, die langen Stunden, wenn sie nicht wusste, was mit ihnen anfangen, wie sie die beiden los würde. Die Kinder, als sie kamen, wollten ihre Getränke. Milch, Milch, sagte der Kleine, und der Ältere: Tee, Tee, als wäre es wiederum ein Spiel, hin und her, wie in einem Duett, ich will Milch, ich will Tee. Die Frau sagte, dass es heute keine Milch gebe. Der Kleine beharrte darauf: Ich will Milch, ich will Milch. Sie versuchte es zu erklären: Die Milch ist aus. Wir können keine kaufen, es ist noch zu früh, am Nachmittag. Du bekommst einen Tee. Der Kleine wollte sich damit nicht zufrieden geben, er begann zu toben, warf sich auf den Boden und schrie, strampelte mit den Füßen, er wollte auf der Stelle die Milch. Noch einmal redete sie beruhigend auf ihn ein, beugte sich zu ihm herab und versprach, gleich nachher, wenn sie angezogen waren, würden sie die Milch kaufen, doch dann, als er nach ihr trat und sie bespuckte, begann sie ihn zu schlagen, mit der bloßen Hand ein paar Mal ins Gesicht. Sie war sehr wütend. Dabei dachte sie: Es fehlt nicht viel, und ich bringe ihn um, das kleine Miststück, ich werde es ihm zeigen. Sie hob das tobende Kind vom Boden auf und packte es, wusste für einen Moment nicht, was sie tat, brachte den Kleinen ins Kinderzimmer und warf ihn wie ein Bündel in sein Bett, ging schnell weg und sperrte ihn ein. Erst wenn er sich beruhigt hätte und dann zur Strafe noch lange nicht, würde sie ihn herauslassen.