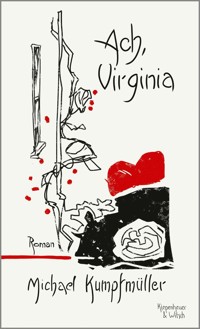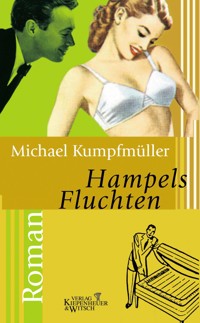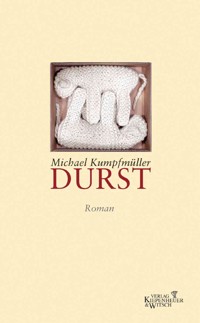19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Geist einer jungen Frau versucht einen Mord aufzuklären – ihren eigenen, um genau zu sein. Wer ist für ihren Tod verantwortlich? Als sie der Antwort näherkommt, merkt sie, dass es eine ganz andere Frage ist, die sie umtreibt. In den frühen Morgenstunden blickt Lilli auf einen leblosen Körper zu ihren Füßen. Nur langsam beginnt sie zu verstehen, dass es ihr eigener ist, der da zwischen den Bäumen des Stadtparks liegt. Während die Hinterbliebenen trauern und die Ermittler mit zunehmender Ratlosigkeit die Spuren sortieren, erhält sie Unterstützung von überraschender Seite. Andrä, ein ehemaliger Kommissar, der viele Jahre zuvor während eines Einsatzes starb, nimmt sich ihrer an. Behutsam navigiert er sie durch die Welt der Gespenster, die unserer erstaunlich ähnlich ist. Die Toten streiten, lieben und vergnügen sich, besprechen ihre Probleme in Selbsthilfegruppen und beobachten mit belustigter Verwunderung das Treiben der Lebenden. Dabei kommen Lilli und Andrä der Lösung des Falles nicht näher, einander aber schon. Als ein Junge, der den Täter gesehen haben will, überraschend stirbt und sich zu ihnen gesellt, gerät alles ins Rutschen. Luzide, melancholisch und heiter zugleich erzählt Michael Kumpfmüller von der Schönheit und Zerbrechlichkeit des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Ähnliche
Michael Kumpfmüller
Wir Gespenster
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Michael Kumpfmüller
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Michael Kumpfmüller
Michael Kumpfmüller, geboren 1961 in München, lebt als freier Autor in Berlin. Im Jahr 2000 erschien mit dem gefeierten Roman »Hampels Fluchten« seine erste literarische Veröffentlichung, 2003 sein zweiter Roman »Durst« und 2008 »Nachricht an alle«, für den er vor dem Erscheinen mit dem Döblin-Preis ausgezeichnet wurde. »Die Herrlichkeit des Lebens« wurde 2011 zum Bestseller und von der literarischen Kritik hochgelobt. Mittlerweile ist der Roman in 27 Sprachen übersetzt und 2024 unter der Regie von Georg Maas und Judith Kaufmann verfilmt worden. Zuletzt erschienen bei Kiepenheuer & Witsch die Romane »Tage mit Ora« (2018), »Ach, Virginia« (2020) und »Mischa und der Meister« (2022).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Der Geist einer jungen Frau versucht einen Mord aufzuklären – ihren eigenen, um genau zu sein. Wer ist für ihren Tod verantwortlich? Als sie der Antwort näherkommt, merkt sie, dass es eine ganz andere Frage ist, die sie umtreibt.
In den frühen Morgenstunden blickt Lilli auf einen leblosen Körper zu ihren Füßen. Nur langsam beginnt sie zu verstehen, dass es ihr eigener ist, der da zwischen den Bäumen des Stadtparks liegt. Während die Hinterbliebenen trauern und die Ermittler mit zunehmender Ratlosigkeit die Spuren sortieren, erhält sie Unterstützung von überraschender Seite. Andrä, ein ehemaliger Kommissar, der viele Jahre zuvor während eines Einsatzes starb, nimmt sich ihrer an.
Behutsam navigiert er sie durch die Welt der Gespenster, die unserer erstaunlich ähnelt. Die Toten streiten, lieben und vergnügen sich, besprechen ihre Probleme in Selbsthilfegruppen und beobachten mit belustigter Verwunderung das Treiben der Lebenden. Dabei kommen Lilli und Andrä der Lösung des Falles nicht näher, einander aber schon. Als ein Junge, der den Täter gesehen haben will, überraschend stirbt und sich zu ihnen gesellt, gerät alles ins Rutschen.
Luzide, melancholisch und heiter zugleich erzählt Michael Kumpfmüller von der Schönheit und Zerbrechlichkeit des Lebens.
Inhaltsverzeichnis
Motto
I. Kapitel
1 Die Tote im Park
2 Können Sie mir erklären, was ich hier mache?
3 Allmählich kapiert sie es
4 In der Gerichtsmedizin
5 Allein und doch nicht allein
6 Die üblichen Verdächtigen
7 Namenstag
8 Aus der neuen Welt
9 In der Selbsthilfegruppe
10 Knochenarbeit
11 Der arme Paul
12 Ohne einander
II. Kapitel
13 Die Beerdigung
14 Der Herzensfreund
15 Nirgendheim
16 Das Haus am See
17 Eine Art Liebesgeschichte
III. Kapitel
18 Kommissar Zufall
19 Böser, böser Junge
20 Home Sweet Home
21 Dummerjan
22 Vom Hören
23 Von Ivo keine Spur
24 Der Auftrag
25 Lilli hat andere Sorgen
26 Der Mörder wird gesucht
27 Im Glashaus
28 Aber sie hören nicht
29 Unter Frauen
30 Ende und doch keins
Laut Kriminalstatistik wurden zwischen 2018 und 2022 in Deutschland 1146 Morde verübt.
Die Aufklärungsrate lag zwischen 94,8 und 99,2 Prozent; in 1114 Fällen konnte ein Täter ermittelt werden, in 33 nicht.
Dass die Toten sich um Aufklärung dieser Fälle bemühen, ist nicht überliefert.
I
»Seid ihr auch Tote?«[1]
Juan Rulfo, Pedro Páramo
1 Die Tote im Park
Anfangs schaut sie nur, ohne sich groß zu wundern, da sie ja nur schaut, am Boden die Frau sieht, um sich herum das bunte Laub, die Bäume, ein Stück Himmel ganz blau und wieder die Frau, die ohne jede Bewegung ist, wie tot, was sie nur eben so feststellt und weiter schaut.
Sie könnte nicht sagen, wann genau sie damit angefangen hat, allerdings scheint es nicht allzu lange her zu sein, als wäre sie kürzlich aufgewacht, und wach ist sie zweifellos, es ist windig und frisch, und sie ist hier, in einem Stück Wald mit dieser Frau, die mit geschlossenen Augen am Boden liegt, jedoch nicht schläft, halb zur Seite gedreht im roten Kleid.
Die Frau liegt, und sie steht.
Sie ist älter, als sie wirkt, sagt sie sich und entdeckt irgendwann die Gemeinsamkeit: Sie tragen das gleiche Kleid.
Aber die Frau ist tot, sagt sie sich, bevor sie es mit einem gewissen Erschrecken für möglich hält, dass sie selbst die Tote ist, während sie gleichzeitig wie eine Lebende neben ihr steht und nun auch das Blut auf ihrem Rücken bemerkt.
Um Himmels willen, nein, schnell weg von hier, denkt sie, bevor sie sich mahnend sagt, dass man vor sich selbst nicht weglaufen kann, und sich mit dem verstrubbelten Haar der Toten beschäftigt, einem Rest Lächeln, das geblieben ist, etwas sanft Ungläubiges, wenn es das trifft, und tatsächlich trifft es die Sache ganz gut.
Noch mag sie sich nicht ganz eingestehen, dass sie eine Kopie der Toten ist, in allem gleich und wieder nicht, da sie selbst ja alles gut wahrnimmt und ansatzweise versteht, während die Tote nicht mal die Augen öffnen kann und bestimmt rein gar nichts versteht.
»Hallo«, versucht sie es und setzt sich zu ihr auf den Waldboden.
Sie tragen das gleiche Kleid, aber nicht nur das, sie haben das gleiche Gesicht, wie man annehmen muss, das gelockte Haar, das fast rabenschwarz ist, die kleine, spitze Nase, Arme, Beine, Schultern.
»Du Arme«, sagt sie zu ihr, zu sich.
»Wer hat dir das um Himmels willen angetan?«
Worauf die Tote nicht reagiert, wenngleich ihr in diesem Moment ein Windstoß durchs Haar fährt und es aussieht, als könne sie sich im nächsten Moment erheben und bis ins Kleinste erklären, was ihr geschehen ist.
Doch sie bleibt stumm und tot.
Aber ich bin es, die tot ist, sagt sie sich zum zweiten, dritten Mal, hört auf den Wind, bevor sie erneut die Tote betrachtet, die nach und nach zu einer anderen, Fremden für sie wird.
So vergehen ihr die ersten Minuten.
Aufstehen will sie vorläufig nicht; sie sitzt einfach so da, wartet, versucht, sich zu orientieren: Da drüben, nicht weit von hier, befinden sich ein asphaltierter Weg und dahinter ein leuchtendes Wasser, zu dem sie später vielleicht hingehen kann.
Sonst ist nichts und niemand zu entdecken, eine ganze Zeit lang, bis zwischen den Bäumen auf einmal alle möglichen Gestalten auftauchen, die teilweise sehr seltsame Kleidungsstücke tragen – Schlafanzüge und Nachthemden in den verschiedensten Farben und Zuständen, aus der Mode gekommene Anzüge, Röcke und Kleider, Blusen, Hemden, Mäntel.
Keiner von ihnen traut sich richtig nah ran, und so findet sie ihre Anwesenheit nicht sonderlich bedrohlich, da sie ja lediglich schauen und bedauernd den Kopf schütteln, vereinzelt miteinander flüstern oder etwas summen.
Gut ein Dutzend Männer, Frauen, Kinder, die seltsam geschrumpft wirken, durchweg einen Kopf kleiner, als sie sein müssten, das ist zumindest ihr Eindruck.
»Was wollt ihr von mir?«, ruft sie ihnen zu, was dazu führt, dass die Gestalten wie auf Kommando einige Schritte zurückweichen, jedoch anhaltend summen und flüstern, vereinzelt auch winken, sich jedoch nicht zu ihr wagen und nach und nach überhaupt zurückziehen und zwischen den Bäumen wieder verschwinden.
Und jetzt wird es um sie herum neuerlich ganz still, etwa eine halbe Stunde lang, bis vom Weg wieder Stimmen zu hören sind, die diesmal jedoch nicht weiterziehen, sondern bleiben.
Ein junger Mann und eine junge Frau.
»Stopp mal kurz«, ist der Mann zu hören. »Ich hab da was gesehen.«
»Was denn?«, fragt die Frau.
»Da drüben liegt jemand.«
Und sie: »Komm, lass uns weiterlaufen, ich mag das nicht.«
Doch der Mann hört nicht auf sie; er ist Anfang zwanzig, beinahe noch ein Kind, wie sie überlegt und mit Erleichterung feststellt, dass er lediglich die Tote wahrnimmt und nun ganz nahe vor ihr steht; sie müsste lediglich die Hand nach ihm ausstrecken, dann könnte sie ihn berühren, am Knie, ihm die Schuhe richten, weil einer seiner Schnürsenkel aufgegangen ist, was sie instinktiv unterlässt.
»Eine Frau im roten Kleid«, sagt der Mann, in einem Ton, dass seine Freundin oder Schwester sofort Bescheid weiß.
»Fass sie bloß nicht an; man soll Tote nicht anfassen!«
»Aber warum denn nicht?«, antwortet er und stupst sie mit den Füßen an, da sie ja möglicherweise schläft oder bewusstlos oder sonst wie am Leben ist.
»Wir müssen die Polizei verständigen«, sagt der Mann zu der Frau, die drei, vier Meter entfernt steht und ebenfalls noch ein Kind ist; sie will so schnell wie möglich weg von hier.
Und so gehen sie gemeinsam weg.
»Was müssen wir auch ausgerechnet in diesem blöden Park laufen«, ist die Schwester oder Freundin zu hören, und dann kehrt Ruhe ein und sie ist aufs Neue allein.
Sonderlich schlecht fühlt sie sich nicht. Sie weiß ihren Namen nicht, wer sie ist und woher sie kommt, bleibt jedoch ruhig, will irgendwann nicht mehr neben der Toten sitzen und begibt sich kurzerhand nach unten zu dem leuchtenden Wasser.
Auf der Stelle fühlt sie sich erleichtert.
Sie hat keine Ahnung, um welches Wasser es sich handelt, und misst der Frage auch keine Bedeutung bei, doch es scheint ein großes Wasser zu sein; ein paar Schiffe fahren nach und nach vorüber, auf der anderen Seite sieht man einen kleinen Yachthafen mit Anlegestelle, zwei, drei Cafés, wo Leute mit Jacken und Mänteln in der Vormittagssonne sitzen und essen, trinken.
Sie fragt sich, wie spät es wohl sein mag, und blickt eine Weile auf die andere Seite, wobei sie bemerkt, wie unendlich müde sie ist.
Aber eben bloß das.
Sie kann sich bewegen, sie kann denken, sieht und hört, findet es ansatzweise interessant, dass sie ohne jede Erinnerung ist, nimmt allerdings an, dass sich das ändern wird; sie kann nicht gut riechen, wie sie am Rande bemerkt, auch das Gehen ist anders, mehr ein Schweben als ein Gehen, was ganz lustig ist.
Sie kräuselt hübsch die Nase, während sie so über alles nachdenkt, was sie natürlich nicht weiß, da sie gar nichts weiß – nicht, wie sie hierhergelangt ist und warum in diesem Kleid, was ihr geschehen ist.
Anfangs dreht sie sich in kurzen Abständen zu der Toten, aber mit der Zeit zunehmend selten, als wäre es so leichter, sie zu vergessen, denn sie zu vergessen ist jetzt ihr Wunsch.
Bald darauf sind Sirenen zu hören und wenig später Stimmen, doch es dauert, bis sie bereit ist, sich mit ihnen zu beschäftigen.
Dort, wo die Tote liegt, hat man ein weißes Zelt aufgebaut, überall sind rot-weiße Absperrbänder, die sich im Wind bewegen, mit Abstand sieben, acht Schaulustige, die nicht viel zu sehen bekommen, sich die Haare raufen oder weinen, jedoch mehrheitlich bloß glotzen.
Gut, jetzt holen sie mich, denkt sie.
Jetzt holen sie sie.
Weiß gekleidete Männer mit Masken treten aus dem Zelt und begeben sich wieder hinein, ein großer, bärtiger darunter, der sich mehrmals suchend umblickt und dann ebenfalls in das Zelt geht.
Und jetzt kämpft sie doch mit den Tränen.
Nein, nein, denkt sie.
Sagt Nein zu ihren Tränen, den weißen Männern mit ihren Masken, ihrem Zustand, dass sie nicht weiß, wer sie ist – obwohl es völlig zwecklos ist, sich dagegen zu wehren, weil es nicht das Geringste ändert.
Sie sitzt in einem Stück Wald am Wasser und versucht, sich einen Reim auf ihre Lage zu machen, sagt Wald, sagt Wasser, weiß, dass sie an einem Fluss sitzt, weil denken kann sie, wie gesagt, und dass die Worte das eine und die Dinge das andere sind, was ihr bloß nicht hilft.
Warum habe ich keine Schuhe an, fragt sie sich und beschließt, alles ganz langsam zu tun.
Man muss geduldig sein, ermahnt sie sich.
Sie erinnert sich an nichts, weiß jedoch gut, dass etwas mit ihr geschehen ist, das sich nicht rückgängig machen lässt, weshalb sie es wohl oder übel hinnehmen muss; ein paar Wolken ziehen vorbei, sie sitzt vorübergehend im Schatten, bevor neuerlich viel Sonne ist, und auf diese Weise – damit nur die Zeit vergeht – beschäftigt sie sich.
Im Warten bin ich ja gut, weiß sie, wenngleich sie nicht sagen könnte, woher.
Warum habe ich keine Schuhe an, überlegt sie wieder, beschäftigt sich vorübergehend mit ihren Füßen und anschließend mit ihrem schönen roten Kleid, das fast bis zum Boden reicht und auch das Kleid der Toten ist, bedauert sich, klagt und hört wieder auf damit, weil ja nichts so bleibt, wie es ist, das Licht, Wind und Wetter und am Ende gewiss auch sie selbst.
2 Können Sie mir erklären, was ich hier mache?
Für Andrä wird es ein Glückstag. Das sagt er sich später wieder und wieder, weil ja alles ganz anders hätte kommen können, aber zum Glück nicht kommt: Er ist vor Ort, als sich das Team in Bewegung setzt, springt in letzter Sekunde in einen Wagen, ahnt natürlich nichts, erwartet nichts.
Es ist das erste Mal seit Langem, dass er von Anfang an dabei ist, den Tatort sieht, die Tote, die wie alle Toten müde und ergeben wirkt, obwohl er einen Rest Lächeln zu bemerken glaubt. Ihr rotes Kleid gefällt ihm, das man in den Müll werfen wird, wie er unweigerlich annimmt und nebenbei hört, wie sein Nachfolger über die Tote spricht und dass sie vorläufig nicht das Geringste über sie wissen; die Frau habe keine Handtasche bei sich gehabt; man habe kein Telefon gefunden, keine Papiere, nichts.
»Was macht jemand frühmorgens im Kleid in diesem Park?«
Das ist eine der ersten Fragen, die er sich in Gedanken notiert und gleichzeitig nach allen Seiten Ausschau hält, ob da irgendwo die Frau ist, die zu der namenlosen Toten gehört, und siehe, da drüben sitzt sie ja – reglos unter einem Baum, ganz nah am Ufer.
So aus der Ferne kann er nicht viel erkennen, denn sie wendet ihm den Rücken zu und blickt immerzu aufs Wasser; einmal hat er das Gefühl, dass sie weint, was unter den gegebenen Umständen nicht überraschend wäre, wobei sie wohl eher nur schnieft, jedenfalls will es ihm so scheinen.
Die Frau, die zu der Toten gehört.
Früher oder später wird er sich zu ihr hinbewegen müssen, wie er weiß, doch seltsam – er kann sich lange nicht entschließen. Wechselt irgendwann die Stellung und läuft in weitem Bogen ebenfalls ans Ufer, und in diesem Moment dreht sie sich in seine Richtung, wartet, bis er sich gesetzt hat, und nickt nicht mal dazu.
»Ich bin Andrä«, sagt er.
»Andrä, ja«, bestätigt sie.
Was fürs Erste alles ist.
Er schätzt sie auf Anfang, Mitte vierzig und beginnt, sich näher mit ihrem Kleid zu beschäftigen, das an einigen Stellen stark zerknittert ist, als wäre es aus Papier, sehr rot und fremd, und als sei es nicht gemacht, um von jemandem wie ihm betrachtet zu werden.
Trotzdem hört er nicht auf, es zu betrachten, macht sich nach und nach ein Bild von der Frau, die es trägt, betrachtet ihren leicht geschwungenen Mund, die graugrünen Augen.
Es gefällt ihm, dass sie ihn jetzt kurz ansieht, mit dem üblichen Blick, der von sich nichts weiß.
»Ich glaube, ich möchte erst mal weiter sitzen«, erklärt sie, womit er einverstanden ist.
Und sie schweigen; vom Tatort sind gelegentlich Stimmen zu hören, die Frau dreht sich mehrfach zu ihnen hin und wieder weg und bleibt die längste Zeit in ihren Gedanken.
»Sie haben ein weißes Zelt aufgebaut. Ist das da, wo die Tote liegt?«, fragt sie schließlich.
»Ja«, bestätigt er.
Das weiße Zelt sei ihr unheimlich, sagt sie, die weißen Anzüge der Männer, Frauen; dass es sich für sie um eine Arbeit wie jede andere handle.
»Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache«, fügt sie hinzu. »Können Sie mir erklären, was ich hier mache?«
Er versucht, ihr ein paar grobe Hinweise zu geben, bloß versteht sie leider nicht und fängt immer wieder damit an, dass das alles nicht sein könne; dass sie doppelt sei, die Frau im roten Kleid, die neben ihm sitze, und die Frau im roten Kleid, die dahinten tot unter dem weißen Zelt liege.
»Das würde ich gerne begreifen. Begreifen Sie es?«
»Es ist, wie es ist«, sagt er.
Darüber sinnt sie länger nach, und als sie fertig damit ist, fragt sie, was er eigentlich von ihr wolle.
»Ich bin nur da«, sagt er.
»Aber ich erinnere mich an gar nichts, nicht mal an meinen Namen.«
»Ja, ich weiß.«
Und so fängt es zwischen ihnen an.
Er hat es nicht eilig mit der Frau, lässt sie reden, lässt sie schweigen, nachdenken, so sie beim Schweigen nachdenkt, was er in keiner Weise weiß.
»Eigentlich müsste man ja frieren, so im Schatten auf dem kalten Waldboden, doch ich friere nicht«, sagt sie.
»Bewegung wäre wahrscheinlich gut«, glaubt sie nach einer Weile und überlegt, ob sie aufstehen und gehen soll, raschelt mit ihrem Kleid und seufzt, worauf er sie wissen lässt, dass sie gar nichts müsse.
Trotzdem will sie jetzt unbedingt gehen, womit sie nicht sonderlich weit kommen, da sie nach wenigen Metern stehen bleibt und nun doch zu weinen anfängt, wobei sie zwischendurch flüstert, in verschiedenen Variationen, dass das alles bestimmt nicht wahr sei.
»Nein, nein, ich bin das nicht, bitte nicht, ich will das nicht, ich möchte nach Hause, deshalb weine ich so, ich könnte bloß noch weinen.«
In den Pausen, die mal länger, mal kürzer ausfallen, laufen sie den asphaltierten Spazierweg entlang, bis sie in einer Senke auf ein altes Gasthaus stoßen, das sie rechts liegen lassen und auf eine Anhöhe gelangen, von wo es einen weiten Blick über den sonnenbeglänzten Fluss gibt.
Die Frau hat bislang mit keiner Silbe gefragt, wer er ist, allerdings weint sie jetzt nicht mehr gar so viel, sondern beginnt, sich wie eine gewöhnliche Spaziergängerin mit der Umgebung zu beschäftigen – einem Stück Himmel, dem golden leuchtenden Laub, ein paar ortsansässigen Vögeln.
»Ich träume Sie sicher«, ist lange das Einzige, was sie in seine Richtung bemerkt.
»Sie trägt dasselbe Kleid wie ich, habe ich gedacht. Die Tote bin ich. Nur wer bin ich bloß?«
»Das müssen wir herausfinden«, antwortet er.
»Herausfinden«, sagt sie.
Und er: »Wir haben Zeit.«
»Zeit«, sagt sie und lächelt.
Auf dem Rückweg wirkt sie beinahe wieder vernünftig und erinnert sich nun auch an die Szenen des Morgens: Ein Pärchen in Joggingkleidung sei gekommen, beide in Weiß und recht jung und nervös; irgendwann habe sie Sirenen gehört und eine Gruppe Männer mit einer Frau sei aufgetaucht.
Mehr weiß sie nicht.
An das Rauschen der Blätter erinnert sie sich, dass es sehr windig gewesen ist und nicht hell, obwohl es bald darauf hell geworden ist.
»Wir sind ganz allein gewesen.«
Die Tote und sie, meint sie.
Inzwischen haben sie neuerlich das Gasthaus erreicht, von dem Andrä glaubt, dass er es kennt und schon dort gewesen ist, mit Christine, wie er unweigerlich annimmt, an einem unendlich fernen Sommertag.
Die Frau ist anhaltend gut zu Fuß und beschäftigt sich ohne Unterlass mit ihren Gedanken – wer sie mutmaßlich ist oder gewesen ist, warum da dieser Mann neben ihr läuft, mit welchen Absichten, aus welchen Gründen.
»Sie sind so eine Art Engel, nicht wahr? So etwas in die Richtung sind Sie doch.«
Aber woher denn, nein, widerspricht er und lässt sie mit wenigen Sätzen wissen, wer er gewesen ist.
»Ein Kommissar, ach ja? Das nenne ich einen Zufall.«
Inzwischen ist es lange nach Mittag und die Tatortarbeit findet allmählich ein Ende.
Sie haben sich noch einmal ans Flussufer gesetzt und die nächsten Schritte besprochen, welche man gehen möchte oder welche womöglich lieber nicht.
»Wir können dabei sein, wenn sie sich die Tote ansehen«, sagt er. »Aber ich glaube, es macht Sie traurig.«
»Ja, traurig«, erwidert sie. »Traurig sein gefällt mir.«
»Sie werden es schrecklich finden.«
»Ja, ja, ganz schrecklich, das will ich, ich will alles sehen und hören«, behauptet sie und dreht sich mehrfach zu der Stelle, wo die Tote liegt.
Kurz darauf fährt ein Wagen vor, damit wird man sie in die Gerichtsmedizin bringen, doch noch liegt sie in dem Zelt, wo sich die weißen Gestalten befinden, und Minuten später packen ein paar Hände die Tote ein und legen sie in eine Box, was gewiss ganz neu und unheimlich für die Frau ist.
»Sie tut mir so leid«, sagt sie, mit einer Art Ehrfurcht, die in diesem Moment auch er empfindet, obwohl da gleichzeitig verschiedene andere Empfindungen sind, zärtliche, besorgte, erfreute, denn es ist eine Freude, in der Nähe dieser Frau zu sein, wie er mit Erstaunen feststellt, die erste seit ganz Langem.
»Sie können sich jederzeit anders entscheiden«, lässt er sie wissen, worauf sie erwidert, dass sie das gewiss nicht tun werde und allerdings Bedenken wegen ihres zerknitterten Kleides habe, das so zerknittert gar nicht ist.
»Mein Kleid, mein Kleid«, jammert sie.
»Wo bin ich da bloß hineingeraten.«
Man merkt, dass ihr die Warterei nicht guttut, und tatsächlich warten sie bereits eine ganze Weile, was sich nach Lage der Dinge nicht so schnell ändern wird; sein Nachfolger ist seit Minuten am Telefon, winkt Leute herbei, um sie wenig später wegzuschicken, schüttelt den Kopf, telefoniert, schüttelt neuerlich den Kopf.
»Sie kennen das alles, nicht wahr?«, vermutet sie.
»Die Tatortarbeit, meinen Sie?«
Aber die meint sie nicht; sie meint den Moment, in dem man zu begreifen beginnt, dieses Doppelte; dass es einfach weitergeht, beinahe, als wäre nichts.
»Ich sage es nicht gut.«
Er findet, man könne es nicht besser sagen.
»Ich bin so müde«, sagt sie. »Waren Sie auch so müde?«
»Müde trifft es nicht«, fügt sie hinzu.
Ernüchtert, denkt er, enttäuscht, wie jemand, der auf schändlichste Weise betrogen worden ist und glaubt, es nicht verdient zu haben.
Damals, am Hafen, ist das in etwa sein Gefühl gewesen, eines von vielen, weil er auch wütend gewesen ist, vor allem auf sich selbst, seinen Hochmut, seinen Leichtsinn.
Er hat lange nicht mehr daran gedacht, jetzt tut er es.
»Hauptsache, Sie geben sich nicht selbst die Schuld«, sagt er mit diesen Gedanken.
»Dass es so gekommen ist, meinen Sie? Ich weiß nicht, wie es gekommen ist.«
»Nein«, sagt er.
»Ich weiß nur, dass ich froh bin, dass jemand mit mir fährt.«
Sie kann sogar lächeln, stellt sich heraus, offenbar hat sie Vertrauen zu ihm gefasst, das bisschen, das nötig ist, um in Kürze in den Wagen der Gerichtsmedizin zu steigen und den nächsten Schritt zu tun.
»Sind Sie weiterhin sicher, dass Sie das wollen?«
»Wollen«, sagt sie.
Sie sieht wirklich sehr müde aus, lächelt müde, nickt müde, während er sich fragt, warum da vorne seit einer halben Stunde partout nichts vorangehen will.
»Wir haben Zeit.«
»Ja, ja, ich weiß«, sagt sie und zupft an ihrem Kleid, so auf eine mädchenhaft kokette Art, dass man glauben möchte, sie lege eben noch Hand an, bevor es ins Theater oder die Oper geht, was nie seine Sache gewesen ist, in den ersten Jahren mit Christine allenfalls, nur an Christine will er jetzt nicht denken.
3 Allmählich kapiert sie es
Sie findet seine Stimme angenehm, mag ansatzweise den Bart; dass er sich kümmert und nicht von ihrer Seite weicht.
Das alles mag sie an ihm, wenngleich ihr seine Gründe unklar geblieben sind; fast will sie ja annehmen, dass er doch eine Art Engel ist, wer weiß, außerdem scheint er ihr Kleid zu mögen, kennt sich in allem gut aus, und sie hat so viele Fragen.
»Ich glaube, wir können«, lässt er sie irgendwann wissen und sieht ihr zu, wie sie neuerlich über ihr Kleid streicht und dann tapfer neben ihm her zu der Stelle läuft, wo sie vor Stunden zu sich gekommen ist.
Sie merkt, wie sich alles in ihr sträubt, und trotzdem muss und will sie da jetzt hin; die Tote liegt inzwischen im Wagen in der verschlossenen Box, man kann ohne Schwierigkeiten zu ihr, die Heckklappe steht offen, und so steigt sie kurzerhand dazu.
»Ich habe gedacht, es ist dir vielleicht lieber, wenn du die Fahrt nicht alleine machen musst«, sagt sie zu der Toten, was, wie sie weiß, völlig unsinnige Sätze sind, die sie trotzdem sagt.
An diesen Andrä hat sie vorübergehend nicht mehr gedacht, aber kaum ist er ihr wieder eingefallen, klettert er in den Wagen und setzt sich neben sie.
[25]»Ich finde es auf einmal richtig so«, erklärt sie.
»Ja«, sagt er dazu.
Jemand schließt die Heckklappe, die Fahrertür wird geöffnet und zugeschlagen, und jetzt fährt der Wagen los, und sie sitzt mit dem fremden Mann bei der Toten, die in ihrer Sarg-Box liegt.
Es ist richtig, dass sie bei ihr sitzt, und es ist gut, dass der Mann sie nicht alleine lässt und mit seinen Gedanken beschäftigt ist und nichts weiter von ihr will.
Anfangs fahren sie recht langsam und anschließend zügig auf einer Straße, die sehr kurvig ist; einmal hört man ein Hupen, dazu ein paar Vögel, wie sie glaubt und mit einem Mal weiß, dass sie in einer Stadt ist – in dieser Stadt hat sie gelebt, früher, wie sie sich sagt, wenngleich dieses Früher keinen Tag zurückliegt.
Bloß wer um Himmels willen ist sie in dieser Stadt gewesen?
Eine Frau, überlegt sie, ich bin eine Frau gewesen, erst ein Mädchen, später eine Frau; ich bin zur Schule gegangen, habe Eltern gehabt; ich bin einer Arbeit nachgegangen, habe gegessen, getrunken, habe geschlafen, allein oder zu zweit, habe mich gelangweilt, mich gefürchtet.
»Ich bin ein Niemand«, sagt sie sich und denkt an die Tote, die allein und tot in ihrer Sarg-Box liegt, an die Szene im Wald, als sie sie entdeckt hat im roten Kleid.
So in etwa überlegt sie, bemerkt, dass auch der Mann sich neuerlich mit dem Kleid beschäftigt, wenngleich, wie sie zu wissen glaubt, auf andere Art als sie.
Anfangs kommen sie gut voran, dann geraten sie mehrfach ins Stocken und stehen mehr, als dass sie fahren.
Wieder muss sie sich sagen, dass sie ein Niemand ist, während der Mann am Steuer nicht mal ahnt, dass es Niemande wie sie überhaupt gibt, was sie für einen Moment beinahe amüsiert.
Andrä ist ebenfalls so ein Niemand, obwohl er gleichzeitig mehr als das ist, jemand, der zu genauen Schlüssen gelangt ist, der sich nicht abfindet und zugleich alles akzeptiert.
So ein Mann, glaubt sie, ist er.
Wahrscheinlich findet er sie ja schrecklich langweilig, weil sie ununterbrochen an sich denkt und lauter dummes Zeug redet oder schweigt oder mit den Tränen kämpft, was in diesem Augenblick erneut der Fall ist, weil es schwer ist, schweigend neben der Toten zu sitzen, die nicht mal ansatzweise weiß, was ihr bevorsteht, oder es womöglich ahnt und sich auf ihre Art fürchtet.
Es ist ein Fehler gewesen, dass sie zu ihr gestiegen ist, das wird ihr plötzlich klar; was im ersten Moment richtig erschien, hat sich in Kürze als das Allerfalscheste herausgestellt.
»Ich bin ganz falsch«, sagt sie, worauf Andrä meint, dass es da nichts Falsches gebe, es sei alles ganz richtig an ihr.
»Wir sind bald da«, erklärt er.
»Turmstraße«, sagt er, womit sie wie üblich nicht das Geringste anzufangen weiß.
Sie will, dass er verspricht, sie jetzt und in Zukunft nicht als Kranke zu behandeln, denn krank sei sie nicht, was er auch nicht behauptet hat.
Trotzdem verspricht er es.
»Vielleicht unterhalten wir uns bei Gelegenheit darüber, es ergibt sich bestimmt eine.«
Gelegenheit, ja, sagt sie sich.
Und nun sind sie wirklich da.
Sie fahren auf ein weitläufiges Gelände und erreichen eine rot-weiße Schranke, bleiben kurz stehen und passieren sie, bleiben neuerlich stehen.
»Ich denke, es ist besser, wenn Sie sich ein wenig fürchten«, sagt er jetzt und lässt sie wissen, was sie zu sehen bekommen wird, irgendwo dadrin in einem Saal, wie er den Ort fast feierlich nennt.
So besorgt, wie er sie ansieht, scheint er weiterhin zu glauben, dass sie sich sehr fürchtet, dabei fürchtet sie sich vorläufig nicht besonders, was in der Hauptsache daran liegt, dass jemand bei ihr ist, während die Tote ganz allein im Wagen liegt; der Fahrer hat es erkennbar nicht eilig mit ihr, er raucht und schaut sich etwas in seinem Smartphone an, das ihn zum Lachen bringt, bevor er mit Handschlag von einem Mann begrüßt wird, der ihm anschließend beim Tragen der Sarg-Box hilft.
Allzu schwer ist die Tote offenbar nicht, sie verliert bereits an Gewicht, wie sie seltsamerweise vermutet und sich wundert, warum sie den Männern nicht folgen.
»Wir warten besser noch«, rät er. »Ein paar Minuten.«
»Gut, einverstanden«, sagt sie, denn warten, wie gesagt, kann sie.
Etwas lästig ist, dass nun wieder diese Gestalten auftauchen, die natürlich andere sind als am Morgen, sich jedoch genauso benehmen, zudringlich und ängstlich sind und durchweg Winterkleidung tragen, schwere Mäntel und Jacken, dazu Schals und Handschuhe und Mützen in allen Farben.
»Du bist neu, nicht wahr?«, sagen sie und singen, summen für sie, was sie ja bereits kennt.
»So, ich glaube, wir können«, sagt Andrä, der auf die Gestalten nicht geachtet hat, sie jetzt jedoch ermahnt, ihnen auf keinen Fall zu folgen, sie mehrfach regelrecht anfaucht und sich anschließend vergewissert, dass sie sich nicht von der Stelle bewegen.
Und jetzt beginnt sie sich doch zu fürchten; ohne diesen Andrä würde sie sofort kehrtmachen.
Sie folgt ihm durch einen schwach beleuchteten Flur, steigt irgendwelche Treppen nach unten, ohne groß darauf zu achten.
»Andrä?«, fragt sie, damit er nicht etwa auf die Idee verfällt, ihr wegzulaufen; doch er scheint gar nicht daran zu denken und sagt so in seinem üblichen optimistischen Ton: »Keine Sorge, da vorne um die Ecke, dann sind wir da.«
»Alles in Ordnung so weit?«
»Ja, alles in Ordnung«, erwidert sie, und tatsächlich fühlt sie sich halbwegs gewappnet; sie fürchtet sich, weil es vielleicht schlimm wird, wenn auch bloß für eine begrenzte Zeit; man geht in die Zeit hinein, und kaum ist man drin, hat man sie schon hinter sich gebracht.
»Ich bin sehr froh, dass Sie mich gefunden haben«, sagt sie, worauf er zurückgibt, dass ja wahrscheinlich er der Gefundene sei, was ihr als Antwort gefällt.
»Da drüben«, sagt er, wozu er aufmunternd nickt, da er so etwas wie zu Hause hier ist.
Fast ist sie versucht, ihn zu bitten, sie in den Arm zu nehmen, bevor sie sich sagt, dass sie ihn ja nur flüchtig kennt und alleine zurechtkommen muss.
»Also ja?«, fragt er.
Worauf sie tapfer nickt.
Na gut, denkt sie, ich kann das hier, er ist bei mir, er verlässt mich nicht, also kann ich das doch.
Und so ist es.
Er zeigt auf eine halb offene Tür, und da gehen sie jetzt durch, und schon sind sie drin.
4 In der Gerichtsmedizin
Er hat ihr nicht ohne Grund geraten, sich zu fürchten, und tatsächlich scheint sie auf ihn gehört zu haben, passt auf den letzten Metern nicht gut auf, stolpert zwei-, dreimal, achtet nicht auf das, was um sie herum ist, sondern läuft ihm nur irgendwie hinterher.
Aber jetzt sind sie drin.
Nach über zwanzig Jahren Dienst kennt er die Räumlichkeiten und Abläufe auswendig, weshalb er versucht, die Dinge mit den Augen der Frau zu betrachten: die metallene Bahre, auf die man die namenlose Tote gelegt hat, die unzähligen Instrumente, Messer, Skalpelle, Stichel, Löffel, Zangen, das erbarmungslose Licht, die Waschbecken und was einen sonst erschrecken mag, bevor es überhaupt losgegangen ist.
Anfangs stört ihn, dass er die beiden Diensthabenden nicht kennt, was sich jedoch als Vorteil erweist, da er in der Folge weniger abgelenkt ist, wobei die beiden nicht viel sprechen, sondern sich den eingeübten Routinen überlassen und zu Beginn lediglich respektvoll schauen – wie die neue Tote daliegt und in aller Ruhe abwartet, was mit ihr geschehen wird.
Die Frau schaut ebenfalls.
Ganz nah ran will sie offenbar nicht, deshalb bleiben sie bei den Waschbecken, von wo man das meiste in einer verträglichen Dosis sehen kann: wie sie der Toten das Kleid vom Leib schneiden und sie umdrehen, die drei Einstichstellen am Rücken untersuchen, ihren Unterleib, da womöglich sexuelle Handlungen stattgefunden haben, ihre Fingernägel, falls sie sich gewehrt hat, ihre Nase, ihren Mund.
All das.
Er hat Schwierigkeiten, die Tote so nackt und ausgeliefert zu sehen, und senkt mehrfach den Blick, während die Frau keine Sekunde wegschaut und nebenbei über ihr rotes Kleid streicht, um zu prüfen, ob es weiterhin da und intakt ist und nicht wie das andere zerschnitten.