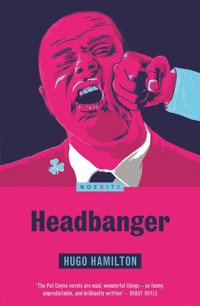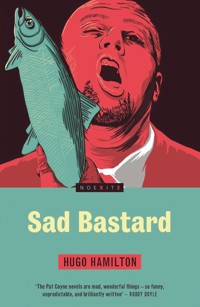14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein mächtiges Werk. Es erweckt so vieles zum Leben – Joseph Roth, Deutschland, die Kunst des Schreibens, Bücherverbote, die Vergangenheit, die zur Gegenwart spricht.« Colum McCann
Genial und ungewöhnlich – ein Buch erzählt. Und »Die Rebellion«, ein Roman von Joseph Roth aus dem Jahr 1924, hat einiges zu erzählen: die Geschichte des Buches selbst, das 1933 vor der Bücherverbrennung bewahrt wurde, die Geschichte seines Autors, der vor den Nazis fliehen musste, und seiner geliebten Frau Friederike, die ermordet wurde.
Und da gibt es noch die Geschichte von Andreas Pum, dem Helden aus »Rebellion«, Kriegsveteran und Drehorgelspieler, den das Glück verlässt, und die aktuelle Besitzerin des Buches, die Deutschamerikanerin Lena Knecht. Sie ist von der handgezeichneten Karte auf der letzten Seite des Buches fasziniert und reist nach Berlin, wo das Buch entstand …
Hugo Hamiltons vielschichtiger Roman trägt die Echos der Vergangenheit in die Gegenwart, erzählt hundert Jahre Weltgeschichte und feiert das Überleben der Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch
Ein Buch erzählt. Und die Erstausgabe von »Die Rebellion«, ein Roman von Joseph Roth aus dem Jahr 1924, hat einiges zu erzählen: die Geschichte des Buches selbst, das 1933 vor der Bücherverbrennung bewahrt wurde, die Geschichte seines Autors, der vor den Nazis fliehen musste, und seiner geliebten Frau Friederike, die wegen ihrer psychischen Erkrankung in einer Heilanstalt ermordet wurde. Und da gibt es noch die Geschichte von Andreas Pum, dem Helden aus »Die Rebellion«, Kriegsveteran und Drehorgelspieler, den das Glück auf einer schicksalhaften Straßenbahnfahrt verlässt. Nicht zu vergessen die Geschichte der aktuellen Besitzerin des Buches, die Künstlerin und Deutschamerikanerin Lena Knecht. Sie ist von der rätselhaften handgezeichneten Karte auf der letzten Seite fasziniert und reist nach Berlin, wo das Buch in die Hände ihres Großvaters gelangte …
Hugo Hamiltons vielschichtiger Roman trägt die Echos der Vergangenheit in die Gegenwart, erzählt hundert Jahre Weltgeschichte und feiert das Überleben der Literatur.
Zum Autor
HUGOHAMILTON wurde 1953 als Sohn eines irischen Vaters und einer deutschen Mutter in Dublin geboren. Zu Hause sprach er Deutsch und Irisch; das Englische, die Sprache der Straße, wurde von seinem Vater verboten. Mit seinen Erinnerungsbänden »Gescheckte Menschen« und »Der Matrose im Schrank« erregte er großes Aufsehen, die Werke wurden in 20 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 2007 erschien »Die redselige Insel«, ein irisches Reisetagebuch auf den Spuren Heinrich Bölls, und zuletzt 2020 der Roman »Palmen in Dublin«. Hugo Hamilton lebt in Dublin.
Zum Übersetzer
HENNINGAHRENS, geb. 1964, lebt als Schriftsteller und Übersetzer in Frankfurt. Er übertrug u. a. Werke von Jonathan Safran Foer, Colson Whitehead, Meg Wolitzer und Richard Powers ins Deutsche. Sein Roman »Mitgift« war für den Deutschen Buchpreis nominiert.
HUGO HAMILTON
Echos der Vergangenheit
Aus dem Englischen von Henning Ahrens
Luchterhand
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »The Pages« bei 4th Estate, einem Imprint von HarperCollins Publishers, London Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Zitiert wurde aus:Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper. edition suhrkamp 229. 47. Aufl. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2022.Paul Celan: »Todesfuge« und andere Gedichte. 6. Aufl. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2022.Joseph Roth: Werke. Köln: Kiepenheuer & Witsch eBook, 2009.
Copyright © der Originalausgabe 2021 Hugo Hamilton
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign | München unter Verwendung eines Motivs von © Ruth Botzenhardt
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28003-1V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
1
Da bin ich nun und werde in einem Handgepäckstück durch die Departure Lounge des JFK Airport getragen. Die Tasche gehört einer jungen Frau namens Lena Knecht. Sie fliegt nach Europa. Bringt mich gewissermaßen nach Hause. Nach Berlin, die Stadt, in der ich geschrieben wurde. Wo ich 1924, vor knapp hundert Jahren, in einem kleinen Verlag erschien. Wo ich davor bewahrt wurde, am Abend des 10. Mai 1933 in den Flammen zu landen. Die Stadt, die mein Verfasser am Tag von Hitlers Machtergreifung fluchtartig verließ.
Mein heimatloser Verfasser. Mein rastloser, umherirrender, staatenloser Verfasser. Ständig auf der Flucht, aus einem Koffer lebend. Um sein Leben bangend.
Sein Name: Joseph Roth.
Mein Titel: Die Rebellion.
Zur Welt kam ich: in der Weimarer Republik, der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Der Zeit zwischen dem, was anfangs als Feld der Ehre und später als Feld der Schande galt. Einer Zeit der Waisen und der Kinderarmut. Als Frauen das Land am Laufen hielten, weil die Männer auf den Schlachtfeldern geblieben oder als Besiegte heimgekehrt waren, als Kriegsversehrte, die Hilfe brauchten, um ihr Glas Bier an die Lippen zu setzen. Die von Albträumen gequält wurden, in denen sich verwesende Hände aus Schützengräben reckten. Eine Zeit eisiger Winter, die man mit den Worten charakterisierte, Gottes Faust fege aus dem Osten heran. Und des Hungers, wie er in der Miene eines Straßenbahnschaffners zum Ausdruck kam, der die von einem Fahrgast zurückgelassene, im Kino gekaufte Schokolade verschlang.
Eine Zeit der Mühsal und des Glamours. Eine Zeit der Revolution. Der Emanzipation, des Cabarets – der freien Liebe und der freien Künste.
Jeder war Mitglied irgendeines Clubs. Jeder wollte einem Verein, einer geselligen Vereinigung angehören: Schachclub, Tanzverein, Hundezüchterverband, Briefmarkensammlerverein, Orchideenzüchterverband. Frauenverein. Herrenclub. Jagdverein. Saufclub. Lachgesellschaft. Oder einem Club von Witzbolden, die möglichst albern auftraten und futterten, was das Zeug hielt, oder Passanten Geld dafür anboten, eine Flasche Wein in ihre Tasche kippen zu dürfen.
Jeder gehörte einem Bund oder einer Gewerkschaft an. Dem Bund der Kriegsblinden. Dem Bund der Zeitungsverkäufer. Dem Zentralverband der Deutschen Uhrmacher. Der Deutschen Fleischerinnung. Dem Deutschen Brauereiverband. Dem Interessenverband Deutscher Kantinenpächter.
Jeder war gegen irgendetwas. Jeder hatte ein Manifest. Die Rechten und die Linken. Es war eine Zeit der Missgunst, des Grolls und der exklusiven Clubs. Eine Zeit, in der man sich als Buch nicht mehr sicher fühlen konnte. Als Hitler schon Pläne für meine Auslöschung und die meines Verfassers schmiedete.
Welche Bedeutung hat die Zeit für ein Buch?
Ein Buch hat alle Zeit der Welt. Meine Regallebenszeit ist unendlich. Mein antiquarischer Preis ist bescheiden. Sammler können mich für ein paar Dollars bei eBay kaufen und anschließend horten wie das Exemplar einer ausgestorbenen Spezies. Die Rebellion – ich hatte zig Auflagen. Wurde in zig Sprachen übersetzt. Wissenschaftler können mich in fast jeder Bibliothek finden. Ich wurde zweimal verfilmt.
Und da bin ich, als Erstausgabe, leicht beschädigt und etwas ausgeblichen. Immer noch lesbar. Ein kurzer Roman über einen Leierkastenmann, der im Ersten Weltkrieg ein Bein verlor. Die Umschlagillustration zeigt die Silhouette eines Mannes mit Holzbein, der die Krücke zornig gegen den eigenen Schatten erhebt.
Lena, meine jetzige Besitzerin, hat die Angewohnheit, alles in ihre Tasche zu stopfen: Reisepass, Portemonnaie, Handy, Make-up, Hygieneartikel, eine zerfranste Spielzeugente aus ihrer Kindheit, sogar ein halb verspeistes Gebäckstück. Da bin ich nun, ich stecke in einem finsteren Sack und warte wie meine Reisegefährten darauf, von Lenas blinder Hand ans Licht befördert zu werden.
Sie holt meist ihr Handy heraus. Wie soll ein Buch gegen ein so raffiniertes Gerät anstinken? Es enthält ihr gesamtes Leben. Alle privaten Informationen, ihre Fotos, ihre Passwörter, ihre intimen Nachrichten. Es kennt ihr Denken, beeinflusst ihre Entscheidungen. Es leistet mehr als jedes Buch. Es gleicht einem unvollendeten Roman, einem Werk, das sich unaufhörlich fortschreibt, es erahnt ihre schlimmsten Befürchtungen und wildesten Träume.
Ihr Vater war Deutscher, sprach aber kein Deutsch mit ihr. Er war Bürger der DDR, Bäcker von Beruf, der nach dem Mauerfall in die USA auswanderte und seine Muttersprache verleugnete, um nicht als Deutscher erkannt zu werden. Er kehrte nach Feierabend mit mehlweißen Wimpern, Augenbrauen und Händen heim, ein lebendiger Geist, der sein innerstes Wesen in einem nicht mehr existierenden Land zurückgelassen hatte. Als Lena zwölf war, trennten sich ihre Eltern. Ihre Mutter kehrte zurück nach Irland, und Lena wohnte mit ihrem Vater in einer nach Hefe riechenden Zweizimmerwohnung in einem Vorort Philadelphias. Dort stand ich in einem Bücherregal neben der Tür, ungelesen, nie verliehen, bis ich vom Vater, der tödlich an Krebs erkrankt war, an Lena übergeben wurde. Er nahm ihr mit schleppender Stimme, in der der Akzent eines verlorenen Landes nachhallte, das Versprechen ab, gut auf mich achtzugeben.
Pass auf dieses Buch auf wie auf einen kleinen Bruder, sagte er.
Ist die Vergangenheit kindlicher als die Gegenwart? Muss die Geschichte gehütet werden, als gehöre sie zur Familie?
Ich wurde ein wenig verschandelt. Mein ursprünglicher Besitzer, ein Germanistikprofessor an der Berliner Humboldt-Universität, notierte ein paar geografische Anmerkungen auf den Seitenrändern. Sein Name lautete David Glückstein, und er war Jude. Er zeichnete auch etwas auf die letzte, leere Seite – einerseits eine Illustration, andererseits eine Landkarte. Er benannte den Ort nicht. Die Illustration zeigt eine Brücke über einen Fluss. Einen Pfad, an dem eine Eiche steht, vor dieser eine Bank. Auf einer Seite des Pfades befindet sich ein Wald, auf der anderen ein Bauernhof. In einem Scheunentor erkennt man eine Schaukel, auf dem Hof eine Sonnenuhr. Die Schatten der Gebäude sind so akribisch gezeichnet, als müsse man zu einer bestimmten Stunde dort sein, um den Ort wiedererkennen zu können. Die Karte spiegelt eine private Erinnerung, sollte eines Tages gedenken, als der Professor gemeinsam mit der Frau, die er liebte, etwas unter der Sonnenuhr vergrub, damit es nicht in falsche Hände geriet.
Unnötig zu sagen, dass diese Zeichnung in keinem Zusammenhang mit meinem Inhalt steht. Der Zweck eines Buches besteht darin, die vom Verfasser erdachte Geschichte auch für kommende Zeiten zu bewahren. In meinem Fall die eines vom Glück verlassenen Leierkastenmanns.
Wahrscheinlich kann ich von Glück reden, noch am Leben zu sein. Damals versammelte sich eine große Schar Schaulustiger auf dem Opernplatz, um der Bücherverbrennung beizuwohnen, doch ich blieb verschont. Während die zahllosen, von Menschen handelnden Geschichten von den Flammen entstellt wurden, als Rauch und verkohlte Fetzen in den Abendhimmel über der Preußischen Staatsbibliothek aufstiegen, wurde ich von dem weitsichtigen Professor zwecks sicherer Aufbewahrung an einen jungen Studenten übergeben. Dieser war Lena Knechts Großvater. Er verbarg mich unter seinem Mantel. So wurde ich gerettet und in der Familie weitergegeben, bis ich in Lenas Hände gelangte. Und nun fliegt sie nach Berlin, um herauszufinden, was es mit der Karte auf sich hat.
2
Ich lag wochenlang auf dem Nachttisch, stumm und unbemerkt, einer von vielen leblosen Gegenständen. Ich war stiller Zeuge, wenn sie zu später Stunde lang ausgestreckt zur Decke aufsahen, während sie wieder zu Atem kamen. Wie soll ein Buch dem Leben genügen? Ein Buch kann nur hoffen, das, was sich zugetragen hat, mit Wörtern nachzuzeichnen.
Sie sind erst seit Kurzem verheiratet – Lena Knecht und Michael Ostowar. Sie haben ihre Hochzeit in Irland gefeiert. In einem kleinen Hotel in Kilkenny. Sie hielten gemeinsam das Messer, als sie die Torte anschnitten, und tupften einander einen Schokoladenklecks ins Gesicht, wie es mancherorts Brauch ist. Sie verlebten ihre Flitterwochen zunächst an der irischen Westküste, auf Clare Island, wo sie ein paar Tage in einem Leuchtturm wohnten und zum Brausen erwachten, mit dem sich die Wellen an den Felsen brachen.
Sie haben sich in Chelsea, Manhattan, eingerichtet. Lena ist Künstlerin, Michael arbeitet als Experte für Cybersecurity. Sie reden inzwischen davon, eine Familie zu gründen.
Wie wäre es, wenn wir ein Kind bekommen?
Als wären ihr Leben, ihr Glück und ihr Platz auf dieser Welt nicht gesichert, wenn sie keine Familie gründen würden. Ein Baby würde ihren Gefühlen Sinn und Zweck verleihen. Es wäre ein leibhaftiger Beweis für ihr tiefes Glück.
Natürlich haben sie darüber diskutiert, ob es angebracht sei, in diesen Zeiten ein Kind zu bekommen. In welcher Welt würde es aufwachsen? Wie mag dieser Planet in fünfzig Jahren aussehen? Ich höre sie darüber sprechen, wie viele Menschen die Erde verkraftet. Sie wissen sehr wohl – wenngleich Michael dies nicht einmal scherzhaft zu sagen wagt –, dass der ökologische Fußabdruck eines Kindes dem von vierundzwanzig Neuwagen entspricht. Sie haben den Roman von Margaret Atwood gelesen, der schildert, wie Mägde als Gebärmaschinen gehalten werden, haben auch die Serie geschaut. Sie sind große Fans von Matrix. Sie begeistern sich für alles, was mit Raumfahrt zu tun hat. Ihr Lieblingsfilm, Auslöschung, handelt von einem Paar, das einen durchsichtigen Schild überwinden muss, um wieder zueinanderzufinden. Sie sprechen davon, ein Kind zu bekommen, das zweihundert oder mehr Jahre alt wird, ein ewiges Kind, das nie altert.
Ein Ruf aus der Zukunft.
Während ihrer Flitterwochen haben sie Museen in London und Madrid besucht. Lena wollte unbedingt Picassos Meisterwerk Guernica sehen. Im Prado standen sie vor einem verstörenden Gemälde, das prominent im größten Saal hängt. Es zeigt den Sündenfall, nur dass der Apfel von einem Kind an Eva überreicht wird, nicht von der Schlange. Welch ein Gedanke! Ein Kind setzt dem Dasein im Garten Eden ein Ende. Sie haben beide wenig für religiöse Geschichten übrig. In Lenas Augen enthalten die Texte der Bibel bestenfalls ein Körnchen Wahrheit. Trotzdem empfand sie dieses Gemälde als ungutes Omen, hatte das Gefühl, ertappt worden zu sein. Die Schlange in Gestalt eines Kindes signalisierte, dass der Ernst des Lebens begann. Jeder Rausch währt nur einen Augenblick, das ist eine grausame Grundtatsache. Während sie die grinsende Kind-Schlange betrachteten, durchzuckte sie wie alle Liebenden die Angst vor dem Ende ihres Glücks. Sie konnten gar nicht anders, als über ein eigenes Kind zu sprechen. Sie wären die hingebungsvollsten Eltern und würden es mit Liebe überschütten.
Immer wenn sie darüber reden, sagt sie zu Mike, er wäre bestimmt ein wunderbarer Vater. Sie hätte gern einen Jungen, der ihm gliche. Zugleich hat sie das Bedürfnis, sich zunächst ganz auf sich selbst zu konzentrieren. Als Künstlerin verspürt sie den Impuls, alles zu visualisieren, was sie erlebt. Und ein Kind könnte sie von diesem Ziel ablenken.
Er wiederum befürchtet, ihre künstlerischen Ambitionen könnten die Mutterinstinkte überlagern. Er beschließt seine Argumentation gern mit einer ironischen Bemerkung: Wenn du den Planeten retten willst, Lena, wenn dir wirklich daran gelegen ist, etwas für unseren Planeten zu tun, dann solltest du schwanger werden, denn unser Kind könnte der nächste Einstein oder die nächste Rosalind Franklin sein, wäre vielleicht klug und genial genug, um alles wieder in Ordnung zu bringen.
Lena lacht dann stets und sagt: Lass uns noch ein bisschen warten. Anschließend tippt sie auf ihren Bauch und ergänzt: Ist das okay für dich, Einstein?
Eines Nachts, beide lagen im Bett, ohne sich zugedeckt zu haben, fiel ihr wieder ein, dass ich auf dem Nachttisch lag.
Dieses Buch, sagte sie leise. Sie schien das Gefühl zu haben, von mir belauscht und beobachtet zu werden wie von einem Fremden. Einem Eindringling. Einem Spanner. Der Kind-Schlange.
Sie nahm mich zur Hand und betrachtete die Umschlagillustration des Mannes, der seinem Schatten die Krücke entgegenreckt. Sie setzte sich hin, hüllte ihre Beine ins Deckbett und strich über mein Gesicht. Sie las den Titel, in Sütterlin gesetzt, fast handschriftlich wirkend. Die Rebellion – Joseph Roth. Die Ränder meines Einbands waren abgenutzt. Verblasste Fingerabdrücke zeugten von Lesenden, die längst von dieser Welt verschwunden waren. Sie kann mich nicht lesen, weil ich die deutsche Ausgabe bin, hat in der Bücherei aber eine englische Übersetzung aufgetrieben und sich in die Geschichte des Leierkastenmannes vertieft. Als sie meine Seiten durchblätterte, entdeckte sie in einer oberen rechten Ecke die Überbleibsel einer zerquetschten Mücke, Andenken an einen fernen Sommer. Die geografischen Angaben auf den Seitenrändern konnte sie nicht einordnen. Sie fand die Karte, die ganz hinten gezeichnet worden war, faszinierend und strich mit den Fingerspitzen über die darauf skizzierte Landschaft, als würde sie ein Märchenreich betreten.
Schau mal, sagte sie, das muss ein Kiefernwald sein. Sie zeigte auf einen hölzernen Bildstock mit spitzem Dach. Sie sah eine Eiche und eine Bank. Und dies, meinte sie, ist wohl ein Denkmal – oder eine Sonnenuhr?
Mike ärgerte sich, dass sie mit den Gedanken woanders war, so als hätte ein Buch die Macht, einen Keil zwischen ihn und sie zu treiben.
Irgendetwas steckt dahinter, sagte sie.
Während sie die Karte betrachtete, war sie sich des Versprechens bewusst, das sie ihrem Vater gegeben hatte. Sie beschloss spontan, nach Berlin zu reisen. Sie hatte noch einen Onkel in Deutschland, genauer in Magdeburg. Der Bruder ihres Vaters. Vielleicht wüsste er, was es mit der Karte auf sich hatte.
Mike ließ sie ungern ziehen. Er kleidete seine Einwände in ein Lob. Er erinnerte sie daran, wie gut ihre Karriere laufe, dass New York genau der richtige Ort für eine junge Künstlerin sei. Es wäre ein Fehler, dieses Umfeld zu verlassen. Sie erwiderte, sie brauche frische Energie, neues Material. Und nun habe sie eine Vision, der sie folgen könne – die Lebensgeschichte eines Buches.
Du wirst mir fehlen, sagte Mike.
In künstlerischer Hinsicht würde sich Lena vermutlich als Diebin charakterisieren. Sie verarbeitet Bilder, die sie in anderen Medien findet. So wurde sie von dem berühmten Ende eines Films von Truffaut inspiriert. Ein Junge, der aus einem Erziehungsheim geflohen ist, erreicht das Meer, und als er sich in der letzten, langen Aufnahme umdreht, kommt in seiner Miene ein ganzes Leben zum Ausdruck, all seine Zuversicht, all sein Leid. Sie suchte im Internet nach ähnlich intensiven Bildern. Der Durchbruch gelang ihr mit Misfortune, einer Serie von Bildern kleiner häuslicher Katastrophen, die auf YouTube gepostet worden waren: Hunde, die gegen Türen rennen, Leute, die vom Fahrrad fallen, Kinder, die zusammenprallen. Sie filterte die überraschten Gesichtsausdrücke heraus, und indem sie diese intimen Momente in statische Bilder verwandelte, entzog sie ihnen die Komik und verwandelte sie in etwas sowohl Liebenswertes als auch Groteskes. Kunstkritiker interpretierten diese Arbeit als Ausdruck einer Welt, die in stiller Verzweiflung über ihre eigene Tollpatschigkeit lacht.
Am Tag vor ihrem Abflug nach Berlin fand sie noch die Zeit, das MoMA zu besuchen. Sie betrachtete ein Gemälde von Rothko, als wollte sie Abschied nehmen. Wenn man sagt, ein Kunstwerk spreche zu jemandem, bedeutet das, dass das betreffende Werk eine visuelle Energie auf den Betrachter überträgt. Umgekehrt wird ein winziger Anteil des Betrachters auf das Werk übertragen. Dieses Gemälde von Rothko hat inzwischen sicher eine Million Herzen aufgesogen. Ich wiederum häufe das Innenleben meiner Leserinnen und Leser an. Durch ihre Gedanken, die sich unterhalb des Textes angesammelt haben, bin ich zu einem lebendigen Geschöpf mit menschlichen Zügen und einem Gedächtnis geworden. Wenn sich die Geschichte zu wiederholen droht, merke ich das.
3
Alle Passagiere sind erleichtert, nachdem das Flugzeug sicher in der Luft ist. Der Cateringwagen naht im Gang. Lenas Stimme übertönt das Brummen der Flugzeugturbinen. Sie hat mit einer Sitznachbarin ein Gespräch angeknüpft, und sie sind beim Thema Insekten gelandet. Sie sei, erzählt die Frau, mit dem Auto aus Princeton gekommen und habe im Parkhaus des Flughafens festgestellt, dass ihre Windschutzscheibe vollkommen sauber war. Früher, wenn sie mit ihrem Vater bei Dunkelheit heimgefahren sei, habe sie im Licht der Scheinwerfer ganze Insektenschwärme gesehen. Als Kind, erzählt die Frau, habe sie es geliebt, verdorrte Fliegen und Motten mit dem Schlauch vom Auto zu spülen. Oft habe sie sie abkratzen müssen.
Lena wiederum erzählt der Frau von einem Urlaub in einem Cottage im irischen Cork. Sie hatte das Fenster offen und das Licht eingeschaltet gelassen, und als sie mitten in der Nacht erwachte, schien das ganze Zimmer in Bewegung zu sein. Alle möglichen Insekten saßen an den Wänden und umwogten die Glühlampe.
Ach, du meine Güte, sagt ihre Nachbarin. Mussten Sie umziehen, um weiterschlafen zu können?
Lena lacht freundlich und leise in sich hinein.
Nein, entgegnet sie. Sie sei wie gelähmt gewesen. Sie habe nicht einmal durch die wogende Insektenwolke zur Tür gehen können. Sie habe zu viel Angst gehabt, die Decke über ihren Kopf gezogen und sei irgendwann wieder eingeschlafen.
Am nächsten Morgen, sagt Lena, waren die meisten verschwunden.
Hier muss ich etwas beisteuern. Ein Buch will schließlich hinaus in die Welt, weil es etwas zu sagen hat. Ich würde den beiden gern erzählen, dass ich zwei Jahre neben einem schmalen Buch über Insekten im Regal stand. Es stammte von einem französischen Autor, der eines schönen Tages auf die Idee kam, alle Insekten, die er im Garten vorfand, zu dokumentieren. Er bestimmte und zeichnete sie und sammelte sie in seinem Tagebuch, als gehörten sie zur Familie. Dieses Buch steckte voller Herzenswärme. Wir wurden enge Freunde. Es war die schönste Zeit meines Lebens, denn das Summen glich einem ewigen Sommer.
Aber das ist natürlich absurd.
Ich kann nicht direkt zu Lena sprechen. Ich bleibe ein stummer Passagier. Ich bin nichts, solange meine Geschichte nicht durch Lesende angekurbelt wird. Wie sagt man? Lesen bedeutet, mit dem Kopf eines anderen zu denken. In den Geist eines anderen Menschen einzutreten.
Ach, wie sehne ich mich nach Lesern! Nach Menschen, die meinen Seiten Leben einhauchen.
Wir (also die Bücher) neigen dazu, uns von realen Situationen fernzuhalten. Wir plaudern nachts in den Bibliotheken. Sie glauben sicherlich, öffentliche Büchereien wären stille Orte, aber Sie sollten die Debatten hören, die bis Tagesanbruch in den Regalen geführt werden, das Getöse, die schiere Lautstärke, mit der Meinungen ausgetauscht werden. Alle reden durcheinander. Es gleicht einem gewaltigen geistigen Ringen. Einer Gerichtsverhandlung, in der jedes Buch seine eigenen Beweise vorträgt, ohne dass jemals ein abschließendes Urteil gefällt wird. Manche Bücher sind lauter als andere. Einige sind pompös und geradezu herrisch. Andere halten endlose Predigten und spucken Warnungen aus. Wieder andere sind glänzend gelaunt, gut gekleidet und in ihrem jeweiligen Plot gefangen. Einige sind schlicht sie selbst und reden nur, wenn sie tatsächlich etwas zu sagen haben. Manchmal bekommt man kein Wort dazwischen – das Stimmengewirr steigert sich zu einem einzigen Getöse, es kommt zu einem Schlagabtausch wie bei einer Parlamentssitzung, bis der Bibliothekar morgens zurückkehrt. Dann tritt wieder Stille ein.
Als das Essen serviert wird, kommt Lenas Mitreisende auf das Thema Insekten zurück. In Afrika, sagt sie, habe sie mal einen Burger aus Fliegen gekostet. Sie werden das nicht glauben, sagt sie, aber die Kinder fangen Fliegen, die über dem Victoriasee schwärmen. Die Eltern verarbeiten sie dann zu schwärzlichen Burgern, deren Proteingehalt fünfmal so hoch ist wie der eines Rindfleisch-Burgers.
Lena lächelt.
Nach dem Essen beschließt die Frau, einen Science-Fiction-Film zu gucken. Lena möchte Musik hören. Sie setzt die Ohrstöpsel ein und schließt die Augen. Sie schiebt die Tasche, in der ich hellwach auf dem Rücken liege, mit einem Fuß behutsam unter den Sitz vor ihr.
Eine Weile schlafen alle.
Und nach der Landung, als sich die Passagiere zum Aussteigen bereit machen und wieder auf ihre Handys schauen, als sie ihre Sachen aus den Gepäckfächern holen, stets darauf achtend, dass anderen nichts auf den Kopf fällt, scheinen sie vorübergehend in Bücher verwandelt worden zu sein. Dicht gedrängt im Gang stehend und bereit, in Bewegung gesetzt zu werden, gleichen sie alle Romanen. Erfüllt von Gedanken. Erfüllt von Fiktionen. Strotzend vor Möglichkeiten. Ein Flugzeug voller Plots in Gestalt von Passagieren, die darauf warten, dass die Türen aufgehen.
Lena spürt beim Aufstehen, dass sie von einem Mann betrachtet wird, der ihre Geschichte zu erraten versucht. Sie trägt eine grüne Lederjacke mit abgewetzten Ellbogen. Ihre Jeans hat Löcher. Das Tattoo eines Geckos schlängelt sich von ihrer Schulter bis auf den Hals. Sie schüttelt ihre langen Haare nach hinten. Sie nimmt sofort Blickkontakt auf und entledigt sich des Gaffers durch ein Lächeln. Man könnte ihr Lächeln auffallend nennen. Sie hatte das Gefühl, mit einem Mund voll überquellender Zähne aufzuwachsen. Sie charakterisiert die Ehe ihrer Eltern gern als zusammengewürfelte Mischung deutsch-irischer Zähne, ein dreidimensionales Bild für ihre Unvereinbarkeit: einerseits der Pragmatismus ihres Vaters, andererseits die stets zur Dramatisierung neigende Mutter. Sie brauchte Jahre, um beide Charaktere auszutarieren. Inzwischen lächelt sie ungehemmt, sie erinnert dabei an die junge Bianca Jagger auf Partys zu später Stunde, im Beisein von Prominenten wie Andy Warhol, die lange vor Lenas Geburt gelebt haben.
Sie greift in ihre Tasche und holt das Handy heraus, um Mike zu schreiben, dass sie gut angekommen sei. Die Passagiere bewegen sich zur Tür. Jeder eine Erzählung auf zwei Beinen, die sich noch einmal umdreht, um sicherzugehen, dass sie nichts vergessen hat, um dann, den Wegweisern folgend, durch lange Gänge zum Ausgang oder zur Gepäckabholung zu laufen und an der Kontrolle den Pass zu zücken.
4
Es muss die Luft sein. Die Sprache. Die unverwechselbare Klangkulisse Berlins. Das zeitlose Echo von Stimmen, die durch die Stadt hallen. Lena ist in eine Demo geraten. Die Menschen schreiten gleichmäßig aus, skandieren Parolen, schlagen Trommeln. Sie fordern ein Umdenken. Man dürfe keine Zeit verlieren – es gehe um unser aller Zukunft.
Sie stürzt sich wie eine Schwimmerin in die Menge und wird als vorübergehende Demonstrationsteilnehmerin von der starken Strömung mitgeschwemmt. Sie strandet an einem Ufer, weit von ihrem Ausgangspunkt entfernt. Nachdem sie den menschlichen Fluss hinter sich gelassen hat, biegt sie in eine stille Straße ein und betritt einen Innenhof.
Dort befindet sich eine Kaffeebar. Musik ertönt, jemand singt: I got seven days to live my life and seven ways to die. Lena wird von einer Frau in die Arme geschlossen. Sie heißt Julia. Julia Fernreich, und sie führt eine Berliner Kunstgalerie.
Sie setzen sich und bestellen Kaffee.
Julia erkundigt sich nach New York: Erzähl mir, was läuft. Sie gehen gemeinsame Bekannte aus der Kunstwelt durch. Julia bereitet gerade eine Ausstellung vor. Das Gästezimmer ihrer Wohnung sei schon aufgeräumt, aber das Wohnzimmer, fügt sie warnend hinzu, stehe voller Verpackungsmaterial und anderem Krempel.
Julia ist eine füllige Endvierzigerin. Ihre Stimme ist heiser und selbstbewusst. Sie hat ein dröhnendes Lachen. Ihre Wortwahl ist kämpferisch und ironisch, sie erteilt Ratschläge und bekennt sich unumwunden zu den Fehlern, die sie in ihrem Leben begangen hat. Sie kommt umgehend aufs Eingemachte zu sprechen und lässt sich über das Glück aus. Das falsche Ziel, sagt sie. Man hat noch nie so viel dummes Zeug über das Glück geredet, meint sie, und das, obwohl die Welt vor lauter Angst außer Rand und Band ist. Wir sprühen vor Optimismus in bedrohlichen Zeiten, erklärt sie laut lachend. Wenn man ganz für den Augenblick leben wollte, könnte man sich ebenso gut der Religion zuwenden. Sind dir je so viele Leute begegnet, die alles schönreden und mit Adjektiven wie toll, fantastisch, großartig, umwerfend, grandios um sich werfen?
Schön. Wunderbar. Super. Alles verlogen. Ein Triumphzug der Lügen. Allmählich gehen den Leuten die Superlative aus.
Dann will sie unvermittelt wissen, ob Lena hungrig sei – wolle sie vielleicht etwas essen?
Nein, danke, antwortet Lena, ich möchte nichts.
Glück macht die Leute nicht glücklich.
Ich bin ein gutes Beispiel, meint Julia. Ich hatte nie Glück in der Liebe. Meine letzte Freundin ist gerade ausgezogen. Es war immer mein Schicksal, verlassen zu werden. Durchgeknallte Bitch. Ich liebe sie trotzdem noch. Man sieht sie oft auf ihrem Motorrad herumdüsen.
Ich habe einen Sohn aus einer früheren Beziehung, erzählt Julia. Matt – du wirst ihn kennenlernen. Ein Glückspilz. Er hat zwei Mütter. Und einen Vater, eine männliche Bezugsperson, obwohl er ihn selten sieht. Ich sorge dafür, dass wir einmal im Jahr Urlaub machen, alle vier, als Familie. Matt ist in schlechte Gesellschaft geraten, er hat ein kleines Drogenproblem. Ich sollte ihn zu seiner anderen Mutter nach Hamburg schicken.
Ich hoffe, er fängt sich wieder, erwidert Lena.
Entschuldige, sagt Julia. Du bist ja nicht in Berlin, um dir meine Jammerei anzuhören.
Danach erzählt Lena. Ihre Stimme klingt jünger. Ihre Worte werden von einer Welle der Begeisterung getragen. Sie beugt sich vor, während sie erzählt, dass sie einen neuen Ansatz suche. Meine Arbeit, sagt sie. Ich hoffe, sie geht in eine neue Richtung, während ich in Berlin bin. Sagen wir mal, ich will hier Material sammeln.
Dann leg los, sagt Julia.
Lena zögert stets, dies zu erwähnen, doch ihre Misfortune-Serie hat ihr viel Anerkennung beschert. Julia weiß von der Ausstellung in einer kleinen Lower-East-Side-Galerie in Manhattan und möchte gern, dass Lena beim nächsten Mal in ihrer Galerie ausstellt. Sie gibt Lena einige konkrete Ratschläge. Als Kuratorin habe sie viele Künstlerinnen und Künstler erlebt, die hochgespült wurden und wieder abgesoffen seien. Es gehe nicht um Ruhm und Erfolg. Sondern um Provokation. Um Aggressivität. Kompromisslosigkeit. All das hast du, Lena. Glaub an dich. Zertrümmere die Klischees. Lass die Zügel schießen und tue etwas vollkommen Verrücktes.
Danke, sagt Lena.
Hock dich mitten in einen Raum, meint Julia, und scheiß auf den Boden, einfach, weil du Lust drauf hast.
Lena lacht.
Lena wurde durch ein Stipendium gewürdigt, mit dem sie ihren Berlinaufenthalt finanziert. Was sie braucht, ist ein kleines Atelier.
Ich höre mich um, sagt Julia. Ich strecke die Fühler aus. Vielleicht finden wir etwas.
Im Café scheint die Musik lauter geworden zu sein. Ein Mann will schreiend von einer Frau wissen, wo sie die letzte Nacht verbracht habe, und sie antwortet, sie habe unter den Kiefern geschlafen, wo die Sonne niemals hingelange, und die ganze Nacht gezittert. Die Stimme des Sängers klingt todtraurig.
Julia sagt: Ich liebe Cobain. Ich trauere täglich um ihn. Er hat sich einen Schuss Heroin gesetzt, vor einem Bild seiner Frau onaniert, und dann hat er sich erschossen, in dieser Reihenfolge.
Da übertönt jemand den lauten Gesang. Es ist ein Gast, der an der Bar sitzt und sich umdreht, um zu rufen: Meine Damen, achten Sie auf Ihre Handtaschen. Eine verspätete Warnung, die durchs Café hallt und zuerst ähnlich rau und tief klingt wie die Stimme des Sängers. Der Mann wiederholt seine Warnung – Handtaschen –, doch es dauert eine Weile, bis sie zum Tisch durchdringt, an dem Julia und Lena sitzen.
Julia springt auf. Die Stuhlbeine kreischen.
Hey, ruft sie. Ist das deine Tasche, Lena?
O mein Gott.
Die Tasche, in der ich in Erinnerungen an meine frühen Jahre in dieser Stadt schwelgte, hängt nun über der Schulter eines Diebs, der aus dem Café flieht. Warum überrascht mich das nicht? Berlin ist seit jeher die Hauptstadt der Bücherdiebe und entwendeten Taschen. Die Stadt der Opportunisten. In der man Bestohlenen oft genug anbot, ihr Eigentum zu einem Spottpreis zurückzukaufen.
Ich habe mich in der Tasche wohlgefühlt. Habe von der Zeit meiner Erstveröffentlichung geträumt, als ich noch druckfrisch war. Als Neuling wurde ich in der Literaturszene wohlwollend, wenn auch nicht überschwänglich aufgenommen. Ich wurde von einem gewichtigeren Buch überschattet, einem längeren Roman, einem Meisterwerk über ein Sanatorium, das im gleichen Jahr erschien. Ich war sehr neidisch auf dieses Buch. Manchmal habe ich mir gewünscht, mein Verfasser hätte es geschrieben. Andererseits war ich stets froh über meine Geschichte, die von einem Mann handelt, der ein Bein für die Verteidigung seines Landes gab, danach von seinen Landsleuten im Stich gelassen wurde und sich schließlich gezwungen sah, gegen alle zu rebellieren.
Sinnieren ist jetzt aber unangebracht. Man hetzt mit mir durch die Tür auf die Straße.
Gerade heimgekehrt, und ich werde geklaut.
Du solltest doch auf mich achten, Lena. Solltest du nicht auf mich aufpassen wie auf einen kleinen Bruder?
Ich spüre eine abrupte Beschleunigung. Jemand rennt mit mir durch die Straße. Julia scheint den Dieb zu verfolgen, denn ich kann ihre barsche Stimme hören, sie klingt, als wäre der Sänger, dessen Song im Café ertönte, wieder zum Leben erweckt worden und nach draußen gerannt, würde röhrend an Hauseingängen vorbeipreschen. Es klingt wie akustisches Graffiti. Der Dieb ist flink, ein junger Mann, der leichtfüßig auf lautlosen Sohlen rennt. Julia kann nicht mithalten. Es klingt, als würde sie ein Bierglas, das sie im letzten Moment von der Theke geschnappt hat, nach ihm werfen, gut gezielt, denn es trifft meinen Entführer, meinen unrechtmäßigen neuen Eigentümer mit einem deutlich vernehmbaren Geräusch am Hinterkopf, um anschließend auf dem Boden in Scherben zu gehen.
Glas auf der Straße. Das werde ich nie vergessen.
Mein Dieb flucht. Er betastet seinen Kopf. Er drückt seine Beute an sich und setzt seine Flucht fort. Julias Rufe verhallen, und ich würde ihr am liebsten wie in einem Film zurufen: Ich finde dich! Doch ich werde außer Hörweite in einen nahen Park verschleppt. Mein Dieb leert Lenas Tasche im Dunkeln neben einem randvollen Mülleimer. Er nimmt an sich, was er für wertvoll hält: Reisepass, Handy, Geld. Dann wirft er die Tasche auf den Mülleimer. Er lässt mich auf dem Boden zurück. Ich liege einsam und allein in meiner Geburtsstadt, Zeuge meines eigenen Diebstahls, direkt neben den Resten einer vietnamesischen Takeaway-Mahlzeit. Regen fällt. Ein warmer Spätsommerregen, der mich dennoch frösteln lässt. Ich spüre die Feuchtigkeit unter meiner Haut. Meine Seiten beginnen, sich zu wellen.
5
Am Abend der Bücherverbrennung, im Mai 1933, regnete es auch. Ein plötzlich aufziehender Regen drohte, alles zu verderben. Man konnte das wochenlang geplante Ereignis nicht mehr verschieben. Zur Überwachung hatte man einen Pyrotechniker engagiert. Auf dem Opernplatz war ein Holzgestell errichtet worden, getränkt mit Benzin. Es stand auf einer Schicht Sand, damit auf dem Boden keine Brandflecke zurückblieben.
In der Staatsbibliothek, gleich neben dem Ort der Verbrennung, ertönten die Parolen von Studenten, die mit einer Liste missliebiger Autorinnen und Autoren durch die Flure gingen. Sie war von einem Bibliothekar aufgesetzt worden, der festgestellt hatte, dass man Bücher genauso hassen wie lieben konnte. Mein Verfasser stand auf der Liste. Er hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon nach Frankreich abgesetzt.
Ein Angstschauer ging durch die Regale, während die Titel aufgerufen wurden. Bücher nahmen hastig Abschied voneinander, während man sie zu Bündeln schnürte, um sie bequemer nach draußen schaffen zu können. Die Studenten kannten sich aus und gingen gründlich vor, sie durchkämmten den Katalog nach Titeln, die aus der Bibliothek entfernt werden sollten wie faule Zähne aus einem Kiefer, und reichten diese in einer Menschenkette zum Ort der Verbrennung weiter.
Sie galten als unvereinbar mit dem nationalen Interesse.
Die Studenten triumphierten. Dies war ihr großer Moment. Ihre Rache für all die Jahre, die sie mit der Lektüre verhasster Bücher am Schreibtisch verbracht hatten. Sie waren mit Herz und Verstand nicht mehr bei den Büchern, sondern der neuen Infrastruktur, der Autobahn. Sie konnten dem geltenden Wissen den Rücken kehren und in einem glorreichen Akt des Vandalismus schwelgen. In einen Zustand wie vor der Aufklärung zurückkehren. Zu dem Recht auf Unwissenheit.
Sie konnten alles abhaken, das Einzige, was zählte, war der Geist der Nation.
Die Bücher meines Verfassers waren zwar im Katalog der Staatsbibliothek aufgelistet, aber ich gehörte Professor Glückstein. Dieser hatte mich zu Hause in seine Aktentasche getan und in die Humboldt-Universität gebracht, weil er nicht wusste, wie weit man bei der Säuberung gehen würde, ob die Studenten nicht doch in Privatwohnungen eindringen würden, was später tatsächlich geschehen sollte. Der Professor hatte sich in seinem Büro mit einem zuverlässigen Studenten verabredet, dem er mich zwecks sicherer Aufbewahrung übergeben wollte.
Dieser Student hieß Dieter Knecht. Er war Lenas Großvater. Ein großer junger Mann mit leiser Stimme, der lieber las, als Sport zu treiben. Er stand kurz vor dem Abschluss seiner Zwischenprüfung in Germanistik. Er nahm mich entgegen, und beide sprachen eine Weile voller Sympathie über meinen Verfasser.
Indem Lenas Großvater diese Schmuggelware, diesen einen Roman vor der Verbrennung rettete, setzte er eine stille Welle des Widerstands in Gang, die bis heute anhält. Es war ein kleines, aber bedeutsames Ereignis, das sich hinter verschlossenen Türen abspielte, fern der Katastrophe auf dem Opernplatz. Es beeinflusste den Lebensweg von Menschen. Es wirkte sich auf Entscheidungen aus, die später, lange nach dem Untergang des Reichs der Bücherverbrenner, unter ganz anderen Umständen getroffen wurden.
Lenas Großvater, der die Gesänge und Parolen im Flur hörte, schob mich unter den Mantel, neben sein Herz. Er verschränkte die Arme vor der Brust, damit ich nicht herausfiel, und verließ das Gebäude über eine breite steinerne Treppenflucht.
Auf dem Opernplatz loderten Flammen. Studenten hatten schon Tage zuvor Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft geplündert. Sie tobten gegen den Schmutz in der Literatur, gegen sexuelle Freiheiten, Kapitalismus, die jüdische Dominanz, wie sie es nannten. Die von der Bibliothek auf den Opernplatz führende Menschenkette lieferte stetig verhasste Bücher. Jede Autorin und jeder Autor wurden im Schnellverfahren verurteilt – man rief den Namen auf, erklärte kurz, warum die Werke der neuen nationalen Vision nicht entsprachen, und warf sie ins Feuer. All das wurde landesweit im Rundfunk übertragen.
Mein Verfasser wurde der sogenannten Asphaltliteratur zugeordnet, dem neuen Stil der multikulturellen Städte.
Die ersten Bücher, die im Feuer landeten, stammten von Karl Marx. Es folgten zahlreiche weitere jüdische Autoren. Ein Autor wurde wegen seines Namens für einen Juden gehalten und protestierte im Nachhinein wütend gegen die Verleumdung. Man verbrannte die Bücher einer Autorin, deren Protagonistinnen zu selbstbewusst agierten und den Nazi-Idealen der Mutterschaft nicht entsprachen. Thomas Manns Der Zauberberg wurde verschont, Heinrich Manns Roman Professor Unrat jedoch nicht. Ebenso wenig die Werke eines Dramatikers, der ein Stück über einen Mann geschrieben hatte, dessen Genitalien in einer Schlacht abgerissen worden waren. Und die Werke eines noch berühmteren Dramatikers, dessen Dreigroschenoper in Berlin großen Beifall gefunden hatte und der später in einem Gedicht sagen sollte, wie froh er sei, dass man ihn nicht verschont habe: »Verbrennt mich! Tut mir das nicht an! Laßt mich nicht übrig!«
Man hörte eine Schaulustige sagen: Herrlich ist das, herrlich. Wie meinte sie das wohl? Bejubelte sie das neue anti-intellektuelle Zeitalter, in dem man sich das Denken sparen konnte und keine Fragen mehr stellen musste, weil man sowieso alles bejahte?
Immer mehr Bücher warf man in die Flammen. Ein Mann mit weißem Hemd zuckte vor der Hitze zurück, als er dem Feuer zu nahe kam. Feuerwehrleute standen bereit. Ein Autor, dessen Werke im Feuer landeten, verschwand eilig, als sein Name ausgerufen wurde.
Viele Bücher, die an jenem Abend verbrannt wurden, hatten den Krieg zum Thema. Es waren Bücher, die sich weigerten, den Tod zu glorifizieren. Unheroische Geschichten von Männern mit abgerissenen Gliedmaßen, durchtrenntem Rückgrat oder Lungenproblemen. Von Männern, denen das halbe Gesicht fehlte. Berlin wimmelte von Veteranen, die zitternd zu Hause saßen und ihre Angehörigen nicht mehr erkannten. Die Schilderungen von Kriegsverstümmelungen sollten aus der Öffentlichkeit getilgt werden, weil sie angeblich die Moral schädigten, den Krieg in ein schlechtes Licht rückten und eine falsche Einstellung gegenüber Tod und Leid förderten.
Mein Verfasser berichtete als Journalist über seinen Besuch in einem Lazarett mit zweieinhalbtausend Verwundeten, alle gesund geboren und auf dem Schlachtfeld verstümmelt. Ein Soldat kehrte als Schatten eines Mannes von der Front zurück. Mein Verfasser nannte diese Männer lebende Kriegsdenkmäler. Er lernte im Krankenhaus jemanden kennen, dessen Lippen fehlten. Davon abgesehen war er unversehrt, die explodierende Granate hatte ihm nur die Lippen abgerissen – er konnte nicht mehr küssen.
Der Protagonist des Romans Die Rebellion