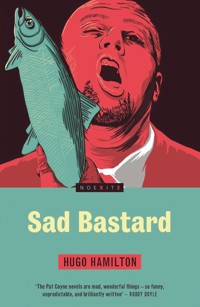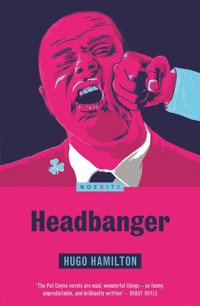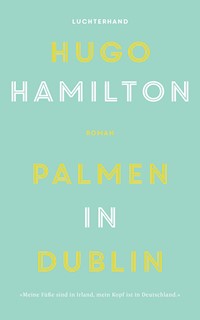8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Hugo Hamiltons ergreifender neuer Roman basiert auf einer Reise nach Berlin, die der irischdeutsche Schriftsteller im Mai 2008 mit seiner Kollegin Nuala O’Faolain unternahm. Die berühmte irische Schriftstellerin war an Krebs erkrankt und hatte nur noch wenige Tage zu leben. Ihr letzter Wunsch war es, dass ihr Freund Hugo Hamilton sie zwei Tage lang auf einer letzten Reise durch Berlin begleitete …
Die Schriftstellerin Úna weiß, dass ihre Tage gezählt sind, weil sie unheilbar an Krebs erkrankt ist. Kurz vor ihrem sicheren Tod will sie sich noch einen letzten Wunsch erfüllen und einmal mit ihrem guten alten Freund nach Berlin reisen. Liam kennt Úna, die zwanzig Jahre älter ist als er, schon lange und hat sich gern auf diese Reise eingelassen, auch wenn er nicht weiß, ob er der Aufgabe gewachsen sein wird. Zwei Tage lang begleitet er seine Freundin durch Berlin. Úna hat eine Liste vorbereitet, will das Pergamon-Museum besuchen, sich bei einem Essen in der Paris Bar von alten Freunden verabschieden und unbedingt »Don Carlos« in der Berliner Staatsoper sehen. Vor allem aber will sie reden. Die Zeit drängt, und ihre Gespräche erfordern, wie Úna es nennt, einen »Rhythmus der Ehrlichkeit«. Es gibt keine Floskeln mehr, keine Ausflüchte, keine falsche Scham. Beide erzählen von entscheidenden Ereignissen in ihrem Leben, Úna von ihren Liebschaften, ihrem berühmten Vater, der alkoholsüchtigen Mutter und, immer wieder, dem schrecklichen Tod ihres jüngeren Bruders. Liam seinerseits spricht von den Unsicherheiten in seiner Liebesbeziehung und den Problemen mit seiner Tochter … Tiefe Zuneigung, Ehrlichkeit und ein unverwüstlicher, vielleicht typisch irischer Humor machen diesen Roman einer Abschiedsreise nach Berlin zu einem ganz besonderen, zuinnerst bewegenden Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Ähnliche
Hugo Hamilton
Jede einzelne Minute
Roman
Deutsch von Henning AhrensMit einem Nachwort von Elke Heidenreich
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem TitelEvery Single Minute bei Fourth Estate, London.
Copyright © der Originalausgabe 2014 Hugo Hamilton
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Der Verlag konnte nicht alle Rechteinhaber ausfindig machen. Berechtigte Ansprüche mögen bitte dem Verlag gemeldet werden.
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-12410-6 V002 www.luchterhand-literaturverlag.deBitte besuchen Sie auch unseren LiteraturBlog www.transatlantik.defacebook.com/luchterhandverlag
twitter.com/LuchterhandLit
Für Mary Rose
Where can I find another brother, ever?
Seamus Heaney, Sophocles
1
Sie trägt die roten Segeltuchschuhe. Sie sind auf allen Fotos zu sehen. Als man ihr am Flughafen die Stufen hinunterhilft. Im Botanischen Garten. Im Pergamon-Museum. Und vor der Oper. Die kennt jeder. Diese Converse-Schuhe, mit flachen, weißen Gummisohlen und groben, weißen Nähten. Und weißen Schnürbändern. Und Löchern in Metall eingefasst, zwei davon auf der Außenseite.
In diesen Schuhen fühlte sie sich leichtfüßig.
Sie stehen neben ihrem Hotelbett. Sie selbst sitzt auf dem Stuhl, bereit zum Aufbruch. Sie trägt weiße Strümpfe, die sie von einem Langstreckenflug aufbewahrt hatte, und ich ziehe ihr die Schuhe an, die roten Segeltuchschuhe, binde die Schleifen. Dann helfe ich ihr auf. Ich habe den Rollstuhl so hingestellt, dass ich sie herumdrehen und, während ich sie an den Ellbogen halte, langsam wieder absetzen kann. Ich höre ihren Atem.
Ob ihr warm genug ist? Sie sollte einen Schal tragen, denn ihr Hals ist ungeschützt. Es werde schon gehen, sagt sie, im Notfall könne sie ja den Mantelkragen hochschlagen.
Sie wollte nach Berlin. Und ich begleitete sie. Das Reisen war ihr Lebenselixier, und sie wollte unbedingt noch ein letztes Mal wegfahren. Ganz egal wohin, sagte sie. Weg. Einfach weg. Wie wäre es mit Berlin?, schlug ich vor, und sie antwortete: Ja, warum nicht? Sie hatte oft mit Berlin geliebäugelt, die Reise aber immer wieder aufgeschoben, und nun befürchtete sie, es nie mehr dorthin zu schaffen. Ich finde es toll, wie man in Deutschland Kartoffeln zubereitet, sagte sie. Ich möchte das Pergamon-Museum sehen. Den Botanischen Garten. Und die Kirche, die man nach dem Krieg als Ruine stehen ließ.
Dieses Mal ist es anders, sagte sie mehrmals während des Fluges von Dublin nach Berlin. Als die Stewardess ein Foto von uns machte, musste sie weinen. Sie lächelte und weinte gleichzeitig, und sie sagte: Dieses Mal ist es anders, Liam. Dieses Mal ist es anders.
Vielleicht hatte sie Angst, so fotografiert zu werden. Denn das Foto hielt sie fest. Einerseits hielt es sie fest, andererseits ließ es sie stehen.
Ihre Reiselust war ungebrochen, und die Reise nach Berlin gab ihr neuen Auftrieb. Sie war sozusagen ein Zugewinn an Zeit. Überzählige Zeit. Ja, ich sterbe, sagte sie, aber davon abgesehen geht es mir doch prima! Sie versuchte immer wieder, ihr Los mit Humor zu nehmen, bemühte sich, die Realität auszublenden. Verständlicherweise. Sie war voller Energie und wollte alles sehen. Alle Galerien. Alle Museen, alle Parks, alle Orte, die sie noch nicht kannte. Sie wollte mehr über die Geschichte erfahren, wollte wissen, wie sich die Stadt nach dem Fall der Mauer verändert hatte und wie sie jetzt aussah, in diesem Moment, lebendig, atmend und voller Erinnerung. Alles, was für mich noch möglich ist, sagte sie. Auf dem Briefpapier des Hotels hatte sie eine Liste geschrieben, einen Terminplan, wenn man so will.
Diese Reise werde ich nie vergessen, sagte sie danach zu mir.
Sie habe jede einzelne Minute genossen, sagte sie. Sie werde sich bis an ihr Lebensende an diese Reise erinnern. Angesichts ihrer Krankheit klingt das zwar widersinnig, aber man versteht wohl, was sie damit meinte. Man darf nicht alles wörtlich nehmen. Sie sprach so hoffnungsvoll von der Welt und der Zukunft, als wäre ihr die Angewohnheit, zuversichtlich nach vorn zu schauen, in Fleisch und Blut übergegangen. Und vielleicht ist es ja tatsächlich schwierig, sich die Worte »bis an mein Lebensende« zu verkneifen, selbst wenn man nicht weiß, wie viel Zeit einem bis dahin noch bleibt.
Ihr blieb noch etwas mehr als eine Woche.
Sie bat mich, Karten für die Oper zu buchen. Sie wollte in die Staatsoper, ganz in der Nähe des Adlon, in dem wir wohnten. Damals lief Don Carlos.
Verdi, sagte sie. Da müssen wir unbedingt hin. Ich habe Don Carlos zuletzt in der Met in New York gesehen.
Leider war die Vorstellung schon ausverkauft. Ich rief bei der Rezeption an und fragte, ob man noch Karten besorgen könne. Der Angestellte war sehr hilfsbereit. Er meinte zwar, wir seien ziemlich spät dran, versicherte mir jedoch, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Und wenn es in ganz Berlin nur noch eine einzige Karte gebe, sagte er, dann würde sie sie bekommen.
Ich erzählte ihr, wir hätten gute Chancen.
Vielen Dank, Liam, sagte sie.
Dann greift sie nach der Perücke. Dichte, hellbraune Locken, fast wie ihr echtes Haar. Sie reißt wie ein Kind mit beiden Händen daran und wirft die Perücke quer durch das Zimmer, als hätte sie in ihrem Leben nichts Abscheulicheres gesehen. Als sie die Perücke zum ersten Mal aufsetzte, musste sie lachen. Sie hatte das Gefühl, sich als Erwachsene zu verkleiden. Damit sehe ich zum Brüllen aus, findest du nicht auch?, fragte sie. Auf manchen Fotos erkennt man sie nur, wenn man weiß, dass sie es ist. Ohne ihre Locken sieht sie jetzt fremd aus, irgendwie nackt. Ihr Gesicht ist durch die Medikamente aufgedunsen. Ich glaube, dass sie die Perücke nur trug, weil sie niemanden erschrecken wollte – sie merkte, wie entsetzt die Leute beim Anblick ihres kahlen Kopfes dreinschauten, weil ihnen plötzlich bewusst wurde, dass es jeden treffen kann, unverhofft.
Ich setze das Ding nicht auf, sagt sie.
Kann ich gut verstehen.
Ich will wieder ich selbst sein, sagt sie.
Die Perücke liegt auf dem Fußboden wie ein von einem Auto überfahrenes Tier. Ich hebe sie auf und lege sie in ihren Koffer. Dann nehme ich meine Mütze ab und reiche sie ihr, denn sie kann nicht ohne Kopfbedeckung nach draußen. Es ist Mai, aber wir sind in Berlin, und die Temperaturen sind unberechenbar.
Hier, nimm meine Mütze.
Es ist eine graue, ganz normale Baseballmütze ohne Logo. Sie nimmt die Mütze und starrt sie eine Weile an. Sie sagt nichts dazu, und sie betrachtet sich auch nicht im Spiegel, denn sie misstraut Spiegeln. Die Mütze sitzt wie angegossen, und ich hoffe, sie behält sie auf. Sie steht ihr gut, und ich erlaube mir die Bemerkung, dass sie ganz hervorragend zu den Schuhen passe, den roten Segeltuchschuhen.
Jetzt siehst du aus wie Steven Spielberg.
Sie lacht.
Was soll’s, sagt sie. Wir sind ja in Berlin. Hier kennt mich kein Schwein.
Sie hatte eine unvergessliche Art, solche Dinge zu sagen. Man erkannte sie überall an ihrer Stimme: mädchenhaft hoch und immer so erstaunt, als wäre alles neu und wunderbar. Ihre ganze Art erinnerte an ein Mädchen. Alles Unbekannte weckte ihre Begeisterung. Sie konnte mit großer Hingabe die Unwissende spielen, was zur Folge hatte, dass man ihr alles mit klaren, schlichten Worten erklärte, ohne zu erwarten, dass sie etwas erwiderte. Sie legte den Kopf schief und hörte aufmerksam zu, und am Ende erzählte man ihr Dinge, die man einem Erwachsenen, ob Frau oder Mann, niemals anvertraut hätte.
Kinder sind unsichtbare Beobachter, sagte sie.
Ich muss gestehen, dass ich manche ihrer Äußerungen erst nach ihrem Tod richtig verstanden habe. Zu ihren Lebzeiten war ich manchmal etwas schwer von Begriff, vielleicht, weil wir einander so nahe waren. Es mag widersinnig klingen, aber was man direkt vor der Nase hat, wird einem sehr häufig erst im Nachhinein bewusst. Ich hoffe, dass ich nichts verfälsche. Ich will nichts durcheinanderbringen. Ich halte mich an die Fotos und die Orte, die wir gemeinsam besucht haben. Aber ich kann natürlich nicht ausschließen, dass ich ihre Worte nicht mehr ganz richtig in Erinnerung habe.
2
Sie hatte diese Tasche. Aus durchsichtigem Plastik, mit einem Reißverschluss oben, ursprünglich die Hülle eines Kopfkissens, Oberbetts oder dergleichen. Eine stabile Tasche mit weißen Kordeln als Griffen, ohne Logo oder Aufdruck. Der ganze Inhalt war zu sehen. Alles, was sie bei sich trug, ihre gesamten Habseligkeiten. Man konnte ihre Geldbörse, ihre Medikamente, ihre Taschentücher und ihre Lesebrille sehen, ihren Pass, die Schlüsselkarte für das Hotelzimmer und die Zeitungsausschnitte, die sie für später aufhob. Ein Buch, das sie nie lesen würde. Ihr ausgeschaltetes Handy. Dinge aus dem Hotel, zum Beispiel ein Kugelschreiber.
Und Schokolade. Berge von Schokolade.
Im Grunde sind wir doch alle Kinder, oder? Das sagte sie damals zu mir.
Diese Tasche war keine Notlösung. Nein, sie hätte sich jede beliebige Tasche leisten können, aber Handtaschen waren ihr nicht wichtig. Diese durchsichtige Tasche sei absolut in Ordnung, sagte sie, und außerdem zu schade zum Wegwerfen. Sie behielt sie aus ökologischen Gründen, aber auch, um anderen zu signalisieren, dass sie keine jener Frauen war, die Unsummen für Designertäschchen verpulverten. Nein, das war nicht ihre Art. Sie war nicht auf der Welt, um zu protzen. Sie brauchte nur eine Tasche für ihre Sachen. Vermutlich wollte sie damit sagen, dass sie nichts zu verbergen, keine Geheimnisse hatte. Es war ganz eindeutig ihre Tasche, sie konnte niemand anderem gehören. Außerdem war es praktisch, dass sie den Inhalt sehen konnte, wenn sie etwas suchte. Dann wurde ihre Hand zu einem Teil des Inhalts, und während sie nach etwas kramte, zum Beispiel nach der Brille mit dem weinroten Gestell, gab die Tasche knarrende Geräusche von sich. Sie hatte die Brille erst kürzlich in New York gekauft, und sie erzählte mir, dass der Optometriker einen wohlriechenden Atem gehabt habe. Sie wollte ihn in ein Gespräch verwickeln, aber er sagte immer nur: Schauen Sie bitte nach oben, schauen Sie nach unten, schauen Sie auf mein linkes Ohr. Und beim anderen Auge ging es von vorn los: Schauen Sie nach oben, nach unten, auf mein rechtes Ohr. Er kam ihr so nahe, dass sie seinen Atem riechen konnte. Und sein Atem duftete nach Brombeermarmelade.
Wir sind doch alle Kinder. So ist das. Wir sind alle nur Kinder, sagte sie.
Sie stellte sich gern vor, dass mit jedem Tag ihr Leben neu begann. Sie genoss den Aufenthalt im Adlon. Etwas Luxus ist nicht übel, sagte sie. Mitten im großen Foyer hatte man einen Bereich mit Tischen und Stühlen durch Kordeln abgetrennt, und dort saßen Leute vor Kaffee und Kuchen oder einem Glas Champagner, als hätten sie noch nie etwas anderes getan. Direkt darüber befand sich eine erleuchtete Kuppel mit einer Galerie, die einen Blick auf die unten sitzenden Gäste bot. Wenn ich mich recht erinnere, war die Rezeption links vom Eingang, rechts davon eine Cocktailbar. Ein Marmorflur führte an den Fahrstühlen vorbei zum hinteren Bereich. Trotz der vielen Menschen, der ständigen Klaviermusik, des Geplauders und des Zischens der Fahrstuhltüren war es ein stiller Ort. Sie fand es herrlich, Menschen kennenzulernen, zum Beispiel die Hotelangestellten. Sie knüpfte Gespräche an und schloss sofort Freundschaft, stellte ihnen Fragen, persönliche Fragen wie: Glauben Sie an Geister? Haben Sie einen Freund? Wie finden Sie Lady Gaga? Und jeder antwortete wahrheitsgemäß, allein schon aus Höflichkeit. Sie redete, als wäre sie eine von ihnen, und tatsächlich hatte sie vor vielen, vielen Jahren einmal in London als Zimmermädchen gearbeitet, ein Begriff, den man heute vermutlich nicht mehr benutzt. Sie gehörte sozusagen dazu, vertrieb sich die Zeit mit einem Schwätzchen, hielt die anderen von der Arbeit ab.
Ihr Zimmer war größer und luxuriöser als meines und bot einen Blick auf die betriebsame Straße. Durch das Fenster meines Zimmers sah ich den mit Blumen bepflanzten Innenhof. Die Einrichtung fand ich allerdings etwas überkandidelt – sinnlose Vergeudung natürlicher Rohstoffe. Alle Wände holzvertäfelt, wuchtig und repräsentativ. Wie in einer Vorstandsetage – trifft es das Wort? Und die Bäder waren eine Nummer für sich, sehr groß, mit Marmorfliesen und wunderschönen Handtüchern, die aussahen, als wären sie noch nie benutzt worden. Alles wirkte gleichzeitig nagelneu und alt. Nach dem Fall der Mauer hatte man dieses Hotel von Grund auf neu erbaut. Von seinem Vorläufer war bis auf den Namen und den Ruf nichts übrig geblieben.
Ich frage mich manchmal, was die Leute in Hotelzimmern so treiben, welche Verrücktheiten sich vor mir dort abgespielt haben.
Unerträgliche Vorstellung, sagte sie. Vergiss es. Das möchte man gar nicht wissen. Während ihrer Zeit als Zimmermädchen in London hatte sie genug gesehen, die unglaublichsten Dinge. Und ihre Aufgabe bestand darin, die Beweise zu vernichten. In einem Hotelzimmer darf nichts mehr an die früheren Gäste erinnern. Auch wenn sie vielleicht nur dasitzen, einander in die Augen schauen und ihre Namen hauchen.
Wir sind startklar, und sie holt die Liste aus ihrer Tasche. Ich schiebe den Rollstuhl durch den Flur und drücke den Knopf für den Fahrstuhl. Sie reicht mir die Liste, die ich unten dem Fahrer geben soll.
Wir reden ihn aber nicht mit Fahrer an, sagt sie. Oder doch?
Wir nennen ihn Manfred.
Macht es ihm etwas aus, mit Manfred angesprochen zu werden?
So heißt er nun mal, erwidere ich. Bitte nennen Sie mich Manfred. Das waren seine Worte.
Sie will wissen, wie gut sein Englisch ist.
Ziemlich gut.
Erzähl ihm nichts, sagt sie. Bitte.
Sie möchte nicht, dass Manfred von ihrem Zustand erfährt. Es ist zwar nicht ihre Art, etwas zu verheimlichen, aber es ist wohl keine schlimme Lüge, wenn sie Manfred verschweigt, dass sie bald sterben wird. Das würde jeder tun.
Sie wollte nichts mehr erklären. Wahrscheinlich hatte sie auch keine Lust, die medizinischen Details noch einmal durchzukauen. Was die Ärzte sagten, wie sie mit den Röntgenbildern wedelten, wie man sie im Flur allein ließ. Wie die Ärzte dann zurückkamen und ihr versicherten, dass sie trotz der Hiobsbotschaft munter wie ein Fisch im Wasser sei. Ihr Herz sei topfit, ihr Blutdruck optimal. Sie erzählte mir, dass man über ihre gesunden Organe geredet habe, als könnte man mehreren Frauen die besten Stücke entnehmen und dann zu einem weiblichen Musterexemplar zusammensetzen. Die Krankenschwester machte sogar eine Bemerkung zu der Haut auf ihren Ellbogen, wollte wissen, wie sie es geschafft hatte, immer noch Ellbogen wie eine Zehnjährige zu haben.
Ich habe ihm erzählt, dass du Schriftstellerin bist, sage ich zu ihr.
Gut. Aber mehr wird nicht verraten, sagt sie.
Er hält dich für meine Mutter.
Sie lacht. Ich soll deine Mutter sein?
Mütter sind liebenswert, antworte ich, und sie muss noch einmal laut lachen.
Die Mutterrolle ist mir vollkommen fremd, sagt sie.
Ach, Unsinn.
Sie ist natürlich nicht meine Mutter, aber da sie ein gutes Stück älter ist und im Rollstuhl sitzt, war das Manfreds messerscharfe Schlussfolgerung.
Nur um das klarzustellen: Sie war nicht meine Mutter, und wir hatten auch nie etwas miteinander. Keine frühere Romanze, keine gemeinsame Vorgeschichte. Wir waren nicht aneinander gebunden, lebten nicht als Liebes- oder Ehepaar zusammen, bildeten auch keine verwandtschaftliche Zwangsgemeinschaft. Wir waren nur gut befreundet. Wir begegneten uns zu einem Zeitpunkt, als wir beide in einer Krise steckten. Sie hatte mehr Jahre auf dem Buckel als ich, sie hatte mehr Bücher gelesen, sie hatte mir in fast jeder Hinsicht etwas voraus. Es störte sie nicht, dass ich weniger wusste als sie. Und dass sie nicht kochen konnte, störte sie auch nicht. Ich ließ sie nicht einmal in die Nähe einer Küche. Vermutlich verstanden wir einander so gut, weil wir offen waren und viel lachten. Jeder von uns nahm den jeweils anderen ernst, aber nicht zu ernst. Ich kam oft bei ihr vorbei und spielte, während sie las, mit Buddy, ihrem Hund, warf einen ihrer Schuhe durch das Zimmer, damit er ihn apportierte. Sie konnte beim Lesen die ganze Welt ausblenden. Sie las auch weiter, wenn ich, verfolgt von Buddy, um ihren Stuhl rannte, ja sogar wenn ich den Schuh hinter ihrem Rücken versteckte, damit Buddy über sie hinwegspringen musste. Erst wenn ihr das Buch aus den Händen flog, schaute sie auf und sagte: Ich bringe dich um, Liam.
Manfred wartet schon an der Rezeption. Er kommt auf uns zu, als wir aus dem Fahrstuhl treten, und ich habe das Gefühl, als wäre er schon seit einiger Zeit auf uns zugekommen, vielleicht schon seit Stunden, vielleicht schon seit Tagen. Vielleicht ist er auch schon immer auf uns zugekommen. Ich frage mich, woher er wusste, wann er sich in Bewegung setzen musste. Sein Kopf ist kahlgeschoren. Er ist nicht übergewichtig, aber auf eine durchtrainierte Art gut gepolstert. Ich vermute, dass er Gewichte stemmt. Er trägt Anzug und Krawatte, und als er uns lächelnd eine Hand entgegenstreckt, schwillt seine Brust regelrecht an. Irgendwo spielt jemand Klavier, oben auf der Galerie, nehme ich an.
Ich übergebe Manfred den Terminplan und weise ihn darauf hin, dass wir die Reihenfolge jederzeit ändern können. Außerdem seien wir offen für andere interessante und nicht auf der Liste stehende Ziele, vorausgesetzt, die Zeit reiche. Er starrt die Liste an, als hätten wir uns in der Stadt geirrt. Sie ist nicht der Topographie des Ortes, sondern dem Ablauf der Geschichte gefolgt, und hat weit auseinanderliegende Ziele notiert. Er zeigt auf diesen und jenen Punkt, pustet nachdenklich, ändert die Reihenfolge so, dass sie für ihn als Fahrer sinnvoll ist.
Während ich mit Manfred spreche, dreht sie sich zum Fahrstuhl um, den wir gerade verlassen haben, und betrachtet die altmodische Stockwerksanzeige über den Türen, die Manfred verraten haben dürfte, dass wir auf dem Weg nach unten waren. Diese Anzeige ist eines der wenigen Charakteristika des alten Adlon, die man in das neue Hotel integriert hat. Sie erinnert an einen Film von Hitchcock: eine Art Uhrzeiger, der die Stockwerke anzeigt und Interessierten verrät, wo sich der Fahrstuhl gerade befindet.
Ich kümmere mich um Ihre Mutter, sagt Manfred.
Er nimmt mir den Rollstuhl ab, und schon ist sie unterwegs, mit der Baseballmütze und den roten Segeltuchschuhen, im Arm die durchsichtige Tasche mit ihren Habseligkeiten. Es geht die marmorne Rollstuhlrampe hinunter, durch die automatischen Türen und dann, unter der roten Markise, zu den am Straßenrand wartenden Fahrzeugen. Manfred öffnet die Schiebetür seines Wagens, und nachdem er sie hineingehievt hat, stelle ich fest, dass sich die Tür elektronisch schließt. Bitte nicht anfassen, sagt Manfred, als ich sie mit der Hand zuschieben will.
Auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor findet eine Demonstration statt. Eine bescheidene Menschenmenge mit Plakaten, die Polizisten sind weit in der Überzahl. Es geht sehr ruhig zu, und es wird viel gesungen. Man scheint für Tibet zu demonstrieren.
Im Grunde hat Manfred recht: Sie war wie eine Mutter. Sie gab Ratschläge wie eine Mutter, sie stellte Fragen wie eine Mutter, sie kommandierte andere herum wie eine Mutter. Bier und Kuchen, das ist doch kein Essen, Liam. Bestell dir etwas Anständiges. Schau dich nur an: Sogar die Geier würden dich links liegen lassen. So redete sie. Als wäre sie für mich verantwortlich. Aber am Ende bekam man immer, was man wollte, sie war leicht herumzukriegen, und sie bestand jedes Mal darauf, die Rechnung zu begleichen. Ihre mütterliche Ader kam auch darin zum Ausdruck, dass sie sich in mein Leben einmischte und am laufenden Band Kommentare abgab, alles, was ich tat, in die Kategorien Richtig oder Falsch einordnete. Sie nahm mich ins Kreuzverhör wie eine Mutter, hielt meinen Arm fest und musterte mich mit einem Röntgenblick, sprach Dinge aus, die ich niemals laut gesagt hätte. Sie konnte Gedanken lesen. Kein Wunder, dass sie von allen für meine Mutter gehalten wurde. Sie war für jeden wie eine Mutter. Unterschiedslos. Sogar für Manfred, unseren Fahrer. Sie hielt sich an seinem Arm fest, während er ihr in den Wagen half, und löcherte ihn mit Fragen, bis er ihr erzählte, dass er ein halber Türke sei, weil er eine türkische Mutter habe, dass er verheiratet und Vater dreier Kinder sei, alle jünger als zehn. Sie erwiderte, sie sei hundertprozentige Irin, wäre aber liebend gern zur Hälfte etwas anderes.
Vielleicht ist das so, wenn man kinderlos ist – dann behandelt man alle anderen wie Kinder. Sie klang sogar wie eine Mutter, wenn sie über Tibet sprach.
Mein Gott, sagte sie, sie wollen doch nur sie selbst sein.
3
Dann sitzen wir nebeneinander hinten im großen, grauen Auto, und sie erzählt von Don Carlos. Im Grunde, sagt sie, sei die Oper eine ausufernde Familiengeschichte, ganz ähnlich wie ihre eigene. Unser Gespräch verläuft anfangs sehr sprunghaft. Sie sorgt sich um ihren Hund. Ob es Buddy gut geht? Was meinst du, Liam? Ich versichere ihr, dass er ganz bestimmt gut aufgehoben ist. Sie sagt, ich müsse sie unbedingt an die Bettwäsche erinnern. Sie plant immer alles im Voraus, und sie hat die feste Absicht, in Berlin neue Bettwäsche zu kaufen und mit nach Dublin zu nehmen.
Manfred fährt uns durch den großen Park, vorbei an der goldenen Siegesgöttin, die in so vielen Filmen und Musikvideos zu sehen ist. Die Sonne scheint, und viele Spaziergänger haben Kaffeebecher in der Hand. Andere joggen mit Wasserflaschen. Und mit Hunden. Sie nehmen ihre Hunde mit, wenn sie laufen. Und wenn sie Fahrrad fahren. Sieh mal, sagt sie und zeigt auf einen Mann, der einen Anhänger für ein Kind an seinem Fahrrad hat. Oder sitzen zwei Kinder darin? In Dublin sieht man so was selten, sagt sie. Sie wundert sich über die vielen Frauen, die ohne Helm auf dem Fahrrad unterwegs sind. Bei dem dichten Verkehr. Wenn sie durch eine Stadt radeln würde, sagt sie, dann sicher nicht ohne Helm. Wir verlassen den Park und passieren ein großes, gelbes, zirkuszeltähnliches Gebäude. Sieht aus wie ein Piratenhut, sagt sie. Es ist die Berliner Philharmonie. Noch ein Ort, den sie gern auf die Liste setzen würde.
Sie erklärt mir, warum sie Don Carlos so heiß und innig liebt.
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Handlung kompliziert. Es geht um einen Vater, der seinen Sohn tötet. Der König sieht sich gezwungen, seinen Sohn zu opfern, um seine Macht zu sichern. So könnte man es kurz zusammenfassen. Die Oper spielt während der Inquisition in Spanien. Der König will sein Reich mit Gewalt zur Ruhe bringen, aber sein Sohn, Don Carlos, hält nichts von dieser Brutalität, er will das Morden beenden, damit jeder heimkehren und mit seinem geliebten Menschen friedlich zusammenleben kann. Doch für den König zählt nur die Macht. Er ist süchtig danach, und er schreckt vor nichts zurück, wenn es darum geht, sie zu bewahren, auch nicht vor dem Mord an seinem eigenen Sohn. Die Entscheidung, die er zu treffen hat, ist schrecklich, und er wird von Reue und Schuldgefühlen gequält, da seine väterlichen Instinkte gegen die Tat aufbegehren. Und es gibt noch ein Problem: Don Carlos liebt eine Französin, die sein Vater inzwischen gewaltsam zur Frau genommen und zu seiner Königin gemacht hat. Diese Frau liebt Don Carlos immer noch, und dieser ist untröstlich. Sein Vater hat also einen weiteren Anlass, seinem Sohn zu misstrauen und ihn aus dem Weg zu räumen. Das mag etwas simpel klingen, ist aber mehr oder weniger der Kern der Oper.
Er muss seine Liebe abtöten, sagt sie. Der König muss seine Liebe ersticken, um seinen Sohn töten zu können.
Diese Oper erinnert sie an ihre eigene Familie, und das ist auch der Grund, warum sie sie unbedingt noch einmal sehen will. Sie erzähle die Geschichte einer jeden Familie, sagt sie, und genau darum sei Don Carlos nach wie vor so beliebt – jeder Mensch im Publikum könne an die Geschichte anknüpfen, sie sei allgemeingültig. Immer, wenn sie diese Oper sieht, muss sie an ihren Vater und an das Schicksal ihres Bruders denken, ihres kleinen Bruders. Die Dramatik ist so groß, dass man sich einbildet, der eigenen Lebensgeschichte zuzuschauen, sagt sie. Man geht vollkommen auf in dem, was sich auf der Bühne abspielt. Ihre Phantasie, sagt sie, sei zu lebhaft. Sie ist wieder ein Mädchen und sieht zu, wie sich ringsumher die Geschichte ihrer Familie entfaltet. Sie ist jedes Mal so tief ergriffen, dass sie glaubt, ihr Bruder würde auf der Bühne zum Leben erwachen. Sie sieht ihren Vater, der seine Liebe erstickt. Sie muss miterleben, wie ihr Bruder am Ende abgeführt wird. Und sie ist vollkommen hilflos, sitzt wie gebannt da. Sie kann nichts tun, kann nicht einschreiten.
Früher gingen wir in Dublin manchmal gemeinsam ins Theater. Wenn sie Freikarten bekommen hatte, fragte sie mich, ob ich sie begleiten wolle. Wir aßen vorher eine Kleinigkeit und gingen dann früh zum Theater, damit sie noch ein paar Bekannte treffen konnte. Wenn sie eintrat, stupsten die Leute einander an, und ich konnte sehen, wie sie tuschelten. Sie tauchte in die Menge ein, wurde Handschlag um Handschlag immer tiefer ins Gewühl gezogen, von einer Gruppe zur anderen weitergereicht, bis es ihr zu viel wurde. Dann zeigte sie auf mich und verabschiedete sich mit der Ausrede, eine Verabredung an der Bar zu haben. Sie kannte jede Menge Theaterbesucher, die mir gar nichts sagten – Schriftstellerkollegen, Journalisten, Fernsehberühmtheiten, bekannte Gesichter. Am lebhaftesten erinnere ich mich daran, dass in der Pause immer wieder Leute auf sie zukamen, um ihr zu sagen, dass sie ihr Buch gelesen hatten. Wenn sie dann mit Lob überschüttet wurde, wand sie sich, als wäre das Licht zu grell. Einmal drehte sich eine Frau zu ihr um und reckte sich über zwei Reihen, um ihre Hand zu schütteln und sich zu bedanken. Die Frau sagte nur: Danke für Ihre Ehrlichkeit, danke, dass Sie Sie selbst sind und so schonungslos offen über Ihr Leben und Ihre Familie geschrieben haben.
In Berlin sprachen wir meist über Familien. Wir sprachen über Don Carlos, über Väter und Mütter und Brüder. Über Männer und Frauen und Tanten und Onkel und Kinder und Jesuiten und Liebe und Hochzeiten und Freunde und Liebhaber und das Leben – über Gott und die Welt, könnte man sagen. Über das, was sich in Familien abspielt. Und das umfasst wohl so gut wie alles. Wir fuhren kreuz und quer durch die Stadt und schauten uns die Sehenswürdigkeiten an, und währenddessen erzählten wir einander Geschichten. Familiengeschichten und Liebesgeschichten, ob mit glücklichem oder unglücklichem Ausgang.
Taugt das Wort Liebe noch als Bezeichnung für Liebe?, wollte sie einmal von mir wissen. Was soll man auf eine solche Frage antworten? Natürlich ist es immer noch ein geeignetes Wort. Das beste Wort für Liebe, das es gibt. Oder gibt es ein treffenderes? Vielleicht Chemie? Sie sagte, man verwandele alte Wörter in junge Wörter, verändere die Bedeutung, so dass man sie nicht wiedererkenne. Und Liebe, das sei ein Wort wie Heimat und Hoffnung, wie Leben oder Leidenschaft – alles Wörter, die man nie wieder an den richtigen Platz gestellt habe, sagte sie.
Ich würde sagen, dass der Aufenthalt in Berlin für eine große Offenheit zwischen uns sorgte. Während dieser Zeit vergaßen wir ihr Schicksal, alles war wie aufgeschoben. Es war wohl ein Trost für sie, nicht daran denken zu müssen, was ihr bevorstand. Solange wir in Bewegung waren und Geschichten erzählten, solange die Straßen vorüberzogen und wir genug Familiengeschichten auf Lager hatten. Wahrscheinlich war alles viel leichter zu erklären, weil gar nichts erklärt werden musste.
4
Sie muss viele Steroide nehmen, damit sie besser atmen kann. Sie kramt in ihrer durchsichtigen Tasche, holt ein Medikament heraus, liest das Etikett, lässt es wieder in die Tasche fallen. Sie hebt die Tasche und mustert sie von außen. So findet sie schneller, was sie sucht. Sie greift noch einmal hinein, holt ein weiteres Medikament heraus, studiert das Etikett, lässt es wieder hineinplumpsen. Schwer zu sagen, ob sie jedes Mal das gleiche herausfischt oder ob es sich um unterschiedliche Mittel handelt.
Das Leben, sagte sie, sei wie die Lungenflügel. Die Zeit sei wie die Lungenflügel. Stimmt das? Man sei immer nur so lebendig wie die eigene Lunge, und ihrer Lunge sei sozusagen die Zeit davongelaufen, so etwas sagte sie zu mir. Sie schilderte mir, wie es ist, wenn man im Krankenhaus seine Atmung untersuchen lässt: Man wird von der Krankenschwester vor einen Apparat gesetzt, der die Lungenfunktion testet. Man schließt die Lippen um eine Gummitülle, die direkt auf dem Apparat sitzt, und wird von der Krankenschwester aufgefordert, tief einzuatmen, bis die Lunge voll ist, und die Luft möglichst lange anzuhalten. Dann muss man die ganze Luft herauslassen. Die Krankenschwester, erzählte sie, habe zu ihr gesagt, es sei wie ein Atemgesang. Tief Luft holen, ganz tief, bis die Lunge prall gefüllt ist, dann die Luft anhalten, anhalten, anhalten, ja, weiter anhalten, anhalten, gut so, und jetzt raus damit, alles auspusten, alles auspusten, weiter so, bis auf den letzten Rest, hervorragend, sehr gut. Danach ist man knallrot vor Anstrengung, und die Krankenschwester sagt, man solle sich entspannen und normal atmen, und dann geht das Ganze von vorn los, noch eine Runde.
Außer den Steroiden nimmt sie auch noch Schmerzmittel. Und man hat ihr Xanax verschrieben, damit sie nachts schlafen kann.
Im Hotel erzählte sie mir, dass sie manchmal Angst habe. Ich habe Angst zu ertrinken, sagte sie. Ich habe Angst, dass meine Lunge vollläuft und dass ich ertrinke. So ist das, wenn man sich eine Lungenentzündung holt – als würde man ertrinken. Ich habe Angst, allein zu ertrinken, sagte sie. Und das Xanax soll die Angst lindern. Sie sagte, es sorge dafür, dass sie wieder wie früher sei, bevor alles anfing, es bringe ihr wahres Selbst zum Vorschein. Denn sie machte sich Sorgen und konnte sich nicht mehr richtig konzentrieren. Den einen oder anderen Zeitungsartikel konnte sie lesen, aber mit zu vielen Neuigkeiten war sie überfordert. Sie wollte jetzt lieber alles mit eigenen Augen sehen und den Menschen zuhören. Sie konnte auch nichts mehr schreiben. Welchen Sinn hätte es noch gehabt, etwas zu Papier zu bringen? Sie hatte keine Zeit mehr für Erfundenes, ertrug es nicht mehr, einen Roman zu lesen oder einen Film zu sehen. Nein, sie hatte keine Zeit mehr für Ausgedachtes.
Aber Don Carlos war eine Ausnahme, weil ihr diese Oper so viel bedeutete.
Sie bietet mir im Auto ein Xanax an, als hätte ich dringend eines nötig, als würde sie mir Pfefferminz oder Schokolade anbieten. Sie schüttelt lachend ihre Tasche. Noch jemand ohne Xanax? Manfred überhört sie. Er ist in seiner eigenen Welt, konzentriert sich auf den Verkehr. Und natürlich sollte man niemandem, der am Steuer sitzt, eine solche Tablette geben. Ich brauche auch keine, aber als sie sagt, es könne nicht schaden, willige ich ein. Ich will kein Spielverderber sein, und wer weiß? Vielleicht hat es eine positive Wirkung.
Ich erzähle ihr, dass Maeve, meine Tochter, bald heiraten wird.
Wie schön, Liam.
Sie glaubt, ich wäre besessen von meiner Tochter. Sie mag es nicht, wenn ich zu viel von Maeve erzähle, und das kann ich verstehen, denn sie ist kinderlos, und Vater-Tochter-Geschichten setzen ihr zu. Sie fühlt sich wohl ausgeschlossen. Bittet mich nach einer Weile stets, nicht mehr davon zu sprechen. Also erzähle ich nur das Nötigste und füge hinzu, dass die Hochzeit für August geplant sei.
Das ist nicht mehr lange hin, sagt sie.
Du bekommst natürlich eine Einladung, erwidere ich.
Vielen Dank, sagt sie.
Da wird mir bewusst, was ich gesagt habe. Die Chance, dass sie an der Hochzeit teilnehmen kann, tendiert gegen null. Vielleicht liegt es am Xanax. Vielleicht bringt es mein wahres Ich zum Vorschein.
Ich werde kommen, sagt sie.
Aber bis dahin sind es noch drei Monate.
Ich werde da sein, Liam. Tot oder lebendig. Wo soll gefeiert werden?
Es kommt mir so vor, als hätte die Zukunft sie verlassen. Alles wird ohne sie weitergehen.
Die Hochzeit, Liam! Wo findet sie statt?
Auf dem Hof, antworte ich, auf Shanes Bauernhof. Seine Eltern sind die treibende Kraft, sie wollen auf ihrem Hof unbedingt eine Hochzeit feiern. Sie haben große Scheunen, und außerdem stehen die Ruinen einer alten Kirche auf ihrem Land. Handfeste Pläne gibt es noch nicht, aber so ist es gedacht. Sie möchten, dass die beiden in der Ruine heiraten, und sie werden für alle Fälle ein Zelt aufstellen. Der Hof wird noch bewirtschaftet, und Vieh haben sie auch. Aber wie ich Shane kenne, wird er für alles eine Lösung finden und dabei auch nicht vergessen, dass sich die Hochzeitsgäste schick machen werden.
Eine Bauernhochzeit, sagte sie. Da wäre ich gern dabei.
Einmal gab sie mir ein Foto, das sie in Maeves heutigem Alter zeigte – vielleicht vierundzwanzig, höchstens fünfundzwanzig. Sie hatte üppige Locken. Das Foto entstand, bevor sie aufbrach, um in London als Zimmermädchen zu arbeiten, kurz vor dem Abschied von ihren Eltern und ihrer Heimat. Sie ging furchtlos, aber auch ohne zu ahnen, was ihr bevorstand. Damals, als sie so voller Leben war, hätte ich sie gern kennengelernt. Sie war bestimmt ein großartiges Motiv, wagemutig und bereit, es mit allem aufzunehmen, sogar mit vollkommen unvorhersehbaren Dingen. Dieser Blick. Sie sah einem direkt in die Augen. Ihre Augenbrauen waren vielleicht das Auffälligste. Wie von einem Kind gezeichnet, könnte man sagen. Markant. Auf dem Foto wirken ihre Augen, als hätte sie viele wichtige Fragen.
Hier, in Berlin, schaut sie genauso. Sie hat die Augen einer Vierundzwanzigjährigen. Die Brauen sind noch da, alle anderen Haare sind durch die Bestrahlung ausgefallen. Das Atmen fällt ihr schwer, und sie bekommt nicht genug Luft, um mir alles zu erzählen, was sie auf dem Herzen hat.
Einmal, erzählt sie, habe sie einen Ort besucht, der eine Labsal für die Lunge sei. Ein Salzbergwerk in Rumänien, genauer gesagt in Transsylvanien. Das Bergwerk war noch in Betrieb, wurde aber von Menschen mit Lungenleiden aufgesucht, weil das Salz der Luft die Feuchtigkeit entzog. Damals war sie mit Noleen auf Reisen. Die beiden legten den weiten Weg von der ukrainischen Grenze hinunter nach Tirana und dann längs der Küste bis nach Italien zurück.
Das Salzbergwerk wurde ihnen mehrfach empfohlen. Aus dem ganzen Land, ja aus der ganzen Welt reisten Menschen mit Lungenproblemen dorthin. Man glaubte, auch die beiden wären extra deswegen gekommen, und wollte wissen, woher sie stammten. Aus Irland, antwortete sie, und ihre Lunge würde einem feuchten Cottage gleichen. Worauf man erwiderte, dass sie an diesem Ort goldrichtig sei.
Das Bergwerk ist berühmt, erzählt sie, eine Pilgerstätte, nur dass man dort nicht betet. Die Temperatur bleibt Tag und Nacht konstant. Sie schildert, wie Lastwagen weiße Steinsalzbrocken abtransportierten, während ständig Leute kamen, um die trockene Luft tief zu inhalieren. Viele davon saßen im Rollstuhl. Uralte Frauen. Leute, die sich das Rauchen abgewöhnt hatten, zündeten sich dort wieder eine Zigarette an. Warum auch nicht? Die Luft war so sauber, dass sie in den Nasenlöchern prickelte, sagt sie. Ganze Familien veranstalteten dort unten ein Picknick, samt Klappstühlen und Kassettenrekordern, die man kaum hörte, weil das Bergwerk so riesig war. Die Kinder atmeten die gute Luft ein und spielten Fußball wie in einem unterirdischen Stadion. Im Schein von Flutlichtern. Die Tore hatten sie auf den Salzwänden markiert.
Und nach dem Besuch im Salzbergwerk, erzählt sie, badeten sie in einem nahe gelegenen Salzsee, der nie zufriert. Es war ein sehr sonderbares Gefühl, wie schwerelos auf der Oberfläche zu treiben. Die Beine ragten wie Schwimmkörper aus dem See, sie wollten nicht unter Wasser bleiben, schienen kein Gewicht mehr zu haben. Und Noleen hatte diese Gabe, über alles zu lachen, was schieflief. Sie schienen eine ziemlich schlammige Badestelle gewählt zu haben, denn als sie aus dem See kamen, waren sie so schmutzig wie Wrestlerinnen, und beide schüttelten sich vor Lachen und mussten sich aneinander festhalten, um nicht umzufallen.
Die große Freiheit des Reisens, sagt sie.
Ihre Lunge, sagt sie, sei in Rumänien geblieben. Sie sagt: Meine Lunge ist in Rumänien, mein Kopf ist in New York, meine Füße sind in Berlin, und der Rest ist in Dublin.
5
Ich habe sie mehrmals vor Publikum sprechen hören. Ich habe sie während des Literaturfestivals in Ennis, County Clare, im Old Ground Hotel auf der Bühne erlebt. Ebenso in Aspen, Colorado. Damals war ich zum ersten Mal in den Rocky Mountains, aber ich kannte das Gebirge längst. Ich kannte es aus Filmen, die ich als Junge im Fernsehen gesehen hatte. Ich kannte auch viele Songs, in denen es um diesen Teil Amerikas ging.
Einiges von dem, was sie in Ennis sagte, wiederholte sie in Aspen. Sie war gekommen, um über sich selbst und ihre Familie zu reden. Darüber, wie es früher für eine Frau in Dublin gewesen war. Wie sich alles verändert hatte. Dass inzwischen vieles besser, manches aber verloren gegangen war. Sie war bekannt dafür, aus ihrem Herzen keine Mördergrube zu machen, egal wo, ob in Ennis oder Aspen. Sie war die weltweit einzige Expertin für ihre Kindheit und das, was sich in ihrer Familie abgespielt hatte, und an diesen Tatsachen konnte niemand rütteln. Überall waren die Zuhörer begeistert und sehr daran interessiert, wie es in Irland zuging und warum sie nicht bereit war, ihren Eltern zu vergeben.
Das Problem bestand darin, dass sie vor Publikum immer aufgewühlter und zorniger wurde und am Ende öffentlich weinte. Heutzutage wollen die Leute alles aus erster Hand erfahren, und es machte sie verletzlich, wenn sie in ihre Kindheit zurückkehrte und sich alles wieder vor Augen rief, als wäre es gestern geschehen und würde nie ein Ende nehmen. Jedes Mal, wenn sie vor einem Publikum über diese Themen sprach, schien sie zu glauben, die Sache mit Tränen emotional unterfüttern zu müssen, damit man sie ernst nahm.
Manchmal befürchtete ich, dass sie ihre Geschichte durch das wiederholte Erzählen immer weiter aufblähte. Man kennt das von sich selbst: Wenn jemand so nett ist, einem zuzuhören, neigt man zur übertriebenen Schilderung seiner Erinnerungen. Gut möglich, dass sie alles so schlimm und drastisch darstellte, weil die Zuhörer jedes Mal wie gebannt an ihren Lippen hingen. Oder es ging nur darum, für das Schlimmste die besten Worte zu finden. Sie hatte ein gutes Gedächtnis für schlechte Erinnerungen, wie sie selbst einmal sagte.
Oder stutzt man alles unter Normalmaß zusammen, wenn man darüber spricht?
Damals hatte ich Bedenken und glaubte, sie könnte sich zu sehr in die Sache verbissen haben. Es tat mir weh, sie in der Öffentlichkeit weinen zu sehen. Ich fand es schlimm, wenn sie ein Taschentuch aus dem Ärmel zog oder ihren Tränen freien Lauf ließ, ohne auch nur zu versuchen, sie zu verbergen. Also schlug ich ihr etwas vor, mit besten Absichten und als guter Freund. Im fernen Aspen sprach ich Dinge aus, die mir im heimischen Ennis niemals eingefallen wären. In den Rocky Mountains konnte ich sie vorsichtig auffordern, etwas mehr Verständnis für ihre Eltern aufzubringen. Ich wollte weder, dass sie ihnen vergab, noch wollte ich ihre Geschichte anzweifeln oder ihr unterstellen, dass sie sich alles nur einbildete. Nein, ich wollte ihr vor Augen führen, dass es für sie zu quälend war, immer wieder darüber zu sprechen. Wäre es nicht besser, wenigstens den Versuch zu unternehmen, mit allem abzuschließen?
Damit du endlich zur Ruhe kommst.
Mir ging es ähnlich, da ich mich von meinem Vater verfolgt fühlte. Er lebt nicht mehr, aber Tatsache ist, dass er nie verschwindet. Ich fürchte mich noch heute vor seinen Wutausbrüchen. Manchmal denke ich, dass es besser wäre, so zu tun, als hätte man nie einen Vater gehabt, wenigstens ab und zu Urlaub von seinen Erinnerungen zu machen und nicht wie ein Kind die ganze Nacht in der Befürchtung wach zu liegen, dass er zur Tür hereinkommen könnte.
Sie hörte mir zu. Legte wie üblich den Kopf schief und erlaubte mir, auszureden. Ich glaubte, etwas Kluges zu sagen oder wenigstens Argumente vorzutragen, die eine Überlegung wert waren. Im Grunde wollte ich darauf hinaus, dass einen die Erinnerung an die eigene Kindheit in manchen Punkten trügen kann. Außerdem, sagte ich, solltest du deinem Vater das Recht auf eine Erwiderung zugestehen, auch wenn er sich nicht mehr rechtfertigen kann. Andernfalls wäre es wie ein Militärtribunal. Mehr sage ich gar nicht. Du solltest dich in sie hineinversetzen und ihren Standpunkt verstehen.
Das ist doch Quatsch, Liam.
Sie meinte, die Höhe sei mir offenbar zu Kopf gestiegen. Ich könne nicht mehr klar denken. Ich würde die Dinge zu einfach sehen, vielleicht weil das Hotel oberhalb der Wolken liege und die Luft so sauerstoffarm sei.
Es ist mein Leben, sagte sie.
Ich will dir nur helfen, darüber hinwegzukommen, sagte ich.
Du willst, dass ich meinen Bruder im Stich lasse?
Ich weiß noch, dass sie einen Joghurt aß. In ihrem Zimmer mit Blick auf die Berge. Sie erwiderte, dass ihre Erinnerungen ihre einzige Stütze seien. Erinnerungen verändern sich ständig, und man muss Schritt mit ihnen halten, sagte sie. Der Joghurt war alle, aber sie fand immer noch kleine Reste. Dann leckte sie die Aluminiumlasche ab und widmete sich im Anschluss wieder dem Becher.
So machen das Schriftsteller, sagte sie. Ihr Gedächtnis gleicht einem Labor, in dem sie nach Themen suchen, über die sie schreiben können. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist fast unmöglich, sagte sie. Man erfindet nichts. Es ist nur so, dass Dinge, die längst passiert sind, in der Vorstellung noch einmal stattfinden, wenn auch in phantastischer Form.
Sie kratzte mit dem Löffel im Joghurtbecher, als wollte sie darin nach einem Thema suchen, über das sie schreiben konnte.
In dem Becher findest du ganz bestimmt nichts mehr, sagte ich.