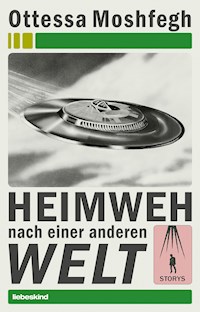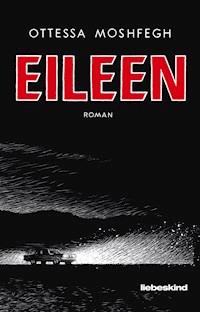
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlagsbuchhandlung Liebeskind
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Kleinstadt in Neuengland, Weihnachten 1964. Die vierundzwanzigjährige Eileen Dunlop hasst sich und die Welt. Sie muss für ihren paranoiden, alkoholkranken Vater sorgen, einen ehemaligen Cop, mit dem zusammen sie in einem heruntergekommenen Haus lebt. Ihren mageren Lohn verdient sie sich als Sekretärin in einer Vollzugsanstalt für jugendliche Straftäter. Als die schöne Harvard-Absolventin Rebecca Saint John ihren Dienst als Erziehungsbeauftragte des Gefängnisses antritt, ist Eileen sofort Feuer und Flamme. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als zu sein wie diese selbstbewusste, unabhängige Frau. Doch die Freundschaft von Rebecca Saint John hat einen hohen Preis. Eileen wird in ein grauenhaftes Verbrechen hineingezogen … In ihrem preisgekrönten Roman beschreibt Ottessa Moshfegh das Schicksal einer jungen Frau, die ausbrechen will aus einer von dunklen Obsessionen und roher Gewalt geprägten Welt. Eigentlich kann man dieser Welt nicht entkommen. Es sei denn, man nimmt das Gesetz in die eigene Hand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
OTTESSA MOSHFEGH
EILEEN
ROMAN
Aus dem Englischenvon Anke Caroline Burger
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
»Eileen« bei Penguin Press, New York.
© Ottessa Moshfegh 2015
© Verlagsbuchhandlung Liebeskind 2017
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Thomas Ott / RawStudios
Umschlaggestaltung: Sieveking, München
eISBN 978-3-95438-083-1
Für X.
Inhalt
1964
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Heiligabend
Das Ende
1964
ICH SAH WIE EIN MÄDCHEN AUS, das man sich im Bus vorstellen könnte, vielleicht mit einem Netz über den mausbraunen Haaren, in einem leinengebundenen, aus der Bücherei stammenden Band über Pflanzen oder Geografie lesend. Man könnte mich für eine Schwesternschülerin oder Stenotypistin halten, würde vielleicht die fahrigen Hände, den zuckenden Fuß, die zerkaute Lippe bemerken. Unscheinbar sah ich aus. Ich kann mir diese junge Frau leicht vorstellen, ein seltsam graues, jüngeres Ich, das eine unauffällige Lederhandtasche oder ein Tütchen Erdnüsse in der Hand hält. Jede Erdnuss wird einzeln zwischen den Handschuhfingern gerollt, die Wangen wölben sich nach innen, wenn sie in den Mund gesteckt wird. Dabei starrt die junge Frau sorgenvoll aus dem Fenster. Im Morgenlicht war der dünne Flaum auf meinem Gesicht zu sehen, den ich mit Kompaktpuder – einem Ton zu rosa für meinen bleichen Teint – abzudecken versuchte. Ich war dünn, meine Haltung steif, ich hatte eine kantige Figur, und meine Bewegungen waren zögerlich, eckig. Mein Gesicht war mit Aknenarben bedeckt, und ob sich Freude oder Wahnsinn unter meiner tödlich kalten neuenglischen Fassade verbargen, blieb unklar. Hätte ich eine Brille getragen, wäre ich vielleicht als Intellektuelle durchgegangen, aber ich war zu ungeduldig, um wirklich schlau zu sein. Man hätte sich vorstellen können, dass ich mich in der Stille abgeschlossener Räume wohlfühlte, stumpfsinniges Schweigen genoss, während ich den Blick langsam über das Papier, die Wände, die schweren Vorhänge wandern ließ und nie weiter dachte als bis zu dem, was ich vor Augen hatte – Buch, Tisch, Baum, Mensch. Aber ich hasste Stille. Ich hasste Bewegungslosigkeit. Ich war im Grunde gegen alles und permanent unglücklich oder aufgebracht. Ich versuchte, meinen Zorn zu kontrollieren, was mich nur noch unbeholfener, unglücklicher und wütender machte. Ich war wie Jeanne d’Arc oder Hamlet, nur ins falsche Leben geboren – das Leben eines Niemands, einer Heimatlosen, unsichtbar. Besser kann man es nicht ausdrücken: Ich war damals nicht ich selbst. Ich war jemand anders. Ich war Eileen.
Außerdem war ich damals – das war vor fünfzig Jahren – schrecklich prüde. Man brauchte mich nur anzusehen. Ich trug schwere Wollröcke, die bis übers Knie gingen, dazu dicke Strumpfhosen. Jacken und Blusen knöpfte ich bis oben hin zu. Nach mir drehte niemand den Kopf um. Dabei war nichts wirklich Schlimmes oder Abstoßendes an meinem Aussehen. Im Grunde genommen war ich jung und nicht unbedingt hässlich, eher normal, durchschnittlich, könnte man sagen. Aber damals fand ich mich das Allerletzte – widerlich, abstoßend, untauglich für die Welt. Da kam es mir idiotisch vor, irgendwie Aufmerksamkeit auf mich ziehen zu wollen. Ich trug nur selten Schmuck und nie Parfüm oder Nagellack. Eine Weile hatte ich einen Ring mit einem kleinen Rubin am Finger. Der hatte meiner Mutter gehört.
Meine letzten Tage als die kleine, zornige Eileen spielten sich Ende Dezember in der grimmigen Kälte jener Kleinstadt ab, in der ich geboren und aufgewachsen war. Mehr als ein Meter Schnee war bereits gefallen und schmolz auch nicht mehr weg. Unerschütterlich lag er in allen Vorgärten und drängte wie eine Flutwelle an die Brüstung jedes Erdgeschossfensters. Tagsüber taute die oberste Schneeschicht ein wenig an, etwas Matsch floss in die Gullys und man erinnerte sich, dass es Freude und Sonnenschein im Leben geben konnte. Aber im Laufe des Nachmittags verschwand die Sonne, alles fror wieder zu und bildete nachts eine Eisschicht, die so dick war, dass sie das Gewicht eines ausgewachsenen Mannes tragen konnte. Jeden Morgen streute ich Salz aus dem Eimer, der neben der Haustür stand, auf den schmalen Gartenweg von unserer Veranda zur Straße. Vom Dachsparren über der Tür hingen Eiszapfen, und wenn ich darunter stand, stellte ich mir vor, sie würden abbrechen und meine Brüste durchbohren, den dicken Knorpel an meiner Schulter durchtrennen oder sich wie eine Gewehrkugel in mein Gehirn bohren. Der Schnee auf dem Bürgersteig war von den Nachbarn weggeschippt worden, denen mein Vater zutiefst misstraute, weil sie Protestanten waren und er Katholik. Allerdings misstraute er allen und jedem. Wie die meisten alten Säufer war er voller Wahn- und Angstvorstellungen. Dieselben protestantischen Nachbarn hatten uns als Weihnachtsgeschenk einen weißen Weidenkorb mit gewachsten, in Zellophan verpackten Äpfeln, einer Schachtel Pralinen und einer Flasche Sherry vor die Tür gestellt. Auf der beiliegenden Karte stand: »Gott segne Sie beide.«
Wer wusste schon, was in unserem Haus vor sich ging, während ich bei der Arbeit war? Es war ein altes, braunes Holzhaus im Kolonialstil mit roten Fensterrahmen. Ich stelle mir vor, wie mein Vater in Weihnachtsstimmung an der Sherryflasche nuckelt und sich einen alten Zigarrenstummel am Gasherd anzündet. Das ist ein lustiger Gedanke. Normalerweise trank er Gin. Manchmal Bier. Wie ich bereits sagte, war er ein Säufer. In der Hinsicht war er unkompliziert. Wenn etwas nicht stimmte, ließ er sich leicht ablenken und beruhigen: Ich drückte ihm einfach eine Flasche in die Hand und ging aus dem Zimmer. Natürlich war seine Trinkerei für mich als junge Frau belastend. Es machte mich unruhig und gereizt. Das ist normal, wenn man mit einem Alkoholiker zusammenlebt. In diesem Punkt ist meine Geschichte nichts Besonderes. Ich habe im Laufe der Jahre mit vielen Alkoholikern zusammengelebt, und bei jedem habe ich immer wieder von Neuem gelernt, wie sinnlos es ist, sich Sorgen um ihn zu machen, wie müßig, nach dem Warum zu fragen, dass es reiner Selbstmord ist zu versuchen, ihm zu helfen. Trinker sind Trinker und bleiben Trinker. Jetzt lebe ich allein. Glücklich. Und sehr zufrieden. Ich bin zu alt, um mir den Kopf über die Probleme anderer Leute zu zerbrechen. Ich vergeude keine Zeit mehr damit, an die Zukunft zu denken oder über ungelegte Eier nachzugrübeln. Aber als ich jung war, beschäftigte ich mich ständig mit der Zukunft, was meistens mit meinem Vater zu tun hatte – wie lang er noch leben würde, was er heute wieder anstellen würde, welches Chaos ich vorfinden würde, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause kam.
Wir hatten kein schönes Zuhause. Nach dem Tod meiner Mutter gingen wir ihre Sachen nicht durch, wir gaben nichts weg und räumten auch nicht um, und da sie nun nicht mehr zum Putzen da war, war das Haus staubig und schmutzig und voll mit nutzlosem Plunder. Überall lag Zeug und noch mehr Zeug herum. Zugleich wirkte es völlig leer. Es kam einem vor wie ein verlassenes Haus, dessen Bewohner mitten in der Nacht fliehen mussten, Juden oder Zigeuner vielleicht. Wohnzimmer, Esszimmer und die Schlafzimmer benutzten wir kaum. Alles stand einfach da und staubte ein; jahrelang lag eine Zeitschrift aufgeklappt auf der Sofalehne, in einer Bonbonschale sammelten sich tote Ameisen. Es erinnerte an Fotos von verlassenen Häusern in der Wüste, nachdem dort Atombomben getestet worden waren, zumindest habe ich es so in Erinnerung. Die Einzelheiten können Sie sich selbst ausmalen.
Ich schlief auf dem Dachboden in einem Feldbett, zehn Jahre zuvor für einen Campingurlaub gekauft, den mein Vater dann nie antrat. Der Dachboden war nicht ausgebaut und sehr kalt und staubig. Hier hatte ich Zuflucht gesucht, als meine Mutter krank wurde. In meinem Kinderzimmer, das direkt neben ihrem Zimmer lag, hatte ich keinen Schlaf finden können. Die ganze Nacht lang weinte sie, klagte und rief nach mir. Auf dem Dachboden war es ruhig. Nur wenige Geräusche drangen aus dem Rest des Hauses nach oben. Mein Vater hatte einen Lieblingssessel, den er aus dem Wohnzimmer in die Küche geschleppt hatte. Auf dem schlief er. Es war ein Fernsehsessel, den man mit einem Hebel nach hinten klappen konnte, was der letzte Schrei gewesen war, als er ihn damals kaufte. Der Hebel war mittlerweile kaputt und der Sessel in der Liegestellung festgerostet. Alles im Haus war wie der Sessel – verdreckt, kaputt und erstarrt.
Ich weiß noch, dass es mich in jenem Winter freute, dass die Sonne so früh unterging. Im Schutz der Dunkelheit fühlte ich mich wohler. Mein Vater fürchtete sich allerdings im Dunkeln. Das mag sich nach einer liebenswerten kleinen Marotte anhören, war es aber nicht. Nachts zündete er den Gasherd und den Ofen an, schaute unter der schwachen Deckenbeleuchtung den blauen Flämmchen zu und trank. Er behauptete, ständig zu frieren. Allerdings zog er sich auch nie richtig an. An diesem Abend – ich werde meine Geschichte an dieser Stelle beginnen – saß er barfuß auf der Treppe, einen Zigarrenstummel zwischen den Fingern, und trank den Sherry. »Arme Eileen«, sagte er sarkastisch, als ich zur Tür hereintrat. Er behandelte mich meist herablassend, immer hatte er etwas an meinem bedauernswerten Anblick auszusetzen und auch keinerlei Skrupel, mir das mitzuteilen. Hätten sich meine damaligen Träume bewahrheitet, hätte ich ihn eines Tages am Fuß der Treppe vorgefunden, mit gebrochenem Genick, aber noch atmend. »Das wurde auch langsam Zeit«, hätte ich dann so gelangweilt wie möglich vorgebracht und ihn gemustert, während er sterbend am Boden lag. Ja, ich verabscheute ihn, aber ich war trotzdem pflichtbewusst. Nur wir zwei wohnten in dem Haus – Dad und ich. Ich habe eine Schwester, die vermutlich noch am Leben ist, aber ich habe seit über fünfzig Jahren kein Wort mehr mit ihr gewechselt.
»Hi, Dad«, sagte ich, als ich auf der Treppe an ihm vorbeiging.
Er war kein besonders großer Mann, aber er hatte breite Schultern, lange Beine und etwas Majestätisches an sich. Die dünnen, grauen Haare standen ihm zu Berge. Sein Gesicht, aus dem er mich mit großen Augen immer skeptisch anblickte, wirkte Jahrzehnte älter, als er tatsächlich war. Im Nachhinein betrachtet hatte er im Grunde eine gewisse Ähnlichkeit mit den Jungs in dem Gefängnis, wo ich arbeitete – empfindsam und wütend. Seine Hände zitterten immer, unabhängig davon, wie viel er trank. Ständig rieb er sich das Kinn, das dadurch rot, gereizt und ganz faltig war. Er fingerte auf eine Art an seinem Kinn herum, mit der man einem kleinen Jungen durch die Haare fährt und ihn einen Bengel nennt. Das Einzige, was Dad wirklich bedauerte, war sein mangelnder Bartwuchs, als hätte er es mit mehr Willenskraft schaffen können, sich einen Vollbart stehen zu lassen. So war er – arrogant, widersprüchlich und voller Selbstmitleid. Ich glaube nicht, dass er seine Kinder je wirklich geliebt hat. Der Ehering, den er auch Jahre nach dem Tod unserer Mutter immer noch trug, schien nahezulegen, dass er wenigstens sie auf eine gewisse Art und Weise geliebt hatte. Aber ich vermute, dass er zu echter Liebe nicht fähig war. Er hatte ein grausames Wesen. Ich kann ihm nur vergeben, wenn ich mir vorstelle, dass seine Eltern ihn als Kind geschlagen haben. Das spendet mir einen gewissen Trost.
Aber diese Geschichte handelt nicht davon, was für ein schrecklicher Mensch mein Vater war. Ich will nicht über seine Grausamkeit klagen. Aber ich weiß noch, wie er an jenem Abend auf der Treppe zu mir hochsah und zusammenzuckte. Als würde ihm bei meinem Anblick schlecht. Ich blickte vom Treppenabsatz auf ihn herunter.
»Du musst noch mal los«, krächzte er, »zu Lardner’s.« Lardner’s war das Wein- und Spirituosengeschäft am anderen Ende des Orts. Dad ließ die leere Sherryflasche aus den Fingern gleiten und die Treppe hinunterrollen, eine Stufe nach der anderen.
Heutzutage bin ich ein gelassener, im Grunde sogar friedfertiger Mensch, aber damals wurde ich rasch zornig. Mein Vater verlangte ständig, dass ich wie eine Hausangestellte all seine Wünsche erfüllte. Und ich war nicht die Art Mädchen, die Nein zu jemandem sagte.
»Von mir aus«, antwortete ich.
Mein Vater ächzte und paffte an dem Zigarrenstummel.
Wenn ich mich unwohl fühlte, half es mir, mich mit meinem Äußeren zu beschäftigen. Im Grunde war ich sogar ziemlich besessen von meinem Aussehen. Meine Augen sind klein und grün, und viel Liebenswürdigkeit lässt sich nicht darin finden – besonders damals. Ich zähle nicht zu den Frauen, die ständig andere glücklich machen wollen. So schlau bin ich nicht. Hätten Sie mich damals mit meiner Haarspange und meinem grauen Wollmantel gesehen, würden Sie vermuten, dass ich in dieser Geschichte nur eine Nebenrolle spiele – wohlerzogen, ausgeglichen, langweilig, unbedeutend. Von Weitem sah ich aus wie ein schüchternes Mäuschen, und manchmal wünschte ich mir das damals auch. Aber ich fluchte oft, lief rot an und geriet leicht ins Schwitzen. An diesem Tag knallte ich die Badezimmertür zu, indem ich mit der flachen Schuhsohle dagegentrat, sodass ich sie beinah aus den Angeln hob. Äußerlich sah ich stumpf und unbeteiligt aus, aber in Wirklichkeit kochte ich innerlich, ständig rasten mir Mordgedanken durch den Kopf. Hinter der ausdruckslosen, trübseligen Miene, die ich aufsetzte, konnte ich mich leicht verstecken. Ich war davon überzeugt, dass alle darauf hereinfielen. Und Bücher über Blumen oder Hauswirtschaft mochte ich schon gar nicht. Lieber las ich schaurige Dinge – Mordfälle, Krankheiten, Tod. Ich weiß noch, dass ich mir eine der dicksten Enzyklopädien in der Stadtbücherei auslieh, eine Abhandlung über altägyptische Medizin, weil darin gezeigt wurde, wie Toten das Gehirn durch die Nase herausgezogen wurde, als sei es ein Knäuel Wolle. So stellte ich mir auch mein Gehirn vor: ein völlig verknoteter Wirrwarr in meinem Schädel. Die Vorstellung, dass meine Hirnwindungen entknotet und geradegebogen und so in einen Zustand friedvoller geistiger Gesundheit versetzt werden könnten, empfand ich als tröstlich. Ich hatte oft das Gefühl, dass etwas in meinem Kopf falsch verdrahtet und dadurch unheilbar krank war, nur eine Gehirnoperation hätte etwas daran ändern können. Ein neues Gehirn brauchte ich, vielleicht ein ganz neues Leben. Ich war ein wenig melodramatisch veranlagt. Außer Büchern las ich gern die Zeitschrift National Geographic, die mir allmonatlich mit der Post zugestellt wurde. So ein Abonnement war ein echter Luxus und gab mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Die Artikel über die primitiven Glaubensvorstellungen von Eingeborenenstämmen fand ich faszinierend. Ihre blutigen Rituale, die Menschenopfer, all das sinnlose Leiden. Ich war melancholisch veranlagt, könnte man sagen. Launisch. Aber ich glaube, durch und durch herzlos war ich nicht. Wäre ich in eine andere Familie hineingeboren worden, wäre ich vielleicht als ganz normaler Mensch aufgewachsen.
Ehrlich gesagt hatte ich eine masochistische Ader. Ich ließ mich ganz gern von meinem Vater herumkommandieren. Ich regte mich über ihn auf und hasste ihn, das ja, aber dieser Zorn verlieh meinem Leben einen Sinn, und mit den Besorgungen für ihn ließ sich die Zeit totschlagen. Das war meine Vorstellung vom Dasein – das langwierige Absitzen der Lebenszeit.
Als ich an jenem Abend aus dem Bad kam, machte ich ein erschöpftes Gesicht. Mein Vater gab ein ungeduldiges Stöhnen von sich. Seufzend nahm ich das Geld entgegen, das er mir hinhielt. Ich knöpfte den Mantel wieder zu. Ich war erleichtert, dass ich etwas zu tun hatte, dass ich den Abend nicht nur damit verbringen musste, auf dem Dachboden auf und ab zu laufen oder meinem Vater beim Trinken zuzusehen. Nichts war mir lieber, als das Haus zu verlassen.
Wenn ich beim Gehen die Haustür kräftig zugeknallt hätte – die Versuchung war da –, wäre bestimmt einer der Eiszapfen abgebrochen. Ich malte mir aus, wie er sich durch die Mulde über meinem Schlüsselbein direkt in mein Herz bohren würde. Oder wenn ich den Kopf in den Nacken warf, hätte der Eiszapfen meine Kehle herunterrutschen und die leere Höhlung meines Körpers – ich stellte mir solche Dinge gern bildlich vor –, meine Gedärme und schließlich meinen Unterleib wie ein Glasdolch durchbohren können. Das war das Bild, das ich damals von meiner Anatomie hatte: ein Gehirn wie verknotete Wolle, der Rumpf ein hohles Gefäß, als Unterleib ein unbekanntes, fremdes Land. Aber ich zog die Tür natürlich behutsam hinter mir zu. Ich wollte nicht sterben.
Seit mein Vater nicht mehr Auto fahren konnte, benutzte ich seinen alten Dodge. Ich liebte den Wagen. Es war ein mattgrüner, viertüriger Coronet mit etlichen Beulen und Kratzern. Der Wagenboden war von vielen Jahren Eis und Salz durchgerostet. Im Handschuhfach bewahrte ich eine tote Feldmaus auf, die ich erfroren auf unserer Veranda gefunden hatte. Ich hatte sie am Schwanz hochgehoben, einmal durch die Luft gewirbelt und dann ins Handschuhfach zu der kaputten Taschenlampe, einer Straßenkarte von Neuengland und ein paar grün angelaufenen Fünfcentstücken fallen lassen. In jenem Winter schaute ich immer mal wieder bei der Maus herein, wie weit ihre unsichtbare Verwesung trotz Eiseskälte fortgeschritten war. Wahrscheinlich gab sie mir ein gewisses Machtgefühl: Sie war mein kleines Totem. Mein Glücksbringer.
Vor der Tür prüfte ich mit der Zungenspitze die Temperatur. Ich streckte die Zunge hinaus in den eisigen Wind, bis es wehtat. An diesem Abend müssen es minus zwölf oder dreizehn Grad gewesen sein. Selbst das Atmen tat weh. Trotzdem war mir Kälte lieber als Hitze. Im Sommer war ich unruhig und launenhaft. Ich bekam Ausschläge und musste mich in die kalte Badewanne legen. Im Gefängnis saß ich am Schreibtisch und wedelte wie eine Verrückte mit einem Papierfächer vor meinem Gesicht herum. In Gegenwart anderer Menschen zu schwitzen, war mir unangenehm. So viel Körperlichkeit fand ich unanständig, ja widerlich. Logischerweise ging ich auch nicht tanzen und trieb keinen Sport. Ich hörte keine Beatles-Platten und sah mir auch nicht im Fernsehen die Ed-Sullivan-Show an. Damals hatte ich kein Interesse an dem, was die anderen jungen Leuten so machten. Ich las lieber Artikel über antike Kulturen und ferne Länder. Alles, was populär oder in Mode war, verstärkte nur mein Gefühl von Einsamkeit. Ich wollte nichts davon wissen, dann konnte ich wenigstens so tun, als hätte ich mir dieses Leben selbst ausgesucht.
Ein Problem gab es mit dem Dodge. Beim Fahren wurde mir schwindlig. Ich wusste, dass es etwas mit dem Auspuffrohr zu tun hatte, aber damals wusste ich nicht, wie man so ein Problem löst. In gewisser Weise mochte ich es, dass ich trotz Kälte das Fenster herunterkurbeln musste. Ich fand mich tapfer. Im Grunde hatte ich wahrscheinlich nur Angst, das Auto könnte mir weggenommen werden, wenn ich viel Aufhebens darum machte. Der Wagen war der einzige Hoffnungsschimmer in meinem Leben. Er war meine einzige Fluchtmöglichkeit. Vor seiner Pensionierung war mein Vater an seinen freien Tagen damit gefahren. Er war sehr unvorsichtig mit dem Wagen umgegangen – hatte ihn mitten auf dem Gehsteig abgestellt oder nachts irgendwo stehen lassen, weil ihm das Benzin ausgegangen war, und die Kurven hatte er immer mit quietschenden Reifen genommen. Er war am Milchlieferwagen und an der Rückseite des AMP-Gebäudes entlanggeschrammt und so weiter. Alle fuhren damals betrunken, aber trotzdem. Ich war eine gute Autofahrerin. Ich fuhr nie zu schnell oder bei Rot über die Ampel. Im Dunkeln fuhr ich besonders langsam, ließ den Fuß nur ganz leicht auf dem Gaspedal liegen, während unsere Kleinstadt wie in einem Film an mir vorbeizog. Ich malte mir immer aus, dass alle anderen Menschen in viel schöneren Häusern wohnten als ich, voll mit edlen Holzmöbeln und einem offenen Kamin, über dem die Weihnachtsstrümpfe hingen. Im Regal standen Keksdosen, in der Garage ein Rasenmäher. Damals fiel mir die Vorstellung leicht, alle hätten es besser als ich. Der Anblick eines hell erleuchteten Hauseingangs einen Block weiter machte mich immer besonders neidisch. Neben der Tür stand eine weiße Bank, und an einer Klinge, die wie ein umgedrehter Schlittschuh aussah, konnte man den Schnee von den Stiefeln streifen. An der Haustür hing eine Ilexgirlande. Unsere Kleinstadt war hübsch, beschaulich, könnte man sagen. Wenn man nicht in Neuengland aufgewachsen ist, kann man sich die eigentümliche Stille eines unter Schnee begrabenen Küstenorts bei Nacht kaum vorstellen. Bei Sonnenuntergang geschieht dort mit dem Licht etwas ganz Eigenartiges: Es lässt nicht einfach nach. Das Licht wird hinaus aufs Meer gezogen und verschwindet dort am fernen Horizont.
Das fröhliche Klingeln der Türglocke am Wein- und Spirituosenhandel werde ich nie vergessen, da es fast jeden Abend für mich ertönte. Lardner’s Liquors. Ich mochte den Laden. Es war warm und aufgeräumt dort, und ich lief immer so lange wie möglich durch die Regalreihen und tat so, als suchte ich nach etwas. Ich wusste natürlich, wo der Gin stand: Mitte rechts, wenn man in Richtung Kasse schaute, nur zwei Regalreihen voll, Beefeater oben und Seagram’s darunter. Mr. Lewis an der Kasse war immer so gut gelaunt, als hätte er noch nie einen Gedanken daran verschwendet, wozu der viele Alkohol überhaupt da war. An diesem Abend kaufte ich den Gin, bezahlte, ging zurück zum Auto und legte die Flaschen auf den Beifahrersitz. Seltsam, dass Hochprozentiges nicht gefriert. Bei uns im Ort war es das Einzige, das sich der Kälte widersetzte. Ich saß zitternd im Dodge, drehte den Schlüssel im Zünd-schloss und fuhr langsam nach Hause. Ich weiß noch, dass ich die schöne, längere Strecke nahm, während die Dunkelheit sich langsam senkte.
Mein Vater lag auf seinem Fernsehsessel in der Küche, als ich zu Hause ankam. An diesem Abend passierte nichts Besonderes. Er ist nur der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Ich stellte die Flaschen in Dads Reichweite auf den Boden, zerknüllte die Papiertüte in meiner Faust und warf sie auf den Müllhaufen neben der Hintertür. Ich ging nach oben auf den Dachboden. Ich las in meiner Zeitschrift. Ich schlief ein.
Da wären wir also. Ich hieß Eileen Dunlop. Jetzt kennen Sie mich. Ich war vierundzwanzig Jahre alt und hatte eine Stelle als Sekretärin in einer Strafvollzugsanstalt für Jungen, die mir siebenundfünfzig Dollar pro Woche einbrachte. Heutzutage sehe ich es als das, was es im Grunde war – ein Kindergefängnis. Ich werde es Moorehead nennen. Delvin Moorehead war ein fürchterlicher Vermieter, den ich viele Jahre später hatte, und es erscheint mir passend, eine solche Institution nach ihm zu benennen.
Eine Woche später sollte ich von zu Hause weglaufen und nie mehr zurückkehren. Dies ist die Geschichte meines Verschwindens.
Freitag
FREITAGS WEHTE EIN widerlicher Fischgeruch aus der Kantine im Keller durch die kalten Schlafsäle der Jungen und die mit Linoleum ausgelegten Gänge in das fensterlose Büro, wo ich meine Tage verbrachte. Es war ein derart penetranter Gestank, dass er bis hinaus auf den Parkplatz drang, als ich morgens in Moorehead ankam. Ich hatte mir angewöhnt, meine Handtasche im Kofferraum einzuschließen, bevor ich hineinging. Im Pausenraum hinter dem Büro gab es Spinde, aber ich traute meinen Kolleginnen nicht. Als ich, auf geradezu kriminelle Weise naiv, mit einundzwanzig dort anfing, hatte mein Vater mich gewarnt, dass man sich in einem Gefängnis nicht vor den Insassen, sondern vor den Angestellten in Acht nehmen müsse. Das kann ich bestätigen. Es waren vielleicht die weisesten Worte, die mein Vater je zu mir gesagt hat.
Ich hatte mein Mittagessen mitgebracht: zwei Scheiben Wonderbread mit Butter, in Alufolie verpackt, und eine Dose Thunfisch. Immerhin war Freitag, und ich wollte nicht in die Hölle kommen. Ich bemühte mich, meinen Kolleginnen lächelnd zuzunicken, zwei abstoßenden Frauen mittleren Alters mit steifen Turmfrisuren. Sie hoben nur selten den Blick von ihren Liebesromanen, ausgenommen, der Gefängnisdirektor war in der Nähe. Ihre Schreibtische waren mit den gelben Zellophanpapierchen der Karamellbonbons bedeckt, die in geschliffenen Kunststoffschalen aufbewahrt wurden. Die Bürodamen waren zwar alles andere als sympathisch, aber auf der Liste abscheulicher Gestalten, die ich im Lauf meines Lebens kennengelernt habe, nahmen sie die unteren Ränge ein. Eigentlich hatte ich es gar nicht so schlecht, bei der Tagschicht mit ihnen zusammen im Büro. Da ich Schreibtischarbeit verrichtete, bekam ich die schrecklichen Schweinsnasen der vier oder fünf Strafvollzugsbeamten kaum zu Gesicht. Sie waren mit der Aufgabe betraut, die Besserung der in Moorehead einsitzenden bösen Buben herbeizuführen. Dabei führten sie sich auf wie Feldwebel bei der Armee, schlugen den Jungen mit dem Knüppel von hinten gegen die Beine, wenn sie nicht spurten, oder nahmen sie in den Schwitzkasten wie auf dem Schulhof. Wenn es zu schlimm wurde, schaute ich lieber weg. Meistens schaute ich auf die Uhr an der Wand.
Die Wärter der Nachtschicht gingen um acht Uhr nach Hause, wenn ich zur Arbeit kam, sodass ich sie nie kennengelernt habe. An ihre erschöpften Gesichter kann ich mich aber noch erinnern – der eine war ein Vollidiot, der andere ein Kriegsveteran mit Halbglatze und nikotingelben Fingern. Sie spielen keine Rolle. Einer der tagsüber diensthabenden Wärter sah allerdings fantastisch aus. Er hatte große, braune Augen mit Schlafzimmerblick, ein markantes, aber jugendliches Profil und eine Aura zauberhafter Melancholie, das bildete ich mir zumindest ein. Die Haare trug er in einer glänzenden, hoch zurückgekämmten Schmalzlocke. Das war Randy. Von meinem Schreibtisch aus beobachtete ich ihn. Er saß auf dem Gang, der das Büro mit dem Rest der Anstalt verband. Er trug eine gestärkte braune Dienstuniform, blank gewichste Motorradstiefel und an der Gürtelschlaufe einen schweren Schlüsselbund. Meist saß er nur mit einem Oberschenkel auf dem Hocker, wobei sein Fuß in der Luft hing, eine Position, die mir sein Gemächt wie auf dem Präsentierteller darbot. Ich war nicht sein Typ, das wusste ich. Was mir wehtat, auch wenn ich das nie zugegeben hätte. Sein Typ war wahrscheinlich blond und hübsch, mit Schmollmund und langen Beinen. Aber träumen durfte man ja. Ich verbrachte Stunden damit, das Spiel seiner Muskeln beim Umblättern des Comichefts, das er las, zu studieren. Wenn ich jetzt an ihn denke, sehe ich ihn vor mir, wie er einen Zahnstocher durch den Mund wandern lässt. Wunderschön. Die reinste Poesie. Einmal habe ich ihn gefragt, ob ihm gar nicht kalt sei im Winter mit dem kurzärmligen Hemd. Ich war total nervös, es war zum Totlachen. Er zuckte nur die Achseln. Stille Wasser sind tief, dachte ich hingerissen. Trotz mangelnder Ermutigung malte ich mir nur zu gern aus, wie er eines Tages Steinchen an mein Dachbodenfenster werfen und alles in diesem gottverdammten Ort zum Schmelzen bringen würde. Gegen solche Fantasien war ich nicht immun.
Ich trank keinen Kaffee – mir wurde schwindlig davon –, aber ich ging trotzdem zu der Ecke, in der die Kaffeemaschine stand, weil darüber ein Spiegel an der Wand hing. Ich empfand zwar abgrundtiefen Hass für mein Gesicht, mein Spiegelbild anzuschauen beruhigte mich aber. So ist das Leben, wenn man von sich selbst besessen ist. Selbst heute mag ich mir kaum eingestehen, wie viel Zeit ich mit dem Leiden an meiner mangelnden Schönheit vergeudet habe. Ich rieb mir ein Körnchen Schlaf aus dem Augenwinkel und schenkte mir eine Tasse Milch ein, die ich mit Zucker und Kondensmilch aus meiner Schreibtischschublade aufbesserte. Niemand machte eine Bemerkung über dieses seltsame Getränk. In unserem Büro wurde ich überhaupt von niemandem beachtet. Die Bürodamen waren mürrisch und unfreundlich. Sie hatten nur Augen füreinander, und ich hegte den Verdacht, dass sie insgeheim homosexuell und ineinander verliebt waren. Derlei Vermutungen trieben damals viele Leute um, die Kleinstädter waren auf der Hut vor den »latenten Homosexuellen« in ihrer Mitte. Solche Unterstellungen meinte ich nicht unbedingt abwertend. Sie halfen mir, ein wenig Mitleid mit meinen Kolleginnen zu haben, weil sie einsam und verbittert abends nach Hause zu ihren widerwärtigen Ehemännern mussten. Aber wenn ich mir andererseits vorstellte, wie sie mit offenen Blusen und gespreizten Beinen einander an die Brust fassten, wurde mir schlecht.
In einem Buch, das ich in der Stadtbücherei entdeckt hatte, waren einige Abgüsse abgebildet, die von den Gesichtern berühmter Männer wie Lincoln, Beethoven oder Sir Isaac Newton nach ihrem Tod angefertigt worden waren. Wenn man einmal einen echten Toten gesehen hat, dann weiß man, dass die Leute nicht mit einem so leeren, friedlichen Ausdruck auf dem Gesicht sterben. Aber ich benutzte diese Gipsabgüsse als Vorbild und übte geduldig vor dem Spiegel. Ich entspannte mein Gesicht, bis es dieselbe wohlmeinende Unerschütterlichkeit ausstrahlte, die für mich aus den Gesichtern dieser toten Männer sprach. Das war die Miene, die ich bei der Arbeit aufsetzte – meine Totenmaske. Ich war ja noch schrecklich jung und sensibel und fest entschlossen, das niemandem zu zeigen. Ich wappnete mich gegen meinen Arbeitsplatz, dieses Moore-head. Das musste ich. Ich war umgeben von Schande und Unglück, aber nicht ein Mal rannte ich weinend auf die Toilette. Später an diesem Morgen brachte ich dem Gefängnisdirektor die Post in sein Büro, das sich innerhalb des Trakts befand, in dem die Jungen unterrichtet wurden und wo sie ihre freien Stunden verbrachten. Dabei ging ich an einem der Vollzugsbeamten vorbei. Mulvaney oder Mulroony oder Mahoney hieß er, was weiß ich. Er packte einen Jungen am Ohr und zwang ihn vor sich in die Knie. »Du glaubst also, du wärst was Besonderes«, sagte er zu dem Jungen. »Siehst du den Dreck da auf dem Boden? Das bist du. Einen Dreck bist du wert.« Er drückte das Gesicht des Jungen hinunter zwischen seine schweren, mit Stahlkappen versehenen Stiefel, mit denen er jemanden hätte tottreten können. »Leck ihn auf«, sagte der Beamte. Ich sah, wie sich der Mund des Jungen öffnete, dann wandte ich den Blick ab.
Die Sekretärin des Gefängnisdirektors war eine Frau, die so fett war, dass es aussah, als würde sie nie Atem holen, als würde ihr Herz nicht schlagen. Ihre Totenmaske, ihr undurchdringlicher Blick waren beeindruckend. Die einzigen Lebenszeichen, die sie von sich gab, waren ihr Zeigefinger, der sich hoch zu ihrem Mund bewegte, und eine blasslila Zungenspitze, die sich herausschob, um den Finger anzufeuchten. Mechanisch ging sie den Stapel Post durch, den ich ihr überreicht hatte, dann wandte sie sich wieder ab. Ich blieb noch einen Augenblick stehen und tat so, als würde ich auf dem Wandkalender, der neben ihrem Schreibtisch hing, die Tage zählen. »Noch fünf Tage bis Weihnachten«, sagte ich und versuchte, dabei erfreut zu klingen.
»Gott sei’s gepriesen«, erwiderte sie.
Ich muss oft an Moorehead und sein lächerliches Motto denken: parens patriae. Die Insassen von Moorehead waren noch so jung, dass sie im Grunde Kinder waren. Damals fürchtete ich mich vor ihnen, weil ich das Gefühl hatte, sie konnten mich nicht leiden und fanden mich unattraktiv. Deswegen versuchte ich sie als Schwachköpfe und Rabauken abzutun. Einige von ihnen waren schon fast ausgewachsen, groß und gut aussehend. Auch gegen diese Jungen war ich nicht immun.
Zurück an meinem Schreibtisch, gab es viel, über das ich hätte nachdenken können. Es war 1964, die Welt war in Bewegung. Überall wurde etwas abgerissen oder neu gebaut, aber ich interessierte mich im Grunde nur für mich selbst und mein elendes Schicksal, während ich die Stifte in der Tasse neu ordnete und den heutigen Tag auf meinem Tischkalender durchstrich. Der Stundenzeiger der Wanduhr zitterte erst, dann stürzte er vorwärts wie jemand, der, zunächst von Angst wie gelähmt, schließlich doch noch in seiner Verzweiflung von der Klippe springt, nur um dann mitten in der Luft hängen zu bleiben. Meine Gedanken gingen auf Wanderschaft. Am liebsten wanderten sie zu Randy. Als mir an diesem Freitag mein Lohnscheck ausgehändigt wurde, faltete ich ihn und versteckte ihn an meinem Busen – den man kaum als Busen bezeichnen konnte. Im Grunde waren es nicht mehr als zwei harte, kleine Knubbel, die ich unter etlichen Schichten Baumwollunterwäsche, einer Bluse und einer Filzjacke verbarg. Ich hatte immer noch die pubertäre Angst, die Leute könnten durch meine Kleider schauen, wenn sie mich ansahen. Vermutlich versuchte niemand, sich meinen nackten Körper vorzustellen, aber ich befürchtete trotzdem, dass jeder, der den Blick nach unten richtete, meinen Unterleib in Augenschein nahm und irgendwie die komplexen, sinnlosen Falten und Höhlungen dechiffrieren konnte, die gut verpackt da unten zwischen meinen Beinen lagen. Meine Falten und Höhlungen schirmte ich immer sehr gut ab. Ich war natürlich noch Jungfrau.
Wahrscheinlich hatte meine Verklemmtheit ihren Sinn und ersparte mir ein schwieriges Leben, wie es meine Schwester führte. Sie war älter als ich und wahrlich keine Jungfrau mehr und lebte ein paar Ortschaften weiter unverheiratet mit einem Mann zusammen – meine Mutter hatte sie eine »Hure« genannt. Joanie war wahrscheinlich ganz in Ordnung, aber unter ihrer aufgekratzten, mädchenhaften Fassade hatte sie etwas Dunkles, Gefräßiges an sich. Einmal erzählte sie mir, dass Cliff, ihr Freund, sie gern »lecke«, wenn sie morgens aufwachte. Sie lachte, als ich erst ein verständnisloses Gesicht machte, dann knallrot und abweisend wurde, als mir aufging, was sie damit meinte. »Ist das nicht unglaublich?«, kicherte sie. Natürlich beneidete ich sie um ihr abwechslungsreiches Liebesleben, aber das zeigte ich nicht. Auf das, was sie hatte, war ich nicht aus. Für mich war die Vorstellung von Geschlechtsverkehr mit einem männlichen Wesen absurd. Ich wünschte mir höchstens eine wortlose Romanze. Aber selbst davor hatte ich Angst. Ich war in Randy und ein paar andere verknallt, aber da tat sich nie etwas. Ach, mein armer Unterleib, der wie ein Baby in einer Windel aus dicken Baumwollunterhosen und dem alten einschnürenden Mieder meiner Mutter steckte. Lippenstift trug ich nicht, weil es in Mode war, sondern weil meine bloßen Lippen dieselbe Farbe hatten wie meine Brustwarzen. Mit vierundzwanzig wollte ich niemanden dazu animieren, sich meinen nackten Körper vorzustellen. Die meisten anderen jungen Frauen schienen es allerdings ganz anders zu halten.
An jenem Tag gab es im Gefängnis eine kleine Feier. Dr. Frye wurde in den Ruhestand versetzt. Er war ein alter Herr, der in der Anstalt jahrzehntelang als Psychiater gearbeitet und den Jungen Unmengen von Beruhigungsmitteln verabreicht hatte. Er mochte über achtzig gewesen sein. Jetzt bin auch ich alt, aber in meiner Jugend hatte ich nie viel für ältere Leute übrig. Schon ihre bloße Existenz empfand ich als Zumutung. Mir war es schnurzegal, ob Dr. Frye wegging oder nicht. Als die Grußkarte für ihn auf meinem Tisch landete, schrieb ich mit meiner ordentlichen Schulmädchenschrift, allerdings mit sarkastisch abgeknickter Hand: »Bis dann!« Ich weiß noch, dass auf der Karte eine Tuschezeichnung abgebildet war, die einen in den Sonnenuntergang reitenden Cowboy zeigte. Du liebe Zeit! Im Laufe meiner Jahre in Moorehead war Dr. Frye hin und wieder bei uns aufgetaucht, um die Angehörigenbesuche zu beobachten, deren Durchführung in meinen Zuständigkeitsbereich fiel. Ich hatte ihm dabei zugesehen, wie er in der offenen Tür des Besuchszimmers stand, nickte, vor sich hin summte und schmatzende Geräusche mit dem Gaumen machte. Gelegentlich bedeutete er dem Kind mit langem, zittrigem Finger, dass es gerade sitzen, eine Frage beantworten oder sich entschuldigen sollte. Nicht ein Mal sagte er Hallo oder fragte: »Wie geht es Ihnen, Miss Dunlop?« Ich war unsichtbar. Ich war Mobiliar. Nach der Mittagspause – ich glaube, ich ließ die Dose Thunfisch ungeöffnet in meinem Spind stehen – sollten sich die Mitarbeiter zu Kaffee und Kuchen in der Kantine versammeln, um Dr. Frye zu verabschieden. Ich verweigerte die Teilnahme. Ich saß einfach am Schreibtisch und tat nichts, außer auf die Uhr zu starren. Irgendwann juckte es in meiner Unterwäsche, und weil niemand hinsah, steckte ich die Hand unter den Rock. Mein Unterleib war so gut verpackt, da war es nicht leicht, sich da unten zu kratzen. Ich musste die Hand vorn unter das Rockbündchen, unter das Mieder und dann in die Unterhose stecken, und als ich mich gekratzt hatte, zog ich sie wieder heraus und roch an meinen Fingern. Ich finde es völlig natürlich, an seinen Fingern zu riechen. Es war dieselbe Hand, die ich später am Tag ungewaschen Dr. Frye hinstreckte, als ich ihm zum Abschied alles Gute wünschte.
Durch die Arbeit in Moorehead war ich nicht unbedingt isoliert. Aber ich war einsam. Ich kam eigentlich nie unter Leute. Die Kleinstadt, in der ich aufgewachsen war und immer noch wohnte – ich werde sie X-ville nennen –, hatte kein eigentliches Armeleuteviertel. Aber es gab natürlich, näher zum Meer hin, weniger adrette Straßen, in denen Arbeiter und Not leidende Menschen wohnten. An den baufälligen Holzhäusern, vor denen Kinderspielzeug und Müll herumlag, war ich nur wenige Male vorbeigefahren. Diese Gestalten auf der Straße zu sehen, verzweifelt, zornig und mit sich selbst beschäftigt, war aufregend und Furcht einflößend zugleich, und ich schämte mich, dass ich nicht so arm war. In meinem Viertel waren alle Straßen von Bäumen gesäumt und ordentlich, die Häuser wurden liebevoll gepflegt. Es herrschte eine Atmosphäre gutbürgerlicher Sauberkeit und Ordnung, angesichts derer ich mich schämte, unordentlich und anders zu sein. Ich wusste nicht, dass es auf der Welt andere wie mich gab, die einfach »nicht hineinpassten«, wie man damals gesagt hätte. Ich als einsamer, intelligenter junger Mensch dachte natürlich, nur ich hätte ein Gewissen, ein Bewusstsein dafür, wie seltsam es war, auf diesem verrückten Planeten Erde zu leben. Ich habe einige Folgen der Fernsehserie The Twilight Zone gesehen, die diese Art des nach außen hin unsichtbaren Wahnsinns, den ich in X-ville spürte, gut veranschaulichten. Ich fühlte mich sehr allein.
Boston mit seinen großen, efeubewachsenen Backsteingebäuden gab mir die Hoffnung, dass es irgendwo auf der Welt intelligente Menschen und junge Leute geben musste, die nach ihren eigenen Vorstellungen lebten. Die Freiheit war gar nicht so weit weg. Aber ich war erst ein einziges Mal in Boston gewesen. Als meine Mutter im Sterben lag, war ich mit ihr zu einem Arzt gefahren, einem Arzt, der sie nicht heilen konnte, ihr aber Mittel verschrieb, die ihr »Unwohlsein linderten«, wie er es ausdrückte. Ein solcher Ausflug nach Boston war für mich damals etwas Besonderes. Ja, ich war schon vierundzwanzig. Ich war erwachsen. Man sollte meinen, ich hätte fahren können, wohin ich wollte. Und tatsächlich unternahm ich während meines letzten Sommers in X-ville, als mein Vater wieder einmal auf einer besonders ausgiebigen Sauftour war, eine Fahrt die Küste entlang. Aber mir ging das Benzin aus, und ich saß, nicht weiter als eine Stunde Fahrzeit von zu Hause entfernt, auf einer Landstraße fest, bis eine ältere Dame anhielt, mir einen Dollar schenkte und mich zur nächsten Tankstelle mitnahm. Sie ermahnte mich, »das nächste Mal besser zu planen«. Ich weiß noch, wie ihr Doppelkinn zitterte, während sie den Wagen lenkte. Sie war eine Frau vom Land, und ich hatte Respekt vor ihr. Das war der Anfang meiner Fluchtfantasien. Ich redete mir ein, dass New York die Lösung meines Problems war. Und mein Problem war das Leben in X-ville.
Es war damals ein Klischee und ist es heute noch, aber nachdem ich im Radio Hello, Dolly! gehört hatte, war ich davon überzeugt, ich bräuchte nur mit Geld für eine Pension in Manhattan aufzutauchen, und alles Weitere würde sich von allein ergeben. An meine Zukunft müsste ich keinen Gedanken verschwenden. Natürlich war das nur ein schöner Traum, aber ich nährte ihn nach Kräften. Ich fing an, Bargeld beiseitezulegen, oben bei mir auf dem Dachboden versteckt. Die Schecks mit den Pensionsbezügen meines Vaters, die wir an jedem Monatsersten von der Polizei in X-ville erhielten, wurden von mir eingereicht. Auf der X-ville Bank wurde ich von den Schalterbeamten immer mit dem Namen meiner Mutter angesprochen, Mrs. Dunlop, und ich dachte, ich könnte problemlos das Sparkonto leer räumen und mir einen Umschlag mit Hundertdollarscheinen aushändigen lassen, wenn ich vorgab, wir bräuchten ein neues Auto.
Über meinen innigen Wunsch, mich aus dem Staub zu machen, sprach ich mit niemandem. Nur manchmal, in meinen dunkelsten Stunden, wenn ich von der nächsten Brücke fahren wollte oder den unbändigen Drang verspürte, meine Hand in der Autotür einzuklemmen, stellte ich mir vor, was für eine Erleichterung es wäre, ein einziges Mal bei Dr. Frye auf der Couch wie eine gefallene Heldin endlich das Geständnis abzulegen, dass mein Leben schlicht und einfach unerträglich war. Dabei war es in Wirklichkeit sehr wohl erträglich. Ich ertrug es ja. Außerdem hätte sich die junge Eileen nie in Gegenwart eines Mannes, der nicht ihr Vater war, in die Horizontale begeben. Es wäre unmöglich gewesen, ihre kleinen Brüstchen daran zu hindern, nach oben zu ragen. Obwohl ich damals dünn und drahtig war, hielt ich mich für fett und behäbig. Wenn ich den Korridor herunterlief, spürte ich richtig, wie meine Brüste und Oberschenkel bei jedem Schritt mitschwangen. Alles an mir empfand ich als überdimensioniert und widerwärtig. In der Hinsicht war ich verrückt. Diese Wahnvorstellungen brachten mir viel Leid ein. Heutzutage lache ich darüber, aber damals litt ich wie ein Tier.
Natürlich hatte niemand im Gefängnissekretariat Interesse an mir, meinem Leben im Jammertal oder meinem Busen. Als ich nach dem Tod meiner Mutter in Moorehead anfing, zeigten mir Mrs. Stephens und Mrs. Murray die kalte Schulter. Sie kondolierten mir nicht, nicht einen freundlichen oder wenigstens mitleidigen Blick warfen sie mir zu. Die beiden Frauen hatten nichts Mütterliches an sich und waren insofern perfekt für die Arbeit in einem Jugendgefängnis geeignet. Dabei waren sie gar nicht streng oder unfreundlich, so wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Sie waren einfach widerliche, faule, unkultivierte Schlampen. Wahrscheinlich langweilten sie sich genauso schrecklich wie ich, aber sie hatten ihre Bonbons und ihre Schundheftchen und leckten sich nach einem Donut schamlos die Finger ab. Sie rülpsten, seufzten und ächzten. Am liebsten stellte ich sie mir beim Sex vor, das Gesicht im Unterleib der anderen, die Nase über den Geruch gerümpft, während sie ihre karamellverklebten Zungen ausfuhren. Mir so etwas auszumalen, befriedigte mich ungemein. Vielleicht kam ich mir im Vergleich dazu fast würdevoll vor. Wenn die beiden ans Telefon gingen, hielten sie sich die Nase zu und sprachen in einem hohen, jaulenden Tonfall. Vielleicht taten sie das zu ihrer eigenen Belustigung, oder ich habe es mir falsch gemerkt. Jedenfalls hatten sie keine Manieren.
»Eileen, gib mir mal die Akte von dem Neuen, dem kleinen Rotzlöffel, wie heißt er gleich«, sagte Mrs. Murrray.
»Der mit dem Schorf auf der Haut?« Mrs. Stephens lutschte schmatzend ihr Karamellbonbon. »Brown, Todd. Die werden jedes Jahr dümmer und hässlicher, ich sag’s dir.«
»Pass bloß auf, was du sagst, Norris. Wenn wir nicht aufpassen, heiratet Eileen demnächst einen von denen.«
»Ist das wahr, Eileen? Tickt bei dir schon die Uhr?«
Mrs. Stephens gab immer mit ihrer Tochter an, einem großen, schmallippigen Mädchen, mit dem ich zur Schule gegangen war. Sie hatte den Baseballtrainer irgendeiner Schule geheiratet und war nach Baltimore gezogen.
»Eines Tages bist du auch mal alt, genau wie wir«, sagte Mrs. Stephens.
»Du hast deinen Pullover falsch rum an«, sagte Mrs. Murray. Ich zog meinen Kragen hoch, um nachzusehen. »Oder auch nicht. Du bist einfach so flach, da weiß man gar nicht, ob man die Vorder- oder die Rückseite anguckt.« Solches Zeug gaben sie von sich. Wirklich zum Weglaufen.
Wahrscheinlich war mein Benehmen genauso abscheulich wie ihres. Ich war immer schrecklich schlecht gelaunt und unfreundlich. Oder ich versuchte verzweifelt, fröhlich zu wirken. »Haha«, sagte ich. »Ich kann mich drehen, wie ich will, ich bin eben platt.« Ich hatte nie gelernt, wie man mit anderen Menschen umgeht oder eine schlagfertige Antwort gibt. Ich war ein stilles Kind gewesen und hatte so lang auf dem Daumen gelutscht, dass ich vorstehende Zähne davon bekam. Glücklicherweise standen sie nicht zu stark vor. Trotzdem war ich natürlich davon überzeugt, ein hässliches Pferdegebiss zu haben, und lächelte deswegen möglichst selten. Falls doch, passte ich höllisch auf, dass meine Oberlippe die Zahnreihe nicht entblößte, was große Zurückhaltung und Disziplin erforderte. Die viele Zeit, die ich mit der Erziehung dieser Lippe verbrachte, kann man sich kaum vorstellen. Ich war davon überzeugt, dass das Innere meines Mundes ein intimer Körperteil war – wie Höhlungen oder feuchte, sich öffnende Hautfalten. Wenn mir jemand in den Mund sah, war es fast so schlimm, als würde ich die Beine spreizen. Damals gab es bei Weitem nicht so viele Leute, die Kaugummi kauten wie heute. Das galt als kindisches Benehmen. Deswegen hatte ich eine Flasche Mundwasser in meinem Spind stehen und gurgelte regelmäßig damit. Manchmal, wenn ich nicht glaubte, zum Waschbecken auf der Damentoilette zu gelangen, ohne den Mund zum Sprechen öffnen zu müssen, schluckte ich das Listerine auch herunter. Niemand sollte meinen, ich könne an Mundgeruch leiden oder überhaupt einen Körper mit organischen Vorgängen haben. Atmen zu müssen war peinlich genug. So eine Art Mädchen war ich.
Abgesehen von dem Mundwasser hatte ich eine Flasche süßen Wermut und eine Packung Pfefferminzdragees in meinem Spind stehen. Die klaute ich immer im Drugstore von X-ville. Ich war eine begnadete Ladendiebin und konnte alles Mögliche in meinen Ärmeln verschwinden lassen. Meine Totenmaske rettete mich viele Male vor den Ladenangestellten, die meinen Anblick in dem übergroßen Mantel, mit dem ich ewig bei den Süßigkeiten herumstand, garantiert auffällig fanden. Die Angst und die Ekstase – nichts war mir anzusehen. Bevor die Besuchszeit im Gefängnis anfing, nahm ich einen kräftigen Schluck aus der Wermutflasche und warf eine Handvoll Dragees hinterher. Selbst nach mehreren Jahren machte es mich noch immer nervös, die gequälten Mütter der einsitzenden Jungen empfangen zu müssen. Zu meinen todlangweiligen Pflichten gehörte es, sie in einem Besucherverzeichnis unterschreiben zu lassen, ihnen dann einen Platz auf den orangefarbenen Plastikstühlen zuzuweisen, die auf dem Gang standen, und sie zum Warten aufzufordern. Moorehead hatte die wahnwitzige Vorschrift, dass nur ein Junge auf einmal Besuch empfangen durfte. Vielleicht war das den wenigen Mitarbeitern oder den begrenzten Räumlichkeiten geschuldet. Jedenfalls entstand dadurch eine Atmosphäre endlosen Leidens, da die Mütter stundenlang dasaßen, weinten, mit den Füßen wippten, sich schnäuzten und beschwerten. Damit es mir nicht zu bunt wurde, dachte ich mir unsinnige Fragebogen aus, die ich vervielfältigte und auf Klemmbrettern an die ungeduldigsten der Mütter verteilte. Ich wollte den Frauen die Illusion geben, sie besäßen eine gewisse Bedeutung – dass ihr Leben oder ihre Meinung zählte. Ausgedacht hatte ich mir Fragen von der Art: »Wie oft fahren Sie zur Tankstelle?«, »Wie sehen Sie sich selbst in zehn Jahren?«, »Schauen Sie gern fern? Wenn ja, welche Sendungen?« Die meisten Mütter waren froh, dass sie etwas zu tun hatten, auch wenn sie immer so taten, als würde es ihnen Umstände machen. Fragten sie nach dem Sinn des Ganzen, sagte ich ihnen, es handele sich um einen »staatlichen Fragebogen« und sie bräuchten ihren Namen nicht anzugeben, wenn sie lieber anonym bleiben wollten. Keine ließ ihren Namen weg. Alle trugen ihn ein, wesentlich leserlicher als im Besucherbuch, und antworteten mit geradezu herzzerreißender Aufrichtigkeit: »Jeden Freitag.« »Ich bin gesund und glücklich und meine Kinder haben Erfolg.« »Jerry Lewis.«
Meine Aufgabe war die Verwaltung eines Aktenschranks voller Berichte und Dokumente über unsere Häftlinge. Die Jungen blieben in Moorehead, bis ihre Jugendstrafe abgesessen war oder sie achtzehn wurden. Der Jüngste, den ich in meiner Zeit in Moorehead erlebt habe, war neuneinhalb. Der Gefängnisdirektor drohte gern damit, die großen, aufmüpfigen Jungen frühzeitig zu den Erwachsenen ins Gefängnis zu stecken. »Ach, du meinst, du hättest es so schwer hier, junger Mann?«, sagte er dann. »Ein Tag im Zuchthaus, und ihr blutet wie die Schweine.«
Angesichts ihrer Lebensbedingungen erschienen mir die Jungen von Moorehead eigentlich ganz in Ordnung. Jeder normale Mensch wäre an ihrer Stelle widerspenstig und missmutig gewesen. Alles, was Kinder normalerweise machen, war ihnen verboten – tanzen, singen, herumgestikulieren, laut reden, Musik hören, sich kurz hinlegen, es sei denn, sie hatten die Erlaubnis dazu. Ich redete nie mit ihnen, mit keinem, aber ich wusste alles über sie. Ich las mir ihre Akten durch, studierte die Beschreibungen ihrer Taten, die Polizeiberichte und Geständnisse. Einer hatte einem Taxifahrer mit dem Kugelschreiber ins Ohr gestochen, daran erinnere ich mich. Nur wenige stammten aus X-ville selbst. Alles, was der Staat Massachusetts an jungen Dieben, Randalierern, Vergewaltigern, Entführern, Brandstiftern und Mördern zu bieten hatte, wurde nach Moorehead geschafft. Viele von ihnen waren hartgesottene Waisenkinder und Ausreißer, die furchtlos und selbstbewusst in Moorehead herumliefen. Andere stammten aus intakten Familien, waren gebändigter, sensibler, ohne Mumm in den Knochen. Mir sagten die rauen Jungs mehr zu. Ich fand sie attraktiver. Ihre Vergehen wirkten irgendwie normaler. Es waren die Jungen aus besserem Hause, die die wirklich abartigen Verbrechen begingen – die ihre kleine Schwester erwürgten, den Priester vergifteten oder den Nachbarhund in Brand setzten. Es war faszinierend. Nach mehreren Jahren allerdings auch irgendwie ein alter Hut.