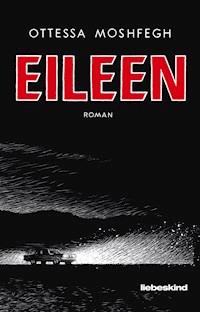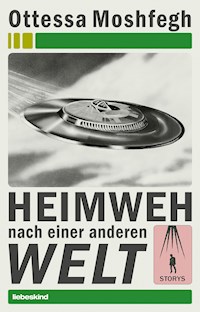
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlagsbuchhandlung Liebeskind
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
John will sich an seiner verstorbenen Frau rächen, indem er sie posthum mit demselben Strichjungen betrügt, mit dem sie ihn mutmaßlich hintergangen hat. Larry arbeitet in einer betreuten Wohneinrichtung für "Menschen mit Entwicklungsstörungen", weil er endlich sein Leben mit Leuten verbringen will, die ihn zu schätzen wissen. Und Charles fährt für ein Wochenende in eine Berghütte, weil seine Frau schwanger ist und er ein paar Tage für sich haben will, bevor das Baby auf die Welt kommt und sein Leben für immer ruiniert … Die Menschen in Ottessa Moshfeghs Erzählungen sind eigensinnig, überheblich und boshaft. Und doch fühlen wir mit ihnen, denn ihr oft absurdes Verhalten hat immer auch etwas zutiefst Menschliches, genau wie ihre pathetischen Illusionen, durch die sie sich ständig selbst im Weg stehen. Haben wir nicht alle irgendwann "Heimweh nach einer anderen Welt"?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ottessa Moshfegh
Heimwehnach eineranderen Welt
Storys
Aus dem Englischenvon Anke Caroline Burger
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
»Homesick for Another World« bei Penguin Books, New York.
© Ottessa Moshfegh 2017
© Verlagsbuchhandlung Liebeskind 2020
Alle Rechte vorbehalten
Covermotiv: Archive Photos / Getty Images
Covergestaltung: Lauren Kolm, New York
eISBN 978-3-95438-119-7
Ich bessere mich
Mr. Wu
Malibu
Durchgeknallt
Die dunkle, kurvenreiche Straße
Nichts für gute Menschen
Ich mische mich unters gemeine Volk
Eine ehrliche Frau
Der Beach Boy
Hier passiert nie was
Ein Tänzchen im Mondschein
Der Ersatz
Der verschlossene Raum
Ein besserer Ort
Ich bessere mich
MEIN KLASSENZIMMER lag im Erdgeschoss, neben dem Aufenthaltsraum der Nonnen. Zum morgendlichen Erbrechen ging ich auf deren Toilette. Eine Nonne bestäubte die Klobrille immer mit Körperpuder. Eine andere steckte den Stöpsel ins Waschbecken und füllte es mit Wasser. Ich verstand die Nonnen nicht. Eine war alt, die andere war jung. Die Junge redete manchmal mit mir, fragte mich, ob ich über das lange Wochenende etwas vorhatte, ob ich meine Eltern zu Weihnachten sehen würde und so weiter. Wenn die Alte mich kommen sah, wandte sie den Blick ab und knetete mit den Fäusten ihre Ordenstracht.
Mein Klassenzimmer befand sich in der ehemaligen Schulbücherei. Es war ein unordentlicher Bibliotheksraum, in dem überall Bücher und Zeitschriften herumlagen, mit einem uralten, pfeifenden Heizkörper und großen, beschlagenen Fenstern, die auf die Sixth Street hinausgingen. Vorn neben der Tafel stellte ich zwei Schultische als Lehrertisch zusammen. Hinten im Raum versteckte ich in einem Karton unter alten Zeitungen einen Daunenschlafsack. Wenn ich keinen Unterricht hatte, holte ich den Schlafsack heraus, verriegelte die Tür und schlief, bis die Glocke läutete. Meist war ich noch vom Vorabend betrunken. Manchmal bestellte ich mir mittags beim Inder um die Ecke ein Bier, nur, um durch den Tag zu kommen – säuerliches Weizenbier in einer dickleibigen, braunen Flasche. Das McSorley’s war auch in der Nähe, aber ich mochte das nostalgische Ambiente nicht. Bei dieser Bar verdrehte ich nur die Augen. Nach unten in die Schulcafeteria ging ich selten, aber wenn ich dort auftauchte, hielt der Rektor, Mr. Kishka, mich jedes Mal an und sagte mit strahlendem Lächeln: »Da ist sie ja, unsere Vegetarierin.« Wie er darauf kam, dass ich Vegetarierin sein könnte, weiß ich nicht. Aus der Cafeteria holte ich mir einzeln verpackte Käsefinger, Chicken Nuggets und fettige Brötchen.
Ich hatte eine Schülerin, Angelika, die zu mir ins Klassenzimmer kam und mit mir zusammen Mittag aß.
»Miss Mooney«, rief sie mir zu. »Ich habe Probleme mit meiner Mutter.«
Ich hatte zwei Freundinnen, sie war eine davon. Wir redeten und redeten. Von mir lernte sie, dass man von Ejakulat nicht dick wurde.
»Aber das stimmt nicht, Miss Mooney. Das Zeug macht dick. Deswegen sind viele Mädchen auch so fett. Weil sie Nutten sind.«
Sie hatte einen Freund, den sie jedes Wochenende im Gefängnis besuchte. Montags kriegte ich immer eine neue Geschichte zu hören, über seine Anwälte, wie sehr sie ihn liebte und so weiter. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich nie. Es war, als kenne sie die Antworten auf ihre Fragen schon im Voraus.
Ich hatte einen Schüler, der mich wahnsinnig machte: Popliasti. Ein blonder, überdrehter Zehntklässler mit Pickeln und starkem Akzent. »Miss Mooney«, sagte er immer und stand von seinem Platz auf. »Hier, ich helfe Ihnen bei Ihrer Frage.« Er nahm mir die Kreide aus der Hand und malte einen Schwanz mit Eiern an die Tafel. Dieser Schwanz mit Eiern wurde zu einer Art Erkennungszeichen der Klasse. Er erschien auf allen Hausaufgaben und Klassenarbeiten, wurde in jeden Tisch geritzt. Mir machte das nichts aus. Ich musste sogar darüber lachen. Aber Popliasti und sein ständiges Stören – da verlor ich öfter mal die Beherrschung.
»Wie soll ich euch unterrichten, wenn ihr euch aufführt wie die Tiere!«, brüllte ich.
»Wie sollen wir etwas lernen, wenn Sie sich wie eine Verrückte benehmen und hier rumschreien? Sie haben sich nicht mal gekämmt«, entgegnete Popliasti, rannte durch den Raum und warf Bücher von den Fensterregalen. Auf ihn hätte ich verzichten können.
Meine Zwölftklässler hingegen behandelten mich mit viel Respekt. Meine Aufgabe war es, sie auf den SAT vorzubereiten. Sie hatten ernst zu nehmende Mathe- und Vokabelfragen, die gar nicht so leicht zu beantworten waren. In Differenzialrechnung musste ich mich ein paar Mal geschlagen geben und erzählte ihnen stattdessen einen Schwank aus meinem Leben.
»Die meisten Menschen haben schon Analverkehr gehabt«, sagte ich. »Da müsst ihr gar nicht so erstaunt gucken.«
Oder: »Mein Freund und ich, wir machen’s ohne Kondom. Wenn man jemandem vertraut, geht das.«
Etwas an der alten Bibliothek schien Rektor Kishka nicht zu behagen, er ließ sich nie bei mir blicken. Wahrscheinlich wusste er, dass er dort klar Schiff machen und mich rausschmeißen müsste, und setzte deshalb nie einen Fuß in den Raum. Die meisten Bücher waren mehrbändige, völlig veraltete Nachschlagewerke, unvollständig und dadurch nicht mehr zu gebrauchen, ukrainische Bibeln oder Nancy-Drew-Krimis. Unter einer ausrangierten Karte der UdSSR, die zusammengefaltet in einer Schublade mit der Aufschrift SCHWESTER KOSZINSKA lag, fand ich sogar ein paar Pornoheftchen. Eine tolle Sache war die alte Enzyklopädie der Würmer, die ich in der Bibliothek aufstöberte. Der Einband der dicken Schwarte fehlte, und die zerfledderten Seiten waren an den Ecken abgegriffen. Wenn ich nicht schlafen konnte, las ich zwischen den Schulstunden darin. Ich legte mich mit der Enzyklopädie in den Schlafsack, drückte die brüchige Bindung auseinander und ließ den Blick über die viel zu kleinen Druckbuchstaben wandern. Jeder Eintrag war unglaublicher als der vorherige. Es gab Spulwürmer und Hufeisenwürmer und Würmer mit zwei Köpfen und Würmer mit Zähnen wie Diamanten und Würmer, die so groß wie Hauskatzen wurden, Würmer, die wie Grillen zirpten, die sich als Kieselsteine oder Lilien tarnten oder ihren Kiefer so aushängten, dass sie ein menschliches Baby verschlingen konnten. Was ist das bloß für ein Müll, den sie Kindern heutzutage beibringen, dachte ich. Ich schlief, stand auf, unterrichtete Mathe, dann legte ich mich wieder in den Schlafsack. Ich zog den Reißverschluss bis über den Kopf zu. Ich kroch ganz tief hinein und kniff die Augen zusammen. In meinem Kopf hämmerte es, und mein Mund fühlte sich an wie eine nasse Küchenrolle. Als die Schulglocke läutete, kroch ich heraus, und da stand dann Angelika mit ihrem braunen Brotbeutel vor mir und sagte: »Ich habe was im Auge, Miss Mooney, deswegen muss ich weinen.«
»Na gut«, sagte ich. »Mach die Tür zu.«
Der Boden war mit kariertem Linoleumfußboden ausgelegt, schwarz und pissgelb. Die Wände waren mit glänzender, aufgeplatzter, pissgelber Farbe gestrichen.
Ich war mit einem Mann zusammen, der noch aufs College ging. Er hatte jeden Tag dieselben Klamotten an: eine blaue Arbeitshose und ein halb durchsichtiges Oberhemd. Es war ein Button-down im Western-Stil mit perlmuttfarbenen Druckknöpfen. Der Stoff war so dünn, dass man seine Brustbehaarung und die Brustwarzen sehen konnte. Ich sagte nichts. Er hatte ein hübsches Gesicht, aber dicke Waden und einen weichen, faltigen Hals. »Auf dem College gibt es eine Menge Mädchen, die was von mir wollen«, sagte er oft. Er studierte, um Fotograf zu werden, was ich nicht ernst nehmen konnte. Ich ging davon aus, dass er nach seinem Abschluss in irgendeinem Bürojob landen und dankbar sein würde, eine anständige Arbeit zu haben, dass er glücklich sein und damit angeben würde, ein festes Einkommen, ein eigenes Konto, einen Anzug im Schrank zu haben und so weiter und so fort. Er war ein lieber Kerl. Einmal kam seine Mutter aus Tennessee zu Besuch. Er stellte mich vor als seine »Bekannte, die in Downtown wohnt«. Die Mutter war eine schreckliche Person. Eine große Blondine mit Silikontitten.
»Welche Nachtcreme benutzen Sie?«, das fragte sie mich, als mein Freund auf dem Klo war.
Ich war dreißig. Ich hatte einen Ex-Mann. Er zahlte mir Unterhalt, und ich hatte eine ordentliche Krankenversicherung, weil ich beim Erzbistum New York beschäftigt war. Meine Eltern aus dem Norden des Bundesstaats schickten mir Carepakete mit Briefmarken und Kräutertee. Wenn ich betrunken war, rief ich meinen Ex-Mann an und beschwerte mich über meinen Job, meine Wohnung, meinen Freund, die Schüler, alles, was mir gerade durch den Kopf ging. Er war schon wieder verheiratet, in Chicago. Er machte irgendwas Juristisches. Ich hatte nie kapiert, was genau sein Job war, und er erklärte es mir auch nicht.
Am Wochenende kam mein Freund vorbei. Wir tranken zusammen Wein und Whiskey, das fand ich romantisch. Er konnte damit umgehen. Wahrscheinlich guckte er nicht so genau hin. Aber in puncto Rauchen war er ein totaler Idiot.
»Wie kann man nur so viel rauchen?«, sagte er andauernd. »Dein Mund schmeckt wie kanadischer Räucherspeck.«
»Ha-ha«, sagte ich auf meiner Seite des Betts. Ich kroch unter die Decke. Klamotten, Bücher, ungeöffnete Post, Tassen, Aschenbecher, mein halbes Leben hatte sich dort zwischen Matratze und Wand angesammelt.
»Erzähl mir, wie deine Woche gelaufen ist«, sagte ich zu meinem Freund.
»Also, am Montag bin ich um halb zwölf aufgewacht«, fing er an. Er konnte endlos reden. Er stammte aus Chattanooga. Er hatte eine angenehme, leise Stimme. Sie hatte einen schönen Klang, wie ein altes Radio. Ich stand auf, schenkte mir Wein in eine Tasse und setzte mich auf die Bettkante.
»Die Schlange im Supermarkt war normal lang«, erzählte er.
Und später: »Aber ich kann Lacan nicht ausstehen. Das ist reine Arroganz, wenn Leute so unzusammenhängend schreiben.«
»Genau«, sagte ich. »Reine Faulheit.«
Wenn er fertig erzählt hatte, war es spät genug, und wir konnten essen gehen. Und dazu was trinken. Ich brauchte nichts weiter zu tun, als ein Stück zu gehen, mich hinzusetzen und ihm zu sagen, was er für mich bestellen sollte. In der Hinsicht kümmerte er sich rührend um mich. Er mischte sich nur selten in mein Privatleben ein. Tat er es doch, zeigte ich mich von meiner gefühlvollen Seite.
»Warum kündigst du nicht?«, fragte er. »Du könntest es dir doch leisten.«
»Weil ich diese Kinder liebe«, antwortete ich. Tränen traten mir in die Augen. »Sie sind wirklich ganz besondere Menschen. Sie bedeuten mir sehr viel.« Ich war betrunken.
Mein Bier kaufte ich in der Bodega Ecke East Tenth Street und First Avenue. Die Ägypter, die da arbeiteten, sahen sehr gut aus und machten mir nette Komplimente. Sie schenkten mir immer Bonbons – einzeln verpackte Twizzlers oder Pop Rocks. Sie ließen eins mit in die Papiertüte fallen und zwinkerten mir zu. Auf dem Heimweg von der Schule kaufte ich mir jeden Nachmittag zwei oder drei Literflaschen Bier und ein Päckchen Zigaretten, dann legte ich mich ins Bett und guckte Eine schrecklich nette Familie und die Sally-Talkshow auf meinem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, trank was, rauchte und döste vor mich hin. Wenn es dunkel wurde, ging ich noch ein paar große Bier holen, und manchmal auch was zu essen. Gegen zehn Uhr abends kam der Wodka dran, und ich gab vor, mit einem Buch oder Musik etwas für meine Bildung zu tun – als überprüfe Gott mein Wohlverhalten.
»Alles gut hier«, so tat ich zumindest. »Wie üblich bessere ich mich.«
Manchmal ging ich auch in eine Bar an der Avenue A. Dort versuchte ich immer, mir Sachen zu bestellen, die mir nicht schmeckten, damit ich langsamer trank. Ich bestellte Gin Tonic oder Gin mit Soda oder einen Gin Martini oder ein Guinness. Der Frau hinter dem Tresen – eine alte Polin – hatte ich anfangs erzählt: »Ich rede nicht gern beim Trinken, deswegen kann es sein, dass ich nicht mit Ihnen rede.«
»Okay«, sagte sie. »Kein Problem.« Sie war sehr respektvoll.
Jedes Jahr mussten die Kinder eine große Prüfung ablegen, mit der der Staat herauszufinden versuchte, wie schlecht ich meine Arbeit erledigte. Die Tests waren darauf angelegt, dass man durchfallen musste. Selbst ich schaffte sie nicht.
Die andere Mathelehrerin war eine kleine Filipina, die für denselben Job weniger Geld als ich verdiente, aber ohne Mann mit drei Kindern in einer Einzimmerwohnung in Spanish Harlem wohnte. Sie hatte eine Atemwegserkrankung und ein großes Muttermal auf der Nase; ihre Blusen trug sie bis zum Hals zugeknöpft, darüber peinliche Schleifen und Broschen und dicke Perlenketten aus Plastik. Sie war strenggläubige Katholikin. Die Schüler machten sich wegen ihres Aussehens über sie lustig. Sie nannten sie »kleine Frau Schlitzauge«. Sie war eine viel bessere Mathelehrerin als ich, aber sie hatte mir gegenüber auch einen Riesenvorteil: Sie bekam die ganzen Schüler, die gut in Mathe waren, denen damals in der Ukraine Multiplikationstabellen, Dezimalstellen, Exponenten, das ganze Handwerkszeug mit dem Stock eingebläut worden waren. Wenn irgendjemand was über die Ukraine erzählte, stellte ich mir einen kahlen, grauen Wald voll heulender, schwarzer Wölfe vor oder eine trostlose, an der Autobahn gelegene Bar mit lauter lustlosen Strichjungen.
Meine Schüler waren alle schrecklich schlecht in Mathe. Ich hatte die ganzen Loser am Hals. Popliasti war der Schlimmste, der konnte kaum zwei und zwei zusammenzählen. Ausgeschlossen, dass meine Kids die staatliche Prüfung bestanden. Wenn der Tag kam, an dem der Test abgelegt werden musste, sahen wir uns nur an, die Filipina und ich, nach dem Motto: Wem machen wir hier eigentlich was vor? Ich verteilte die Tests, ließ die Schüler das Siegel aufbrechen, zeigte ihnen, mit welchem Bleistift sie die Kästchen richtig ausfüllen mussten, und ermunterte sie: »Versucht es einfach, so gut ihr könnt.« Dann nahm ich die Tests mit nach Hause und machte die Kreuze an der richtigen Stelle. Diese Loser würden mich auf keinen Fall um meinen Job bringen.
»Ganz hervorragend!«, sagte Mr. Kishka, wenn wir die Ergebnisse bekamen. Er zwinkerte mir zu, hielt den Daumen hoch, schlug ein Kreuz und schloss langsam die Tür hinter sich.
Jedes Jahr das gleiche Spiel.
Eine andere Freundin hatte ich noch, Jessica Hornstein, ein unscheinbares jüdisches Mädchen, das ich auf dem College kennengelernt hatte. Ihre Eltern waren Cousins zweiten Grades. Sie wohnte bei ihnen zu Hause in Long Island und fuhr abends manchmal mit dem Vorortzug in die Stadt, dann gingen wir zusammen aus. Sie kreuzte in stinknormalen Jeans und Sneakers auf, öffnete ihren Rucksack und holte Koks und ein Outfit heraus, das zur billigsten Prostituierten auf dem Strip in Vegas passte. Das Kokain bezog sie von einem Schüler in Bethpage. Schreckliches Zeug, vermutlich mit Waschpulver verschnitten. Außerdem besaß Jessica Perücken in allen möglichen Farben und Stilen: ein neonblauer Pagenschnitt, ein lange, blonde Barbarella-Perücke, rote Locken, eine rabenschwarze japanische Frisur. Jessica hatte ein farbloses Gesicht und Froschaugen. Wenn ich mit ihr ausging, fühlte ich mich wie Kleopatra neben einer Milchmagd. Sie wollte immer »in einen Club gehen«, was ich furchtbar fand. Die Nacht unter einer bunten Glühbirne verbringen, vor einem Zwanzig-Dollar-Cocktail, wo man von dürren indischen Ingenieuren angemacht wurde, nicht tanzte und dafür einen Stempel auf den Handrücken bekam, den man nicht abwaschen konnte. Für mich war das Körperverletzung.
Aber Jessica Hornstein konnte sehr sexy tanzen. Die meisten Abende endeten damit, dass sie sich im Arm irgendeines gesichtslosen Managertyps von mir verabschiedete, mit dem sie sich dann in seiner Eigentumswohnung in Murray Hill, oder wo auch immer diese Typen wohnten, »herrlich amüsierte«. Hin und wieder ging ich auf die Avancen eines Inders ein, setzte mich mit ihm in ein privates Taxi nach Queens, guckte mir sein Arzneimittelschränkchen an, ließ mich lecken und fuhr um sechs mit der U-Bahn nach Hause, um noch schnell zu duschen, meinen Ex-Mann anzurufen und rechtzeitig vor dem zweiten Klingeln in der Schule zu sein. Aber meistens verließ ich den Club relativ früh und hievte mich auf einen Hocker vor meiner alten polnischen Barfrau. Jessica Hornstein konnte mich mal. Ich tauchte einen Finger ins Bier und rieb mir damit die Wimperntusche ab. Ich schaute mir die anderen Frauen in der Bar an. Geschminkte Frauen sehen immer schrecklich verzweifelt aus, fand ich. Die Leute sind einfach unehrlich, wenn es um ihre Kleidung geht oder wie sie sich verhalten. Und dann dachte ich: Wen juckt’s? Sollen sie doch machen, was sie wollen. Ich habe genug mit mir selbst zu tun. Ab und an heulte ich meinen Schülern etwas vor. Ich warf die Arme in die Luft. Ich legte den Kopf auf den Tisch. Ich bat sie um Hilfe. Aber was war da groß zu erwarten? Sie drehten sich weg, um mit ihren Mitschülern zu quatschen, setzten sich Kopfhörer auf, zogen Bücher und Chipstüten hervor, sahen aus dem Fenster, was weiß ich. Nur trösten wollten sie mich nicht.
Ja, natürlich gab es manchmal auch gute Zeiten. Einmal ging ich in den Park und beobachtete ein Eichhörnchen, das einen Stamm hochlief. Eine Wolke schwebte durch den Himmel. Ich setzte mich auf ein vertrocknetes, gelbes Rasenstück und ließ mir von der Sonne den Rücken wärmen. Vielleicht versuchte ich sogar, ein Kreuzworträtsel zu lösen. Einmal fand ich einen Zwanzigdollarschein in einer alten Jeans. Ich trank ein Glas Wasser. Es wurde Sommer. Die Tage wurden unerträglich lang. Die Schulferien fingen an. Mein Freund machte seinen Abschluss und zog zurück nach Tennessee. Ich kaufte ein Kühlgerät und gab einem Jungen Geld, damit er es mir nach Hause und die Treppe hoch zu meiner Wohnung trug. Dann hinterließ mein Ex-Mann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter: »Ich bin nächste Woche in der Stadt«, sagte er. »Wie wär’s, wenn wir uns zum Mittag- oder Abendessen treffen? Oder was trinken gehen. Nichts Großes«, sagte er. »Nächste Woche, dann können wir reden.«
Nichts Großes. Das würden wir ja sehen. Ich blieb ein paar Tage trocken, machte bei mir in der Wohnung auf dem Boden Turnübungen. Von meinem Nachbarn, einem nicht mehr ganz jungen Schwulen mit tiefen Aknenarben im Gesicht, der mich wie ein besorgter Hund ansah, lieh ich mir einen Staubsauger. Ich machte einen Spaziergang zum Broadway und gab etwas von meinem Geld für neue Kleider, Stöckelschuhe und Seidenhöschen aus. Ich ließ mich schminken und kaufte alle Produkte, die mir vorgeschlagen wurden. Ich ging zum Friseur. Ich ließ mir die Nägel machen. Ich ging alleine zum Lunch. Zum ersten Mal seit Jahren aß ich einen Salat. Ich ging ins Kino. Ich rief meine Mutter an. »Mir geht’s so gut wie nie«, sagte ich. »Ich genieße den Sommer. Ich mache richtig Urlaub.« Ich räumte die Wohnung auf. Ich füllte eine Vase mit bunten Blumen. Alles Gute, das mir irgendwie einfiel, tat ich. Hoffnung erfüllte mich. Ich kaufte neue Bettwäsche und Handtücher. Ich hörte Musik. »Bailar«, sagte ich zu mir selbst. Schau her, ich spreche Spanisch. Mein Kopf heilt, dachte ich. Alles wird gut.
Und dann kam der Tag. Ich war mit meinem Ex-Mann in einem schicken Bistro an der MacDougal Street verabredet, in dem die Kellnerinnen hübsche Kleider mit weißen Spitzenkrägen trugen. Ich war früh dran, setzte mich an die Bar und sah den Kellnerinnen dabei zu, wie sie sich bedächtig mit ihren runden, schwarzen Tabletts, auf denen bunte Cocktails, kleine Brotteller und Schälchen mit Oliven standen, durch den Raum bewegten. Ein schmächtiger Sommelier trat auf und wieder ab, wie der Dirigent eines Orchesters. Die Nüsse an der Bar waren mit Salbei aromatisiert. Ich zündete mir eine Zigarette an und sah auf die Uhr. Ich war viel zu früh. Ich bestellte mir etwas zu trinken. Einen Scotch mit Soda. »Scheiße«, sagte ich. Ich bestellte mir noch was zu trinken, diesmal Scotch pur. Ich zündete mir noch eine Zigarette an. Eine junge Frau setzte sich neben mich. Wir kamen ins Gespräch. Sie wartete auch auf jemanden. »Männer«, sagte sie. »Denen macht es einfach Spaß, uns zu foltern.«
»Ich weiß nicht, was Sie damit sagen wollen«, erwiderte ich und drehte mich auf meinem Hocker von ihr weg.
Dann war es zwanzig Uhr und mein Ex-Mann kam herein. Er sprach mit der Empfangsdame, nickte in meine Richtung, folgte ihr zu einem Tisch am Fenster und winkte mich zu sich. Ich nahm meinen Drink mit an den Tisch.
»Danke, dass du dir Zeit für ein Treffen genommen hast«, sagte er und zog sein Jackett aus.
Ich zündete eine Zigarette an und schlug die Weinkarte auf. Mein Ex räusperte sich, sagte aber erst mal nichts. Dann fing er mit seinem üblichen Gerede an, über das Restaurant, dass er in irgendeiner Zeitschrift etwas über den Koch gelesen habe, wie schrecklich das Essen im Flieger gewesen sei, das Hotel, wie die Stadt sich verändert habe, die Speisekarte sei interessant, das Wetter hier, das Wetter dort und so weiter und so fort. »Du siehst müde aus«, sagte er. »Bestell dir, was du willst«, als sei ich seine Nichte oder der Babysitter oder sonst was.
»Das werde ich, danke schön«, sagte ich.
Eine Kellnerin kam und erklärte uns die Tageskarte. Mein Ex war sehr charmant zu ihr. Zu Kellnerinnen war er immer freundlicher als zu mir. »Oh, danke. Vielen Dank. Sie sind die Beste. Wow. Wow, wow, wow. Danke, danke, danke.«
Ich beschloss, etwas zu bestellen, dann so zu tun, als würde ich auf die Toilette gehen, und ihn einfach sitzen zu lassen. Ich nahm meine Baumelohrringe ab und steckte sie in die Handtasche. Ich schlug die Beine nicht mehr übereinander. Ich sah ihn an. Er lächelte nicht und machte auch sonst nichts. Mein Freund fehlte mir. Er war so unkompliziert gewesen. Er hatte sich immer respektvoll verhalten.
»Und wie geht es Vivian?«, fragte ich.
»Danke, gut. Sie ist befördert worden und hat viel zu tun. Alles bestens. Sie lässt dich grüßen.«
»Wunderbar. Sag ihr auch Grüße von mir.«
»Werde ich ausrichten.«
»Danke«, sagte ich.
»Gern geschehen«, sagte er.
Die Bedienung kam mit einem weiteren Drink und nahm unsere Bestellung auf. Ich orderte eine Flasche Wein. Ich dachte, für den Wein bleibe ich noch. Die Wirkung des Scotchs ließ allmählich nach. Die Bedienung ging weg, und mein Ex stand auf, um zur Toilette zu gehen, und als er wiederkam, bat er mich, ihn nicht mehr anzurufen.
»Nein, ich glaube, ich rufe dich weiter an«, erwiderte ich.
»Ich gebe dir Geld dafür«, sagte er.
»An wie viel hattest du gedacht?«
Er nannte mir eine Summe.
»Gut«, sagte ich. »Ich nehme das Angebot an.«
Unser Essen wurde aufgetragen. Wir aßen schweigend. Und dann konnte ich nicht weiteressen. Ich stand auf. Ich sagte nichts. Ich ging nach Hause. Ich lief zur Bodega und zurück. Meine Bank rief bei mir an. Ich schrieb einen Brief an die Ukrainisch-Katholische Schule.
»Sehr geehrter Direktor Kishka«, schrieb ich. »Danke, dass ich an Ihrer Schule unterrichten durfte. Bitte werfen Sie den Schlafsack weg, der in dem Karton hinten in meinem Klassenraum liegt. Leider muss ich aus persönlichen Gründen meine Kündigung einreichen. Ich habe übrigens die staatlichen Prüfungen gefälscht, nur, damit Sie Bescheid wissen. Vielen Dank für alles. Danke, danke, danke.«
Hinten an die Schule schloss sich eine Kirche an – eine Kathedrale mit überlebensgroßen Mosaikabbildungen von Figuren, die einen Finger hochhielten, als wollten sie sagen: Und schön still sein! Ich hatte vor, in die Kirche zu gehen und einem der Priester mein Kündigungsschreiben auszuhändigen. Wahrscheinlich sehnte ich mich auch nach ein bisschen Zuwendung und stellte mir vor, der Priester würde mir die Hand auf den Kopf legen und »meine liebe Tochter« zu mir sagen, »liebes Kind«, »Kleines«. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee kam. »Mein Schatz.«
Ich war auf schlechtem Kokain und Alkohol und hatte seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ich hatte ein paar Männer in meine Wohnung gelockt, ihnen mein gesamtes Hab und Gut gezeigt, fleischfarbene Strumpfhosen in die Länge gezogen und vorgeschlagen, dass wir uns abwechselnd damit aufhängten. Keiner blieb länger als ein paar Stunden. Der Brief an Direktor Kishka lag auf dem Nachttisch. Es war so weit. Bevor ich losging, betrachtete ich mich im Badezimmerspiegel. Ich fand, dass ich relativ normal aussah. Das war eigentlich unmöglich. Ich schniefte das letzte bisschen von dem Zeug weg. Ich setzte eine Basecap auf. Ich schmierte Pflegestift auf meine Lippen.
Auf dem Weg zur Kirche kam ich an einem McDonald’s vorbei und ging hinein, um mir eine Coca-Cola Light zu holen. Ich war seit Wochen nicht mehr unter Menschen gewesen. Ganze Familien saßen dort zusammen, saugten betäubt an Strohhalmen und kauten ihre Pommes wie kranke Pferde ihr Heu. Am Eingang durchwühlte ein Obdachloser, ob Mann oder Frau konnte ich nicht sagen, den Müll. Wenigstens war ich nicht völlig allein, dachte ich. Es war ein heißer Tag. Ich wollte diese zuckerfreie Cola. Aber die Schlangen am Bestelltresen ergaben einfach keinen Sinn. Die meisten Leute standen in willkürlich gebildeten Trauben davor und blickten mit apathischem Blick, die Hand am Kinn, hoch zur Tafel mit den Angeboten, zeigten auf etwas und nickten.
»Stehen Sie an?«, fragte ich einen nach dem anderen. Niemand wollte mir antworten.
Schließlich trat ich einfach vor, zu einem jungen Schwarzen, der hinter dem Tresen stand und eine Kappe auf dem Kopf trug. Ich bestellte meine Cola Light.
»Welche Größe?«, fragte er.
Er zeigte mir vier Becher in aufsteigender Größe. Der größte erhob sich sicher dreißig Zentimeter über dem Tresen.
»Die da«, sagte ich.
Es kam mir vor wie ein außerordentliches Ereignis. Ich kann es nicht erklären. Ich fühlte mich augenblicklich mit großer Macht ausgestattet. Ich steckte den Strohhalm in den Becher und trank. Es schmeckte gut. Es war das Wohlschmeckendste, was ich je getrunken hatte. Ich überlegte, ob ich noch eine bestellen sollte, für später, wenn ich die erste leer hatte. Aber das wäre respektlos der ersten gegenüber, dachte ich. Erst mal die hier auskosten. Okay, dachte ich. Eine nach der anderen. Eine Cola Light nach der anderen. Und jetzt zum Priester.
In der Kirche war ich zum letzten Mal an einem katholischen Feiertag gewesen. Ich hatte mich nach hinten gesetzt und mich bemüht, alles richtig zu machen, mich hinzuknien, zu bekreuzigen, zu den lateinischen Sprüchen die Lippen zu bewegen und so weiter. Ich verstand nichts davon, aber eine gewisse Wirkung hatte es doch auf mich. Es war kalt in der Kirche. Meine Brustwarzen richteten sich auf, meine Hände waren geschwollen, mein Rücken tat weh. Ich muss nach Alkohol gestunken haben. Ich sah den Schülern zu, die sich in ihren Uniformen zur Eucharistie anstellten. Die, die vor dem Altar das Knie beugten, taten das so überzeugt und inbrünstig, dass es mir das Herz brach. Die Liturgie war zum größten Teil auf Ukrainisch. Ich sah, wie Popliasti mit der Polsterbank spielte, auf die man sich kniete, sie hochhob und immer wieder nach unten knallen ließ. Die Kirche war mit schönen Buntglasfenstern und einer Menge Blattgold verziert.
Aber als ich an diesem Tag mit meinem Brief vor der Kirche stand, war sie verschlossen. Ich setzte mich auf die feuchte Steintreppe und trank meine Cola Light zu Ende. Ein Obdachloser ohne Hemd ging vorbei.
»Bete um Regen«, sagte er.
»Okay.«
Ich ging zum McSorley’s und aß eine Schale Silberzwiebeln. Ich zerriss den Brief. Die Sonne schien weiter.
Mr. Wu
JEDEN TAG UM ZWÖLF UHR mittags ging Mr. Wu über den schmalen Pfad vorbei an dem stinkenden Graben und dem Feuerwerksverkäufer und dem alten Tempel, der jetzt von den Landarbeitern, die in die Vororte kamen, um auf dem Markt zu verkaufen, als eine Art Absteige benutzt wurde, vorbei an kleinen Läden, in denen Herrenfriseure und Bordelle und Apotheken und Bekleidungsgeschäfte und Zigarettenhändler waren, bis zu dem kleinen, familienbetriebenen Restaurant, wo er sich einen Platz unter dem schnell rotierenden Deckenventilator suchte, der mit Straßenstaub bedeckt war, und sich etwas mit Schweinefleisch, etwas mit Kartoffeln und etwas mit dem frischen Gemüse aus der Auslage bestellte, dasaß und Zeichentrickserien schaute und rauchte, während das Essen kochte und die Hunde vorbeitrotteten und der Staub von den Kleinlastwagen, Fahrrädern und Mopeds aufgewirbelt wurde und sich wieder legte.
Er war in die Frau von der Videospielhalle verliebt. Sie war ungefähr so alt wie er, Mitte vierzig, und hatte eine Tochter auf der Oberschule. Er kannte sie aus der Spielhalle und aus seinem Viertel; sie wohnte zusammen mit ihrer Tochter und ihrer Schwester und deren zurückgebliebenem Sohn nur wenige Türen von ihm entfernt. Wenn Mr. Wu der Frau auf der belebten Straße begegnete, würdigte sie ihn keines Blickes. Aber wenn er ihr auf dem Markt zwischen den Ständen über den Weg lief, lächelte sie höflich und erkundigte sich nach seiner Gesundheit. »Kann nicht klagen«, murmelte er immer. Er wusste, dass er Mundgeruch hatte, und auch, dass sie nicht an ihm interessiert war, weil ihr Blick immer so schnell weiterhuschte.
Mr. Wu wagte es nicht, die örtlichen Prostituierten aufzusuchen. Er fuhr mit dem Bus in die Stadt und bezahlte dort gern mehr Geld für ein wenig Anonymität. Außerdem, dachte er, ist es besser, wenn man nicht weiß, wo die Mädchen herkommen, wen sie noch bedienen und so weiter. Alles Geschlechtliche war ihm peinlich, und ausziehen mochte er sich nur unter dem Bettlaken. Während des Geschlechtsaktes lagen seine Hände leicht auf den Schultern des Mädchens, den Blick hielt er abgewandt, die Augen machte er aber nicht zu. Er hatte irgendwo gehört, die Augen zu schließen hieß, man sei verliebt. Er stellte sich vor, dass er bei der Frau aus der Spielhalle die Augen schließen würde. Ob sie wohl einen Körper hatte wie die Prostituierten: weich, weiß und geruchslos und blass? Ein wenig Selbsthass nach dem Besuch bei einer Prostituierten fand er normal, und es überraschte ihn nie, wenn ihm der Gedanke kam: Ich bin eklig. Auf der Heimfahrt aß er ein Eis, sah aus dem Busfenster und dachte an die Frau in der Spielhalle, was sie in diesem Augenblick wohl gerade machte, und das versetzte ihm einen Stich ins Herz.
Er lebte allein, im höchsten Haus des Viertels. Unter ihm wohnte ein junges Paar mit einem großen, dicken Baby und einem Hausschwein. Der junge Mann verdiente seinen Lebensunterhalt, indem er Bestechungsgelder für einen lokalen Stadtrat eintrieb. Seine Frau hatte eine verkümmerte Hand, die Mr. Wu an eine große Krabbe erinnerte. Jedes Mal, wenn er die Hand sah, lief ihm ein Schauer über den Rücken und er musste würgen. Das Kind tat ihm leid, weil es von diesem schaurigen, verdrehten, schlaffen, roten Tentakel gehalten und gefüttert wurde. Die Frau aus der Spielhalle hatte kleine, zärtliche, bronzefarbene Hände, stark und muskulös waren sie, nicht zu knochig und auch nicht zu dick. Genau richtig, dachte er. Perfekte Hände. Er ging mindestens einmal am Tag in die Spielhalle und blieb drei bis vier Stunden lang, meist am späten Abend. Manchmal ging er auch morgens hin, wenn keine Schulkinder da waren. An Tagen, an denen er nicht ging, war ihm ganz schlecht, und sein Herz knurrte mürrisch und sinnlos wie ein Tier hinter Gittern. Deswegen ging er so oft wie möglich hin.
Die Spielhalle war keine echte Spielhalle. Es war ein Raum voller Computer, auf denen es Spiele und einen Internetzugang gab. Er kaufte einen Tagespass bei der Frau. Er bezahlte mit einem großen Schein, damit sie ihm Wechselgeld herausgeben musste und er etwas länger dort stehen, ihr beim Geldzählen zusehen und ihre Nähe auf der anderen Seite des Tresens spüren konnte.
»Wie geht es Ihnen heute, Mr. Wu?«, sagte sie. Das sagte sie jeden Tag.
Er murmelte irgendetwas Unverständliches. Er wusste nie, was er in ihrer Gegenwart erzählen sollte. Alles, was er sagen wollte, war: »Sie sind schön« und »Ich bin in Sie verliebt«. Seiner Meinung nach gab es nichts weiter zu reden.
Stattdessen sagte er nur: »Danke« und nahm das Wechselgeld und die Karte mit seinem Passwort zum Einloggen entgegen.
»Viel Spaß«, sagte die Frau.
Er setzte sich an den Computer mit der besten Sicht auf die Frau. Den ganzen Abend lang lugte er hinter seinem Bildschirm hervor und beobachtete sie dabei, wie sie die halbwüchsigen Jungs begrüßte, das Geld entgegennahm und ihnen ihre Karten aushändigte. Wenn keine neuen Kunden kamen, spielte sie Spiele auf ihrem Handy. Sie mag Spiele, dachte Wu. Das ist wunderbar, so frei und unbeschwert. Er liebte ihr dickes, borstiges Haar, das meist offen und kastenförmig auf ihre Schultern fiel. Ihr breites Gesicht war braun und glänzend, sie hatte kräftige Wangen und ein rundes Näschen. Ihre kleinen, klaren Augen leuchteten. Sie trug Lippenstift und blauen Lidschatten. Er fand, dass sie mit jedem Tag schöner wurde. Er beobachtete sie beim Blick in die Puderdose. Er fragte sich, was sie denken mochte, wenn sie in den Spiegel sah: ob sie sich ihrer Schönheit bewusst war.
Eines Tages kam ihm eine Idee. Er würde sie um ihre Handynummer bitten, dann könnten sie einander Kurznachrichten schicken. Die Idee stammte aus einem Gespräch, das er im Restaurant belauscht hatte, in dem er immer zu Mittag aß. Zwei Männer unterhielten sich über einen Artikel, den sie gelesen hatten, es ging um Partnersuche und Technologie. Sie direkt nach ihrer Nummer zu fragen war allerdings ein Risiko, damit könnte er sich verraten. Sie sollte nicht wissen, dass er in sie verliebt war. Das sollte sie erst nach und nach herausfinden, während er sie umwarb und ganz allmählich für sich gewann. Oder noch besser wäre es, wenn er seine Liebe zu ihr ein Leben lang geheim hielte und sie in dem Glauben ließe, dass sie es gewesen war, die ihn verführt hatte. Sie wäre hoffnungslos in ihn verliebt und würde sich glücklich schätzen, ihn zu haben. Er stellte sich vor, wie er ihr viele Jahre später am Esstisch gegenübersitzt. Sie himmelt ihn auf eine fast unerträgliche Art und Weise an. Unbeeindruckt isst er seinen Reis, mit durchgedrücktem Rücken, innerlich rasend vor Glück.
Er kam zum Schluss, dass er es nicht tun konnte. Die Frau nach ihrer Handynummer zu fragen war so, als würde er um ihre Hand anhalten. Er wusste, dass sie Nein sagen würde. Er ging in die Spielhalle, stellte sich in die Schlange, bezahlte für die Zeit dort, roch ihr Haar und sah ihr beim Geldzählen zu, und das Herz tat ihm weh. Ihr Handy lag auf dem Tresen. Wenn er es nur kurz an sich nehmen könnte, dachte er. Aber das war unmöglich. Er setzte sich an einen Computer und verzehrte sich dort nach ihr. Er beobachtete sie bei der Arbeit. Er beobachtete sie, wenn sie ihr Telefon zur Hand nahm. Auf dem Weg nach draußen sah er etwas, von dem er nicht glauben konnte, dass er es bisher nicht bemerkt hatte. Die Spielhalle hatte einen Handzettel mit einem Gutschein ausliegen, für eine kostenlose Stunde am PC, werktags zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens. Die Telefonnummer der Spielhalle stand auch dabei. Er nahm einen Handzettel. Er würde die Nummer später anrufen. Ging die Frau nicht dran, wusste er, dass es nicht ihre Handynummer war. Ging jemand anderes dran, könnte er so tun, als sei er Polizist oder irgendein hochrangiges Tier, und verlangen, mit der Geschäftsführerin der Spielhalle zu sprechen. Er könnte sagen, eine Vorschrift sei verletzt worden, und er müsse umgehend mit ihr sprechen. Er könnte zu einer Uhrzeit anrufen, zu der sie auf jeden Fall nicht da sein würde. Er hatte einen Plan. Immer und immer wieder übte er seine Sätze.
»Hier spricht Lieutenant Liu. Geben Sie mir den Geschäftsführer.«
»Geben Sie mir die Durchwahl des Geschäftsführers.«
Aber am nächsten Morgen ging er zur Spielhalle, stand in der Schlange, bezahlte für die Zeit dort und sah zu, wie die Frau mit ihrem Ohrring spielte und das Wechselgeld herausgab, und sein Herz brach fast entzwei. Er wurde ungeduldig. Er setzte sich an einen PC in der Ecke und rief die Nummer auf dem Handzettel an.
»Wei?«, sagte die Frau.
Sie benutzte ihr Handy!
Fast wäre er vor Freude an die Decke gesprungen. Bald würde er sie in die Arme schließen, dachte er.
»Wei?«, hörte er wieder. Sie saß nichts ahnend hinter dem Tresen, hatte das Telefon ans Ohr gedrückt und kritzelte auf einem Block herum. Er wartete noch ein paar Sekunden, dann legte er auf. Er schickte schnell eine E-Mail an seinen Bruder, der in Suizhou bei der Armee war. Er schrieb ihm, er habe die wunderbarste Frau der Welt kennengelernt und dass er sie wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres heiraten werde. Dann fügte er noch hinzu: »Sie ist alt und nicht sehr hübsch.« Das schrieb er, weil er wusste, dass Prahlerei Unglück brachte.
Er verließ die Spielhalle und ging zurück über den schmalen Pfad, vorbei an dem stinkenden Graben zum Restaurant, wo er sich heute ein besonderes Mittagessen gönnen würde. Alles war wunderschön: die Sonne, der Himmel, die ausgetrockneten, staubig braunen Straßen. Als er eine schmale Fußgängerbrücke überquerte, ging ihm beim Anblick eines roten Banners, das auf die Neueröffnung eines Lebensmittelladens hinwies, das Herz auf. Er kaufte ein Päckchen von den teuersten Zigaretten. Er kaufte eine Dose Orangenlimonade und eine kleine Flasche Baijiu. Bei dem alten Tempel, der jetzigen Absteige, fiel er auf die Knie und sprach ein Dankgebet für die Handynummer.
Jetzt, da er die Nummer der Frau hatte, würde er ihr eine SMS schicken. Aber er wusste nicht, wie er anfangen sollte. Wer sind Sie? könnte er schreiben. Ich habe Ihre Nummer in meinen Kontakten gefunden. Aber ich weiß nicht, wer Sie sind.
Aber das war nicht die richtige Art und Weise, um die Liebe seines Lebens zu beginnen. Er zermarterte sich das Gehirn nach einem guten Einstieg.
Ich habe Sie in der Spielhalle gesehen.
Ich habe Sie auf der Straße gesehen und finde Sie wunderschön.
Ich finde Sie wunderschön und würde Sie gern kennenlernen.
Sie gefallen mir.
Ich sehe Ihnen gern beim Geldzählen zu.
Sie haben hübsche Haare und hübsche Hände, könnte er schreiben.
Nichts davon eignete sich als Einstieg. Er entschloss sich, abzuwarten, bis ihm der perfekte Satz einfiel, anstatt sich vorschnell in einen nicht wohldurchdachten Austausch zu stürzen, der ihn womöglich straucheln lassen könnte. Er wollte nicht plump wirken – Peinlichkeit zu vermeiden war ihm das Wichtigste auf der Welt, vielleicht noch wichtiger als die Eroberung ihres Herzens.
»Ich gehe in den Puff«, sagte sich Wu, trat nach draußen, spazierte zur Bushaltestelle und wartete.
Er wusste natürlich, dass jeder normale andere Mann in seiner Situation sie einfach zum Essen einladen würde. Aber das schien ihm die denkbar schlechteste Taktik zu sein. Er war sich sicher, dass sie ihn zurückweisen würde, wenn er ihr die Gelegenheit dazu gab. »Sie haben mein Gesicht schon mal gesehen«, könnte er schreiben.
Sein Nachbar von unten wartete auch auf den Bus.
»Bruder Wu«, rief er ihm zu. »Wohin fahren Sie?«
»Ich will mit den hochrangigen Tieren in der Stadt sprechen«, log Wu. »Wir bemühen uns um eine Reinigungsmannschaft für die Hu-Long-Straße. Es wird einiges an Überzeugungsarbeit kosten, damit Gelder für so ein Projekt bereitgestellt werden. Es ist nicht meine Aufgabe, aber irgendjemand muss sich ja darum kümmern.«
»Sie sind eine echte Stütze der Gemeinschaft«, sagte der Nachbar. Er wirkte niedergeschlagen. Wahrscheinlich zwickte ihn die Hummerschere seiner Frau, dachte Wu ein wenig schadenfroh.
»Und wie geht es Frau und Kind?«, fragte er.
»Das Baby ist krank. Meine Frau kann nicht stillen, und von der Babynahrung bekommt es Durchfall. Ich muss etwas getan haben, um die Götter zu verärgern«, klagte der Nachbar. Er hielt die Arme mit den Handtellern nach oben. Einem solch abergläubischen Menschen war Wu lange nicht begegnet. Er hatte ganz vergessen, dass es so etwas gab. Sein eigenes Gebet diesen Morgen war kein Dankgebet gewesen, eher der Wunsch eines Kindes beim Ausblasen der Geburtstagskerzen. Er hatte sich gewünscht, die Frau eines Tages nackt in den Armen zu halten und sie auf ein mondbeschienenes Bett zu legen.
»Wo wollen Sie hin?«, fragte Wu den Nachbarn.
»Zum Arzt«, antwortete er. »Neue Medikamente holen.«
Wu wusste nicht mehr, was er sonst noch sagen sollte. Er sah auf sein Handy, als erwarte er schon jetzt eine Antwort von der Frau aus der Spielhalle. Ihm war immer noch nicht eingefallen, was er ihr schreiben sollte. Vielleicht kann mir mein Nachbar helfen, dachte er.
»Sagen Sie mal, Herr Nachbar«, fing er an. »Wie haben Sie Ihre Frau dazu gebracht, Sie zu heiraten?«
»Wir haben in der Grundschule nebeneinander gesessen«, sagte der Nachbar. »Wir haben nicht weit voneinander entfernt gewohnt, und unsere Mütter haben abends Mah-Jongg zusammen gespielt, also waren wir auch befreundet und haben miteinander gespielt. Anfangs waren wir nur befreundet, und dann kam der Rest«, sagte er. »Sie hat eine verkümmerte Hand, wissen Sie.« Er blickte Wu aus dem Augenwinkel an.
»Das ist mir noch gar nicht aufgefallen«, log Wu.
»Nun, wahrscheinlich war sie deswegen verzweifelt und hätte jeden genommen.«
Das brachte Wu auf eine Idee.
Er sah seinen Nachbarn an. »Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute, auch für den Kleinen«, sagte er.
»Es ist ein Mädchen«, erwiderte der Nachbar.
Aber Wu hörte nicht mehr hin. Er dachte an die Frau in der Spielhalle.
Die ganze Busfahrt über dachte er angestrengt nach und war auch bei der Prostituierten nicht recht bei der Sache. Um seine Schmach hinterher zu vergessen, ging er in ein westliches Restaurant, bestellte sich ein Steak, einen frischen Kohlsalat und ein Glas Rotwein.
Er fuhr mit dem Taxi nach Hause.
Er wusste, was er der Frau in der Spielhalle schreiben würde. Er würde schreiben: »Was ist das für ein Gefühl, nicht mehr jung zu sein und geschieden und mit Ihrem zurückgebliebenen Neffen zusammenzuwohnen und in einem Computercafé zu arbeiten? Haben Sie sich nie mehr erhofft?«
Es dauerte sehr lange, bis er alle Buchstaben auf Pinyin eingetippt und dann die richtigen Schriftzeichen auf seinem Handy ausgewählt hatte. Er las die Nachricht immer wieder durch, bis das Taxi vor seiner Haustür anhielt. Er schickte sie ab und bezahlte den Fahrer.
Er ging in die Spielhalle. Die Frau war nicht da. Er bezahlte und setzte sich an einen PC in der Ecke, wo ihn niemand sah, und spielte Videospiele, bis die Sonne aufging. Alle ein bis zwei Minuten legte er eine Pause ein, um auf sein Handy zu schauen.
Auf dem Heimweg machte er auf dem ehemaligen Kasernenhof der Volksbefreiungsarmee halt und sah einer Gruppe von Oberschülern beim Schwerttraining zu. In ihren erbsengrünen Uniformen sehen sie sehr elegant und rechtschaffen aus, dachte er. Irgendwo in einem blühenden Baum zwitscherte ein Vogel. Wu ging durch einen Torbogen aus Beton und über die Badmintonplätze und durch das hohe, schmiedeeiserne Tor hinaus, die Straße hoch zum Markt unter der Brücke, wo er eine Schale scharfe Nudeln ohne Suppe bestellte, mit nach Hause nahm und dort am offenen Fenster aß.
An diesem Nachmittag wurde er von seinem Telefon geweckt. Er hatte eine Kurznachricht von der Frau erhalten.
»Es ist wahr, ich habe ein trauriges Leben. Ich bin sehr einsam und voller Sorgen. Wer sind Sie?«
Er konnte es nicht fassen, dass er auf seinen überfallartigen Vorstoß eine solch ehrliche, offenherzige Antwort bekommen hatte.
»Ich bin ein Bewunderer«, schrieb er zurück. »Ich finde Sie schön.«
Und dann schickte er noch eine Nachricht hinterher: »Ich bin in Sie verliebt.«
Er legte sich wieder hin und wartete darauf, dass sie antwortete. Zwanzig Minuten wartete er, dann konnte er es nicht mehr aushalten.
»Als ich geschrieben habe, ich bin in Sie verliebt, meinte ich damit: Ich bewundere Sie. Ich würde Sie gern kennenlernen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie mich attraktiv finden werden.«
Doch das war immer noch nicht gut genug.
»Ich weiß nicht, welche Art Mann Sie mögen. Welche Art mögen Sie?« Jetzt hatte er einen Riesenfehler begangen. Er hatte zu viel geschrieben. Er war überzeugt, alles kaputt gemacht zu haben. Er wusste, dass er gerade sein Leben zerstört hatte.
»Ich mag Männer, die keine Angst haben, etwas Neues auszuprobieren«, schrieb sie zurück.
Das, was ihm blieb, wollte er nicht auch noch kaputt machen. Deswegen überlegte er sich seine Antwort sehr genau. Aber sie schickte noch eine Nachricht hinterher.
»Warum treffen wir uns nicht?«, schrieb sie. »Ich will wissen, wie Sie aussehen.«
»Wann?«, schrieb er zurück. »Ich habe immer Zeit.«
»Heute Nacht«, schrieb sie. »Wir treffen uns um Mitternacht am hinteren Tor beim Markt. Ich trage eine Rose im Haar.«
Ihm blieb kurz das Herz stehen, dann fing es ganz langsam wieder an zu schlagen. Er legte sich wieder hin und streichelte sich unter der Bettdecke. Er merkte, dass er sich seit Langem nicht mehr gestreichelt hatte. Er stellte sich das Treffen vor, das Gesicht der Frau, die Rose, der gestreifte Schatten des Eisengitters, der im Mondlicht auf ihren Busen fallen würde. Er würde sie ein paar Minuten beobachten, bevor er aus dem Schatten trat. Als lange, dunkle Figur würde er auftauchen. Er würde eine Zigarette rauchen. Nein, lieber nicht, das könnte sie abstoßen. Er würde die Hände in die Taschen stecken und das Kinn senken. Er dachte an den amerikanischen Film Casablanca. Er würde aussehen wie der Held in Casablanca. Er würde ihr Gesicht leicht mit dem Handrücken berühren. Sie würde erröten und das Gesicht abwenden, aber dann würde sie wieder aufblicken und ihm direkt in die Augen sehen. Sie würden sich verlieben, und er würde sie küssen. Keinen langen Kuss auf den Mund, sondern flüchtige Küsse auf die Wangen und den Nacken und die Stirn. Wu fand lange Küsse auf den Mund widerlich. Wenn so etwas im Kino gezeigt wurde, wendete er den Blick ab. Der Gedanke hinderte ihn daran, sich weiter zu streicheln. Er las sich alle ihre Nachrichten noch einmal durch. Es war erst vierzehn Uhr. Er zog sich an und ging in die Spielhalle.
Die Frau in der Spielhalle sah mitgenommen und zerzaust aus. Sie hatte die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und trug einen fleckigen Trenchcoat über ihrem Kleid. Er versuchte, ihre ungepflegte Erscheinung zu ignorieren. Wenn sie erst mal die Seine war, konnte er sie so anziehen, wie er wollte
»Wie geht es Ihnen, Mr. Wu?«, fragte sie, ohne richtig von dem Stapel Rechnungen vor sich aufzublicken.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte er eindringlich zurück. Er legte den Arm auf den Tresen und versuchte zu lächeln. Sie drehte sich um und schrie einer ihrer Angestellten im Hinterzimmer etwas zu, dann zählte sie das Wechselgeld ab und hielt ihm die Karte hin.
»Viel Spaß«, sagte sie barsch und griff nach ihrem Handy.
Er wählte den PC direkt vor dem Tresen. Wenn er sich ein wenig neben den Bildschirm setzte, die Beine übereinanderschlug, rauchte und so tat, als würde er im Internet Artikel lesen, konnte er sie aus dem Augenwinkel beobachten. Er sah, wie sie ihre Puderdose herausholte und sich die Haare glatt strich. Sie löste ihren Pferdeschwanz und versuchte, die Haare mit den Fingern auszukämmen, wodurch sie noch struppiger aussahen. Sie band sie wieder zusammen und zog ihre Augenwinkel nach unten. Es sah aus, als würde sie sich den Schlaf aus den Augen reiben. Mr. Wu wurde ein wenig übel, und er drückte seine Zigarette aus. Er blickte auf die Uhr. Es war fünfzehn Uhr dreißig. Er schaute zu, wie sie sich das Gesicht puderte, und bemerkte, wie ungelenk sie dabei vorging, zu schnell, mit übertriebenen Bewegungen. Er fand, dass ihre Hautfarbe unnatürlich wirkte. Er fand, dass sie sehr seltsam aussah. Jetzt holte sie Rouge heraus und verteilte es auf ihren kräftigen Wangen. Das ist nicht schlecht, dachte er. Aber dann leckte sie ihre Finger an und wischte etwas von dem Rouge wieder weg. Er dachte an all die Geldscheine und Karten, die sie mit denselben Fingern schon berührt hatte. Er dachte: Würde ich diese Finger küssen? Er dachte an die Finger der Prostituierten vom Vortag und fragte sich, wo die schon überall gewesen sein mochten, wie viel Geld sie angefasst und an welch klebrigen Türknäufen sie gezogen hatten. Dann legte die Frau blauen Lidschatten und roten Lippenstift auf. Wu konnte sich nicht gegen den Gedanken wehren, dass die Frau nun aussah wie eine Prostituierte. Sie sieht sogar schlimmer als eine Prostituierte aus, dachte er. Sie sieht aus wie eine Puffmutter. Er fragte sich, ob er sie noch liebte. Er holte das Handy heraus und las all ihre Nachrichten noch einmal durch.
»Ich bin sehr einsam und voller Sorgen. Wer sind Sie?«
Sie klang verzweifelt, dachte er.
Er hatte einen furchtbaren Fehler gemacht, dachte er.
Er loggte sich aus, stand auf, ging zum Tresen und gab seine Karte zurück.
»Danke«, sagte er. Ihm war schlecht.