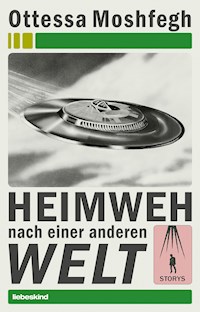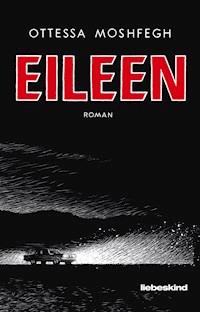11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlagsbuchhandlung Liebeskind
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
New York, am Anfang des neuen Jahrtausends. Einer jungen Frau stehen die Türen zu einer Welt aus Glanz und Glitter offen. Sie ist groß, schlank und ausgesprochen hübsch. Gerade hat sie an einer Elite-Universität ihren Abschluss gemacht und arbeitet nun in einer angesagten Kunstgalerie. Sie wohnt im teuersten Viertel der Stadt, was sie sich leisten kann, weil sie vor Jahren schon ein kleines Vermögen geerbt hat. Es könnte also nicht besser laufen in ihrem Leben ... In Wirklichkeit jedoch wünscht sie sich nichts sehnlicher, als ihrer Welt den Rücken zu kehren. Von einer dubiosen Psychiaterin lässt sie sich ein ganzes Arsenal an Beruhigungsmitteln, Antidepressiva und Schlaftabletten verschreiben. Mithilfe der Medikamente will sie "Winterschlaf halten". Aber dann merkt sie in einem ihrer wenigen wachen Momente, dass sie im Schlaf ein eigenes Leben führt. Sie findet Kreditkartenabrechnungen, die auf Shoppingtouren und Friseurbesuche hindeuten. Und scheinbar chattet sie regelmäßig mit wildfremden Männern in merkwürdigen Internetforen. Erinnern kann sie sich daran aber nicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ottessa Moshfegh
Mein Jahrder Ruhe undEntspannung
Roman
Aus dem Englischenvon Anke Caroline Burger
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel
»My Year of Rest and Relaxation« bei Penguin Press, New York.
© Ottessa Moshfegh 2018
© Verlagsbuchhandlung Liebeskind 2018
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Jacques-Louis David / National Gallery of Art
Umschlaggestaltung: Sieveking · Agentur, München
eISBN 978-3-95438-096-1
Für Luke.Den einen. Den Einzigen.
Inhalt
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Eins
WURDE ICH WACH, tagsüber oder nachts, durchquerte ich das helle Marmorfoyer unseres Hauses und ging die paar Schritte zur Bodega um die Ecke, die immer geöffnet hatte. Ich kaufte zwei große Kaffee mit Milch und jeweils sechs Stück Zucker, trank den ersten schnell im Aufzug hoch zu meiner Wohnung und den zweiten dann in aller Ruhe, während ich Filme schaute, Animal Crackers aß und Trazodon und Ambien und Nembutal schluckte, bis ich wieder einschlief. Auf diese Weise verlor ich jegliches Zeitgefühl. Tage vergingen. Wochen. Ganze Monate. Wenn ich dran dachte, bestellte ich mir etwas beim Thai gegenüber oder einen Thunfischsalat beim Diner an der First Avenue. Beim Aufwachen fand ich Nachrichten auf meiner Mailbox vor, in denen mir Termine beim Friseur oder im Spa bestätigt wurden, die ich im Schlaf gebucht hatte. Ich rief immer zurück, um die Termine abzusagen, aber nur widerwillig, weil ich eigentlich mit niemandem sprechen wollte.
Zu Beginn dieser Phase ließ ich meine schmutzige Wäsche noch einmal pro Woche abholen und sauber wieder zurückbringen. Das Rascheln der aufgerissenen Plastikfolie im Luftzug vom offenen Wohnzimmerfenster tat mir gut. Ich liebte den Geruch der frischen Wäsche beim Eindösen auf dem Sofa. Aber nach einer Weile wurde es mir zu anstrengend, die schmutzigen Sachen einzusammeln und in einen Wäschesack zu stopfen. Und die Geräusche von Waschmaschine und Trockner in meiner Wohnung störten mich beim Schlafen. Deswegen warf ich meine gebrauchten Unterhosen einfach weg. Die alten Slips erinnerten mich sowieso nur an Trevor. Eine Zeit lang kamen geschmacklose Dessous von Victoria’s Secret mit der Post– gerüschte Stringtangas in Fuchsie und Limette, Teddys und Baby-Doll-Hemdchen, jedes einzeln in durchsichtiges Plastik verpackt. Ich stopfte die ungeöffneten Plastikbeutel in den Schrank und verzichtete ganz auf Unterwäsche. Gelegentlich trafen Päckchen von Barneys oder Saks mit Herrenpyjamas oder anderen Sachen ein, an deren Bestellung ich mich nicht erinnern konnte – Kaschmirsocken, bedruckte T-Shirts, Designerjeans.
Ich duschte höchstens einmal pro Woche. Ich hörte auf, mir die Augenbrauen zu zupfen, die Oberlippenhärchen zu bleichen, die Bikinizone zu wachsen, die Haare zu bürsten. Keine Feuchtigkeitscreme, kein Peeling. Kein Rasieren. Ich verließ die Wohnung nur noch selten. Alle Rechnungen wurden automatisch von meinem Konto abgebucht. Die Grundsteuer für mein Apartment und das alte Haus meiner verstorbenen Eltern auf dem Land hatte ich für das ganze Jahr im Voraus gezahlt. Die Zahlungen der Mieter dort wurden mir jeden Monat direkt aufs Girokonto überwiesen. Solange ich noch jede Woche bei der voll automatisierten Hotline des Jobcenters anrief und »1« für »ja« drückte, wenn die Computerstimme mich fragte, ob ich ernsthafte Anstrengungen unternommen hätte, eine neue Stelle zu finden, ging auch das Arbeitslosengeld ein. Das reichte für die Zuzahlung zu meinen Medikamenten und die Einkäufe bei der Bodega. Außerdem besaß ich Aktien. Der Finanzberater meines verstorbenen Vaters kümmerte sich um meine Geldanlagen und schickte mir vierteljährliche Abrechnungen, die ich nie las. Auf dem Sparkonto hatte ich auch Geld – genug, um ein paar Jahre davon zu leben, solange ich nichts allzu Extravagantes unternahm. Obendrein hatte ich einen großzügigen Kreditrahmen auf meiner Visakarte. Um Geld machte ich mir also keine Sorgen.
Meinen »Winterschlaf« begann ich Mitte Juni 2000. Ich war sechsundzwanzig Jahre alt. Durch eine kaputte Lamelle in der Jalousie sah ich zu, wie der Sommer starb und der Herbst kalt und grau wurde. Meine Muskeln verkümmerten. Meine Bettwäsche verfärbte sich gelb, auch wenn ich meistens vor dem Fernseher auf dem weiß-blau gestreiften Sofa von Pottery Barn einschlief, das in der Mitte durchhing und voller Kaffee- und Schweißflecken war.
In meinen wachen Stunden schaute ich hauptsächlich Filme. Fernsehen hielt ich nicht aus. Besonders am Anfang regte mich das Fernsehen noch viel zu sehr auf, und ich drosch wie eine Besessene auf der Fernbedienung herum und schaltete von einem unerträglichen Programm zum nächsten. Die einzigen Nachrichten, die ich verkraftete, waren die Schlagzeilen der Gazetten in der Bodega. Wenn ich meinen Kaffee bezahlte, warf ich einen kurzen Blick darauf: Wer wird Präsident, Bush oder Gore? Jemand Wichtiges war gestorben, ein Kind entführt worden, ein Senator hatte Geld gestohlen, ein berühmter Sportler hatte seine schwangere Frau betrogen. In New York City war so einiges los – wie immer –, aber nichts davon ging mich etwas an. Das war das Schöne am Schlafen – die Realität hatte nichts mehr mit mir zu tun und spielte für mein Bewusstsein keine größere Rolle als ein Film oder ein Traum. Es fiel mir leicht, alles zu ignorieren, was mich nichts anging. Die U-Bahnfahrer streikten. Ein Hurrikan zog auf und wieder ab. Es spielte keine Rolle. Aliens hätten landen, eine Heuschreckenplage hätte einfallen können, und ich hätte es zwar bemerkt, mir aber nicht den Kopf darüber zerbrochen.
Wenn ich Medikamentennachschub brauchte, machte ich mich auf den Weg zu Rite Aid, drei Blocks weiter. Das war jedes Mal eine echte Qual. Der Gang die First Avenue hoch ließ mich erschaudern. Ich war wie ein neugeborenes Baby – die Luft tat weh, das Licht tat weh, alles wirkte grell und feindselig. Nur an diesen Exkursionstagen behalf ich mir mit Alkohol – ein Wodka, bevor ich loszog und an all den kleinen Bistros und Cafés und Läden vorbeikam, in denen ich früher oft gewesen war, als ich noch so getan hatte, als würde ich ein Leben führen. Ansonsten versuchte ich möglichst, mich nicht weiter als einen Block von meiner Wohnung zu entfernen.
In der Bodega arbeiteten lauter junge Ägypter. Abgesehen von meiner Psychiaterin Dr. Tuttle, meiner Freundin Reva und den Portiers bei mir im Haus waren die Ägypter die einzigen Menschen, mit denen ich regelmäßig zu tun hatte. Sie sahen relativ gut aus, einige mehr als andere. Kantiger Kiefer, männliche Stirn und buschige, raupenartige Augenbrauen. Bei allen hatte man den Eindruck, sie trügen Kajal. Ich schätzte, es gab ein halbes Dutzend von ihnen – Brüder oder Cousins wahrscheinlich. Ihr Kleidungsstil stieß mich ab. Sie trugen Fußballtrikots, Motorradlederjacken, Goldkettchen mit Kreuzen daran, hörten Z100 im Radio und hatten null Sinn für Humor. Anfangs, als ich neu in der Gegend war, wollten sie noch mit mir flirten, sogar ziemlich aufdringlich. Aber seit ich zu unmöglichen Uhrzeiten mit schlafverklebten Augen und verkrusteten Mundwinkeln in den Laden geschlurft kam, versuchten sie nicht mehr, meine Zuneigung zu gewinnen.
»Du hast da was«, sagte der Ägypter an der Kasse eines Morgens zu mir und deutete mit langen braunen Fingern auf sein Kinn. Ich winkte nur ab. Später entdeckte ich, dass ich im ganzen Gesicht Zahnpasta hatte.
Nachdem ich ein paar Monate lang immer ungepflegt und verschlafen bei ihnen aufgekreuzt war, fingen sie an, mich »Boss« zu nennen, und verkauften mir einzelne Zigaretten zu fünfzig Cent das Stück, wenn ich darum bat, was häufiger vorkam. Ich hätte mir meinen Kaffee natürlich auch woanders holen können, aber ich mochte die Bodega. Sie war in der Nähe, der Kaffee schmeckte immer gleich schlecht, und ich brauchte mich über niemanden zu ärgern, der ein Brioche oder einen Latte ohne Schaum bestellte. Keine Kinder mit Rotznasen oder schwedischen Au-pairs. Keine sterilen Geschäftsleute, keine verliebten Paare. Der Bodega-Kaffee war Kaffee für die Arbeiterklasse – Kaffee für Portiers, Paketboten, Putzfrauen, Handwerker und Kellner. Im Laden roch es nach billigen Reinigungsmitteln und blühendem Schimmel. Die beschlagene Kühltruhe war verlässlich mit Eis am Stiel und Eiscreme in Plastikbechern gefüllt. In den durchsichtigen Plexiglasfächern über dem Ladentisch lagen Kaugummis und Süßigkeiten. Nie veränderte sich etwas: ordentlich aufgereihte Zigaretten, rollenweise Rubbellose, zwölf verschiedene Sorten Wasser, Weißbrot, eine Auslage mit Wurst und Käse, aus der nie etwas gekauft wurde, ein Tablett mit trockenen portugiesischen Brötchen, ein Korb mit plastikverpacktem Obst, eine Wand voller Zeitschriften, die ich mied. Mehr als die Schlagzeilen der Zeitungen wollte ich nicht lesen. Ich hielt mich von allem fern, mit dem sich mein Verstand beschäftigen, das Neid, Angst oder Sorge bei mir auslösen könnte, und guckte nicht nach rechts oder links.
In regelmäßigen Abständen tauchte Reva mit einer Flasche Wein bei mir zu Hause auf und bestand darauf, mir Gesellschaft leisten zu wollen. Ihre Mutter starb gerade an Krebs. Das war einer von vielen Gründen, warum ich sie lieber nicht sehen wollte.
»Hast du etwa vergessen, dass ich vorbeikommen wollte?«, fragte Reva dann, schob sich an mir vorbei ins Wohnzimmer und schaltete das Licht an. »Das haben wir gestern Abend abgemacht, weißt du noch?«
Ich rief gern bei Reva an, wenn die Wirkung des Ambien oder Luminal gerade einsetzte. Sie berichtete, ich wolle immer nur über Harrison Ford oder Whoopi Goldberg reden, wogegen sie prinzipiell nichts habe. »Gestern Abend hast du mir die ganze Handlung von Frantic erzählt. Außerdem hast du die Szene nachgespielt, wo sie mit dem Kokain im Auto sitzen. Du hast gar nicht mehr aufgehört.«
»Emmanuelle Seigner ist einfach genial in dem Film.«
»Genau das hast du gestern Abend auch gesagt.«
Wenn Reva aufkreuzte, war ich genervt und erleichtert zugleich, so, wie man sich fühlen würde, wenn einen jemand beim Selbstmord stört. Natürlich war das, was ich da machte, kein Selbstmord. Im Gegenteil. Mein Winterschlaf diente der Selbsterhaltung. Ich glaubte, er würde mir das Leben retten.
»Ab unter die Dusche«, sagte Reva und verschwand in der Küche. »Ich bring den Müll raus.«
Ich liebte Reva, aber gern hatte ich sie nicht mehr. Wir waren seit der Uni befreundet, schon so lange, dass wir außer unserer Geschichte nichts mehr gemeinsam hatten. Uns verband ein komplexer Kreislauf aus Missgunst, Erinnerungen, Eifersucht, Ablehnung und ein paar Kleidern, die ich Reva ausgeliehen hatte und die sie mir irgendwann gereinigt zurückbringen wollte, es aber nie tat. Sie war Sekretärin bei einem großen Versicherungsmakler in Midtown, Einzelkind und Fitnessjunkie, hatte ein rotes Muttermal in der Form von Florida auf dem Hals und kaute so viel Kaugummi, dass sie sich damit den Kiefer kaputt machte und ihr Atem immer nach Zimt und grünem Apfel roch. Sie kam oft zu Besuch, räumte sich einen Sessel frei, äußerte sich abfällig über den Zustand der Wohnung, erklärte, ich hätte schon wieder abgenommen, und beschwerte sich über ihre Arbeit. Dabei füllte sie ihr Weinglas nach jedem Schluck nach.
»Diese Leute schaffen es einfach nicht, sich mal in mich hineinzuversetzen«, klagte sie. »Für die ist es selbstverständlich, dass ich immer gut drauf bin. Und dann glauben diese Arschlöcher auch noch, dass sie alle Untergebenen wie den letzten Dreck behandeln können. Und ich soll immer nur kichern und süß aussehen und ihnen die Faxe verschicken? Die können mich mal. Sollen sie doch ’ne Glatze kriegen und in der Hölle schmoren.«
Reva hatte eine Affäre mit ihrem Chef, Ken, einem nicht mehr ganz jungen Mann mit Frau und Kind. Sie redete offen darüber, wie verrückt sie nach ihm war, versuchte aber zu vertuschen, dass sie ein Verhältnis mit ihm hatte. Einmal zeigte sie mir ein Bild von ihm in einer Firmenbroschüre: groß, breite Schultern, weißes Oberhemd, blaue Krawatte und ein derart langweiliges, durchschnittliches Gesicht, dass es auch aus Plastik hätte sein können. Reva stand auf ältere Männer, genau wie ich. Männer in unserem Alter waren ihr zu peinlich, zu uncool, zu bedürftig. Ich verstand, warum sie von solchen Männern angewidert war, auch wenn mir noch nie so einer begegnet war. Alle Männer, mit denen ich bisher zusammen gewesen war, egal ob alt oder jung, waren distanziert und unfreundlich gewesen.
»Du bist kalt wie ein Fisch, deswegen«, klärte mich Reva auf. »Gleich und gleich gesellt sich gern.«
Reva war als Freundin peinlich, uncool und bedürftig und neigte obendrein zu geheimniskrämerischem und bevormundendem Verhalten. Sie konnte einfach nicht verstehen, warum ich nur schlafen wollte, oder sie weigerte sich, es zu verstehen, rieb mir ständig ihre hohen moralischen Ansprüche unter die Nase und erzählte mir, ich müsse mich den Konsequenzen meiner schlechten Angewohnheiten früher oder später »verdammt noch mal stellen«. In dem Sommer, in dem mein Dauerschlaf anfing, warf Reva mir vor, ich würde »meinen Bikini-Body verschwenden«. »Rauchen kann tödlich sein.« »Du musst mehr unter die Leute gehen.« »Nimmst du auch genug Eiweiß zu dir?« Und so weiter.
»Ich bin kein Baby, Reva.«
»Ich mache mir doch nur Sorgen um dich. Weil du mir wichtig bist. Weil ich dich lieb habe«, antwortete sie dann immer.
Seit Beginn unserer Freundschaft im dritten Studienjahr hatte Reva sich im nüchternen Zustand noch nie auch nur ansatzweise zu irgendwelchen unkoscheren Gelüsten bekannt. Aber ein Engelchen war sie auch nicht gerade. »Die hat es faustdick hinter den Ohren«, hätte meine Mutter dazu gesagt. Ich wusste seit Jahren, dass Reva an Bulimie litt. Ich wusste, dass sie sich mit einem elektrischen Nackenmassagegerät befriedigte, weil sie sich zu sehr schämte, im Sexshop einen richtigen Vibrator zu kaufen. Ich wusste, dass sie wegen des Studiums bis über beide Ohren verschuldet war und seitdem zahlreiche Kreditkarten bis zum Limit ausgereizt hatte. In der Körperpflegeabteilung des Bioladens bei ihrer Wohnung an der Upper West Side klaute sie die Tester. Ich hatte schon mehrere entsprechende Aufkleber in der riesigen Kosmetiktasche gesichtet, die sie immer mit sich herumschleppte. Sie war Sklavin von Äußerlichkeiten und Statussymbolen, was in Manhattan natürlich nichts Ungewöhnliches war. Trotzdem regte mich ihre verzweifelte Gier nach Anerkennung auf, und es fiel mir schwer, Respekt vor ihr zu haben. Sie war besessen davon, die richtigen Marken zu tragen, dazuzugehören, nicht aufzufallen. Sie fuhr regelmäßig runter nach Chinatown, um sich die neuesten gefälschten Designerhandtaschen zu besorgen. Zu Weihnachten hatte sie mir mal ein Dooney-&-Bourke-Portemonnaie geschenkt. Ein andermal kaufte sie nachgemachte Coach-Schlüsselanhänger im Partnerlook für uns beide.
Ironischerweise wirkte ihr penetrantes Verlangen nach einer stilvollen Erscheinung eher peinlich. »Antrainierte Anmut ist keine Anmut«, versuchte ich ihr einmal zu erklären. »Eleganz ist keine Frisur. Entweder hat man Stil, oder man hat ihn eben nicht. Je krampfhafter du versuchst, schick und cool zu sein, desto peinlicher wird es.« Nichts verstörte Reva mehr als selbstverständliche, mühelose Schönheit, so wie ich sie besaß. Als wir uns irgendwann mal Before Sunrise auf Video anschauten, sagte sie: »Wusstest du, dass Julie Delpy Feministin ist? Vielleicht nimmt sie deswegen nicht mal ein bisschen ab. Wenn sie Amerikanerin wäre, hätte sie die Rolle niemals gekriegt. Siehst du, wie schwabbelig ihre Arme sind? Mit Schwabbelarmen kommst du bei uns nirgendwohin. Schwabbelarme sind ein echtes K.o.-Kriterium. Schwabbelarme sind wie der SAT-Test. Unter 1400 existierst du noch nicht mal.«
»Freust du dich, dass Julie Delpy Schwabbelarme hat?«, fragte ich.
»Nein«, sagte sie, nachdem sie gründlich darüber nachgedacht hatte. »Freude würde ich es nicht nennen. Aber es befriedigt mich.«
Neid und Eifersucht versuchte Reva nicht vor mir zu verstecken. Seit wir uns angefreundet hatten, jaulte sie jedes Mal »Nicht fair!«, wenn ich ihr von etwas Gutem erzählte, das mir passiert war. Das machte sie so oft, dass es zur stehenden Redewendung zwischen uns wurde, einem Witz, den sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit ausdrucksloser Stimme zum Besten gab. Es wurde zur automatischen Reaktion auf meine gute Note, meinen neuen Lippenstift, das letzte Wassereis, meinen teuren Haarschnitt. »Nicht fair.« Ich machte ein Kreuz mit den Fingern und streckte es ihr entgegen, als wollte ich mich vor ihrer Missgunst schützen. Einmal fragte ich sie, ob ihr Neid vielleicht daher rührte, dass sie Jüdin war und glaubte, als WASP hätte ich es im Leben leichter.
»Das hat nichts damit zu tun, dass ich Jüdin bin«, antwortete sie, das weiß ich noch genau. Es war zu der Zeit, als wir unseren Uniabschluss machten. Ich war unter den Jahrgangsbesten, obwohl ich im vierten Jahr nur etwa bei der Hälfte meiner Seminarstunden anwesend war; Reva hingegen hatte den GRE komplett versiebt. »Das liegt daran, dass ich so fett bin.« Dabei war sie überhaupt nicht fett. Sie sah sogar sehr gut aus.
»Ich wünschte bloß, du würdest besser auf dich aufpassen«, sagte sie bei einem ihrer Besuche, als ich im halb wachen Zustand war. »Ich kann mich nicht ständig um dich kümmern. Was findest du bloß an Whoopi Goldberg? Sie ist noch nicht mal witzig. Du musst dir Filme angucken, die dich aufheitern. Austin Powers zum Beispiel. Oder den mit Julia Roberts und Hugh Grant. Du benimmst dich auf einmal wie Winona Ryder in Durchgeknallt. Aber aussehen tust du mehr wie Angelina Jolie. Die ist auch blond in dem Film.«
So brachte sie ihre Sorge um mein Wohlergehen zum Ausdruck. Außerdem missfiel ihr, dass ich »auf Drogen« war.
»Wenn man so viele Medikamente nimmt, sollte man nicht trinken«, sagte sie und machte den Wein leer. Ich überließ Reva die ganze Flasche. An der Uni hatte sie ihre Kneipentouren »Therapiesitzungen« genannt. Einen Whiskey Sour konnte sie sich mit einem einzigen Schluck hinter die Binde kippen, zwischen den Cocktails warf sie Advil ein. Dann vertrüge sie mehr, erklärte sie mir. Wahrscheinlich könnte man sie als Alkoholikerin bezeichnen. Aber was mich betraf, hatte sie recht: Ich war tatsächlich »auf Drogen«. Ich schluckte mindestens ein Dutzend Tabletten am Tag. Aber ich hatte das Gefühl, es verlief in geordneten Bahnen. Alles war voll korrekt. Ich wollte einfach nur schlafen, sonst nichts. Ich hatte einen Plan.
»Ich bin ja kein Junkie oder so.« Ich war eingeschnappt. »Ich mach einfach mal Pause, mehr nicht. Ein Jahr der Ruhe und Entspannung.«
»Du hast’s gut«, erwiderte Reva. »Ich würde auch gern mal freinehmen und nur abhängen, pennen und den ganzen Tag Filme gucken. So einen Luxus kann ich mir leider nicht leisten, aber ich will mich ja nicht beschweren.« Wenn sie betrunken war, wischte sie meine Klamotten und ungeöffneten Briefe vom Couchtisch, legte die Füße hoch und plapperte endlos von Ken und ihrer privaten Seifenoper: Liebe im Büro. Sie gab an mit ihren tollen Wochenendplänen, klagte, dass sie ihre letzte Diät abgebrochen habe und die Extrakalorien jetzt durch Überstunden im Fitnessstudio abarbeiten müsse. Und irgendwann fing sie dann wegen ihrer Mutter an zu weinen. »Ich kann einfach nicht mehr mit ihr reden wie früher. Ich bin so traurig. Ich fühle mich so verlassen. Ich fühle mich so schrecklich allein.«
»Wir sind alle allein, Reva«, antwortete ich. Es stimmte doch: Ich war allein, sie war allein. Das war das Höchste, was ich an Trost zu bieten hatte.
»Ich weiß, dass ich mich bei meiner Mom auf das Schlimmste gefasst machen muss. Ihre Prognose ist gar nicht gut. Dabei glaube ich noch nicht mal, dass sie mir die ganze Wahrheit über ihren Krebs sagt. Ich bin so schrecklich verzweifelt. Ich will einfach nur, dass mich jemand in den Arm nimmt. Ist das nicht schrecklich?«
»Immer willst du irgendwas«, sagte ich. »Klingt frustrierend.«
»Und dann ist da die Sache mit Ken. Ich halt’s einfach nicht aus. Lieber bring ich mich um, als ganz allein zu sein«, sagte sie.
»Immerhin hast du Optionen.«
Wenn mir danach war, bestellten wir Salat beim Thai-Imbiss und schauten Filme im Bezahlfernsehen. Mir waren meine Videos lieber, aber Reva wollte immer die Filme sehen, die »neu« und »angesagt« waren und »gut sein sollten«. Sie war stolz darauf, dass sie in puncto Popkultur voll auf dem Laufenden war. Sie kannte den neuesten Promiklatsch und folgte den aktuellsten Modetrends. Mir war das alles scheißegal. Reva hingegen las die Cosmo von vorn bis hinten und verpasste keine Folge von Sex and the City. In Sachen Schönheit und »Lebensweisheiten« war sie ganz vorn mit dabei. Ihr Neid war sehr selbstgerecht. Verglichen mit mir sei sie »unterprivilegiert«, und gemessen an ihren Standards hatte sie auch recht: Ich sah aus wie ein Model, hatte Geld, für das ich keinen Finger krumm zu machen brauchte, trug echte Designerklamotten, hatte einen Abschluss in Kunstgeschichte und war damit Teil der »Kulturelite«. Reva hingegen kam aus Long Island, war optisch eine acht von zehn – aber ihrer Meinung nach »für New Yorker Verhältnisse höchstens eine drei« – und hatte Wirtschaft studiert. »Studium für asiatische Brillenschlangen«, ihre Worte.
Revas Wohnung auf der anderen Seite des Central Park war im zweiten Stock eines Altbaus ohne Aufzug und roch nach verschwitzten Sportsachen, Pommes Frites, Desinfektionsspray und Tommy-Girl-Parfüm. Ich hatte zwar seit ihrem Einzug vor fünf Jahren einen Schlüssel, war aber bisher nur zweimal da gewesen. Sie kam lieber zu mir. Ich glaube, sie fand es toll, dass mein Portier sie erkannte und grüßte, dass sie im schicken Aufzug auf goldene Knöpfe drücken und sich ansehen konnte, wie ich mein Luxusleben vergeudete. Keine Ahnung, warum Reva das machte. Ich wurde sie einfach nicht los. Ja, sie vergötterte mich, aber gleichzeitig hasste sie mich auch. Für sie waren meine Probleme eine grausame Parodie ihres eigenen Unglücks. Ich hatte Einsamkeit und Sinnlosigkeit selbst gewählt, während Reva es trotz all ihrer Bemühungen einfach nicht geschafft hatte, das zu bekommen, was sie sich wünschte – Mann, Kind, eine tolle Karriere. Insofern vermute ich, es bereitete Reva eine gewisse Genugtuung, als ich nur noch schlafen wollte und mich ihrer Hoffnung entsprechend in einen lebensuntüchtigen Waschlappen verwandelte. Ich hatte keine Lust auf dieses Kräftemessen, aber Reva ging mir ganz prinzipiell auf den Nerv und deswegen kam es öfter zum Streit. Vielleicht ist das wie mit einer Schwester, mit jemandem, der einem so nah ist, dass er einen gnadenlos auf sämtliche Fehler hinweist. Sogar am Wochenende weigerte sie sich, bei mir zu übernachten, wenn es mal wieder spät geworden war. Ich hätte es sowieso nicht gewollt, aber sie machte immer viel Wind darum, als würden zu Hause Verpflichtungen auf sie warten, von denen ich einfach nichts verstand.
Eines Abends schoss ich ein Polaroid von ihr und klemmte es an den Spiegel im Wohnzimmer. Reva empfand das als liebevolle Geste, dabei sollte mich das Foto eigentlich daran erinnern, wie wenig ich ihre Gesellschaft genoss, falls ich später im Medikamentennebel wieder meinte, sie anrufen zu müssen.
Wenn ich irgendwelche Sorgen oder Probleme erwähnte, sagte sie: »Ich leih dir mein CD-Box-Set, wie man sein Selbstvertrauen aufbaut.«
Reva war ein großer Fan von Selbsthilfebüchern und Workshops, bei denen es meist um eine Mischung aus der neuesten Diät, beruflicher Weiterentwicklung und Beziehungsfähigkeit ging, die einem dabei helfen sollte, »sein volles Potenzial auszuschöpfen«. Alle paar Wochen kam sie mit komplett neuen Lebensweisheiten an. »Du musst ein Gespür dafür entwickeln, wenn du müde bist«, riet sie mir unter anderem. »Wir Frauen überanstrengen uns heutzutage viel zu sehr.« Einem Lifestyle-Tipp aus Ladies, macht das Beste aus eurem Tag! zufolge, sollte man schon am Sonntagabend die Outfits für die ganze Arbeitswoche vorausplanen.
»Dann gerät man morgens nicht ins Zweifeln.«
Ich konnte es nicht ausstehen, wenn sie so daherredete.
»Und nachher gehst du mit mir ins Saints. Heute ist Ladies Night. Frauen trinken bis elf umsonst. Hinterher fühlst du dich gleich viel besser.« Sie verstand sich prima darauf, irgendwelche angelesenen Ratschläge in Vorwände für das nächste Besäufnis umzuwandeln.
»Ich kann nicht ausgehen, Reva«, sagte ich.
Sie sah hinunter auf ihre Hände, spielte mit ihren Ringen, kratzte sich am Hals und starrte dann zu Boden.
»Du fehlst mir«, sagte sie mit belegter Stimme. Vielleicht meinte sie, mit diesen Worten könne sie mein Herz erweichen. Ich hatte den ganzen Tag lang Nembutal geschluckt.
»Wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir nicht mehr befreundet wären.« Ich machte mich auf dem Sofa lang. »Ich habe drüber nachgedacht und sehe keinen Grund, warum wir weitermachen sollten.«
Reva saß nur da und rieb sich die Oberschenkel. Nach ein oder zwei Minuten des Schweigens sah sie mich an und hielt sich einen Finger unter die Nase – das tat sie immer, kurz bevor sie in Tränen ausbrach. Es sah aus wie ein Hitlerbärtchen. Ich zog mir den Pullover über den Kopf, biss die Zähne zusammen und versuchte, nicht laut aufzulachen, während sie losflennte und sich wieder zu fassen versuchte.
»Ich bin deine beste Freundin«, schluchzte sie. »Du kannst mich nicht loswerden. Das wäre total selbstzerstörerisch.«
Ich zog den Pullover wieder herunter, um meine Zigarette weiterzurauchen. Sie hüstelte gekünstelt und wedelte den Rauch aus ihrem Gesicht. Dann sah sie mich direkt an – sich Mut machen, Blickkontakt mit dem Feind aufnehmen. Ich sah die Angst in ihren Augen, als starre sie in ein schwarzes Loch, in das sie fallen könnte.
»Wenigstens strenge ich mich an und versuche mich zu ändern, um das zu erreichen, was ich will«, sagte sie. »Und was willst du vom Leben, außer schlafen?«
Ich ignorierte ihren Sarkasmus.
»Ich wollte Künstlerin werden, aber ich habe kein Talent«, antwortete ich.
»Braucht man denn dazu unbedingt Talent?«
Das war vermutlich das Intelligenteste, was Reva je zu mir gesagt hat.
»Ja«, gab ich zurück.
Sie stand auf, stöckelte in ihren hochhackigen Schuhen zur Tür und zog sie leise hinter sich zu. Ich nahm ein paar Tafil, aß eine Handvoll Animal Crackers und starrte die zerknautschte Sitzfläche des leeren Sessels an. Ich stand auf, schob Tin Cup in den Videorekorder und schaute mir den Film lustlos dösend an.
Eine halbe Stunde später meldete sich Reva und sprach mir auf die Mailbox, sie habe mir bereits verziehen, dass ich ihr so wehgetan hatte, sie mache sich Sorgen um meine Gesundheit, sie habe mich »trotz allem« immer noch lieb und würde mich nie im Stich lassen. Als ich die Nachricht hörte, löste sich etwas in meinem Kiefer, als hätte ich tagelang die Zähne zusammengebissen. Vielleicht hatte ich das ja auch. Dann sah ich Reva vor mir, wie sie ihren Einkaufswagen schniefend durch den Gristedes schob und sich etwas zu essen aussuchte, das sie anschließend wieder auskotzen und ins Klo spucken würde. Ihre Treue zu mir war absurd. Das hielt uns zusammen.
»Du schaffst das«, sagte ich zu Reva, als sie mir von der dritten Runde Chemotherapie ihrer Mutter erzählte.
»Reiß dich zusammen«, meinte ich, als ich hörte, jetzt sei bei ihrer Mutter auch noch ein Hirntumor gefunden worden.
Ich weiß nicht genau, ob ein konkretes Ereignis zu meiner Entscheidung führte, Winterschlaf zu halten. Anfangs wollte ich nur ein paar Downer, um meine ewig kritischen Gedanken zu ersticken; der stetige negative Ansturm in meinem Hirn machte es mir schwer, nicht alles und jeden zu hassen. Ich dachte, das Leben wäre leichter zu ertragen, wenn mein Kopf die Welt um mich herum nicht ganz so schnell verurteilen würde. Meine Besuche bei Dr. Tuttle begannen im Januar 2000. Anfangs war alles noch ganz harmlos: Traurigkeit, Angst und der Wunsch, aus dem Gefängnis meines Körpers und Geistes auszubrechen, verfolgten mich. Dr. Tuttle bestätigte, das sei nichts Außergewöhnliches. Sie war keine gute Ärztin. Ich hatte ihren Namen aus dem Telefonbuch.
»Gutes Timing«, sagte sie bei meinem ersten Anruf. »Ich bin gerade fertig mit dem Abwasch. Woher haben Sie meine Nummer?«
»Aus den Gelben Seiten.«
Ich redete mir ein, es sei Schicksal, dass meine Wahl auf Dr. Tuttle gefallen war, von den Göttern vorherbestimmt, aber in Wirklichkeit war sie einfach nur die einzige Psychiaterin gewesen, die an einem Dienstagabend um 23.00 Uhr ans Telefon ging. Als Dr. Tuttle abhob, hatte ich bereits ein Dutzend Nachrichten auf anderen Anrufbeantwortern hinterlassen.
»Die größte Gefahr für das Gehirn heutzutage sind Mikrowellengeräte«, erklärte mir Dr. Tuttle an jenem Abend übers Telefon. »Mikrowellen, Radiowellen. Und jetzt gibt es auch noch Handymasten, die uns auf was weiß ich welchen Frequenzen bombardieren. Aber das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich beschäftige mich mit der Behandlung von Krankheiten des Geistes. Arbeiten Sie bei der Polizei?«
»Nein, ich arbeite für eine Kunsthändlerin in Chelsea.«
»Sind Sie beim FBI?«
»Nein.«
»CIA?«
»Nein, warum?«
»Ich muss diese Fragen stellen. Sind Sie von der DEA? FDA? NICB? NHCAA? Wurden Sie von einer Privatperson oder Regierungsorganisation beauftragt? Arbeiten Sie für eine Krankenversicherung? Sind Sie Drogendealerin? Drogensüchtig? Sind Sie Ärztin? Medizinstudentin? Hat ein Freund oder Arbeitgeber Sie gezwungen, Tabletten für ihn zu besorgen? NASA?«
»Ich würde sagen, ich leide unter Schlaflosigkeit. Das ist mein Hauptproblem.«
»Und wahrscheinlich sind Sie koffeinsüchtig, habe ich recht?«
»Keine Ahnung.«
»Trinken Sie weiter Ihren Kaffee. Wenn Sie jetzt aufhören, werden Sie verrückt. Echte Insomniker leiden unter Halluzinationen, Absencen und meist einem schlechten Gedächtnis. Dadurch kann das Leben sehr verwirrend werden. Trifft das auf Sie zu?«
»Manchmal fühle ich mich wie tot«, antwortete ich. »Und ich hasse alle und alles. Zählt das auch?«
»O ja, das zählt. Das zählt auf jeden Fall. Ich kann Ihnen sicherlich helfen. Ich bitte allerdings alle neuen Patienten, zu einer Vorbesprechung zu kommen, um sicherzustellen, dass wir gut zusammenpassen. Eine Viertelstunde, gratis. Ich würde Ihnen raten, sich ab jetzt alle Termine bei mir zu notieren, damit Sie sie nicht vergessen. Absagen müssen Sie mindestens vierundzwanzig Stunden vorher. Kennen Sie Post-its? Besorgen Sie sich welche. Wenn Sie kommen, müssen Sie ein paar Sachen unterschreiben, einen Vertrag. So, und jetzt notieren Sie sich Folgendes.«
Dr. Tuttle bestellte mich für den nächsten Morgen um neun Uhr zu sich.
Ihre Praxis in einem Wohnhaus an der Thirteenth Street in der Nähe des Union Square war zugleich ihre Wohnung. Das Wartezimmer befand sich in einem dunklen, holzgetäfelten Salon, der mit nachgemachten Biedermeiermöbeln, Katzenspielzeug, Schalen mit Duftmischungen, lila Kerzen, Kränzen aus lila Trockenblumen und stapelweise alten National Geographic-Heften vollgestopft war. Das Badezimmer war voller künstlicher Pflanzen und Pfauenfedern. Auf dem Waschbecken stand neben einem großen, gebrochenen Stück Fliederseife in einer Muschel eine Holzschale mit Erdnüssen. Das erstaunte mich. Ihre persönlichen Toilettenartikel hatte Dr. Tuttle in einem großen Flechtkorb im Schrank unter dem Waschtisch versteckt. Sie benutzte diverse Fußpilzpuder, eine verschreibungspflichtige Steroidsalbe und Shampoos, Seifen und Cremes, die nach Lavendel und Flieder dufteten. Fenchelzahnpasta. Das Mundwasser war vom Zahnarzt verschrieben. Ich probierte es – es schmeckte nach Meersalz.
Als ich Dr. Tuttle kennenlernte, trug sie eine Halskrause aus Schaumstoff wegen eines »Taxiunfalls«, und auf dem Arm hielt sie einen fetten Kater, den sie als »meinen Großen« vorstellte. Sie zeigte auf kleine gelbe Umschläge im Wartezimmer. »Wenn Sie kommen, schreiben Sie Ihren Namen auf einen Umschlag und legen Ihren Scheck gefaltet hinein. Das kommt dann hier rein.« Sie klopfte auf eine Holzkiste auf ihrem Schreibtisch, ein Kollektekästchen, wie man es in der Kirche für die Opferkerzen findet. Die Psychologencouch im Sprechzimmer war voller Katzenhaare; an einem Ende saß eine Vielzahl antiker Püppchen mit angeschlagenen Porzellangesichtern. Auf ihrem Schreibtisch lagen halb gegessene Müsliriegel und ineinander gestapelte Tupperwarecontainer mit Trauben und Melonenstückchen, ein riesiger alter Computer stand zwischen weiteren National Geographic-Heften.
»Was führt Sie zu mir?«, fragte sie. »Depressionen?« Sie hatte den Rezeptblock bereits gezückt.
Ich hatte mir einen wohldurchdachten Plan zurechtgelegt. Ich wollte lügen. Ich erzählte ihr, ich litte seit einem halben Jahr an Schlafstörungen, und klagte über Verzweiflung und Nervosität im Umgang mit anderen. Doch während ich mein einstudiertes Sprüchlein aufsagte, merkte ich, dass es in gewisser Weise stimmte. An Schlaflosigkeit litt ich nicht, aber unglücklich war ich tatsächlich. Ich empfand es als seltsam befreiend, Dr. Tuttle davon zu erzählen.
»Ich brauche etwas, das mich runterbringt«, sagte ich ganz offen. »Und ich wäre froh, wenn ich nicht mehr ständig das Bedürfnis hätte, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ich bin mit den Nerven am Ende. Außerdem habe ich keine Eltern mehr. Wahrscheinlich bin ich traumatisiert. Meine Mutter hat sich umgebracht.«
»Wie?«, wollte Dr. Tuttle wissen.
»Pulsadern aufgeschnitten«, log ich.
»Interessant.«
Sie hatte rote, krusselige Haare. Ihre Halskrause war voller Kaffee- und Essensflecken und schob ihr die Haut unterm Kinn zusammen. Sie hatte ein herabhängendes, faltiges Mopsgesicht, und die tief liegenden Augen waren hinter der winzigen Nickelbrille mit den dicken Gläsern kaum zu erkennen. Ich konnte Dr. Tuttle nie richtig in die Augen sehen. Ich vermute, dass sie verrückte Krähenaugen hatte, klein, schwarz und glänzend. Sie schrieb mit einem langen lila Kugelschreiber, an dessen Ende eine lila Feder prangte.
»Meine Eltern sind beide gestorben, als ich noch an der Uni war. Vor ein paar Jahren«, fuhr ich fort.
Sie musterte mich einen Augenblick lang mit einem seltsam leeren, abgehetzten Ausdruck im Gesicht. Dann wandte sie sich wieder ihrem Rezeptblock zu.
»Mit Krankenversicherungen kann ich gut umgehen«, meinte sie nur. »Ich weiß, wie man deren Spielchen spielt. Schlafen Sie denn überhaupt?«
»Kaum«, antwortete ich.
»Träume?«
»Nur Albträume.«
»Habe ich mir gedacht. Ausreichend Schlaf ist das A und O. Die meisten Menschen brauchen mindestens vierzehn Stunden am Tag. Unsere heutige Welt zwingt uns zu einem völlig unnatürlichen Lebensstil. Immer in Eile. Immer beschäftigt. Schneller, schneller, schneller. Wahrscheinlich arbeiten Sie zu viel.« Sie schrieb eine Weile auf ihrem Block herum. »Lebensfreude«, meinte Dr. Tuttle. »Ich mag das Wort lieber als Glück. Glück benutze ich nicht gern. Sehr drastisch, das Konzept. Sie müssen wissen, dass ich die Subtilitäten der menschlichen Erfahrung sehr zu schätzen weiß. Voraussetzung ist natürlich, dass man gut ausgeruht ist. Können Sie mit dem Wort Freude etwas anfangen?«
»Na klar. Wie in Edith Whartons Haus der Freude«, sagte ich.
»Trauriger Roman«, erwiderte Dr. Tuttle.
»Ich habe ihn nicht gelesen.«
»Dann lassen Sie’s auch lieber bleiben.«
»Aber Zeit der Unschuld kenne ich.«
»Sie sind also gebildet.«
»Ich habe an der Columbia University studiert.«
»Interessant. Wird Ihnen allerdings nicht viel nützen. Bildung steht in direktem Verhältnis zu Angst, das hat man Ihnen an der Columbia sicher beigebracht. Wie sieht es mit der Nahrungsaufnahme aus? Essen Sie regelmäßig? Irgendwelche Unverträglichkeiten oder Allergien? Als Sie reingekommen sind, musste ich an Farrah Fawcett und Faye Dunaway denken. Sind Sie verwandt? Sie wiegen, na, ich schätze mal, um die zehn Kilo unter Idealgewicht?«
»Wenn ich endlich wieder schlafen könnte, würde mein Appetit bestimmt auch zurückkommen«, sagte ich. Das war gelogen. Ich schlief bereits um die zwölf Stunden pro Nacht, von acht bis acht. Ich hoffte auf Tabletten, mit denen ich das gesamte Wochenende verschlafen könnte.
»Versuche an Ratten haben gezeigt, dass sich Schlaflosigkeit mit Meditation bekämpfen lässt. Ich persönlich bin kein religiöser Mensch, aber Sie könnten ja mal eine Kirche oder Synagoge besuchen und dort um Rat zu innerem Frieden bitten. Die Quäker scheinen da ganz vernünftig zu sein. Aber hüten Sie sich vor Sekten. Die wollen junge Frauen oft nur versklaven. Sind Sie sexuell aktiv?«
»Nicht wirklich«, antwortete ich.
»Wohnen Sie in der Nähe eines Atomkraftwerks? Einer Hochspannungseinrichtung?«
»Ich wohne an der Upper East Side.«
»Fahren Sie U-Bahn?«
Zu der Zeit nahm ich noch jeden Tag die U-Bahn zur Arbeit.
»Eine Menge psychischer Krankheiten werden in öffentlichen Verkehrsmitteln übertragen. Ich habe das Gefühl, dass Ihr Geist zu durchlässig ist. Haben Sie irgendein Hobby?«
»Ich schaue Filme.«
»Wie schön.«
»Wie bringt man Ratten zum Meditieren?«, fragte ich.
»Haben Sie diese Nager mal gesehen, die in Gefangenschaft gezüchtet werden? Die fressen ihre Jungen! Aber wir dürfen sie natürlich nicht dämonisieren. Sie machen es aus Mitgefühl. Zum Wohl ihrer Art. Sind Sie gegen irgendetwas allergisch?«
»Gegen Erdbeeren.«
Daraufhin ließ Dr. Tuttle den Stift sinken und starrte nachdenklich vor sich hin.
»Manche Ratten haben es wahrscheinlich verdient, dass man sie dämonisiert«, sagte sie nach einer Weile. »Bestimmte, einzelne Ratten.« Mit einer schwungvollen Bewegung der lila Feder nahm sie den Kugelschreiber wieder zur Hand. »Sobald wir alles über einen Kamm scheren, verlieren wir unser Recht auf eine freie Meinung. Ich hoffe, Sie können mir folgen. Ratten sind unserem Planeten sehr treu verbunden. Versuchen Sie’s mal mit denen hier.« Sie händigte mir eine Handvoll Rezepte aus. »Aber holen Sie die nicht alle gleichzeitig bei der Apotheke ab. Wir müssen das nach und nach machen, um keinen Verdacht zu erregen.« Steif erhob sie sich, öffnete ein Holzschränkchen und warf eine Reihe von Probepackungen auf den Schreibtisch. »Ich tu Ihnen das in eine braune Tüte, das ist diskreter«, sagte sie. »Holen Sie am Anfang nur das Lithium und das Haldol ab. In Ihrem Fall ist es besser, mit einem Hammer anzufangen. Falls wir dann später zu härteren Mitteln greifen müssen, wundert sich Ihre Versicherung wenigstens nicht.«
Ich kann Dr. Tuttle ihren schlechten medizinischen Rat nicht zum Vorwurf machen. Immerhin habe ich mich freiwillig in ihre Behandlung begeben. Sie verschrieb mir alles, was ich wollte, und das wusste ich zu schätzen. Ich bin mir sicher, dass sie nicht die einzige Quacksalberin der Welt war, aber die Leichtigkeit, mit der ich sie gefunden hatte, und die umgehende Linderung, die ihre Rezepte mir verschafften, überzeugten mich, dass ich es mit einer pharmazeutischen Schamanin zu tun hatte, einer Magierin, einer Medizinfrau. Manchmal fragte ich mich, ob Dr. Tuttle überhaupt real war. Aber wenn ich sie mir nur eingebildet hätte, wäre es witzig, dass ich mir nicht jemanden ausgesucht hatte, der meinen Heldinnen ähnelte – Whoopi Goldberg zum Beispiel.
»Wählen Sie den Notruf, falls irgendwas Unvorhergesehenes passiert«, instruierte sie mich. »Lassen Sie Vernunft walten, wenn Sie können. Es lässt sich unmöglich vorhersagen, wie die Medikamente bei Ihnen wirken werden.«
Anfangs schaute ich noch alle neuen Tabletten, die sie mir verschrieb, im Internet nach, um herauszufinden, wie lang ich damit wohl pro Tag schlafen könnte. Aber zu viel Recherche raubte ihnen den Zauber. Dann war der Schlaf auf einmal banal, nichts als eine mechanische Funktion des Körpers, wie Niesen oder Kacken oder ein Gelenk beugen. Die im Internet aufgeführten »Risiken und Nebenwirkungen« waren entmutigend, und wenn ich mir deswegen Sorgen machte, drehte das die Lautstärke meiner Gedanken voll auf – genau das Gegenteil von dem, was ich mir von den Tabletten erhoffte. Und so holte ich mir Alacetan, Maxiphen, Valdignore oder Silencior als gelegentliche Beigabe zu meinem Cocktail aus der Apotheke, schluckte aber vorwiegend Schlafmittel in hohen Dosen und ergänzte sie mit Seggies oder Nembutal, wenn ich schlecht drauf war, mit Valium oder Librium, wenn ich den Verdacht hatte, eventuell traurig zu sein, oder mit Placidyl, Chloraldurat oder Miltown, wenn ich mich einsam fühlte.
Innerhalb weniger Wochen hatte ich ein beeindruckendes Sortiment an Psychopharmaka und Beruhigungsmitteln angehäuft. Auf allen waren Piktogramme mit einem schläfrigen Auge und einem Totenschädel abgebildet. »Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker.« »Nehmen Sie das Medikament mit Nahrung oder Milch ein.« »An einem trockenen Ort aufbewahren.« »Präparat kann Benommenheit verursachen.« »Präparat kann Schwindel verursachen.« »Nicht zusammen mit Aspirin einnehmen.« »Nicht zerdrücken.« »Nicht kauen.« Jeder normale Mensch hätte sich Sorgen darum gemacht, was die Medikamente mit seiner Gesundheit anstellen würden. Völlig blauäugig stand ich den möglichen Gefahren aber auch nicht gegenüber. Mein Vater war bei lebendigem Leib vom Krebs aufgefressen worden. Ich hatte meine Mutter hirntot und voller Kanülen im Krankenhaus gesehen. Eine meiner Kindheitsfreundinnen war in der Highschool an Leberversagen gestorben, weil sie zu viel Paracetamol und Hustensaft geschluckt hatte. Natürlich war man als Mensch verletzlich und vergänglich und so weiter, aber ich setzte mein Leben gern aufs Spiel, wenn ich dafür den ganzen Tag lang schlafen und zu einem neuen Menschen werden konnte. Und ich hielt mich für schlau genug, dass ich es vorher merken würde, wenn die Tabletten mich umbrachten. Bevor es so weit kam und mein Herz aussetzte oder mein Gehirn platzte oder blutete oder mich zum Sprung aus dem Fenster im sechsten Stock veranlasste, bekäme ich Albträume voll düsterer Vorahnungen, da war ich mir sicher. Ich vertraute darauf, dass alles gut werden würde, Hauptsache, ich konnte den ganzen Tag lang schlafen.
Meine Wohnung an der East Eighty-fourth Street hatte ich 1996, ein Jahr nach dem Ende meines Studiums, bezogen. Im Sommer 2000 hatte ich immer noch mit keinem einzigen meiner Nachbarn ein Wort gewechselt – fast vier Jahre konsequentes Schweigen im Aufzug, jede Fahrt eine unangenehme Darbietung von hypnotisierter Geistesabwesenheit. Die meisten meiner Nachbarn waren kinderlose Ehepaare über vierzig. Alle hatten gute Jobs und schicke Klamotten. Eine Menge Kamelhaarmäntel und schwarze Aktentaschen. Burberry-Schals und Perlenohrringe. Hin und wieder sah ich auch alleinstehende Frauen meines Alters, die lautstark telefonierend ihre Miniaturpudel ausführten. Sie erinnerten mich an Reva, allerdings mit mehr Geld und weniger Selbsthass. Wir sprechen hier von Yorkville an der Upper East Side. Natürlich waren die Leute überspannt. Wenn ich auf dem Weg zur Bodega in Schlafanzug und Hausschuhen durch die Lobby schlurfte, hatte ich das Gefühl, ein Verbrechen zu begehen, aber das war mir egal. Die einzigen anderen schlampig gekleideten Leute in der Gegend waren die älteren Juden in den Wohnungen mit Mietpreisbindung. Aber ich war groß und dünn und blond und hübsch und jung. Ich wusste, dass ich selbst im schlimmsten Zustand immer noch gut aussah.
Das Mehrfamilienhaus hatte acht Stockwerke und weinrote Markisen, eine nichtssagende Fassade in einem Straßenzug, in dem es ansonsten nur makellos gepflegte Altbauten gab, an deren Wänden Hundebesitzer ermahnt wurden, ihre Hunde nicht an die Außentreppen pinkeln zu lassen, da das den Klinker beschädige. »Lasst uns jene achten, die uns vorausgingen, genau wie jene, die uns folgen«, stand auf einem Schild. Die Männer fuhren morgens mit dem Taxi zur Arbeit nach Downtown und die Frauen ließen sich mit Botox behandeln, die Brüste liften und die Vagina straffen, damit sie für ihre Männer und Fitnesstrainer schön eng blieben, das erzählte jedenfalls Reva. Ich hatte gehofft, an der Upper East Side wäre ich vor den Hahnenkämpfen der Kunstszene sicher, die mich bei meiner »Arbeit« in Chelsea umgaben. Aber als ich nach Uptown zog, befiel auch mich der dort grassierende Schönheitswettbewerbs-Virus. Ich versuchte mich in der Rolle der ortstypischen Blondine, die die Uferpromenade in Lycra auf und ab walkt mit Bluetooth im Ohr wie eins von diesen hochwichtigen Arschlöchern, aber mit wem sollte ich telefonieren – mit Reva?
Am Wochenende machte ich das, was von einer jungen Frau in New York erwartet wird: Ich ertrug Einläufe und Gesichtsbehandlungen, ließ mir Strähnchen machen, ging in ein überteuertes Fitnessstudio, trieb mich dort im Hamam herum, bis ich blind war, und ging abends in unbequemen Schuhen aus, die mir Füße und Rücken kaputt machten. Hin und wieder lernte ich in der Galerie interessante Männer kennen. Stoßweise überkam es mich, ich schlief mit etlichen von ihnen, ging abends viel aus, dann wieder weniger. Nichts entwickelte sich je in Richtung »Liebe«. Reva redete oft davon, sie wolle endlich »solide werden«. Für mich klang das wie ein Todesurteil.
»Lieber bleibe ich allein, als jemandem zu Hause die kostenlose Prostituierte zu machen«, verkündete ich.