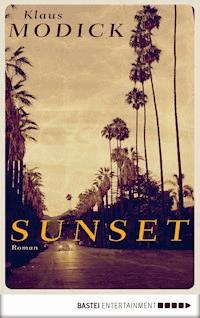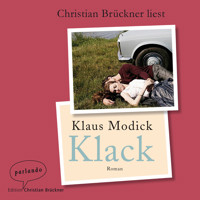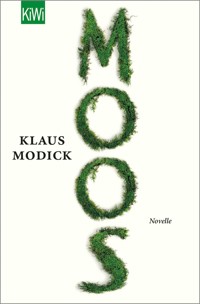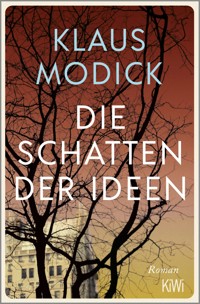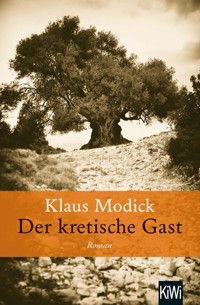18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Von der Skizze zum Buch, vom Bild zum Roman Klaus Modick gewährt mit seinem neuen Buch einen Blick auf seinen Schreibtisch, erklärt dem Leser die Entstehungszusammenhänge seiner erfolgreichsten Werke und lässt ihn teilhaben an der Inspiration, die den Schreibprozess auslöst und vorantreibt. Beinahe dreißig Jahre liegen zwischen dem Schreibtagebuch zum Roman »Das Grau der Karolinen« (1986) und der ersten Idee zu »Konzert ohne Dichter« (2015), die dem Autor beim Ausfüllen der Steuererklärung kam. Dreißig Jahre, in denen sich Klaus Modick immer auch Gedanken über das eigene Schreiben macht. Er erinnert sich an den Zauber der ersten Karl-May-Lektüre in der Kindheit, seine Anfänge als Schriftsteller, definiert seine Position als postmoderner Autor und bestimmt das Verhältnis von Erfahrung und Literatur. Dabei erweist er sich als kenntnisreicher Leser angloamerikanischer Klassiker, als kluger Kommentator der jüngeren deutschen Literaturgeschichte und als versierter Übersetzer. Und immer auch als feiner Beobachter seiner selbst. Die vorliegenden Betrachtungen bieten spannende und erhellende Einblicke in die Arbeit an und mit Literatur. Und wecken die Lust am Lesen und Wiederlesen. Der im Rahmen einer Poetikvorlesung entworfene Entstehungsbericht zu seinem großen Bestseller »Konzert ohne Dichter« eröffnet neue Zugänge zu diesem Roman und bereichert die Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Ähnliche
Klaus Modick
Ein Bild und tausend Worte
Die Entstehungsgeschichte von »Konzert ohne Dichter« und andere Essays
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Klaus Modick
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Lesefieber
Unter der holzgetäfelten Dachschräge wirkte das Kinderzimmer wie ein Beduinenzelt, in dem jeder Tag mit einer Geschichte endete. Lagen die Mädchen im Bett, wurde vorgelesen. Meine amerikanische Frau und ich wechselten uns dabei ab – heute Englisch, morgen Deutsch. Es gab lustige und traurige Geschichten, kurze und lange, ganze Romane gar, die sich über Wochen hinzogen. In diesen Stunden herrschte ein heller Zauber, der die Buchstaben in gesprochene Worte verwandelte und zwischen dem Mund des Vorlesenden und den lauschenden Ohren eine unsichtbare Brücke bildete, während das Schnurren des Katers, der eingerollt einem der Mädchen zu Füßen lag, wie ein einverständiger Kommentar klang. Manchmal, wenn die Mädchen schon eingeschlafen waren, las ich noch ein wenig weiter – vielleicht, um ihren Träumen ein paar Worte einzugeben, vielleicht aber auch, weil ich vom Vorlesen nicht lassen wollte, wenn daraus etwas aufstieg, was stummer, erwachsener Leseroutine abgeht: Klang.
Als sie dann selbst lesen konnten, lasen meine Töchter manisch bis zügellos – von den Büchern zu Fernsehserien wie »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« und »Wendy«-Heften über »Gone With The Wind« bis zu den »Buddenbrooks«, gelegentlich sogar, wenn auch stirnrunzelnd und kopfschüttelnd, Bücher, die ihr Vater geschrieben hatte. Aber die Bücher, die in meiner Kindheit beliebt waren, ließen die Mädchen kalt. Vielleicht lag es auch daran, dass die Karl-May-Lektüre eine Sache für Jungen war und erst die Sechzigerjahre-Verfilmungen mit Pierre Brice als Winnetou den Hormonhaushalt weiblicher Teenager seinerzeit in Wallung versetzen konnten.
Wäre zu Pubertätszeiten meiner Töchter Leonardo DiCaprio als Apachenschönling angetreten, hätten vermutlich auch sie sich mit solcher Inbrunst in die dunkelgrünen Schwarten versenkt wie der etwa zwölfjährige Junge, der in Hannover mit seiner Mutter zugestiegen war und mir nun im ICE-Abteil gegenübersaß. Er hatte einen »Harry-Potter«-Band aus seinem schreiend roten Plastikrucksack gezogen, mit fieberhafter Unersättlichkeit zu lesen begonnen und sich von nichts und niemandem ablenken lassen – nicht von der draußen wintertrüb vorbeiziehenden Welt, nicht vom Angebot der durch die Zuggänge scheppernden Minibar, schon gar nicht vom Schaffner, der die Fahrkarten kontrollierte. Und selbst als seine Mutter ihm einen Apfel hinhielt, blickte er kaum auf, sondern griff traumwandlerisch abwesend danach, biss hinein und verschlang, nun kauend, weiter sein Buch. Er fuhr nicht von Hannover nach Bremen oder Oldenburg oder Norddeich Mole, sondern von einem Kapitel zum nächsten. Dazwischen lag der öde Gleichtakt der Schwellen und Schienen, den die Hochspannungsleitungen aufteilten, die Leere einer Welt, die ihn am Zielbahnhof wieder in Empfang nehmen würde. Inzwischen führte er ein Leben auf Fortsetzung, indem er den Abenteuern seiner Helden sein eigenes Dasein beimischte, ohne es zu bemerken.
Damals, in meiner Kindheit in den Fünfzigerjahren, die Stadtbibliothek in der Oldenburger Gartenstraße! Die Bücherei hieß schlicht und einfach Brücke. Ich nahm an, dass damit die brückenartige Treppe gemeint war, die zum Eingang hinaufführte, diese Brücke, auf der wir in schnell fallenden Dämmerungen, an Spätnachmittagen im Herbst oder Winter, fröstelnd im Nebelstaub warten mussten, bis geöffnet wurde. Und als ich später dahinterkam, dass Brücke nur ein Kürzel für das städtische Kulturzentrum Brücke der Nationen war, blieb ich dennoch dabei: Die Brücke war diese Treppe zum Wunderreich der Bücher, die ich wie Piratenschätze nach Hause trug, um sie dort, vom Lesefieber in bunte Fantasielandschaften gebannt, gierig und nimmersatt wegzuschlürfen, wie einem wirklich Fiebernden ja auch kein Getränk den unstillbaren Durst zu löschen vermag. Die Bücher freilich, die man am dringlichsten gebraucht hätte, um das Lesefieber zu stillen, waren fast immer ausgeliehen, besonders natürlich die Werke Karl Mays.
Und das, was auf dem Index stand, der Schmutz und Schund, also Tarzan, Akim, Sigurd und wie die Helden der schmalformatigen Comicserien alle heißen mochten, war in der Brücke nicht zu haben. Es gab jedoch einen Ort, an dem solche Schätze im Überfluss vorhanden waren; diese Leseschatzinsel lag in einer Wohnung in der Westerstraße. Ein Schulkamerad hatte das sagenhafte Glück eines Vaters, der sowohl Comichefte sammelte als auch alle, aber auch wirklich alle Bände Karl Mays besaß. Unsere Lektüre gab sich dort der grellen Kolportage so hemmungslos hin wie der Junge vor mir im Zug. Als ob man sich im Buch verbrannte. Die Seiten als Scheite, entflammt durch Lesende. Gibt es womöglich einen Zusammenhang zwischen Schmökern und Schmöken, Rauchen also? Nun ja, das führt ins Nebelreich der Spekulation, die allerdings der Erinnerung verwandt ist. Die Karl-May-Bände mit den bunten Umschlagbildern und grün-schwarzen Jugendstil-Ornamenten auf den Rücken standen in einer Vitrine hinter Glasschiebetüren. Der stolze Besitzer war zu sehr Sammler, als dass er die Bücher aus dem Haus gegeben und uns ausgeliehen hätte. Vielleicht fürchtete er, seine Kostbarkeiten könnten unter unseren entzündenden Blicken in Feuer und Rauch aufgehen. Und so hockten wir also sehr artig im Schneidersitz vor dieser Schleiflackvitrine auf dem Sofa oder auf dem Fußboden und schmökerten uns mit heißen Ohren »Durchs wilde Kurdistan«, durch »Winnetou I« bis »III« und durch Tarzans und Prinz Eisenherz’ Abenteuer.
Mein Vater rauchte – das heißt also: schmökte – zu dieser Zeit Senoussi-Zigaretten, auf deren orange grundierten Packungen Araber in wildromantischen, bunt gestreiften Burnussen abgebildet waren, sodass ich ein klares Bild davon gewann, wie ich mir Hadschi Halef und die anderen Orientalen vorzustellen hatte. Illustrationen zu den Wildwestgeschichten gab es als Sammelbilder in den Wilken-Tee-Packungen, die meine Mutter kaufte. Unten, im Parterre des Schmökerhauses in der Westerstraße, befand sich ein Wäscherei- und Heißmangelbetrieb, aus dessen Räumen Dampfschwaden nach oben in unsere Leseräusche drangen. Deshalb werden die Abenteuer Kara Ben Nemsis und Old Shatterhands in meiner Erinnerung stets von einem Aroma durchtränkt bleiben, das sich aus Waschlauge und Hoffmanns Universal Stärke, Teeblättern und dem scharfen Rauch von Senoussi-Zigaretten zusammensetzt.
Und was meine Töchter betrifft: Die sind längst zu erwachsenen, passionierten Leserinnen geworden, doch zwischen den Zeilen mögen sie manchmal noch jene Stimmen hören, die ihnen vorgelesen haben. Heute Englisch. Morgen Deutsch.
Dichter wollte ich nicht werden
Eine bio-bibliografische Langnotiz
Manchmal werde ich gefragt, welches der Bücher, die ich geschrieben habe, mir selbst am besten gefalle, mir am liebsten sei. Ich weiß darauf eigentlich keine Antwort; wahrscheinlich geht es mir da wie einem Vater mehrerer Kinder, der die Frage, welcher seiner Sprösslinge ihm denn der oder die liebste sei, nicht beantworten kann, ohne den anderen Unrecht zu tun – selbst wenn bei genauem Nachdenken und retrospektiv bedacht eins der Kinder, eins der Bücher vielleicht besser als ein anderes geraten sein mag.
Besonders am Herzen liegt einem Schriftsteller jedoch immer das zuletzt erschienene, das neueste Buch, zu dem er noch wenig Distanz hat, und dann natürlich immer auch das Erstgeborene, mit dem alles anfing. In meinem Fall war das die Novelle »Moos«, mit der ich als Schriftsteller debütierte, genauer gesagt: als Verfasser von Romanen und Erzählungen, als Belletrist also. Ich hatte zuvor nämlich durchaus schon geschrieben und publiziert, aber dabei handelte es sich um literaturwissenschaftliche, essayistische und journalistische Arbeiten, die zu einer Zeit entstanden, als ich noch gar nicht wusste, vielleicht noch nicht einmal hoffte, dass ich einmal Schriftsteller werden würde.
Wohl ist es mir in der Schule leichtgefallen, lesen und schreiben zu lernen, aber werden wollte ich natürlich etwas ganz anderes. Berufswünsche und -vorstellungen, die man in der Kindheit hegt, wechseln bekanntlich schnell, und ich glaube mich zu erinnern, zu einer gewissen Zeit Polizist werden zu wollen, wahrscheinlich deshalb, weil im Umgang mit meinen Wiking-Autos der Polizeiwagen sich nicht an die Teppichstraßenverkehrsordnung zu halten hatte, die mein Bruder und ich uns ausgedacht hatten. Eine Zeit lang kam mir auch der Pilotenberuf verlockend vor.Und als ich im Heimatkundeunterricht der zweiten oder dritten Klasse vom heroischen Einsatz der DGZRS erfuhr, stand für mich fest, dass ich später zu einem ebenso vollbärtigen wie vollwertigen Mitglied der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger werden würde; diese Karriere erledigte sich aber von selbst, als ich während meiner ersten Schiffspassage von Harlesiel nach Wangerooge furchtbar seekrank wurde.
Am entschiedensten erinnere ich mich an den Wunsch, ja geradezu Entschluss, eines Tages Maurer zu werden. Als in meinem Elternhaus zu Umbau- oder Renovierungsarbeiten einmal ein Trupp Maurer zur Sache ging, war ich derart begeistert, dass ich tagelang nicht von ihrer Seite wich und meine Mutter mir das Essen im Henkelmann aufwärmen musste. Was mich an dieser Arbeit so sehr faszinierte, weiß ich heute nicht mehr, aber, wer weiß, vielleicht ähnelt das geduldige Stein-auf-Stein-Setzen in gewisser Hinsicht meiner heutigen Tätigkeit, in der ich Wort an Wort und Satz an Satz reihe, bis die Mauer einer Geschichte oder das Haus eines Romans steht.
Dichter, Schriftsteller, Autor – oder wie immer man so einen merkwürdigen Beruf auch nennen mag – wollte ich jedenfalls durchaus nicht werden. Und dennoch verfasste ich als Elf- oder Zwölfjähriger meine ersten Gedichte. Und das kam so: Im Lateinunterricht hatten wir Fabeln des Äsop zu übersetzen, und mein Lateinlehrer, der ein leicht schrulliger, aber pädagogisch begabter Mann war, gab uns als Hausaufgabe auf, die entsprechende Fabel in Reime zu fassen. Ich hatte keine Ahnung, wie man Reime findet oder macht, aber mein Vater, ansonsten ein eher sachlich-unpoetischer Charakter, half mir dabei. Diese Vater-Sohn-Koproduktion begann mit den unsterblichen Zeilen:
Äsop, der konnte prima dichten,
erzählt uns meistens Tiergeschichten,
aus denen wir, sind sie gelesen,
stets ein Stück schlauer sind gewesen.
Das Versepos fand den Beifall meines Lateinlehrers, und ich musste von nun an immer wieder Übersetzungen aus dem Lateinischen in Versen liefern, was zwar meine mangelhaften Grammatikkenntnisse nicht verbesserte, aber ganz zweifellos eine mir bis dahin unbewusste poetische Ader schwellen ließ. Ab sofort dichtete ich ohne Hilfe meines Vaters weiter und rettete mich dank dieser Verse bis zur zehnten Klasse auf eine Vier in Latein – bis sich nichts mehr recht zusammenreimen wollte und ich mit zwei Fünfen, in Mathematik und, man kann es sich denken, in Latein sitzen blieb.
Dichter wollte ich aber immer noch nicht werden, auch wenn ich einige Jahre später in der Pubertät und gar noch in der Postpubertät unerreichbaren wie erreichbaren Geliebten schmachtende oder, je nachdem, verachtende Gedichte schrieb. Auch wenn ich die Schülerzeitung unseres Gymnasiums mit mehr oder minder albernen Talentlosigkeiten belieferte. Auch wenn ich in den dialektischen Besinnungsaufsätzen des Deutschunterrichts mit Themen wie »Inwiefern werden Rosenkranz und Güldenstern in Stoppards Schauspiel schuldig?« insofern leidlich reüssierte, als die Kommentare des Deutschlehrers sich stets ähnelten: »Inhaltlich ansprechend, sprachlich gewandt«, hieß es dann in roter Tinte, manchmal mit dem mahnenden Zusatz: »Gliederung unklar bis zügellos.«
Dichter werden wollte ich immer noch nicht, sondern, wir schreiben die späten Sechzigerjahre, eher Rockstar, da mir das seinerzeit als die Erfolg versprechendste Methode vorkam, mit meiner Liebeslyrik, die ich inzwischen auch zu selbst vertonten Weisen auf der Gitarre von mir gab, bei den Mädchen offene Ohren und Einlass zu finden. Auf dem Weg zum Rockstar verfasste ich reichlich radikalexistenzielle Songs in der hoffnungsfrohen Nachfolge meines Idols Leonard Cohen, von denen einer a-mollig, schwermütig so anhub:
Wenn die Sonne versinkt
und der Mond einst ertrinkt,
und die Schatten in dir werden Stein …
Tja, was dann? »Und die Schatten in dir werden Stein?« Wird man dann nicht doch lieber Maurer?
Oder notfalls Theaterregisseur! Denn Dichter wollte ich ja nicht werden, und ein Studium für angehende Rockstars gab es noch nicht, aber das Theater interessierte mich brennend, seitdem ich mich als Siebzehnjähriger unsterblich in eine etwa fünfunddreißigjährige, vollbusige Schauspielerin des Oldenburgischen Staatstheaters verliebt hatte, die von ihrem Glück natürlich nie etwas erfuhr. Und so ließ ich dann dem Abitur zwei Semester Theaterwissenschaft an der Universität Hamburg folgen, bis die nachdrücklichen Mahnungen aus dem Elternhaus, irgendwann bitte auch »etwas Vernünftiges« zu studieren, verfingen; als »vernünftig« galt vor allem der Lehrerberuf, der in unserer Familie seit Generationen durchgereicht wurde. Da ich meine Schulzeit in nicht ganz unangenehmer Erinnerung hatte und immer noch nicht Dichter werden wollte, absolvierte ich zügig ein entsprechendes Studium, machte jedoch während eines Schulpraktikums nachdrücklich die Erfahrung, dass ich die Erfahrungen einer Lehrerexistenz lebenslang und unwiderruflich lieber nicht würde machen wollen. Um elterliche Beunruhigungen zu besänftigen, legte ich dennoch ein passables Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ab: Deutsch und Geschichte.
Inzwischen war mir klar geworden, dass meine Zukunft der Germanistik gehörte, genauer: der Neueren Deutschen Literaturwissenschaft, in welcher Disziplin ich mit der Niederschrift einer Doktorarbeit begann. Als Thema hätte ich gern das Verhältnis von Rauscherfahrungen und literarischer Produktion gewählt, vielleicht, weil dort noch einige späte Reflexe zur nicht realisierten Rockstarkarriere hätten eingearbeitet werden können. Aber mein Doktorvater, der gern Genever trank, winkte ab: Davon verstehe er rein gar nichts. Weiterhin kam das Frühwerk Hugo von Hofmannsthals in Betracht, worüber ich eine Hauptseminararbeit verfasst hatte, aber ein Blick auf die nur in Metern messbaren Mengen an Sekundärliteratur ließen mich selbst abwinken. Schließlich entschied ich mich zu einer Arbeit über Lion Feuchtwanger, der Ende der Siebzigerjahre in der westdeutschen Literaturwissenschaft ein weißer Fleck war, über den es also kaum aufzuarbeitende Sekundärliteratur gab und der mithin ein dankbares Thema mit besten, für die Karriere als Germanist überaus wichtigen Publikationschancen darstellte.
Ich begann also – aber ich kam nicht weit: Was immer ich zu Papier brachte, erschien mir leblos, langweilig, ohne jede Aussagekraft. Konnte man überhaupt Literatur, selbst so eindeutig populäre Literatur wie die Feuchtwangers, in wissenschaftliche Begrifflichkeit fassen? Mauerte man nicht das, was »das Literarische« war, in diesen Termini eher ein? Konnte man überhaupt »schön« und »richtig« voneinander trennen? Literatur war doch potenziertes Leben, Wissenschaft aber radiziertes. Wissenschaft lebte aus der Abstraktion, aus der Überwindung lebendiger Erfahrungsfülle durch Begrifflichkeit, während Literatur genau diese Erfahrungsfülle sprachlich darstellte. War Literaturwissenschaft am Ende nur die systematische Vertreibung des Literarischen aus der Literatur? Und wo blieb bei dieser Arbeit das Ich desjenigen, der sie schrieb, wo seine Lebendigkeit, seine Zweifel?
Ich löste das Problem, indem ich es dort stehen ließ, wo es herkam und hingehörte: im luftleeren Raum. Das heißt, ich löste damit das Problem gar nicht – hätte ich es gelöst, wäre aus mir vielleicht ein berühmter Hermeneutiker geworden. Ich wich dem Problem lediglich aus, indem ich einfach drauflosschrieb – allerdings keine Dissertation über Lion Feuchtwanger, sondern eine Ausbruchs- und Reisefantasie, eine mit eigenen Erlebnissen angereicherte und ziemlich hanebüchene Geschichte, die mir unter der Hand lang und länger und immer zweifelhafter wurde. Einige Jahre und etliche Umarbeitungen später sollte sie sich als brauchbare Keimzelle meines Romans »Ins Blaue« entpuppen.
Die Dissertation war damit immer noch ungeschrieben, aber die hemmungslose Fabuliererei hatte mich offenbar so gelockert, dass ich die Arbeit nun angehen konnte. In forscher Missachtung sämtlicher Methodendiskussionen und anderer Literaturverderber, die ich mir im Laufe des Studiums hatte aneignen müssen, machte ich mich ans Werk. Und siehe da: Es ging. Es ging sogar gut, das Schreiben machte mir Spaß. Auch dieses Manuskript wurde lang und länger – und mir wurde bang und bänger, dachte ich daran, dass es bald Wissenschaftlern, denen Selbstzweifel fremd waren oder die sich ihre Selbstzweifel jedenfalls nicht anmerken ließen, zur Begutachtung unter die Augen kommen würde.
Ich hatte Glück. Mein Doktorvater, sein Name sei an dieser Stelle achtungsvoll genannt, Karl-Robert Mandelkow, ein bedeutender Goethe-Forscher, war ein liberaler Mann, der wohl Wert auf Genauigkeit legte, der aber auch wusste, dass ein gut und temperamentvoll formuliertes Fehlurteil der ominösen »Wahrheit«, dem Phantom der Objektivität, oft näher ist als die staubige Korrektheit literaturwissenschaftlicher Planerfüllung. Auch der Zweitgutachter war dieser Ansicht, und fast wäre ich schon beleidigt gewesen, dass niemand meine Unverschämtheiten und methodischen Ermächtigungsfantasien monierte, als schließlich im Rigorosum, der mündlichen Disputation der Arbeit, ein Germanistikprofessor vom Schlage »Sachbearbeiter Literatur« es empört ablehnte, über meinen Text überhaupt auch nur zu diskutieren: Es handele sich nämlich, so die Argumentation dieses Mannes namens Müller, in weiten Teilen um einen essayistisch gefärbten Bekenntnistext, der keinen Anspruch auf strenge Wissenschaftlichkeit erheben könne und mithin keine Wissenschaftler als Diskursteilnehmer beanspruchen dürfe.
Ganz unrecht hatte der Mann damit nicht. Zwar handelte es sich um eine wissenschaftliche Arbeit, doch war sie von einem angehenden Schriftsteller verfasst worden, der hier, ohne recht zu wissen, was er da tat und ließ, eigene ästhetische Haltungen und Verfahren erprobte und antizipierte. Da Professor Müller mit seiner Einrede nicht durchdrang, war ich nun promovierter Literaturwissenschaftler. Wegen des notorischen Stellenmangels an den Hochschulen war aber ein entsprechender Job nirgends in Sicht.
Zu dieser Zeit war es, dass ich zum ersten Mal ernsthaft daran dachte, Autor zu werden, Publizist, Schriftsteller, Dichter gar. Denn das Schreiben der Dissertation hatte mir Spaß gemacht, wie zuvor schon das Schreiben des Textes, mit dem ich mich vor der Dissertation gedrückt hatte. Ich konnte schreiben, ich wollte schreiben. Aber zur Dichterexistenz fehlten mir zwei wesentliche Voraussetzungen: Erstens hatte ich kein Geld, zweitens hatte ich keinen publizierbaren Text.
Ich hielt mich einige Jahre als Texter in einer Werbeagentur über Wasser und versuchte nebenbei, mit dem Ernst zu machen, was ich während der Arbeit an der Dissertation als Mangel erfahren und zugleich gelernt hatte: Ich schrieb, ich erzählte, allerdings Langweiliges, denn was da zu Papier drängte, war nichts anderes als ein recht unmittelbarer Reflex auf mein Problem. Ich schrieb nämlich einen Roman über einen Literaturwissenschaftler, der zwischen Literatur und Wissenschaft aufgerieben wird, weil er der Wissenschaft misstraut und der Literatur noch nicht gewachsen ist. Die Sache war, bei genauem Hinsehen, peinlichste Betroffenheitsliteratur und zugleich hüftsteife Germanistenprosa. Immerhin und glücklicherweise war meine Fähigkeit zur Selbstkritik so weit entwickelt, dass ich die Sache entschlossen in den Papierkorb wandern ließ. Tagsüber erarbeitete ich unterdessen in der mich recht großzügig nährenden Werbeagentur sprachspielerische Preziosen wie diese: »Mach doch keinen Heckmeck, sonst schleck ich dich vom Fleck weg«, und abends und an den Wochenenden schrieb ich Essays, deren Form als Changieren zwischen Akten jäher Imagination und rationaler Durchdringung meiner Situation entsprach. Ja, kein Zweifel, ich wollte jetzt, wenn schon nicht Dichter, so doch Schriftsteller werden, und irgendwie war ich auch auf dem Weg dazu.
Im Sommer 1982 saß ich eines sonnigen Spätsommernachmittags auf einem hölzernen Bootssteg an einem Baggersee, dessen sandige Ufer zum Teil mit Moos überwachsen waren. Dies Vordringen des Mooses auf unfruchtbarem Untergrund erschien mir, ich wusste nicht wie, als ein Symbol oder Bild für mein eigenes Problem, für mein Schwanken zwischen Diskurs und Erzählung, zwischen Abstraktion und literarischer Sprache. In meinem halbschlafartigen Dösen überfiel mich da plötzlich mit sanfter Gewalt eine Idee oder Vorstellung oder Vision, wie die angefangene und verworfene Erzählung zu machen sei: Um von dir selbst zu sprechen, wusste ich plötzlich, erzähle von etwas anderem.
So begann ich noch am gleichen Abend mit einem Text, von dem ich vorerst nur wusste, dass er von Moosen handeln würde und wohl auch »Moos« heißen musste – nur dass ich von der Botanik des Mooses überhaupt keine Ahnung hatte. Ich recherchierte entsprechende Fachliteratur in Bibliotheken, und die Reibung zwischen der Trockenheit dieser Fachterminologie und der milden Vision, die mich an dem besonnten, moosigen Strand überkommen hatte, wurde zum Kraftfeld und zugleich Thema des Textes. Die Novelle »Moos« erzählt von einem alten Botaniker, dem gegen Ende seines Lebens die wissenschaftliche Terminologie und Nomenklatur fragwürdig und unbrauchbar wird, weil sie alles erklärt, aber nichts versteht. Und so kommt der Alte zum Schluss, ohne es recht zu wissen, ohne es recht zu wollen, zu einer neuen, fremden und doch vertrauten Sprache – zur Sprache der Literatur. Das Ende dieses fiktiven Alten war mein literarischer Anfang.
Der Text ist nicht sehr lang, aber ich brauchte ein Jahr, um ihn fertigzustellen. Anders als meine Dissertation, anders als meine unkontrollierten Schreibexzesse davor, machte er mir Schwierigkeiten. Denn jetzt, mit diesem Text, wollte ich wirklich Schriftsteller werden, und ich entdeckte bei der Arbeit an diesem Text erstmals so etwas wie literarische Disziplin. Und das heißt: ich entwickelte den Ehrgeiz, möglichst keinen überflüssigen Satz zu schreiben und mit jedem Wort gleich nah am gedanklichen Mittelpunkt des Ganzen zu bleiben. Das musste mir sogar halbwegs gelungen sein, denn als ich das fertige Manuskript schließlich an Verlage sandte, geschah zu meiner freudigen Überraschung recht bald das, was mit unaufgefordert eingesandten Manuskripten unbekannter Autoren angeblich nie geschieht: Es wurde von Haffmans in Zürich, einem mittleren, damals recht renommierten Verlag, angenommen und erschien im Frühjahr 1984.
Das Buch wurde ein sogenannter Kritikererfolg – das heißt, es bekam durchweg positive Rezensionen, verkaufte sich aber nur sehr mäßig. Der komplette Titel der Erstausgabe lautete übrigens: »Moos. Die nachgelassenen Blätter des Botanikers Lukas Ohlburg. Herausgegeben von Klaus Modick.« Dieser Titelzusatz war seinerzeit eine Idee des Verlegers gewesen, gegen die ich mich vergeblich wehrte. Mir kam das zu indirekt vor, vielleicht auch zu pompös. Es stimmt zwar, dass der Text mit einer Herausgeberfiktion arbeitet, aber ich kann glaubhaft versichern, dass ich mir das ganze Buch selbst ausgedacht und es auch selbst geschrieben habe, nicht nur das Vorwort des angeblichen Herausgebers. Dieser Zusatz hat zu dem kuriosen Missverständnis geführt, dass ausgerechnet mein Debüt in manchen Bibliotheken nicht unter meinem Namen katalogisiert wurde, sondern unter »Ohlburg, Lukas; Nachlassedition, herausgegeben von Klaus Modick«. Kaum war ich endlich und wirklich Dichter geworden, wurde ich prompt zum Editor eines fiktiven Botanikers degradiert.
Wichtiger als der Umgang mit derlei berufsnotorischer Autoreneitelkeit war die Frage, ob und wie ich als Schriftsteller überleben konnte, ohne zum armen Poeten zu werden – ob ich nicht nur vom Leben schreiben, sondern auch vom Schreiben würde leben können. In der Werbeagentur, der ich mit bedenkenlosem Größenwahn den Rücken kehrte, hatte ich relativ viel Geld verdient. Und da ich einen bescheiden-studentischen Lebensstil pflegte, hatte ich mir dank Ed von Schleck und Unox-Suppen nach Gutshausart ein finanzielles Polster zugelegt, mit dem ich etwa zwei Jahre ohne Einkommen auskommen konnte. Wenn es mir in diesen zwei Jahren, so mein Vorsatz, nicht gelingen sollte, mich auf dem literarischen Markt zu etablieren, würde ich zu den Unoxtöpfen der Werbung zurückkehren oder womöglich noch mein Zweites Staatsexamen absolvieren, um als Studienrat zu kärrnern und meine Eltern zu erfreuen, denen meine Existenz als Werbetexter nur windig vorgekommen war, meine Zukunft als Dichter aber unsolide, spinnert und aussichtslos erschien.
Nach einem Debüt muss das ominöse, angeblich besonders wichtige und angeblich besonders schwer gelingende, zweite Werk her. Ich begann mit Recherchen für einen umfangreichen Roman, dessen Arbeitstitel »Samoa Grau« hieß und aus dem später »Das Grau der Karolinen« wurde. Das war eine ziemlich ambitionierte Sache, von jugendlicher Bedenkenlosigkeit und Selbstbegeisterung angestiftet sogar eine bedenklich überambitionierte Sache, die mich vor lauter Recherchen, Gliederungen, Skizzen, Handlungs- und Personengerüsten immer energischer auf der Stelle treten ließ, bis die Stelle zu einer Art schwarzem Loch wurde, in dem die Ambitionen rettungslos versanken. Anders gesagt: Ich kam nicht weiter. Und obwohl mir stets Ludwig Marcuses kluger Satz eingeleuchtet hat, dass unter seinem Können bleibt, wer nicht mehr will, als er kann, überforderte mich das Projekt.
Da sich das zweite Buch jedoch nicht von selbst schreiben würde, griff ich auf jenes Manuskript zurück, das ich zu der Zeit verfasst hatte, während der ich eigentlich meine Dissertation hätte verfassen sollen. Ich arbeitete den Text um, indem ich aus der im Kern naiv-autobiografischen Reise- und Liebesgeschichte die ironische Geschichte einer Kopfreise machte, einer Fiktion in der Fiktion. Und das machte mir nicht nur Spaß, sondern erwies sich als Volltreffer. Unter dem Titel »Ins Blaue« wurde der Roman nicht nur freundlich rezensiert, sondern verkaufte sich auch überraschend gut, wurde später als Taschenbuch zu einem sogenannten Longseller, wurde auch vom ZDF zu einem so grottenschlechten Fernsehfilm verwurstet, dass ich die bei jeder Wiederholung eingehenden Filmtantiemen als Schmerzensgeld empfand. Das Buch machte sogar die Karriere, der sein Autor ausgewichen war, gelangte es doch auf die Lehrpläne einiger Gymnasien.
Erfolg, wer wollte das leugnen, macht selbstbewusst, und Selbstbewusstsein macht produktiv. Und Produktivität macht noch produktiver oder, um mit Baudelaire zu sprechen: Je mehr man schreibt, desto fruchtbarer wird man. Mit der Flut und dem Rückenwind von »Ins Blaue« wurde jedenfalls auch mein auf Grund gelaufener Roman wieder flott, segelte ein Jahr später als »Das Grau der Karolinen« im Ozean der Neuerscheinungen und wurde dort von der Kritik durchweg freundlich gesichtet, gelegentlich aber auch unfreundlich gerichtet.
Das wäre der Rede nicht weiter wert und könnte unter der Rubrik »Umstritten« abgeheftet werden, hätten die kritischen Reaktionen seinerzeit nicht eine Besonderheit gehabt, in der sich Fürsprecher und Verreißer bemerkenswert einig waren. Diese Besonderheit hieß: Postmoderne. Lobten die einen das Buch gerade wegen seiner angeblich postmodernen Qualitäten, lamentierten die anderen über den angeblich spielerischen Unernst der Postmoderne. Einig wussten sich fast alle Kritiker lediglich darin, dass »Das Grau der Karolinen« eben ein Werk der Postmoderne sei. Nur der Autor wusste mal wieder von nichts. Bis mir die einschlägigen Rezensionen unter die Augen kamen, hatte ich von Postmoderne nur ganz vage etwas gehört oder gelesen, hielt das für einen Stil- oder Epochenbegriff der Architektur und hatte nicht die leiseste Ahnung, dass es auch postmoderne Literatur geben sollte, ganz zu schweigen davon, dass ich selbst derartige Literatur produzierte.
Im Gegensatz zu so manchem Literaturkritiker, der sich wenig Mühe macht, das von ihm kritisierte Werk überhaupt zu verstehen, hatte ich immerhin den Ehrgeiz, meine Kritiker zu verstehen. Wenn ich ein Postmoderner war, dann konnte es ja nicht schaden, sich darüber zu informieren, was das überhaupt sein sollte. Ich las mich also durch einschlägige Werke; angesichts der hochgestylten, nicht selten verblasenen Theorien hielt sich der Erkenntnisgewinn allerdings in engen Grenzen. Mit mir oder mit dem, was mich zum Schreiben antrieb, hatte das wenig bis nichts zu tun. Schließlich schrieb ich, und schreibe immer noch, Bücher – und nicht das, was sie bedeuten sollen; zum Beispiel solche Bücher, die ich selbst gern lesen würde. Was mich interessierte und immer noch interessiert, sind gut erzählte Geschichten, und mit »gut erzählt« meine ich eine unprätentiöse Schreibweise, die auf stilistische Effekthascherei verzichtet und zugleich Abstand zum Trivialen hält. Und das ist eigentlich alles.
Wenn ich es recht verstand, war die Postmoderne aber etwas unendlich viel Komplizierteres, so kompliziert, dass ich es eigentlich gar nicht begriff, obwohl ich ein intellektuell durchaus belastbarer Mensch bin. Doch brachte mich die Beschäftigung mit diesen theoretischen Schaumschlägereien auf die Idee für ein neues Buch, das 1988 unter dem Titel »Weg war weg« erschien und die Gattungsbezeichnung »Romanverschnitt« trägt. Es handelt davon, wie einem ehrgeizigen Schriftsteller das Manuskript seines überaus ambitionierten, entschieden bis peinlich postmodernen Romans abhanden kommt. Während der Suche nach dem verschollenen Opus Magnum macht der Schriftsteller nun aber desillusionierende Erfahrungen mit dem wirklichen Leben, das sich als viel interessanter, spannender, komischer, absurder, anrührender erweist als die Literatur. Das Leben überholt das Werk, die Realität triumphiert über die Fiktion.
Wichtiger als das Werk, weil das Werk bedingend, ist das Leben ohnehin. Meine ersten Bücher erwiesen sich zwar nicht als Ladenhüter, aber es waren auch keine Bestseller. Da ich inzwischen verheiratet war, zwei Kinder hatte und eine vierköpfige Familie durchbringen musste, reichten die Honorare aus den Buchverkäufen zum Überleben nicht aus. Da traf es sich gut, dass dem damaligen Literaturredakteur der »Zeit« mein Roman »Ins Blaue« so gut gefallen hatte, dass er mich zur Mitarbeit an seinem Blatt einlud. Ich schrieb nun regelmäßig Rezensionen und Kritiken und bekam auch eine eigene Kolumne. Damit wurde ich zu einem Schriftsteller, der sich nebenbei als Literaturkritiker betätigte, und da »Die Zeit« recht angemessene Honorare zahlte, kam ich halbwegs über die Runden.
Mit dieser Doppelrolle war ich eine Weile sehr einverstanden und zufrieden, bis ich eines Tages bei einer Lesung aus »Weg war weg« mit den Worten vorgestellt wurde, ich sei ein Literaturkritiker, der nebenbei Romane schreibe. In der Wahrnehmung der literarischen Öffentlichkeit hatte sich das Verhältnis umgekehrt, was mein Selbstverständnis nachhaltig erschütterte. Wie es zu dieser Verkehrung kommen konnte, verstand ich sehr wohl: Als Kritiker der »Zeit« hatte ich ein größeres Publikum, als ich es als Autor meiner eigenen Werke hatte. Dichter hatte ich zwar nicht werden wollen – und war es dennoch geworden. So weit, so gut. Aber dass sich der Dichter nun zum Kritiker verpuppen sollte, erschien mir als schnöder Triumph des Sekundären. Der Mister Hyde, den ich als Kritiker spielte, war drauf und dran, den Dr. Jekyll zu vertilgen, der ich als Schriftsteller war. Nun könnte man auf die Idee kommen, dass die von mir verfassten Kritiken besser waren als meine Bücher und der Wandel meines Status in der literarischen Öffentlichkeit mir sagen wollte: Schreib lieber weiter Kritiken und lass die Finger von eigenen Sachen. Ein besonders sensibler Verleger hat mir das sogar einmal ausdrücklich empfohlen, als er ein Manuskript von mir ablehnte, das dann in einem anderen Verlag erschien – und übrigens mit viel Kritikerlob bedacht wurde.
Wer Autor ist und sich auch als Kritiker auf den Markt wagt, dem wird über kurz oder lang von den Berufskritikern das um die Ohren gehauen, was er selbst irgendwo als Kritiker geäußert hat – als ob die von einem Schriftsteller verfasste Literaturkritik automatisch dessen ästhetisches Credo sein könne oder solle. Konkret sah das dann so aus: Ich hatte einen Roman des Autors X negativ besprochen, was der den Autor X verehrende Kritiker Y übel vermerkte, um meinen nächsten Roman unter der Fragestellung zu verreißen: Kann er es besser als X? Womit ich in einem Aufwasch sowohl als Schriftsteller als auch als Kritiker blamiert werden sollte. Der Schuster bekam Prügel, weil er nicht bei seinen verordneten Leisten geblieben war.
Ich machte immer deutlicher die Erfahrung, dass regelmäßig betriebene Literaturkritik jenes undankbare Geschäft ist, das Charles Simmons in seiner Literaturbetriebssatire »Belles Lettres« auf diesen knappen Begriff gebracht hat: Kritik ist »eine Methode, alte Freundschaften zu ruinieren oder sich neue Feinde zu schaffen«. Und so ließ ich es bleiben. Fast. Zwar schrieb ich auch später noch gelegentlich Literaturkritiken, aber um meinen Feindeskreis überschaubar zu halten, kaprizierte ich mich dabei fast ausschließlich auf tote oder ausländische Kollegen – vorzugsweise auf tote ausländische.
Was mir in Folge an Rezensionshonoraren entging, machte ich dadurch wett, dass ich Übersetzungen aus dem Englischen anfertigte, was ich heute immer noch tue, zum Beispiel den eben zitierten Charles Simmons. Machart und Feinstruktur eines fremden Textes lernt man als Übersetzer besser kennen als durch bloße Lektüre, und da lässt sich so mancher Honigtropfen fürs eigene Werk saugen.
Anfang der 1990er-Jahre schrieb ich mit den beiden Romanen »Die Schrift vom Speicher« und »Das Licht in den Steinen« sowie den fünfzig Sonetten »Der Schatten den die Hand« wirft drei thematisch und sprachlich eng miteinander korrespondierende Bücher, die ich stets als eine Art Trilogie empfunden habe – leider erwies sie sich als Trilogie der Unverkäuflichkeit. Es waren handlungsarme, fast monologische, introvertierte, nicht unbedingt leicht lesbare Bücher, die mir zwar viel Kritikerlob einbrachten, die Bestenliste des SWF zierten – auf dem Markt jedoch gründlich durchfielen und mich finanziell praktisch ruinierten. »Die Schrift vom Speicher« hat bis heute etwa 2000 Stück verkauft, »Das Licht in den Steinen« 1600 und »Der Schatten den die Hand wirft« knapp 800 (was jedoch, wie ich von Lyrikern höre, für Lyrik fast schon als Bestseller gilt).
Indem ich diese erschütternden Zahlen nenne, gehe ich naiverweise davon aus, dass die Verlagsabrechnungen korrekt sind. Wirklich glauben und trauen mag diesen Abrechnungen vermutlich kein Autor. Das Gefühl, dass da doch etwas nicht stimmen könne, ist chronisch, weil man als Autor nie wirklich verifizieren kann, was einem vor- und abgerechnet wird. Dieses Misstrauen gehört zum weiten, komplizierten Feld der Beziehung zwischen Autoren und Verlegern, das zwar sehr viel zur Sache tut, das ich hier aber nur streifen kann, beispielsweise mit folgender Anekdote: In einer Halbjahresabrechnung wurden mir einmal weniger Exemplare auf der Habenseite verbucht, als ich für meinen Eigenbedarf selbst bestellt und bezahlt hatte. Der Verlag entschuldigte sich mit Hinweis auf einen »bedauerlichen Softwarefehler«. Dergleichen »Softwarefehler« finden sich übrigens bis heute immer mal wieder in den Abrechnungen – zu Ungunsten der Verlage sind sie so gut wie nie ausgefallen. In Dimensionen bereits krimineller Energie drang ein anderer Verlag vor, der mir von einem Titel mehr als 3000 verkaufte Exemplare nicht abrechnete. Als ich hinter diesen ausgewachsenen Honorarschwindel kam, wurde mir erklärt, diese 3000 Exemplare seien als Rezensionsstücke unter die Leute gebracht worden. Bei 3000 Rezensionsexemplaren müssten wohl weltweit sämtliche Kritiker beglückt worden sein! Die Sache wurde auf dem Rechtsweg geklärt. Und ich wechselte den Verlag.
Mit meiner Trilogie der Unverkäuflichkeit stand ich jedenfalls vor der Alternative, entweder den Bettel hinzuschmeißen, zurück in die Werbung zu gehen oder doch noch Studienrat zu werden, um nach Feierabend und in den Ferien weiter derartige Kunststücke zu produzieren, oder aber endlich wieder Bücher zu schreiben, die am Markt erfolgreicher wären, was mir zuvor ja schon gelungen war. Ich schrieb den Roman »Der Flügel« und hatte damit den bitter notwendigen Erfolg, der sich nicht zuletzt der Tatsache verdankte, dass der Roman in der Fernsehsendung »Das literarische Quartett« besprochen wurde. Und vermutlich wäre der Erfolg noch größer gewesen, hätte der laute alte Mann das Buch gelobt, statt es wütend zu verreißen. Über das schwierige Verhältnis von Autoren zur Kritik ist viel geschrieben und noch mehr geredet worden. Die Dominanz des Sekundären, ich sagte es bereits, ist schwer erträglich. Ein Kritiker versuchte einmal, mich mit der Bemerkung zu beschwichtigen, wir Kritiker und Autoren säßen doch alle in einem Boot. »Ja«, sagte ich, »aber die Autoren rudern.«
Ich vollzog jedenfalls die Rückkehr von der schwer lesbaren, vermutlich auch überambitionierten Preziose zu einer eher plot-orientierten, unpeinlich-unterhaltsamen Erzählliteratur, die meinem Erzähltemperament gemäß war. In einer Diskussionsrunde wurde ich einmal gefragt, ob das, was ich schreibe, mehr U oder mehr E sei, eher Unterhaltung oder eher Seriös-Ernsthaftes. Das ist eine in Deutschland ungemein beliebte, literaturfremde Kategorisierung, die meistens von Leuten vorgenommen wird, die weder von U noch von E die leiseste Ahnung haben. »Weder … noch«, antwortete ich. »Ich mache Ü!« Diese Kurskorrektur zum Ü, dem ich bis heute treu geblieben bin, sagt vielleicht auch etwas darüber aus, wie das sogenannte Familienglück nicht nur die materielle Existenz von Autoren bestimmt, sondern auch deren Schreibweisen und Stil beeinflussen kann. Jene drei Bücher waren meine Sorgenkinder. Immerhin sind sie immer noch lieferbar und verkaufen sich jährlich mit zirka zehn Exemplaren, was in der gegenwärtigen Situation auf dem Buchmarkt, den die Furie des Verschwindens durchtobt, einigermaßen verblüffend, wenn nicht gar tröstlich ist.
Wenn ich darüber rede, dass meinem Werk Rücksichtnahmen auf meine familiäre Situation eingeprägt sind wie Wasserzeichen in Geldscheine, will ich nicht davon schweigen, dass Familienleben und besonders die Erfahrungen, die ich mit Kindern gemacht habe, mir Stoffe und Inspiration geliefert haben und ein wichtiges Motiv meines Werks wurden. Die Romane »Der Mann im Mast«, »Vierundzwanzig Türen« und »September Song« speisen sich zumindest teilweise aus solchen Erfahrungen, und mit dem »Vatertagebuch«, einem Journal des Jahres 2004, habe ich schließlich den Versuch gemacht, diese Thematik ohne Fiktionalisierung anzugehen, mit offenem Visier.
Für literarische Agenten bin ich längst zu einem hochinteressanten Autor geworden, und zwar deshalb, weil ich keinen Agenten habe. Agenten wollen von den Autoren immer nur das Beste – nämlich 15 % Anteil an den Honoraren und Tantiemen. Mit dem »Kaufmann im Dichter« habe ich aber im Lauf meiner Karriere so nachdrücklich Bekanntschaft gemacht, dass ich mir auch ohne Agenten eine halbwegs gesunde Mischkalkulation zusammenbastele, die mich auf bescheidenem Niveau nährt. Zu den Buchtantiemen kommen die Übersetzungshonorare; ich schreibe gelegentlich Artikel in Zeitungen und Zeitschriften und Beiträge für den Rundfunk; dank meines akademischen Hintergrunds werden mir manchmal Gastdozenturen angetragen. Hilfreich sind und waren auch Stipendien und Preisgelder, in deren Genuss ich gekommen bin. Eine nicht zu unterschätzende Einnahmequelle bilden schließlich die Lesungen; es gab Zeiten, zu denen ich durch Lesungshonorare höhere Einnahmen erzielt habe als durch Buchverkäufe. Der Rede wert sind Lesungen aber nicht nur des Geldes wegen, als viel mehr deshalb, weil sie deutlicher Ausdruck der Tatsache sind, dass man als Autor nicht nur sein Werk zu Markte trägt, sondern seine Person mit in Kauf gibt.
Ohne die Geduld und Unterstützung meiner Frau wäre das alles unmöglich gewesen. In seinem autobiografischen Buch »On Writing« hat Stephen King angemerkt: »Immer, wenn ich einen Debütroman sehe, der einer Ehefrau oder einem Ehemann gewidmet ist, muss ich lächeln und denke: Da weiß also jemand Bescheid. Schreiben ist ein einsames Geschäft. Wenn man dabei aber jemanden zur Seite hat, der an einen glaubt, erleichtert das die Sache entscheidend. Diese Person muss gar keine großen Reden schwingen. Vertrauen reicht normalerweise schon.« In meinem Falle heißt diese Person Jamie, der mein Debüt »Moos« gewidmet ist.
Als wir uns 1980 auf Kreta kennenlernten, ist sie einmal an dem Cafétisch vorbeigekommen, an dem ich gerade saß und etwas notierte. Sie ist stehen geblieben und hat gesagt: »Hi, what are you doing there?« Und ich hab sie angesehen und ebenso wahrheitsgemäß wie bescheuert geantwortet: »I’m writing a poem.« Später hat sie mir gestanden, dass sie in dem Moment gedacht hat, ich müsse ein weltfremder Spinner sein, harmlos zwar, aber nicht ganz dicht. Dichter sollte ich ja auch erst noch werden.
Das graue Tagebuch
Zur Entstehung der Romane »Ins Blaue« und »Das Grau der Karolinen«
Ich kenne keine Künstler.
Ich kenne nur Leute, die hart arbeiten.
Jacques Brel
Als Kind habe ich eine gewisse Lust am Lügen empfunden. Ist dem die Lust verwandt, etwas zu erzählen?
Im Gespräch mit M. J. F. und M. H. über Wirkungsgeschichte und Rezeptionsästhetik ging mir auf, wie unbefriedigend diese Methoden bleiben müssen. Nicht nur, dass sie den Forscher oder Historiker von eigener Interpretationsarbeit suspendieren, indem sie ihn zum bloßen Sichten, Sammeln und Sortieren dessen einladen, was zuvor über die betreffenden Werke geschrieben wurde (also Wirkungsgeschichte als Krisenmanagment einer orientierungslosen Literaturwissenschaft, natürlich auch der Anything-goes-Kunstgeschichte); sondern es kommt mir auch so vor, als nähre dieses rein akkumulative Verfahren die Fiktion, ein Kunstwerk historisch-wissenschaftlich entschlüsseln, ihm sein »Geheimnis« entreißen zu können – nun aber nicht mehr per abgewirtschafteter Einfühlung à la Staiger, nicht einmal mehr ideologiekritisch, psychoanalytisch oder dergleichen, sondern im Auftürmen der Wirkungen, die die Werke in der Geschichte auslösten. Dahinter verbirgt sich die These, die Wahrheit eines Werkes sei die Summe seiner Wirkungen in der historischen Zeit.
Nun hat diese These durchaus manches für sich, versteht man sie wie Benjamin: »Das Schöne ist seinem geschichtlichen Dasein nach ein Appell, zu denen sich zu versammeln, die es früher bewundert haben. Das Ergriffenwerden vom Schönen ist ein ad plures ire, wie die Römer das Sterben nannten. Der Schein im Schönen besteht für diese Bestimmung darin, dass der identische Gegenstand, um den die Bewunderung wirbt, in dem Werke nicht zu finden ist. Sie erntet ein, was frühere Geschlechter in ihm bewundert haben. Es ist ein Goethewort, das hier der Weisheit letzten Schluss lautbar macht: ›Alles, was eine große Wirkung getan hat, kann eigentlich gar nicht mehr beurteilt werden.‹«