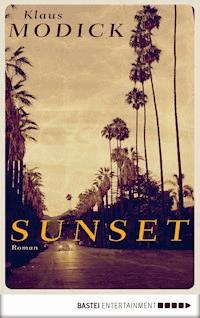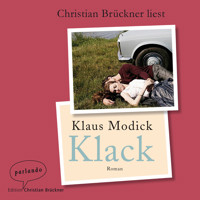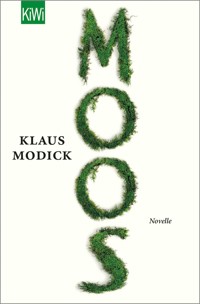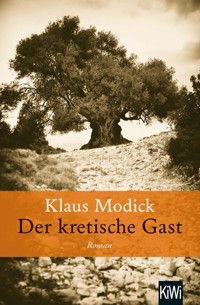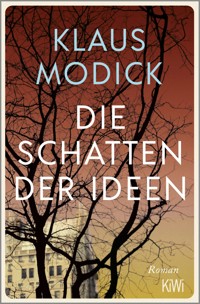
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
1935: Der deutsche Historiker Julius Steinberg flüchtet wegen seiner jüdischen Herkunft aus Nazideutschland in die USA. Nach einer dramatischen Odyssee durchs Elend des Exils findet er sein privates und berufliches Glück als Professor am Vermonter Centerville College. Doch als er unverschuldet in die Mühlen von McCarthys Hexenjagd auf Kommunisten gerät, wird Steinbergs amerikanischer Traum zum Albtraum. Ein halbes Jahrhundert später, im Jahr des Irak-Kriegs, kommt der Schriftsteller Moritz Carlsen als Writer in Residence ans Centerville College, um dort ein halbes Jahr lang zu unterrichten. Die Arbeitsbedingungen sind gut, das Salär angemessen, und der allgegenwärtige Patriotismus, mit dem die Amerikaner ihre Truppen im Irak unterstützen, scheint in Centerville nur eine lästige Pflichtübung zu sein. Doch dann stößt Carlsen durch Zufall auf Briefe und nachgelassene Aufzeichnungen Julius Steinbergs – geschrieben im Gefängnis. Anfangs nur neugierig, recherchiert Carlsen den abenteuerlichen Lebensweg des vor 50 Jahren emigrierten Historikers und kommt einem dunklen Geheimnis auf die Spur. In der von Misstrauen und Hysterie geprägten Gegenwart macht er die bittere Erfahrung, dass die Geschichte sich wiederholt. Denn Carlsen bringt verstörende Ereignisse ans Licht, an die sich in Centerville niemand erinnern will...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 667
Ähnliche
Klaus Modick
Die Schatten der Ideen
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Klaus Modick
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Klaus Modick
Klaus Modick, geboren 1951, studierte in Hamburg Germanistik, Geschichte und Pädagogik, promovierte mit einer Arbeit über Lion Feuchtwanger. Seit 1984 ist er freier Schriftsteller und Übersetzer und lebt nach diversen Auslandsaufenthalten und Dozenturen wieder in seiner Geburtsstadt Oldenburg. Für sein umfangreiches Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zu seinen erfolgreichsten Romanen zählen »Der kretische Gast« (2003), »Sunset« (2011), »Konzert ohne Dichter« (2015) und »Keyserlings Geheimnis« (2018). Zuletzt erschien »Leonard Cohen« (2020) und der Roman »Fahrtwind« (2021) sowie (mit Bernd Eilert) »Nachlese. Hundert Bücher – Ein Jahrhundert« (2024).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Der Historiker Julius Steinberg flüchtet 1935 wegen seiner jüdischen Herkunft aus Nazideutschland in die USA. Nach einer dramatischen Odyssee durch das Elend des Exils findet er sein Glück als Professor am Vermonter Centerville College. Doch als er unverschuldet in die Mühlen von McCarthys Kommunistenjagd gerät, wird sein amerikanischer Traum zum Albtraum.
Ein halbes Jahrhundert später kommt der Schriftsteller Moritz Carlsen ans Centerville College, um dort zu unterrichten. Zufällig stößt er auf Briefe Steinbergs – geschrieben im Gefängnis. Carlsen recherchiert den abenteuerlichen Lebensweg des Historikers. Je mehr verstörende Ereignisse aus Steinbergs Vergangenheit er ans Licht bringt, desto öfter begegnen ihm Misstrauen, Neid und Hass. Und bald wird ihm klar, dass sich Geschichte stets wiederholt …
»Ein überaus dichtes, ebenso informierendes wie inspirierendes und vor allem sehr packendes Werk« ORF
Inhaltsverzeichnis
Motto
1 Anflug
2 Ein Netz und ein Summen
3 Unter Verwandten
4 Ein Sturz
5 Fundsachen
6 Julius Steinbergs Aufzeichnungen
7 Spezielle Fälle
8 Julius Steinbergs Aufzeichnungen
9 Lost in translation
10 Julius Steinbergs Aufzeichnungen
11 Im Schnellkochtopf
12 Julius Steinbergs Aufzeichnungen
13 Fehlbestände
14 Julius Steinbergs Aufzeichnungen
15 Gerührt und geschüttelt
16 Julius Steinbergs Aufzeichnungen
17 Echo und Fluss
18 Julius Steinbergs Aufzeichnungen
19 Wildgänse
20 Julius Steinbergs Aufzeichnungen
21 Zuckmayers Schatten
22 Julius Steinbergs Aufzeichnungen
23 Dead or alive
24 Julius Steinbergs Aufzeichnungen
25 Die Brücke
26 Hanky Panky
27 Ideentreibstoff
28 Schönheit und Treue
29 Moonlight in Vermont
30 Der Schatten eines Blatts
31 Schnittstellen
32 Vielleicht ein Roman
33 Mitten im Nirgendwo
Quellen und Dank
Es ist ein Fehler des Denkens, zu glauben,
das Gegenwärtige nur sei die ganze Welt.
Giordano Bruno
Amerika – Vermont – unser blutiges Leben –
[…] und die süße Gewalt unserer Träume.
Carl Zuckmayer
1Anflug
Ein Zittern durchlief die Maschine, als die beiden Motoren angelassen wurden. Für einen Augenblick ruckten die Propeller, als wollten sie störrisch den Dienst verweigern, begannen sich dann langsam zu drehen und durchschlugen die Luft mit einem flappenden Geräusch, das zu einem gleichmäßigen Dröhnen anschwoll, während die Cessna 208 aus ihrer Parkposition der Startbahn entgegenrollte. Im gelben Licht der Flughafenbeleuchtung verloren die starren Metallfinger der Propellerblätter ihre Form und verwandelten sich in sirrende, ums unsichtbare Zentrum ihrer Naben rotierende Ringe. Nach einem letzten wie nachdenklichen Stopp startete das Flugzeug durch, nahm Fahrt auf, hob sanft von der Landebahn ab, schlingerte im Steigflug durch verspätete Böen des abgezogenen Gewitters und zog einen weiten Bogen in Richtung Norden, wo das Dunkel schon tiefer war, während weit im Westen noch Lichtreste am Himmel verdämmerten.
New York, Newark, Jersey City und die wuchernden Vororte New Jerseys warfen das Muster ihrer unregelmäßig flimmernden Lichter millionenfach in die Nacht. Anfangs waren noch einzelne Gebäude zu erkennen, von Flutlicht erfülltes Grün eines Baseballstadions, unablässiges gelb und rot glitzerndes Ziehen und Fließen auf den Straßen. Doch schnell verschmolzen die einzelnen Punkte zu fremdartigen geometrischen Formen, die von innen zu leuchten schienen wie die Armaturen im Cockpit, das von der engen Passagierkabine nicht abgetrennt war. Das Blinken der Skalen und Tasten, über die manchmal schattenhaft die Hand des Piloten wischte, gehorchte vielleicht dem gleichen Rhythmus, in dem das Geflimmer von unten aufstieg, folgte der gleichen Struktur, die an Schaltkreise auf Mikrochips erinnerte, betrachtet man sie unter einem Mikroskop. Als die Maschine ihre Reiseflughöhe erreicht hatte, verblassten diese Vorstellungen, denn jetzt glich der Lichtteppich den magischen Ornamenten auf jenen Decken, die Indianer in Arizona oder New Mexico weben. Je schwächer das Leuchten von unten schien, desto deutlicher wurden große Sternmengen, und plötzlich stand auch eine wie aus Silber geschnittene Mondsichel am aufklarenden Nachthimmel.
Wegen der aus Kanada nach Süden durchziehenden schweren Gewitterfront war sein Anschlussflug von Newark nach Lebanon, New Hampshire, von 16 auf 21 Uhr verschoben worden, sodass er nun schon seit über zweiundzwanzig Stunden unterwegs war. Außer ihm befanden sich nur noch drei andere Passagiere in der zehnsitzigen Maschine, eine Frau seines Alters, die gelangweilt in einem Modemagazin blätterte, und zwei junge Männer, die sich über den Mittelgang hinweg lautstark unterhielten, um den Fluglärm zu übertönen. Es musste sich um Studenten handeln, drehte sich ihr Gespräch doch um Studiengebühren und Anmeldefristen, Studentenwohnheime und die Qualität des Mensaessens am Centerville College. Die beiden hatten also dasselbe Ziel wie er. Vielleicht würden sie ihm nächste Woche sogar in seinen Seminaren gegenübersitzen. Am Centerville College in Vermont.
Der Anruf war vor einem halben Jahr gekommen, gegen Mitternacht, als er sich vorm Zubettgehen die Zähne putzte. Wer rief denn zu einer derart unmöglichen Zeit an?
»Schöffe hier. Spreche ich mit Moritz Carlsen?«
»Ja, aber wer …«
»Johannes Schöffe hier. Wir kennen uns aus dem Studium. Hamburg, Siebzigerjahre. Erinnern Sie, erinnerst du dich etwa nicht mehr? Das Benjamin-Seminar bei Mandelkow? Heinrich Mann bei Old Man Schneider? Strukturalismus bei Martens? Wir haben sogar mal gemeinsam ein Referat gehalten. Über Hofmannsthal bei …«
»Oh, ja klar, jetzt fällt’s mir wieder … Hocki! Bist du das etwa, Hocki?«
»Genau.« Er lachte. »Nur dass mich hier, wo ich jetzt bin, niemand mehr so nennt.«
Er sah ihn vor sich: eins neunzig groß, breitschultrig, blondes volles Haar, strahlend blauäugig, fast das Klischee des Athleten, der er tatsächlich war, spielte er doch in einem ziemlich noblen Hamburger Club sehr erfolgreich Feldhockey, was seinerzeit noch exzentrischer als Tennis und böse bourgeoisieverdächtig war. Weniger exzentrisch oder nobel war allerdings sein Vorname. Johannes hießen viele, weshalb er zwecks genauerer Distinktion unter den Studenten erst Hockey-Hannes genannt wurde, woraus sich bald die Kurzform Hockey entwickelte und schließlich zu Hocki verschliff. Er stammte aus einer Husumer Pastorenfamilie, und in seiner Aussprache klangen manchmal noch Reste nordfriesischen Platts durch. Kennengelernt hatten sie sich Anfang der Siebzigerjahre in einem literaturwissenschaftlichen Seminar über Walter Benjamin, das mit hundertzwanzig Teilnehmern so überlaufen war, dass es in einem Hörsaal stattfinden musste. Hocki saß eine Reihe vor Carlsen und fiel angenehm auf, weil er sich über die theologische Ahnungslosigkeit lustig machte, mit der einige revolutionär gesinnte Kommilitonen Benjamin zum Theologen der Revolution ernennen wollten. Als Pfarrerssohn musste Hocki es besser wissen.
Sie freundeten sich an, wenn auch nicht besonders eng, was unter anderem daran lag, dass Hocki wegen seines ewigen Hockeytrainings ständig in Zeitnot war. Aber sie belegten häufig dieselben Seminare und Vorlesungen und schrieben schließlich auch gemeinsam ein Referat über Hofmannsthal, über den Hocki sogar promovieren wollte, obwohl dieser Autor gar nicht zu ihm zu passen schien. Hockis Art, mit Literatur umzugehen, war nie sonderlich subtil, sondern hatte etwas derb Zupackendes, womit er allzu verblasene Theorien und Interpretationen schnell auf ihren hohlen Kern zurückführte. Mit Ideologiekritik oder gar Proletkult hatte das allerdings nichts zu tun, sondern Hocki analysierte Literatur einfach mit dem, was man gesunden Menschenverstand nennt. Literatur, sagte er einmal, müsse man besprechen, wie man früher Krankheiten besprochen habe. Deshalb kam im Hofmannsthal-Referat auch die Bemerkung vor, dass es dem sprachskeptischen und weltmüden Lord Chandos, den angesichts einer herumstehenden Gießkanne »die Gegenwart des Unendlichen umschauert«, vermutlich ganz gutgetan hätte, sich einmal mit seinem Gärtner zu unterhalten.
Carlsen vermutete auch, dass Hocki heimlich selber schrieb und literarische Ambitionen hegte. Als sie einmal Vorlesungsmitschriften austauschten, fand Carlsen zwischen den Papieren in Hockis Handschrift ein sehr trauriges, elegisches Gedicht, das von einer verlorenen oder unerfüllten Liebe handelte. Es war konventionell geschrieben, sogar gereimt, und hatte etwas Liedhaftes. An den Titel konnte Carlsen sich nicht mehr erinnern, vielleicht gab es auch keinen. Als er ihm ein paar Tage später die Aufzeichnungen zurückgab, fragte er, ob Hocki das Gedicht geschrieben habe. Er lief knallrot an, schüttelte heftig den Kopf und sagte nur: »Ach Quatsch.«
Kurz darauf verschwand er sang- und klanglos von der Bildfläche, und niemand wusste, warum und wohin. Hocki war einfach weg. Mitten im Semester. Gerüchte kursierten, er sei in einen Versicherungsbetrug verstrickt gewesen und habe auf einem Containerschiff angeheuert. Ein anderes Gerücht wollte von einer Liebesaffäre mit einer Inderin wissen, die er bei einem Hockeyländerspiel kennengelernt habe und der er Hals über Kopf auf ihren Subkontinent nachgereist sei. Carlsen glaubte beides nicht, machte sich aber auch weiter keine Gedanken über Hockis Verschwinden und verlor ihn bald aus der Erinnerung. Und dreißig Jahre später rief er also plötzlich zu nachtschlafender Zeit an und sagte, dass man ihn da, wo er jetzt sei, nicht mehr Hocki nenne.
Jetzt war er nämlich in Amerika. Am Centerville College im US-Bundesstaat Vermont. Und er war dort Professor für Germanistik, seit einem Jahr auch Direktor des Instituts für German Studies and Language. Wie er das geworden sei, sagte er auf Carlsens Zwischenfrage, sei eine lange Geschichte, die er gelegentlich gern erzählen wolle, zum Beispiel dann, wenn Carlsen ans College käme. Und damit falle er auch gleich mit dem Haus in die Tür. Wie Carlsen bald merken sollte, unterliefen Hocki manchmal solche Ausdruckskapriolen, und dreißig Jahre Amerika hatten das zwischen Zunge und Gaumen rollende plattdeutsche R tief in Hockis Rachen rutschen lassen.
»Ich habe«, sagte er, »am College Geld beschafft für die Position eines Writer in Residence. Die soll ab jetzt alle zwei Jahre von einem deutschsprachigen Schriftsteller besetzt werden. Für zwei Semester. Und natürlich hab ich sofort an dich gedacht. Du hast ja Karriere gemacht als Schriftsteller. Das hab ich von hier mit großem Respekt verfolgt. Ich hab auch zwei deiner Romane gelesen. Gefallen mir gut. Und du arbeitest auch als Übersetzer. Das ist die perfekte Kombination für unseren Writer in Residence. Und dann natürlich unsere alte Verbundenheit aus Hamburger Tagen.« Der Arbeitsaufwand werde sich in Grenzen halten – ein Seminar Kreatives Schreiben, zu unterrichten in deutscher Sprache, sowie ein Workshop Literarisches Übersetzen. Das in Aussicht gestellte Honorar war anständig.
Carlsen erbat sich einen Tag Bedenkzeit.
»Großartig«, meinte Hocki. »Hier wird’s dir gefallen. Centerville liegt zwar mitten im Nirgendwo, aber das Nirgendwo ist schön. Ich ruf dich morgen wieder an.«
Vermont? Vermont sagte ihm etwas. Hatte Carl Zuckmayer da nicht damals sein Exil ausgesessen? Auf einer Farm in den Bergen? Nordosten der USA. Neuengland. Aber Centerville? Nie gehört. Carlsen schlug im Atlas nach. Der Ort fand sich schließlich, sehr klein gedruckt, etwa dreißig Kilometer westlich der Grenze zu New Hampshire und knapp hundert Kilometer südlich der kanadischen Grenze. Die nächsten, wenn auch nicht gerade nahen Großstädte waren Montreal und Boston. Um Details auszumachen, startete er mit Google Earth auf die virtuelle Umlaufbahn. Zwar lokalisierte das Programm den Ort, aber ab einer Höhe von etwa dreißigtausend Fuß verlor das Bild beim Heranzoomen seine Schärfe. Auszumachen war nur eine von Straßen durchzogene Häuseransammlung, die an den Rändern in bewaldete Gebiete ausfaserte. Hier war offensichtlich so abgrundtief Provinz, dass Google Earth sie nur beiläufig überflog. Oder eben, in Hockis gepflegtem Denglisch, die Mitte des Nirgendwo.
Im Kalender überprüfte er, ob seinem Aufenthalt irgendwelche anderen Termine im Weg standen, aber die Verabredungen und Verpflichtungen, die er für den fraglichen Zeitraum eingegangen war, ließen sich absagen oder verschieben. Zwei Semester Centerville also? Warum eigentlich nicht? Tapetenwechsel war stets willkommen, würde vielleicht sogar die üble Schreibblockade lösen, die ihn seit Monaten lähmte. Und da er seit seiner Scheidung finanziell chronisch klamm war, kam ihm das in Aussicht gestellte Honorar mehr als gelegen.
Vierzehn Tage später kam per Post ein Umschlag, der so dick war, dass er nicht durch den Briefkastenschlitz passte. Er enthielt Informationen über das College, einen Arbeitsvertrag, unterzeichnet vom Chair of Department Johannes Schöffe, der sich jetzt aber umlautlos amerikanisiert John H. Shoffe schrieb – ob das H. wohl für Hocki stand? –, sowie einen verwirrenden Wust von Formularen, die zur Erteilung eines J-1-Visums für akademische Austauschkräfte auszufüllen waren. Lehraufträge in den USA hatte Carlsen schon zweimal wahrgenommen, zuletzt 1999, vor vier Jahren also, konnte sich aber nicht entsinnen, damals mit einem derart massiven Formularpaket bombardiert worden zu sein. Früher reichte ein Doppelblatt mit Angaben zur Person samt Passfoto, Reisepass und frankiertem Rückumschlag. Das sandte man dann auf dem Postweg ans nächste US-Konsulat und bekam ein paar Tage später seinen Pass mit dem Visum zurückgeschickt. Inzwischen hatte sich das Doppelblatt zu einem Formulardutzend in diversen Farben vervielfacht, in das akribisch sämtliche USA-Aufenthalte, die man je absolviert hatte, einzutragen waren. Das Fotoformat inklusive der Gesichtshaltung des Porträtierten waren millimetergenau vorgeschrieben. Drei Referenzpersonen mit vollständigen Adressen wurden verlangt, Erklärungen zu Vermögensverhältnissen, Steuerpflicht, Familienstatus, Kindern und so weiter und so fort.
Mit dem komplett ausgefüllten Bürokratiekrempel sollte man sich persönlich in der Passstelle der Berliner US-Botschaft einfinden, und um sich dort einfinden zu dürfen, musste man sich über eine kostenpflichtige Telefonnummer einen Termin zuweisen lassen. Die Leitung war ständig besetzt, und als Carlsen nach dem zwanzigsten Wählversuch endlich eine Verbindung bekam, war diese so schlecht, als säße die Sachbearbeiterin mit einem Handy auf dem Mond. Durchs Fiepen und Rauschen leierte sie ihm noch einmal alles vor, was er bereits aus dem Kleingedruckten der Formulare wusste, nahm umständlich seine Personalien auf und nannte schließlich einen Termin: in zwei Wochen um 8 Uhr früh. Die Telefonrechnung klärte ihn später darüber auf, dass dieses Gespräch mit sechzig Euro zu Buche schlug.
Als er dann pünktlich und verschlafen in der Berliner Clayallee erschien, stand vor dem Gebäude bereits eine etwa dreißigköpfige Warteschlange im Nieselregen, bewacht von drei deutschen Polizisten und zwei strammstehenden, wie in Granit gehauenen US-Soldaten. Es stellte sich heraus, dass die Wartenden allesamt zu 8 Uhr, der Öffnungszeit der Passstelle, einbestellt worden waren. Die Ersten in der Schlange hatten offenbar Bescheid gewusst und mussten sich schon gegen 6 Uhr eingereiht haben, um die Prozedur zügig hinter sich zu bringen. In der quälend langsam vorrückenden Warteschlange gingen Bemerkungen und Witzeleien über die Trägheit amerikanischer Amtsschimmel von Mund zu Mund, wenn auch gedämpft und geflüstert, als würden derlei albern-harmlose Despektierlichkeiten mit lebenslangem Einreiseverbot oder zumindest der Deportation aus der Warteschlange geahndet. Hätte Carlsen damals gewusst, was im nächsten halben Jahr auf ihn zukommen sollte, hätte er vermutlich nicht so breit mitgegrinst, wie er es tat.
Gegen 9.30 Uhr war er endlich in die gläserne Eingangsschleuse vorgerückt, legte den regenschweren Trenchcoat und das Sakko in die Plastikschüssel der Röntgenanlage und wollte auch den kleinen Lederkoffer dazulegen, in dem sich seine Antragsunterlagen befanden, wurde jedoch höflich und streng darauf aufmerksam gemacht, dass Koffer, Taschen, Tüten und überhaupt jede Form von Behältnissen, die nicht der Bekleidung dienten, unzulässig seien. Ob er etwa die entsprechenden Hinweise im entsprechenden Informationsblatt nicht gelesen habe? Zum Transport der Unterlagen seien lediglich Plastikfolien oder transparente Aktenordner zulässig. Eine Ablage für unzulässige Behältnisse gab es nicht. Wohin also mit dem Koffer?
Der uniformierte Kontrolleur zuckte mit den Schultern und sagte, nun schon sichtlich genervt, das sei nicht seine Sache, fügte jedoch tröstend hinzu, dass Carlsen nach Entsorgung des Koffers an der immer noch wachsenden Warteschlange vorbei unverzüglich in die Eingangsschleuse zurückkehren dürfe.
Er ging zurück auf die Straße und sah sich ratlos um. Auf der gegenüberliegenden Seite der Clayallee gab es parkartige Rasenflächen, die zur Straße hin von Buschwerk begrenzt waren. Er nahm die Unterlagen aus dem Koffer, sah sich noch einmal um, ob er nicht von den Polizisten oder Soldaten beobachtet würde, und schob den Koffer kurz entschlossen unter die nässetriefenden Büsche. Der Koffer enthielt jetzt nur noch Wäsche zum Wechseln, Kulturtasche, Reiselektüre und anderen Kleinkram; sollte er wirklich gestohlen werden, wäre es zu verschmerzen gewesen. Als Carlsen an der Warteschlange vorbei zügig zur Eingangsschleuse strebte, trafen ihn vorwurfsvolle Blicke, die ihn wohl als Vordrängler denunzieren wollten, aber der Kontrolleur erkannte ihn wieder und nickte freundlich bis anerkennend, als wollte er sagen: Warum nicht gleich so?
In der Passstelle teilte sich die Warteschlange in drei Kolonnen, die im Schneckentempo Richtung Schalter krochen. Nach fünfundvierzig Minuten hatte Carlsen in seiner Kolonne nur noch zwei Personen vor sich, als eine Lautsprecherdurchsage ertönte: Im Gebüsch vor dem Gebäude sei ein verdächtiger Koffer lokalisiert worden. Sollte sich der Eigentümer nicht unverzüglich beim Koffer einfinden, werde dieser aus Sicherheitsgründen konfisziert und zur Sprengung gebracht.
Der Koffer war nicht wichtig, aber die Lautsprecherdurchsage schüchterte ihn ein. Was, wenn sich aus dem Inhalt seine Identität feststellen ließ? Lagen nicht sogar einige Visitenkarten darin? Einreisevisum und zwei sorgenfreie Semester im verheißungsvollen Nirgendwo könnte er dann wohl vergessen. Also scherte er mit weichen Knien aus der Kolonne aus und meldete sich, schuldbewusst und unterwürfig Erklärungen stammelnd, bei einem der Sicherheitsmenschen im Foyer, der ihn auf die Straße schickte. Die Lautsprecherdurchsage war wohl auch zur äußeren Warteschlange durchgedrungen, galten ihm doch nun sämtliche Blicke. Man hatte es immer schon geahnt: So unauffällig sah ein Kofferbomber aus.
Vor dem Gebüsch wartete bereits einer der deutschen Polizisten und empfing ihn mit den Worten, er sei das also. Der Polizist lächelte aber nachsichtig, vielleicht auch mitleidig, und erklärte jovial, das Problem ergebe sich mindestens einmal täglich. In der U-Bahn-Station gebe es jedoch eine Dönerbude, die sich inzwischen auf diese Fälle spezialisiert habe und als eine Art inoffizieller Gepäckaufbewahrungsdienst der Passstelle der Berliner Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika fungiere. Immerhin. Ein deutscher Polizist mit Humor.
Carlsen hechelte die fünfhundert Meter zur U-Bahn-Station und wollte dem Dönermann seine Bredouille erklären, aber der unterbrach sein Gestammel und sagte nur: »Isse klar, Kollege. Drei Euro, wenn abhole«, nahm den Koffer in Empfang und schob ihn in ein Gestell neben dem Getränkekühler, in dem bereits diverse Taschen, Koffer und Tüten auf ihr Visum warteten.
Für die Warteschlange war Carlsen nun schon eine vertraute Erscheinung, und auch in der Eingangsschleuse wurde er lässig durchgewinkt, aber in den Schalterkolonnen war er erneut der Letzte.
Gegen 12.30 Uhr war dann die Reihe endlich an ihm. Er händigte einer mechanisch vor sich hin nickenden Frau seine gesammelten Formularwerke aus, die sie mit spitzen Fingern auf Vollständigkeit überprüfte und ihn wissen ließ, dass er nunmehr Platz nehmen dürfe, um auf den Aufruf für sein Interview mit einem Immigration Officer zu warten. Die wenigen Stühle waren besetzt. Im Stehen blätterte er in ausliegenden Broschüren, die in bunten Hochglanzbildern die Herrlichkeiten Amerikas priesen und die Notwendigkeit erklärten, sich im Krieg gegen den globalen Terror uneingeschränkt solidarisch zu verhalten. An einem der Schalter gab es in gedämpftem Ton eine Auseinandersetzung. Soweit Carlsen es verstand, wurden einem vorderorientalisch aussehenden Ehepaar die Einreisevisa verweigert, und als ein Sicherheitsbeamter die beiden schließlich nach draußen eskortierte, fluchte der Mann halblaut vor sich hin, während die Frau weinte.
Um 13.26 Uhr wurde Carlsen, Moritz, per Lautsprecher an Schalter drei beordert, wo ihn ein überaus höflicher junger Mann befragte, aus welchen Gründen er eigentlich ein J-1-Visum in die USA beantragt habe. Die Gründe hatte Carlsen in den Antragsformularen zwar schon detailgenau und schriftlich dargelegt, wiederholte sie jetzt jedoch so wortgetreu wie möglich, wobei der junge Mann interessiert in den Papieren blätterte.
»Centerville College, Vermont«, nickte er respektvoll. »Ivy League. Beneidenswert.«
Dann musste Carlsen seinen linken und rechten Zeigefinger auf eine rot blinkende Apparatur legen, und nachdem die Abdrücke eingescannt waren, verkündete der Immigration Officer, dass Carlsens Reisepass samt Visum ihm innerhalb der nächsten drei Werktage postalisch zugestellt werde. Dabei strahlte er ihn so erfreut an, als verkünde er ihm den Gewinn des Lottojackpots.
Carlsen bedankte sich, eilte an der geschrumpften Schlange vorbei zur U-Bahn-Station, ließ sich den Koffer aushändigen und bestellte einen Döner und eine Cola. Kauend und schluckend dachte er darüber nach, wieso man als simpler Tourist ohne Visum in die USA einreisen durfte, als Austauschakademiker aber erkennungsdienstlich kujoniert und biometrisch vermessen wurde. Vielleicht war es ja eine neue Strategie des Terrorismus, sich als Germanist, Kardiologe oder Astrophysiker zu tarnen?
Der Dönermann nickte ihm verständnisinnig zu und sagte: »Lebbe is hart.«
Carlsen gab ihm einen Euro Trinkgeld und nahm die nächste U-Bahn Richtung Bahnhof Zoo. Als er ankam, fiel ihm ein, dass er kein Ticket gelöst hatte. Obwohl er gar nicht kontrolliert worden war, erschrak er bei der Vorstellung. Und über sein Erschrecken wunderte er sich.
An einem schwülen Vormittag Anfang September checkte Carlsen am Frankfurter Flughafen ein. Bei der Passkontrolle sah ihm der Zollbeamte prüfend ins Gesicht. Ob er Arzt sei?
»Nein, wieso?«
»Wegen des Doktortitels.«
»Ich bin Schriftsteller.«
Der Zollbeamte zog die Augenbrauen hoch, legte Carlsens Pass auf das elektronische Lesegerät, kniff die Augen zusammen, als habe er eine verdächtige Information entdeckt, gab ihm den Pass aber wortlos zurück und winkte ihn weiter.
Auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen fischten die Kontrolleure bei der Handgepäckkontrolle vor den Gates einen Nagelknipser aus seinem Koffer. Man erklärte die Nagelfeile, keine fünf Zentimeter lang, für waffenfähig. Also war sie an Ort und Stelle abzubrechen, wahlweise war der komplette Nagelknipser abzugeben. Er brach die Feile ab. Den Laptop sollte er hochfahren. Es misslang, weil der Akku nicht geladen war. Das schien Verdacht zu erregen, denn nun komplimentierte man ihn hinter eine Sichtwand, und während er dort den Laptop per Steckdose booten musste, wurde sein Handkoffer erneut durchsucht. Zu beanstanden gab es nichts, nur seine Reiselektüre, Carl Zuckmayers Autobiografie »Als wär’s ein Stück von mir«, drehte der Kontrolleur misstrauisch in der Hand, als handele es sich um etwas Verbotenes. Oder Ekelhaftes.
»Na dann, gute Reise«, sagte der Mann und warf das Buch in den Koffer zurück.
Obwohl der Metalldetektor nicht fiepte, als Carlsen ihn passierte, wurde er vom Hemdkragen über die Gesäßtaschen bis zu den Socken abgetastet. Leibesvisitation, dachte er, merkwürdiges Wort. Früher wurde sie nur dezent, verschämt fast, angedeutet, jetzt ging es handfest an die Wäsche und darunter. Am Gate wurde man vernommen, wann man seinen Koffer gepackt, ob man dabei fremde Hilfe in Anspruch genommen und ob man sein Handgepäck vorübergehend unbeaufsichtigt gelassen hatte. Nein, nein, nein. Während des Boardings, beim Weg über die zum Flugzeug führende Gangway, wurden dann noch einige Passagiere aufgefordert, ihre Schuhe auszuziehen, und Carlsen war sich unangenehm sicher, dass auch diese Kontrolle ihn treffen würde, aber man ließ ihn unbehelligt. Saubere Socken hätte er immerhin vorzuweisen gehabt.
Gern geflogen war er noch nie, weil das kein Reisen vom Vertrauten ins Fremde ist, sondern Transport. Man wird wie Stapelware umgeschlagen, an Gate X verladen und an Gate Y gelöscht. Allerdings hatte er bislang auch nie Flugangst gespürt, doch das änderte sich jetzt. Die Verschärfung der Kontrollen sollte vermutlich beruhigen, bewirkte aber das Gegenteil. Als sich der Start um ein paar Minuten verspätete, was mit einer Verzögerung bei der Gepäckverladung entschuldigt wurde, assoziierte er reflexartig »Kofferbombe«. Als der Kurs über England Richtung Atlantik führte, schoss ihm »Lockerbie« in den Kopf. Und bei jeder noch so schwachen Turbulenz entwickelte er Fantasien, wie das wohl bei einem Absturz wäre. Ob man noch lebte, wenn man unten aufschlüge? Ob einem während des Falls der notorische Lebenszeitrafferfilm präsentiert würde?
Das Essen wurde serviert. Carlsens Sitznachbar, ein wortkarger Amerikaner, klappte die »Financial Times« zusammen, in der er die Börsenkurse studiert hatte, fummelte seufzend die Folie von seinem Alunapf, sog misstrauisch den aufsteigenden Essensgeruch durch die Nase und sagte: »Now, that’s biological warfare.« Er nickte Carlsen grinsend zu.
Sie verputzten wortlos die fade Hähnchenbrust auf Gemüsereis, der Amerikaner vertiefte sich wieder in seine Kurslisten und Carlsen sich in seine Reiselektüre, die er gewählt hatte, weil Zuckmayer auch die weltabgewandte Gegend beschrieb, in die Carlsen jetzt unterwegs war.
»Wir hatten keine Erfahrung«, las er da, »mit amerikanischer Bürokratie. Wir kannten nicht den absoluten Legalismus der amerikanischen Beamten, dem nichts als der Buchstabe des Gesetzes gilt, und zwar genau bis aufs Haar. Wir hatten uns noch nicht klargemacht, dass es nur dadurch, durch diese unberechenbare, pedantische Gesetzesstrenge, gelungen war, eine halbwilde Gesellschaft von Westwanderern, Ansiedlern, Glücksrittern, Abenteurern aus allen Ländern und Rassen zu domestizieren und überhaupt zu einem Staatsvolk zusammenzufügen – dass es sich hier um eine Tradition der Rechtlichkeit handelte, welche nicht die geringste Unkorrektheit oder Umgehung dulden kann, ohne ihre Grundlagen in Frage zu stellen.«
Die Entstehung des amerikanischen Korrektheitsfanatismus aus dem Geist des Wilden Westens? In der Umgehung der pedantischen »Rechtlichkeit« hatte Amerika es allerdings auch zu entsprechender Meisterschaft gebracht, zum Beispiel bei der Wahl George W. Bushs zum Präsidenten, bei der man es in Florida mit der Gesetzesstrenge wohl nicht allzu genau genommen hatte.
Inzwischen wurden die Fragebogen der Einwanderungsbehörde verteilt, über deren sprichwörtliche Absurdidät er sich diesmal nicht einmal mehr amüsieren konnte, sondern nur stur seine Kreuze machte und eidesstattlich versicherte, weder geisteskrank zu sein noch der Prostitution oder dem Drogenhandel nachgehen zu wollen und auch nicht die Absicht zu hegen, den amerikanischen Präsidenten zu ermorden. Warum wurde eigentlich nicht nach der Mitgliedschaft bei al-Qaida oder den Taliban gefragt? Vielleicht sollten die penetranten Kontrollen und Befragungen auch gar keine Sicherheitsgefühle erzeugen, sondern das, was sie zu dämpfen vorgaben: Angst – und damit Gefügigkeit gegenüber einem Regel- und Räderwerk, das alles und jeden überwachen wollte. Paranoide Züge hatte Carlsen bislang nicht an sich feststellen können, aber in diesem Flugzeug, das sicher und pünktlich in Newark, New Jersey, landete, zeigten sie ihre Grimasse.
Die umständlichen Formalitäten in der Immigration-Schleuse kamen ihm noch umständlicher vor als bei früheren Einreisen. Obwohl aus dem J-1-Formular zweifelsfrei hervorging, zu welchem Zweck er an welchen Ort unterwegs war, fragte der Immigration Officer nach seinem Reiseziel, während er den Pass fotokopierte und das Formular abstempelte. Eine automatische Kamera schoss noch ein Foto von Carlsen, dann wurde er durchgewinkt: »Have a nice time, enjoy your stay.«
Der dem College nächstgelegene Flughafen lag in Lebanon, New Hampshire, direkt an der Grenze zu Vermont, und der Anschlussflug nach Lebanon sollte in 45 Minuten aus dem Domestic Flights Terminal abgehen. Vorher musste Carlsen sein Gepäck holen, durch den Zoll bringen und erneut einchecken. Die Zeit war also knapp, und er hastete zur Gepäckausgabe. Als das Laufband sich endlich in Bewegung setzte und sein Koffer als einer der letzten erschien, blieben noch zwanzig Minuten bis zum Abflug. Der Koffer war mit einem gelben Aufkleber markiert: Der deutsche Zoll hatte ihn in Frankfurt durchsucht. Weshalb? Wegen der Verlängerungskabel des Laptops, mit denen man jemanden strangulieren könnte? Wegen des Schweizer Messers, das ja Terrorinstrumente gleich im Dutzend zur Verfügung stellte? Der gelbe Aufkleber war jedenfalls ein unübersehbarer Hinweis auf Carlsens Verdächtigkeit, und er rechnete damit, beim Zoll bis aufs Hemd gefilzt zu werden, musste jedoch nur die im Flugzeug ausgefüllte Erklärung abgeben, dass er weder Drogen noch landwirtschaftliche Produkte noch Devisen in rauen Mengen importierte.
Mit dem Shuttlebus zuckelte er zum Terminal für Inlandsflüge, erreichte schweißgebadet und außer Atem fünf Minuten nach der planmäßigen Abflugzeit den Check-in-Schalter, der nicht mehr besetzt war und vor dem auch niemand mehr wartete oder anstand. Zu spät. Erschöpft sank er auf eine der Sitzschalen aus Hartplastik, wischte sich Schweiß von der Stirn, schloss die Augen. Als die wie permanenter Nieselregen von irgendwo und nirgends rieselnde Dudelmusik von einer automatisierten Lautsprecherdurchsage unterbrochen wurde, dass Newark Airport ein absolut rauchfreier Flughafen sei, verspürte Carlsen ein unbändiges Bedürfnis nach einer Zigarette. Als er die Augen wieder öffnete, fiel sein Blick auf die elektronische Anzeigetafel über dem Schalter: Der Flug war gar nicht ohne ihn abgegangen, sondern von 16 auf 21 Uhr verlegt. Wetterbedingt. Fünf Stunden Wartezeit waren ärgerlich, aber ein verpasster Flug wäre noch ärgerlicher gewesen. Er schlenderte an eins der Panoramafenster. Auf die schiefergrauen Parkflächen und Rollfelder prasselte sintflutartiger Regen, und in der tief hängenden, fast schwarzen Wolkendecke wetterleuchteten lautlose schwefelgelbe Explosionen. Was für ein Glück, jetzt nicht durch diese tosende Waschküche fliegen zu müssen.
Er ging zurück zum Haupteingang und gesellte sich draußen vor den automatischen Glastüren zu den ausgesperrten Rauchern. Der Regen verwandelte die Zufahrtsrampe in einen reißenden Strom, durch den die Busse, Autos und Taxis zu schwimmen schienen, aber Abkühlung brachte das Unwetter nicht. Das digitale Thermometer auf einem Terminaldach zeigte einundneunzig Grad Fahrenheit.
Hocki hatte gesagt, dass er ihn am Flughafen in Lebanon abholen würde. Um die Verspätung anzukündigen, versuchte Carlsen, ihn mit dem Handy zu erreichen, bekam aber keinen Anschluss. Dann versuchte er es erfolglos mit einem der öffentlichen Telefone in der Eingangshalle. Vielleicht machte er etwas mit den Vorwahlen oder der Kreditkarte falsch? Vielleicht war die Nummer, die er notiert hatte, nicht korrekt, oder der Anschluss war gestört.
Am Hauptschalter der Fluglinie gab er sein Gepäck auf und bekam die Bordkarte für den verschobenen Flug, aß in einem Restaurant einen Cheeseburger mit Pommes frites und Krautsalat, trank dazu ein Samuel-Adams-Bier. Im Fernsehgerät überm Tresen lief ein Interview mit dem Anwalt Ralph Nader. Ob, und wenn ja, warum er bei der nächsten Wahl als Präsidentschaftskandidat antreten werde, obwohl bekanntlich chancenlos. Er trete wieder an, sagte Nader, weil Bush ein demokratischer Diktator sei.
Carlsen wusste nicht, ob er es beruhigend oder tollkühn finden sollte, dass so etwas im amerikanischen Fernsehen gesagt und gesendet wurde, zahlte, ging wieder nach draußen, starrte rauchend in den monsunartigen Regen und die niedrige Wolkendecke, die jetzt so schwer zu lasten schien wie Carlsens wachsende Müdigkeit.
Er versuchte noch einmal ergebnislos, Hocki zu erreichen, und schlenderte dann gemächlich zu den Gates. Bei der Handgepäckkontrolle stieß der Nagelknipser ein weiteres Mal auf gesteigertes Interesse: warum die Klinge abgebrochen sei? Carlsens Erklärung wurde mit anerkennendem Kopfnicken quittiert. Brav, der Mann. Die Wartezone am Gate war menschenleer. Er streckte sich auf einer Sitzbank aus, starrte eine Weile gegen die mit verschmutzten Plastikplatten verschalte Decke, döste schließlich ein und erwachte erst wieder, als der Flug aufgerufen wurde.
Während die Cessna nach Norden zog und die beiden Studenten ihren lautstarken Dialog beendet hatten, wich die Müdigkeit einer überdrehten Empfindlichkeit, einer Dünnhäutigkeit der Wahrnehmung, die in ihm ein Gefühl wiederbelebte, das er aus seiner Kindheit kannte. Es überkam ihn, wenn er im Bett lag, in Momenten kurz vorm Einschlafen, diesen Momenten überwacher Unwirklichkeit. Sein Körper wölbte sich dann langsam schwellend, einem Luftballon ähnlich, auf Zimmergröße. An der Decke, am Boden, an den Wänden machte er halt, als traute er sich nicht über die Geborgenheit des Zimmers hinaus, als fürchtete er sich vorm grenzenlosen Draußen. Dann lag der kleine Moritz nicht mehr nur im Zimmer, in dem sein Bett stand, sondern Zimmer samt Bett und allen anderen Gegenständen lagen zugleich in ihm. Wenn das Gefühl nach einigen Sekunden verebbte, hinterließ es Zufriedenheit und eine Art Heiterkeit, die einverstanden war mit ihm und allem um ihn herum, ein inneres Lächeln. Später wünschte er sich manchmal, diese Momente zurückrufen zu können, aber das gelang nie. Doch in dem winzigen Flugzeug kam das Gefühl zurück, plötzlich und ungerufen. Er gab sich ihm hin, glaubte, es würde haltmachen an den Rücken- und Seitenlehnen des Sitzes, denn es schien ihm indiskret, andere Passagiere mit seiner aufgeblähten Person zu überfluten. Aber dann ging es weit hinaus, über den Rumpf der Maschine, über die Tragflächen, und das schwächer werdende Glitzern der Stadt, diese wie ein Monitor flimmernde Indianerdecke, befand sich in seinem Inneren, die schwarz ragenden Wolken oder Berge am Horizont und der sichtbare Teil des Nachthimmels dazu. Nur die Sterne erreichte er nicht. Die Sterne waren zu fern. Vielleicht, dass der Mond ein wenig näher rückte? Ihm kamen Worte für die Empfindung, sehr schwach nur, abstrakt und hilflos, aber immerhin. Das Zentrum, dachte er nämlich, ist überall – alles gleich nah, alles gleich fern. Und in der Mitte dieser Entrückung zog das Flugzeug seine Bahn, bis die Lichter von unten aus leuchtendem Gewebe und Pixelgeflimmer wieder zu Ansiedlungen, Straßen und der Landebahn wurden, der das Flugzeug entgegensank. Indem er Einzelheiten unterschied, schmolz das Gefühl lautlos wie ein Traum, und er saß wieder auf Ichgröße geschrumpft in seinem Sitz. Was wollten ihm solche mentalen, der Übermüdung geschuldeten Exkursionen eigentlich sagen? Handfeste Ideen für einen neuen Roman lieferten solche Spinnereien ja nicht gerade. Leider. Kopfschüttelnd löste er den Sicherheitsgurt.
Der Flughafen Lebanon bestand aus ein paar ein- und zweistöckigen Betonbauten und barackenartigen Gebäuden mit Dächern aus Holzschindeln und weiß verplankten Wänden. Auf dem Dach des Towers bauschte sich im Nachtwind die amerikanische Flagge. Im blassgelben Scheinwerferlicht kletterten die Passagiere über die angelegte Treppe aus der Cessna aufs Rollfeld, wo der Co-Pilot verkündete, dass die Gepäckausgabe zu dieser nachtschlafenden Zeit geschlossen sei. Ein junger vollbärtiger Mann im Overall lud die Koffer, Taschen und Rucksäcke aus der Gepäckklappe und knallte sie wortlos auf den Beton. Die beiden Studenten und die Frau griffen sich ihre Sachen und marschierten zielstrebig auf einen erleuchteten Eingang zu.
Carlsen folgte ihnen mit seinem Koffer in eine Halle, von deren Decke ein enormes Holzschild mit Gravur hing.
WELCOME IN NEW HAMPSHIRE
LIVE FREE OR DIE
Außer den drei Mitpassagieren und ihm selbst war kein Mensch in der Halle, kein Hocki und auch sonst niemand, den er geschickt haben könnte, um ihn abzuholen. Die beiden Ticket- und Check-in-Schalter waren verwaist, die Schalter von Hertz und National mit Rolläden verrammelt; ein Auto konnte er also auch nicht mieten. Er lief den Studenten nach, die bereits durch die verglaste Drehtür mit der Aufschrift »EXIT« nach draußen gegangen waren, erklärte seine Bredouille, und falls sie auf dem Weg zum College …
Ja, klar, sie würden jetzt mit dem Auto nach Centerville fahren, und nein, es sei überhaupt kein Problem, ihn mitzunehmen. Dass er keinen Telefonanschluss bekommen hätte, sei nicht ungewöhnlich. Bei Unwettern wie dem, das heute durchgerauscht war, knickten irgendwo in den Bergen immer mal wieder Masten um, und es konnte Stunden, manchmal Tage dauern, bis die Leitungen repariert waren. Übrigens heiße er Glenn, sagte der Student, der eine grüne Baseballkappe mit dem eingestickten College-Emblem CVC trug, und schüttelte Carlsen kräftig die Hand. Und er heiße Paul, sagte der andere Student, der die gleiche Kappe trug, aber den Schirm in den Nacken gedreht hatte, und schüttelte ihm die Hand noch kräftiger, während er sich vorstellte und es ebenfalls beim Vornamen beließ.
»Maurice?«, vergewisserte sich Glenn.
Er nickte. Warum nicht?
»Nice to meet you, Maurice«, sagten beide wie aus einem Munde.
Nur wenige Schritte vom Flughafengebäude entfernt befand sich ein geschotterter, von einer Glühbirnenkette trübe beleuchteter Parkplatz, auf dem etwa zehn Autos standen. Glenn und Paul führten ihn zu einem gewaltigen Geländewagen und öffneten die Heckklappe, auf der ein Aufkleber in Form einer windbewegten amerikanischen Flagge mit der Aufschrift »We support our troops« klebte. Die beiden luden ihre Rucksäcke ein, Carlsen schob seinen Koffer daneben, Glenn setzte sich hinters Steuer, Paul auf den Beifahrersitz, und Carlsen kletterte auf die Rückbank. An Platz fehlte es hier wahrlich nicht; man hätte noch sechs Personen mehr mitnehmen können. Der Motor klang wie das gedämpfte Röhren eines urzeitlichen Monsters.
»Was ist das für ein Auto?«, erkundigte Carlsen sich, weil er annahm, dass die Jungs auf ihren Truppentransporter stolz waren.
»Chevrolet Tahoe.« Paul drehte sich zu ihm um; sein Grinsen war so breit wie die Stoßstangen. »Leider kein richtiger Hummer, aber immerhin ein SUV.«
»SUV? Was ist das? Ich komme aus Europa, aus Deutschland, und kenne …«
»Deutschland? Tatsächlich? Ihr Englisch ist aber ziemlich gut.«
»Danke. Ich bin Übersetzer und werde am College auch ein Übersetzerseminar geben.«
»Übersetzer? Tatsächlich? Hast du das gehört, Glenn? Maurice ist Übersetzer.«
»Ja, toll«, sagte Glenn. »Stört es Sie, wenn wir rauchen?«
»Im Gegenteil. Ich rauche selbst.«
»In Deutschland raucht jeder, stimmt’s?«, sagte Paul und hielt Carlsen eine Schachtel Camel Filter hin. Er bediente sich, Paul gab ihm Feuer und steckte sich selbst und Glenn Zigaretten an.
»Na ja«, sagte Carlsen, »vielleicht nicht jeder, aber Raucher werden da nicht so, wie soll ich sagen? Nicht so …«
»… diskriminiert«, sagte Paul.
»Ja«, sagte er, »jedenfalls noch nicht.«
»Toll«, sagte Paul und stieß mit gespitzten Lippen Rauch durch die geöffnete Seitenscheibe.
»SUV steht für Sports Utility Vehicle«, sagte Glenn nach kurzem Schweigen. »Dieser hat zwei V8-Motoren, die wahlweise die Hinterachse oder alle vier Räder antreiben.«
»Verstehe«, nickte Carlsen, der von Autos nicht die leiseste Ahnung hatte. »Und wie hoch ist der Verbrauch?«
Glenn zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Ziemlich hoch. Spielt aber keine Rolle.«
»Nein, natürlich nicht«, sagte Carlsen, obwohl ihm Widerspruch auf der Zunge lag. Aber sollte er diesen hilfsbereiten Jungs mit deutscher Ökokorrektheit oder einem Kein-Krieg-für-Öl-Pazifismus auf die Nerven gehen? Mit einem Pazifismus, der sich nicht zuletzt der Reeducation und Entnazifizierung durch die Amerikaner nach 1945 verdankte? Die deutsche Haltung gegen den Irakkrieg war doch wohl eine Mischung aus antimilitaristischer und antinationaler Überzeugung, anerzogen von Amerika selbst. Aber dieser Krieg war auch das entscheidende Wahlkampfthema der rot-grünen Regierung gewesen. Hätte der machtversessene Bundeskanzler mit einem Kriegskurs die Wahlen gewinnen können, hätte er Kriegskurs gesteuert. Davon war Carlsen überzeugt. Beim Außenminister war er sich nicht sicher, aber prinzipientreu war der auch nicht.
Und Moritz Carlsen war jetzt weder im diplomatischen Dienst unterwegs noch als europäischer Friedensapostel eingeladen worden, sondern als Gastprofessor – mit der Betonung auf Gast. Er musste schlicht dankbar sein, dass diese Studenten ihn so umstandslos und gastfreundlich mitnahmen, wechselte also lieber das Thema und fragte, welche Fächer sie auf dem College belegten. Beide studierten Economics, Wirtschaftswissenschaften also, wovon Carlsen noch weniger Ahnung als von Autos hatte, weshalb er außer »Verstehe« gar nichts mehr sagte, was offenbar auch nicht erwartet wurde.
Sie fuhren über eine Ausfallstraße nach Westen, vorbei an den Leuchtreklamen von Restaurants, Tankstellen, Supermärkten, zwischen deren immer größer werdenden Abständen Bäume aufragten, bis nach einem letzten Dunkin-Donuts-Laden nur noch das Licht der Autoscheinwerfer durchs Dunkel brach. Paul schob eine CD in den Player am Armaturenbrett und drehte die Lautstärke hoch. Countryrock. Ein schneller, nervöser Song im Rhythmus einer zügig auf Touren kommenden Maschine, die im gleichen Takt wie der Automotor zu schlagen schien. Die Bässe pumpten wie Herzschläge eines Läufers durchs Wageninnere, entwichen mit den Zickzacklinien einer Fiedel und den langen Bögen einer Pedal-Steel-Gitarre durch die offenen Seitenfenster, wehten als Klangfahne in die Nacht, und Glenn und Paul sangen den Refrain mit. »Into the future and out of the past, trains run in my head, trains run in my head …«
Die Strecke führte in lang gezogenen Kurven bergauf. Manchmal war die Fahrbahn so dicht von Wald gesäumt, dass die Wipfel ineinanderzuwachsen schienen, als führe man durch einen Schacht aus Stämmen und Astwerk. Manchmal traten die Bäume weiter von der Straße zurück, und dann zeichneten sich bewaldete Bergkuppen, schwarz und scharf umrissen wie Scherenschnitte, gegen den heller schimmernden Nachthimmel ab. Zwischen Wachsein und Schlaf schwamm Carlsen noch eine Weile in Grenzregionen, in denen ähnliche Zustände herrschten wie in der wogigen Anwandlung, die ihn im Flugzeug überkommen hatte, »trains run in my head«, überließ sich schließlich der Schwerkraft seiner Müdigkeit und erwachte erst wieder, als Paul ihn anstieß und sagte: »Hey, Maurice! Wir sind da.«
Der Wagen hielt vor dem Verwaltungsgebäude des Colleges, einem modernen mehrstöckigen Steinklotz mit grauer Schieferfassade, umgeben von parkartigem Gelände, durch das von Lampen beleuchtete, betonierte Fußwege führten. Über den Rasenflächen, zwischen Bäumen und Büschen, hingen Dunstschwaden. Grillen zirpten, Mücken surrten, und irgendwo zwischen den Bäumen schlappte schwerer Flügelschlag eines Nachtvogels. Manchmal glitten Autos vorbei, langsam, fast im Schritttempo. Aus zwei Fenstern im Erdgeschoss des Gebäudes brachen Lichtstreifen über den Rasen. Carlsen sah auf die Uhr: Viertel nach eins. In den Verwaltungsbüros war um diese Zeit natürlich niemand mehr anzutreffen, aber hinter den erleuchteten Fenstern residierte der Sicherheitsdienst des Colleges.
Von dort aus, erklärten Glenn und Paul, könne er telefonieren. Sie wollten auf ihn warten, und falls immer noch keine Verbindung zustande kommen sollte, boten sie ihm an, bei ihnen zu übernachten. Sie wohnten im Haus einer Studentenverbindung, und dort würden sich allemal noch ein Bier und ein freies Bett finden.
Durch den Seiteneingang mit der Aufschrift »Campus Security« gelangte Carlsen in ein stickiges Büro, in dem es nach Staub, Papier und abgestandenem Kaffee roch. An einem der Metallschreibtische saß eine uniformierte Frau vor einem Computer, blickte auf, erwiderte lächelnd seinen Gruß, fragte, wie sie ihm helfen könne, hörte sich seine Geschichte an, drückte ihr Bedauern über derlei Unannehmlichkeiten aus, blätterte in einem Telefonverzeichnis, griff zum Hörer, wählte Professor Shoffes Privatnummer, bekam ihn gleich an den Apparat und erklärte, dass hier ein Mr., »wie war doch noch mal der Name?«, ein Mr. Carlsen warte und »verdammt müde« aussehe. »Er wird in fünfzehn Minuten hier sein«, sagte sie, nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte. »Er sagt, er habe erst morgen mit Ihnen gerechnet. Hat sich wohl im Datum geirrt.«
Carlsen bedankte sich und ging wieder nach draußen, erklärte Glenn und Paul die Situation, bedankte sich auch bei ihnen, öffnete die Heckklappe, »We support our troops«, lud seinen Koffer aus und blickte den Rücklichtern des Wagens nach, bis sie in der Dunkelheit verglühten.
2Ein Netz und ein Summen
Morgensonne reflektierte im Spiegel über der Wäschekommode, bildete auf dem Holzfußboden ein scharf umrissenes, leuchtendes Rechteck, durch das die dunklen Nuten zwischen den Dielen schnitten, und so wirkte der Lichtfleck wie ein Blatt liniertes honiggelbes Papier. Darauf könnte man seine Träume notieren, dachte er im Erwachen, mit Traumtinte, in Traumschrift, die keine Hand, keinen Stift und keine Tastatur benötigt, sondern von Gedanken und Fantasien, Wahrnehmungen und Erinnerungen unmittelbar erzeugt wird. Und Schreibblockade ein Fremdwort. Jenseits des Lichtpapiers waren die derben Dielen dunkelbraun, fast schwarz. Wände und Zimmerdecke cremeweiß. Vor der Kommode lag der aufgeklappte Koffer. Die Traumschrift verblasste, denn jetzt wusste Carlsen, wo er war, und blinzelte zur Armbanduhr, die er auf dem Nachttisch neben dem Bett abgelegt hatte. Zwanzig nach sieben. Also hatte er kaum fünf Stunden geschlafen, war aber nicht müde. Jetlag. In Deutschland begann schon der Nachmittag.
Als Hocki ihn heute Nacht endlich aufgegabelt hatte, aus seinem Auto gestiegen, auf ihn zugegangen war, ihm kräftig die Hand geschüttelt, mehrfach auf die Schulter geklopft und sich wiederholt entschuldigt hatte, den »blöden Termin vermasselt« zu haben, hätte Carlsen ihn auch erkannt, wenn er nicht mit ihm gerechnet hätte. Hocki war so groß, breit, blond und blauäugig wie damals und hatte immer noch sein joviales, kumpelhaftes Grinsen. Nur seine Lachfalten waren zu tiefen Furchen geworden, sein eckiges Kinn hatte sich massig gerundet, die Schläfen waren seriös ergraut, und er schob jetzt auch einen gewaltigen Bauch vor sich her, der sich ballonartig unter einem dunkelblauen Polohemd wölbte. Sie waren dann eine Viertelstunde durch die Nacht gefahren, bis zu diesem Haus.
»Es ist eins der Gästehäuser vom College«, hatte Hocki erklärt, »liegt etwas off campus, aber schön. Szenischer Blick auf die Berge und alles.« In der Dunkelheit war kaum etwas zu erkennen gewesen. Von ferne hatte Carlsen Wasser rauschen gehört. »Beaver Creek«, hatte Hocki gesagt, »kann man großartig baden.«
Sie hatten einen schnellen Rundgang durchs Haus gemacht und noch eine halbe Stunde am Küchentisch gesessen, eiskaltes Flaschenbier getrunken, das Hocki mitgebracht hatte, »Beaver Creek Summer Ale, kein deutsches Pils, sorry, kann man aber großartig trinken«, und über Belanglosigkeiten geplaudert. »Und was hier wichtig ist«, hatte Hocki gesagt, »erzähl ich dir morgen.«
Bei der zweiten Flasche waren Carlsen die Augen zugefallen. Hocki hatte ebenfalls gegähnt, hatte angekündigt, ihn zum Frühstück hier wieder abzuholen, und sich verabschiedet.
Carlsen stellte sich unter die Dusche. Die Installationen im Bad waren neu, aber das Haus war alt. Die Bodendielen knarrten bei jedem Schritt, einige Türen klemmten in den Rahmen. In der Luft hing ein süßlich-strenger Geruch, der ihm vertraut vorkam. Es gab eine Küche mit hölzernen weiß gestrichenen Einbauschränken, einer Hintertür nach draußen und einer niedrigen Tür, an der ein Schild mit der Aufschrift »Watch Your Step« hing. Dahinter führte eine wackelige Stiege in einen Kellerraum. Grobes gekalktes Mauerwerk; Heizungskessel, Waschmaschine, Wäschetrockner; ein Regal mit Wasch- und Putzmitteln und einem aufgerissenen Karton voller Haushaltskerzen; zwei weitere Regale mit Werkzeugen, Farbeimern, Pinseln; unter der Stiege Kisten und Kartons; an der Wand ein Sicherungskasten für die Hauselektrik.
Von der Küche gelangte man durch einen türlosen Durchgang mit Rundbogen ins Wohnzimmer, beherrscht von einem mächtigen aus Feldsteinen gemauerten Kamin. Davor standen im Halbkreis eine Couch und zwei tiefe Sessel aus abgewetztem flaschengrünem Leder; ein rundes Tischchen; eine Vitrine mit Gläsern; ein Fernsehgerät und eine kleine Stereoanlage auf einem Sideboard. Neben dem Schlafzimmer gab es einen als Büro eingerichteten Raum. Auf einem grauen Metallschreibtisch ein Tastentelefon und ein Monitor mit Tastatur; Rechner und Drucker standen in einem Bücherregal, in dem sonst nur ein paar Zeitschriftenstapel verstaubten.
Es gab keine Klimaanlage, aber in jedem Raum hing ein Ventilator an der Zimmerdecke. Carlsen zog an dem herabbaumelnden Zugschalter. Die Rotation wirbelte den Geruch durch die stille Luft. Bohnerwachs, wusste er plötzlich. Es war der Geruch von Bohnerwachs aus Kindertagen, der aus den Bodendielen dünstete. Vom Wohnzimmer ging eine Tür auf eine überdachte Veranda, die an der Vorderfront und an beiden Seiten des Hauses entlanglief und vollständig mit Fliegendraht eingefasst war. Neben der Eingangstür standen ein hölzerner Schaukelstuhl und ein runder Hocker, im hinteren Teil der Veranda lagen Klappstühle aufgestapelt. Alles war sauber, die Fenster geputzt, aber das Ganze wirkte unbewohnt, erkaltet, aufgegeben.
Er drückte die Fliegendrahttür auf und ging über drei Holzstufen auf den Zufahrtsweg. Die Zugfeder ließ die Tür hinter ihm gegen den Rahmen knallen. In der Morgenstille klang das wie ein Schuss. Jetzt also der »szenische Blick auf die Berge und alles«, der durch die Drahtmaschen gefiltert wie ein grob gerastertes Foto ausgesehen hatte. Umstanden von alten Ahornbäumen lag das Haus an einem grasbewachsenen Hang, an dessen Fuß sich der Beaver Creek wie eine grünblau glitzernde Riesenschlange durchs Weideland schob. Die geschotterte, mit Schlaglöchern übersäte Zufahrt führte zu einer schmalen Brücke und mündete auf der anderen Flussseite in eine Straße, über die lebhafter Autoverkehr von und nach Centerville zog. Das Städtchen lag ein paar Kilometer flussabwärts, und dahinter erstreckte sich das weitläufige Collegegelände über einen Hügel. Den östlichen Horizont begrenzten die grünen Berge, denen Vermont seinen Namen verdankt. Voici les verts monts! Da, seht die grünen Berge!, soll der französische Entdecker Samuel de Champlain ausgerufen haben, als er im frühen siebzehnten Jahrhundert in Begleitung eines katholischen Missionars und einiger indianischer Scouts von Kanada nach Süden über den See gekommen war, der heute seinen Namen trägt. Die bewaldeten Bergketten und Hügel sahen im Morgenlicht eher blau als grün aus, erstarrte Wellen eines Meeres, dessen Ferne zum Greifen nah schien. Flussaufwärts lagen vereinzelte Farmhäuser, deren rot gestrichene Rundscheunen und röhrenförmige Aluminiumsilos wie fette, künstliche Blüten aus dem Grün und Gelb des Weidelands stachen.
Carlsen schlenderte zur Brücke, eine mit armdicken Holzbohlen verplankte, einspurige Eisenkonstruktion, unter der das Wasser in rasender Strömung dahinschoss und nach etwa hundert Metern über Stromschnellen abwärtsschäumte. Das Tosen war bis zur Brücke zu hören, und über den Fällen hing als Dunstschleier aufsprühende Gischt in der Luft. Während er wieder zum Haus zurückging, wirkte es nicht mehr abweisend und verlassen, sondern strahlte in seiner Schlichtheit eine absichtslose Schönheit aus. Überm dunklen Sockel aus Feldsteinen erhoben sich die weiß gestrichenen Holzwände, auf den Fenstern reflektierte Sonnenlicht, und an einer Giebelseite des altersgrauen Schindeldachs ragte zwischen Baumkronen der Schornstein des Kamins in den Himmel, als sei er nicht gemauert worden, sondern gewachsener Fels, an dessen Beständigkeit sich das Haus wie schutzsuchend schmiegte. Schade, dass jetzt kein Rauch aufsteigt, dachte Carlsen. Der Anblick hatte etwas rührend Wehmütiges, Anheimelndes – ein Zuhause, zu dem man gern zurückkehrt. Weil ihm der Gedanke zu sentimental vorkam, dachte er vorsichtshalber: ein Haus, mit dem man Werbung für Ahornsirup machen könnte.
Er ging auf die Rückseite, gegen die vom Boden bis zur Dachtraufe Brennholz gestapelt war, mit dem wohl wolkenweise anheimelnder Rauch zu machen wäre; nur die schmale Hintertür zur Küche war frei gelassen. Ein Trampelpfad lief durchs hohe Gras weiter hügelaufwärts. Auf der Kuppe überblickte man sanft rollendes gelbgrünes Hügelland, dazwischen Farmhäuser, Baumgruppen und Wäldchen, vereinzelte Asphaltbänder der Straßen, und am Horizont, viel ferner als die grünen Berge und doch zum Greifen nah, schroffe Grate, Gipfel und Kämme der Adirondacks. Von hier oben sahen die unregelmäßigen Rechtecke der Dachschindeln wie ein grobmaschiges Netz aus, übers Haus geworfen, um einzufangen oder festzuhalten, was unter diesem Dach je vor sich gegangen war. Vielleicht würde dies Netz auch die Gedankenfluchten bündeln, die Carlsens Schreibblockade schon viel zu lange ausbrütete, aber vermutlich war diese Hoffnung nur ein weiterer Schritt im Kreis lähmender Unproduktivität.
Von der Hauptstraße bog ein Wagen ab, rollte langsam über die Brücke und kam die Zufahrt hinauf. Es war nicht der rote Volvo, mit dem Hocki ihn nachts herchauffiert hatte, sondern ein dunkelgrüner Toyota Corolla. Als Carlsen am Haus ankam, stieg Hocki aus und drückte ihm den Wagenschlüssel in die Hand.
»Mit Komplimenten vom College«, sagte er. »Das ist sozusagen deine Dienstlimousine. Sehr dezent, ziemlich alt, aber fährt noch okay. Das College spart immer am falschen Ende, besonders«, er lachte, »besonders, wenn’s um mein Salär geht. Obwohl es im Teig rollt.«
»Obwohl es was?«
»Im Teig … O Gott, mein Deutsch rostet wirklich. Rolling in dough? Obwohl das College im Geld schwimmt. Egal, jetzt wollen wir erst mal frühstücken.«
Hocki setzte sich auf den Beifahrersitz, Carlsen fuhr. Als sie an der Brücke ankamen, ermahnte Hocki ihn, das Tempo zu drosseln. In der Sommerhitze lockerten sich manchmal die Bolzen der Beplankung, und im Winter, das würde Carlsen noch erleben, sei die Brücke häufig vereist. Es habe hier schon tödliche Unfälle gegeben. Sie bogen Richtung Centerville auf die Route 9 ein, passierten Supermärkte und Einkaufszentren mit Parkplätzen, Autohändler, Schnellrestaurants, Tankstellen, eine Bowlingbahn – das zu austauschbarer Nichtidentität zerfranste Weichbild Centervilles.
In der Stadt jedoch, sagte Hocki, erwarte Carlsen nicht nur ein »großartiges« amerikanisches Frühstück, sondern ein Amerika, das es eigentlich gar nicht mehr gebe. Die amerikanische Kleinstadt nämlich. Vor hundert Jahren hätten die USA noch fast vollständig aus solchen Small Towns bestanden, umgeben von Farmland oder Wildnis, winzige Kaffs, die mit europäischen Maßstäben nur als Dörfer zu bezeichnen seien. In denen hätte der amerikanische Traum gewurzelt und die traditionellen Werte geblüht, intaktes Familienleben, Gemeinschaftssinn, puritanische Frömmigkeit, harte Arbeit und Patriotismus. All diese »großartigen« Ideen. Und hier hätten sich »großartige« Tugenden entfaltet, Nachbarschaftshilfe zum Beispiel, und fernab der politischen Zentren auch eine Art Direkt-Demokratie. In den Fünfzigerjahren hätte noch die Hälfte der Bevölkerung auf Farmen oder in Kleinstädten gelebt; heute seien es kaum noch zwanzig Prozent. Vermont allerdings, dieser kleinste und zugleich »großartigste«, weil eigenwilligste der Neuenglandstaaten zwischen New Hamsphire, Hocki deutete nach hinten, und New York State, Hocki deutete nach vorn, bilde eine Ausnahme. Vermont sei immer der ländlichste Staat der USA gewesen und sei es immer noch. Abgesehen von seinem »verrosteten« Deutsch redete Hocki wie gedruckt, als halte er einen Vortrag.
»Du bist ja wirklich Amerikaner geworden«, sagte Carlsen. »Und ein Patriot dazu.«
»Patriot? Ich? No way.« Er lachte gemütlich. Aber Vermont gefalle ihm. Die Leute seien eigensinnig bis zum Separatismus. Ihr Nationalheld Ethan Allen habe seinerzeit gar nicht den USA beitreten wollen, sondern ein unabhängiges Vermont angestrebt. Hier sei es ruhig, und man ließe sich auch gegenseitig in Ruhe. Und wenn man Hilfe brauche, bekomme man Hilfe. Leben und leben lassen. Hier siedelten mehr Aussteiger und Althippies als sonst wo, Künstler und Lebenskünstler, Schwulenehen würden anerkannt und so weiter und so fort. Vermont sei im besten Sinn liberal. Vielleicht erinnere es ihn auch an seine Kindheit in Schleswig-Holstein, weil die Leute so bodenständig seien. »Weißt du, was das Wahrzeichen von Vermont ist? Nein?« Er machte eine Kunstpause. »Es ist eine Kuh. Das gefällt mir. Und so viel zu meinem Patriotismus.«
»Und was sagt dein Patriotismus zum Irak?«
»Zum Ir…, ähm, rechts ab, du musst hier rechts abbiegen, und da vorne an der Kirche können wir parken. Und zum Irak sagt mein Patriotismus nur Bullshit. Aber er sagt das nicht sehr laut, weil man es hier im Moment nicht so gern hört.«
Weiß gestrichene Holzhäuser mit überdachten Veranden standen dicht an dicht, gelegentlich auch ein Steinhaus oder eine steinerne Fassade, scharten sich um den weißen Holzbau der Congregational Church mit ihrem spitzen Holzturm.
Sie stellten den Wagen vor dem Postamt ab, gingen vorbei an der Bank of Vermont und Ben Franklin’s Store, einer Art Woolworth der Kleinstädte, wo man vom Dosenöffner bis zur Spaltaxt, vom Schneeschuh bis zur Bratpfanne alles bekomme, was man hierzulande zum Leben und Überleben brauche. Hocki deutete aufs Schaufenster des Vermont Book Store, wo er vor einigen Jahren mal eine Erstausgabe von Gedichten Robert Frosts aus dem Ramsch gerettet habe. Ob Carlsen eigentlich wisse, dass Robert Frost aus dieser Gegend stamme? Und das Kino auf der anderen Straßenseite, das Marquis Theatre, sei in den Sechzigerjahren modernisiert worden, leider, wirke mit seinem Plastikcharme heute aber schon wieder erfreulich antiquiert. Und drüben in Abraham’s Department Store, in dessen tapfer undekorierten Schaufenstern schon seit Jahren ein Schild den Totalausverkauf wegen Geschäftsaufgabe verkünde, sei die Zeit stehen geblieben; in fünfzig Jahren werde das Schild vermutlich immer noch hängen. »Ist das nicht großartig?«
Auch in Jodie’s Restaurant – Ice Cream and Soda Fountain, est. 1901, einem dämmerigen Raum mit langem Tresen und abgeteilten Tischnischen, schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Jedenfalls ging die Uhr mit Budweiser-Emblem auf dem Ziffernblatt eine halbe Stunde nach, und die dürre alte Dame, die die Speisekarten aufs grau gescheuerte Holz der Tischplatte legte, sei, flüsterte Hocki, schon ewig so klein, dürr und alt gewesen.
Carlsen bestellte Rührei mit Speck und Toast. Hocki, dessen Bauch gegen die Tischkante drückte, nahm ein Schinken-Käse-Omelette mit Bratkartoffeln, vier Würstchen und sechs Pfannkuchen, die in Ahornsirup schwammen. Die Liberalität Vermonts oder die Zeitenthobenheit von Jodie’s Restaurant kam auch darin zum Ausdruck, dass man im hinteren Teil noch rauchen durfte. Und während Carlsen sich eine Zigarette ansteckte, schwärmte Hocki noch eine Weile von der Großartigkeit des Kleinstädtischen, machte Carlsen dann auch ein paar Komplimente über seine Bücher, von denen er einige offenbar sehr genau gelesen hatte, und schließlich schwelgten beide in Erinnerungen an ihre gemeinsamen Hamburger Tage – was aus diesen Professoren geworden, wohin es jene Kommilitonen verweht und verschlagen habe.
Als Carlsen fragte, warum Hocki damals so sang- und klanglos verschwunden sei, grinste er breit. »Aus Liebe natürlich.« Aber das sei eine längere Geschichte, die er ein anderes Mal erzählen würde. Jetzt sei es Zeit, ihm das College zu zeigen. »Ich geb dir ’ne Tour durch die Fazilitäten und alles das.«
Das Institut für German Studies and Language war in Huddle Hall untergebracht, einem wuchtigen vierstöckigen Granitbau, kurz vor dem Ersten Weltkrieg errichtet, laut Marmortafel am Portal gestiftet von William H. Huddle, Collegeabsolvent des Jahrgangs 1880. Der habe seine Millionen mit Eisen und Stahl gemacht, Abkömmling deutscher Einwanderer von 1848 übrigens, und der von ihm gestiftete Klotz sei zwar weder das neueste noch das schönste Gebäude auf dem Campus, aber das mit der »absolut großartigsten Location«, da es sich auf dem Hügelkamm erhob, von dem man weite Teile des Geländes überblicken konnte. Vor dem Haupteingang grünte eine fußballfeldgroße Rasenfläche, auf der Bäume und Holzsessel standen.
»Adirondack Chairs«, erläuterte Hocki, »wenn nächste Woche das Semester läuft, sind die alle besetzt.«
Jenseits der Rasenfläche lagen zwischen Büschen und Bäumen weitere Gebäude. Linker Hand, im Stil eines französischen Landschlösschens, Le Chateau, das romanistische Institut. In der Mitte die Mathematiker, amerikanischer Kolonialstil mit Säulen und Gesimsen. Rechter Hand die Soziologen, Politologen und Philosophen in einem futuristischen Gebilde aus Stahl, Glas und Beton. Und alles Weitere werde Carlsen im Lauf der Zeit noch kennenlernen. Im Hintergrund ragten und wogten die grünen Berge, und darüber spannte der Spätsommer ein durchsichtiges Blau, durch das Schäfchenwolken segelten.
Die Büro- und Seminarräume des Instituts verteilten sich aufs Erdgeschoss und die erste Etage von Huddle Hall, während ein Souterrain und die oberen Stockwerke als Studentenwohnheim dienten, als Dormitory, also kurz Dorm. Auf den Fluren und Treppen war niemand zu sehen. Stille. Und auch hier Geruch nach Bohnerwachs.
Die Studenten und Professoren würden erst am Wochenende aus den Ferien zurückkehren, aber im Institutsbüro, laut Hocki »unserem Hauptquartier«, wurde Carlsen eine gewisse Ross, »Ross für Rosalynn«, vorgestellt, »unsere Seele«. Seele Ross hatte helmartig toupierte blonde Haare, blasslila geschminkte Lippen, war klein und korpulent. Eine Lesebrille baumelte vor ihrem enormen Busen, und an der Bluse in der Farbe ihres Lippenstifts trug sie eine Anstecknadel in Form der amerikanischen Flagge.
Seit dreißig Jahren, sagte Hocki fast ehrfürchtig, lange vor seiner Zeit also schon, erledige Ross ihren Job, und vor ihr habe eine Tante von ihr den Job erledigt, fast vierzig Jahre lang.
Ihre Familie stamme nämlich auch aus Deutschland, aus Bayern, erklärte Ross lächelnd, die Urgroßeltern Bachmüller seien ausgewandert, der Name sei irgendwann zu Backmiller anglisiert worden, aber die Zweisprachigkeit habe sich lange erhalten, weshalb Tante Alice Anfang der Vierzigerjahre den Job im College ergattert habe.
Ross erzählte das allerdings auf Englisch, und nachdem Hocki Carlsen in sein Büro geführt hatte, sagte er grinsend, dass Ross’ Zweisprachigkeit, wenn überhaupt, eher passiv als aktiv ausgeprägt sei.
Die Fenster des Direktorenzimmers wiesen nach Westen auf die Adirondacks. Die Sonnenuntergänge seien spektakulär, Caspar David Friedrich sei nichts dagegen, und wenn demnächst der Indian Summer ausbreche, böte sich ein überwältigender, um nicht zu sagen großartiger Farbenrausch. Und dahinten, Hocki tippte gegen die Scheibe, irgendwo hinter der Baumgruppe, jenseits des Flusses, liege das Haus, in dem Carlsen untergebracht sei. Ob es ihm gefalle? Das College habe im Lauf der Jahre einige der umliegenden Privathäuser aufgekauft, nutze sie zu allen möglichen Zwecken, zum Beispiel als Gästehaus, von wegen »großartiger Location« und »szenischem Blick«. Im Institut stehe Carlsen aus Platzmangel leider kein eigener Büroraum zur Verfügung, aber für seine Sprechstunden könne er eine der Lounges im Mehrzweckgebäude benutzen. Er zeigte auf einen lang gestreckten Holzbau mit tonnenartigem Kupferdach. »Da ist auch das Wichtigste drin«, grinste er, »nämlich die Mensa.«
Ross erschien an der offen stehenden Tür. Sie habe der Abteilung Human Resources in der Verwaltung Carlsens Ankunft gemeldet. Dort müsse er seine College-ID abholen und die üblichen Papiere unterschreiben.
Und zwar möglichst umgehend, ergänzte Hocki, da man ohne College-ID auf dem Campus kaum ein halber Mensch sei, quasi nicht existent. Er selbst müsse jetzt zu einer Gremiensitzung, habe übermorgen jedoch einen freien Tag, und er schlug vor, dann gemeinsam einen Ausflug in die Umgebung zu machen.
Das Verwaltungsgebäude kannte er bereits von seinem nächtlichen Besuch im Security-Büro. Im zweiten Stock residierte Human Resources. Carlsen fand die Bezeichnung »menschliche Rohstoffe« für eine Personalabteilung irgendwie bedenklich, wenn nicht gar unmenschlich, wurde jedoch mit aufgeräumter, burschikoser Höflichkeit empfangen und einer weiteren erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt, indem man ihn vor eine Leinwand komplimentierte und bat, recht freundlich (»Say cheese«) in eine Digitalkamera zu blicken. Der digital erfasste menschliche Rohstoff seines Gesichts erschien, verlegen lächelnd, auf einem Monitor und verwandelte sich dann als Foto in einen integralen Teil seiner College-ID, des Identitätsnachweises, den ein Drucker lautlos ausspuckte: ein kreditkartengroßes Stück Plastik mit Carlsens Konterfei, Namen, Geburtsdatum und dem Zusatz »Faculty«. Für die korrekte Verwendung der Karte und alle weiteren Notwendigkeiten des Campuslebens wurde ihm ein knallgelbes Merkheft ausgehändigt. »The CCCCG: The Complete Centerville College Campus Guide – Faculty Edition«. Weiterhin hatte er verschieden umfangreiche, bereits ausgefüllte Formblätter und Schriftsätze zu unterzeichnen, die seinen Steuerstatus, den Arbeitsvertrag und den Verzicht auf sämtliche Renten- oder Pensionsansprüche betrafen. Deutsche Bürokratie war ein lichter Hain gegen diesen Formaliendschungel, der aber in Form eines Vorschussschecks schließlich noch eine schöne Blüte trieb.
Der Toyota stand vor Huddle Hall auf einem Parkplatz mit dem Hinweisschild »Faculty Only«. Vor dem Wagen stand breitbeinig ein Mann in der Uniform von Campus Security und notierte sich das Kennzeichen. Was das nun wieder sollte? Carlsen war doch jetzt Faculty, konnte das kraft seiner Campus-ID sogar beweisen und war mithin befugt, hier zu parken. Er grüßte mit einem schüchternen »Hi« und schloss die Fahrertür auf.
»Ist das Ihr Wagen, Sir?« Die Betonung auf »Sir« klang streng bis unerbittlich.
»Ja. Ich meine, es ist ein Wagen des Colleges, aber …«
»Dieser Parkplatz ist nur für Fakultätsmitglieder, Sir.«
»Ich weiß. Ich bin, ich meine …« Statt weitere Erklärungen zu stammeln, hielt Carlsen ihm die College-ID vor die Nase. »Ich bin Fakultätsmitglied.«
»Der Wagen hat aber keine Registrierungsnummer, Sir.«
»Keine was?«
»Wenn Sie auf dem Campusgelände parken, müssen Sie den Wagen bei Campus Security registrieren lassen.«
»Oh, das wusste ich nicht.«
»Jetzt wissen Sie’s ja. Das Büro hat geöffnet. Also machen Sie’s lieber gleich. Sie müssen die Wagenpapiere vorlegen, Sir.«
Wagenpapiere hatte Hocki ihm nicht gegeben. »Papiere? Ich weiß gar nicht, ob ich … wo die …«
Der Security-Mensch klopfte mit den Handknöcheln gegen den oberen Rand der Frontscheibe. Wurde er jetzt ungeduldig? »Da sind sie doch«, sagte er.
»Was? Wo?«
»Die Papiere, Sir!« Wieder klopfte er gegen die Scheibe. »Hinter der Sonnenblende, Sir!«