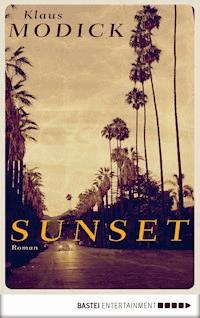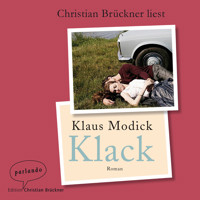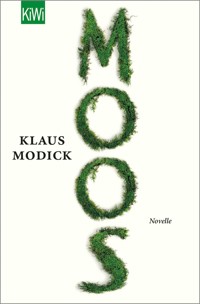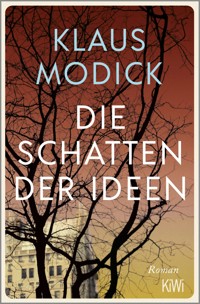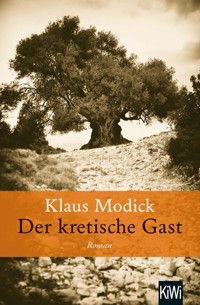8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Verliebt in die kleine Italienerin von nebenan – ein Roman aus dem Wirtschaftswunderland Die Agfa Clack hat alles dokumentiert: Bilder aus dem Jahr, in dem für den Bürgersohn Markus in der norddeutschen Provinz alles anders wurde – weil Clarissa aus Apulien in sein Leben trat. Klaus Modick erzählt unterhaltsam, detailgetreu und farbecht, wie es sich angefühlt hat, zwischen Mauerbau und Kubakrise verliebt zu sein. Markus hat es eigentlich gut. Auch seine Familie hat teil am westdeutschen Wirtschaftswunder, man kann sich wieder etwas gönnen, sogar ein Fernseher ist angeschafft worden – und doch hat er zu leiden: an der tyrannischen Großmutter, den immergleichen Kriegserzählungen des Vaters, den autoritären Lehrern am Gymnasium, vor allem aber an unerwiderten Gefühlen. Mit dem Auftauchen der Tinottis kommt Bewegung in sein Leben. Die italienische Familie zieht nebenan ein und eröffnet eine Eisdiele. Markus ist aber vor allem fasziniert von Clarissa. Während in Berlin die Mauer gebaut wird und seine Oma im Garten einen Zaun ziehen lässt, um vor den Spaghettifressern sicher zu sein, erprobt Markus Strategien der Annäherung und greift sogar zur Gitarre.Mit Lust am Detail, großer erzählerischer Kraft und viel Humor fängt Klaus Modick die Stimmung einer entscheidenden Phase der bundesdeutschen Geschichte ein. Im Westen geht es aufwärts, während der Osten sich einmauert, und plötzlich steht die Welt am atomaren Abgrund. Und mittendrin Markus, der sich nichts sehnlicher wünscht als den ersten Kuss, und der mit seiner Kamera die Momente festhält, die das Leben ausmachen. »Modick schreibt Literatur mit jener spezifischen Leichtigkeit, die in Deutschland einen schweren Stand hat.« Neue Zürcher Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Ähnliche
Klaus Modick
Klack
Roman
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Klaus Modick
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
»Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.«
Walter Ulbricht
»Oh nononono no!«
Rocco Granata
Agfa Clack
Im Westen ist die Luft wieder rein, ausgewaschen die bleierne Schwüle. Die regenschwere Schleppe des Sommergewitters zieht letzte Wolkenfetzen nach Osten. Verspätete Böen kräuseln die Pfützen, auf denen die Abendsonne glüht. Auf der Terrasse Tontrümmer, rostrote Scherben, handtellergroß und fingernagelklein. Der Sturm hat Ziegel vom Dach gerissen. Von unten ist nichts zu erkennen; erst auf dem Speicher zeigt sich der Schaden. Damit hier ein Dachdecker arbeiten kann, muss das Gerümpel unter der Schräge beiseitegeräumt werden – ramponierte Möbel, kaputte Koffer, Kisten und Kartons, die schon manchen Umzug mitgemacht haben, nie ausgepackt und selbst bei Sperrmüllabfuhren vergessen.
Durchs Loch im Dach ist Regenwasser eingedrungen, hat einen der mürben Kartons so durchweicht, dass er beim Verschieben auseinanderreißt. Bücher rutschen auf die Dielen, Algebra II, Der Lederstrumpf, Physik Mittelstufe, Der Schatz im Silbersee, Der Große Diercke Weltatlas und Der kleine Stowasser, eine Handvoll Reclamhefte, Der Schimmelreiter, Don Carlos, Die Judenbuche und Kleider machen Leute. Im Sonnenlicht, das durch die Luke fällt, tanzt Staub, riecht wie Kreide, wie Schule, und die dunklen Spalten zwischen den Fußbodendielen sind Linien in Schreibheften. Eine klamme Plastiktüte, Kaufhaus Kepa – Das Paradies der Dame, voll mit Muscheln und Kieselsteinen, brackig müffelnde Relikte heller Nordseesommer. Fußballschuhe ohne Schnürbänder, Grasreste schimmeln zwischen den Stollen. Fahrradflickzeug. Eine Wasserpistole aus rotem Plastik. Der Abzug klemmt. Verrostete Schlittschuhe. Schienenstücke einer Modelleisenbahn von Märklin. Ein kleiner Karton Leibniz-Keks nach alter Tradition in thermoplastischer Steifpackung konserviert zwei Faller-Häuschen, Stellwerk und alpenländischer Bergbauernhof. Eine Blechdose Globol tötet Motten und Mottenbrut, darin Bakelitpanzer, Plastiksoldaten, Wikingautos. Ein luftloser Lederfußball, in sich selbst versunken wie ein Schrumpfkopf aus Kannibalien. Noch eine Plastikpistole, in deren Innerem es klötert. Erbsen. Die Schulflure liegen voller Erbsen. Ein Lehrer sagt mit saurem Gesicht: Ihr wisst ja gar nicht, was Hunger ist, und Erbsenpistolen werden auf dem Schulgelände verboten. Zwei Tischtennisschläger mit abgeschabten Gumminoppen. Ein Schuhkarton Salamander Knabensandalen Hopps, zusammengehalten von brüchigen Einweckgummis. Hopps? Der grüne Frosch auf dem Kartondeckel, Lurchis bester Freund. Lurchi, der Feuersalamander, besteht mit seinen Freunden abstruse Abenteuer. Sie gehen glimpflich aus, weil Lurchi und seine Freunde unverwüstliche Salamanderschuhe tragen. Lange schallt’s im Walde noch – Salamander lebe hoch!
Bis eben hast du gar nicht gewusst, dass du so etwas noch weißt. Es fällt dir einfach zu, weil du nicht danach gesucht hast. Die Gummibänder zerbröseln beim Abstreifen unter den Fingern wie trockene Brotkrumen. Tief unten im Karton liegt ein hellbraunes Ding aus Weichkunststoff, und du weißt jetzt auch sofort, dass dies Ding die Bereitschaftstasche ist, ein Schonbezug wie die Schonbezüge aus Plastik auf den Autositzen, die Schondecken auf Tischen, die Schonkissen auf Sofas. Und immer noch birgt die Bereitschaftstasche die Kamera. Agfa Clack. Einlinsiges Objektiv. Rollfilm, Format 6×9. Clack, weil der Auslöser klackt, wenn man ihn drückt. Immer noch. Das Kunststoffgehäuse beklebt mit schwarzem Lederimitat. Die Narbung erinnert an Krokodil- oder Schlangenhaut, an Dschungelexpeditionen, Giftpfeile und Malaria, an die Fieberträume, in denen du herumirrst, als du im längst versunkenen Sommer mit Mumps im Bett liegst, umströmt vom herbsüßen Duft der Holunderbeeren. Er dringt aus der Küche, wo Mutter Marmelade kocht. Im Duft schwebt ihre Stimme durch den Halbschlaf. Sie singt.
Ramona, zum Abschied sag ich dir Goodbye,
Ramona, ein Jahr geht doch so schnell vorbei,
Ramona, denk jeden Tag einmal daran,
Ramona, dass nichts vergeht, was so begann.
Dann ist es wunderbar still. Geschirr klappert wie Hufschlag oder Kastagnetten. Dass nichts vergeht, was so begann. Dass nichts vergeht, nicht einmal der Holunderduft, dessen süße Bitterkeit das Aroma allen Erinnerns verströmt. Auch wenn wunderbarerweise keiner das Jahr kennt, droht doch der Weltuntergang, und Mauern werden gebaut, eine weit weg in Berlin, und auf der Gartengrenze zum Nachbarhaus eine andere. Und plötzlich weißt du, dass der wahre Sommer nicht der ist, den du gerade erlebst, nicht der, dessen Gewitterböe die Ziegel vom Dach gerissen hat, sondern der andere Sommer, in dem sich Holunderduft mit Fieberschweiß mischt und nebenan das dunkle Mädchen einzieht. Weißt du ihren Namen noch? Ramona? Zum Abschied sag ich dir Goodbye? Nein, nicht Ramona. Clarissa. Das weißt du genau. Du schreibst ja den Namen hundertfach aufs Löschpapier der Schulhefte und flüsterst ihn beim Einschlafen. Ja, Clarissa. Clarissa Tinotti aus Fasano. Sie steht vor der Landkarte, fährt mit der Fingerspitze den italienischen Stiefel abwärts und tippt am Absatz auf einen schwarzen Punkt. Da, sagt sie. Du siehst ihr über die Schulter, schmiegst dich wie unabsichtlich an ihren Rücken, riechst an ihrem schwarzen Haar, hoffst, dass sie deine Erektion nicht spürt, hoffst zugleich, sie möge sie spüren, und starrst auf den hell schimmernden, schmalen Nagel ihres Zeigefingers, der das Wort unterstreicht. Fasano, sagt sie, in Apulien.
Jahre später, du bist längst erwachsen und hast die Liebe erlebt, liest du in einem Buch den Satz, die wahren Lieben unseres Lebens seien die unerreichbaren, unerfüllten. Da musst du für einen flüchtigen Moment auch an Clarissa denken, streichst vielleicht sogar den Satz an, obwohl du zweifelst, ob er stimmt. Als du das Buch zurück ins Regal stellst zwischen all die anderen Bücher, verweht auch Clarissa wie all die anderen Lieben, wie eine Böe des Gewitters.
Aber nun fragst du dich plötzlich, ob das wahre Jahr, das so schnell vorbeigeht wie der Schlager, den deine Mutter in der Küche singt, vielleicht das Jahr ist, in dem du mit der Agfa Clack die schwarz-weißen Fotos machst, die mit grünem Weihnachtsband gebündelt im feuchten Karton liegen. Die Ränder sind leicht gebräunt, das Papier wellig, und die einstmals glänzenden Oberflächen abgestumpft, ermattet. Sie halten fest, was sich im Leben nicht wiederholen lässt. Indem du die Fotos wie ein Kartenspiel auffächerst, hat es den Anschein, als seien von Dingen und Menschen, die einmal real waren, Strahlen ausgegangen, die dich nun erreichen. Die Bilder dessen, was verschwunden ist, berühren dich wie das Licht eines Sterns, der durch Abwesenheit glänzt, als ob eine Nabelschnur des ungreifbaren Lichts den Blick mit den Bildern verbindet. Aber weil du die Fotos gemacht hast, bist du selbst nie im Bild, bleibst immer unsichtbar. Wie im Märchen.
Als hätten sie auch den Duft der Vergangenheit konserviert, riechst du an den Fotos. Verstockt und verschimmelt. In der ungelenken, wichtigtuerischen Handschrift des Vierzehn- oder Fünfzehnjährigen, der du damals warst, sind die Rückseiten beschriftet. Legenden – das, was zu lesen ist.
1Hanna. Ostermarkt
Unscharf. Verwackelt. Was soll das sein? Eine schräge Plattform. Senkrechtes Gestänge oder Gebälk. Und nackte Mädchenwaden. Der Faltenrock reicht eine Handbreit übers Knie. Eingerahmt von zwei Paar unten eng zulaufenden, schwarzen Hosenbeinen. Ostermarkt 1961? Dein erstes Foto. Unscharf, weil du noch nicht weißt, dass man an der Kamera die Entfernung einstellen muss. Der Hebel wird auf »weit« gestanden haben, während du so nah wie möglich heranwillst. Verwackelt, weil du beim Auslösen die Kamera verreißt und statt der Gesichter nur die Beine erwischst. Die nackten Mädchenwaden gehören zu Hanna, die Hosenbeine links und rechts zu zwei Halbstarken. Das Gebälk, an dem sie lehnen, ist das Geländer der Raupenbahn.
Klack.
In manchen Weinen schmeckt man nur, was man über sie weiß, aber manche Fotos erzählen Geschichten, die man ohne sie nicht mehr wüsste. Du wolltest deine große Schwester mit dem Foto erpressen. Und jetzt weißt du sogar, dass Hanna unter dem Faltenrock ihren rosa Petticoat angehabt haben muss.
Egal, ob gerade Ostern war, noch kommen würde oder schon vorbei war – der Ostermarkt fand jedes Jahr in der zweiten Aprilwoche statt und hieß Ostermarkt, weil er immer schon so geheißen hatte. Eine Duftwolke aus gebrannten Mandeln, Bratwurst, Zuckerwatte, Räucheraal, Schmalzkuchen und Türkischem Honig, gemischt mit Stimmengewirr, Lachen und Juchzen aus Karussells, Schiffschaukeln, Riesenrad, Achterbahn und Auto-Scootern.
Ich spielte mit dem blanken 5-Mark-Stück in meiner Hosentasche und überlegte, was ich mir dafür leisten konnte. Verlockend war alles außer dem Kinderkarussell, für das ich natürlich schon viel zu erwachsen war. Es stammte aus dem vorigen Jahrhundert. Oma behauptete, als Kind selber noch auf einem der Holzpferdchen gesessen zu haben, deren Farbenpracht längst abgestoßen und traurig verblichen war. Zu einer schrillen, klagenden Drehorgelmusik drehten sie sich seit Generationen immer im Kreis, als käme auf dieser Welt nichts Neues mehr.
Ich grinste altklug, stolz, kein Kind mehr zu sein, und schlenderte mit unbeholfener Lässigkeit zur Raupenbahn, die mich magisch anzog, weil ich für sie eigentlich noch zu jung war. In meinem Elternhaus galt die Raupenbahn als etwas Unanständiges, Verruchtes, dem Kinder aus gutem Hause nicht zu nahe kommen durften. Die Raupe war unmanierlich, gehörte sich einfach nicht. Dort standen beziehungsweise, wie meine Mutter sagte, lümmelten sich nämlich die Halbstarken herum. Die Jungs hatten Frisuren, die kraft üppigen Einsatzes von Pomade – Brisk! Und das Haar sitzt! – in der Stirn zu verwegenen Schmalztollen aufgetürmt waren und im Nacken zu schnittigen Entenschwänzen ausliefen, die wie Heckflossen amerikanischer Straßenkreuzer aussahen. Sie trugen Nietenhosen, aus deren Hintertasche der stets einsatzbereite Kamm ragte, messerspitz zulaufende Schuhe, Lederjacken oder Motorradjacken aus glänzendem Skai-Kunstleder oder knapp über der Hüfte sitzende Nylonblousons. Sie rauchten oder kauten Kaugummi, und manche klimperten mit den Schlüsseln ihrer Mopeds. Kurz: Sie strunzten. Die Mädchen hatten Pferdeschwänze, kesse Bubiköpfe oder mit Haarspray wetterfest gemachte seitliche Sechserlocken, trugen hautenge Pepitahosen oder Röcke, die durch Petticoats wie halb aufgespannte Regenschirme vom Körper abstanden.
So standen sie dann lässig ans Geländer gelehnt auf der runden Plattform der Raupenbahn, deren betuliche Geschwindigkeit und sanfte Berg-und-Tal-Führung wie ein weiteres Rummelrelikt aus Omas Zeiten wirkte. Wenn jedoch ein Hupsignal ertönte, wurden die Planen über den Wagen geschlossen, und was dann im Innern dieser fahrenden Liebeslauben vor sich ging, musste grob unanständig sein. Vermutlich ließen sich die heißen Bräute von ihren Brisk-Boyfriends küssen und womöglich sogar an den Busen fassen, bis dann wieder das Hupsignal warnte, das zügellose Treiben einzustellen. Wenn die Planen zurückgeklappt wurden, sah man höchstens noch ein paar züchtig Händchen haltende Paare und das eine oder andere errötete Mädchengesicht.
Ich sah dem Treiben mit entsagungsvollem Staunen zu. Unvorstellbar, dass es mir je gelingen würde, mit einer dieser süßen Bienen gemeinsam unter der Plane zu verschwinden, um ihr, um sie – einfach unvorstellbar. Mir mit ordentlichem, zur Seite gescheiteltem Fassonschnitt, ausrasiertem Nacken, Weißwandreifen über den Ohren und verspäteten Pubertätspickeln auf der Stirn, mir mit braun melierter, etwas zu kurzer Gabardinehose und beigem Anorak, mir mit Rixe-Fahrrad statt Kreidler Florett, mir mit dem einsamen 5-Mark-Stück in der Tasche, mir mit meinen kümmerlichen vierzehndreiviertel Jahren. Unvorstellbar. Heute Abend, im Schutz der als Raupenplane phantasierten Bettdecke, würde ich es mir vielleicht vorzustellen wagen, einhändig, lebensprall, doch zugleich enttäuschend.
Weil ich wusste, dass sich all das nicht gehörte und ich eigentlich auch gar nicht dazugehörte, drückte ich mich an den Rändern herum, mit einem Fuß auf der Plattform, dem anderen auf dem Schotter des Rummelplatzes. Und dann kam Hanna. Kam Arm in Arm und kichernd mit Sabine, ihrer besten Freundin. Hanna im per Petticoat glockig ausgestellten Faltenrock und halbärmeliger Nylonbluse, Sabine in roter Nietenhose und Rollkragenpulli, unter dem sich ihr BH abzeichnete. Ich wollte mich verdrücken, aber Hanna hatte mich schon entdeckt und hielt mich am Arm fest.
»Was machst du denn hier?«, schnappte sie und klang dabei wie meine Mutter. »Das ist nichts für kleine Jungs.«
Sabine gackerte.
»Nix«, sagte ich, »wollte nur mal –« Aber dann fiel mir ein, dass Hannas Erscheinen an der Raupe eigentlich noch viel ungehöriger, wenn nicht gar skandalöser war als meine demütige Randexistenz. Gab sie, die angehende Abiturientin, sich etwa mit Halbstarken ab? Mit Schmalztollenträgern, Entenschwanzproleten und ordinären Knatterprotzen, wie Oma die Mopedfahrer nannte? »Und was machst du hier?«, konterte ich also ihr Vonobenherab. »Wenn das Mutti und Vati wüssten! Au Backe!«
»Ich bin nur wegen der Musik hier«, sagte sie schnippisch, folgte Sabine auf die Plattform, drehte sich aber noch einmal zu mir um und giftete: »Zieh Leine!«
Das mit der Musik glaubte ich ihr sogar, weil auch mich die Musik mehr als alles andere zur Raupe zog. Die Mädchen ignorierten mich ja schnöde, lieferten nur eine Vorlage, ein feuchtes Traumbild; heute Abend würde es vielleicht Sabines spitzer BH sein. Und die strunzenden Knatterprotze hatten für mich nur ein verächtliches Grinsen übrig. Aber die Musik war echt. Den lässigen Jungs an der Raupe mochte der Schmalz aus den Tollen tropfen, aber was aus den Lautsprechern klöterte, hatte nichts mehr gemein mit den schmalzigen Schlagern aus dem Radio, die meine Mutter beim Bügeln oder Marmeladekochen inbrünstig mitsang. Sie schmolz dahin bei Drei weiße Birken von Monika & Peter, Schöner fremder Mann von Connie Francis, Mit 17 hat man noch Träume von Peggy March oder Ramona von den Blue Diamonds, während auf der Raupe Bill Haley, Chuck Berry, Buddy Holly, Ricky Nelson und Chubby Checker Töne anschlugen, die wild, aufsässig, aufreizend waren. Rock’n’Roll. Diese Negermusik war unmanierlicher Lärm, war jugendgefährdend, war Schmutz, Schund und Aufruhr. Gehörte sich nicht. Unerhört!
Der König der musikalischen Aufsässigkeit war Elvis Presley, dessen Hüftwackeln zu Unzucht animierte. Als er vor drei Jahren zur US-Armee eingezogen worden und als GI in Bremerhaven gelandet war, um die amerikanischen Besatzungstruppen zu verstärken, erregte das den Un-, wenn nicht gar Widerwillen meiner Mutter, die in Elvis nur den aasig lächelnden Verführer sah.
Mein Vater verstieg sich allerdings zu einer bemerkenswert tückischen Theorie. Er begrüße es durchaus, wenn solche Typen mit ihrer Hottentottenmusik den freien Westen infiltrierten und jeden Rest guten Geschmacks verhunzten. Denn dergleichen Lärm wirke wie eine Art akustischer Schutzwall gegen die Expansionsgelüste des Iwan. Der Russe an sich habe nämlich im Gegensatz zu diesen Schreihälsen Seele, wovon er, mein Vater, weiß Gott ein Lied singen könne, habe er doch während des Kriegs immer wieder gern und nicht ohne Ergriffenheit den tief empfundenen Gesängen russischer Gefangener gelauscht. Damit wolle er natürlich nichts gegen die Westalliierten gesagt haben, schon gar nicht gegen die Amerikaner. Die hätten nämlich inzwischen begriffen, dass nicht der Russe, sondern der Deutsche der bessere Verbündete war, und deshalb hätten die Amerikaner sich spätestens mit der Berliner Luftbrücke von Besatzern zu Beschützern gemausert. Und als solche machten sie auch durchaus anständige Musik. Er denke da etwa an Bill Ramseys Pigalle, schon irgendwie köstlich, oder Gus Backus mit seinem alten Häuptling der Indianer oder auch Billy Mo, dieser ja durchaus drollige Neger mit seinem Tirolerhut. Dergleichen habe Humor und Schmiss und gehe ins Ohr. Ansonsten sei Musik seinem eher naturwissenschaftlichen Naturell wesentlich fremd, und im Übrigen habe er von Krieg und Russen die Schnauze voll. Gestrichen. Und damit verlor er den Faden.
Und neulich erst hatte sogar meine Mutter ein Faible für Elvis Presley gezeigt, wenn auch unfreiwillig. Im Radio lief das Volkslied Muss i denn, das Elvis Presley am Ende seiner Dienstzeit als eine Art Abschiedsgruß an Good Old Germany aufgenommen hatte. »Muss i denn, muss i denn zum Städele hinaus«, trällerte meine Mutter beim Kartoffelschälen versonnen mit, »Städele hinaus, u-hund du mein Schatz bleibst hier«, und ließ sich sogar zu der Bemerkung hinreißen, der Sänger habe eine wunderbare Stimme. Samtweich.
»Ja, Mutti«, sagte Hanna triumphierend, »hat er auch. Das ist nämlich Elvis Presley.«
Worauf meine Mutter das Kartoffelschälmesser fallen ließ und sich die Hand vor den Mund schlug, als hätte man sie beim Absingen des Horst-Wessel-Lieds oder der Becher-Hymne ertappt.
Jedenfalls trollte ich mich von der Raupe und schlenderte mit düsteren Rachegelüsten für die Schmach, die Hanna mir zugefügt hatte, über den Ostermarkt. Mein 5-Mark-Stück investierte ich in »den atemberaubenden Nervenkitzel auf höchstem Niveau« namens Wilde Maus, eine Rostbratwurst mit Brötchen und Senf, zwei Karambolagetouren mit dem Auto-Scooter, das Round Up, in dem »Fliehkraft die Schwerkraft besiegt«, und zu guter Letzt in die Schwerelosigkeit des Kettenkarussells.
Vor einigen Tagen hatten die Russen eine Weltraumkapsel ins All geschossen, in der kein dressierter Hund mehr saß, sondern ein lebender Mensch. Sputnik! Juri Gagarin! Schon enorm, hatte mein Vater teils schockiert, teils respektvoll gemurmelt, aber doch auch bedenklich, weil der Iwan nun die Amerikaner überholt habe, obwohl die sich für ihre Raketen unseren großen Ingenieur Wernher von Braun »geangelt« hätten. Höchst bedenklich sogar. Und meine Mutter hatte gefragt, wo das bloß alles enden solle. Im Sputnik musste man sich wohl so ähnlich vorkommen wie im Kettenkarussell, nur dass ich nicht den ganzen Globus überblicken konnte, sondern nur den Ostermarkt, vorbeiwischende Kirchtürme, Fabrikschlote, Baumkronen und Dächer.
Danach hatte ich noch vier Groschen, mit denen keine weiteren Weltraumabenteuer finanzierbar waren. Was tun? Spardose? Für hungernde Negerkinder in Afrika spenden? Für 30 Pfennig am Kiosk ein jugendgefährdendes Piccolo-Heft kaufen? Sigurd, der ritterliche Held oder Nick, der Weltraumfahrer, der den Russen Lichtjahre voraus war? Galten als Schmutz und Schund wie die Musik an der Raupe. Sigurd war eine Art Elvis des Mittelalters. Am Kiosk gab es auch fotokünstlerische Magazine für Freikörperkultur, die mich noch mehr als Sigurd, Akim oder Nick interessierten. Aber mit solchen Sexbomben unter der Bettdecke mit Taschenlampe erwischt zu werden? Oh Mann. Für vier Groschen waren die auch gar nicht zu haben.
Dann vielleicht einfach mal in den Plastikblumentopf greifen, den mir eine verhärmte Frau in weißem Kittel unter die Nase hielt. Ein Los 30 Pfennig, fünf Lose eine Mark. Lotterien und Glücksspiele aller Art waren in unserer Familie verpönt. Unseriös.
Als Ausnahme galt allerdings die Fernsehlotterie, weil sie ihre Wurzeln in der Zeit der Berliner Blockade von 1948 hatte. Damals, so mein Vater, hätten nämlich die Rosinenbomber der Alliierten blasse, abgemagerte Kinder aus dem isolierten West-Berlin in den freien Westen ausgeflogen, damit die armen Gören dort ein paar erholsame Ferienwochen auf dem Lande unter dem Motto Ein Platz an der Sonne erleben konnten. Ich schloss daraus, dass in Berlin immer schlechtes Wetter war, und empfand ein ungeheures Glücksgefühl, im Westen zu wohnen. Akzeptabel waren auch Preisausschreiben, zumal meine Mutter einmal nach korrekter Ausfüllung eines Kreuzworträtsels und Einsendung des Lösungsworts Pantoffelheld einen original Teppichdackel der Firma Leifheit gewonnen hatte. Nach einigen Probeläufen erwies sich das stromlose Gerät zwar dem Staubsauger Moulinex als hoffnungslos unterlegen und wurde in die hinterste Ecke der Besenkammer verbannt, aber immerhin beziehungsweise, wie mein Vater anerkennend sagte, immerhinque: 4. bis 10. Preis!
Also drückte ich der Losverkäuferin, die so abgezehrt aussah, als sei auch sie mit einem Rosinenbomber aus Berlin evakuiert worden, drei Groschen in die Hand und griff beherzt in den Plastikblumentopf. Während ich das Los irgendwie feierlich aufriss, gab ich mich keinen übertriebenen Illusionen hin. Niete war die Regel, Trostpreis à la Luftballon oder Plastiktulpe die Ausnahme. Und nun aber das! Hauptgewinn! Freie Auswahl! Ich starrte der Losverkäuferin ungläubig ins graue Gesicht. Eine Märchenfee.
Wie in Trance näherte ich mich der Losbude, die natürlich keine Bude war, sondern ein Lkw-Anhänger, auf dem eine Regalwand mit den Gewinnen aufgebaut war. Über ein paar Holzstufen stieg ich auf die Ladefläche, die sich nun in eine glanzvolle Bühne verwandelte, auf der ich als Hauptdarsteller, wenn nicht gar König agierte. Der Losbudenchef hatte schwarze, mit Frisiercreme oder Wasser nach hinten gebügelte Haare und ein verwegenes Schnurrbärtchen. Er begrüßte mich mit Handschlag, nahm mir das Los aus der Hand, hielt es wie einen Pokal in die Höhe und brüllte dann durchs Gedröhn der Karussells und Fahrgeschäfte in sein Mikrofon: »Und schon wieder die freie Auswahl, Damen und Herren! Einfach sensationell! Hier gewinnt jedes dritte Los! Greifen Sie zu, kommen Sie ran! Zwingen Sie das Glück!«
Ich hatte das Gefühl, dass sämtliche Besucher des Ostermarkts ehrfürchtig, wenn nicht gar neidisch zu mir aufblickten.
»Treffen Sie Ihre Wahl, junger Mann«, trompetete der Herr der Gewinne.
Freie Auswahl also. Gar nicht so leicht. Das Teeservice für sechs Personen? Der Riesenteddybär, der brummen kann? Die Ritterrüstung mit Schwert? Der Schwarzwälder Schinken? Das Modelleisenbahnstartpaket von Fleischmann? Der japanische Kimono? Die Puppenstube mit Einbauküche? Das Edelstahlbesteck?
»Kommen Sie ran, Damen und Herren.«
Die elektrische Kaffeemühle? Das große Paket der Gesellschaftsspiele? Die Negerpuppe, die »Mama« sagt? Das Topfsortiment für den modernen E-Herd? Der Texasgurt mit zwei Westerncolts? Die hochmoderne Teflonpfanne? Und noch viel mehr!
»Jedes dritte Los gewinnt! Beim Hauptgewinn haben Sie die Wahl und wir die Qual!«
Meine Qual bestand allerdings darin, dass ich wieder einmal für die Hälfte zu jung und für die andere Hälfte schon zu alt war. Vor drei Jahren hätte ich noch den Texasgurt, vor zwei Jahren vielleicht die Fleischmann-Bahn gewählt. Aber jetzt? Mit Bestecken, Teeservice oder Teflonpfanne war gar nichts anzufangen; die konnte ich höchstens meiner Mutter zum Geburtstag schenken, aber es war ja mein Hauptgewinn. Ich sah mich unschlüssig um und stellte enttäuscht fest, dass das Publikum gar nicht mehr zu mir aufblickte. Schließlich erspähte ich zwischen einer Mama-Puppe und einem Kinderdreirad das Päckchen mit der Aufschrift Box 620 Agfa Clack. Obwohl ich mir noch nie einen gewünscht hatte, wusste ich plötzlich, dass mir ein Fotoapparat fehlte, zu meinem Glück fehlte, und zeigte darauf.
»Eine exquisite Wahl, junger Mann!« Der Losonkel drückte mir den Karton in die Hand. »Und schon wieder ein Hauptgewinn, Damen und Herren! Ein Fotoapparat von Agfa. Erstklassige Qualität. Ein Rollfilm ist bereits eingelegt. Sie brauchen nur noch abzudrücken. Schießen Sie los, junger Mann!« Und damit war ich entlassen.
»Schießen Sie los« fand ich irgendwie lustig, lustiger jedenfalls als das schnöde »Zieh Leine«, das Hanna mir nachgerufen hatte. Ob die immer noch an der Raupe stand? Sich in diesem Moment womöglich unter der geschlossenen Plane von einem Halbstarken abknutschen ließ? Wenn das unsere Eltern – Moment mal! Das ließ sich jetzt ja beweisen. Wenn ich sie mit so einem Entenschwanzboyfriend fotografieren würde, hätte ich sie auf ewig in der Hand. Ich packte die Kamera aus, warf den Karton in den Mülleimer einer Würstchenbude und pirschte in Richtung Raupe. Aus den Lautsprechern wummerte Runaway von Del Shannon. Das mochte ich.
Und siehe da, eingerahmt von zwei Knatterprotzen lehnten Hanna und Sabine am Geländer. Probehalber hielt ich mir den Sucher vors Auge und berührte den Auslöser, drückte aber noch nicht ab. Ich nahm sie vorerst nur ins Visier, und zwar genau so, wie Ricky Nelson als Revolverheld Colorado in Rio Bravo die Mörderbande beim Showdown ins Visier nahm. Zwar war John Wayne als Sheriff der Chef, aber Ricky Nelson war einer wie ich, blutjung, sträflich unterschätzt, brandgefährlich und lässiger als sämtliche Halbstarken an der Raupe. Ich machte noch ein paar Schritte vorwärts, die Kamera schussbereit vorm Auge. »Hallo Hanna, bitte recht freundlich!«
Sie drehte sich um, entdeckte mich aber gar nicht, sondern sah wie immer einfach über mich hinweg. Egal.
Klack!
Erst als ich ihr triumphierend mit der Kamera zuwinkte, sah sie mich, wusste aber wohl im ersten Moment gar nicht, was sie von diesem Auftritt halten sollte. Sie flüsterte Sabine etwas ins Ohr, Sabine gackerte albern vor sich hin, und ich machte mich mit meinem kostbaren Beweis auf den Heimweg. Hanna würde vor mir knien, mich anflehen, mir Lösegeld bieten. Dass das Foto missglückt und ohne Beweiskraft war, sondern lediglich bewies, dass mir jedes Talent zum Paparazzo abging, sollte sich erst später herausstellen.
2Schulenbergs
Ein Mann und eine Frau. Er trägt einen zusammengerollten Teppichläufer unter dem linken Arm, sie hält in der rechten Hand einen Putzeimer. Ihren linken Arm hat sie in der angewinkelten Beuge seines rechten eingehängt. Ein Ehepaar. Sie haben sich in Positur gestellt und lächeln in die Kamera.
Klack.
Das Ehepaar Schulenberg. Kinderlos. Die Aufnahme entsteht, als du, stolz über den Hauptgewinn, vom Ostermarkt nach Hause kommst. Ohne das Foto wären Schulenbergs nicht mehr präsent, nicht ihr Name und schon gar nicht ihr Aussehen. Der stämmige Herr Schulenberg im Blaumann, die schmale Frau in einem Haushaltskittel aus Dralon. Mitten in der Arbeit ein erzwungenes Lächeln.
Wie, fragst du dich, sind die Beziehungen zwischen Bildern und Leben, zwischen dem zum Foto gefrorenen Augenblick und dem, was wirklich geschehen ist?
Vor unserem Nachbarhaus, laut Oma der »Schandfleck des Viertels«, parkte ein Möbelwagen der Spedition Kraus. Zieh’n Sie ein – Zieh’n Sie aus – Stets zu Diensten Fa. Kraus. Familie Schulenberg zog endlich aus beziehungsweise um. Endlich nicht etwa, weil sie unangenehme Zeitgenossen oder streitsüchtige Nachbarn gewesen wären, sondern endlich, weil der Schandfleck einer ordentlichen deutschen Familie schlicht unzumutbar war.
Kurz vor dem Ersten Weltkrieg vom selben Architekten und im selben Stil erbaut wie unser Haus, war früher auch der Schandfleck ein gepflegtes Zweifamilienhaus gewesen. Im Zweiten Weltkrieg hatte die Gepflegtheit allerdings ein Ende mit Schrecken gefunden. Zwar war unser Viertel von Bombenangriffen verschont geblieben, aber in den allerletzten Kriegstagen hatte die Gauleitung unsere Stadt zur Festung erklärt, die bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen sei. Das wusste ich aus Erzählungen meines Opas, der damals 60 Jahre alt gewesen war und zum Volkssturm eingezogen wurde. Als kanadische Panzerdivisionen am Stadtrand auf ein Dutzend Hitlerjungen und eine Handvoll alter Männer mit Karabinern stießen, die sich ohne jede Gegenwehr ergaben – laut Oma die beste Entscheidung, die Opa in seinem Leben je getroffen habe, abgesehen mal von der Heirat mit ihr –, feuerten die Kanadier zum Zeichen ihrer Entschlossenheit wahllos ein paar Granaten in die Stadt. Eine halbe Stunde später erschien der Oberbürgermeister mit einer Ratsdelegation und erklärte kleinlaut die kampflose Übergabe. Dummerweise war eine der Granaten im Dach unseres Nachbarhauses eingeschlagen, hatte den Dachstuhl in Brand gesetzt, und bis das Feuer endlich gelöscht werden konnte, war auch die erste Etage zerstört. Halbwegs verschont blieb nur die Parterrewohnung.
Auch bei uns war eine Granate eingeschlagen oder genauer gesagt gelandet. Sie hatte nämlich nur ein Loch in die Wand gerissen und war dann im Wohnzimmer einfach liegen geblieben, ohne zu explodieren. Als ich etwa sechs Jahre alt war, erzählte mir Oma von dieser unerhörten Begebenheit des Glücks im Unglück. Teils gruselnd, teils staunend fragte ich, was passiert wäre, wenn die Granate doch explodiert wäre – worauf Oma knapp erwiderte, sie sei aber nicht explodiert. Und das klang so, als wollte sie sagen: Diese Granate wusste, was sich gehört.
Das von einer ungehörigen Granate demolierte Nachbarhaus hätte eigentlich abgerissen werden müssen, aber wegen der Wohnungsnot nach dem Krieg wurde über das unversehrt gebliebene Erdgeschoss einfach ein Flachdach gebaut, gedeckt mit Teerpappe. Seitdem sah die Jugendstilvilla aus Kaisers Zeiten wie ein verwahrloster Geräteschuppen aus. Das Pappdach war als Provisorium geplant, als Behelf, aber als das Haus nach dem Tod des Eigentümers an eine Erbengemeinschaft fiel, fühlte sich offenbar niemand mehr zuständig. Die Miete war an eine Anwaltskanzlei in Köln zu zahlen.
Familie Schulenberg, die nun, endlich, in eine neue Siedlung des sozialen Wohnungsbaus umzog, waren sogenannte Heimatvertriebene aus Ostpreußen. Ende Mai 1945 waren sie angekommen. Zu Fuß. Ihre gesamte Habe bestand aus dem, was sie am Leibe trugen, und zwei Rucksäcken. Im Rahmen der britischen Zwangsbewirtschaftung, laut Oma »auch so ein Unding«, hatte man ihnen die Halbruine zugewiesen, die sie sich anfangs noch mit einer vierköpfigen Familie aus Schlesien teilen mussten.
Wie der Schandfleck im Originalzustand ausgesehen hatte, konnte ich mir leicht vorstellen, da er fast baugleich mit unserem Haus gewesen sein sollte. Im Parterre wohnten Oma und Opa. Und im ersten Stock wohnten wir. Mein Vater hatte sich angeblich lange dagegen gesträubt, mit seinen Schwiegereltern unter einem Dach zu wohnen, aber was sollte man machen? Man sei ja froh gewesen, überhaupt ein Dach überm Kopf zu haben. Froh über ein paar Briketts oder einen Korb mit Torf. Froh über einen Kanten trocken Brot. Froh über ein Ei pro Monat. Froh über Lebensmittelkarten. Froh über Care-Pakete aus dem Schlaraffenland Amerika. Froh über dies und froh über das. Heilfroh! Bei dem Wort schreckte meine Mutter, die derlei Monologe schweigend abnickte, allerdings auf und sah meinen Vater dringlich an, was ihm entging. Man habe sich aber nie unterkriegen lassen. Niemals. Habe die Ärmel aufgekrempelt, zugepackt und aufgebaut. Werde sich auch jetzt nicht unterkriegen lassen. Schon gar nicht vom Iwan und seinen Atombomben. Obwohl der Russe an sich beziehungsweise mal rein menschlich gesehen – wir Kinder wüssten jedenfalls gar nicht, wie gut wir es hätten. Und dann riss der Faden auch wieder.
Anfangs waren unsere Wohnverhältnisse noch so beengt »wie auf einem Hausboot in Hongkong«, sagte Oma. Im Erdgeschoss wurden britische Besatzungsoffiziere einquartiert, die in Omas Augen zwar »höflich, sauber und korrekt« waren, deren Anwesenheit man aber nur mürrisch ertrug. Geladene Gäste waren das ja nicht gerade.
Immerhinque, sagte mein Vater, hätten sie uns vom Gröfaz befreit und beschützten uns jetzt vorm Iwan. Da dürfe man nicht wählerisch sein. Schließlich sei man nicht auf der Welt, um zu wählen, sondern um sich zu fügen. Das war so eine seiner Lebensweisheiten, zu denen meine Mutter stumm und verständnisinnig nickte.
Hanna und ich fanden die Tommies aber riesig nett, weil sie uns immer mal wieder einen Riegel Cadbury-Schokolade oder Kaugummi zusteckten, wenn wir sie mit Haudujudu begrüßten.
In der ersten Etage drängten sich Oma, Opa, wir vier sowie eine gewisse Frau Hübner, laut Oma »vom Schicksal doppelt gebeutelt«, weil sie sowohl eine »Kriegerwitwe« als auch eine »Ausgebombte« war. Und auf dem Dachboden gab es noch das sogenannte Juchhe, eine Mansardenkammer, in der in der guten alten Zeit das Hausmädchen untergebracht war. Dort hauste jetzt Herr Tabbert, der aber als Handelsvertreter für Kurzwaren häufig außer Haus war. Die zugige Kammer mit winzigem Waschbecken und per Vorhang abgeteilter Toilette, die nur mit einem Heizlüfter notdürftig zu erwärmen war, benutzte er nur an den Wochenenden, wenn er von seinen Touren zurückkam.
Als die Tommies Anfang der Fünfzigerjahre abrückten, nahmen sie Frau Hübner gleich mit. Die ausgebombte Kriegerwitwe hatte nämlich auch einen Hauptgewinn gelandet, indem sie sich in einen der britischen Offiziere verliebte, »ihn sich angelte«, wie meine Mutter sagte. Alle Jahre wieder bekamen wir zu Weihnachten eine Postkarte aus Bristol, wo Frau Hübner nun als Mrs McGill lebte, offenbar glücklich verheiratet und Mutter dreier Kinder. Oma und Opa waren wieder ins Parterre gezogen, und wir hatten die erste Etage endlich für uns.
Nur Herr Tabbert wohnte immer noch im Juchhe. Seine ersten Touren hatte er noch auf einem Fahrrad mit Hilfsmotor absolviert, war dann auf ein Motorrad umgestiegen und war seit einigen Jahren stolzer Besitzer eines roten VW-Käfers mit ovaler Heckscheibe. Wir bekamen den unauffälligen, zurückhaltenden Herrn Tabbert allerdings kaum zu Gesicht. Seine Anwesenheit am Wochenende teilte sich lediglich durchs gelegentliche Rauschen der Toilette über unseren Köpfen mit. Das sollte freilich bald ein ebenso geheimnisvolles wie überraschendes Ende finden.
Ich sah eine Weile dabei zu, wie Schulenbergs