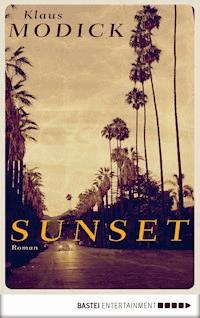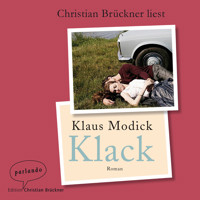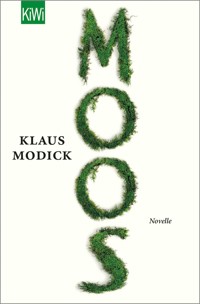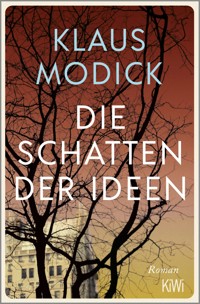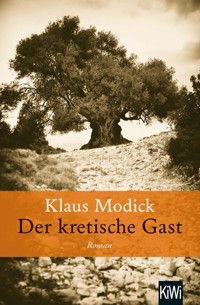9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Klaus Modicks Bestsellerroman über Eduard Graf von Keyserling. Sommer 1901 am Starnberger See. Lovis Corinth porträtiert Eduard Graf von Keyserling, Schriftsteller und Dandy aus baltischem Adel, den seine geheimnisumwitterte Vergangenheit einholt, als unvermutet eine durchreisende Sängerin erscheint. Handelt es sich womöglich um jene Frau, die ihn vor mehr als zwanzig Jahren in den Skandal verwickelte, der ihn zur Flucht nach Wien zwang und in Adelskreisen zur persona non grata werden ließ? Geistreich, einfühlsam, voller Witz und Verve spürt Klaus Modick den emotionalen und gesellschaftlichen Widersprüchen der Jahrhundertwende nach und erzählt davon, wie ein Außenseiter zu jenem brillanten Schriftsteller wurde, der den Zerfall der eigenen Klasse mit Melancholie und scharfsinniger Ironie beschrieb. »Ein ganz hinreißendes Buch. Bei mir geht das sogar so weit, dass ich inzwischen gar nicht mehr genau unterscheiden kann, was die wahre Biographie Keyserlings ist und was ich durch Modicks wirklich kongeniale Sprache für Keyserling halte.« Florian Illies, Bayern 2
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Ähnliche
Klaus Modick
Keyserlings Geheimnis
Roman
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Klaus Modick
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
»Wenn es so Korrekturbogen
– nicht wahr, so nennt man das? –
Korrekturbogen des Lebens gäbe –––«
Eduard von Keyserling
1
Indem er die lindgrüne Seidenschleife über dem blütenweißen Stehkragen bindet und die silberne Krawattennadel mit dem Saphirkopf einsteckt, lässt sich ein Blick in den Spiegel nicht vermeiden. Unter rau gewelltem rötlich-brünettem Haar und klarer Stirn stehen wässrig blaue Augen leicht vor, als müssten sie dem, was sie wahrnehmen, entgegenkommen, doch wegen ihrer milchigen Trübung scheinen sie zugleich nach innen gerichtet. Tiefe Höhlungen im bleichen Gesicht, die Wangenknochen kantig. Auf der darübergespannten gelben, faltigen Pergamenthaut zeigen sich scharf umgrenzte rostrote Flecken, durch Talkumpuder eher betont als kaschiert. Ein strohblonder, an den Spitzen aufgezwirbelter Schnurrbart und ein Kinnbärtchen rahmen schmollend geschürzte Lippen, deren Rot sich von der Blässe der Haut befremdlich abhebt, sodass sie wie geschminkt wirken.
Manchmal fragt er sich, wer eigentlich dieser Untote ist, der ihm da im Spiegel ins Auge blickt und hinter dem seine wahre Person immer unsichtbarer zu werden scheint. Zugegeben – das, was Frauen einen schönen Mann nennen, ist er nie gewesen, doch kam er sich so lange einigermaßen passabel vor, bis die Symptome zu wüten begannen. Im Gegensatz zur Tuberkulose, die als mondän und geradezu vornehm gilt, nur Aussterben könnte noch vornehmer sein, ist seine Krankheit eine Peinlichkeit, der grobe Nachweis moralischen Fehlverhaltens, das man taktvoll mit Schweigen ignoriert. Ihm aber ist seine Krankheit wie aufdringliche, schlechte Gesellschaft, ein ungebetener, gespenstischer Gast, der sich Macht über das Dasein seines Opfers, dessen Fühlen und Denken erschleicht. Weil dies Gespenst Lebensgefährte des Ichs werden will, flüchtet sich das Ich in Fantasien und Träume. Doch das Gespenst will auch dort eindringen, um alles hässlich, schmutzig und schmerzhaft zu machen. Und das Ich zieht sich immer weiter zurück in Kammern und Winkel, Gärten und Parks vergangener Tage, wo die Träume friedlich und klar und die Bilder der Erinnerung jung, hell und gesund sind. Aber vielleicht muss er den Spiegel bald nicht mehr fürchten, weil die Krankheit inzwischen auch seine Sehkraft schwächt, zusehends schwächt, denkt er und blinzelt dem schlottrigen Don Quixote im Spiegel melancholisch zu.
Vor einem Monat ist er sechsundvierzig Jahre alt geworden. Der vorzeitige Verfall macht ihn zu einer pittoresken Ruine, zur Inkarnation des zerfallenden Adels in den baufälligen Schlössern und Herrenhäusern seiner baltischen Heimat. Sowenig er seiner Krankheit entfliehen kann, sowenig kann er seiner Epoche entkommen, doch lässt sich immerhin mit ein wenig nachlässiger Eleganz und kultiviertem Geschmack den gröbsten Anmaßungen ihres Banausentums ausweichen. Er streicht die zerknitterten Schöße des chamoisfarbenen Leinenanzugs glatt und rückt das farblich mit der Krawattenschleife abgestimmte Einstecktuch zurecht. So mag es gehen: Kein Adonis, aber ein Graf, Dandy und Dichter, der sich seiner eigenen Unzeitgemäßheit bewusst und deshalb auch seiner Wirkung auf andere gewiss ist, der seinen Habitus verinnerlicht hat, par cœur, wie der Franzose sagt. Und niemand weiß besser als er, dass solches Selbstbewusstsein rein äußerlich ist. Intelligente Menschen hegen stets Zweifel an sich. Stil zu haben bedeutet eben auch, Skepsis gegenüber seiner Herkunft und seiner Person zu pflegen, mit der eigenen Wenigkeit ironisch umzugehen. Nur Idioten sind von sich selbst überzeugt.
»Edchen?« Zwischen Geschirrgeklapper ein halblauter Ruf durch die angelehnte Küchentür. Die Stimme seiner Schwester Henriette.
»Mhh –––?«
»Gehst du aus?« Die Stimme seiner Schwester Elise.
»Mhh, mhh.«
»Denk an das, was der Doktor gesagt hat.« Henriette jetzt.
»Ja, ja.« Der Arzt, denkt er, hat gesagt, dass die Nebenwirkungen der Quecksilbertherapie leider unvermeidlich seien. Aber das meinen seine Schwestern natürlich nicht.
Und wieder Elise: »Dass du dich mit dem Wermut zurückhalten sollst.«
»Ja doch.« Wenn nicht Wermut, sondern Portwein sein Lieblingsgetränk wäre, hätte der Doktor natürlich vom Portwein abgeraten.
Er zieht den Spazierstock aus dem Schirmständer neben dem Garderobenspiegel. Den Stock hat sein Vater ihm damals zum Abitur geschenkt. Auf dem Ebenholzschaft sitzt ein geschwungener massiver Silbergriff, auf dem sich, umgeben von Lotosblüten, eine unbekleidete Jugendstil-Nymphe rekelt.
Das sei der Handharem des Flaneurs, hat sein Vater lächelnd gesagt und dabei ein Auge zugekniffen.
Er klemmt sich den Spazierstock unter den linken Arm. »Mein Anzugchen ist verkrubbelt«, ruft er in Richtung Küchentür. »Müsste mal wieder geplättet werden.«
»Wie sollen wir ihn denn plätten, Edchen?«, ruft Henriette zurück.
»Solange du ihn anhast«, ergänzt Elise.
Er öffnet die Wohnungstür, murmelt »Ah so, nu ja, mh mh –––«, und lässt sie hinter sich ins Schloss fallen.
Durchs Treppenhausfenster fällt Sonne, glänzt auf dem Messing des Namenschilds. . Die verschnörkelte Fraktur missfällt ihm. So alt ist er doch noch gar nicht.
2
Der Sonnendunst eines Juninachmittags schimmert über der Stadt. Ein Himmel von blauer Seide, durch den weiße Schäfchenwolken flanieren und sich in den Atelierfenstern der Dachgeschosse spiegeln. Lässiges, hastloses Schlendern auf den Trottoirs, vorbei an Kunst- und Buchhandlungen, Damen- und Herrenausstattern, Antiquitätenläden, Cafés und Wirtshäusern. Eile, Erwerbsgier gar, spielen hier keine Rolle. Maler in von Farbklecksen dekorativ gesprenkelten Samtkitteln, die ihre Mieten schon mal mit Aquarellen begleichen. Erbschaften verzehrende, dem Schlendrian huldigende Lebenskünstler. Modelle der Kunstakademie und andere Mädchen mit unbedenklichen Sitten, die das Leben und die Liebe unbefangen nehmen und geben. Spinnerte Stifter schräger Religionen. Feuilletonisten mit lyrischen Ambitionen und Verbalanarchisten mit christlichem Sendungsbewusstsein. Genialische Musiker. Eifernde Lebensreformer, hagere Vegetarier und braun gebrannte Sonnenanbeter. Kosmogonische Erotiker und entlaufene, von Bildhauern, Dichtern oder verführerisch philosophierenden Sexualethikern umschwärmte höhere Töchter. Wild Gelockte, adrett Gescheitelte. Männer mit langen, zu Zöpfen gebundenen Haaren, Frauen mit männlichen Kurzhaarfrisuren. Samtkappen und breitkrempige Strohhüte, Schotten- und Baskenmützen, Jägerhüte mit Gamsbartschmuck, Hüte mit Blüten und Spitzen, mit Federn von Paradiesvögeln und afrikanischen Straußen. Einig ist man sich nur darin, dass jeder seine Aufmachung selbst bestimmt, geleitet von Eitelkeit, von Bequemlichkeit und manchmal sogar von Stilgefühl. Jede ist sich selbst die Schönste, jeder ist sich selbst der Größte. Ihren Auftritt, ihren Habitus und ihre Kleidung abweichend von der Norm so zu ziselieren, dass etwas Eigenes zu erkennen ist, lassen sich einige so viel Nachdenken kosten, dass darüber schon mancher Roman scheiterte, manch ein Bild ungemalt und die eine oder andere Symphonie unvollendet geblieben ist.
Keyserlings bedächtige, leicht schlurfende Schritte, synkopiert vom Takt des Spazierstocks auf dem Pflaster, harmonieren mit dem gelassenen Rhythmus, der das Schwabinger Lebensgefühl bestimmt. Er nickt vergnügt vor sich hin, fühlt sich wieder einmal in seiner Entscheidung bestätigt, hier seinen Wohnsitz genommen zu haben. Während der Italienreise vor zwei Jahren kamen ihm auch Florenz, Venedig oder Rom verlockend vor. Aber in Venedig müffelten die Kanäle allzu sehr nach Verfall, und Verfall kennt er schon zur Genüge. In Rom war es ihm zu heiß, und nachts zerstachen ihn Millionen Mücken. Und in Florenz hat ihm ein Dieb die Börse aus der Tasche gezogen. Bella Italia, schön und gut, aber München ist ihm gemäßer. Er schreibt ja Deutsch. Seine Romane und Geschichten brauchen deutsche Leser, seine Stücke deutsches Theater und Publikum.
Und Schwabing, diese Hauptstadt des Schlawinertums, passt ihm wie ein maßgeschneiderter Anzug. Schnell hat er Anschluss gefunden. Ein waschechter baltischer Graf und russischer Staatsbürger, der eines Tages wie aus dem Nichts auftaucht! Dazu ein veritabler Poet, dessen Drama Ein Frühlingsopfer im vergangenen Jahr auch in München für einiges Aufsehen gesorgt hat. Dass er lieber ein Leben im Geistesadel der Bohemiens und Schlawiner führt, statt seine Güter und Schlösser in Kurland zu verwalten, setzt allem die Krone auf und macht ihn zu einer stillen Attraktion. Märchenhaft reich ist er zwar nicht, aber lieber bescheiden und vornehm als einer der eitlen Parvenüs, die sich in den Cafés der Boheme anbiedern, indem sie sich noch karnevalesker kostümieren als die Maler und Dichter. Er hat es nicht nötig, sich als Künstler zu verkleiden – er inszeniert sich nicht. Ihm reicht es, ein höflicher, stilbewusster, geistreicher Mensch zu sein. Man sucht seine Nähe. Wem er das Du anbietet, fühlt sich geadelt.
Zwei seiner Schwestern führen ihm den Haushalt und engagieren sich ansonsten für die Missionierung der Heiden in den Kolonien. Doch über seine Vergangenheit weiß man wenig. In der Bodega hat er einmal eine allzu neugierige Schauspielerin mit den Worten abblitzen lassen, ein anständiger Mensch behalte neun Zehntel von dem, was er erlebt habe, was ihm durch den Kopf gehe oder ins Herz greife, für sich. Weil man ja schließlich niemanden langweilen oder verletzen wolle. Diese elegante Diskretion ist auch eine Diskretion in eigener Sache. Könnte sie nicht auf Abgründe hindeuten, auf Fehltritte, auf Peinlichkeiten, auf Verschwiegenes und Skandalöses? Es kursieren allerlei Gerüchte.
Seine Contenance ist mit Witz gewürzt. Im Café Stefanie hat ihn erst neulich der junge Sezessionsmaler Albert Weisgerber angesprochen: »Ach, Herr Graf, ich würde Sie zu gern porträtieren. Sie haben solch eine blödsinnig noble Haut, ganz wie zerknittertes Papier.«
»Nu, nu, Jungchen«, hat er da schmunzelnd geantwortet, »dann malen Sie doch lieber gleich die Münchner Neuesten Nachrichten von vorgestern.«
Er öffnet die Schwingtür zum Salon Georg Loibl – Herrenfriseur und Barbier, und die Türschelle begrüßt ihn, ta-ta-ta-taaa, mit den ersten vier Tönen von Beethovens Fünfter. Es riecht nach Eau de Cologne, nach frisch gewaschenen Leinenmänteln und Handtüchern, durchzogen von zartem Zigarettenrauch Sultan flor – Cigarettes des Princesses égyptiennes.
Herr Georg Loibl, Träger einer künstlerisch wallenden, dezent auftoupierten Haarkreation, die manche für eine Perücke halten, wieselt höchstpersönlich auf ihn zu, vollführt einen etwas zu tiefen Bückling. »Grüß Gott, der Herr Graf. Das Übliche?«
»Natürlich. Und lassen Sie doch endlich mal den Graf beiseite.«
»Sehr wohl, Herr Graf.«
Loibl komplimentiert ihn zum Frisiersessel vor einem Kristallspiegel, bindet ihm eine Krepppapierkrause um den Hals, wirft mit genialischer Geste den blütenweißen Umhang um seinen Oberkörper. Nun, denkt Keyserling, sieht er endgültig aus wie eine aufgewärmte Leiche. Loibl schlägt mit dem Pinsel in einer Porzellanschale Seifenschaum und sieht ihn dabei im Spiegel fragend an, als wartete er auf sein Stichwort.
Keyserling weiß, was Loibl hören will, und nickt. »Nur zu, Maestro, walten Sie Ihres Amtes.«
Loibl liebt es nämlich, als Maestro tituliert zu werden. Und solange der Herr Graf den Loibl Maestro nennt, solange wird der Loibl den Herrn nicht vom Grafen trennen.
Er legt den Kopf in den Nacken, als Loibl ihm nun die Wangen einseift, das Rasiermesser über den Riemen streicht und mit sicherer, fast zärtlicher Hand über die Haut zieht. Im Spiegel schielt er zum Kassentresen mit den Parfüms, Kämmen, Tinkturen, Bürsten, Pomaden, Wässerchen. Hier sitzt sonst immer dies entzückend junge, blond gelockte Mädchen, aber heute ist ihr Stuhl leer. Manchmal hat er sie heimlich und entsagungsvoll im Spiegel gemustert und dabei albern-kitschige Dinge gedacht wie etwa: »Dich wird wohl bald ein schneidiger Leutnant verführen, du Wunderschöne. Oder ein Fürst.« Einmal hat sie seinen Blick aufgefangen, hat ihn ertappt und den Blick so erwidert, als wollte sie sagen: »Sieh mich nicht so an, du armer hässlicher Alter. Vor mir liegt das Leben, das Leben und die Liebe. Weil ich schön bin. Weil ich jung bin. Weißt du das nicht?«
Er weiß es. Sein Freund Max Halbe, mit dem er sich nachher treffen wird, hat vor einigen Jahren ein Stück geschrieben, das ihm viel Ruhm und noch mehr Geld einbrachte. Ein Geniestreich mit dem unverschämt schlauen Titel Jugend. Warum Jugend so ein großes Thema ist? Weil jeder sie kennt. Und weil sie vergeht. Weil es nicht von Dauer ist, könnte auch Glück so ein Thema sein – nur dass, leider, nicht jeder das Glück kennt.
Loibl tupft ihm die Schaumreste aus dem Gesicht, klopft ihm sanft Rasierwasser auf Wangen und Hals.
»Sagen Sie mal, Maestro, wo ist denn die süße Mamsell abgeblieben, die da hinterm Tresen residierte? War ja ’ne wahre Zierde des Hauses.«
»Die Resi? Die hat geheiratet.«
»Ach was?«
»Ja, den Schorsch, den Sohn vom Huber, vom Metzgermeister –––«
Wie schade, denkt er, sagt aber nur: »Ach!«
Und so dreht Maestro Loibl heute höchstpersönlich die Kassenkurbel, bedankt sich tief dienernd fürs großzügig aufgerundete Entgelt. »Servus, Herr Graf!«
Ta-ta-ta-taaa –––
Wenige Schritte weiter hält er vor dem Schaufenster der Buchhandlung Goltz, zieht das Pince-nez aus der Anzugtasche, klemmt es sich auf die Nase und betrachtet die Auslage. Wenn das so weitergeht, wird er bald eine Lupe brauchen. Der Augenarzt spricht zwar, dezent, wie er ist, nicht von schleichender Erblindung, vermeidet jedoch auch jede optimistische Prognose. Bedauerlicherweise sei das Nachlassen der Sehschärfe ein typisches Symptom der Krankheit, des Grundübels sozusagen, vielleicht auch eine Nebenwirkung des Quecksilbers.
Wem also gönnt der kluge Herr Goltz derzeit einen Platz in der Ehrenloge seines Schaufensters?
Götzen-Dämmerung, Jenseits von Gut und Böse. Kein Buchladen, der etwas auf sich hält, kann heutzutage auf Nietzsche verzichten. Vor einem Jahr ist der Philosoph gestorben, geistig umnachtet, wie man das so nennt. War ja ein Leidensgenosse. Hoffentlich endet er nicht selbst in solch radikaler Finsternis, erblindet und umnachtet.
Sigmund Freud, Die Traumdeutung, sieh an. Davon hat sein Freund Peter Altenberg erzählt, als er neulich in München vorbeischaute. Er verstehe ja nichts von Psychologie, weil er nur ein kleiner Schreiberling sei, aber dieser Freud sei unbedingt beachtenswert.
Effi Briest. Das hätte er gern selbst geschrieben. Schade, dass er diesem Fontane nie persönlich begegnet ist. Mit dem hätte er sich verstanden. Daneben Paul Bourget. Oscar Wildes Bildnis des Dorian Gray, das Lieblingsbuch aller Ästheten und Urninge. Niels Lyhne von Jens Peter Jacobsen, das Lieblingsbuch aller Feinsinnig-Dekadenten – zum Leben zu schwach und zu wach zum Sterben.
Stapelweise Ibsen.
Der Teppich des Lebens, Gott, ja, Stefan George, der es mit der Dichterselbstdarstellung auf die Spitze treibt. Im Fasching ist er als Dante aufgetreten, darunter tut er es nicht. Wie Dante sieht er aber gar nicht aus, sondern nur wie eine alte Tante, die wie Dante aussieht. Seine Berufsbekleidung besteht aus schwarzer hochgeschlossener Weste mit schwarzem Krawattentuch und dünner Halskette aus Silber, die in einer Westentasche endet. Das gehört zu Georges Weihe und Selbstfeier.
»Weihenstefan« hat ihn Franziska zu Reventlow deshalb genannt. Die spitzzüngige Gräfin, weder verwandt noch verschwägert mit den Keyserlings, gehört unter all den Betriebsnudeln, Wichtigtuern und Möchtegernkünstlern zu den Umtriebigsten. Geschrieben hat sie so gut wie nichts, scheint aber über bemerkenswerte Talente anderer Natur zu verfügen, ist sie doch in ständig wechselnder Herrenbegleitung überall dabei und immer mittendrin. Keyserlings bescheidener Meinung nach gibt es gar nicht zu viele Künstler, sondern nur zu viele, die sich dafür halten, nicht zu viele Schriftsteller, nicht einmal in Schwabing, sondern nur zu viele Leute, die schreiben.
Im Schaufenster prangt natürlich auch Das Schweigen im Walde, zwei stattliche Leinenbände. Ludwig Ganghofer ist hierzulande der literarische Platzhirsch. Eigentlich ist dieser urbayerische Heimatdichter sehr sympathisch, ein ehrlicher, rechtschaffener Mensch und solider Erzähler, der jedoch zu oft in den Schmalztopf langt und zu tief ins Kitschglas schaut. Wenn man schon seine Herkunft und seine Heimat zum Thema macht, muss man die Sache kälter anpacken, distanzierter, ironischer. Keyserling hegt da durchaus ein paar Ideen. Je ferner ihm Kurland rückt, desto klarer prägen Motive, Stoffe und Themen sich aus, wie ja auch die Farben der Erinnerung umso heller zu leuchten scheinen, je trüber sein Augenlicht wird.
Er öffnet die Ladentür. Vor den Regalen und Verkaufstischen blättern ein paar Herren in Zeitschriften, einige Damen in Büchern. Wenn man sieht, was die Verlage heutzutage alles publizieren, muss einem angesichts dessen, was sie ablehnen, übel werden.
Herr Goltz, der Buchhändler, ein asketisch wirkender, schmaler Mensch mit hoher Denkerstirn, der Bücher nicht nur verkauft, sondern auch liest und dabei einen höchst kultivierten Geschmack beweist, eilt auf Keyserling zu und begrüßt ihn per Handschlag. Poeten, Romanciers, Dramatiker sind seine liebsten Kunden, auch wenn manche auf ihrem Eilmarsch in die Unsterblichkeit den Laden lediglich aufsuchen, um zu kontrollieren, ob die eigenen Werke sichtbar ausliegen. Und wenn sie feststellen, dass ihr jüngster Geniestreich nur als schmaler Rücken ins Regal gezwängt ist, ziehen sie, wenn niemand hinschaut, das Buch heraus und legen es neben die Stapel der Erfolgreichen. Goltz lässt sie schmunzelnd gewähren, weil die Anwesenheit armer Poeten zahlungskräftige Kundschaft anlockt.
Keyserling gehört allerdings zur seltenen Sorte von Dichtern, die sich Werke der Kollegen nicht nur von den Kollegen schenken lassen, sondern auch Bücher kaufen. Denn bei den geschenkten und höchstpersönlich zugeeigneten Werken handelt es sich leider nicht immer um solche, die man gern lesen würde. Bestellt hat er diesmal Herman Bangs Roman Hoffnungslose Geschlechter, weil ihn der Titel ansprach.
»Übrigens«, sagt Goltz, »hat sich vor einigen Tagen eine Dame nach einem Roman von Ihnen erkundigt. Wie Sie wissen, habe ich stets ein paar Exemplare von Die dritte Stiege auf Lager.« Das magere Gesicht des Herrn Goltz zieht sich kummervoll in die Länge. »Ein so schönes Buch, und kaum wird es nachgefragt. Leider, leider.«
»Nun wurde es ja offenbar doch einmal nachgefragt«, sagt Keyserling lächelnd.
»Ja, beziehungsweise nein«, stottert Goltz. »Die Kundin meinte nicht Die dritte Stiege, sondern einen anderen Roman, den Sie angeblich verfasst haben sollen. Den genauen Titel wusste sie nicht. Rosarote Herzen oder so ähnlich. Aber da habe ich natürlich gleich gesagt, das klinge doch sehr nach Dienstmädchenroman und Gartenlaube, und derlei Trivialitäten kämen dem Grafen Keyserling nie aus der Feder.«
Keyserling zögert einen Moment. Wenn sogar Goltz nichts von dem Buch weiß, dann muss es tatsächlich restlos vergessen sein. Eigentlich schade. So übel war es dann doch nicht.
»Der Roman heißt Fräulein Rosa Herz«, sagt er schließlich so leise zu Goltz, als vertraue er ihm ein Geheimnis an. »Eine Jugendsünde, wenn Sie so wollen. Habe ich zu meiner Wiener Zeit geschrieben. Erschienen 1887 bei Heinrich Minden in Dresden und Leipzig. Ist inzwischen aber derart gründlich vergriffen, wie’s gründlicher gar nicht geht.«
»Da schau her«, staunt Goltz.
Und Keyserling lässt es damit bewenden. Dichtung, denkt er, ist eine schöne Sache, aber die Wahrheit, die schnöde Wirklichkeit, die den Roman damals anregte und an der er schließlich wieder zerschellte, erwies sich als weniger schön.
»Und was empfehlen Sie mir heute, lieber Herr Goltz?«
Der Buchhändler greift zu einem Band der Collection Fischer. Auf dem Umschlag ist eine lesende Dame abgebildet. Und der Preis von zwei Mark. Der kleine Herr Friedemann.
Keyserling zuckt mit den Schultern. »Thomas Mann? Sagt mir nichts.«
»Es handelt sich um den jüngeren Bruder von Heinrich Mann«, erklärt Goltz. »Sie wissen schon, Im Schlaraffenland.«
»Richtig, ja, köstlich. Ätzende Satire. Hat mich schärfstens amüsiert. Die Literaturkritik war natürlich eher negativ.«
Goltz winkt ab. »Die üble Laune«, sagt er, »ist die Mutter der Literaturkritik, das Lob ein Stiefkind.«
»Sehr wahr, lieber Goltz, leider, leider.« Keyserling nickt nachdenklich. »Manche Kritiker nehmen Bücher doch nur zur Hand, um sich zu ärgern. Da könnte man manchmal fast den Eindruck gewinnen, Kritik sei Besserwisserei derjenigen, denen es an Talent fehlt, über die Leistung derer, die Talent haben.«
»Auch das ist nur allzu wahr«, seufzt Goltz. »Doch sei dem, wie dem wolle, der kleine Bruder, dieser Thomas Mann, meine ich, hat durchaus Talent.«
»Na, wenn Sie’s sagen, lieber Herr Goltz, riskier ich das mal. Die Debütrakete von heute erweist sich aber oft als der Rohrkrepierer von morgen, der neue helle Stern am Firmament der Literatur als bloße Schnuppe. Deswegen schrumpfen in den Literaturgeschichten ja auch nicht die ersten Kapitel, sondern immer die letzten. Aber für zwei Mark –––«
3
Dank des sensationellen Erfolgs seines Stücks Jugend ist Max Halbe aus den Niederungen mäßiger Bekanntheit schlagartig in den Olymp der Hochprominenz aufgestiegen. Unter den zahllosen Schwabinger Cliquen und Zirkeln ist sein Stammtisch im Café Leopold zur allerersten Adresse avanciert. Künstler und Künstlerdarsteller, Schauspielerinnen und junge Damen, die gern welche wären oder so aussehen, als wären sie es, Musiker und Verleger – alle Welt inklusive Halbwelt sucht Anschluss an den Halbe-Kreis, den diejenigen, denen der Zutritt verwehrt bleibt, neidvoll als Kreis der Halbgaren bezeichnen.
Man tagt oft bis in die Morgenstunden in Tabakwolken und Bierdunst, schwelgt in Würsten, Haxen und Sauerkraut, redet, diskutiert, mit jedem Glas selbstvergessener und zugleich von sich selbst begeisterter. Der eine erzählt, was ihm wieder alles gelungen ist, von seinen Triumphen, der andere, warum es ihm wieder mal nicht gelungen ist, von seinen Krisen, der Dritte, wie er es gern gehabt hätte, von seinen Wünschen, der Vierte fantasiert von seinen sexuellen Sehnsüchten, der Fünfte prahlt mit seinen erotischen Eroberungen, der Sechste bejammert die x-te Enttäuschung seines Lebens. So reden sie miteinander und aneinander vorbei, fallen sich gegenseitig ins Wort, als wäre endlich der Moment gekommen, da genau dieses Wort ausgesprochen werden müsste.
Halbe ist von seiner Bedeutung so überzeugt und in seinen Erfolg so verliebt, dass er immer langweiliger wird. Er zitiert sich am liebsten selbst, suhlt sich in seinen eigenen Worten wie in einem Dampfbad. Keyserling findet zwar Skeptiker und Zweifler grundsätzlich anregender, hält seinem Freund Halbe aber zugute, dass er sich zumindest nicht am Mummenschanz des Schlawinertums beteiligt. Im dreiteiligen Anzug, die massive Uhrkette über der Weste, auf der Nase den Kneifer und unter der Nase den gepflegten Schnauzbart, sieht Halbe eher wie ein Gymnasialprofessor aus, und zwar umso mehr, als er stets seine neuesten Manuskripte in einer korrekten Aktentasche mit sich herumträgt, um, gefragt oder ungefragt, jederzeit daraus vortragen zu können. Halbe ist ein Gemütsmensch, ein Vermittler, ist generös und jovial und ein wenig hölzern, versprüht keinen Humor, hat aber Sinn für den Humor anderer Leute und weiß deren Witz zu schätzen. Eigentlich, hat Keyserling sich einmal notiert, würde das Mäxchen ein besseres Publikum abgeben als einen Dichter.
Dennoch, vielleicht auch gerade deshalb, sind sie Freunde, und außerdem ist Keyserling in Halbes Frau Louise verliebt, ein ganz kleines bisschen natürlich nur, streng platonisch und ganz im Geheimen. Denn Louise ist nicht nur hübsch, jung und gesund, sondern auch erfreulich unkompliziert, nicht durch Tradition, Konvention und starres Reglement verzogen wie die adligen Fräuleins und Damen, deren Kreisen Keyserling entlaufen ist. Er glaubt zudem, dass gescheite, mutterwitzige Frauen wie Louise gut schreiben könnten, wenn sie einfach mutig drauflosschreiben würden, weshalb er ihr einmal einen in Leder gebundenen Blindband mit der goldgeprägten Titel-Inschrift Tagebuch einer Realistin geschenkt hat.
An diesem Abend hat Halbe nur seinen engsten Freundeskreis einbestellt, ausdrücklich nicht ins Café Leopold,sondern in die Dichtelei, um dort, quasi als geheime Kommandosache, eine gemeinsame Sommerfrische zu verkünden. Zu Halbes besten Freunden zählen außer Keyserling der Verleger Korfiz Holm nebst Gattin Annie und der Maler Lovis Corinth, im Schlepptau seine neueste Errungenschaft: Charlotte Berend, Malschülerin und Muse, aktuelles Lieblingsmodell und künftige Ehefrau in Personalunion. Er nennt sie, merkwürdig genug, »das Petermannchen«.
Halbe und Holm, Keyserling und Corinth fühlen sich von ihrer gesellschaftlichen und regionalen Herkunft her verwandt, kommen sie doch alle aus östlichen Regionen. Halbes Familie besitzt ein Landgut bei Danzig, Corinth stammt von einem Gutshof in Ostpreußen und Holm, wie Keyserling Baltendeutscher, aus dem Rigaer Großbürgertum. Diese vier Männer verstehen sich nicht zuletzt deshalb so prächtig, weil sie eine gemeinsame Mundart sprechen. Wenn sie als Landsleute im freiwilligen bayerischen Exil zusammensitzen, werden Kinder zu Bambusen oder Ruscheldupsen, die Mädchen zu Marjellchen; aus dem Schwätzer wird das Blubbermaul, aus dem Geizhals der Gniefke. Nach der zweiten Flasche Wein werden noch die grandiosesten Begriffe niedlich, Masurens endlose Wälder schrumpfen zu Wäldchen, und sogar der Herrgott wird zu Gottchen diminuiert. Stets gibt es viel Gejuchze und Gejacher, wenn Mäxchen und Edchen, Korfizchen und Lovischen bis in die Morgendämmerung, die sie Uhlenflucht nennen, zechen und vertellcherken.
Die Runde sitzt bereits beisammen, als Keyserling in der Dichtelei eintrifft, die Freunde begrüßt, die Damen mit charmantem Handkuss, eine Geste, die er aus seinen Wiener Jahren mitgebracht hat. Er nimmt Platz und bestellt Whisky Soda, trinkt ihn schnell, schüttelt sich wie angeekelt und bestellt gleich einen zweiten, was nicht nur gegen seine Gewohnheit, sondern fast schon gegen seine Natur ist, hält er sich doch üblicherweise an Wermut oder Rotwein. Er erntet entsprechend fragende Blicke und hochgezogene Augenbrauen.
»Mein Arzt behauptet«, sagt er fast entschuldigend, »dass ich Wermut und Wein nicht vertrage. Einen kleinen Whisky hat er mir aber gestattet.«
Holm schmunzelt. »Wenigstens ist dein Arzt kein Antialkoholiker.«
»Im Gegenteil. Der säuft ja selbst! Unbegreiflich, der Mensch. Nee, nee, nee, ausgerechnet Whisky. Da komm ich einfach nicht auf den Genuss. Schmeckt wie Odol! Nach dieser Selbstgeißelung hab ich mir was Besseres verdient.« Er winkt der Wirtin zu. »Kathi, bring mir einen Wermut! Kann ruhig schnell gehen.«
Gelächter in der Runde.
Nach dem ersten Schluck Wermut nickt er anerkennend. »Ja doch, da schmeckt man Italien! Wer will schon Schottland schmecken? Der Doktor mit seinem ewigen ungesund, ungesund. Lachhaft. Wer alles Ungesunde meiden will, kann das nur im Grab. Leben ist überhaupt ungesund, eine Krankheit zum Tode. Zum Wohl, ihr Lieben.«
Gelächter. So witzig, findet Keyserling, ist das gar nicht. Man stößt mit den Gläsern an, trinkt.
Charlotte Berend kichert vor sich hin und sieht Keyserling aus wunderbar großen dunklen Augen an. Augen, die ihn an eine andere erinnern. An Vroni. Damals, gleich am ersten Tag, als er in Wien ankam –––
»Drollig.« Charlotte Berend unterbricht die Erinnerung, bevor das Damals zu Bildern gerinnt. »Nichts für ungut, Herr Graf«, sie kichert immer noch, »aber –––«
»Sag einfach Eduard zu mir, Kindchen. Die Freunde von Lovischen sind auch meine Freunde. Was ist denn so drollig?«
»Na ja, wie Sie –––«, gluckst sie, »ich meine den Dialekt. Wie das klingt. Wie Sie, also wie du das gesagt hast: ›Wer alles Unjesunde mäiden will, kann das nur im Jrabe. Läben is’ ieberhaupt unjesund‹.«
So klingt er also?
»Den Dialekt«, sagt er, »musst du doch auch von Lovischen kennen.«
Sie schüttelt den Kopf. »So redet er nur, wenn er mit seinen Landsleuten zusammensitzt. Oder zu viel getrunken hat. Mit mir spricht er Hochdeutsch. Leider.«
Klingt er denn wirklich so? Keyserling wundert sich. Eine Opernsängerin hat ihm irgendwann erzählt, sie habe sich furchtbar erschrocken, als sie zum ersten Mal ihre Stimme auf einer Grammofonplatte gehört habe. Drollig? So hört er sich an? Fremd wie der Blick in den Spiegel, in dem er sich nicht wiedererkennt.
Man plaudert, kichert, lästert und lacht, bestellt noch eine Runde, tauscht den neuesten Klatsch aus, wer mit wem und warum die nicht mit dem und wie viel unverdienten Vorschuss dieser Dichter bekommt und welche horrenden Preise jetzt jener Maler erzielt.
»Was ist denn nun mit dem Haus am See?«, fragt zu bereits vorgerückter Stunde Lovis Corinth. »Soll das heute nicht verabredet werden?«
»Doch, doch«, nickt Max Halbe. »Aber ich warte noch auf Frank.«
»Ach was?« Keyserling staunt. »Der will mit dir zusammen Urlaub machen? Letzte Woche wollte er dich doch noch erschießen.«
Halbe zuckt mit den Schultern. »Ich glaube, er hat sich’s anders überlegt.«
Frank Wedekind ist weder Balte noch Ostpreuße oder Masure, gehört jedoch zu Max Halbes engstem Kreis. Vielleicht ist er sogar sein bester Freund, weil er sich manchmal einbildet, zugleich sein ärgster Feind zu sein. Ihre Hassliebe besteht aus einem wild bewegten Hin und Her. Haben sie sich eben erst gegenseitig hemmungslos als Genies bewundert, bekämpfen sie sich am nächsten Tag umso erbitterter als Banausen und Scharlatane; haben sie sich neulich noch gemeinsam betrunken und innig vertragen, sind sie heute wild entschlossen, sich zu prügeln oder zu duellieren, und die Verehrung von gestern wird schon morgen in Verachtung umschlagen – und zur Erheiterung ganz Schwabings immer so weiter und immer so fort ad infinitum.
Da sich Wedekind als überzeugter Nachtmensch erst aus dem Bett zu erheben pflegt, wenn der Durchschnittsbohemien bereits überlegt, wo er den Aperitif einnehmen soll, wundert sich niemand über sein spätes Eintreffen, das stets einem Auftritt gleichkommt. Zur gelb karierten Pepitahose trägt er einen taillierten taubenblauen Biedermeierfrack, die Hände stecken in gelben Glacéhandschuhen. Ein Künstler? Auf dem Kopf balanciert er einen nagelneu glänzenden Zylinder, den er, als er an den Tisch herantritt, mit prunkvoller Geste zieht, schwenkt und dabei eine übertrieben tiefe Verbeugung vollführt. Ein Magier? Ein Mann der Manege. Vor nicht allzu langer Zeit ist er mit einem Zirkus durchs Land getingelt, und selbst seine Barttracht ist immer noch zirkusreif, besteht sie doch aus zwei üppig wuchernden, wiederum in je zwei Spitzen zulaufenden Koteletten, einem Schnurrbart und einem fast bis auf die Brust hängenden Ziegenbart.
Keyserling schmunzelt, wie sehr Wedekind sich wieder einmal selber gleicht. Wer sich derart pompös mit der Kunst einlässt, trägt keine Kleider mehr, sondern Gewänder – im Falle Wedekinds sind es Kostüme. Die Spezies des Schlawiners hat sich in dieser Gestalt zu höchster Vollkommenheit entwickelt.
Wedekind nimmt Platz, wird mit einer Flasche Bordeaux als Zungenlöser versorgt und beginnt sogleich mit einer Variation seines Lieblingsthemas. Es lautet, bekannt zur Genüge: das Genie des Frank Wedekind. »Meiner Dichterarbeit«, rühmt er, »ist es ungemein zuträglich, wenn ich mich, auf der Chaiselongue liegend, schwelgerischen Tagträumen hingebe. Zum Beispiel habe ich mir vorhin vorgestellt –––«
»Frank, einen Moment bitte«, unterbricht ihn Louise Halbe, »wir wollten euch nämlich mitteilen, dass wir auch in diesem Sommer Karl Taneras Haus in Bernried gemietet haben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dort besuchen kommt.«
Keyserling, Corinth und die Holms danken erfreut, wenn auch nicht sonderlich überrascht für die Einladung. Ein paar Sommertage mit Freunden am Starnberger See wird man sich keinesfalls entgehen lassen. Darauf noch das eine oder andere Gläschen! Nur Wedekind stiert finster schweigend in den Zigarren- und Zigarettenrauch, der als dichter werdende Wolke wie ein aufziehendes Gewitter über dem Tisch dräut.
»Was ist mit dir, Frank?«, hakt Halbe vorsichtig nach. »Bist du etwa nicht dabei?«
Wedekind scheint nachzudenken oder in tiefer Meditation, wenn nicht gar Inspiration versunken zu sein.
»Ich mag es vielleicht in Erwägung ziehen«, sagt er schließlich resignierend wie von weit her, aus Sphären, die nur seinem Genie zugänglich sind, »aber nur, wenn man mir verspricht, mich dort in meinen Ausführungen nicht so permanent unterbrechen zu wollen wie hier.«
»Na also«, sagt Louise Halbe energisch.
Und Lovis Corinth, in Sachen gekränkter Eitelkeit gleichfalls ein anerkannter Experte, fragt Wedekind versöhnlich, was es denn mit dem Tagtraum auf sich habe, dem der Dichter vorhin auf seiner Chaiselongue nachgehangen hätte.
Wedekind räuspert sich bedeutungsvoll. »Eine geniale Eingebung. Stoff für ein ungeheures Drama, das davon ausgeht, dass ein Weib nur dort Weib sein kann, wo es nicht Ehefrau ist, insofern die Gattin der Dirne ebenso wenig verschwistert ist wie –––, ähm –––«
Wedekind hat offenbar den Faden verloren, greift zum Glas, trinkt.
»Hochinteressant, Frank«, sagt Keyserling gemütlich, »aber wie geht es weiter?«
»Die Handlung«, sagt Wedekind, der den Faden wiedergefunden oder vielleicht einfach einen anderen Faden aufgenommen hat, »die Handlung geht so: Eine Offizierswitwe hat drei Töchter, von denen die erste eine berühmte Künstlerin, die zweite Lehrerin, die dritte aber eine Dirne wird. Aus der Langeweile und starren Ordnung des Elternhauses flieht sie ins Freudenhaus. Sie versteht das Bordell als philanthropisches Unternehmen, das nicht nach Profit strebt, sondern eine Art sexuellen Sozialismus einführt, Dienstleistung an der Einsamkeit des Menschen.«