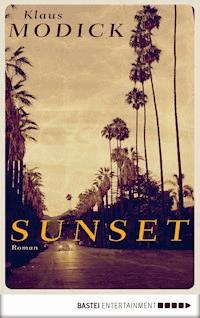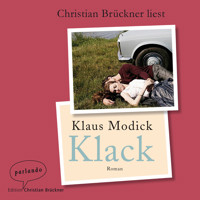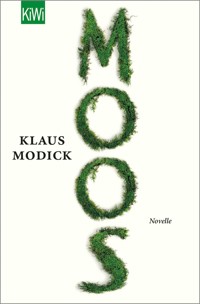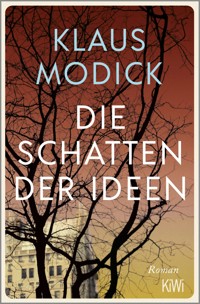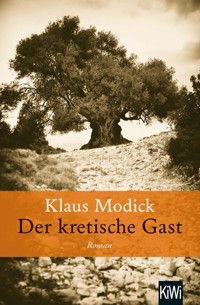
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein hochaktueller, spannender und gut recherchierter Roman, der zwischen den Vierzigerjahren und den Jahrzehnten danach, zwischen kretischem Sommer und Hamburger Winter angesiedelt ist. Kreta 1943: Der deutsche Archäologe Johann Martens soll im Auftrag der Wehrmacht die Kunstschätze der besetzten Insel katalogisieren, die sich als Beutegut für Hitlers Germanisches Museum eignen. Der Einheimische Andreas wird zu seinem Fahrer und Führer, doch verbindet beide bald mehr. Die Lebensart der Kreter und noch mehr Andreas' schöne Tochter Eleni schlagen Martens immer mehr in ihren Bann. Als die Deutschen eine Razzia planen, muss er sich entscheiden, wo er steht. »Ein Balanceakt zwischen historischer Recherche, Abenteuerroman, Liebesromanze und Hommage an eine Insel« Hajo Steinert, Deutschlandfunk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 702
Ähnliche
Klaus Modick
Der kretische Gast
Roman
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Klaus Modick
> Über dieses Buch
> Impressum
> Klimaneutraler Verlag
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
ξένος:
fremd; ausländisch;
Gast
NULLI PARVUS EST CENSUS CUI MAGNUS EST ANIMUS
… auch einmal wieder einer, der aus seiner Haut steigt, während die übrigen nur daraus fahren möchten!
– Wilhelm Raabe –
1. KapitelKreta 1943
1
Der Nordweststurm heulte von den Bergen des Peloponnes über die Ägäis, trieb Regenschauer vor sich her, die wie gigantische nasse Lappen gegen das Aluminiumblech klatschten und in Sturzbächen von den Cockpit-Scheiben abliefen. Bei plötzlichen Böen schien das Flugzeug unkontrollierte Bocksprünge nach vorn zu machen, die Tragflächen vibrierten, große, vor Angst zitternde Hände, und wenn die Böen verebbt waren, sackte das Flugzeug, in allen Nähten, Nieten und Verstrebungen ächzend, manchmal wie ein Stein durch, fiel der tobenden, weiß schäumenden See entgegen, wurde aber jedes Mal vom Piloten wieder auf Kurs und Höhe gebracht. Das gleichmäßige, beruhigende Dröhnen der drei Motoren drang nur ganz selten durchs Toben und Prasseln, und obwohl sich Pilot und Kopilot brüllend verständigten, konnte man im Laderaum ihre Worte nicht verstehen.
Die Sitze in der Kabine waren ausgebaut worden, um mehr Stauraum zu gewinnen. Johann Martens kauerte zwischen Säcken, Stoffballen und festgezurrten Munitionskisten, krallte sich mit beiden Händen an einer Metallverstrebung fest, aber wenn die Ju 52 durchsackte, schnitt ihm der Haltegurt dennoch in die Achsel. Er würgte, spürte den süßsauren Geschmack von Erbrochenem auf der Zunge, schluckte, würgte wieder und wunderte sich, dass die Piloten offenbar bester Laune waren, gelegentlich lachten und seelenruhig Zigaretten rauchten. Nach einem weiteren Steigflug aus einem Luftloch heraus, in das die Maschine so tief stürzte, dass Johann den Aufprall auf der Wasseroberfläche für unvermeidbar hielt, drehte sich der Kopilot um und gab ihm durch Gesten zu verstehen, ins Cockpit zu kommen. Johann löste den Gurt, kroch zitternd über Zeltbahnen, Mehlsäcke und Metallkisten nach vorn, kniete sich hinter den Sitz des Kopiloten und klammerte sich an die Rückenlehne. Der Kopilot deutete mit dem Zeigefinger aus der rechten Seitenscheibe und brüllte: »Kreta!«
Johann reckte den Kopf vor und starrte durch die Sturzbäche des Regens ins graue Getöse. Erkennen konnte er nur eine der fünf Schlepp-Jus der Staffel, die sich in einiger Entfernung vor ihnen durch den Sturm kämpfte. Der Lastensegler, den sie zog, tanzte wie ein Papierspielzeug im Wind, lag für ein paar Augenblicke ruhiger in der Luft als die Schleppmaschine, begann aber gleich wieder zu schlingern und zu torkeln, bäumte sich gegen den Sog. Johann konnte noch von Glück sagen, dass man ihm einen Platz in der Ju zugewiesen hatte und er jetzt nicht in dem Segler saß. Auf der linken Seite schob sich einer der beiden ME-109-Jäger, die als Begleitschutz mitflogen, ins Blickfeld, rüttelte mit den Tragflächen einen Abschiedsgruß, zog eine weite Schleife und verschwand in der kochenden Regenwand Richtung Festland.
»Wo?«, brüllte Johann zurück.
Der Kopilot klopfte mit den Knöcheln der geballten Faust ans Cockpitfenster, deutete dann mit dem Daumen nach unten. Johann richtete sich schwankend auf und drückte das Gesicht gegen die Scheibe. In diesem Moment riss der Sturm eine Wolkenlücke, der Regen dünnte zu silbernen Fäden aus, Sonnenbündel stürzten als gleißender Lichtschacht in die Tiefe und ließen hinter zwei langgezogenen Vorgebirgen die Insel erkennen. Im geisterhaften Licht des plötzlichen Sonneneinfalls und mit den nach Norden gereckten Landzungen sah sie aus wie eine Schnecke, die ihre Fühler zum Festland schob. Felsen hoben sich nackt, tönern und ockerfarben aus dem weiß tosenden Wasser, blankes Gestein, baumlos, graslos, Gipfel eines vom Meer umspülten Gebirges, schroffe Schichtungen, heftiges Zusammenprallen von Gesteinsmassen, Abgründe, Kliffe, Risse, Engpässe und Steilhänge. Bizarre Formen aus maßloser Übermacht und Gewalt. Wolken schoben sich wieder vor die Sonne, die Farben wichen einem bleiern triefenden Grau.
»Wir gehen runter!«, schrie der Pilot.
Johann kroch zurück in die Kabine und schnallte sich an, während das Flugzeug im Sinkflug, von Böen gerüttelt, als stolpere es, einen weiten Bogen schlug, um gegen den Wind zu landen. Ein scharfer Ruck ging durch die Maschine, als der Kopilot den Lastensegler, den die Ju im Schlepp hatte, ausklinkte. Wenige Augenblicke später berührte das Fahrwerk die Piste, die Maschine schwankte leicht, vollführte ein paar Hüpfer, holperte über den schadhaften Asphalt, rollte aus und stand. Die Motoren wurden abgestellt, die Propeller liefen noch eine Weile surrend nach.
»Maleme, Endstation!«, rief der Kopilot durchs Prasseln des Regens auf das Aluminiumblech.
2
Die Tür wurde geöffnet, ein Windstoß trieb Regenspritzer in die Kabine, und der Pilot fluchte mit hamburgischem Akzent, bei dem »Schietweddä« fühle er sich wie zu Hause. Johann zerrte seinen Koffer und den Rucksack aus dem Haltenetz und kletterte mit weichen Knien über eine Gangway, die von außen an die Tür geschoben worden war, auf das Rollfeld. Im Zwielicht aus Regen, gelben Scheinwerfern und einsetzender Dämmerung herrschte hektischer Betrieb. Einige Lkws britischer Bauart, zum Teil noch mit britischen Hoheitszeichen versehen, rollten von Lagerschuppen heran oder standen bereit, um den Nachschub aus den Jus aufzunehmen. Drei andere Maschinen des Konvois parkten bereits weiter vorne, und ganz hinten, wo das Rollfeld in eine breite Schotterpiste überging, waren die Lastensegler gelandet. Die fünfte und letzte Maschine setzte soeben zur Landung an, als ein Kübelwagen auf Johann zuhielt und dicht vor ihm stoppte.
Der Fahrer, ein stämmiger, unrasierter Mann in Kakiuniform, legte nachlässig eine Hand gegen den Mützenschirm und stellte sich als Hauptfeldwebel Sailer vor. »Sailer mit a i«, sagte er grinsend. »Herr Martens?«
Johann nickte.
»Willkommen auf Kreta«, sagte Sailer, nahm Johanns Gepäck und verstaute es auf den Rücksitzen. »Ich habe Befehl, Sie nach Chania in Ihre Unterkunft zu bringen.«
»Danke.« Johann winkte den Piloten zu, die in der Kabinentür standen, und stieg neben Sailer auf den Beifahrersitz.
Während sich der Kübelwagen ruckend in Bewegung setzte, riss im Nordwesten die Bewölkung auf, und letzte Strahlen der untergehenden Sonne schimmerten wie blutige Schlieren auf Pfützen und dem nässeglänzenden Asphalt des Rollfelds. An seinen Rändern waren noch Bombentrichter zu erkennen, und zwei ausgebrannte britische Tanks standen auf der hinteren Piste. In der Dämmerung wirkten sie wie versteinerte Tiere aus irgendeiner Vorzeit, deren Rüssel drohend in die Gegenwart stachen. Der Regen ließ nach, und als sie die Küstenstraße erreicht hatten, fielen nur noch ein paar verirrte Tropfen. Sailer stellte den Scheibenwischer aus und schaltete die Scheinwerfer ein. Johann wühlte in der Tasche seines Trenchcoats nach der silbernen Zigarettendose, klappte sie auf, steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen und hielt die Dose seinem Chauffeur hin. Sailer griff zu, gab Johann und sich selbst mit einem blakenden Sturmfeuerzeug Feuer.
»Kreta also«, sagte Johann und stieß den Rauch gegen die Windschutzscheibe.
Sailer warf ihm einen spöttischen Blick zu. »Ja, Kreta. Winter gibt’s hier leider auch. Zum Ausgleich keine Heizungen.«
»Na ja«, sagte Johann, »ich werd’s hier schon aushalten.«
Sie schwiegen eine Weile. »Sind Sie«, fragte Sailer plötzlich und zögerte einen Moment, »Zivilist?« In der Art und Weise, mit der er das Wort aussprach, bekam es einen merkwürdigen Klang. Eine Art Misstrauen schwang darin mit, aber auch Neid auf eine Normalität, die immer unerreichbarer zu werden schien.
Johann wunderte sich nicht, dass ein dreißigjähriger, offensichtlich gesunder Mann ohne Uniform, der trotz des knappen Transportraums im Januar 1943 nach Kreta eingeflogen wurde, für etwas Ungewöhnliches gehalten werden musste, wahrscheinlich für einen Parteibonzen, Gestapo-Offizier oder Agenten; vielleicht aber auch nur für einen Drückeberger, der sich mithilfe hochrangiger Beziehungen aus dem Krieg heraushalten konnte. Und weil genau das in gewisser Hinsicht auf Johann zutraf, fühlte er sich diesem Mann gegenüber unbehaglich. Vermutlich gehörte der zur kämpfenden Truppe, die im vorletzten Jahr unter enormen Verlusten die Insel aus der Luft erobert hatte. Gern hätte Johann ihm jetzt erzählt, dass er von einer sehr hohen Stelle, wie Professor Lübtow es formuliert hatte, angefordert worden war, um hier auf Kreta einer schwierigen Aufgabe nachzugehen, einer Pflicht sozusagen. Aber da man ihm Stillschweigen über alle Informationen und Aktivitäten abverlangt hatte, nickte er nur und wiederholte tonlos: »Zivilist, ja.«
»Und Sie kommen also«, Sailer sog an der Zigarette und warf die glühende Kippe aus dem Wagen, »direkt aus«, er schluckte und spuckte durchs Seitenfenster auf die Straße, »aus Deutschland?«
»Mehr oder weniger. Bin von München über Rom nach Thessaloniki geflogen und …«
»Wie sieht es in Deutschland aus?«, unterbrach Sailer ihn hastig. »Gibt es immer noch Bombenangriffe? Ich meine, verstehen Sie mich nicht falsch, aber wir bekommen hier nur sehr«, wieder zögerte er, »sehr wenig Informationen. Und ob die stimmen, weiß man nicht so recht. Mit der Feldpost ist das auch eher eine Lotterie, und es gibt praktisch keinen Urlaub mehr. Transportprobleme. Alle Kapazität wird für Versorgung und Nachschub frei gehalten. Ich komme aus Dortmund. Meine Eltern leben da, meine Verlobte …«
»Ihre Verlobte«, echote Johann und dachte an den Brief aus Lübeck. Bedauern wir Ihnen mitteilen zu müssen, dass Fräulein Ingrid …
»Ja, ja«, sagte Sailer. »Dortmund.«
»Es ist etwas besser geworden«, murmelte Johann zögernd. »Jedenfalls hat es seit dem Sommer kaum noch Angriffe gegeben. Man hat auch die Flak weiterentwickelt, und es gibt bessere Nachtjäger. Zuletzt hat es noch Düsseldorf erwischt, Ende Juli, glaube ich.«
»Und Dortmund?«
»Soviel ich weiß, ist da bislang nichts passiert. Köln muss schlimm gewesen sein, Rostock, Bremen. Und Lübeck. Lübeck hat gebrannt wie, wie …« Er fand das Wort nicht.
»Bislang ist also nichts passiert«, sagte Sailer, »bislang …«
»Ja«, sagte Johann, »bislang«, starrte in die Nacht, die von den auf und ab tanzenden Scheinwerfern des Kübelwagens zerschnitten wurde. »Es kommt aber noch mehr, fürchte ich.«
Die Straße musste jetzt unmittelbar am Ufer entlangführen, weil sich manchmal das Rauschen und Schlagen von Brandung ins Motorengeräusch mischte. Der Sturm war abgeflaut. Hin und wieder strich noch eine verspätete Böe vom Meer herüber, griff durch die offenen Seiten ins Wageninnere und ließ das Persenningdach des Kübelwagens knattern. Im Norden blinkten Sterne am Himmel, und manchmal konnte man im Süden hinter den eilig ausdünnenden Wolkenbahnen schon einen niedrigen Mond erkennen.
»Und Russland?«, fragte Sailer plötzlich. »Wir hören hier immer nur Offensive, Offensive, Offensive. Und Sieg an allen Fronten.«
»Das klingt in Deutschland auch nicht anders, offiziell jedenfalls nicht«, sagte Johann fröstelnd, schlug den Kragen des Trenchcoats hoch und fingerte wieder nach der Zigarettendose. »Es gibt aber Gerüchte, dass die Sache bei Stalingrad gar nicht gut … Was ist los?«
Sailer war abrupt auf die Bremse getreten, brachte den Kübelwagen zum Stehen, schaltete Motor und Scheinwerfer aus. »Da vorn auf der Straße bewegt sich was«, flüsterte er, lauschte in die Dunkelheit und zog unter seinem Sitz eine Maschinenpistole hervor. »Können Sie damit umgehen?«
»Ich fürchte nein«, sagte Johann entsetzt. »Aber was soll da denn sein?«
»Weiß ich nicht«, zischte Sailer. »Vielleicht Banden.«
»Was für Banden?«
Sailer gab keine Antwort, ließ den Motor wieder an, fuhr im Schritttempo weiter, lenkte den Kübelwagen mit der linken Hand und klemmte sich die Maschinenpistole unter den rechten Arm, den Finger am Abzug. Im Mondlicht, das wie aus einem schwankenden Bullauge hinter Wolkenfetzen hervorbrach, erkannte Johann einen wippenden Schatten auf dem hellen Schotterbelag der Straße. Sailer schaltete plötzlich die Scheinwerfer wieder ein. Der Lichtkegel riss grell aus der Dunkelheit, was sich da vor ihnen bewegte. Auf einem Esel hockte eine Gestalt, die so weit nach vorn gekrümmt war, dass sie fast auf Hals und Kopf des Tieres lag. Als der Kübelwagen nur noch wenige Meter entfernt war, trat eine in Schwarz gekleidete Frau, die den Esel an einem Strick führte, heftig gestikulierend auf die Fahrbahn und versperrte den Weg. Sailer musste bremsen, um die Frau nicht zu überfahren, und brachte fluchend die Maschinenpistole in Anschlag, als sie nun auf Johanns Seite an den Wagen kam und, abwechselnd auf die Gestalt auf dem Esel und in Richtung Stadt deutend, einen aufgeregten Wortschwall hervorstieß. Sailer gab wortlos Gas und ließ die Gruppe hinter sich.
»Warten Sie«, sagte Johann, »ich glaube, die Frau hat gesagt, dass sie ihren Mann ins Krankenhaus bringen muss.«
»Können Sie etwa Griechisch?« Sailer sah Johann staunend an, stoppte aber nicht, sondern drückte ihm die Maschinenpistole in die Hand, beschleunigte den Kübelwagen und jagte so schnell weiter, wie die von Schlaglöchern übersäte Straße es zuließ.
»Wollen Sie den Leuten denn nicht helfen? Wir könnten doch zumindest den Mann mitnehmen.« Johann hielt sich am Türrahmen fest, streckte den Kopf aus dem Wagen und sah hinter sich die Gruppe in der Nacht verschwinden. »Halten Sie doch an, Mensch!«
»Ich habe Befehl, Sie in Ihr Quartier zu bringen«, sagte Sailer ruhig. »Und sonst gar nichts.«
»Aber das ist doch ein Notfall und …«
»Das kann genauso gut ein Hinterhalt sein«, knurrte Sailer durch zusammengebissene Zähne. »Diese Scheißbanden sind schon seit Wochen wieder aktiv.«
»Welche Banden?«
»Partisanen«, sagte Sailer. »Nennen sich selbst Andarten. Dreckschweine.«
Sie schwiegen. Johanns Hilfsbereitschaft wich einer diffusen Angst. Auf Kreta, hatte Professor Lübtow zu ihm gesagt, sei man in diesen Zeiten wahrscheinlich sicherer als in Deutschland. Da könne Johann sich einen feinen Lenz machen. Von Partisanen war keine Rede gewesen. Und jetzt saß er hier auf dem Weg nach Chania mit einer Maschinenpistole auf dem Schoß, die er im Notfall nicht einmal zu bedienen gewusst hätte, und wusste immer noch nicht genau, warum man ihn überhaupt nach Kreta kommen ließ. Links und rechts der Straße waren vereinzelt Schatten von Häusern zu erkennen, die nach und nach dichter zusammenstanden, und gelegentlich fiel Licht aus Fensteröffnungen über die Fahrbahn. Manchmal kamen ihnen Lastwagen entgegen, vereinzelt Motorräder, einmal ein anderer Kübelwagen, und dennoch wirkte die Gegend wie ausgestorben.
»Sie können Griechisch?«, fragte Sailer plötzlich. »Dann sind Sie also Dolmetscher?«
»Nein, nein«, Johann schüttelte den Kopf, »mit meinem Griechisch ist es nicht sehr weit her, aber ohne mein Griechisch wäre ich jetzt wohl auch nicht hier.«
»Verstehe«, nickte Sailer und warf Johann einen verständnislosen Seitenblick zu.
Sie hatten inzwischen den westlichen Vorort durchquert, fuhren an der venezianischen Mauer entlang, die Chanias Altstadt umgab, passierten einen Platz vor einer großen Markthalle, durch deren erleuchtetes Portal Menschen ein- und ausströmten, bogen aber gleich wieder in eine stillere Straße ab. Im Schein von Straßenlaternen, die in weiten Abständen trübes Licht warfen, erkannte Johann in Gärten und Parks weiß gekalkte Villen, Häuser im klassizistischen und venezianischen Stil.
»Chalepa«, sagte Sailer, »das Diplomatenviertel. Ganz so nobel ist Ihr Quartier nicht, aber ich würde jederzeit mit Ihnen tauschen.«
Schließlich kamen sie in eine schmale, weiter ostwärts führende Straße. Die Häuser waren bescheidener als in Chalepa, wirkten aber im vorbeihuschenden Licht der Scheinwerfer sauber und gepflegt. Vor einem schlichten, zweistöckigen Haus mit Flachdach, dessen Fenster erleuchtet waren, hielt Sailer an.
»Da wären wir«, sagte er, blickte die Straße auf und ab, sah auf seine Armbanduhr und schüttelte den Kopf. »Eigentlich sollten Sie von Leutnant Hollbach empfangen werden, aber sein Wagen ist nicht da. Ich habe lediglich Befehl, Sie hier abzusetzen.«
Sie stiegen aus. Johann nahm seinen Rucksack, Sailer trug den Koffer. Die Haustür öffnete sich, bevor sie die Schwelle erreicht hatten, und eine dunkelhaarige Frau in einem knöchellangen, blauen Wollkleid trat heraus.
»Kalos orisate«, sagte sie und streckte Johann die Hand entgegen. »Welcome in Chania. Mr. Martens, I presume? I am Mrs. Xenakis.«
»Ja, also yes beziehungsweise efcharisto«, stammelte Johann, gab der Frau die Hand und verbeugte sich knapp.
»O! Do you speak Greek?«
Nur ein bisschen, erklärte Johann auf Griechisch, eigentlich lerne er es noch. Altgriechisch könne er besser.
Die Frau lachte. Leider spreche sie kein Deutsch, aber mit Griechisch, Altgriechisch und Englisch werde man wohl irgendwie eine gemeinsame Sprache finden.
Sie führte die beiden Männer durch einen gefliesten Flur. Sailer stieß Johann an, als sie an einer offen stehenden Tür vorbeikamen, und Johann warf einen Blick in den Raum, der wie das Behandlungszimmer eines Arztes aussah.
Ihr Mann, sagte Frau Xenakis, der das nicht entgangen war, sei Arzt, und sie hoffe sehr, dass er bald wieder nach Hause kommen möge.
Sie gelangten in ein geräumiges Esszimmer, von dem ein offener Durchgang zur Küche führte. In der Mitte des Raumes stand ein runder Tisch aus dunklem Olivenholz. Aus einer Karaffe schenkte Frau Xenakis zwei Gläser mit Wasser voll und reichte sie den beiden Männern. Johann stürzte es gierig hinunter, die Frau schenkte nach und sagte, kretisches Wasser sei das beste der Welt.
»Leutnant Hollbach?«, sagte Sailer und tippte auf seine Armbanduhr.
»O yes, excuse me.« Frau Xenakis nahm einen Briefumschlag von einer Kommode und reichte ihn Johann. Der Herr Leutnant werde erst morgen erscheinen können, und der Brief sei vor zwei Stunden von einem Kradmelder abgegeben worden.
Johann öffnete den Umschlag, auf dem sein Name stand, und las, was offenbar in Eile handschriftlich notiert worden war.
Sehr geehrter Herr Martens!
Wichtige Dienstverpflichtungen machen es mir leider unmöglich, Sie heute Abend in Ihrem Quartier zu begrüßen und Sie über Ihre kommenden Aufgaben zu instruieren. Ich werde Sie morgen Vormittag um 9 Uhr aufsuchen, um alles Weitere zu besprechen. Sobald Sailer Sie bei Frau Xenakis abgesetzt hat, soll er sich unverzüglich bei seiner Einheit zurückmelden.
Hollbach
PS: Frau Xenakis ist vertrauenswürdig.
Johann reichte Sailer den Brief, der ihn überflog, mit einem Blick auf Wein, Brot, Käse, Tomaten, Oliven und Äpfel, die auf dem Tisch standen, leise »Scheiße« sagte, die Hand an die Mütze legte, auf dem Absatz kehrtmachte und das Haus verließ. Das meckernde Geräusch des Boxermotors, als der Kübelwagen anfuhr. Verlegene Stille.
Frau Xenakis, eine Mittvierzigerin mit dunklem Teint und fast schwarzen Augen, forderte ihn auf, Platz zu nehmen. Nach der Reise müsse er doch sehr hungrig sein? Während er aß und dazu von dem leicht süßlichen Wein trank, überkam ihn eine so bleischwere Müdigkeit, dass es ihm kaum noch gelang, auf die freundliche Konversation einzugehen. Mühsam unterdrückte er ein Gähnen. Frau Xenakis lächelte verständnisvoll und sagte, sie wolle ihm nun seine Unterkunft zeigen.
Er nahm sein Gepäck, sie zündete eine Petroleumlampe an und öffnete eine Tür, die aus dem Essraum direkt in den Garten führte. Im blakenden Schein der Lampe waren undeutlich Bäume und Büsche zu erkennen, zwischen denen ein Pfad entlangführte, der nach etwa zwanzig Metern an einem niedrigen Häuschen aus Feldsteinen endete. Es bestand aus einem einzigen weiß gekalkten Raum, ausgelegt mit hellbraunen Feldsteinen. Johann stellte sein Gepäck ab und sah sich um, während Frau Xenakis sich vielwortig für die Schlichtheit der Ausstattung entschuldigte. Ein Eisenbett. Tisch. Zwei Stühle. Eine Kommode. In einer Ecke ein großes Waschbecken aus Blech, daneben auf einem Holzgestell ein Spirituskocher, in einem Regal etwas Geschirr und Handtücher.
Früher, sagte Frau Xenakis, sei das Häuschen ein Stall gewesen. Ihre Großeltern hätten noch Ziegen und einen Esel gehalten. Aber schon ihre Eltern hätten ein Gartenhaus daraus gemacht, und später sei es dann zu einer bescheidenen Unterkunft umgebaut worden, für Gäste und Patienten, die über Nacht bleiben müssten. Und die Kinder hätten hier viel gespielt. Ob er meine, sich damit behelfen zu können?
Johann war entzückt von der einfachen Klarheit des Raums und versicherte, dass er sich hier wohlfühlen werde. Im Anblick des Betts meldete seine Müdigkeit sich so nachdrücklich, dass ihm im Stehen fast die Augen zufielen. Frau Xenakis wünschte ihm Gute Nacht und ging. Er wusch sich Hände und Gesicht, zog sich aus und fiel wie ein Stein ins Bett.
Die Regenwolken mussten inzwischen ganz abgezogen sein, denn durch die Holzjalousien vor den Fenstern fingerte Mondlicht und legte bleiche Streifen auf die schweren, ölig riechenden Schafwolldecken, unter denen Johann lag. Die weißen Wände wirkten im Zwielicht wie aufgespannte Tücher. Dass kein einziges Bild, keine Fotografie, nicht einmal ein Kalender an diesen Wänden hing, erfüllte ihn mit Erleichterung. In diesem Raum gab es nichts zu katalogisieren, doch im Halbschlaf, der wie eine sanfte Welle über ihn kam, sah er Bilder über Bilder an weißen Wänden, die aber im Licht schwanden oder unter Tüchern verborgen blieben, während der Mondschein sanft über die Steine des Fußbodens fiel und wie ein Finger auf das Wandregal wies. Die quadratischen Fächer. Das dunkle, abgegriffene Holz. Tropfen fielen draußen vom Dach. Gleichmäßig. Wie das Ticken einer Uhr. Für einen Moment wusste er nicht mehr, ob er noch wach war oder schon träumte, und wie er hierhergekommen war, wusste er auch nicht mehr.
3
Das Regal aus dunklem, abgegriffenem Holz hat quadratische Fächer, über denen die Namensschilder der Institutsmitglieder kleben. An diesem Abend im Oktober ist Johann der Letzte im Institut. Der Hausmeister marschiert schon schlüsselklappernd über den Korridor, löscht Lichter und kontrolliert die Verdunkelungen. Johann hat die Seiten seines Manuskripts zusammengeschoben, in die Schreibtischschublade gelegt, die Ordner, Mappen und Bücher zurück ins Regal gestellt, die Aktentasche genommen und ist auf dem Weg zum Ausgang noch einmal ins Sekretariat gegangen. Vielleicht ist das Buch, das er über die Fernleihe bestellt hat, inzwischen gekommen, und die Benachrichtigung der Bibliothek liegt in seinem Postfach. Er greift hinein und hält einen Briefumschlag in der Hand. Herrn Dr. Johann Martens – Im Hause. Die mikroskopische Handschrift Lübtows. Vermutlich hat der Professor wieder diverse Wünsche. Recherchieren. Bibliografieren. Wozu hat man schließlich seine Assistenten? Johann reißt den Umschlag auf.
5.X.42
Lieber Martens!
Konnte nicht persönlich ins Institut kommen. Ich erwarte Sie heute Abend um acht im »Keller«. Sehr dringend!
In Eile.
Lübtow
Johann zuckt zusammen. Zwar schreibt Lübtow häufig solche Billetts an seine Mitarbeiter, genau genommen an seinen letzten Mitarbeiter, sind doch die beiden anderen Assistenten an der russischen Front. Zumeist drückt sich Lübtow jedoch in einer gewundenen, apokryphen Höflichkeit aus und nicht in diesem barschen Kommandoton. Etwas Ungewöhnliches muss vorgefallen sein, etwas Unangenehmes. Johann schaut auf die Armbanduhr: schon halb acht. Wenn er um acht in »Krügers Weinkeller« sein will, bleibt keine Zeit, um vorher noch nach Hause zu gehen; er wird also im »Keller«, dem Stammlokal der Institutsmitarbeiter, etwas essen. Er holt seinen gefütterten Kleppermantel aus der Garderobe und geht zum Ausgang, wo der Hausmeister bereits wartet und hinter ihm abschließt.
Herbstnebel kriecht feucht durch die Altstadt. Während Johann übers Kopfsteinpflaster des dunklen Marktplatzes geht und ins Gassengewirr hinter der Kirche einbiegt, überlegt er beunruhigt, was Lübtow dazu veranlasst haben kann, ihn auf diese fast schon militärische Art herzuzitieren. Den Bericht über die Archivierungen in Norwegen hat Johann lektoriert, wie es abgesprochen war, und pünktlich weitergeleitet. Die Feldnotizen, Vermessungs- und Grabungsskizzen aus Sandstede sind durchgesehen, nur die unergiebige Liste der Grabungsfunde muss noch der Sekretärin diktiert werden. Oder ob er vielleicht bei der norwegischen Sache diesmal allzu dick aufgetragen hat? Dass die Hünengräber eindeutige Rückschlüsse auf die dem nordischen Menschen angeborene Führertreue aufweisen, ist in der Tat haarsträubender Schwachsinn, aber Lübtow selbst hat diese Strategie vorgegeben, und als Johann bei der Sandsteder Grabung von hohem, hartem Friesengewächs geblödelt hat, war Lübtow geradezu hingerissen.
Hinter den gelben Butzenscheiben in »Krügers Weinkeller« verlieren sich nur wenige Gäste in den Nischen und Erkern unterm niedrigen Tonnengewölbe. Zigarrenrauch und Bierdunst, Küchengerüche, gedämpfte Gespräche. Johann bestellt Bier und Nürnberger auf Kraut, und als die Kellnerin das Essen serviert, erscheint Lübtow, fünf Minuten vor acht und nicht, wie bei ihm üblich, mit dem akademischen Viertel Verspätung. Mit grauem, bedenklich ernstem Gesicht gibt er Johann die Hand, lässt sich schwer auf einen Stuhl fallen, bestellt ebenfalls Bier, wischt sich mit der Hand über die Augen, schaut ihn einige Sekunden wortlos an und sagt dann ohne jede Einleitung, er, Johann, spreche doch Griechisch? Neugriechisch?
Johann lässt die Gabel mit dem Sauerkraut sinken und nickt. Er habe seit Jahren einen Kurs an der Universität belegt, das schon, weil es bekanntlich sein Traum sei, irgendwann einmal an Ausgrabungen in Griechenland teilzunehmen, aber die Sprache sei, trotz seiner Altgriechischkenntnisse, schwierig, und um sie ernsthaft zu erlernen, müsse man sich wohl eine Weile vor Ort aufhalten, in Griechenland also. An diesen Traum aber wage er, und jetzt senkt er die Stimme, weil auch in diesem Keller schon weitaus harmlosere Bemerkungen gemacht worden sind, deren Urheber dann in Gestapokellern und Konzentrationslagern landeten, an diesen Traum also wage er in dieser schwierigen Zeit nicht einmal im Traum zu denken.
Lübtow nimmt einen Schluck Bier, nickt nachdenklich vor sich hin, setzt das Glas hart auf dem Tisch ab und sagt: »Ihr Traum hat sich erfüllt.« Angefordert von einer, wie Lübtow sich ausdrückt, sehr hohen Stelle, werde Johann nach Griechenland versetzt, genauer gesagt nach Kreta, um dort, Lübtow zieht einen Zettel aus seiner Lodenjacke und liest mit gerunzelter Stirn, archäologische und kunstgeschichtliche Bestimmungen und Katalogisierungen durchzuführen. Als Johann ihn unterbrechen will, winkt Lübtow ab. Für diese, bemerkenswerterweise nicht näher präzisierte, Aufgabe sei ursprünglich kein Archäologe, sondern ein Kunsthistoriker gesucht worden, aber bei den Kunsthistorikern, die Neugriechisch sprächen, das seien sowieso nur eine Handvoll, und die nicht längst zur Wehrmacht eingezogen seien, handele es sich um Frauen. Und die kämen nicht in Betracht. Nun bestehe aber, erstens, nach Ansicht dieser sehr hohen Stelle zwischen Kunstgeschichte und Archäologie kein relevanter Unterschied, was Lübtow, und jetzt zwinkert er Johann zu, selbstverständlich gern bestätigt habe, zumal Kunstgeschichte und Archäologie in ihrer konkreten Anwendung vielleicht nirgends auf der Welt so eng miteinander verwandt seien wie bei Forschungen auf Kreta, was freilich die sehr hohe Stelle nicht sogleich begriffen habe. Zweitens sei jedoch die Beherrschung der neugriechischen Sprache, wie lückenhaft auch immer, für die anstehende Aufgabe von erheblicher Relevanz. Und drittens, so wiederum die Meinung der sehr hohen Stelle, hätten Frauen an deutschen Universitäten im Grunde nichts zu suchen und auf Kreta schon gar nichts, sondern an der Heimatfront ihren Mann zu stehen, was Lübtow gleichfalls lachend bestätigt und sich für dies Lachen zugleich geschämt habe. Aber lieber mitgelacht als kaltgemacht. Der langen Rede kurzer Sinn: Diese ominöse, vermutlich auch dubiose Aufgabe sei Johann auf den Leib geschneidert wie ein Maßanzug, wenn auch mit etwas zu langen oder zu kurzen Ärmeln, die man aber leicht kürzen oder auslassen könne. Schließlich habe Johann doch auch Kunstgeschichte studiert, im Nebenfach. Lübtow nimmt einen tiefen Zug Bier und schaut Johann über den Glasrand hinweg in die Augen.
Aber die Bronzezeit-Grabungen in Sandstede, will Johann einwenden, und die Auswertung des norwegischen Projekts? Und überhaupt – Kunstgeschichte? Da sei er noch weniger firm als in Neugriechisch, Nebenfach hin oder her, und …
Wenn ihm sein Leben lieb sei, fällt Lübtow ihm leise, Silbe für Silbe akzentuierend, ins Wort, vergesse Johann auf der Stelle jedes Wenn und Aber, vergesse den heldischen Bronzequatsch und die germanische Hünengrabarchitektur Skandinaviens in ihrer arischen Herrlichkeit und stimme schleunigst zu. Seine kunstgeschichtlichen Studien und seine Griechischkenntnisse, wie rudimentär auch immer, zahlten sich jetzt vermutlich als eine Art Lebensversicherung aus. Welberg, Lübtows erster Assistent, liege irgendwo in Russland in der Scheiße, und Kossmann, Lübtows designierter Nachfolger, und nun flüstert er so leise, dass Johann sich über den Tisch beugen muss, um ihn noch zu verstehen, sei als vermisst gemeldet – offiziell; inoffiziell werde von standrechtlichen Erschießungen gemunkelt, Wehrkraftzersetzung, Befehlsverweigerung. Bislang habe Lübtow ihn, Johann, vor dem Gestellungsbefehl schützen können, obwohl er gesund und im sogenannten wehrtüchtigen Alter sei, außerdem, und nun spricht Lübtow so leise, dass es fast nur noch eine Bewegung der Lippen ist, aber das Wort muss Johann nicht erraten, außerdem – ledig.
Das furchtbare Wort. Ledig. Ein anderes Wort gehört dazu: Waise. Im Mai wäre die Hochzeit gewesen. Und im März ist Ingrid zu Johanns Eltern, ihren zukünftigen Schwiegereltern, nach Lübeck gefahren, um Details für die Hochzeitsfeier zu besprechen. Und ist nie zurückgekommen. Am 28. März hat ein alliiertes Bombergeschwader die Stadt zerstört. Sie habe, hat Johann später gehört, gebrannt wie ein überdimensionales Feuerzeug. Und so hat Johann seine Eltern verloren. Und ist ledig geblieben.
Geschützt, flüstert Lübtow weiter, habe er ihn, wie Johann sehr genau wisse, indem er bis zur Selbstverleugnung und weit darüber hinaus die Tätigkeit des archäologischen Instituts umgebogen und umgelogen habe zu rassenkundlichen Forschungen, völkischem Dienst an nationalsozialistischer Volkskunde, indem er seine Wissenschaft sozusagen mit Blut gewaschen und in braunem Boden vergraben habe, um seine Mitarbeiter vor dem Heldentod zu bewahren. Bislang habe das geklappt, jedenfalls für Johann. Aber nun sei es vorbei. Welberg seit einem Jahr an der Front, Kossmann vermutlich tot. In Russland zeichne sich eine Katastrophe ab, und in Nordafrika habe eine groß angelegte britische Gegenoffensive eingesetzt. Ungeheure Verluste an allen Fronten, der Endsieg eine Schimäre. Johann habe die Wahl: als Zivilist mit kunsthistorischem Spezialauftrag nach Kreta – oder ab an die Front. Alle, Lübtow ist jetzt kaum noch zu verstehen, restlos alle würden verheizt. Er wache manchmal nachts auf und sehe sich selbst in Uniform, ein alter Mann von Mitte sechzig; er sehe Frauen und Kinder in Uniform; und die Städte, Martens, die Städte fielen schon jetzt in Schutt und Asche. »Mehr kann ich nicht mehr für Sie tun«, zischelt er dringlich. »Gehen Sie nach Kreta, Mensch. Was genau Sie dort machen sollen, weiß ich nicht. Die Erfüllung Ihres archäologischen Traums wird es vermutlich nicht werden, aber immerhin kunstgeschichtliche Bestimmungen und Katalogisierungen, was immer das bedeuten mag. Es wird irgendein Schwachsinn sein. Oder eher eine große Sauerei, vielleicht eine Art Sonderstab bildende Kunst, mit dem man Frankreich ausgeräubert hat. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich weiß aber, dass Sie auf Kreta sicherer sind als derzeit in Deutschland. Von Russland ganz zu schweigen. Auf Kreta wird nicht mehr gekämpft, dort wird nur besetzt und verwaltet. Das ist, verglichen mit dem, was auf uns zukommt, Arkadien. Ihr Traum meinetwegen. Zumindest Ihr Leben. Stecken Sie sich Ihr Parteiabzeichen ans Revers, gehen Sie zur Reichskammer der bildenden Künste und holen sich Ihre Instruktionen ab. Hier«, Lübtow schiebt ihm einen Zettel zu, »steht die Uhrzeit für Ihren Besuch drauf. Unseren sauberen Stöver kennen Sie ja von Weitem. Morgen lernen Sie ihn aus der Nähe kennen. Und dann gehen Sie nach Kreta«, Lübtow spricht wieder mit normaler Lautstärke, »und gehen Sie gefälligst begeistert. Begeistert für die deutsche Sache, die bekanntlich überall auf der Welt Männer wie Sie braucht. Sie wissen doch, dass das, was auf Kreta in Trümmern herumsteht«, und wieder zwinkert Lübtow ihm zu, »Pfalzen und Burgen nach urwüchsiger germanischer Art sind. Der Hellene als solcher ist bekanntlich Arier, der minoische Mensch ein Urarier. Zu Füßen seiner Herrenburgen drängen sich die Hütten der Ackerbürger und Hörigen. Auf Kreta hat schon zu minoischer Zeit die germanische Herrenrasse ihre Sitze errichtet, ausgewählt nach Bodenertrag und der Sicherheit vor ränkesüchtigen, lebensunwerten Feinden. Zeigen Sie, was Sie bei mir gelernt haben. Gehen Sie nach Kreta, Martens. Und darauf trinken wir jetzt noch ein gepflegtes, urgermanisches Pils.«
Als sie sich zuprosten und Johann nach Worten sucht, mit denen er Lübtow danken könnte, sagt der Alte: »Ich beneide Sie.« Johann sieht ihn fragend an. »Vor zwanzig Jahren, im kurzen Frieden, war ich mal da. Archäologisch das reinste Schlaraffenland. Knossos, Phaistos, Górtis et cetera pp., Sie wissen schon. Aber deswegen beneide ich Sie eigentlich nicht. Es ist etwas anderes. Es ist eher ein Gefühl des … Wie soll ich das ausdrücken? Gewissermaßen des Ursprungs. Es ist eine dieser Inseln, von denen wir herkommen. Wir alle.«
4
Und so kommt es, dass Johann pünktlich am nächsten Morgen, das Parteiabzeichen am Aufschlag der Anzugjacke, den rechten Arm hochreißt und Stöver, den Gaupropagandaleiter, mit einem halbwegs zackigen »Heil Hitler!« begrüßt, was Stöver mit einem angedeuteten Zucken der Hand erwidert und ihn auffordert, auf dem Stuhl vor dem massigen Eichenschreibtisch Platz zu nehmen.
Stöver, der vor 1933 Hilfskustos des städtischen Heimatmuseums war, mustert Johann mit einem eher gelangweilten als strengen Blick, blättert in den wenigen Papieren, die auf der ansonsten leeren Fläche des Schreibtisches seltsam verloren wirken, und sieht Johann wieder an. Er sei also besagter, des Neugriechischen mächtiger, mit kunstgeschichtlichen Kenntnissen ausgestatteter Assistent des Archäologieprofessors Lübtow, der ihn für eine verantwortungsvolle Aufgabe auf Kreta nachdrücklich empfohlen habe, eine Aufgabe, die freilich, um das gleich zu sagen, im Vergleich zu den heroischen Leistungen der deutschen Armeen in aller Welt eher unbedeutend erscheine. Gleichwohl nur auf den ersten Blick! Denn, und nun nimmt Stövers Gesicht einen verklärten Ausdruck an, und seine Stimme verschwimmt ins Weihevolle, er, Johann Martens, werde in den Dienst einer gewaltigen, kunstgeschichtlichen Mission gestellt, deren Sinn und Trachten es sei, sämtliche Kunst- und Kulturzeugnisse germanischen Charakters, germanischen Ursprungs und germanischer Einflusszonen in den angestammten Besitz des germanischen Herzvolks rückzuführen, um sie dort für alle Zukunft als heiligen Nationalbesitz horten und ansehen zu können. Martens habe ja gewiss bereits von dem Museumsprojekt in Linz gehört? Wie nämlich Berlin zum geopolitischen Mittelpunkt germanisch-europäischer Raumgestaltung werde, so werde in Linz an der Donau, der dem Führer besonders am Herzen liegenden Stadt der Bodenbewegung, ein gewaltiges europäisches Kunstzentrum errichtet, wie die Welt es noch nicht gesehen habe, ein wahres Mekka oder, wenn er so wolle, Rom der bildenden Künste, das die Werke der germanischen Klassik von den Uranfängen bis zur Gegenwart zu einer noch nie gesehenen, den Betrachter überwältigenden Schau vereinen und die deutsch-germanische Vormachtstellung in Europa auch auf allen ästhetischen Gebieten sinnfällig und kunstsinnig bekunden solle. Der Führer persönlich, Stöver wendet sich zum Hitlerbild, das hinter ihm an der Wand hängt, bestehe nicht nur darauf, aus seiner privaten Sammlung die Paradestücke auszuwählen und dem Museum zu schenken; vielmehr gehe die Teilnahme des kunstbegeisterten und fachlich einschlägig durchgebildeten Führers so weit, Stövers Stimme vibriert vor devoter Rührung, dass ER selbst den Einfall des Lichtes auf die von eigener Hand ausgewählten und gehängten Werke zu bestimmen sich vorbehalte. Auch der kunstsinnige Herr Reichsmarschall habe durchblicken lassen, die eine oder andere Kostbarkeit aus seinen Beständen dem Linzer Kunstmekka zur Verfügung zu stellen, wenn auch vorerst nur als Leihgabe. Ein Projekt also, wie unschwer zu erahnen, von ungeheuren, nachgerade titanischen Ausmaßen, zu dem er, Martens, als Mann germanischer Ur- und Ahnenforschung, nun auf seine Weise beizutragen aufgerufen und verpflichtet sei. Frage er sich nun: Wie das?, falle die Antwort folgendermaßen aus: Was wäre Mekka ohne Byzanz? Was Rom ohne Kreta? Was Berlin ohne Knossos? Was germanische Kultur ohne die minoische? Auf dem Hintergrund dieser sich von selbst beantwortenden Fragen werde er, Martens, nun also in von allerhöchster Stelle ausdrücklich gewünschter Mission nach Kreta entsandt, jener prägermanischen Einflusszone hellenischen Ariertums, um dort einschlägige Werke und Gegenstände ausfindig zu machen, in ihrem Wert zu bestimmen und für anschließende Rückführmaßnahmen ins Herz- und Kernland zu kennzeichnen. Von kulturellem Interesse sei grundsätzlich alles, aus jedem Stil und jeder Epoche, die ja allesamt und ausnahmslos vom germanischen Geist durchwaltet seien. Stöver greift zu einem der vor ihm liegenden Papiere, setzt eine randlose Brille auf und liest geschäftsmäßig vom Blatt: Gemälde, Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen, Bücher, Handschriften, Plastiken, Terrakotten, Möbel mit kunstgeschichtlichem Wert, Gobelins, Teppiche, Stickereien, koptische Stoffe, Porzellan, Bronzen, Fayencen, Majoliken, Keramik, Schmuck. Im Hinblick auf das mit Antiken bekanntermaßen reichlich gesegnete Kreta seien ferner besonders zu beachten: Münzen, Skulpturen, Bronzen, Vasen, Schalen, Gemmen, Waffen, dabei in Sonderheit, falls aufzufinden, auf besonderen Wunsch des Herrn Reichsmarschalls, Jagdwaffen. Und falls er, Martens, bei seinen Exkursionen und Wanderungen über die sagenhafte Insel zufällig noch auf einen echten El Greco stoßen sollte, Stöver beginnt scheppernd zu lachen, sei der ebenfalls dingfest zu machen.
Johann will kein Lachen gelingen, doch reicht es zu einem breiten, komplizenhaft gemeinten Grinsen. Ihm fällt, fast wie ein Schreck, seine Mutter ein, die, wenn sie als Kinder Grimassen schnitten, auf die Uhr zeigte und sagte: Wenn die jetzt stehen bleibt, bleibt auch euer Gesicht immer so stehen. Aber die Uhr an der Wand gegenüber dem Führerbild tickt beharrlich weiter durch die plötzliche Stille. Johanns Mund ist so trocken, dass er das Gefühl hat, die Zunge zersplittere ihm wie Glas, als er endlich hervorwürgt: »Ich verstehe.«
Stöver nickt zufrieden. Gut, der Mann. Was die organisatorischen Modalitäten angehe, bleibe er, Martens, bei gleichen Bezügen zuzüglich Auslandszulage weiterhin Angestellter des archäologischen Instituts und könne somit im Status eines Zivilisten seinen kunstgeschichtlichen Erkundungen frönen, wovon man sich im Hinblick auf die nicht immer hundertprozentig germanentreue Mentalität der kretischen Bevölkerung gewisse Vorteile verspreche. Wo germanischer Mut an seine Grenzen stoße, springe nordische List in die Bresche. Wiewohl also Zivilist, sei er auf Kreta dem Inselkommandanten unterstellt, der, getreu dem Führerprinzip, dort nicht nur militärisch, sondern auch in jeder anderen Beziehung die Kommandogewalt innehabe. Ein Leutnant, wieder blättert Stöver in den Papieren, jawohl, Leutnant Hollbach, sei schriftlich in die Pläne eingeweiht worden, werde sich vor Ort um sämtliche logistischen Fragen und Probleme kümmern und, falls nordische List auf südländisch-welsche Hinterlist treffen sollte, notfalls auch für militärische Hilfestellungen Sorge tragen. Der Wille zur politischen Förderung und Sicherung der werdenden Großraumordnung, Stövers Stimme klirrt entschlossen, müsse nämlich mit dem gebotenen Fanatismus fordern, dass die jüdisch-ungermanische Bezeichnung Völkerrecht, auch und gerade in ihrem fachlichen Schlupfwinkel Kultur, rücksichtslos ausgemerzt werde. Noch Fragen?
Johann, den ein Schwindelgefühl ergriffen hat, will um ein Glas Wasser bitten, lässt es aber sein und schüttelt mechanisch den Kopf.
Ob ihm nicht gut sei?
»Doch, doch«, beeilt Johann sich. »Es ist nur …«
Wahrscheinlich die Vorfreude, mutmaßt Stöver, steht auf und streckt Johann die Hand entgegen, der sie nimmt und schütteln lässt. Für ihn als Archäologen müsse doch ein Traum in Erfüllung gehen. Kreta! Die Aufgabenstellung sei im Übrigen auch detailliert schriftlich niedergelegt und könne zusammen mit den Reiseunterlagen und Papieren bei Stövers Sekretärin abgeholt werden, eine Etage tiefer, zweites Zimmer rechts. Heil Hitler!
Die Mappe mit den Unterlagen unterm Arm, steht Johann zehn Minuten später im nassen Wind eines Herbsttiefs. Blätter taumeln über den glänzenden Blaubasalt des Straßenpflasters, treiben im Rinnstein den eisernen Verstrebungen eines Gullys entgegen, die wie Gefängnisgitter aussehen. Im Rhythmus der Uhr an Stövers Wand tropft Regen auf Haare und Wangen. Fast sieht es so aus, als weine Johann Martens. Er wird nach Kreta reisen. Geht ein Traum in Erfüllung? Oder beginnt ein Albtraum? Verabschieden muss er sich von niemandem mehr, seit Ingrid nicht aus Lübeck zurückkam. Ist er noch wach? Oder träumt er schon?
5
Das Ticken. Träger Rhythmus der Uhr. Tropfen in einem stillen Raum. Ticken. Johann blinzelte. Weißes Licht, in Streifen geschnitten. Kein Gully, keine Gefängnisgitter. Die Streben der blau gestrichenen Holzjalousien vor den Fenstern. Das Weiß der bilderlosen Wände. Das Ticken kam vom Dach. Letzte Regentropfen hatten sich irgendwo gesammelt, liefen ab, trafen schnalzend den wassersatten Boden.
Er schlug die Decken zurück, stand auf, reckte sich, ging zum Waschbecken. Das Wasser schoss unter hohem Druck aus der Leitung, hatte eine bräunliche Färbung und roch erdig, als er den Kopf unter den Strahl hielt. Es musste Regenwasser aus einer Zisterne sein. Neben dem Spirituskocher standen ein Tonkrug mit Trinkwasser und ein Glas. Er trank. Der Geschmack so klar, dass fast etwas Süßes mitschwang. Als er das Glas nachfüllte, klopfte es an der Tür.
»Herr Dr. Martens?« Eine gedämpfte, männliche Stimme. »Schlafen Sie noch?«
Johann schob den Riegel zurück, öffnete. Vor ihm stand ein Mann in Kakiuniform, aber ohne Rangabzeichen. Er salutierte nicht und hob auch nicht den Arm zum Hitlergruß, sondern streckte Johann die Hand entgegen, fester Druck, und stellte sich als Leutnant Friedrich Hollbach vor. Er war etwa in Johanns Alter, hager, scharf geschnittenes, braun gebranntes Gesicht unter dichten, dunkelblonden Haaren, graue Augen. Sie setzten sich an den Tisch, auf dem Hollbach eine Ledermappe ablegte und sich mit floskelhafter Höflichkeit erkundigte, ob Johann eine gute Reise gehabt habe und mit dem Quartier zufrieden sei.
Frau Xenakis erschien mit einem Tablett, wünschte einen Guten Morgen, was Johann auf Griechisch erwiderte. Sie lächelte ihm zu und setzte ein dampfendes Mokkakännchen aus Kupfer, Tassen, Brot und eine Honigschale vor ihnen auf den Tisch.
»Efcharisto«, sagte Johann, und wieder lächelte die Frau und ging.
»Donnerwetter! Dass Sie wirklich Griechisch sprechen …«, sagte Hollbach gedehnt, wie erstaunt, und schenkte den Mokka in die winzigen Tassen. »Ich bin zwar darüber informiert worden«, er klopfte auf die Ledermappe, »aber wenn Sie wüssten, mit was für Verständigungsproblemen wir es hier zu tun haben. Die Dolmetscher kann man an einer Hand abzählen. Die sprechen dann zwar Griechisch und halbwegs Deutsch oder umgekehrt, aber wir müssen uns auch noch mit unseren italienischen«, er zögerte einen Moment und grinste, »Waffenbrüdern verständigen, die den Ostteil der Insel besetzt halten. Inwieweit sind Sie eigentlich über die Lage informiert?«
Johann zuckte mit den Schultern, schlürfte den heißen, sehr süßen Mokka, setzte die Tasse ab. »Na ja, was man in Deutschland so mitbekommt. Kreta als unversenkbarer Flugzeugträger des Afrikakorps und …«
»Unversenkbar schon«, unterbrach ihn Hollbach, »fehlen nur die Flugzeuge, jedenfalls in ausreichender Menge. Auf dem Meer haben die Briten das Kommando. Das war von Anfang an so. Deshalb waren wir im Mai 41 auch zu der reinen Luftlandeoperation gezwungen. Von unseren Heldentaten haben Sie ja garantiert gehört. Sprung aus den Wolken mit Max Schmeling in vorderster Front.« Hollbach lachte verkrampft und spöttisch. »Ein Zuckerschlecken war das allerdings nicht, und Glück gehabt haben wir auch. Aber das gehört dazu. Leider kommt man sich hier manchmal nicht wie auf einem Flugzeugträger vor, sondern wie in einem Gefangenenlager. Wir haben enorme Versorgungs-, Transport- und Nachschubprobleme, weil über See so gut wie nichts geht. Die meisten meiner Leute, die mit mir abgesprungen sind und die Tommies rausgeschmissen haben, sind seitdem nicht auf Heimaturlaub gewesen. Ich auch nicht. Gut, ich will mich nicht beklagen. Die Insel ist ja ganz schön, aber auch ganz schön langweilig. Kein Wunder, dass viele Kameraden lieber nach Russland wollen, wo sie wirklich gebraucht werden. Viele melden sich freiwillig, aber man lässt sie nicht. Weil man sie nicht von hier wegbekommt. Und weil man eine britische Invasion befürchtet. Groteske Situation.« Hollbach griff zu dem Brot und schnitt ein paar Scheiben herunter. »Mehl ist hier übrigens Mangelware«, sagte er und schob sich Brot in den Mund. »Echtes Mehl, meine ich. Es gibt schon Brot aus Kastanienmehl. Ekelhaft. Wie dem auch sei: Nachdem wir Kreta erst einmal erobert hatten, verfügten wir im Prinzip über hervorragende Voraussetzungen für eine Offensive im Mittelmeerraum. Zu der ist es aber nicht gekommen, weil sich die Idio…«, er hustete, »’tschuldigung, hab mich verschluckt, weil man sich in Berlin mehr für Russland interessiert hat. Jetzt geht es nur noch darum, die Insel mit möglichst geringem Aufwand zu halten. Solange deutsche Truppen in Nordafrika kämpfen, sind wir in der Tat der Flugzeugträger für die Hin- und Rücktransporte. Wie schmeckt Ihnen übrigens der Honig? Das ist eine kretische Spezialität.«
»Gut, wirklich ausgezeichnet«, sagte Johann kauend. »Aber jetzt läuft doch in Nordafrika eine britische Gegenoffensive, und …«
»Die läuft nicht nur«, sagte Hollbach kalt, »die rennt. Die Cyrenaika ist schon von uns geräumt, Montgomery steht kurz vor Tripolis. Und deshalb müssen wir auch mit einem britischen Angriff auf Kreta und die anderen Stützpunkte in der Ägäis rechnen. Wenn aus dem Raum Suez ein massiver Vorstoß erfolgt, dessen Ziel die Lahmlegung unserer Ölversorgung aus Rumänien sein dürfte, ist es hier vorbei mit dem süßen Nichtstun. Deshalb gibt es einen Befehl des Grö…«, wieder zögerte Hollbach, »einen Befehl aus Berlin, Kreta zur Festung auszubauen. Wir sprengen Bunker und Stellungen in die Felsen, legen Minen, bauen die Flugplätze aus. Zu dem Zweck müssen wir Sperrgebiete ausweisen und eine ganze Menge Leute zwangsumsiedeln. Das gibt böses Blut in der Bevölkerung und stärkt das verdammte Andartiko.«
Hollbach kratzte mit einem Löffel im Kaffeesud am Boden seiner Tasse herum. Für eine Weile herrschte Schweigen. Johann lauschte auf das Tropfen vom Dach, aber es war nichts mehr zu hören. »Und was, bitte, ist das verdammte Andartiko?«, fragte er schließlich.
Hollbach verzog das Gesicht zu einem gequälten Grinsen. »Davon hört man in Deutschland natürlich nichts. Andarten, das sind die kretischen Partisanen. Diese Banden machen uns schwer zu schaffen, und wenn es so weitergeht, machen die uns am Ende mehr Probleme als die englische Armee. Die militärische Lage ist derzeit unerfreulich, aber zumindest übersichtlich. Das Andartiko ist höchst unerfreulich und völlig unübersichtlich. Wir haben ihnen auf Befehl und manchmal auch ohne Befehl die Peitsche gegeben und gelegentlich auch das Zuckerbrot. In den Griff bekommen haben wir damit gar nichts. Das Andartiko ist eine wüste Gemengelage, die vermutlich nicht einmal die Kreter selbst durchschauen. Es gibt sozialistische Gruppen. Es gibt republikanische Gruppen. Es gibt Separatisten, die Kreta von Griechenland lösen wollen. Es gibt sogar Royalisten, obwohl die Kreter eher Antiroyalisten sind. Es gibt welche, die sind von allem etwas. Es gibt andere, die sich als Andarten bezeichnen, aber eigentlich nur Banditen sind. Gemeinsam sind ihnen drei Dinge: Erstens bekämpfen sie die deutsche Besatzung. Zweitens bekämpfen sie sich gegenseitig. Und drittens arbeiten sie gelegentlich mit uns zusammen, wenn sie sich daraus Vorteile bei ihren internen Streitigkeiten und unterschiedlichen Zielen versprechen. Das wechselt so häufig, dass niemand genau weiß, woran er mit wem eigentlich ist. Schließlich treiben sich noch eine Menge britischer Agenten auf der Insel herum, die natürlich Kontakte zum Andartiko pflegen. Sie verstecken sich im Süden, wo unsere Patrouillen so gut wie nie hinkommen, oder im italienischen Teil, wo sie unsere Verbündeten mit ihrer bekannten Laschheit lieber gewähren lassen, als sich mit ihnen und damit den Andarten anzulegen. Vermutlich gibt es im Süden sogar noch versprengte britische und neuseeländische Truppen, die von der Royal Navy nicht mehr evakuiert werden konnten. Solange sie uns nichts tun, können sie uns natürlich scheißegal sein. Gefangene sind das Letzte, was wir hier brauchen. Die Versorgung für uns selbst ist schwierig genug. Zum Problem würden sie allerdings, wenn es tatsächlich den Versuch einer britischen Invasion gäbe. Sie sehen also, was für ein Chaos im Paradies herrscht. Jedenfalls müssen Sie auf der Hut sein, wenn Sie sich demnächst auf der Insel bewegen und Ihrem Auftrag nachgehen. Allerdings sind die Kreter auch auf geradezu überwältigende, mich manchmal beschämende Weise gastfreundlich. Das fängt bei Bauern und Hirten an, die Ihnen Honig und Käse schenken, obwohl sie selbst am Hungertuch nagen, geht über diese Frau Xenakis, bei der Sie Quartier haben, und endet bei …« Hollbach verstummte und wirkte für einen Moment verstört.
»Endet wo?«, fragte Johann.
»Da es sowieso jeder weiß und Sie es sonst über kurz oder lang von kretischer Seite hören würden, kann ich es Ihnen auch gleich erzählen.« Hollbach schüttelte den Kopf, kratzte weiter Muster in den Kaffeesud und seufzte. »Ein Kreter namens Xilouris besaß einen reinrassigen Araberschimmel, den er nach der Eroberung einem deutschen General schenkte. Das dürfte wohl ein Angebot zur Kollaboration gewesen sein, geschah jedoch auch aus Anerkennung und Bewunderung für unsere militärische Leistung. Die Kreter sind merkwürdig, ein kämpferisches Volk, wild, unberechenbar und zugleich friedliebend. Kurze Zeit später sahen wir uns gezwungen, im Kampf gegen das Andartiko Geiseln zu erschießen. Befehl ist Befehl, und gegen diese Banden muss rücksichtslos durchgegriffen werden. Unter den Hingerichteten war nun auch der Sohn dieses Xilouris. Der Mann reagierte mit fassungslosem Entsetzen, dann mit Hass. Jetzt führt er eine Andartengruppe an. Kann man ihm das ernsthaft verdenken? Wir wollen die Insel befrieden und machen uns damit Feinde. Aber ich will Ihnen keine Angst einjagen. Da Sie hier als der Zivilist auftreten, der Sie sind, dürften Sie jedenfalls weniger in Gefahr geraten als unsere Soldaten. Und damit«, Hollbach tippte auf die Ledermappe, die er auf dem Tisch abgelegt hatte, »wären wir also bei Ihrem«, wieder legte er eine dieser Pausen ein, als müsse er über etwas nachdenken, »bei Ihrem Auftrag und meiner Rolle in dieser Angelegenheit.«
Johann strich sich mit der Zunge über den Gaumen, auf dem der dickflüssige Honig eine stumpfe, nach Zucker und Akazien schmeckende, pelzige Schicht hinterlassen hatte, holte sich ein Glas Wasser aus dem Krug, trank. »Man hat mir gesagt, dass Sie über meinen Auftrag informiert sind und mir weitere Instruktionen geben werden.«
Hollbach nickte, klappte die Mappe auf und entnahm ihr einen eng beschriebenen Bogen Kanzleipapier. »Auf dieser Liste«, er schob sie Johann über den Tisch, »sind Orte und Dörfer, Kirchen und Klöster im Westteil der Insel notiert, in denen angeblich zu finden sein soll, was Sie«, erneute Pause, »zu katalogisieren haben. Sie ist gemäß unserer Anweisungen von kretischen Beamten in Hiraklion erstellt worden. An einer weiteren Liste wird noch gearbeitet. Sie können sie sich demnächst in Hiraklion abholen. Inwieweit diese Listen zutreffend sind, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis. Sie werden es ja früh genug merken.«
Johann warf einen Blick auf die Ortsnamen in griechischer Schreibmaschinenschrift. »Ich kenne mich auf der Insel nicht aus«, sagte er, »wie soll ich da wissen …«
»Sie bekommen eine detaillierte Karte«, Hollbach öffnete die Mappe und schob Johann eine zusammengefaltete Landkarte über den Tisch. »Hier. Und da Sie mit dieser Karte nicht weit kommen werden, kriegen Sie noch einen einheimischen Führer dazu.« Hollbach schluckte, schien dem letzten Wort nachzulauschen. »Er wird auch Ihr Fahrer sein. Heute Abend werden Sie ihn kennenlernen. Der Mann weiß, was Ihre Aufgabe ist, und er freut sich darauf, Ihnen Kreta und seine Kunstschätze zu zeigen – soweit überhaupt noch etwas zu finden ist. Ich habe da so meine Zweifel. Die Museen sind voll, aber das Land hat nichts. Und um die Museen müssen Sie sich nicht kümmern. Der Mann, der Sie führen wird, weiß aber nicht, was meine Befehle sind, und darf es unter keinen Umständen erfahren. Sie sind verpflichtet, darüber strengstes Stillschweigen zu bewahren, in Ihrem eigenen Interesse. Sie sind nur der Kunsthistoriker oder Archäologe oder beides, der den Bestand sichtet, einschätzt und einen Katalog erstellt. Und Sie haben mich regelmäßig über die Fortschritte zu unterrichten.«
»Sonst nichts?«
»Sonst nichts! Ich habe allerdings den Befehl, die von Ihnen als wertvoll festgestellten Gegenstände sicherstellen und in ein Bergungsdepot verbringen zu lassen. Und falls Sie Probleme bekommen sollten, habe ich Ihnen militärischen Schutz zu gewähren. Sonst nichts«, Hollbach seufzte, »nichts …«
Wieder war es still im Raum. Schattenrisse der Fensterläden an der weißen Wand. Starr. Gittergleich. Wenn man den Blick darauf heftete, entstand ein kaum wahrnehmbares Flimmern, aber Johann wusste nicht, ob dies Flimmern von seinen Augen ausging oder von den Mustern aus Sonne, Kalk und Schatten. »Und was«, sagte er plötzlich tonlos, wie abwesend, »halten Sie persönlich von der Sache?«
Hollbach, der mit übergeschlagenen Beinen und verschränkten Armen am Tisch hockte, wich Johanns Blick aus, griff zu einem Bleistift, tippte sich mit dem stumpfen Ende gegen die Schneidezähne und zuckte mit den Schultern. »Eine persönliche Meinung steht mir nicht zu. Ich habe meine Befehle auszuführen. Sonst nichts. Und Sie haben Ihren Auftrag. Fertig. Aus.« Hollbach stand auf und nahm sich ein Glas Wasser aus dem Krug. »Kommen Sie heute Abend um sieben zu den venezianischen Lagerhäusern am Hafen. Dort gibt es ein Restaurant, und dort werde ich Sie mit Ihrem Führer bekannt machen.«
»Mein Führer also«, echote Johann und faltete die Liste zusammen.
Hollbach sah ihn über den Rand des Wasserglases aus zusammengekniffenen Augen an. Misstrauisch? »Ganz recht. Und Fahrer.« Lächelte er? »Ach, und übrigens«, sagte er leise und langsam, jedes Wort einzeln betonend, »katalogisieren können Sie natürlich nur das, was Sie zu Gesicht bekommen und was Sie fotografieren. Ihnen wird zu dem Zweck eine Kamera aus Heeresbeständen zur Verfügung gestellt. Die bringe ich Ihnen heute Abend mit. Und was mich betrifft«, noch leiser jetzt, fast verschwörerisch, »ich kann nur konfiszieren und deponieren, was Sie fotografiert und katalogisiert haben.«
Johann sah ihn fragend an, aber Hollbach blickte angestrengt auf die weiße Wand, als hätte er dort etwas entdeckt. »Ich glaube, ich verstehe«, sagte Johann und nickte.
»Glauben ist gut«, Hollbach setzte das Glas ab. »Verstehen ist besser. Ich muss mich jetzt verabschieden.« Er griff zu seiner Mappe und wandte sich zur Tür. »Ach ja«, noch einmal drehte er sich zu Johann um, »Ihr Quartier hier wird natürlich von der Kommandantur bezahlt. Sie sind sozusagen unser Gast. Und diese Frau Xenakis ist zuverlässig. Zumindest braucht sie das Geld.«
»Was ist mit ihrem Mann?«, fragte Johann. »Sie hat gestern gesagt, dass sie hofft, dass er bald zurückkommt.«
»Der sitzt in einem Kriegsgefangenenlager auf dem griechischen Festland. Gehörte zur kretischen Division der griechischen Armee. Er ist Arzt und wird hier dringend benötigt. Für die Bevölkerung, aber auch für uns. Wir sind darum bemüht, ihn aus dem Lager zu holen, was relativ einfach ist. Aber wir müssen ihn auch nach Kreta bringen, was relativ schwierig ist. Die Tommies schießen auf alles, was schwimmt. Frau Xenakis weiß das«, er grinste, »und das macht sie noch zuverlässiger. Wir sehen uns heute Abend am Hafen.« Hollbach ging. Die Tür fiel hinter ihm zu.
Johann starrte die Tür an. Blaue, abblätternde Farbe auf Holz. Daneben die Wand. Kalk auf Mörtel. Weiß. Draußen schrie ein Vogel. Ein paar Risse wie Spinnwebfäden. Schwarz. Er stellte die Tassen aufs Tablett. Unter den Kratzspuren im dunkelbraunen Kaffeesud das Porzellan. Weiß. Sonst nichts.
6
Der Sturm, durch den Johann gestern geflogen war, trieb letzte Nachwehen über die Insel, eine frische, seegängige Brise, die sich manchmal zu heftigen Böen bündelte und das Meer immer noch zu Schaumkämmen reizte. Wie beschneite Kolonnen marschierten sie grau über die Wasser der Bucht, zerfielen und bildeten sich im Zerfall aufs Neue. Der Sturm, der durch die Welt tobte, Kolonne auf Kolonne in den Tod riss. Und Johann stand am Kai von Chania, wie in einem Traum oder wie in Arkadien oder wie in einem Gefängnis ohne Mauern und Gitter, und sollte Listen erstellen. Sonst nichts. Erst wenn der Sturm sich gelegt haben würde, entstünden keine Schaumkämme mehr, keine neuen Marschkolonnen. Während die Sonne hinter milchigen Dunstschwaden unterging, wurde der Schaum vom Wind aufgenommen und zum nächsten Wellenkamm getragen, bildete strähnige Schleifen. Eine Wellenreihe griff in die andere, hin und zurück, Schriftzeichen des Meeres, Kanzleipapier des Wassers, Listen aus Zufall und Wind.
Er war den ganzen Tag ziellos durch die Stadt gestreift, durch winklige Gassen und Torbögen, vorbei an bröckelnden Fassaden und Portalen venezianischer Paläste, über stille Innenhöfe, wo Brunnen sprudelten, vorbei an Kirchen und Moscheen und der Synagoge, die sich seit fast dreihundert Jahren unversehrt und wie vergessen in einer Gasse versteckte, und in einer anderen Gasse hatte er plötzlich vor einer Loggia gestanden, die mit einem Wappen und einer Inschrift geschmückt war: nulli parvus est census cui magnus est animus – Keiner ist gering geschätzt, der großherzig ist. Auch diese Inschrift hing seit Jahrhunderten hier, und dennoch kam es ihm so vor, als sei sie eben erst in den Sandstein gemeißelt worden und gelte ihm. Keiner ist gering geschätzt, der großherzig ist. Die Übersetzung war klar, doch schien es unter oder über ihr noch eine andere Bedeutung zu geben, Worte, gesprochen in leiser Eindringlichkeit.
Eine dieser Gassen, in der ausschließlich Lederwaren angeboten wurden, Schuhe, Taschen, Sättel, Gürtel, Jacken, Kappen, Mäntel, mündete in einen Eingang der Markthalle, einem kreuzförmigen Gebäude im neoklassizistischen Stil. In den Gängen wimmelte dichtes Gedränge und summender Lärm, über den Verkaufsständen lagerte eine Duftwolke aus Orangen und Salzlake, Blumen und Blut, schwerem Parfüm, Geruch von Sackleinen, Rosinen, Schweiß, Ruß und frischem Kistenholz, der stechende Dunst von Schafwolle und Eselsfell. Im Anblick der betäubenden Fülle von Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch erinnerte Johann sich an Hollbachs Klage über die schlechte Versorgungslage und wunderte sich. Bei einem Imbissstand, an dem ein Mädchen bediente, kaufte er zwei Blätterteigtaschen, gefüllt mit Ziegenkäse und Hackfleisch. Das Mädchen, fast noch ein Kind, wickelte das von Fett triefende Gebäck in Zeitungspapier und reichte ihm das Päckchen mit einem Lächeln. Woher er käme?
Germania.
Das Lächeln erfror.
Er zahlte, verließ die Markthalle, schlenderte wieder in Richtung Hafen, den Hügel zum Kastell hinauf, wo er sich in verfallenen Arkaden niederließ, mit dem Rücken an einen Säulenstumpf gelehnt, den Blick aufs Meer, die Teigtaschen aß und eine Zigarette rauchte. Die tief stehende Nachmittagssonne verströmte im Windschatten eine dumpfe, ungewohnte Wärme. Er zog den Mantel aus, blinzelte ins langsam trüber werdende Lichtgeflimmer auf dem Wasser und fiel in einen flachen Dämmerzustand. Lebte er nicht seit Jahren im Halbschlaf? Die Augen stets so weit geschlossen, dass er nicht sehen musste, was er nicht sehen wollte. Die Augen stets so weit offen, dass er die Schlupflöcher erkennen konnte, die Lübtow ihm bot und in denen er sich verbarg vor Terror und Krieg. Getarnt durch lasches Mitläufertum, das er, wenn es opportun schien, mit dem Parteiabzeichen am Revers straffte, geschützt durch schweigende Anpassung und Selbstverleugnung, durch schlaue Widerstandslosigkeit hinter der Mauer einer Archäologie, die Lübtow schlechten Gewissens, aber mit erstaunlichem Einfallsreichtum zur unentbehrlichen Hilfswissenschaft völkischer Rassenkunde umgebogen und umgelogen hatte.
»Die Schweinerei«, sagt Lübtow, als Johann ihm von seinem Besuch bei Stöver erzählt, »die Schweinerei, die Sie auf Kreta treiben sollen, rettet Ihnen wahrscheinlich das Leben. Aber Ihre Seele müssen Sie schon selber retten.«
Seine Freunde und Kollegen verreckten an allen Fronten, die Städte in Deutschland verwandelten sich in Trümmerlandschaften, gegen die die Reste dieses venezianischen Kastells eine Idylle waren. Scherben, geborstene Mauern, Quader und Wegplatten, verwachsen, beweidet fast schon wieder. Alte Steine und ein paar Ziegen. Es gab sehr viel auszugraben hier. Er könnte so lange graben, bis er selbst daran wäre, ausgegraben zu werden. Inzwischen verschlang alles die Erde. Irgendwo wurde gegraben, irgendwo fielen Bomben, und anderswo wuchs wieder Gras. Ob in den Trümmern von Rostock und Lübeck schon Sträucher wuchsen, schon Ziegen weideten? Ob der Schrecken sich schon selbst begrub? Die Trümmer kannten den Tod. Johann kannte nur die Trümmer. Schwatzte nicht auch er den Dingen die Dauer auf, den zerfallenen Werken den Wert des Unvergänglichen, und glaubte er nicht schon selbst an die hohlen Phrasen der Propaganda, die den Leichenbergen Unsterblichkeit zubrüllten? Die Trümmer, zwischen denen er tagträumte, wussten es besser. Ihre Ewigkeit war nur ein Missverständnis, gewollt, sehenden Auges, weil man die Augen verschloss, weil man den Tod nicht zu Gesicht bekommen wollte. Zu Gesicht bekommen, ja. Plötzlich, von einer Windböe aus dem Dämmer geweckt, wusste er die Bedeutung, die unter der Inschrift verborgen war. NULLIPARVUSESTCENSUSCUIMAGNUSESTANIMUS. Keiner ist gering geschätzt, der großherzig ist. Das hieß es wortwörtlich. Es hieß aber auch dies: Katalogisieren kann man nur, was man zu Gesicht bekommt, wovor man nicht die Augen verschließt. Im Wegsehen war Johann geübt. Indem er wegsah, mogelte er sich durch und blieb am Leben, während um ihn herum alles in Scherben fiel. Wenn er jetzt weiter wegsehen würde, könnte er dann Kunstwerke retten? Vielleicht sogar seine Seele?
Er war lange vor der verabredeten Zeit bei den venezianischen Arsenalen angekommen, hatte dort den Kolonnen der Wellen zugesehen, die schließlich vom abnehmenden Wind eingeebnet wurden, grau und stumpf versanken, während die Gischt schmolz wie Schnee auf ödem Brachland.
Dann setzte er sich vor der Tür des Restaurants an ein Tischchen. Der Wirt kam erst, als Johann durch die geöffnete Tür ins Innere gerufen hatte, ein großer, breitschultriger Mann, graues, kurz geschorenes Haar, grauer, über die Mundwinkel hängender Schnurrbart, schwarze Augen unter struppigen, grau melierten Brauen; Johann schätzte sein Alter auf sechzig. Er trug hohe Stiefel und Pluderhosen, eine kurze gestickte, vorn offene Jacke über weißem Hemd, eine schwarze Leibschärpe, und um die Stirn hatte er ein zusammengerolltes, fransiges Tuch geschlungen.
Er brachte weißen Wein in einer Metallkaraffe und Wasser, machte Johann ein Kompliment für sein Griechisch, fragte, ob er der mit dem Leutnant verabredete Mann sei, lächelte anerkennend, als Johann nickte, und brachte ihm, ohne dass er danach gefragt hätte, ein Gläschen wasserklaren Schnaps. Tsikoudiá sei das, Trester. Er stellte ein Tellerchen mit Sonnenblumenkernen dazu und verschwand wieder im Lokal, in dem ein paar alte Männer Mokka tranken, Perlenketten klackernd durch die Finger laufen ließen und über einem Brettspiel brüteten, das Johann nicht kannte.