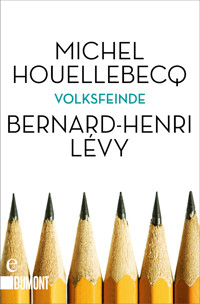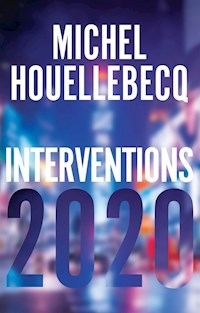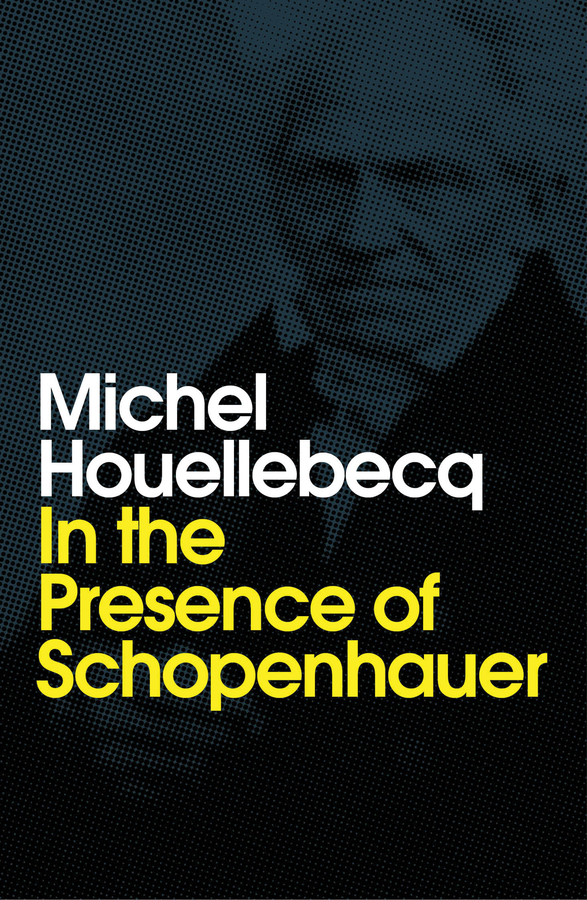17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Literatur, Religion, Glaube, Meinungsfreiheit, Konservatismus, Liebe – in seinen neuesten Essays beschäftigt sich Michel Houellebecq mit den Themen, die ihn seit jeher bewegen. Und erläutert erneut Positionen, die man von ihm kennt; Positionen, die mal provozieren, mal intellektuell anregen. Dabei geht es auch immer um seine Haltung als Schriftsteller, sei es in sehr persönlichen Gesprächen wie mit seinem Freund, dem Autor Frédéric Beigbeder, oder in Diskussionen wie mit dem Literaturkritiker Marin de Viry oder der Literaturwissenschaftlerin Agathe Novak-Lechevalier. In seinen Essays zeigt sich, dass Michel Houellebecq zu Recht zu den wichtigsten literarischen Stimmen unserer Zeit zählt und als »der umwerfendste Schriftsteller unserer Gegenwart« (Julia Encke, FAS) bezeichnet wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Literatur, Religion, Glaube, Meinungsfreiheit, Konservatismus, Liebe – in seinen neuesten Essays beschäftigt sich Michel Houellebecq mit den Themen, die ihn seit jeher bewegen. Und erläutert erneut Positionen, die man von ihm kennt; Positionen, die mal provozieren, mal intellektuell anregen. Dabei geht es auch immer um seine Haltung als Schriftsteller, sei es in sehr persönlichen Gesprächen wie mit seinem Freund, dem Autor Frédéric Beigbeder, oder in Diskussionen wie mit dem Literaturkritiker Marin de Viry oder der Literaturwissenschaftlerin Agathe Novak-Lechevalier.
In seinen Essays zeigt sich, dass Michel Houellebecq zu Recht zu den wichtigsten literarischen Stimmen unserer Zeit zählt und als »der umwerfendste Schriftsteller unserer Gegenwart« (Julia Encke, FAS) bezeichnet wird.
© Philippe Matsas, Flammarion
MICHEL HOUELLEBECQ wurde 1958 geboren. Er gehört zu den wichtigsten Autoren der Gegenwart, seine Bücher werden in über vierzig Ländern veröffentlicht. Für den Roman KARTE UND GEBIET (2011) erhielt er den renommiertesten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt. Sein Roman UNTERWERFUNG (2015) stand wochenlang auf den Bestsellerlisten und wurde mit großem Erfolg für die Theaterbühne adaptiert und verfilmt. Zuletzt erschien SEROTONIN (2019).
STEPHAN KLEINER, geboren 1975, lebt als literarischer Übersetzer in München. Er übertrug u.a. Geoff Dyer, Chad Harbach, Tao Lin, Nick Hornby und Hanya Yanagihara ins Deutsche.
MICHEL HOUELLEBECQ
EIN BISSCHEN SCHLECHTER
Neue Interventionen
Essays
Aus dem Französischen von Stephan Kleiner
Die französische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel ›Interventions 2020‹ bei Flammarion, Paris.
© Michel Houellebecq and Flammarion Paris, 2020
Erste Auflage 2020
© 2020 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Stephan Kleiner
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
© plainpicture/ballyscanlon/Kollektion Rauschen
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7079-0
www.dumont-buchverlag.de
DER KONSERVATISMUS, QUELLE DES FORTSCHRITTS
Der Text erschien erstmals in: Le Figaro, 8.November 2003; erneut veröffentlicht in: Houellebecq, »Les Cahiers de l’Herne«, Paris, Éditions de l’Herne, 2017.
DASPARADOX IST nur allzu offensichtlich: Der Konservatismus kann ebenso eine Quelle des Fortschritts sein, wie die Faulheit die Mutter der Effizienz ist. Was weitgehend erklärt, warum die konservative Haltung so selten begriffen wird.
Seit dem Auftauchen des Begriffs nouveau réactionnaire in den Schriften des gerissenen Lindenberg hat ihn meines Wissens niemand mit Sinn gefüllt. Er ist weder inhaltlich noch in irgendeinem weiteren Sinne definiert, wie Jacques Braunstein in Elle klug angemerkt hat. Das vordringliche Ziel des Kolloquiums in Deauville ist, wie mir scheint, dieser uneindeutigen Situation zu entkommen, die über den unglücklichen Lindenberg hinaus die intellektuelle Glaubwürdigkeit seines Geldgebers, des Bullen Plenel, und sogar die Beständigkeit eines »linken Denkens« infrage stellt, zu dessen letzten Echos er zählt (das tote Leuchten längst verloschener Sterne etc.).
Um ein zukünftiges Scheitern der Debatte zu vermeiden, möchte ich hier versuchen, den Weg etwas frei zu machen. Ontologisch betrachtet, setzt jede Reaktion eine Aktion voraus; gibt es also neue Reaktionäre, bedeutet das, es muss auch neue Progressive geben. Wie soll man sie definieren? Unter Rückgriff auf Taguieffs geniale Terminologie können wir den neuen Progressivismus leicht dem bougisme, also einem gewissen Aktionismus, zuschlagen.
Anders als sein großer Bruder erkennt der neue Progressive den Fortschritt nicht anhand seines intrinsischen Werts, sondern anhand seiner Neuartigkeit. Alles in allem existiert er in einem in seiner Einfalt sehr hegelianischen Zustand der permanenten Offenbarung, in dem alles neu Erscheinende schon aufgrund der schlichten Tatsache seines Erscheinens gut ist. Damit wäre es genauso reaktionär, sich dem Tanga zu widersetzen wie dem islamischen Schleier, dem »Loft« ebenso sehr wie den Predigten Tariq Ramadans. Alles neu Erscheinende ist gut.
Der neue Reaktionär, dem das Neue prinzipiell widerstrebt, erscheint dagegen wie ein Griesgram. Hätten solche Begriffe irgendeinen Sinn, wäre er genau das, was wir einen »Konservativen« (Royalist in der Monarchie, Stalinist unter Stalin usw.) nennen müssten. In ihrer gemeinsamen Opposition gegen die Position des gesunden Menschenverstands, die darin besteht, das Neue gutzuheißen, wo es gut ist, und abzulehnen, wo es schlecht ist, erscheinen auf den ersten Blick beide Haltungen gleichermaßen stumpfsinnig. Aber diese Symmetrie stimmt nur zum Teil. An diesem Punkt ließen sich ungefähr vierzehn Beobachtungen anbringen; aus Platzgründen will ich mich auf zwei beschränken.
Erstens strengt Innovation an. Jede Routine, gut oder schlecht, hat den Vorteil, routinemäßig abzulaufen und also mit minimalem Aufwand betrieben werden zu können. Aller Konservatismus wurzelt in intellektueller Faulheit. Nun ist die Faulheit, die nach der Synthese strebt, der Suche nach gemeinsamen Eigenschaften jenseits oberflächlicher Unterschiede, in intellektueller Hinsicht jedoch eine mächtige Kraft. In der Mathematik wird man von zwei Beweisen immer den kürzeren wählen, der das Gedächtnis weniger belastet. Das recht mysteriöse Konzept der Eleganz eines Beweises ist in Wahrheit quasi deckungsgleich mit seiner Kürze (was nicht überrascht, bedenkt man, dass sich die Eleganz einer Bewegung annähernd daran messen lässt, wie ökonomisch sie ausgeführt wird).
Zweitens ist die wissenschaftliche Methode in ihrer Gesamtheit (begriffen als Wechsel zwischen Phasen der theoretischen Ausarbeitung und der experimentellen Überprüfung) zunächst einmal eine im Wesentlichen konservative Denkweise. Eine Theorie ist eine wertvolle, hart erkämpfte Sache, und ein Wissenschaftler wird sie nur dann aufgeben, wenn ihn die experimentellen Fakten wirklich dazu zwingen. Da er nur aus schwerwiegenden Gründen von einer Theorie ablässt, wird er nie versucht sein, zu ihr zurückzukehren.
Aus diesem Konservatismus des Prinzips folgt die Möglichkeit effektiven Fortschritts, ja sogar, sollten die Umstände es erfordern, echter Revolution (seit Kuhn »Paradigmenwechsel« genannt). Es ist daher kein bisschen paradox zu behaupten, dass der Konservatismus ebenso Quelle des Fortschritts ist wie die Faulheit die Mutter der Effizienz.
Die politische Übersetzung dieser Prinzipien hat, da stimme ich zu, nichts Unmittelbares an sich; darum wird die mäßig sympathische konservative Haltung mit ihrem wenig ideologischen Inhalt so selten begriffen. Metaphorisch ausgedrückt, würde ich sagen, dass der Konservative dazu neigt, die Gesellschaft zu einer perfekten Maschine zu idealisieren, bei der sich der Übergang von einer Generation zur nächsten unter minimalem Aufwand vollzieht, bei der versucht wird, Leid und Zwänge auf die gleiche Weise zu reduzieren, wie man in der Mechanik versucht, Reibung zu minimieren (was beispielsweise eine drastische Beschränkung der Bevölkerungsdichte zur Folge hat). In jeder Situation wird er die von einem Poitevin-Taoismus durchdrungenen Prinzipien des verstorbenen Senators Queuille (wie etwa: »Es gibt kein politisches Problem, das sich nicht durch Untätigkeit lösen ließe.«) in Erwägung ziehen; er wird den Ausspruch des alten Goethe nicht vergessen, demzufolge die Ungerechtigkeit der Unordnung vorzuziehen sei – was angesichts des fruchtbaren Nährbodens der Ungerechtigkeiten, den jede Unordnung darstellt, nur dem Anschein nach zynisch ist.
Einer der letzten wahren Konservativen war zweifellos der von Huxley erwähnte englische Lord, der 1940 einen Leserbrief an die Times schrieb, in dem er vorschlug, den Krieg doch mit einem Kompromiss zu beenden (die, wie Huxley schreibt, »sonst so konservative Zeitung« weigerte sich, den Brief abzudrucken).
Im Bewusstsein, dass sich das menschliche Leben in einem biologisch, technisch und gefühlsmäßig (also nur ganz nebenbei politisch) bestimmten Umfeld abspielt, im Bewusstsein, dass es auf die Verfolgung privater Ziele abhebt, wird seine politische Überzeugung von einer instinktiven Ablehnung geprägt sein. Der Revolutionär, der Widerständische, der Patriot, der Unruhestifter wird ihm vor allem als verachtenswert erscheinen, angetrieben von Dummheit, Eitelkeit und der Gier nach Gewalt. Im Gegensatz zum Reaktionär wird der Konservative daher auch keine Helden oder Märtyrer haben; wenn er niemanden rettet, wird er auch niemanden zum Opfer machen; alles in allem wird er nichts besonders Heroisches an sich haben; doch er ist, das ist einer seiner Vorzüge, ein sehr ungefährliches Individuum.
DER VERLORENE TEXT
Dieser Text ist das Vorwort des Buches L’imaginaire touristique von Rachid Amirou (CNRS Éditions, 2012).
WÄHREND MEINESE-MAIL-Austauschs mit seinem Bruder Amar Amirou, der es freundlicherweise übernahm, die verstreuten Texte zu sammeln, erwähnte ich mehrfach einen Artikel, dessen Inhalt ich beinahe vollständig vergessen hatte, bis auf die Tatsache, dass Rachid es darin gewagt hatte, eine unerwartete Parallele zwischen dem von einigen Umweltfunktionären eingeführten Begriff der »Belastungskapazität« eines Landstrichs (bei dieser oder jener natürlichen Landschaft ist mit einer bestimmten – sagen wir monatlichen – Anzahl menschlicher Besucher zu rechnen; um die landschaftliche Unversehrtheit sicherzustellen, sollte Besuchern, die diese Zahl überschreiten, der Zutritt möglichst verwehrt werden) und dem noch stärker verherrlichten Begriff der »Toleranzgrenze« (diesmal bezogen auf die Menge der Zugewanderten, die sich in einem Gebiet ansiedeln dürfen) zu ziehen.
Gewiss ist es vorstellbar, dass sich – ebenso wie ein Überschuss an menschlichen Besuchern (das Menschliche wird hier als etwas Schädliches betrachtet) eine Landschaft verschandeln und ihren Wert als Sehenswürdigkeit mindern kann – ein nicht mit den ethnografischen Erwartungen der Besucher aus dem Ausland übereinstimmender Überschuss an Zugewanderten aus Sicht der Tourismusindustrie als kontraproduktiv erweisen könnte. Doch der Ton, den Rachid in jenem Artikel anschlug, war frech, sanft ironisch und ganz sicher nicht militant. Es ging ihm darum, die Menschheit und ihr Verhalten zu beschreiben, und nicht darum, sie zurechtzuweisen oder zu reformieren; schließlich war er Schriftsteller.
Aber er war auch und vor allem Soziologe, ein Soziologe von unbestreitbarer Originalität bis hinein in die Wahl seines dessen Fülle zum Trotz außergewöhnlich wenig erforschten Studiengebiets (ich erinnere mich noch an meine Überraschung, als ich bei der ersten Lektüre von Imaginaire touristique et sociabilités du voyage zum ersten Mal sah, wie die Tätigkeit der Pilgerschaft in eine allgemeine Reflexion über den Tourismus einbezogen wurde. Im Zuge dieses E-Mail-Austauschs (den Text haben wir letzten Endes nicht wiedergefunden) fragte mich sein Bruder nach inhaltlichen Einzelheiten des von mir gesuchten Artikels: Ging es darin um Themenparks (à la »Die Holzschuhmacher des Marquenterre«), um Vergnügungsparks im Stil von Euroschtroumpfs oder schlicht um Naturparks? Dabei wurde mir die unglaubliche und beinahe groteske Vielfältigkeit bewusst, die das touristische Angebot in unserem Land (Frankreich) in den letzten Jahren erreicht hat. Und ich dachte mir, dass uns ein guter Tourismussoziologe entschieden fehlen wird. Was gute Schriftsteller angeht, so kann man nie genug davon haben – das ist jedenfalls meine Meinung.
Allerdings hat er nie einen Roman geschrieben – und im Gegensatz zu Philippe Muray (den er bewunderte) hat er es nicht einmal versucht. Das habe ich zuweilen bedauert, wohl wissend, dass das, was er getan hat, auf seine Art ebenso bedeutsam war. Hätte er sich auf das Gebiet der Fiktion vorgewagt, dann hätte er sich gewiss weder in die Gruppe der Proustianer noch die der Célinianer noch in irgendeine der altbewährten großen Abstammungslinien eingegliedert. Seine Vorlieben verorteten ihn eher in jener erlesenen und glanzvollen kleinen Familie der ironischen und wohlwollenden, strahlenden und sonderbaren Geister von besonders funkelnder Intelligenz, die Borges oder Perec zu ihren Mitgliedern zählen darf.
In »Cantatrix sopranica L. und andere wissenschaftliche Schriften«1 widmet sich Georges Perec einer Reihe oft hochkomischer Parodien der Kommunikation zwischen Gelehrten. Es schien mir oft, als hätte sich Rachid Amirou in Imaginaire touristique et sociabilités du voyage, seinem einzigen veröffentlichten Buch, mitunter einer ähnlichen Übung gewidmet und als zielten die von ihm gewählten Quellenangaben und Fußnoten (durch ihre Position, ihren Ton, den sanften Bruch, den sie erzeugen) oft darauf ab, uns ein kleines Lächeln zu entlocken – natürlich viel diskreter als das Gelächter, das einige der von Perec erfundenen Fußnoten hervorrufen. Und auch mit dem feinen Unterschied, dass es sich ursprünglich tatsächlich um eine in äußerst offizieller Weise vertretene These handelte und dass die entsprechenden Verweise natürlich exakt und überprüfbar sein mussten. Kurz gesagt, er musste verdeckt vorgehen, hätte doch jeglicher Verdacht der Literarizität die Wissenschaftlichkeit seines Beitrags zweifelhaft erscheinen lassen können. Daher bot er uns zugleich einen wissenschaftlichen Diskurs – schon für sich betrachtet interessant und stellenweise geradezu verstörend innovativ – und eine Ironisierung eben dieses Diskurses (nicht seines Inhalts, sondern der Position des Soziologen selbst, der »wissenschaftliche« Diskurse über den gesellschaftlichen Zustand produziert), eine Ironisierung, die, so lautete das Gesetz der von ihm gewählten Gattung, bis zuletzt unbestimmbar bleiben musste.
Als Akademiker einem größeren Publikum unbekannt, war Rachid Amirou bei seinen Kollegen oft wenig beliebt, was nicht sonderlich verwundert angesichts seiner Randständigkeit und seiner – man muss es wohl so sagen – eklatanten Überlegenheit über Publikationen, die für gewöhnlich zwischen Rückständen linksradikaler Positionen (zum touristischen »Neo-Kolonialismus«) und die verloren gegangenen Authentizität der einheimischen Bevölkerung beklagenden ökologischen Frömmeleien oszillierten (zwischen Victor Segalen und dem Reiseführer Guide du Routard, um das Niveau zu verorten). Im Gegensatz zu vielen seiner erbärmlichen Kollegen wusste er, dass die auf diese Weise verdorbenen einheimischen Einwohner teils außerordentlich glücklich darüber waren, sich einem westlichen Lebensstil anzuverwandeln, den sie ohnehin anstrebten – dass sie, wie er schrieb, nicht unbedingt den Wunsch hatten, »einen identitären Wohnsitz zugewiesen zu bekommen«. Manchmal sprach er mit mir darüber, unverblümt, aber stets ohne Bitterkeit, er nahm diese Ausgrenzung im Grunde frohgemut hin. Er wusste: Auch wenn das mit einer glänzenden akademischen Laufbahn einhergehende Ansehen und die Aufmerksamkeit der Medien wahrscheinlich anderen zukämen, blieb er als Universitätsprofessor »nahezu unantastbar«. Das stimmt, dachte ich mir, das ist ein Status. Es gibt in Frankreich noch eine solche Art von Status, die eine relative Gedankenfreiheit ermöglicht. Es ist erstaunlich, aber es ist gut.
Mir fehlen unsere Gespräche. Wer außer ihm sollte mir Anekdoten erzählen wie jene erstaunliche von diesem Dorf im Departement Var, dessen Bewohner (größtenteils Rentner) von der Gemeindeverwaltung eine bescheidene Vergütung dafür erhalten, dass sie ihre Häuser verlassen, ihren Pastis trinken und eine Runde Boule spielen, wenn die Touristenbusse durch den Ort fahren? Letztlich also dafür, dass sie genau ihre übliche Lebensweise beibehalten?
Die am Ende des Bandes versammelten Texte verdeutlichen, und sei es nur durch die ungewöhnliche Natur der Bezugsgrößen (Winnicott, Muray), mit besonderer Klarheit das Unvermögen der vorherigen soziologischen Kategorien, neue, »postmoderne« Formen der Tourismusindustrie zu reflektieren. Sie lassen eindeutig ein Buch von weit größerer Tragweite erahnen. Über dieses Buch hat er viel nachgedacht, er hat sogar zu viel darüber nachgedacht, meine ich, er hätte sich besser etwas mehr Gedanken um seinen Krebs machen sollen (es macht einen doch rasend, wenn man sich überlegt, dass er leicht hätte geheilt werden können, hätte man es nur beizeiten in Angriff genommen). Wir können uns anhand dieser Texte nur eine sehr grobe Vorstellung davon verschaffen, können den Umfang dessen, was er zu leisten versuchte, allenfalls abschätzen. Seit dem Erscheinen von Imaginaire touristique et sociabilités du voyage hat sich in der Tourismusindustrie ein erstaunlicher Wandel vollzogen, der mehr als alles andere dazu beigetragen hat, das Antlitz zahlreicher Länder neu zu gestalten – und insbesondere das von Frankreich. Wer wäre nach seinem Tod in der Lage, uns so gut wie er davon zu erzählen?
GESPRÄCH MIT FRÉDÉRIC BEIGBEDER
Dieses Gespräch erschien im April 2014 in Lui, Nr. 7.
Frédéric Beigbeder: Es ist also offiziell, du wirst nächstes Jahr einen Roman veröffentlichen?
Michel Houellebecq: Mmmm … ja, aber den Titel verrate ich dir nicht. Teresa legt Wert auf Exklusivität.
Großartig, daraus schließe ich, dass du bei Flammarion bleibst! (Teresa Cremisi leitet den Verlag.)
Ich möchte zunächst einmal über dich sprechen, Frédéric. Du hast einige Bücher geschrieben, manche gut, manche nicht. Aber du bist eindeutig der beste Literaturkritiker seit Langem. Darum fürchte ich dich!
Haha! Du bist zum Essen gekommen, weil du mich für dich einnehmen willst?
Mmmm … Ich meine das ganz ernst: Du bist der Kritiker, den ich am meisten fürchte.
(lacht) Nein, Michel, du hast dich für ein Essen bei mir entschieden, weil du im Restaurant nicht mehr rauchen darfst.