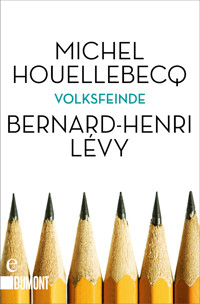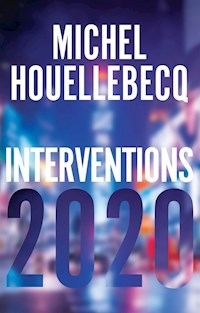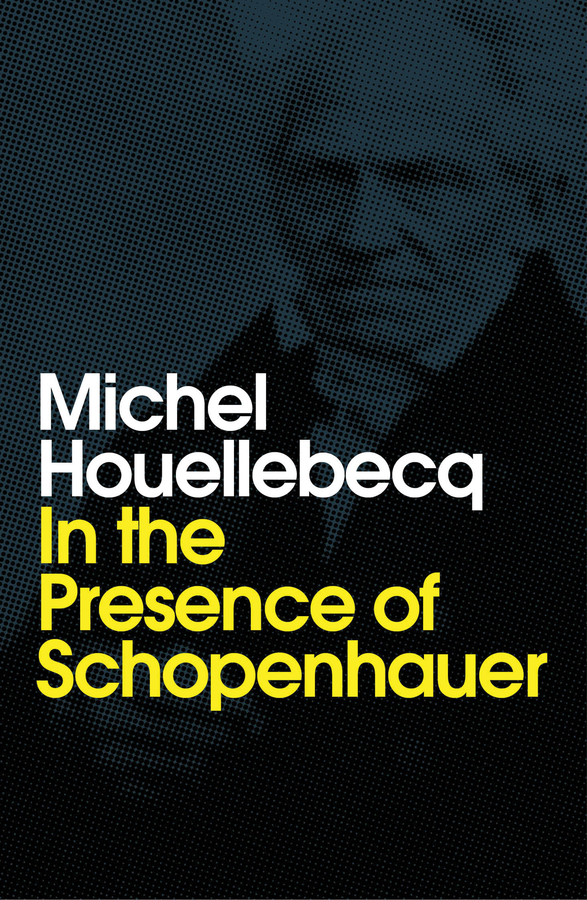13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kurz vor den französischen Präsidentschaftswahlen 2027 taucht im Netz ein Video auf, das die Hinrichtung des möglichen Kandidaten Bruno Juge zu zeigen scheint. Paul Raison ist Absolvent einer Elitehochschule und arbeitet als Spitzenbeamter im Wirtschaftsministerium. Als Mitarbeiter und Vertrautem Juges fällt ihm die Aufgabe zu, die Urheber des Videos ausfindig zu machen. Im Laufe seiner Nachforschungen kommt es zu einer Serie mysteriöser terroristischer Anschläge, zwischen denen kein Zusammenhang zu erkennen ist. Aber nicht nur die Arbeit, auch das Privatleben von Paul Raison ist alles andere als einfach. Er und seine Frau Prudence leben zwar noch zusammen, aber sie teilen nichts mehr miteinander. Selbst die Fächer im Kühlschrank sind getrennt. Während Juge um seine Kandidatur kämpft, kann Paul entscheidende Hinweise für die Aufklärung der Anschläge liefern. Doch letztlich verliert Juge gegen einen volksnahen ehemaligen Fernsehmoderator, und die Erkenntnisse aus Pauls Recherche sind nicht minder niederschmetternd für die Politik des Landes. Als Paul von seiner Arbeit freigestellt wird, kommt es zu einer Annäherung zwischen ihm und seiner Frau und die beiden finden wieder zueinander. Ein unerwartetes, wenn auch fragiles Glück …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Kurz vor den französischen Präsidentschaftswahlen 2027 taucht im Netz ein Video auf, das die Hinrichtung des möglichen Kandidaten Bruno Juge zu zeigen scheint. Paul Raison ist Absolvent einer Elitehochschule und arbeitet als Spitzenbeamter im Wirtschaftsministerium. Als Mitarbeiter und Vertrautem Juges fällt ihm die Aufgabe zu, die Urheber des Videos ausfindig zu machen. Im Laufe seiner Nachforschungen kommt es zu einer Serie mysteriöser terroristischer Anschläge, zwischen denen kein Zusammenhang zu erkennen ist. Aber nicht nur die Arbeit, auch das Privatleben von Paul Raison ist alles andere als einfach. Er und seine Frau Prudence leben zwar noch zusammen, aber sie teilen nichts mehr miteinander. Selbst die Fächer im Kühlschrank sind getrennt. Während Juge um seine Kandidatur kämpft, kann Paul entscheidende Hinweise für die Aufklärung der Anschläge liefern. Doch letztlich verliert Juge gegen einen volksnahen ehemaligen Fernsehmoderator, und die Erkenntnisse aus Pauls Recherche sind nicht minder niederschmetternd für die Politik des Landes. Als Paul von seiner Arbeit freigestellt wird, kommt es zu einer Annäherung zwischen ihm und seiner Frau und die beiden finden wieder zueinander. Ein unerwartetes, wenn auch fragiles Glück …
Die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Liebe, das komplexe Zusammenspiel von Gesellschaft und Politik und die weitreichende, oftmals kaum wahrnehmbare Verknüpfung von Politischem und Privatem – das sind die Themen des neuen Romans von Michel Houellebecq, dem großen Visionär der französischen Literatur.
© Philippe Matsas, Flammarion
MICHEL HOUELLEBECQ, 1958 geboren, gehört zu den wichtigsten Autoren der Gegenwart. Seine Bücher werden in über vierzig Ländern veröffentlicht. Für den Roman ›Karte und Gebiet‹ (2011) erhielt er den Prix Goncourt. Sein Roman ›Unterwerfung‹ (2015) stand wochenlang auf den Bestsellerlisten und wurde mit großem Erfolg für die Theaterbühne adaptiert und verfilmt. Zuletzt erschien der Essayband ›Ein bisschen schlechter‹ (2020).
STEPHAN KLEINER, geboren 1975, lebt als literarischer Übersetzer in München. Er übertrug u.a. Geoff Dyer, Chad Harbach, Tao Lin und Hanya Yanagihara ins Deutsche.
BERND WILCZEK, geboren 1975, arbeitete mehrere Jahre als Universitätslektor in Frankreich. Er übertrug u.a. André Glucksman, Maurice Blanchot und Paul Virilio ins Deutsche.
MICHEL HOUELLEBECQ
VERNICHTEN
Roman
Aus dem Französischenvon Stephan Kleiner und Bernd Wilczek
Die französische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel ›Anéantir‹ bei Flammarion, Paris.
© Michel Houellebecq und Flammarion, 2022
eBook 2022
© 2022 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Stephan Kleiner (Teil I–III), Bernd Wilczek (Teil IV–VII)
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © plainpicture/Ludovic Mornand – Aus der Kollektion Rauschen
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8243-4
www.dumont-buchverlag.de
EINS
1
An manchen Montagen Ende November oder Anfang Dezember fühlt man sich, besonders als Alleinstehender, wie im Todestrakt. Die Sommerferien sind längst vorbei, das neue Jahr ist noch weit weg; das Nichts ist ungewohnt nah.
Am Montag, dem 23.November, beschloss Bastien Doutremont, mit der Métro zur Arbeit zu fahren. Als er an der Haltestelle Porte de Clichy ausstieg, stand er dem Schriftzug gegenüber, von dem ihm in den vergangenen Tagen mehrere seiner Kollegen erzählt hatten. Es war kurz nach zehn Uhr, der Bahnsteig war menschenleer.
Seit seiner Jugend interessierte er sich für die Graffiti der Pariser Métro. Er fotografierte sie oft mit seinem veralteten iPhone – inzwischen war man wohl bei der 23. Generation angelangt, er war immer noch bei der elften. Er sortierte die Fotos nach Haltestellen und Linien, auf seinem Computer waren ihnen zahlreiche Ordner gewidmet. Es war ein Hobby, wenn man so will, aber er bevorzugte die prinzipiell ansprechendere, eigentlich aber brutalere Bezeichnung Zeitvertreib. Eines seiner liebsten Graffiti war im Übrigen der Schriftzug mit den präzisen schräg gestellten Buchstaben, den er in der Mitte eines langen weißen Gangs an der Haltestelle Place d’Italie entdeckt hatte und der energisch verkündete: »Die Zeit wird nicht vergehen!«
Die Plakate der Aktion »Poésie RATP« mit ihrer Zurschaustellung belangloser Einfältigkeiten, die eine Zeit lang sämtliche Pariser Haltestellen überflutet und sich vermittels Kapillarwirkung sogar bis in einige Züge hinein ausgebreitet hatten, hatten bei den Fahrgästen mehrfach zu unausgewogenen, wütenden Reaktionen geführt. So hatte er an der Haltestelle Victor Hugo den folgenden Spruch entziffern können: »Ich beanspruche den Ehrentitel des Königs von Israel. Ich kann nicht anders.« An der Haltestelle Voltaire war das Graffito brachialer und aufgeregter: »Endgültige Botschaft an alle Telepathen, an alle Stéphanes, die versucht haben, mein Leben durcheinanderzubringen: Die Antwort ist NEIN!«
Der Schriftzug an der Haltestelle Porte de Clichy war genau genommen gar kein Graffito: In gewaltigen dicken, mit schwarzer Farbe aufgemalten Buchstaben von zwei Metern Höhe erstreckte er sich über die gesamte Länge des Bahnsteigs in Richtung Gabriel Péri-Asnières-Gennevilliers. Selbst im Vorbeigehen auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig hatte er es nicht geschafft, ihn ganz aufs Bild zu bekommen, aber er hatte den gesamten Text entziffern können: »Es überleben die Monopole/Im Herz der Metropole«. Das war nicht sehr beunruhigend und nicht einmal besonders eindeutig; dennoch gehörte es zu den Dingen, die geeignet waren, das Interesse des Inlandsgeheimdienstes DGSI zu erwecken, so wie all die mysteriösen, vage bedrohlichen Mitteilungen, die seit einigen Jahren in den öffentlichen Raum eindrangen und sich keiner eindeutig identifizierbaren politischen Gruppierung zuordnen ließen und deren spektakulärstes und besorgniserregendstes Beispiel die Botschaften im Internet waren, mit deren Entschlüsselung er derzeit beauftragt war.
Auf seinem Schreibtisch fand er den Bericht des lexikologischen Labors; er war mit der ersten Zustellung am Morgen gekommen. Bei der Untersuchung der bestätigten Botschaften hatte man dreiundfünfzig Zeichen unterscheiden können – alphabetische Zeichen und keine Ideogramme; durch die Abstände hatten sich diese Zeichen in Wörter unterteilen lassen. Daraufhin hatte man sich um eine Bijektion mit einem bestehenden Alphabet bemüht und es zunächst mit dem französischen versucht. Dabei schien es unverhoffte Übereinstimmungen zu geben: Fügte man den sechsundzwanzig Grundbuchstaben diejenigen mit Akzenten, Ligaturen oder Cedillen hinzu, erhielt man zweiundvierzig Zeichen. Herkömmlicherweise zählte man darüber hinaus elf Interpunktionszeichen, was insgesamt dreiundfünfzig Zeichen ergab. Die Experten sahen sich also mit einem klassischen Entschlüsselungsproblem konfrontiert, das darin bestand, eine eindeutige Übereinstimmung zwischen den Zeichen der Botschaft und denen des erweiterten französischen Alphabets herzustellen. Bedauerlicherweise stellten sie nach zwei Wochen Arbeit fest, dass sie in eine Sackgasse geraten waren: Mit keinem der bekannten Entschlüsselungssysteme hatte sich irgendeine Entsprechung herstellen lassen; seit der Gründung des Labors passierte das zum ersten Mal. Botschaften über das Internet zu verbreiten, die niemand zu lesen vermochte, war offensichtlich ein absurdes Unterfangen, die Botschaften mussten an irgendjemanden gerichtet sein; aber an wen?
Er stand auf, machte sich einen Espresso und trat mit seiner Tasse in der Hand an die Glasfront. Die Wände des Landgerichts warfen ein blendend helles Licht zurück. Er hatte in diesem unstrukturierten Nebeneinander riesenhafter Quader aus Glas und Stahl, die über einer morastigen und trostlosen Landschaft aufragten, nie irgendeinen besonderen ästhetischen Wert erkennen können. In jedem Fall hatten sich die Planer nicht Schönheit und nicht einmal wirklich Charme, sondern vielmehr die Zurschaustellung eines gewissen technischen Könnens zum Ziel gesetzt – als ginge es vor allem darum, bei etwaigen außerirdischen Besuchern Eindruck zu schinden. Bastien hatte die historischen Gebäude am Quai des Orfèvres 36 nicht gekannt und dachte daher im Gegensatz zu seinen älteren Kollegen auch nicht wehmütig an sie zurück, doch dieses Viertel im sogenannten »neuen Clichy« bewegte sich mit jedem Tag unübersehbar weiter auf eine städtische Katastrophe in Reinform zu; das Einkaufszentrum, die Cafés und die Restaurants, die im ursprünglichen Bebauungsplan vorgesehen gewesen waren, waren nie verwirklicht worden, und tagsüber außerhalb des Arbeitsumfelds zu entspannen, war an dem neuen Standort nahezu unmöglich; dafür gab es keinerlei Schwierigkeiten beim Parken.
Fünfzig Meter weiter unten fuhr ein Aston Martin DB11 auf den Besucherparkplatz; Fred war also angekommen. Dieses Festhalten an den überkommenen Reizen des Verbrennungsmotors war bei einem Geek wie Fred, der sich konsequenterweise einen Tesla hätte kaufen müssen, ein merkwürdiger Zug – mitunter blieb er minutenlang im Wagen sitzen und ließ sich vom Schnurren des V12 einlullen. Schließlich stieg er aus und warf die Tür hinter sich zu. Die Sicherheitsmaßnahmen am Empfang eingerechnet, würde er in zehn Minuten da sein. Er hoffte, Fred würde Neuigkeiten haben; ehrlich gesagt, war das sogar seine letzte Hoffnung, wollte er in der nächsten Sitzung über irgendwelche Fortschritte berichten.
Als sie sieben Jahre zuvor auf Vertragsbasis von der DGSI eingestellt worden waren – mit einem mehr als komfortablen Gehalt für junge Leute ohne irgendein Diplom, ohne jegliche Berufserfahrung –, hatte sich das Einstellungsgespräch auf eine Demonstration ihrer Fähigkeit zum Hacken verschiedener Internetseiten beschränkt. Sie hatten den etwa fünfzehn anwesenden Vertretern der Untersuchungseinheit für Computer- und Netzwerkkriminalität BEFTI und anderer technischer Abteilungen des Innenministeriums erklärt, wie sie nach dem Eindringen in das Identifikationsportal mit einem einzigen Klick eine Krankenversicherungskarte hatten deaktivieren oder wieder aktivieren können; wie sie vorgegangen waren, um das Regierungsportal für die Online-Steuererklärung zu hacken und von dort aus ganz einfach die Höhe der angegebenen Einkommen zu ändern. Sie hatten ihnen sogar vorgeführt – dieses Verfahren war schwieriger, die Codes wurden regelmäßig geändert –, wie sie, hatten sie sich erst einmal Zugang zur automatisierten nationalen Datenbank für genetische Fingerabdrücke verschafft, ein DNS-Profil verändern oder löschen konnten, selbst wenn es sich um einen bereits verurteilten Straftäter handelte. Das Einzige, was sie lieber verschwiegen, war ihr Eindringen in das IT-System des Kernkraftwerks Chooz. Innerhalb von achtundvierzig Stunden hatten sie die Kontrolle über das System erlangt und konnten einen Notfallunterbrechungsprozess des Reaktors in Gang setzen und damit mehreren französischen Départements den Strom abdrehen. Einen schwerwiegenden atomaren Zwischenfall hätten sie dagegen nicht auslösen können – das Vordringen zum Reaktorkern verhinderte ein Verschlüsselungscode von 4096 Bits, den sie noch nicht geknackt hatten. Fred hatte ein neues Crackprogramm, das er gern angewandt hätte; aber an diesem Tag waren sie sich einig gewesen, dass sie vielleicht zu weit gegangen waren; sie hatten sich zurückgezogen, hatten alle Spuren ihres Eindringens gelöscht und nie wieder darüber gesprochen – weder mit irgendjemand anderem noch miteinander. Nachts hatte Bastien einen Albtraum gehabt, in dem er von monströsen Chimären verfolgt wurde, die aus lauter verwesenden Neugeborenen zusammengesetzt waren; am Ende des Traums war ihm der Reaktorkern erschienen. Sie hatten einige Tage verstreichen lassen, ehe sie sich wieder trafen, nicht einmal miteinander telefoniert hatten sie, und wahrscheinlich war das der Moment gewesen, in dem sie erstmals in Betracht gezogen hatten, sich in den Dienst des Staats zu stellen. Für sie, deren Jugendhelden Julian Assange und Edward Snowden gewesen waren, war es alles andere als selbstverständlich, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, aber Mitte der 2010er-Jahre herrschten besondere Umstände: Die französische Bevölkerung hatte in der Folge mehrerer islamistischer Mordanschläge begonnen, ihre Polizei und ihre Armee zu unterstützen und ihnen sogar eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen.
Fred jedoch hatte seinen Vertrag mit der DGSI am Ende des vergangenen Jahres nicht verlängert; er hatte stattdessen Distorted Visions gegründet, ein auf digitale Spezialeffekte und Computergrafik spezialisiertes Unternehmen. Im Gegensatz zu ihm war Fred im Grunde nie ein echter Hacker gewesen; er hatte nie wirklich jenes Vergnügen verspürt, das ein wenig dem beim Spezialslalom ähnelte und das er beim Umgehen einer Reihe von Firewalls empfand, und auch nicht jene größenwahnsinnige Trunkenheit, die ihn überkam, wenn er einen Angriff mit brutaler Kraft durchführte, Tausende Zombiecomputer mobilisierte, um eine besonders durchtriebene Verschlüsselung zu knacken. Fred war wie sein Lehrmeister Julian Assange vor allem ein geborener Programmierer und in der Lage, die ausgefeiltesten Programmiersprachen, die unaufhörlich auf dem Markt erschienen, innerhalb weniger Tage zu beherrschen – und er hatte diese Fähigkeit angewandt, um Algorithmen zur Generierung gänzlich innovativer Formen und Texturen zu schreiben. Es ist oft die Rede davon, wie sehr sich die Franzosen im Bereich der Luft- oder Raumfahrttechnik hervortun, an digitale Spezialeffekte wird seltener gedacht. Freds Unternehmen war regelmäßig für die größten Hollywood-Blockbuster tätig; fünf Jahre nach seiner Gründung stand es weltweit bereits auf Platz drei.
Als er das Büro betrat und sich aufs Sofa fallen ließ, begriff Doutremont augenblicklich, dass es schlechte Nachrichten gab.
»Ich habe tatsächlich keine besonders erfreulichen Neuigkeiten für dich, Bastien«, bestätigte Fred auch gleich. »Gut, von der ersten Botschaft habe ich dir ja schon erzählt. Ich weiß, dafür interessiert ihr euch nicht, aber das Video ist auf jeden Fall merkwürdig.«
Das erste Pop-up-Fenster hatte die DGSI übersehen; es hatte sich im Wesentlichen auf Websites für den Erwerb von Flugtickets und Online-Hotelreservierungen ausgebreitet. Wie die zwei darauffolgenden hatte es aus einer Aneinanderreihung von Fünfecken, Kreisen und Textzeilen in dem nicht zu entziffernden Alphabet bestanden. Klickte man irgendwo innerhalb des Fensters, startete die Filmsequenz. Sie war von einem Vorsprung oder einem auf der Stelle schwebenden Flugobjekt aus aufgenommen; es war eine statische Einstellung von etwa zehn Minuten Dauer. Eine unermesslich weite Wiese mit hohem Gras erstreckte sich bis zum Horizont, der Himmel war makellos klar – die Landschaft erinnerte an einige Staaten im amerikanischen Westen. Durch den Wind entstanden gewaltige gerade Linien auf der Grasoberfläche; dann kreuzten sie sich, Dreiecke und Polygone zeichneten sich ab. Ruhe kehrte ein, die Oberfläche wurde wieder gleichmäßig, so weit das Auge reichte; dann frischte der Wind erneut auf, die Polygone setzten sich wieder zusammen, teilten die Fläche langsam in Quadrate, die sich unendlich ausdehnten. Es war sehr schön, hatte aber nichts sonderlich Beunruhigendes an sich; das Pfeifen des Windes war nicht aufgezeichnet worden, die gesamte Geometrie entfaltete sich in völliger Stille.
»Wir haben in letzter Zeit für Kriegsfilme eine ganze Menge Sturmszenen auf See umgesetzt«, sagte Fred. »Eine Grasoberfläche dieser Größe lässt sich in etwa wie eine entsprechend große Wasserfläche modellieren – kein Ozean, eher ein großer See. Und ich kann dir versichern, dass die geometrischen Figuren, die in diesem Video entstehen, unmöglich sind. Das würde voraussetzen, dass der Wind gleichzeitig aus drei verschiedenen Richtungen weht – zeitweise aus vier. Ich bin mir also sicher: Das ist computergeneriert. Aber was mir wirklich zu denken gibt, ist, dass man das Bild beliebig vergrößern kann und die digitalen Grashalme trotzdem weiterhin wie echte Grashalme aussehen; und das ist eigentlich nicht machbar. In der Natur gibt es keine zwei identischen Grashalme, sie weisen allesamt Unregelmäßigkeiten auf, kleine Makel, einen spezifischen genetischen Fingerabdruck. Wir haben tausend zufällig aus dem Bild ausgewählte Halme vergrößert: Sie sind alle unterschiedlich. Ich würde darauf wetten, dass die Millionen von Grashalmen in dem Video allesamt unterschiedlich sind, das ist unfassbar, das ist eine Wahnsinnsarbeit, wir würden das bei Distorted vielleicht hinbekommen, aber für eine Sequenz von dieser Länge bräuchten wir Monate an Rechenzeit.«
2
In dem zweiten Video stand der Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Juge – der seit Beginn der fünfjährigen Legislaturperiode auch Haushaltsminister war – mit hinter dem Rücken gefesselten Händen in einem Garten von mittlerer Größe, der hinter einem Einfamilienhaus lag. Die hügelige Landschaft ringsum erinnerte an die Normannische Schweiz und musste im Frühling wohl grün sein, aber zu dieser Jahreszeit waren die Bäume kahl, es war vermutlich Herbstende oder Winteranfang. Der Minister war mit einer dunklen Anzughose und einem kurzärmligen weißen Hemd bekleidet, das er ohne Krawatte trug und das für die Jahreszeit zu leicht war – er hatte Gänsehaut.
In der nächsten Einstellung war er in ein langes schwarzes Gewand gekleidet, über den Kopf hatte man ihm eine ebenfalls schwarze, spitz zulaufende Kapuze gezogen, wodurch er wie einer der Büßer während der Semana Santa in Sevilla aussah. Diese Art von Kopfbedeckung hatten während der Inquisition auch die zum Tode Verurteilten als Zeichen der öffentlichen Demütigung getragen. Zwei ebenso gekleidete Männer – abgesehen davon, dass ihre Kapuzen auf Augenhöhe geschlitzt waren – packten ihn unter den Armen, um ihn fortzuschleppen.
Im hinteren Teil des Gartens angekommen, rissen sie dem Minister die Kopfbedeckung brutal herunter, und er kniff wiederholt die Augen zusammen, um sich wieder an das Licht zu gewöhnen. Sie standen am Fuß eines kleinen Grashügels, auf dem sich eine Guillotine erhob. Das Gesicht des Ministers verriet keine Furcht, als er das Gerät entdeckte, nur eine leichte Überraschung.
Während einer der beiden Männer den Minister dazu brachte, sich hinzuknien, seinen Kopf in der Lünette platzierte und dann den Schließmechanismus betätigte, befestigte der zweite das Beil am Rammbock, dem schweren Eisenblock, der der herabfallenden Klinge Stabilität verleihen sollte. Mithilfe eines über eine Rolle laufenden Seils zogen sie gemeinsam die aus Eisenblock und Fallbeil bestehende Vorrichtung hoch bis an den Querbalken. Bruno Juge schien nach und nach von einer großen Traurigkeit befallen zu werden, jedoch eher einer allgemeinen Traurigkeit.
Nach einigen Sekunden, in denen man den Minister die Augen kurz schließen und wieder öffnen sah, betätigte einer der Männer den Auslöser. Die Klinge fiel innerhalb von zwei oder drei Sekunden herab, der Kopf wurde auf einen Schlag abgetrennt, ein Blutschwall ergoss sich in die Wanne, während der Kopf den Grashügel hinunterrollte, um schließlich genau vor der Kamera liegen zu bleiben, wenige Zentimeter von der Linse entfernt. Die weit geöffneten Augen des Ministers spiegelten nun eine gewaltige Überraschung wider.
Das Pop-up-Fenster und das dazugehörige Video waren auf behördliche Informationsseiten wie www.impots.gouv.fr oder www.servicepublic.fr vorgedrungen.
Nachdem Bruno Juge mit seinem Kollegen im Innenministerium darüber gesprochen hatte, hatte dieser die DGSI verständigt. Dann war der Premierminister informiert und die Angelegenheit bis hinauf zum Präsidenten getragen worden. Der Presse gegenüber hatte es keine offizielle Erklärung gegeben. Bis zum heutigen Tag waren alle Versuche, das Video zu beseitigen, erfolglos gewesen – von einer anderen IP-Adresse aus gepostet, erschien das Fenster innerhalb weniger Stunden, teils innerhalb weniger Minuten wieder.
[2]
»Dieses Video«, sagte Fred, »haben wir uns wirklich stundenlang angesehen, wir haben es maximal vergrößert, vor allem die Einstellung auf den geköpften Rumpf in dem Augenblick, als das Blut aus der Halsschlagader schießt. Bei ausreichender Vergrößerung fängt man normalerweise an, geometrische Regelmäßigkeiten zu sehen, artifizielle Mikromuster – meist lässt sich sogar die Gleichung bestimmen, die der Rechner angewandt hat. Hier findet sich nichts dergleichen: Du kannst es vergrößern, so viel du willst, es bleibt chaotisch, unregelmäßig, genau wie bei einem echten Schnitt. Das hat mich so stutzig gemacht, dass ich mit Bustamante, dem Chef von Digital Commando, darüber gesprochen habe.
»Aber das sind doch eure Konkurrenten, oder?«
»Ja, wir sind Konkurrenten, wenn du so willst, aber wir kommen gut miteinander aus und haben auch schon zusammen an Filmen gearbeitet. Wir haben nicht ganz die gleichen Spezialgebiete: Wir sind besser in imaginärer Architektur, Generierung virtueller Menschenmassen und so weiter. Aber bei allen digitalen Splatter-Effekten, organischen Monstern, Verstümmelungen, Enthauptungen sind sie die besten. Jedenfalls war Bustamante genauso baff wie ich: Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie das ging. Hätten wir unter Eid vor einem Gericht aussagen müssen und hätte es sich natürlich nicht um einen Minister, sondern um sonst irgendwen gehandelt, ich glaube, wir hätten geschworen, dass es eine echte Enthauptung war …«
Eine abrupte Stille trat ein. Bastien richtete den Blick auf die Glasfront, ließ ihn wieder über die riesigen Quader aus Glas und Stahl schweifen. Das Gebäude war wirklich eindrucksvoll und an einem klaren Tag sogar furchteinflößend; aber es war wohl unerlässlich, dass ein Landgericht bei der Bevölkerung Schrecken auslöste.
»Das dritte Video, gut, das haben wir ja beide gesehen«, fuhr Fred fort. »Es zeigt eine mit Handkamera in Eisenbahntunneln aufgenommene Totale. Ziemlich schaurig, mit den dominierenden Gelbtönen. Die Tonspur bildet klassischer Industrial Metal. Es ist offensichtlich ein computergeneriertes Bild, es gibt keine zehn Meter breiten Bahngleise und auch keine fünfzig Meter hohen Triebwagen. Es ist gut gemacht, sehr gut sogar, es ist eine sehr gute Computergrafik, aber letztlich ist es weniger verblüffend als die anderen Videos, das hätten wir auch bei Distorted hingekriegt, zwei Wochen Arbeit, würde ich sagen.«
Bastien sah ihn wieder an. »Das Beunruhigende an der dritten Botschaft ist nicht ihr Inhalt, sondern ihre Verbreitung. Diesmal haben sie keine behördliche Seite angegriffen, sondern Facebook und Google ins Visier genommen; Leute, die eigentlich die Mittel hätten, um sich zu verteidigen. Und das Verblüffende ist, wie gewaltsam und wie plötzlich der Angriff vonstattenging. Meiner Einschätzung nach kontrolliert ihr Botnet mindestens hundert Millionen Zombierechner.« Fred schreckte auf; das erschien ihm unmöglich, das lag völlig außerhalb der Größenordnungen, die er kannte. »Ich weiß«, fuhr Bastien fort, »aber die Dinge haben sich geändert, und auf eine Art ist es für Piraten einfacher geworden. Die Leute kaufen aus Gewohnheit weiter Computer, aber sie gehen nur noch mit ihren Smartphones ins Netz, und den Computer lassen sie eingeschaltet. In diesem Augenblick hast du Hunderte von Millionen Geräte im Standby-Modus, die nur darauf warten, von einem Bot kontrolliert zu werden.«
»Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann, Bastien …«
»Du hast mir geholfen. Um neunzehn Uhr habe ich einen Termin mit Paul Raison, das ist der Typ vom Wirtschaftsministerium. Er sitzt im Stab des Ministers, und er ist mein Ansprechpartner in der Angelegenheit; ich weiß jetzt, was ich ihm mitzuteilen habe. Erstens: Wir haben es mit einem Angriff von Unbekannten zu tun. Zweitens: Sie können digitale Spezialeffekte realisieren, die von den besten Spezialisten auf dem Gebiet für unmöglich gehalten werden. Drittens: Die Rechenleistung, die sie aufwenden können, ist unerhört, sie übersteigt alles bisher Bekannte. Viertens: Ihre Motive sind unbekannt.«
»Wie ist er denn so, dieser Raison?«, fragte Fred schließlich.
»Er ist in Ordnung. Ernsthaft, kein bisschen lustig, geradezu streng, ehrlich gesagt, aber er ist vernünftig. Zufällig kennt man ihn bei der DGSI sogar – das heißt, sie erinnern sich an seinen Vater Édouard Raison. Er hat seine gesamte Berufslaufbahn in dem Laden absolviert, vor vierzig Jahren hat er beim alten Nachrichtendienst angefangen. Er war angesehen; er hat große Fälle bearbeitet, hochkarätige Fälle von unmittelbarem Interesse für die Staatssicherheit. Kurz, sein Sohn gehört so ein bisschen zur Familie. Er ist zwar Finanzinspektor, Absolvent der ENA, der übliche Werdegang also, aber er kennt den speziellen Charakter unserer Arbeit, er ist uns nicht von Haus aus feindselig gesinnt.«
3
Der Himmel ist wolkenverhangen, grau, dicht. Das Licht scheint nicht von oben zu kommen, sondern von der Schneedecke auf dem Boden auszugehen; es schwindet unerbittlich, offenbar wird es Abend. Es bilden sich Frostplatten, die Äste der Bäume sind brüchig. Schneeflocken wirbeln zwischen den Menschen hindurch, die aneinander vorbeigehen, ohne einander wahrzunehmen, ihre Gesichter verhärten sich, werden runzelig, flammende kleine Lichtpunkte tanzen in ihren Augen. Manche gehen nach Hause, doch ehe sie dort ankommen, wissen sie, dass ihre Angehörigen sterben werden oder bereits tot sind. Paul wird bewusst, dass der Planet den Kältetod stirbt; anfangs ist es nur eine Vermutung, doch nach und nach wird es zur Gewissheit. Die Regierung existiert nicht mehr, sie hat die Flucht ergriffen oder sich selbst aufgelöst, das ist schwer zu sagen. Dann ist Paul in einem Zug, er hat beschlossen, durch Polen zu fahren, doch der Tod nistet sich in den Abteilen ein, obwohl die Innenwände mit dicken Pelzen ausgekleidet sind. Da begreift er, dass niemand mehr den Zug führt, der mit Höchstgeschwindigkeit über eine leere Ebene rast. Die Temperatur fällt weiter: -40°, -50°, -60° …
Es war die Kälte, die Paul aus seinem Traum riss; es war siebenundzwanzig Minuten nach Mitternacht. In den Büros des Ministeriums wurde die Heizung jeden Abend um einundzwanzig Uhr abgestellt, was bereits spät war, in den meisten Behörden wurde deutlich früher Feierabend gemacht. Er musste auf dem Sofa in seinem Büro eingenickt sein, kurz nachdem der DGSI-Mann gegangen war. Der hatte besorgt gewirkt, besorgt über sein persönliches Schicksal – so als würde Paul sich bei seinen Vorgesetzten beschweren und verlangen, dass ihm der Fall entzogen wurde oder etwas in der Art; er hatte nicht die geringste Absicht, das zu tun. Seit dem dritten Video war es ohnehin eine globale Angelegenheit. Diesmal war Google direkt angegriffen worden: das führende Unternehmen des Planeten, das darüber hinaus Hand in Hand mit der NSA arbeitete. Die DGSI wäre vielleicht über die ersten Resultate unterrichtet worden, aus Höflichkeit und weil die Angelegenheit zuvor unerklärlicherweise einen französischen Minister betroffen hatte; aber die Amerikaner verfügten über Ermittlungsmethoden, die mit denen ihrer französischen Kollegen nicht vergleichbar waren, und sie hätten sehr rasch die komplette Kontrolle über das Dossier übernommen. Maßnahmen gegen diesen DGSI-Mann zu ergreifen, wäre nicht nur ungerecht, sondern auch dumm gewesen: Dies war nicht mehr die Zeit seines Vaters, in der die Gefahren lokal begrenzt blieben; sie nahmen inzwischen beinahe augenblicklich globale Dimensionen an.
Im Moment hatte Paul Hunger. Er würde nach Hause gehen, es blieb ihm nichts anderes übrig, dachte er, ehe ihm bewusst wurde, dass es bei ihm zu Hause nichts zu essen gäbe, dass das Kühlschrankfach, das für ihn reserviert war, hoffnungslos leer sein würde und dass selbst der Ausdruck »bei ihm zu Hause« von einem unangemessenen Optimismus zeugte.
Es war sicherlich die Teilung des Kühlschranks, die den Niedergang ihrer Beziehung am besten symbolisierte. Als Paul, der junge Beamte in der Abteilung Staatshaushalt, Prudence, die junge Beamtin in der Abteilung Finanzverwaltung, kennengelernt hatte, war in den ersten Minuten unbestreitbar etwas geschehen; vielleicht nicht in den ersten Sekunden, der Ausdruck Liebe auf den ersten Blick wäre übertrieben gewesen, doch es hatte nur einige Minuten gebraucht, sicherlich weniger als fünf, tatsächlich in etwa die Dauer eines Lieds. Prudence’ Vater sei in seiner Jugend Fan von John Lennon gewesen, daher komme ihr Vorname, das hatte sie ihm nach einigen Wochen offenbaren müssen. »Dear Prudence« war gewiss nicht der beste Beatles-Song, und ganz allgemein hatte Paul das Weiße Album nie als den Höhepunkt ihrer Karriere betrachtet, jedenfalls hatte er Prudence nie bei ihrem Vornamen rufen können, in Momenten der Zuneigung nannte er sie »Mein Schatz« oder manchmal auch »Liebling«.
Sie hatte zu keinem Zeitpunkt ihres Zusammenlebens gekocht, das erschien ihr ihrem Status nicht angemessen. Genau wie Paul war sie Absolventin der ENA, sie war Finanzinspektorin, genauso wie Paul Finanzinspektor war, und eine Finanzinspektorin am Herd, das hätte wohl tatsächlich etwas deplatziert gewirkt. Im Hinblick auf die Besteuerung von Kapitalgewinnen waren sie sich auf Anhieb einig gewesen, und sie waren beide so wenig in der Lage, auf eine gewinnende Weise zu lächeln, behände über verschiedene Themen zu sprechen, in einem Wort: zu verführen, dass es wohl diese Einigkeit war, die das Entstehen ihrer Romanze im Laufe jener endlosen Sitzungen ermöglicht hatte, die von der Abteilung für Steuerrecht spätabends, meist in Raum B87, einberufen worden waren. Ihr sexuelles Miteinander war von Anfang an befriedigend gewesen, selten überschwänglich, doch das verlangen die wenigsten Paare, die Aufrechterhaltung jedweder sexueller Aktivität stellt bereits einen echten Erfolg dar, das ist eher die Ausnahme als die Regel, die Mehrzahl der gut informierten Personen (Journalistinnen der maßgeblichen Frauenzeitschriften, Autoren realistischer Romane) bezeugt das, und das betrifft nicht einmal nur vergleichsweise ältere Menschen, wie Paul und Prudence es waren, die allmählich auf die fünfzig zugingen, den jüngsten ihrer Zeitgenossen erschien die Vorstellung einer sexuellen Beziehung zwischen zwei unabhängigen Individuen, selbst wenn sie nur einige Minuten dauerte, nur noch als ein aus der Mode gekommenes und offen gestanden jämmerliches Phantasma.
Die Uneinigkeit zwischen Prudence und Paul in Ernährungsfragen war dagegen rasch offenkundig geworden. Allerdings hatte Prudence in den ersten Jahren, bedingt durch Liebe oder eine vergleichbare Empfindung, ihrem Lebensgefährten eine seinem Geschmack entsprechende, in ihren Augen jedoch von einem nur schwer erträglichen Konservatismus gekennzeichnete Ernährung zugestanden. Auch wenn sie nicht kochte, kaufte sie doch selbst ein und verwandte einen besonderen Ehrgeiz darauf, für Paul die besten Steaks, die besten Käsesorten, die beste Wurst aufzutreiben. Die Fleischerzeugnisse mischten sich in den Fächern des gemeinsamen Kühlschranks dann in einem verliebten Durcheinander mit den Früchten, Zerealien und Bio-Hülsenfrüchten, aus denen ihre persönliche Alltagskost bestand.
Prudence’ Wandlung zur Veganerin, die im Jahr 2015 gleichzeitig mit dem erstmaligen Auftauchen des Begriffs im Wörterbuch Le Petit Robert unvermittelt eingetreten war, sollte einen totalen Ernährungskrieg auslösen, dessen Folgen sie elf Jahre später noch immer nicht verwunden hatten und durch den ihre Beziehung nun kaum noch Überlebenschancen besaß.
Prudence’ erster Angriff war brutal, absolut, entschlossen. Nach seiner Rückkehr aus Marrakesch, wo er dem damaligen Minister bei einem Kongress der Afrikanischen Union assistiert hatte, stellte Paul überrascht fest, dass sein Kühlschrank neben dem üblichen Obst und Gemüse von einer Vielzahl sonderbarer Lebensmittel überflutet war. Dicht an dicht lagen Algen, Sojakeime und zahlreiche Fertiggerichte der Marke Biozone, die sich aus Tofu, Bulgur, Quinoa, Dinkel und japanischen Nudeln zusammensetzten. Nichts davon erschien ihm auch nur im Entferntesten essbar, was er auch mit einer gewissen Schärfe anmerkte (»Hier ist ja nur Scheiße drin«, lauteten seine exakten Worte). Es folgte eine kurze, aber heftige Verhandlung, in deren Folge Paul ein eigenes Kühlschrankfach zugestanden wurde, um seinen »Proletenfraß«, wie Prudence es formulierte, darin aufzubewahren – Fraß, den er sich von nun an selbst würde kaufen müssen, von seinem eigenen Geld (sie hatten immer getrennte Konten beibehalten, ein nicht unwichtiges Detail).
In den ersten Wochen wagte Paul einige Scharmützel; sie wurden mit großer Heftigkeit abgewehrt. Jedes Stück Saint-Nectaire oder Blätterteigpastete, das er zwischen Prudence’ Tofu und Quinoa platzierte, kehrte innerhalb weniger Stunden in sein ursprüngliches Fach zurück, wenn es nicht schlicht und einfach im Müll landete.
Rund zehn Jahre später hatte sich die Lage äußerlich beruhigt. Was die Lebensmittel anging, begnügte Paul sich mit seinem kleinen Fach, das sich rasch füllte, seit er nach und nach aufgehört hatte, Feinkostläden aufzusuchen, um sich auf die sowohl eine ausgewogene Ernährung als auch zuverlässige Verfügbarkeit gewährleistende Menüauswahl mikrowellengeeigneter Fertiggerichte zu beschränken. »Irgendetwas muss man schließlich essen«, sagte er sich immer wieder artig, wenn er vor seiner Geflügel-Tajine von Monoprix Gourmet saß, und eignete sich auf diese Weise eine Art mürrischen Epikureismus an. Das Geflügel stammte »aus verschiedenen Ländern der Europäischen Union«; es hätte schlimmer sein können, dachte er weiter, brasilianische Hühner, nein danke. Nachts erschienen ihm nun immer öfter kleine Wesen; sie bewegten sich flink, ihre Haut war dunkel, ihre Arme waren zahlreich.
Seit Beginn der Krise hatten sie getrennte Schlafzimmer. Allein zu schlafen, fällt schwer, wenn man nicht mehr daran gewöhnt ist, man friert und fürchtet sich; doch dieses beschwerliche Stadium hatten sie längst hinter sich gelassen; sie hatten eine Art vereinheitlichte Hoffnungslosigkeit erreicht.
Der Niedergang ihrer Beziehung begann kurz nachdem sie sich zusammen die Wohnung in der Rue Lheureux am Rand des Parc de Bercy gekauft und sich beide auf zwanzig Jahre verschuldet hatten – eine prachtvolle Maisonette mit zwei Schlafzimmern und einem wunderschönen Wohnbereich, dessen deckenhohe Fenster zum Park hinaus gingen. Die Überschneidung war kein Zufall, eine Verbesserung der Lebensumstände geht oft mit einer Verschlechterung der Lebensinhalte einher, insbesondere hinsichtlich des Zusammenlebens. Das Viertel sei »mehr als großartig«, hatte Indy, seine bescheuerte Schwägerin, geurteilt, als sie sie im Frühjahr 2017 in Begleitung seines unglücklichen Bruders besucht hatte. Dieser Besuch war glücklicherweise der einzige geblieben, die Versuchung, Indy zu erwürgen, war zu groß gewesen, ein zweites Mal hätte er ihr nicht widerstehen können.
Ja, das Viertel war großartig, da hatte sie nicht unrecht. Ihr Schlafzimmer – als sie noch ein gemeinsames Schlafzimmer gehabt hatten – lag zum Museum für Jahrmarktskunst in der Avenue des Terroirs de France hinaus. In etwa fünfzig Metern Entfernung verlief die Rue de la Cour Saint-Émilion quer durch das als »Bercy Village« bekannte Carré, das winters wie sommers von einem Schwarm bunter Luftballons überragt wurde und in dem sich Restaurants mit regionaler Küche und alternative Bistros aneinanderreihten. Hier ließ sich der Geist der Kindheit nach Belieben neu entdecken. Der Park selbst zeugte von dem gleichen Willen zum spielerischen Durcheinander: Das Gemüse hatte seinen gebührenden Platz erhalten, und in einem von der Pariser Stadtverwaltung unterhaltenen Häuschen wurden Gartenbau-Workshops für die Bewohner des Viertels angeboten (»Gärtnern in Paris, das ist das Paradies!«, lautete der Slogan, der die Fassade zierte).
Man brauchte von dort aus – und das Argument blieb bestehen, sachlich und unerschütterlich – zu Fuß eine Viertelstunde zum Ministerium. Jetzt war es 12.42Uhr – seine Überlegungen hatten, obwohl sie den wesentlichen Teil seines Erwachsenendaseins abdeckten, nur eine Viertelstunde gedauert. Wenn er jetzt ginge, könnte er um eins zu Hause sein. Oder zumindest in der Wohnung.
4
Als er unmittelbar nach dem Verlassen seines Büros nach rechts abbog, um wieder zu den Aufzügen im Nordteil des Gebäudes zu gelangen, nahm Paul am Ende des langen, schwach beleuchteten Korridors, der zu den Ministerwohnungen führte, die Umrisse einer mit einem grauen, nach Art von Sträflingskluft gestreiften Pyjama bekleideten Gestalt wahr, die sich langsam vorwärtsbewegte. Einige Schritte weiter erkannte er den Mann: Es war der Minister selbst. Vor zwei Monaten hatte Bruno Juge darum gebeten, seine Dienstwohnung nutzen zu dürfen, die seit der Vereidigung des Ministers so gut wie immer leer gestanden hatte. Er hatte also, auch wenn er das nicht ausdrücklich gesagt hatte, beschlossen, die Wohnung zu verlassen, in der er mit seiner Frau lebte, und damit einer fünfundzwanzigjährigen Ehe ein Ende gesetzt. Paul wusste nicht genau, welche Probleme Bruno mit seiner Frau hatte – wobei er sich vermittels bloßer Empathie zwischen westlichen Männern ähnlichen Alters und ähnlicher sozialer Verhältnisse vorstellte, dass sie mit seinen eigenen vergleichbar waren. Auf den Gängen des Ministeriums wurde gemunkelt (wie es sein konnte, dass dergleichen auf den Gängen gemunkelt wurde, das würde Paul ein Rätsel bleiben, aber gemunkelt wurde es zweifellos), dass der Sache eine schnödere Angelegenheit zugrunde liege, die mit wiederholtem Fremdgehen – vonseiten der Frau – zu tun habe. Einige Zeugen hatten bei Empfängen während der vorherigen Amtszeit offenbar unmissverständliche Gesten Évangélines, der Frau des Ministers, beobachtet. Immerhin hielt sich Pauls Frau von Skandalen dieser Art fern. Prudence hatte, soweit Paul wusste, kein Sexleben, die enthaltsameren Freuden von Yoga und Transzendentaler Meditation schienen ihr zur Selbstentfaltung auszureichen, oder wahrscheinlich war es eher so, dass sie nicht ausreichten, und das deshalb, weil nichts ausgereicht hätte, und Sex schon gar nicht, Prudence war keine Frau, die für den Sex gemacht war, zumindest versuchte Paul sich das einzureden, ohne echten Erfolg, denn im Grunde wusste er sehr wohl, dass Prudence gleichermaßen für den Sex gemacht war wie die meisten Frauen und vielleicht sogar mehr als sie, dass ihr inneres Wesen immer Sex brauchen würde und dass es sich in ihrem Fall um heterosexuellen Sex handelte, und zwar, wenn er es ganz genau auf den Punkt bringen müsste, um die Penetration mit einem Schwanz. Doch die soziale Mimikry der Positionierung innerhalb der Gruppe, so lächerlich, ja verachtenswert sie auch sein mochte, spielte eine Rolle, und Prudence war im Hinblick auf den Sex ebenso wie auf die vegane Ernährung eine Art Vorreiterin gewesen; die Zahl der Asexuellen wuchs immer weiter, alle Umfragen bezeugten das, Monat für Monat schien der Anteil der Asexuellen an der Bevölkerung nicht nur konstant, sondern mit zunehmender Geschwindigkeit anzusteigen; die Journalisten hatten mit ihrer üblichen Lust am Ungefähren und am unzutreffenden wissenschaftlichen Begriff nicht gezögert, den Anstieg als exponentiell zu bezeichnen, in Wahrheit stimmte das nicht, das Wachstum vollzog sich nicht mit dem extremen Tempo eines tatsächlich exponentiellen Anstiegs, aber es vollzog sich nichtsdestoweniger sehr schnell.
Im Gegensatz zu Prudence und den meisten ihrer Zeitgenossinnen war Évangéline vollkommen in der Rolle der echten scharfen Maus aufgegangen und tat es vielleicht noch immer, was einem Mann wie Bruno natürlich nicht passte, der vor allem ein warmes und anheimelndes Zuhause liebte, das ihn von den Machtkämpfen ablenken konnte, die ein notwendiger Teil des politischen Spiels waren. Doch in Wahrheit hatten ihre Beziehungsprobleme damit so gut wie nichts zu tun.
»Ach, Paul, du bist noch da?« Bruno schien nicht ganz wach zu sein; er klang unsicher, leicht verwirrt, dabei aber fröhlich. »Arbeitest du noch?«
»Nein, eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen.«
»O ja, die Sofas …« Er hatte das Wort genussvoll ausgesprochen, so als handelte es sich um eine wunderbare Erfindung, deren Existenz er soeben erst wiederentdeckt hatte. »Ich habe schlecht geschlafen«, setzte er in einem gänzlich anderen Tonfall hinzu, »und mir fiel eine bestimmte Akte ein. Wollen wir in meiner Wohnung noch etwas trinken? Wir dürfen nicht zulassen, dass die Chinesen bei den Seltenen Erden ein Monopol bekommen«, fuhr er beinahe augenblicklich fort, während Paul ihm schon folgte. »Ich bin dabei, mit Lynas, dem australischen Unternehmen, eine Vereinbarung zu treffen – sie verhandeln hart, diese Australier, du machst dir keine Vorstellung; bei Yttrium, Gadolinium und Lanthan wären wir damit auf der sicheren Seite, aber es bleiben noch jede Menge Probleme, vor allem, was Samarium und Praseodym angeht; ich bin mit Burundi und Russland in Kontakt.«
»Das mit Burundi sollte doch machbar sein«, antwortete Paul unbekümmert. Burundi war ein Land in Afrika, viel weiter reichten seine Kenntnisse über Burundi nicht, allerdings verortete er es in der Nähe des Kongo, aufgrund des Begriffs »Burundi-Kongo«, den er irgendwie im Hinterkopf hatte, ohne ihn mit irgendeinem belastbaren semantischen Gehalt füllen zu können.
»Burundi hat sich unlängst eine ganz bemerkenswerte Führungsriege zugelegt«, betonte Bruno, diesmal ohne eine Antwort abzuwarten.
»Ich habe ein wenig Hunger«, sagte Paul. »Ehrlich gesagt habe ich heute Abend, also gestern Abend, gar nicht daran gedacht, etwas zu essen.«
»Ja …? Ich glaube, ich habe noch ein Sandwich, oder so eine Art Sandwich, ich wollte es eigentlich am Nachmittag essen. Es ist vielleicht nicht besonders gut, aber immerhin besser als nichts.«
Sie betraten die Dienstwohnung, und Bruno drehte sich zu ihm um. »Ich habe ganz vergessen, dass ich rausgegangen war, um eine Akte aus meinem Büro zu holen. Wartest du kurz auf mich?«
Sein Ministerbüro, in dem er verantwortliche Politiker, Gewerkschafter und Geschäftsführer großer Unternehmen empfing, lag in einem anderen Flügel, der Weg hin und zurück würde ihn um die zwanzig Minuten kosten. Bruno hatte sich in einem kleinen Raum seiner Wohnung ein Zweitbüro eingerichtet: eine schlichte Tischplatte mit einer Melaninharzbeschichtung in Esche-Optik, auf der sich sein Laptop und einige Akten sowie ein Duplexdrucker befanden. Er hatte die Vorhänge zugezogen, die den gesamten Blick auf die Seine verhüllten.
Die Küche war neu und funkelnd und wirkte unbenutzt: Kein Geschirr häufte sich in der Spüle, und der riesige amerikanische Kühlschrank war leer. Die zur Seine gelegene Schlafzimmersuite war ebenfalls verwaist, das Bett unangetastet. Bruno schien in einem Raum zu schlafen, der ein Kinderzimmer hätte sein können, ein wenig anspruchsvolles Kind vorausgesetzt. Es war ein kleiner fensterloser, nur mit einem Einzelbett und einem Nachttisch ausgestatteter Raum mit grauen Wänden und grauem Teppichboden.
Paul kehrte in das Ess- und Empfangszimmer zurück, das über der Seine lag. Die Aussicht durch die Glasfront, die den Raum auf drei Seiten umgab, war prachtvoll: Die Stege der Hochbahn waren beleuchtet, und am Quai d’Austerlitz herrschte noch immer reger Verkehr; das von den Lichtern der Stadt goldgelb gefärbte Wasser der Seine schlug plätschernd gegen die Pfeiler der Pont de Bercy. Der Glanz der Lichter, die den Raum durchfluteten, verströmte etwas Mondänes und Luxuriöses, wie in einem Milieu von Paris, das mit der Welt des Nachtlebens in Verbindung stand, der Welt der Eleganz, ja der bildenden Kunst. Ihn erinnerte der Anblick an nichts, nichts, was er kannte – und Bruno sicherlich ebenso wenig. Auf dem mit einem weißen Tischtuch bedeckten Tisch für acht Personen befanden sich ein noch verpacktes Daunat-Sandwich aus extraweichem Weißbrot mit Hähnchenbrust und Emmentaler und eine Flasche Tourtel-Bier. Das war also Brunos Mahlzeit; seine Uneigennützigkeit als Staatsdiener nötigt einem wirklich Respekt ab, dachte Paul. Es musste doch am Gare de Lyon eine Brasserie geben, die noch offen war, an großen Bahnhöfen gibt es eigentlich immer Brasserien, die bis spätnachts geöffnet haben und einsamen Reisenden traditionelle Gerichte bieten, ohne sie je wirklich davon zu überzeugen, dass es für sie noch einen Platz gibt in einer für jedermann zugänglichen, humanen Welt, die sich durch Familienküche und Traditionsgerichte auszeichnet. Auf diesen heroischen Brasserien, deren Kellner, die viel Elend zu sehen bekommen, meist jung sterben, ruhten Pauls letzte kulinarische Hoffnungen für diesen Abend.
Als Bruno zurückkehrte, eine umfangreiche Akte in der Hand, begutachtete er gerade in dem kleinen angrenzenden Salon eine Tierskulptur auf einem Fenstersims. Das Tier, dessen Muskulatur sorgfältig nachgebildet war, wandte den Kopf nach hinten. Es wirkte unruhig, vielleicht hatte es hinter sich etwas gehört, die Gegenwart eines Raubtiers gespürt. Es musste sich um eine Geiß handeln oder vielleicht um ein Reh oder eine Hirschkuh, er kannte sich mit Tieren nicht besonders aus.
»Was ist das hier?«, fragte er.
»Eine Hirschkuh, glaube ich.«
»Ja, du hast recht, es muss eine Hirschkuh sein. Und woher kommt sie?«
»Ich habe keine Ahnung, sie war schon da.«
Offenbar bemerkte Bruno die Existenz der Skulptur zum ersten Mal. Während er seine Klage über die chinesischen oder nicht chinesischen Seltenen Erden wieder aufnahm, fragte Paul sich, ob er ihn auf den neusten Stand bezüglich der DGSI bringen sollte. Er wusste, dass ihm dieses Video sehr zugesetzt hatte, eine Zeit lang hatte er sogar überlegt, sich aus dem politischen Leben zurückzuziehen. Bruno wusste, im wahren politischen Leben, also im Reaktorkern, war er mehr oder weniger ein Außenseiter. Seine Nominierung für das Finanzministerium vor fast fünf Jahren war bei den Behörden gelinde gesagt nicht auf Begeisterung gestoßen – man hätte sogar von einem empörten Aufschrei sprechen können, hätte der Begriff sich mit den von Kopf bis Fuß in Anthrazit gekleideten Finanzinspektoren übereinbringen lassen. Er war kein Finanzinspektor, er hatte nicht einmal an der ENA studiert, er war in jeder Hinsicht ein typischer Absolvent der École Polytechnique, der seine gesamte Berufslaufbahn in der Industrie absolviert hatte. Er hatte dort echte Erfolge erzielt, zuerst im Vorstand von Dassault Aviation, dann bei Orano und schließlich bei Arianespace, wo es ihm innerhalb weniger Jahre gelungen war, die Vorstöße der amerikanischen und chinesischen Konkurrenz zu vereiteln und Frankreich fest auf dem weltweiten Spitzenplatz der Satellitennationen zu verankern. Rüstungsindustrie, Kernkraft, Weltraum: alles Hightechsektoren, alles Bereiche, in denen sich ein Absolvent der École Polytechnique naturgemäß entfalten konnte und die ihn zugleich mit dem idealen Werdegang ausstatteten, um die Wahlversprechen des wiedergewählten Präsidenten zu erfüllen. Dieser hatte im Grunde die Träume von einer start-up nation aufgegeben, die seine erste Wahl ermöglicht, objektiv betrachtet jedoch zur Schaffung einiger prekärer und unterbezahlter, an Sklaverei grenzender Arbeitsstellen in unbeherrschbaren multinationalen Konzernen geführt hatten. Er hatte sich auf den Charme der Planwirtschaft nach französischer Art besonnen und nicht gezögert, während der riesigen Pariser Konferenz, die den Abschluss seines Wahlkampfs bildete, mit weit geöffneten Armen und in geradezu christlichem Überschwang (das konnte er immer noch, und heute besser denn je, seine Arme spreizten sich in einem scheinbar unmöglichen Winkel ab, er musste das mit einem Yoga-Trainer geübt haben, sonst wäre es nicht möglich gewesen) zu verkünden: »Ich bin heute Abend mit einer Botschaft der Hoffnung hier, und ich werde die Untergangspropheten verstummen lassen: Für Frankreich beginnen heute die nächsten Dreißig Glorreichen Jahre des Wirtschaftswunders!«
Bruno Juge war besser als jeder andere geeignet, um diese Herausforderung zu meistern. Nicht ganz fünf Jahre waren vergangen, und er hatte seinen Auftrag mehr als erfüllt. Sein spektakulärster Erfolg, von dem in den Medien am meisten die Rede gewesen war, der aber auch den tiefsten Eindruck hinterlassen hatte, war die aufsehenerregende Sanierung der PSA-Gruppe. Größtenteils vom Staat refinanziert, der damit de facto die nahezu vollständige Kontrolle übernommen hatte, hatte sich der Automobilkonzern darangemacht, die Luxusklasse zurückzuerobern, und sich dabei auf eine einzige seiner Marken konzentriert: Citroën. Es gab, das war zumindest Brunos Überzeugung, nur noch zwei Automobilmärkte, low cost und Luxusklasse, so wie es auch, doch das behielt Bruno für sich, es fiel übrigens auch nicht direkt in seinen Zuständigkeitsbereich, nur noch zwei Gesellschaftsschichten gab, die Reichen und die Armen, die Mittelschicht hatte sich in Luft aufgelöst, und der Mittelklassewagen würde ihr bald folgen. Frankreich hatte seine Kompetenz und seine Kampfeslust im low-cost-Sektor bewiesen – die Übernahme von Dacia durch Renault war der Ausgangspunkt einer beeindruckenden success story gewesen, zweifellos der beeindruckendsten in der jüngeren Geschichte des Automobilbaus. Gestützt auf eine Reputation von Eleganz und eine aufrechterhaltene Führungsposition innerhalb der Luxusindustrie, hatte Frankreich die Herausforderung des Luxusautomobilmarkts annehmen und sich als ernsthafter Konkurrent der deutschen Autobauer positionieren können, dachte Bruno. Die oberste Luxusklasse blieb unerreichbar – sie war von den englischen Herstellern blockiert, aus alles in allem kaum verständlichen Gründen, denen vermutlich erst das Aussterben der britischen Monarchie ein Ende setzen würde; aber die von den deutschen Herstellern dominierte Luxusklasse lag in ihrer Reichweite.
Diese Herausforderung, die wichtigste seiner Ministerlaufbahn, die ihn in seinem Büro im Finanzministerium über Monate hinweg nachts wach gehalten hatte, während seine Frau sich fragwürdigen Umarmungen hingab, hatte er schließlich gemeistert. Im vergangenen Jahr hatte Citroën auf nahezu dem gesamten Weltmarkt mit Mercedes gleichgezogen. Das Unternehmen hatte sich sogar auf dem strategisch sehr wichtigen indischen Markt zur Spitzenposition aufgeschwungen und war an seinen drei deutschen Rivalen vorbeigezogen – selbst Audi, das souveräne Unternehmen Audi, war auf den zweiten Rang zurückgedrängt worden, und der kaum für Gefühlsausbrüche bekannte Wirtschaftsjournalist François Lenglet hatte bei der Verkündung der Nachricht in der sehr beliebten Sendung von David Pujadas auf LCI geweint.
Dank des Einfallsreichtums seiner Designer – die von Bruno persönlich ausgewählt worden waren, der bei dieser Gelegenheit seine rein technische Rolle abgelegt und nicht gezögert hatte, seine künstlerische Vision durchzusetzen – hatte Citroën mit der Kühnheit der Schöpfer des Traction und des DS reüssiert, und ganz allgemein war es Frankreich gelungen, wieder zur für das Luxussegment emblematischen, überall auf der Welt beneideten und bewunderten Nation zu werden – und der Anstoß war entgegen aller Erwartungen nicht aus dem Mode-, sondern aus dem Automobilbereich gekommen, dem symbolischsten überhaupt, dem vollkommenen Resultat der Verbindung aus technologischer Intelligenz und Schönheit.
Auch wenn dieser Erfolg die mit Abstand größte mediale Aufmerksamkeit erhalten hatte, war es bei Weitem nicht der einzige gewesen, und Frankreich war wieder zur fünftstärksten globalen Wirtschaftskraft geworden, dicht hinter Deutschland auf Platz vier; das Staatsdefizit betrug nun weniger als 1% des Bruttoinlandsprodukts, und die Schulden wurden Stück für Stück abgebaut; das alles ohne Proteste, ohne Streiks, in einem Klima erstaunlichen Einverständnisses; Brunos Amtszeit war ein voller Erfolg.
Die nächste Präsidentschaftswahl würde in nunmehr weniger als sechs Monaten stattfinden, und der Präsident, der ohne Schwierigkeiten wiedergewählt worden wäre, konnte sich auf keinen Fall zur Wahl stellen: Seit der unklugen Verfassungsreform von 2008 war es nicht mehr möglich, mehr als zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten zu absolvieren.
Vieles war bei dieser Wahl bereits bekannt: Der Kandidat des Rassemblement National würde es in die Stichwahl schaffen – wenngleich sein Name noch nicht bekannt war, gab es fünf oder sechs mögliche Anwärter – und unterliegen. Es blieb eine einfache, aber entscheidende Frage: Wer würde der Kandidat der präsidentiellen Mehrheit werden?
In vielerlei Hinsicht hatte Bruno die beste Ausgangsposition. Er besaß bereits das Vertrauen des Präsidenten – was wesentlich war, weil der amtierende Präsident durchaus die Absicht hatte, nach fünf Jahren zurückzukehren und nochmals zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten zu absolvieren. Aus irgendeinem Grund schien der Präsident davon auszugehen, dass Bruno Wort halten und nach fünf Jahren im Amt zurücktreten, dass er nicht dem Machtrausch erliegen würde. Bruno war ein Techniker, ein herausragender Techniker, aber er war kein Machtmensch, zumindest vermochte sich der Präsident das die meiste Zeit über einzureden; dennoch hatte das Ganze etwas von einem faustischen Pakt, dessen Ausgang sich unmöglich mit Gewissheit voraussagen ließ.
Ein weiteres, viel drängenderes Problem stellten die Umfragen dar. Für 88% der Franzosen war Bruno »kompetent«, 89% hielten ihn für »tatkräftig« und 82% für »integer«, ein herausragendes Ergebnis, das seit Beginn der Umfragen noch kein Politiker erreicht hatte, selbst Antoine Pinay und Pierre Mendès France hatten nicht annähernd solche Werte erzielt. Doch nur 18% empfanden ihn als »herzlich«, 16% als »einfühlsam« und gerade einmal 11% schätzten ihn als »volksnah« ein – ein wiederum katastrophales Ergebnis, das schlechteste in der gesamten politischen Landschaft, alle Parteien zusammengenommen. Kurz gesagt, er wurde geschätzt, aber nicht geliebt. Er wusste es, er litt darunter, und darum hatte ihn dieses blutrünstige Video so tief getroffen: Er wurde nicht nur nicht geliebt, einige hassten ihn sogar so sehr, dass sie seine Ermordung inszenierten. Die Wahl der Enthauptung mit ihren revolutionären Konnotationen unterstrich nur sein Image als volksferner Technokrat, der den Menschen so fernstand, wie die Aristokraten des Ancien Régime es getan hatten.
Es war ungerecht, denn Bruno war ein guter Kerl, wie Paul wusste; aber wie sollte man die Wähler davon überzeugen? Er hatte ein gewisses Unbehagen den Medien gegenüber, weigerte sich beharrlich, auf private Fragen einzugehen, und sprach auch nicht gern öffentlich. Wie sollte er einen Wahlkampf durchstehen? Seine Kandidatur lag wirklich nicht unbedingt auf der Hand.
Ihre Freundschaft bestand noch nicht sehr lange. Als er in der Abteilung für Steuerrecht gearbeitet hatte, war Paul Bruno mehrmals, aber stets nur kurz begegnet. Die massiven Steuersenkungen, die Bruno im ersten Jahr seiner Amtszeit beschlossen hatte, durften ausschließlich für Investitionen gelten, die unmittelbar für die Finanzierung der französischen Industrie bestimmt waren – das war eine nicht verhandelbare Bedingung, und er hielt sich strikt daran. So verbindlich zu befolgende staatliche Vorgaben entsprachen nicht den Gewohnheiten des Hauses, und Paul musste nahezu allein gegen die Widerstände sämtlicher Beamten in seiner eigenen Abteilung ankämpfen, indem er unverdrossen Richtlinien und Berichte ausarbeitete, die den Wünschen des Ministers entsprachen. Nach einem mehr als ein Jahr lang währenden internen Krieg, der seine Spuren hinterlassen hatte, hatten sie sich schließlich durchgesetzt.
Dieser gemeinsame Kampf hatte Bruno auf ihn aufmerksam werden lassen, doch ihr Verhältnis hatte erst anlässlich eines erneuten, diesmal in Addis Abeba stattfindenden Kongresses der Afrikanischen Union eine persönlichere Wendung genommen, genauer gesagt am Abend des ersten Sitzungstags an der Bar des Hilton. Anfangs war das Gespräch befangen, gezwungen gewesen, doch als die Bedienung wieder zu ihnen kam, hatte sich alles entspannt. »Mit meiner Frau läuft es gerade nicht so gut …«, hatte Bruno in dem Augenblick gesagt, in dem sie ihm ein Glas Champagner hinstellte. Paul war überrascht zusammengezuckt und hätte beinahe seinen Cocktail umgestoßen – irgendein tropisches Dreckszeug, abscheulich und überzuckert, es wäre kein großer Verlust gewesen. In genau diesem Moment hatten sich auf perfekt synchrone Weise zwei afrikanische Prostituierte an einen wenige Meter entfernten Tisch gesetzt. Noch nie zuvor hatte Bruno ein annähernd privates Thema angesprochen; Paul hatte nicht einmal gewusst, dass er verheiratet war. Aber warum auch nicht, ja, so etwas gibt es, Menschen heiraten noch, Männer und Frauen, das ist sogar alltäglich. Und ein studierter Ingenieur, selbst einer, der als Jahrgangsbester abgeschnitten hatte, selbst einer, der aus dem Corps des Mines, der Vereinigung der Bergbauingenieure, hervorgegangen war, blieb doch ein Mann; das war eine neue Dimension, die er erst einmal erfassen musste.
Bruno sprach zunächst einmal nicht weiter; dann stammelte er mit gepresster Stimme: »Wir haben seit einem halben Jahr nicht mehr Liebe gemacht …« Er hatte den Ausdruck Liebe machen verwendet, fiel Paul sofort auf, und die Entscheidung für diesen gefühlsmäßig konnotierten Begriff statt Formulierungen wie vögeln (die er selbst wahrscheinlich verwendet hätte) oder Sexleben (wofür sich viele entschieden hätten, die darauf bedacht waren, die affektive Wirkung ihrer Enthüllung zu beschränken, indem sie einen neutralen Begriff benutzten) sagte schon viel aus. Auch als studierter Ingenieur machte Bruno Liebe mit seiner Frau, oder er hatte es zumindest einmal getan; auch als studierter Ingenieur war Bruno (und seine ganze Persönlichkeit, einschließlich der haushaltspolitischen Unnachgiebigkeit, erschien ihm in diesem Augenblick in einem neuen Licht) ein Romantiker. Die Romantik ist in Deutschland entstanden, das vergisst man manchmal, um ganz genau zu sein, ist sie sogar im Norden Deutschlands entstanden, in einem pietistischen Milieu, das übrigens eine nicht unerhebliche Rolle bei den anfänglichen Entwicklungen des industriellen Kapitalismus gespielt hat. Das war ein schmerzliches historisches Rätsel, über das Paul in seinen Jugendjahren manchmal nachgedacht hatte, in einer Zeit, in der die Dinge des Geistes noch seine Aufmerksamkeit erregen konnten.
Er hatte es gerade noch vermieden, voller Derbheit und Zynismus zu sagen: »Sechs Monate? Bei mir sind es zehn Jahre, mein Freund!« Es stimmte trotzdem, seit zehn Jahren hatte er weder mit Prudence noch mit sonst irgendwem gevögelt, geschweige denn Liebe gemacht. Doch die Bemerkung wäre in diesem Stadium ihrer Beziehung unangebracht gewesen, das wurde ihm gerade rechtzeitig bewusst. Bruno rechnete zweifellos noch damit, dass eine Verbesserung, ja schlichtweg eine Wiederaufnahme möglich wäre; und tatsächlich konnte das den meisten Berichten zufolge passieren.
Es wurde Abend über Addis Abeba, und der dumpfe Klang einer kongolesischen Rumba breitete sich sanft in der Bar aus. Die beiden Mädchen am Nebentisch waren Prostituierte, doch es waren Edelprostituierte, darauf wies alles hin: ihre Markenkleidung, ihr diskretes Make-up, ihre allgemeine Eleganz. Wahrscheinlich waren es auch gebildete Mädchen, womöglich Ingenieurinnen oder Doktorandinnen. Darüber hinaus waren sie sehr schön, ihre Röcke waren kurz und hauteng, ihre dazu passenden Korsagen wirkten wie ein Versprechen beträchtlicher Vergnügungen. Es waren zweifellos Äthiopierinnen, sie hatten die hochmütige Haltung von Frauen aus diesem Land. In diesem Stadium hätte alles ganz einfach sein können: Sie hätten sie nur an ihren Tisch einladen müssen. Dafür waren sie hergekommen, und sie waren nicht die Einzigen, fast alle waren deswegen zu diesem beschissenen Kongress gekommen, die Entscheidungen hinsichtlich der Entwicklung Afrikas würden ganz gewiss nicht hier getroffen werden, das war schon am Ende des ersten Tages offensichtlich. Bruno würde vielleicht hier und da ein paar Kernkraftwerke platzieren, es war eine kleine Marotte von ihm, auf internationalen Kongressen Kernkraftwerke zu platzieren; in Wahrheit würden die Verträge nicht gleich unterzeichnet werden, man würde nur Kontaktinformationen austauschen, die Unterschrift würde später erfolgen, auf diskrete Weise, vermutlich in Paris.
In näherer Zukunft wären die Verhandlungen, hätten sie die beiden Mädchen erst einmal an ihren Tisch gebeten, taktvoll und kurz gewesen, die Preise waren allen mehr oder weniger bekannt – bei den Kernkraftwerken wäre es sicher weniger einfach, doch das fiel nicht mehr in seinen Zuständigkeitsbereich. Blieb die Frage, wie die Mädchen aufzuteilen wären, aber was das anging, war Paul ganz gelassen: Die beiden gefielen ihm fast gleich gut, sie waren gleichermaßen schön, wirkten beide liebenswürdig und zart und gleichermaßen gewillt, einem westlichen Schwanz zu dienen. Paul war zu diesem Zeitpunkt ganz und gar bereit, Bruno die Wahl zu überlassen. Und sollte sich diese Wahl als unmöglich erweisen, war vielleicht ein Vierer vorstellbar.
Genau in dem Moment, in dem dieser Gedanke in seinem Geist Gestalt annahm, begriff er, dass die ganze Lage aussichtslos war. Seine Beziehung zu Bruno hatte seit einigen Minuten gewiss eine neue Dimension angenommen, aber sie waren nicht an dem Punkt, an dem sie gemeinsam in einem Raum mit Mädchen schlafen konnten, und würden es wohl auch niemals sein, darauf würde ihre Freundschaft niemals gründen, sie waren beide keine Stecher und würden es auch niemals sein, es war sogar ausgeschlossen, dass er mitansah, wie Bruno sich entschied, die Dienste einer Nutte in Anspruch zu nehmen – ganz abgesehen davon, dass Bruno ein landesweit bekannter Politiker war, dass wahrscheinlich in diesem Augenblick als Kongressteilnehmer getarnte Journalisten durch die Lounge zogen, den Zugang zu den Aufzügen beobachteten und dass er sich schon auf einer Art Rettungsmission zu befinden glaubte. Das Fehlen dieser grundlegenden maskulinen Komplizenschaft verbot es Bruno, in seiner Gegenwart den Verlockungen der beiden jungen Frauen nachzugeben, schuf aber zwischen ihnen beiden zugleich eine noch stärkere Komplizenschaft auf Grundlage ihrer schamhaften Reaktion, die zwischen ihnen eine ganz neue Nähe entstehen ließ, indem sie sie von der elementaren Gemeinschaft der Männer entfernte.
Paul zog augenblicklich die Konsequenzen aus dieser Einsicht und stand auf, gab eine vage Müdigkeit vor, die Zeitverschiebung vielleicht, setzte er hinzu (was ziemlich idiotisch war, es gab praktisch keine Zeitverschiebung zwischen Paris und Addis Abeba) und wünschte Bruno eine gute Nacht. Die Mädchen reagierten mit zarten Bewegungen und kurzem Getuschel; die Gesamtkonstellation hatte sich tatsächlich verändert. Was würde Bruno tun? Er konnte sich für die eine oder die andere entscheiden; er konnte sie auch beide nehmen, das hätte er wohl an seiner Stelle getan. Er konnte auch, das war eine dritte und leider die wahrscheinlichste Hypothese, gar nichts tun. Bruno war ein Mann, der nach langfristigen Lösungen strebte, und das galt für die Gestaltung seines Sexlebens sicherlich ebenso wie für die der Industriepolitik des Landes. Die verdrießliche Haltung, die er sich immer mehr zu eigen machte und die in der Anerkenntnis der Tatsache bestand, dass es keine langfristige Lösung gab, dass das Leben an sich keine langfristige Lösung bot, hatte Bruno nie angenommen und würde es vielleicht auch nie tun.
Als ihm vier Jahre später diese Erinnerung kam, die Erinnerung an den Moment, in dem er entschieden hatte, aufzustehen, in sein Zimmer zu gehen und Bruno im Angesicht seines sexuellen Schicksals für jenen Abend allein zurückzulassen, begriff Paul, dass er ihm nicht von seinem Treffen mit dem DGSI-Mann erzählen würde, nicht jetzt, nicht sofort.
Als Paul am Tag nach jenem Abend seine Minibar-Rechnung beglichen und sich dann an der Rezeption nach Bruno erkundigt hatte, war er überrascht zu hören, dass Bruno das Hotel schon frühmorgens mitsamt seinem Gepäck verlassen habe. Diese einsame frühmorgendliche Abreise deutete offensichtlich nicht auf eine Liebesgeschichte hin, auf Brunos Handy war die Mailbox aktiviert, und die Lage erforderte eine rasche Entscheidung: Sollte er schon den Auswärtigen Dienst benachrichtigen? Unter keinen Umständen durfte er seinen Minister im Stich lassen, doch er beschloss, sich etwas Zeit zu lassen, und rief ein Taxi zum Flughafen.
Der Mercedes-Kleinbus, der ihn zum Flughafen Addis Abeba brachte, hätte eine vielköpfige Familie transportieren können, dachte Paul. Addis Abeba, wo aufgrund der geografischen Höhe nicht so extreme Temperaturen wie in Dschibuti oder dem Sudan herrschten, hatte sich vorgenommen, zu einer maßgeblichen afrikanischen Metropole zu werden, zum wirtschaftlichen Dreh- und Angelpunkt des gesamten Kontinents. Am Ende seiner kurzen Reise war Paul durchaus geneigt gewesen, dieses Ziel für realistisch zu halten; was beispielsweise die Anbieter von Nebendienstleistungen anging, waren die Nutten vom Vorabend von einem mehr als anständigen Niveau gewesen, sie hätten jeden westlichen Geschäftsmann ebenso um den Finger wickeln können wie einen chinesischen Businessman.
Die Haupthalle des Flughafens war von Touristen völlig überschwemmt, von denen einige, wie er ihren Gesprächen entnahm, gekommen waren, um Okapis zu fotografieren. Ihr Reiseanbieter hatte sie schlecht beraten: Das Okapi lebt ausschließlich in einer kleinen Region im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo, dem Ituri-Regenwald, wo ihm ein Reservat gewidmet ist; darüber hinaus ist es aufgrund seines diskreten Lebenswandels sehr schwer zu fotografieren. Im Flughafencafé plauderte ein untersetzter und jovialer Slowene auf ihn ein, ein Delegierter der Europäischen Union. Wie alle Delegierten der Europäischen Union hatte der Mann nichts Nennenswertes zu sagen. Paul hörte ihm dennoch geduldig zu, denn das war Delegierten der Europäischen Union gegenüber die einzig mögliche Haltung. Plötzlich zog eine auffällige Farbzusammenstellung seine Aufmerksamkeit auf sich, die von einem jungen Mädchen mit schwarzen Haaren und dunkler Haut in einer weißen Hose und einem roten T-Shirt herrührte, das sich aus der Menge der Touristen löste. Dann ließ die Erstarrung nach; das junge Mädchen selbst schien verschwunden zu sein, sich in der mal überhitzten, mal kühlen Luft des Terminals aufgelöst zu haben, doch ein solches Verschwinden war, wie Paul wusste, so gut wie sicher unmöglich.
Unmittelbar nach dem letzten Aufruf im Boarding-Bereich erschien Bruno, seinen Reisekoffer in der Hand. Er sagte nicht, was er gemacht hatte, was der Grund für seine verspätete Ankunft war, und Paul wagte nicht, ihn zu fragen, nicht in diesem Moment und auch nicht später.
Eine Woche nach ihrer Rückkehr bot Bruno ihm an, seinem Ministerialkabinett beizutreten. Es war keine ungewöhnliche Entscheidung, Paul war etwa in der Phase seiner Odyssee durch die öffentliche Verwaltung, in dem ein Wechsel ins Kabinett einen normalen Schritt darstellt. Überraschender wurde das Ganze dadurch, dass er, wie er sofort begriff, keine klar umrissene Aufgabe haben würde. Die Verwaltung von Brunos Terminplan stellte keine großen Anforderungen, er war viel weniger voll, als Paul gedacht hätte. Bruno bearbeitete lieber Akten und willigte in sehr wenige Treffen ein; Bernard Arnault beispielsweise, immerhin der reichste Mann Frankreichs, versuchte seit Beginn von Brunos Amtszeit vergeblich, mit ihm zusammenzukommen; er interessierte sich einfach nicht für den Luxusbereich – der ohnehin keiner Hilfe durch öffentliche Mittel bedurfte.
Pauls wesentliche Rolle, das wurde ihm allmählich bewusst, bestand schlicht darin, Bruno im Bedarfsfall als Vertrauter zu dienen. Er fand das nicht ungewöhnlich und auch nicht erniedrigend; Bruno war der wohl größte Wirtschaftsminister seit Colbert, und die Ausübung seiner Tätigkeit im Dienste des Landes würde bedeuten, dass er vielleicht viele Jahre lang ein singuläres Schicksal auf sich nehmen würde, bei dem Momente der Fragen, des Zweifels unvermeidlich wären. Berater brauchte er nicht, er bewältigte die Akten auf herausragende Weise, es war beinahe, als besäße er ein zweites Gehirn, ein Computerhirn, das in seinen gewöhnlichen Menschenschädel verpflanzt worden war. Aber ein Vertrauter, jemand, dem er echtes Vertrauen schenkte, war in diesem Stadium seines Lebens sicherlich unverzichtbar geworden.
An diesem Abend, zwei Jahre später, hörte Paul Bruno schon seit einiger Zeit nicht mehr richtig zu. Dieser hatte sich von den Seltenen Erden abgewandt und eine heftige Schmährede gegen chinesische Solarmodule angestimmt, gegen den unglaublichen Technologietransfer, den die Chinesen während der letzten Amtsperiode auf Kosten Frankreichs betrieben hatten und der es ihnen nun ermöglichte, Frankreich mit ihren Billigprodukten zu überschwemmen. Es sei so weit, dass er einen echten Handelskrieg gegen China in Erwägung ziehe, um die Interessen französischer Solarmodul-Produzenten zu schützen. Das sei vielleicht eine gute Idee, sagte Paul, womit er ihn zum ersten Mal unterbrach; er habe bei den umweltbewussten Wählern einiges wiedergutzumachen, vor allem seine beharrliche Unterstützung der französischen Nuklearindustrie.
»Ich glaube, ich gehe, Bruno«, fügte er hinzu. »Es ist zwei Uhr morgens.«