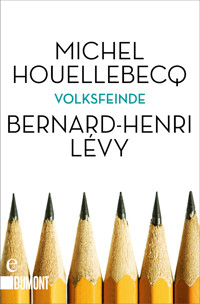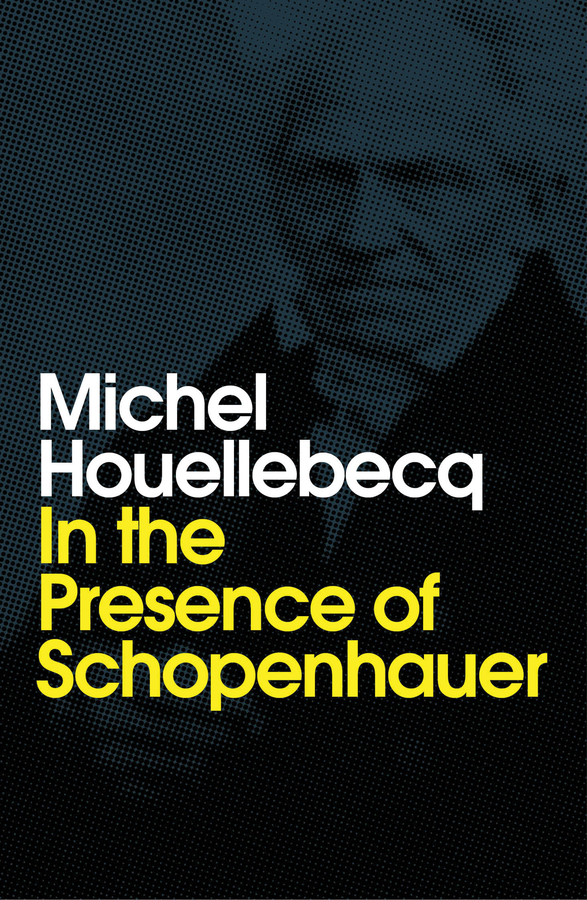9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Michel Houellebecq, Enfant terrible der Literaturszene, hat das Buch geschrieben, das niemand erwartet hätte. ›Karte und Gebiet‹ ist ein großer Wurf: ein doppelbödiges, selbstironisches Vexierspiel, ein gewichtiger Roman, der zugleich wie schwerelos wirkt. Houellebecq erweist sich darin als begnadeter Erzähler, der alle Spekulationen ins Leere laufen lässt. Jed Martin ist Künstler. In seinen ersten Arbeiten stellt er Straßenkarten und Satellitenbilder gegenüber, zum Durchbruch verhelfen ihm jedoch Porträts. Einer der Porträtierten: »Michel Houellebecq, Schriftsteller«. Doch dann geschieht ein grausames Verbrechen: ein Doppelmord, verübt auf so bestialische Weise, dass selbst die hartgesottenen Einsatzkräfte schockiert sind. Die Kunst, das Geld, die Arbeit. Die Liebe, das Leben, der Tod: Davon handelt dieser altmeisterliche Roman, der auch hierzulande bereits als literarische Sensation gefeiert wird. Michel Houellebecqs neustes Werk ist ein vollendeter Geniestreich von überraschender Zartheit. Der einstige Agent provocateur erscheint darin gereift und auf so humorvolle Weise melancholisch wie nie. ›Karte und Gebiet‹ wird nicht nur die Freunde Houellebecqs begeistern, sondern auch manchen seiner Feinde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Michel Houellebecq
KARTE UND GEBIET
Roman
Aus dem Französischen von Uli Wittmann
Die französische Originalausgabe erschien 2010 unter dem TitelLa carte et le territoire bei Flammarion, Paris© Michel Houellebecq/Flammarion 2010eBook 2011
»Die Welt ist meiner überdrüssig,Und ich bin es ihrer gleichermaßen.«Karl, Herzog von Orléans
JEFF KOONS HATTE SICH GERADE von seinem Sitz erhoben und voller Begeisterung die Arme ausgestreckt. Ihm gegenüber saß Damien Hirst leicht in sich zusammengesunken auf einem weißen Ledersofa, das zum Teil mit Seidenstoff bedeckt war. Er schien im Begriff zu sein, einen Einwand geltend zu machen, auf seinem geröteten Gesicht lag ein mürrischer Ausdruck. Beide trugen einen schwarzen Anzug – Koons einen Nadelstreifenanzug –, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Zwischen den beiden Männern stand auf einem niedrigen Tisch eine Schale mit kandierten Früchten, der keiner von beiden die geringste Aufmerksamkeit widmete. Hirst trank ein Budweiser Light.
Hinter ihnen war durch eine Fensterwand eine Hochhauslandschaft zu sehen, ein babylonisches Gewirr aus riesigen Polygonen, das sich bis zum Horizont erstreckte. Die Nacht war hell, die Luft ungemein klar. Die Begegnung hätte in Katar oder in Dubai stattfinden können; tatsächlich war die Raumausstattung einem Werbefoto aus einer deutschen Hochglanzbroschüre über das Hotel Emirates in Abu Dhabi nachempfunden.
Jeff Koons’ Stirn glänzte ein wenig. Jed milderte den Glanz mit dem Pinsel ab und trat drei Schritte zurück. Mit Koons gab es ganz offensichtlich ein Problem. Hirst dagegen war leichter darzustellen: Man konnte ihn als brutalen, zynischen Typen wiedergeben, mit einem Ausdruck, der gleichsam besagte: »Ich bin so reich, dass ich es mir leisten kann, auf euch zu scheißen«; man konnte ihn auch als unbequemen Künstler darstellen (wenn auch steinreich), der sich in seiner Arbeit auf ängstliche Weise mit dem Tod auseinandersetzte; und schließlich hatte sein Gesicht die typisch englischen Züge eines jener hitzköpfigen, pöbelhaften Kerle, wie man sie von den Fans des FC Arsenal kennt. Kurz gesagt, es gab verschiedene Aspekte, die sich jedoch zu einem kohärenten Porträt vereinigen ließen, das einen für seine Generation typischen englischen Künstler repräsentierte. Koons dagegen schien etwas Doppeldeutiges an sich zu haben, eine Art unlösbaren Widerspruch zwischen der üblichen Gerissenheit eines Vertriebsleiters aus der Technikbranche und der Überspanntheit eines Asketen. Schon seit drei Wochen arbeitete Jed am Gesichtsausdruck von Koons, der sich von seinem Sitz erhob und die Arme voller Begeisterung ausstreckte, als wolle er Hirst von etwas überzeugen; es wäre nicht schwieriger gewesen, einen pornografischen Mormonen zu malen.
Er besaß zahlreiche Fotos von Koons: allein, in Begleitung von Roman Abramowitsch, Madonna, Barack Obama, Bono, Warren Buffett oder Bill Gates … Keines dieser Fotos brachte irgendetwas von Koons’ Persönlichkeit zum Ausdruck, auf allen glich er einem Verkäufer von Chevrolet-Cabrios, es war die Erscheinung, die er gewählt hatte, um sich der Welt zu präsentieren. Es machte Jed rasend, ebenso wie die Fotografen ihn schon seit langem rasend machten, vor allem die großen Fotografen mit ihrem Anspruch, auf den Bildern die Wahrheit über ihre Modelle an den Tag zu bringen; sie brachten gar nichts an den Tag, sondern begnügten sich damit, sich vor einen zu stellen und den Auslöser ihres Apparats zu betätigen, um leise glucksend aufs Geratewohl Hunderte von Aufnahmen zu machen, und später wählten sie dann die Fotos der Serie aus, die nicht total misslungen waren. So gingen sie vor, all diese sogenannten großen Fotografen, ohne Ausnahme, Jed kannte mehrere von ihnen persönlich und hatte nur Verachtung für sie übrig, in seinen Augen waren sie durch die Bank weg so kreativ wie ein Fotoautomat.
Ein paar Schritte hinter ihm gab der Heizkessel in der Küche eine Folge von kurzen, knackenden Geräuschen von sich. Jed erstarrte. Es war schon der 15. Dezember.
EIN JAHR ZUVOR HATTE SEIN HEIZKESSEL ungefähr um diese Zeit die gleiche Folge von kurzen, knackenden Geräuschen von sich gegeben, ehe die Heizung ganz ausfiel. Innerhalb weniger Stunden war die Temperatur im Atelier auf 3° Celsius gesunken. Jed hatte es fertiggebracht, ein bisschen zu schlafen oder genauer gesagt ab und zu vorübergehend einzunicken. Gegen sechs Uhr morgens hatte er sich mit den letzten Litern, die sich noch im Warmwasserspeicher befunden hatten, kurz gewaschen, dann hatte er sich einen Kaffee gekocht und auf den Monteur der Firma Allgemeine Klempnerei gewartet – sie hatten versprochen, ihm am frühen Vormittag jemanden zu schicken.
Auf ihrer Website versprach die Firma Allgemeine Klempnerei, »das Klempnerhandwerk in das dritte Jahrtausend zu überführen«. Sie könnten damit anfangen, ihre Verabredungen einzuhalten, brummte Jed gegen elf Uhr, während er im Atelier auf und ab ging, ohne dass es ihm gelang, sich aufzuwärmen. Er arbeitete zu jener Zeit gerade an einem Porträt seines Vaters, das den Titel Der Architekt Jean-Pierre Martin gibt die Leitung seines Unternehmens ab tragen sollte, und das Sinken der Temperatur würde unweigerlich das Trocknen der letzten Farbschicht verzögern. Wie jedes Jahr hatte Jed zugestimmt, zwei Wochen darauf am Heiligabend mit seinem Vater zu Abend zu essen. Er hoffte, das Bild vorher fertigzustellen, und wenn nicht bald ein Klempner kam, drohte die Sache zu scheitern. Eigentlich war das völlig unwichtig, er hatte gar nicht die Absicht, das Bild seinem Vater zu schenken, er wollte es ihm nur zeigen; warum maß er der Sache also auf einmal so große Bedeutung zu? Er war wohl gerade wirklich mit den Nerven fertig, er arbeitete zu viel, hatte sechs Gemälde gleichzeitig begonnen, seit mehreren Monaten hatte er so gut wie keine Pause eingelegt, das war ziemlich unvernünftig.
Gegen fünfzehn Uhr beschloss er die Firma Allgemeine Klempnerei anzurufen. Es war ständig besetzt. Kurz nach siebzehn Uhr gelang es ihm endlich, jemanden zu erreichen; die für den Kundendienst zuständige Mitarbeiterin machte die aufgrund des Kälteeinbruchs außergewöhnliche Mehrarbeit geltend, versprach ihm aber fest, am folgenden Vormittag jemanden vorbeizuschicken. Jed legte auf und reservierte ein Zimmer im Hôtel Mercure am Boulevard Auguste-Blanqui.
Den ganzen nächsten Tag wartete er auf die Ankunft eines Monteurs der Allgemeinen Klempnerei, aber auch auf jemanden von der Firma Ganz einfach Klempner, die er in der Zwischenzeit erreicht hatte. Ganz einfach Klempner versprach zwar die Wahrung der Tradition eines »Klempnerhandwerks von hohem Niveau«, stellte sich aber als ebenso unfähig heraus, eine Verabredung einzuhalten.
Auf dem Bild, das Jed von seinem Vater gemalt hatte, stand dieser auf einem Podium vor den etwa fünfzig Angestellten, die sein Unternehmen zählte, und hob mit einem leicht bitteren Lächeln sein Glas. Die Abschiedsfeier hatte im Großraumbüro seiner Firma stattgefunden, einem durch ein Glasdach erhellten etwa dreißig mal zwanzig Meter großen Raum mit weißen Wänden, in dem sich mit Computern ausgestattete Arbeitsplätze und auf Böcken ruhende Tischplatten mit maßstabsgetreuen Modellen der in Arbeit befindlichen Projekte abwechselten. Der größte Teil der Mitarbeiter bestand aus jungen Leuten, die wie Nerds aussahen: Das waren die 3-D-Gestalter. Am Fuß des Podiums standen drei Architekten um die vierzig, die seinen Vater umrahmten. Die Gestaltung eines zweitrangigen Gemäldes von Lorenzo Lotto imitierend, mied jeder von ihnen den Blick der beiden anderen, versuchte jedoch den Blick seines Vaters auf sich zu ziehen; wie man sogleich begriff, hegte jeder von ihnen die Hoffnung, seine Nachfolge als Firmenchef anzutreten. Der Blick seines Vaters, der einen imaginären Punkt oberhalb der Köpfe seiner Mitarbeiter fixierte, drückte den Wunsch aus, sein Team ein letztes Mal um sich herum zu versammeln. Es lag ein gewisses Vertrauen in die Zukunft darin, vor allem aber unendliche Trauer. Die Trauer darüber, das Unternehmen zu verlassen, das er gegründet und dem er sein Bestes gegeben hatte, die Trauer angesichts des Unvermeidlichen: Man hatte hier ganz offensichtlich einen Mann vor sich, der am Ende war.
Im Verlauf des Nachmittags versuchte Jed etwa zehn Mal vergeblich, die Firma The Klemp zu erreichen, die sich für die Wartemusik ihrer Telefonanlage des Radiosenders Skyrock bediente, während sich Ganz einfach Klempner für das Unterhaltungsprogramm des Senders Rires et chansons entschieden hatte.
Gegen siebzehn Uhr ging er ins Hôtel Mercure. Über dem Boulevard Auguste-Blanqui brach die Dunkelheit an; ein paar Obdachlose hatten in der Seitenallee ein Feuer gemacht.
Die folgenden Tage verliefen ganz ähnlich: Er wählte die Nummern von Klempnerfirmen, landete fast augenblicklich in einer Warteschleife mit Musik und verharrte in immer eisigerer Kälte neben seinem Gemälde, das nicht trocknen wollte.
Am Vormittag des 24. Dezember bot sich ihm eine Lösung in Gestalt eines kroatischen Handwerkers an, der ganz in der Nähe in der Avenue Stephen-Pichon wohnte – Jed hatte das Schild zufällig auf dem Rückweg vom HôtelMercure entdeckt. Er könne kommen, ja, sofort. Er war ziemlich klein, hatte schwarzes Haar, eine blasse Gesichtsfarbe, ebenmäßige, feine Züge und einen kleinen Schnurrbart im Stil der Belle Époque; tatsächlich ähnelte er Jed sogar ein wenig – abgesehen vom Schnurrbart.
Gleich nachdem er die Wohnung betreten hatte, untersuchte er lange den Heizkessel, nahm die Bedienungseinheit heraus und tastete mit seinen feingliedrigen Fingern das komplizierte Netz der Rohrleitungen ab. Er sprach von Ventilen und Siphons. Er machte den Eindruck, sich im Leben generell ganz gut auszukennen.
Nach einer viertelstündigen Untersuchung stellte er folgende Diagnose: Er könne die Heizung reparieren, ja, er könne eine Art von Ausbesserung vornehmen, und zwar für fünfzig Euro, nicht mehr. Aber es handele sich dabei nicht um eine richtige Reparatur, sondern eher um eine Art Flickwerk, das ein paar Monate, bestenfalls ein paar Jahre halten könne. Auf lange Sicht jedoch könne er nichts garantieren, und ganz allgemein gesprochen erscheine es ihm nicht ratsam, auf die Langlebigkeit dieses Heizkessels eine Wette einzugehen.
Jed seufzte. Damit habe er schon fast gerechnet, gab er zu. Er erinnerte sich noch genau an den Tag neun Jahre zuvor, an dem er beschlossen hatte, diese Wohnung zu kaufen; er sah den untersetzten, selbstzufriedenen Wohnungsmakler wieder vor sich, der die außergewöhnliche Helligkeit rühmte, ohne zu verheimlichen, dass die Wohnung leicht »renovierungsbedürftig« sei. Damals hatte Jed sich gesagt, dass er lieber Wohnungsmakler oder Gynäkologe geworden wäre.
Der untersetzte Wohnungsmakler, der in den ersten Minuten lediglich freundlich gewesen war, verfiel in eine geradezu lyrische Trance, als er erfuhr, dass Jed Künstler war. Es sei das erste Mal, rief er, dass er die Möglichkeit habe, ein Künstleratelier an einen Künstler zu verkaufen! Jed befürchtete einen Augenblick, er könne seine Solidarität mit authentischen Künstlern bekunden, im Unterschied zu Yuppies und anderen Spießern derselben Sorte, die die Preise in die Höhe trieben und somit den Künstlern den Kauf eines Künstlerateliers verwehrten, aber was soll man da schon machen, nicht wahr, ich kann mich schließlich nicht gegen die Marktlage auflehnen, das ist nicht meine Rolle … Doch zum Glück kam es nicht dazu, der untersetzte Wohnungsmakler begnügte sich damit, ihm einen Preisnachlass von 10 Prozent zu gewähren – den er ihm vermutlich schon nach der ersten Vorverhandlung einzuräumen beschlossen hatte.
Das »Künstleratelier« war in Wirklichkeit ein Dachboden mit großen Glasfenstern, die allerdings sehr schön waren, und ein paar dunklen Nebenräumen, die selbst für jemanden wie Jed kaum ausreichten, obwohl er nur ein begrenztes Hygienebedürfnis hatte. Aber der Blick war tatsächlich prachtvoll: Jenseits der Place des Alpes konnte man den Boulevard Vincent-Auriol sehen, die oberirdische Metro und in der Ferne die in den Siebzigern erbauten viereckigen Festungen, die in totalem Gegensatz zur Ästhetik der restlichen Pariser Landschaft standen und die Jed vom architektonischen Standpunkt aus allen anderen Gebäuden in Paris vorzog.
Der Kroate nahm die Reparatur vor und steckte die fünfzig Euro ein. Er bot Jed nicht an, eine Rechnung auszustellen, was dieser im Übrigen keineswegs erwartet hatte. Die Tür war gerade hinter ihm ins Schloss gefallen, als es wieder mehrmals kurz klopfte. Jed schob die Tür einen Spalt auf.
»Noch eins, Monsieur«, sagte der Mann. »Fröhliche Weihnachten. Ich wollte Ihnen noch fröhliche Weihnachten wünschen.«
»Ach, richtig«, sagte Jed verlegen. »Das wünsche ich Ihnen auch. Fröhliche Weihnachten.«
In diesem Augenblick wurde ihm klar, dass er wohl ein Problem haben würde, ein Taxi zu bekommen. Wie erwartet weigerte sich AToute kategorisch, ihn nach Le Raincy zu fahren, und Speedtax war allenfalls bereit, ihn bis zum Bahnhof zu bringen oder zur Not bis zum Rathaus, aber bestimmt nicht in die Nähe der Cité des Cigales. »Eine Frage der Sicherheit, Monsieur …«, flüsterte der Angestellte leicht vorwurfsvoll. »Wir verkehren nur in völlig sicheren Bereichen, Monsieur«, erklärte seinerseits mit aalglatter Arroganz ein Typ von Voitures Fernand Garcin am Telefon. Jed bekam allmählich Schuldgefühle, weil er den Heiligen Abend in einem so wenig statthaften Vorstadtviertel wie der Cité des Cigales verbringen wollte, und wie in jedem Jahr nahm er es seinem Vater übel, dass dieser sich beharrlich weigerte, das großbürgerliche, von einem großen Park umgebene Haus zu verlassen, das durch die Bevölkerungsmigration mehr und mehr ins Zentrum eines Viertels rückte, das immer gefährlicher geworden und seit kurzem tatsächlich völlig in die Hand von Gangs geraten war.
Als Erstes hatte sein Vater die Umfassungsmauer verstärkt, sie mit einem Elektrozaun erhöht und durch ein mit der Polizeiwache verbundenes Videoüberwachungssystem aufgerüstet, und all das, damit er einsam durch die nicht zu beheizenden zwölf Zimmer irren konnte, in denen ihn nie jemand besuchte, abgesehen – an jedem Heiligabend – von Jed. Schon seit langem waren die kleinen Geschäfte ringsumher verschwunden, und es war unmöglich, zu Fuß durch die benachbarten Straßen zu laufen – selbst Autos wurden immer öfter an roten Ampeln überfallen. Die Stadtverwaltung von Le Raincy hatte ihm eine Haushaltshilfe bewilligt, eine mürrische, ja boshafte Senegalesin namens Fatty, die von Anfang an eine Aversion gegen ihn entwickelt hatte, sich weigerte, mehr als einmal im Monat die Bettwäsche zu wechseln, und bei den Einkäufen höchstwahrscheinlich einen Teil des Geldes für sich selbst abzweigte.
Wie auch immer, die Temperatur im Raum stieg jedenfalls langsam. Jed machte ein Foto von dem Gemälde, an dem er arbeitete, damit er seinem Vater wenigstens etwas zeigen konnte. Er zog Hose und Pullover aus, setzte sich im Schneidersitz auf die direkt auf dem Boden liegende schmale Matratze, die ihm als Bett diente, und hüllte sich in eine Decke ein. Nach und nach verlangsamte er seinen Atemrhythmus. Er stellte sich Wogen vor, die sich in fahlem Dämmerlicht langsam und träge hoben und senkten. Er bemühte sich, seinen Geist in eine Zone der Ruhe zu lenken, und bereitete sich, so gut er konnte, innerlich darauf vor, wieder einmal einen Heiligabend mit seinem Vater zu verbringen.
Diese geistige Vorbereitung trug Früchte, und der Abend verlief in neutraler, fast geselliger Atmosphäre; schon seit langem erhoffte er sich nicht mehr.
Am nächsten Morgen gegen sieben lief Jed zum Bahnhof in Le Raincy, da er davon ausging, dass auch die Gangs Heiligabend gefeiert hatten, und erreichte ungehindert die Gare de l’Est.
EIN JAHR DARAUF ZEIGTE DIE HEIZUNG zum ersten Mal wieder ein Zeichen von Schwäche, nachdem die Reparatur so lange gehalten hatte. Das Gemälde Der Architekt Jean-Pierre Martin gibt die Leitung seines Unternehmens ab war seit langem beendet und in Erwartung einer persönlichen Ausstellung, die noch immer nicht terminiert war, im Lagerraum von Jeds Galeristen untergebracht. Jean-Pierre Martin selbst hatte – zur Überraschung seines Sohnes und obwohl dieser schon lange darauf verzichtete, das Thema anzuschneiden – beschlossen, die Villa in Le Raincy zu verlassen, um in ein Altersheim mit Pflegestation in Boulogne zu ziehen. Ihr alljährliches Abendessen würde diesmal in einer Brasserie namens Chez Papa an der Avenue Bosquet stattfinden. Jed hatte das Restaurant aufgrund einer Anzeige im Citymagazin Pariscope ausgewählt, die eine traditionelle Küche wie zu Großmutters Zeiten versprach, und dieses Versprechen war im Großen und Ganzen eingehalten worden. Weihnachtsmänner und mit Girlanden geschmückte Christbäume waren hier und dort im halbleeren Saal aufgestellt, der im Wesentlichen von kleinen Gruppen alter oder sogar sehr alter Leute besetzt war, die eifrig, gewissenhaft, ja fast grimmig auf den verschiedenen Gerichten traditioneller Küche herumkauten. Es gab Wildschwein, Spanferkel oder Truthahn und zum Nachtisch natürlich die zu Weihnachten übliche mit Creme gefüllte Biskuitrolle wie zu Großmutters Zeiten. Höfliche, unscheinbare Ober walteten lautlos ihres Amtes wie in einem Zentrum für Brandopfer. Jeds Idee, seinen Vater in ein solches Restaurant einzuladen, hatte etwas Kindisches, das war ihm völlig klar. Der hagere, ernste Mann mit dem schmalen, strengen Gesicht schien sich nie für Gaumenfreuden interessiert zu haben, und die wenigen Male, an denen Jed mit ihm in der Stadt gegessen hatte, um ihn in der Nähe seines Arbeitsplatzes zu treffen, hatte sein Vater ein Sushi-Restaurant gewählt – und zwar immer dasselbe. Es war geradezu pathetisch und ziemlich aussichtslos, eine gastronomische Geselligkeit schaffen zu wollen, für die es keine Grundlage gab und vermutlich nie gegeben hatte – als seine Frau noch am Leben gewesen war, hatte sie es immer gehasst zu kochen. Aber es war eben Weihnachten, und was hätte Jed sonst für ihn tun können? Seinem Vater war es völlig gleichgültig, wie er gekleidet war, er las immer weniger und schien sich kaum noch für irgendetwas zu interessieren. Er war, den Worten der Leiterin des Altersheims zufolge, »relativ gut integriert«, was vermutlich hieß, dass er mit so gut wie niemandem sprach. Im Moment kaute er mühselig auf seinem Spanferkel herum, mit einem Gesichtsausdruck, als handele es sich um ein Stück Gummi. Nichts deutete darauf hin, dass er das schon lange anhaltende Schweigen brechen wollte, und Jed suchte nervös und fieberhaft – er hätte keinen Gewürztraminer zu den Austern trinken sollen, das war ihm schon in dem Augenblick bewusst geworden, als er die Bestellung aufgegeben hatte, denn wenn er Weißwein trank, konnte er keinen klaren Gedanken mehr fassen – nach etwas, das einem Gesprächsthema ähnelte. Wenn er verheiratet gewesen wäre, wenn es wenigstens eine Freundin oder auch nur irgendeine Frau in seinem Leben gegeben hätte, wäre die Sache ganz anders verlaufen – Frauen gehen bei solchen Familiengeschichten eben viel geschickter vor als Männer, das ist ihnen gewissermaßen in die Wiege gelegt, und selbst wenn keine Kinder anwesend sind, geben diese immer einen potentiellen Gesprächsstoff ab, und alte Leute interessieren sich bekanntermaßen für ihre Enkelkinder, sie verbinden das mit den Zyklen der Natur oder so, auf jeden Fall entsteht dabei so etwas wie Rührung in ihrem alten Kopf, der Sohn ist zwar der Tod des Vaters, das steht fest, aber für einen Großvater ist der Enkel eine Art Wiedergeburt oder Revanche, und zumindest für die Dauer eines Weihnachtsessens kann so etwas durchaus genügen. Jed sagte sich manchmal, er solle für diese Weihnachtsabende ein Escort Girl engagieren und eine kleine Geschichte erfinden; dazu hätte er das Mädchen nur zwei Stunden vorher kurz über die Situation informieren müssen, sein Vater war nicht sehr neugierig, was Einzelheiten aus dem Leben anderer Leute betraf, eben nicht neugieriger, als Männer es im Allgemeinen sind.
In den romanischen Ländern kann Politik als Gesprächsthema für Männer mittleren oder vorgerückten Alters ausreichen, in den unteren Schichten kann Sport eine weitere Möglichkeit bieten. Bei Leuten, die stark von angelsächsischen Werten beeinflusst sind, wird die Rolle der Politik eher durch Themen aus Wirtschaft und Finanz eingenommen, auch Literatur kann als Zusatzthema dienen. Doch was Jed und seinen Vater betraf, so interessierten sie sich weder für Wirtschaft noch für Politik. Jean-Pierre Martin war im Großen und Ganzen mit der Art einverstanden, wie das Land regiert wurde, und sein Sohn hatte dazu keine Meinung. Alles in allem erlaubte ihnen das aber immerhin, bis zur Käseplatte durchzuhalten, indem sie sich ein Ministerium nach dem anderen vornahmen.
Als die Käseplatte auf einem Rollwagen herbeigeschoben wurde, kam etwas Leben in Jeds Vater, und er fragte seinen Sohn nach dessen künstlerischen Plänen. Leider würde Jed diesmal die Stimmung etwas trüben müssen, denn sein letztes Gemälde Damien Hirst und Jeff Koons teilen den Kunstmarkt unter sich auf gefiel ihm überhaupt nicht mehr, er kam nicht voran, seit ein oder zwei Jahren war er von einer Kraft beseelt gewesen, die inzwischen nachließ und allmählich versiegte, aber warum sollte er all das seinem Vater sagen, der konnte nichts dafür, niemand konnte im Übrigen etwas dafür, die Leute konnten angesichts eines solchen Eingeständnisses höchstens ein leichtes Bedauern ausdrücken, denn die zwischenmenschlichen Beziehungen sind letzten Endes ziemlich begrenzt.
»Ich bereite fürs Frühjahr eine persönliche Ausstellung vor«, verkündete er schließlich. »Aber die Sache geht nicht so recht voran. Franz, mein Galerist, möchte gern einen Schriftsteller haben, der das Vorwort zu dem Katalog schreibt. Er hat an Houellebecq gedacht.«
»Michel Houellebecq?«
»Du kennst ihn?«, fragte Jed überrascht. Er hätte nie vermutet, dass sein Vater sich noch in irgendeiner Form für die gegenwärtige Kulturproduktion interessieren könnte.
»Im Altersheim haben wir eine kleine Bibliothek, ich habe zwei Romane von ihm gelesen. Das ist ein guter Autor, wie mir scheint. Liest sich sehr angenehm, und er zeichnet ein ziemlich zutreffendes Bild unserer Gesellschaft. Hat er dir schon geantwortet?«
»Nein, noch nicht …« Jed dachte jetzt blitzschnell nach. Wenn selbst jemand, der zutiefst in einer verzweifelten, ja geradezu tödlichen Routine erstarrt war, jemand, der sich zutiefst in die Schattenseiten des Lebens verkrochen und den düsteren Weg zum Tod schon betreten hatte wie sein Vater, wenn also so jemand einen Autor wie Houellebecq zur Kenntnis genommen hatte, dann musste wohl wirklich etwas an ihm dran sein. Da wurde Jed plötzlich bewusst, dass er es versäumt hatte, Houellebecq per E-Mail an seine Anfrage zu erinnern, worum Franz ihn schon mehrmals gebeten hatte. Und dabei war die Sache sehr eilig. Aufgrund der Daten von Art Basel und Frieze Art Fair musste die Ausstellung im April oder spätestens im Mai stattfinden, und man konnte Houellebecq schlecht bitten, ein Vorwort für den Katalog in vierzehn Tagen herunterzuschreiben, er war immerhin ein berühmter, Franz zufolge sogar weltberühmter Autor.
Sein Vater war wieder in seine Lethargie verfallen, er kaute mit ebenso wenig Begeisterung auf seinem Saint-Nectaire herum wie auf dem Spanferkel. Vermutlich geht es auf Mitgefühl zurück, wenn man alten Leuten eine stark entwickelte Esslust unterschiebt, weil man sich einreden möchte, dass ihnen wenigstens das noch bleibt, dabei sterben bei den meisten Menschen vorgerückten Alters auch die Gaumenfreuden unweigerlich ab wie alles andere. Stattdessen bleiben nur noch Verdauungsstörungen und Prostatakrebs.
Ein paar Meter links von ihnen schienen drei Frauen in ihren Achtzigern andächtig vor ihrem Obstsalat zu verharren – vielleicht in Gedenken an ihre verstorbenen Ehemänner. Eine von ihnen streckte die Hand nach ihrem Champagnerglas aus, doch dann ließ sie sie auf den Tisch sinken; ihr Brustkorb hob sich von der Anstrengung. Nach ein paar Sekunden versuchte sie es mit stark zitternder Hand noch einmal, wobei sich ihr Gesicht vor Konzentration verzerrte. Jed nahm sich zusammen, um nicht einzugreifen, doch er wäre sowieso nicht dazu in der Lage gewesen. Selbst der Ober, der ein paar Meter neben ihnen stand und den Vorgang mit besorgtem Blick überwachte, hätte nicht mehr eingreifen können; diese Frau stand jetzt in direktem Kontakt mit Gott. Sie war vermutlich eher um die neunzig als Mitte achtzig.
Damit alles einen guten Abschluss fand, wurde nun der Nachtisch serviert. Resigniert machte sich Jeds Vater über die traditionelle Biskuitrolle her. Jetzt würde die Sache nicht mehr lange dauern. Die Zeit verging auf seltsame Weise zwischen ihnen: Obwohl sie kein Wort wechselten und das an ihrem Tisch nun schon lange andauernde Schweigen eigentlich schwer auf ihnen hätte lasten müssen, schienen die Sekunden und sogar die Minuten mit rasender Geschwindigkeit zu verrinnen. Ohne dass ihm irgendein Gedanke durch den Kopf gegangen wäre, begleitete Jed seinen Vater eine halbe Stunde später zum Taxistand.
Es war erst zehn Uhr abends, doch Jed wusste, dass die anderen Bewohner des Altersheims seinen Vater beneiden würden, weil er zu Weihnachten mehrere Stunden lang mit jemandem zusammen war. »Ihr Sohn ist ein guter Junge«, hatte man schon mehrfach zu ihm gesagt. Nach dem Einzug in ein Altersheim mit Pflegestation befindet sich der ehemalige Senior – der nun unwiderruflich zum Greis geworden ist – ein bisschen in der Rolle eines Internatsschülers. Manchmal bekommt er Besuch: Das ist dann ein Moment des Glücks, er kann die Welt erkunden, Schokokekse von Bahlsen essen und den Clown Ronald McDonald treffen. Aber die meiste Zeit bekommt er keinen Besuch: Dann irrt er traurig zwischen den Handballpfosten über das geteerte Gelände des leeren Internats. Er wartet auf die Befreiung, darauf, flügge zu werden.
Als Jed wieder in seinem Atelier war, stellte er fest, dass die Heizung noch funktionierte, die Raumtemperatur war normal, ja sogar recht warm. Er zog sich halb aus, ehe er sich auf seiner Matratze ausstreckte und mit völlig leerem Kopf sofort einschlief.
ER SCHRECKTE MITTEN IN der Nacht hoch, der Wecker zeigte 4.43 Uhr an. Im Zimmer war es heiß und stickig. Das Geräusch des Heizkessels hatte ihn geweckt. Aber es war nicht das übliche Knacken. Diesmal gab das Gerät ein tiefes, infraschallartiges Brummen von sich. Jed riss das Küchenfenster auf, dessen Scheiben mit Eisblumen überzogen waren. Kalte Luft drang herein. Sechs Stockwerke tiefer störte ein Grunzen wie von Schweinen die weihnachtliche Ruhe. Er schloss das Fenster sofort wieder. Wahrscheinlich waren Penner in den Innenhof eingedrungen; am folgenden Tag würden sie sich an aus Mülltonnen zusammengesuchten Resten des Weihnachtsmahls gütlich tun. Keiner der Mieter würde es wagen, die Polizei zu rufen, um sie loszuwerden – nicht am Weihnachtstag. Meistens kümmerte sich die Mieterin aus dem ersten Stock darum – eine Frau in ihren Sechzigern, die ihr Haar mit Henna färbte, Patchwork-Pullover in grellen Farben trug und Jeds Einschätzung nach eine Psychoanalytikerin im Ruhestand war. Aber er hatte sie in den letzten Tagen nicht gesehen, sie war vermutlich in Urlaub gefahren – falls sie nicht plötzlich gestorben war. Die Penner würden mehrere Tage lang dort bleiben, der Gestank ihrer Fäkalien würde den Innenhof erfüllen, sodass man unmöglich die Fenster öffnen konnte. Den Mietern gegenüber zeigten sie sich freundlich, sogar unterwürfig, aber die Schlägereien, die sie untereinander anzettelten, waren äußerst brutal und endeten fast immer auf die gleiche Weise: Laute Schreie, wie von einem Todeskampf, drangen in die Nacht, irgendjemand rief den Notarztwagen, und dann fand man einen Typen, der mit halb abgerissenem Ohr in einer Blutlache lag.
Jed ging auf den mittlerweile verstummten Heizkessel zu und hob behutsam die Klappe an, hinter der sich die Bedienungseinheit befand; das Gerät gab augenblicklich ein kurzes Brummen von sich, als fühle es sich von diesem Eingriff bedroht. Eine gelbe Kontrollleuchte blinkte in kurzen Abständen auf, was Jed aber nicht zu deuten wusste. Vorsichtig drehte er den Wärmeregler Millimeter für Millimeter nach links. Falls die Sache schiefgehen sollte, hatte er noch die Telefonnummer des Kroaten; aber übte der seinen Beruf überhaupt noch aus? Er habe nicht die Absicht, »als Klempner zu versauern«, hatte er Jed ohne Umschweife gestanden. Sobald er »ein hübsches Sümmchen« zusammengetragen habe, wolle er in seine Heimat Kroatien zurückkehren, und zwar genauer gesagt auf die Insel Hvar, um dort eine Firma zu gründen, die Jet-Boote vermietete. Nebenbei bemerkt war eines der letzten Projekte, an denen Jeds Vater vor seinem Ruhestand gearbeitet hatte, eine Ausschreibung für den Bau eines luxuriösen Yachthafens in Stari Grad auf der Insel Hvar gewesen, die tatsächlich im Begriff war, ein Reiseziel von Rang zu werden – im vergangenen Jahr hatte man dort Sean Penn und Angelina Jolie begegnen können –, und Jed empfand eine gewisse zutiefst menschliche Enttäuschung bei dem Gedanken daran, dass dieser Mann die Klempnerei an den Nagel hängte, ein durchaus edles Handwerk, um stinkreichen kleinen Scheißern, die in Paris in der Rue de la Faisanderie wohnten, beknackte, lärmende Motorfahrzeuge zu vermieten.
»Worum handelt es sich hier eigentlich?«, ist die Frage, die die Internetseite der Insel Hvar stellt, ehe sie mit folgenden Worten darauf antwortet: »Hier findet man breite Lavendelfelder, uralte Olivenbäume und Weingärten, eine einzigartige Harmonie, deswegen wird ein Gast, der sich der Natur anzunähern versucht, viel lieber einen kleinen Hvarer Weinkeller als ein luxuriöses Hotel aufsuchen. Er wird authentische einheimische Weinsorten anstatt des berühmten Sekts kosten, wird ein altes Insellied anstimmen und seine alltägliche Routine vergessen«, das war es vermutlich, was Sean Penn verlockt hatte; Jed stellte sich die ruhige Nachsaison vor, einen noch milden Oktober, in dem der ehemalige Klempner in aller Ruhe vor einem Risotto aus Meeresfrüchten saß, und diese Wahl war natürlich verständlich, ja sogar durchaus zu entschuldigen.
Fast unwillkürlich näherte er sich dem Gemälde Damien Hirst und Jeff Koons teilen den Kunstmarkt unter sich auf, das auf der Staffelei mitten im Atelier ruhte, und wieder überkam ihn ein Gefühl der Unzufriedenheit, das diesmal noch bitterer war. Ihm wurde bewusst, dass er Hunger hatte, was nicht normal war, denn er hatte ein vollständiges Weihnachtsmahl mit seinem Vater eingenommen, inklusive Vorspeise, Käse und Nachtisch, nichts hatte gefehlt, aber er hatte Hunger und ihm war zu warm, er konnte kaum noch atmen. Er kehrte in die Küche zurück, öffnete eine Dose Cannelloni in Soße, verschlang die Nudeln eine nach der anderen und betrachtete dabei mit mürrischer Miene sein missratenes Bild. Koons war ganz eindeutig nicht locker genug geraten, nicht ätherisch genug – vielleicht hätte er ihn mit Flügeln versehen müssen, wie der Gott Merkur dargestellt wird, dachte Jed stumpf; so wie er hier abgebildet war, in seinem Nadelstreifenanzug und mit seinem Handelsvertreterlächeln, ließ er ein wenig an Silvio Berlusconi denken.
In der von ArtPrice aufgestellten Rangliste der vermögendsten Künstler nahm Koons weltweit den zweiten Platz ein; seit einigen Jahren hatte ihm der etwa zehn Jahre jüngere Hirst den ersten Rang streitig gemacht. Was Jed anging, so hatte er gut zehn Jahre zuvor den 583. Platz eingenommen – aber immerhin Platz 17 unter den Franzosen. Anschließend war er, wie die Kommentatoren der Tour de France es ausdrücken, »vom Feld geschluckt« worden, ehe er ganz aus der Liste verschwunden war. Er leerte die Dose Cannelloni und entdeckte eine Cognacflasche mit einem kleinen Rest. Dann drehte er die Spots seiner Halogenleiste voll auf und richtete sie auf die Mitte des Gemäldes. Bei näherer Betrachtung stellte er fest, dass selbst die Nacht nicht richtig gelungen war, ihr fehlte die geheimnisvolle Pracht, die man mit Nächten der arabischen Halbinsel verband; er hätte Cölinblau verwenden sollen und nicht Ultramarin. Es war wirklich ein beschissenes Bild, das er da malte. Er nahm einen Spachtel, stach Damien Hirst ein Auge aus und vergrößerte dann mühevoll das Loch – es war eine sehr widerstandsfähige Leinwand aus eng gewebten Leinenfasern. Dann ergriff er die klebrige Leinwand mit einer Hand und zerriss sie mit einem Ruck. Die Staffelei geriet ins Schwanken und stürzte zu Boden. Ein wenig ruhiger geworden, hielt Jed inne, betrachtete seine mit Farbe besudelten Hände und trank den Cognac aus, ehe er mit beiden Füßen auf das Gemälde sprang, es zertrampelte und über den Boden rieb, der allmählich glitschig wurde. Schließlich verlor er das Gleichgewicht und fiel der Länge nach hin, wobei er mit dem Hinterkopf gegen den Rahmen der Staffelei schlug. Er musste aufstoßen und übergab sich, und plötzlich fühlte er sich besser, die frische Nachtluft strich über sein Gesicht, er schloss glücklich die Augen; er hatte ganz offensichtlich das Ende eines Zyklus erreicht.
ERSTER TEIL
I
JED ERINNERTE SICH nicht mehr daran, wann er zu zeichnen begonnen hatte. Vermutlich zeichnen mehr oder weniger alle Kinder, er kannte keine Kinder und war sich daher nicht sicher. Sicher wusste er im Moment nur, dass er damals begonnen hatte, Blumen zu zeichnen – und zwar mit Buntstiften in kleine Hefte.
Hauptsächlich an Mittwochnachmittagen und manchmal auch sonntags hatte er Momente regelrechter Ekstase erlebt, wenn er allein im sonnigen Garten war, während die Babysitterin mit ihrem aktuellen Freund telefonierte. Vanessa war damals achtzehn und studierte im ersten Jahr Wirtschaftswissenschaft an der Universität Saint-Denis/ Villetaneuse, und über lange Zeit war sie die einzige Zeugin seiner ersten künstlerischen Versuche gewesen. Sie fand seine Zeichnungen hübsch, das sagte sie ihm, und es war durchaus ehrlich gemeint; dennoch blickte sie ihn manchmal verwundert an. Kleine Jungen zeichnen meistens blutrünstige Monster, Naziabzeichen und Jagdflugzeuge (oder, wenn sie schon weit für ihr Alter sind, Mösen und Schwänze), aber nur selten Blumen.
Jed wusste es damals nicht, und Vanessa ebenso wenig, aber Blumen sind reine Sexualorgane, farbenprächtige Scheiden, die die Oberfläche der Welt schmücken und der Lüsternheit der Insekten preisgegeben sind. Die Insekten, die Menschen und auch andere Tiere scheinen ein Ziel zu verfolgen, sie bewegen sich schnell und zielsicher voran, während die Blumen im Licht bleiben, strahlend schön und unverrückbar. Die Schönheit der Blumen stimmt traurig, weil Blumen empfindlich und dem Tod geweiht sind wie natürlich alles andere auf der Erde, aber in ganz besonderer Weise, und wie bei den Tieren sind ihre sterblichen Überreste nur eine groteske Parodie ihres lebendigen Seins, und wie die der Tiere stinken auch sie – all das begreift man, sobald man einmal den Wechsel der Jahreszeiten miterlebt hat, und Jed hatte es schon im Alter von fünf Jahren oder vielleicht noch früher begriffen, denn der Park, der das Haus in Le Raincy umgab, war voller Blumen und Bäume, und die sich im Wind bewegenden Zweige der Bäume gehörten vielleicht, abgesehen von Wolken und Himmel, zu den ersten Dingen, die er wahrgenommen hatte, als er von einer erwachsenen Frau (seiner Mutter?) in einem Kinderwagen durch den Garten geschoben worden war. Der Lebenswille der Tiere kommt durch schnelle Umwandlungen zum Ausdruck – durch das Befeuchten des Lochs, das Aufrichten des Stängels und anschließend das Ausscheiden der Samenflüssigkeit –, aber das sollte er erst später auf einem Balkon in Port-Grimaud herausfinden, unter Mithilfe von Marthe Taillefer. Der Lebenswille der Blumen kommt durch die Bildung von Flecken in leuchtenden Farben zum Ausdruck, die das banale Grün der natürlichen Landschaft wie auch die im Allgemeinen banale Einförmigkeit der Städte sprengen, zumindest in blumengeschmückten Gemeinden.
Abends kehrte Jeds Vater heim, er hieß »Jean-Pierre«, so nannten ihn seine Freunde. Jed nannte ihn »Papa«. Er war ein guter Vater, so wurde er zumindest von seinen Freunden und Untergebenen angesehen; ein Witwer braucht sehr viel Mut, um ein Kind allein aufzuziehen. In den ersten Jahren war Jean-Pierre ein wirklich guter Vater gewesen, jetzt war er es nicht mehr so sehr, er ließ immer öfter eine Babysitterin kommen, aß abends häufig außer Haus (meistens mit Kunden, manchmal mit seinen Untergebenen, immer seltener mit Freunden, denn die Zeit der Freundschaften ging für ihn allmählich zu Ende, er glaubte nicht mehr so recht daran, dass man Freunde haben konnte und dass eine freundschaftliche Beziehung im Leben eines Mannes wirklich zählen oder seinen Lebensweg beeinflussen kann), er kehrte abends spät heim und versuchte nicht einmal, mit der Babysitterin zu schlafen, wie es die meisten Männer taten; er hörte sich nur ihren Bericht über den Tagesverlauf an, lächelte seinem Sohn zu und zahlte den geforderten Lohn. Er war das Oberhaupt einer zerfallenen Familie und hatte nicht vor, eine neue zu gründen. Er verdiente viel Geld: Er war Chef eines Bauunternehmens und hatte sich auf die Realisierung von schlüsselfertig übergebenen Ferienwohnungen in Seebädern spezialisiert; er hatte Kunden in Portugal, auf den Malediven und in Santo Domingo.
Jed hatte aus dieser Zeit die Hefte aufbewahrt, die seine sämtlichen damaligen Zeichnungen enthielten, und all das verkam allmählich (das Papier war nicht von hoher Qualität, die Buntstifte ebenso wenig), wenn auch nicht sehr schnell, es konnte vielleicht noch zwei oder drei Jahrhunderte überstehen, Dinge und Lebewesen haben nun einmal eine begrenzte Lebensdauer.
Ein Bild, das vermutlich aus den ersten Jahren seines Jugendalters stammte, eine Gouache, trug den Titel »Heuernte in Deutschland« (das war ziemlich rätselhaft, denn Jed kannte Deutschland nicht und hatte nie eine »Heuernte« miterlebt und erst recht nicht an einer teilgenommen). Im Hintergrund waren verschneite Berge zu sehen, obwohl das Licht ganz offensichtlich an den Hochsommer denken ließ, die Bauern, die das Heu mit Heugabeln auf die Wagen luden, und die an die Fuhrwerke angeschirrten Esel waren in gleichmäßigen lebhaften Farbtönen ohne Schattierungen dargestellt – das Bild war ebenso schön wie ein Cézanne oder was auch immer. Die Frage der Schönheit ist in der Malerei zweitrangig, die großen Maler der Vergangenheit wurden als solche betrachtet, wenn sie eine sowohl kohärente als auch innovative Weltsicht entwickelt hatten; das bedeutet, dass sie immer auf die gleiche Art malten, sich stets derselben Methoden, derselben Vorgehensweisen bedienten, um Objekte der Welt in Objekte der Malkunst zu verwandeln, und dass die Art, die ihnen zu eigen war, noch nie zuvor angewandt worden war. Noch höher wurden sie als Maler geschätzt, wenn ihre Weltsicht erschöpfend zu sein schien und sich dem Anschein nach auf alle Objekte und alle existierenden oder vorstellbaren Situationen anwenden ließ. Das war die klassische Vorstellung von Malerei, mit der man Jed während seiner Ausbildung im Gymnasium vertraut gemacht hatte und die auf dem Konzept der gegenständlichen Darstellung beruhte – der gegenständlichen Darstellung, auf die Jed seltsamerweise einige Jahre später im Lauf seiner Karriere zurückgreifen sollte und die, was noch seltsamer war, ihm letztlich Reichtum und Ruhm einbringen sollte.
Jed widmete sein Leben (zumindest sein Berufsleben, das sehr bald mit seinem übrigen Leben verschmelzen sollte) der Kunst, der Produktion von Darstellungen der Welt, in denen die Menschen allerdings absolut kein bisschen zu leben brauchten. Und daher konnte er Darstellungen produzieren, die eine gewisse Kritik enthielten – zumindest bis zu einem bestimmten Grad, denn die Kunst wie auch die gesamte Gesellschaft tendierten in Jeds Jugendjahren dazu, die Welt zu akzeptieren, manchmal sogar mit Begeisterung, meistens aber mit einer gewissen Ironie. Sein Vater dagegen verfügte nicht über die Freiheit dieser Wahl; er musste Wohneinheiten produzieren, bei deren Konzeption er sich keinerlei Ironie leisten konnte, weil Menschen darin wohnen und die Möglichkeit haben sollten, sich dort wohlzufühlen, zumindest für die Dauer ihres Urlaubs. Und falls in diesen Wohnmaschinen irgendwelche ernsthaften Funktionsstörungen auftreten sollten – wenn zum Beispiel ein Fahrstuhl abstürzte oder die Toiletten verstopft waren –, war er dafür verantwortlich. Keinerlei Verantwortung trug er dagegen für den Fall, dass der Ferienwohnungskomplex von einer rohen, gewalttätigen Bevölkerungsgruppe überfallen wurde, welche die Polizei oder die zuständigen Behörden nicht unter Kontrolle zu halten imstande waren; im Fall eines Erdbebens konnte er nur in begrenztem Maß zur Verantwortung gezogen werden.
Der Vater seines Vaters war Fotograf gewesen – seine Abstammung verlor sich in einem ziemlich unappetitlichen, seit vordenklichen Zeiten stagnierenden Sozialsumpf, der im Wesentlichen aus Landarbeitern und armen Bauern bestanden hatte. Was hatte bloß diesen aus armseligen Verhältnissen stammenden Mann dazu veranlassen können, sich mit den gerade im Entstehen begriffenen Techniken der Fotografie auseinanderzusetzen? Jed hatte nicht die geringste Ahnung, sein Vater ebenso wenig. Und doch war er der Erste in einer langen Ahnenfolge gewesen, der das Joch der simplen gesellschaftlichen Reproduktion des Immergleichen abgeschüttelt hatte. Er hatte sich sein Brot damit verdient, zumeist Hochzeiten, manchmal eine Erstkommunion oder das Abschlussfest zum Ende des Schuljahres in einer Dorfschule zu fotografieren. Da er in der Creuse lebte, einem seit jeher stiefmütterlich behandelten, weitab vom Schuss liegenden Departement, hatte er so gut wie nie die Gelegenheit gehabt, die Einweihung von Gebäuden oder den Besuch von Politikern nationaler Bedeutung zu fotografieren. Er übte einen bescheidenen, schlecht bezahlten Handwerksberuf aus, und dass sein Sohn den Architektenberuf ergriff, war als solches schon ein echter sozialer Aufstieg – ganz zu schweigen von seinem späteren Erfolg als Unternehmer.
Als Jed sein Kunststudium an der Pariser École des Beaux-Arts begann, hatte er das Zeichnen bereits zugunsten der Fotografie aufgegeben. Zwei Jahre zuvor hatte er im Haus seines Großvaters eine Fachkamera auf dem Dachboden gefunden – eine Linhof Master Technika Classic –, die dieser zum Zeitpunkt, da er in den Ruhestand gegangen war, schon nicht mehr benutzt hatte, die aber noch perfekt funktionierte. Jed war damals von diesem vorsintflutlichen Objekt fasziniert gewesen, das schwer und seltsam war, aber von außergewöhnlicher Qualität, was die Fertigung betraf. Nach ein paar tastenden Versuchen hatte er schließlich gelernt, wie man mit Hilfe von exzentrischer Verstellung und dem gegeneinander Verkippen von Film- oder Objektivebene nach der scheimpflugschen Regel gut fokussierte Fotos erhielt, ehe er sich einem Bereich zuwandte, der ihn während seines ganzen Studiums nahezu ausschließlich beschäftigen sollte: die systematische fotografische Wiedergabe der gewerblichen und industriellen Erzeugnisse der Welt. Er machte die Aufnahmen in seinem Zimmer, meistens bei natürlicher Beleuchtung. Aktenhefter in Hängevorrichtungen, Faustwaffen, Terminkalender, Druckerpatronen, Gabeln: Nichts entzog sich seinem enzyklopädischen Ehrgeiz, der darin bestand, einen erschöpfenden Katalog der Gegenstände menschlicher Fertigung im industriellen Zeitalter zu erstellen.
Dieses grandiose und zugleich manische, um nicht zu sagen etwas verrückte Projekt brachte ihm zwar die Anerkennung seiner Hochschullehrer ein, erlaubte ihm aber nicht, sich einer der Gruppen anzuschließen, die sich in seinem Umfeld auf der Grundlage gemeinsamer ästhetischer Ambitionen oder mit der eher prosaischen Absicht bildeten, sich als geschlossene Gruppe auf dem Kunstmarkt zu etablieren. Dennoch schloss er einige, wenngleich nicht sehr intensive Freundschaften, ohne zu ahnen, von welch kurzer Dauer diese sein würden. Auch Liebesbeziehungen ging er ein, von denen ebenfalls so gut wie keine länger anhalten sollte. An dem Tag nachdem er sein Diplom erhalten hatte wurde ihm bewusst, dass er fortan ziemlich allein sein würde. Das Resultat seiner Arbeit der vergangenen sechs Jahre bestand aus etwas mehr als elftausend Fotos. Im TIFF-Format gespeichert, ließen sie sich als Kopien in Form von JPEG-Dateien mit herabgesetzter Auflösung mühelos auf einer etwas über 200 Gramm wiegenden 640-Gigabyte-Festplatte der Marke Western Digital unterbringen. Er verstaute sorgsam seine Fachkamera und seine Objektive (er verfügte über ein Rodenstock Apo-Sironar 105 mm, f/5,6 und ein Fujinon 180 mm, f/5,6) und betrachtete dann seine restliche Habe. Er besaß einen Laptop, einen iPod, ein paar Kleidungsstücke und einige Bücher: also im Grunde nicht sehr viel, all das würde leicht in zwei Koffer passen. Das Wetter in Paris war schön. Er war in diesem Zimmer nicht unglücklich, aber auch nicht sonderlich glücklich gewesen. Sein Mietvertrag lief in einer Woche aus. Er überlegte, nach draußen zu gehen, um noch einen letzten Spaziergang durch sein Viertel zu machen, zum Beispiel an den Ufern des Arsenal-Beckens – dann rief er seinen Vater an, um ihn zu bitten, ihm beim Umzug zu helfen.
Ihr Zusammenleben in dem Haus in Le Raincy – zum ersten Mal seit sehr langer Zeit, tatsächlich zum ersten Mal seit Jeds Kindheit, von ein paar Schulferien abgesehen – entpuppte sich sofort als unkompliziert und zugleich ziemlich unausgefüllt. Sein Vater arbeitete damals noch sehr viel, er war weit davon entfernt, die Leitung seines Unternehmens abzugeben, und kehrte abends selten vor einundzwanzig, wenn nicht gar zweiundzwanzig Uhr heim. Dann ließ er sich vor dem Fernseher in einen Sessel sinken, während Jed eines der Fertiggerichte aufwärmte, die er ein paar Wochen zuvor im riesigen Carrefour-Supermarkt in Aulnay-sous-Bois gekauft und in den Kofferraum des Mercedes gepackt hatte; er bemühte sich, die Gerichte zu variieren, um ein gewisses Ernährungsgleichgewicht zu erzielen, er hatte auch Käse und Obst eingekauft. Sein Vater schenkte dem Essen ohnehin kaum Aufmerksamkeit, er zappte schlaff durch die Kanäle und sah sich schließlich meistens auf dem Kabelsender LCI eine der ermüdenden Debatten über Wirtschaftsprobleme an. Nach dem Abendessen ging er beinahe augenblicklich ins Bett, morgens war er fort, ehe Jed aufgestanden war. Das Wetter war sonnig und fast jeden Tag gleichmäßig warm. Jed ging unter den Bäumen des Parks spazieren, setzte sich mit einem Philosophiebuch in der Hand, das er im Allgemeinen nicht aufschlug, unter eine hohe Linde. Kindheitserinnerungen kamen ihm in den Sinn, aber nicht sehr viele; dann ging er wieder ins Haus, um sich die Tour de France im Fernsehen anzusehen. Er hatte eine Vorliebe für die endlosen, langweiligen Aufnahmen aus dem Hubschrauber, die das Peleton zeigen, das sich scheinbar träge durch die französische Provinzlandschaft bewegt.
Jeds Mutter Anne entstammte einer kleinbürgerlichen jüdischen Familie – ihr Vater hatte ein kleines Juweliergeschäft in einem abgelegenen Pariser Stadtviertel besessen. Mit fünfundzwanzig hatte sie Jean-Pierre Martin geheiratet, der damals ein junger Architekt gewesen war. Es war eine Liebesheirat gewesen, und einige Jahre später hatten sie einen Sohn gezeugt, der in Gedenken an ihren geliebten Onkel den Vornamen Jed bekam. Ein paar Tage vor dem siebten Geburtstag ihres Sohnes nahm sie sich das Leben – Jed erfuhr das erst viele Jahre später durch eine Indiskretion seiner Großmutter väterlicherseits. Seine Mutter war damals vierzig Jahre alt gewesen, ihr Mann siebenundvierzig.
Jed hatte fast keine Erinnerungen mehr an seine Mutter, und ihr Selbstmord war kein Thema, das er im Verlauf seines Aufenthalts in der Villa in Le Raincy anschneiden konnte; er wusste, dass er zu warten hatte, bis sein Vater von sich aus darüber sprach – und wusste zugleich, dass es vermutlich nie dazu kommen und sein Vater dieses Thema, so wie alle anderen Themen, bis zum Schluss meiden würde.
Ein Punkt musste jedoch geklärt werden, und das besorgte schließlich sein Vater an einem Sonntagnachmittag, nachdem sie sich gemeinsam eine kurze Etappe – das Zeitfahren von Bordeaux – angesehen hatten, die zu keiner wesentlichen Änderung in der allgemeinen Platzierung geführt hatte. Sie saßen im Bibliothekszimmer – dem mit Abstand schönsten Raum der Villa, der mit Eichenparkett und englischen Ledermöbeln ausgestattet war und in dem aufgrund seiner bunten Glasfenster immer ein leichtes Halbdunkel herrschte; in den Regalen an allen vier Wänden standen beinahe sechstausend Bücher, hauptsächlich im neunzehnten Jahrhundert veröffentlichte wissenschaftliche Abhandlungen. Jean-Pierre Martin hatte das Haus vierzig Jahre zuvor zu einem günstigen Preis von dem damaligen Besitzer erworben, der dringend Geld brauchte. Seinerzeit war diese Gegend noch völlig sicher gewesen, es war ein gutbürgerliches Viertel mit Einfamilienhäusern und vereinzelten Villen, und er hatte gehofft, dort ein glückliches Familienleben führen zu können; das Haus bot auf jeden Fall genug Raum für eine kinderreiche Familie und hätte es erlaubt, häufig Freunde zu empfangen, aber nichts von alledem war letztlich eingetreten.
In dem Augenblick, da auf dem Bildschirm wieder Michel Druckers Gesicht mit dem unvermeidlichen Lächeln zu sehen war, schaltete sein Vater den Ton ab und wandte sich seinem Sohn zu. »Hast du vor, eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen?«, fragte er ihn. Jed bejahte. »Aber momentan verdienst du noch nicht genug, um deinen Lebensunterhalt zu sichern, sehe ich das richtig?« Jed gab ihm eine differenzierte Antwort. Zu seiner eigenen Überraschung war er im Verlauf des vergangenen Jahres von zwei Fotoagenturen angerufen worden. Die erste war auf Objektfotografie spezialisiert und hatte Kunden wie Quelle und La Redoute, für deren Kataloge sie die Fotos realisierte; manchmal verkauften sie ihre Aufnahmen auch an Werbeagenturen. Die zweite hatte sich auf die Gastronomiefotografie spezialisiert, Zeitschriften wie Notre Temps oder Femme Actuelle nahmen regelmäßig ihre Dienste in Anspruch. Diese Zweige genossen kein hohes Ansehen und zahlten nicht sonderlich gut: Ein Mountainbike oder einen Kartoffelauflauf zu fotografieren brachte sehr viel weniger ein als ein entsprechendes Foto von Kate Moss oder sogar George Clooney, aber die Nachfrage war beständig, unterlag keinen Konjunkturschwankungen und konnte ein annehmbares Einkommen garantieren: Jed war daher, wenn er sich die Mühe machte, nicht ganz mittellos; außerdem fand er es wünschenswert, sich weiterhin als Fotograf praktisch zu betätigen, wenn auch nur im Rahmen reiner Fotografie. Er begnügte sich damit, perfekt belichtete, gestochen scharfe Aufnahmen auf Planfilm abzuliefern, die die Agentur scannte und nach Belieben modifizierte. Er zog es vor, sich nicht mit dem Retuschieren der Fotos abzugeben, weil das vermutlich diversen kommerziellen Zwängen und Werbungskriterien unterlag, und begnügte sich damit, technisch perfekte, ansonsten aber neutrale Negative abzuliefern.
»Es freut mich, dass du finanziell unabhängig bist«, erwiderte sein Vater. »Ich habe in meinem Leben einige Typen kennengelernt, die Künstler werden wollten und von ihren Eltern finanziell unterstützt wurden – keiner von ihnen hat den Durchbruch geschafft. Es ist seltsam, man möchte meinen, dass das Bedürfnis, sich auszudrücken und eine Spur in der Welt zu hinterlassen, eine starke Kraft sein müsse; dennoch reicht das im Allgemeinen nicht aus. Was noch immer am besten funktioniert und die Menschen mit Macht dazu drängt, über sich hinauszuwachsen, ist und bleibt ganz einfach das Bedürfnis nach Geld.
Ich werde dir trotzdem helfen, eine Wohnung in Paris zu kaufen«, fuhr er fort. »Es ist gewiss notwendig für dich, dass du wieder unter Leute kommst und Kontakte knüpfst. Außerdem kann man das als Geldanlage ansehen, auf dem Markt herrscht gerade eine ziemliche Flaute.«
Auf dem Bildschirm war inzwischen ein Komiker zu sehen, den Jed wiederzuerkennen glaubte. Dann erschien die Großaufnahme eines selig lachenden Michel Drucker. Jed sagte sich plötzlich, dass sein Vater vielleicht ganz einfach Lust hatte, allein zu leben; der Kontakt zwischen ihnen war nie richtig wiederhergestellt worden.
Zwei Wochen später kaufte Jed das Atelier am Boulevard de l’Hôpital im nördlichen Teil des 13. Arrondissements, in dem er immer noch wohnte. Die meisten Straßen in der Nähe waren nach Malern benannt – Rubens, Watteau, Veronese, Philippe de Champaigne –, was sich zur Not als gutes Vorzeichen interpretieren ließ. Nüchterner betrachtet, war er nicht weit von den neuen Kunstgalerien entfernt, die in dem Viertel rings um die Nationalbibliothek eröffnet worden waren. Er hatte über den Kaufpreis nicht wirklich verhandelt, sich aber trotzdem über die Marktlage informiert; überall in Frankreich brachen die Preise zusammen, vor allem in den Städten, und trotzdem standen die Wohnungen leer und fanden keine Abnehmer.
II
JED HATTE ZWAR SO GUT WIE keine visuellen Erinnerungen an seine Mutter, aber er hatte natürlich Fotos von ihr gesehen. Sie war eine hübsche Frau mit blasser Gesichtsfarbe und langem schwarzem Haar gewesen, und auf manchen Aufnahmen konnte man sie durchaus als schön bezeichnen – sie ähnelte ein bisschen dem Porträt von Agathe von Astighwelt, das im Museum von Dijon hängt. Sie lächelte nur selten auf diesen Bildern, und selbst ihr Lächeln schien noch eine gewisse Beklemmung zu überdecken. Sicher wurde man von der Tatsache beeinflusst, dass sie sich das Leben genommen hatte, aber selbst wenn man versuchte, sich von diesem Gedanken zu befreien, ging etwas Unwirkliches oder zumindest Zeitloses von ihr aus. Man konnte sie sich leicht auf einem Gemälde des Mittelalters oder der frühen Renaissance vorstellen; dagegen schien es unwahrscheinlich, dass sie in den sechziger Jahren ein Teenager gewesen sein könne, ein Transistorradio besessen habe oder zu Rockkonzerten gegangen sei.
In den ersten Jahren nach ihrem Tod hatte Jeds Vater sich bemüht, die Schularbeiten seines Sohnes zu beaufsichtigen, außerdem unternahmen sie an den Wochenenden immer etwas gemeinsam, gingen zu McDonald’s oder ins Museum. Doch dann weitete sich das Betätigungsfeld seiner Firma fast unvermeidlich immer mehr aus; sein erster Vertrag im Bereich der Realisierung schlüsselfertig übergebener Ferienwohnungen in Seebädern war ein glänzender Erfolg gewesen. Nicht nur die Termine und die anfänglich vereinbarten Kostenvoranschläge wurden eingehalten – was an sich schon eher selten war –, sondern die Verwirklichung der Bauten wurde für ihre Ausgewogenheit und die umweltfreundliche Konzeption einhellig gelobt – in der Regionalpresse und in den französischen Fachzeitschriften für Architektur waren überschwängliche Artikel veröffentlicht worden, und die Beilage »Styles« der Tageszeitung Libération hatte dem Projekt eine ganze Seite gewidmet. In Port-Ambarès, war da zu lesen, habe er es verstanden, sich der »Quintessenz der mediterranen Bauweise« anzunähern. Dabei hatte er seiner Ansicht nach lediglich in einheitlich mattem Weiß gehaltene Betonwürfel unterschiedlicher Größe aneinandergereiht, die nach dem Prinzip der traditionellen marokkanischen Häuser konzipiert waren, und diese durch Gruppen von Oleandersträuchern voneinander getrennt. Jedenfalls bekam er nach diesem ersten Erfolg eine Flut von Aufträgen und musste immer öfter Auslandsreisen machen. Als Jed in die siebte Klasse kam, beschloss sein Vater, ihn ins Internat zu schicken.
Er entschied sich für das Jesuitenkolleg in Rumilly im Departement Oise. Es war zwar ein Privatgymnasium, aber keines von denen, die einer Elite vorbehalten waren; im Übrigen hielt sich die Höhe des Schulgelds durchaus in Grenzen, der Unterricht war nicht zweisprachig und das Sportangebot in keiner Weise extravagant. Die Schüler des Kollegs von Rumilly waren keine Sprösse steinreicher Eltern, sondern stammten eher aus konservativen Kreisen der ehemaligen Bourgeoisie (viele der Väter waren Berufsoffiziere oder Diplomaten), waren jedoch keine fundamentalistischen Katholiken – meistens waren die Kinder nach einer langen, komplizierten Scheidung ins Internat geschickt worden.
Die Gebäude waren nüchtern und eher hässlich, boten aber akzeptable Wohnbedingungen – die Schüler der unteren Stufen waren in Doppelzimmern untergebracht, hatten aber Anrecht auf ein Einzelzimmer, sobald sie in die zehnte Klasse kamen. Die Stärke des Kollegs, das Hauptargument, welches das Internat geltend machte, war die pädagogische Betreuung, die jedem einzelnen Schüler zugute kam – und tatsächlich hatte die Erfolgsquote beim Abitur seit der Gründung der Schule immer über 95 Prozent gelegen.
Innerhalb dieser Mauern sollte Jed seine Jugendjahre verbringen, die im Wesentlichen arbeitsam und trübselig verliefen. Bisweilen unternahm er auch lange Spaziergänge unter dem äußerst finsteren Nadeldach der von Tannen gesäumten Parkwege. Er beklagte sich nicht über sein Schicksal und stellte sich kein anderes vor. Die Raufereien unter den Schülern waren manchmal sehr gewaltsam, die Erniedrigungen, die sie sich gegenseitig zufügten, brutal und quälerisch, und Jed, der empfindsam und schmächtig war, wäre nie imstande gewesen, sich zu verteidigen; aber es hatte sich herumgesprochen, dass er einen Elternteil verloren hatte, und zwar die Mutter. Dieser Schmerz, den seine Mitschüler nicht kannten, schüchterte sie ein, und daher war Jed gleichsam von einem Schutzwall furchtsamer Achtung umgeben. Er hatte keinen engen Freund und suchte nicht die Freundschaft anderer. Dagegen verbrachte er ganze Nachmittage in der Bibliothek, und als er mit achtzehn das Abitur machte, besaß er ein für die jungen Leuten seiner Generation ungewöhnlich umfangreiches Wissen über den Schatz der Weltliteratur. Er hatte Platon, Aischylos und Sophokles gelesen; er hatte Racine, Molière und Victor Hugo gelesen; er kannte Balzac, Dickens, Flaubert, die deutschen Romantiker und die russischen Romanschriftsteller. Und er war, noch erstaunlicher, mit den grundlegenden Dogmen des katholischen Glaubens vertraut, welche die westliche Kultur zutiefst geprägt hatten – während seine Zeitgenossen im Allgemeinen weniger über das Leben Jesu wussten als über das von Spiderman.
Dieser Eindruck von etwas altmodischem Ernst, den er vermittelte, sollte die Hochschullehrer, die seine Bewerbungsunterlagen für die École des Beaux-Arts zu begutachten hatten, positiv beeinflussen; offenbar hatten sie es mit einem originellen, kultivierten, ernsthaften und vermutlich arbeitsamen Kandidaten zu tun. Das Dossier, das er vorlegte, trug den Titel »Dreihundert Fotos von Objekten aus dem Eisenwarenhandel« und zeugte von erstaunlicher ästhetischer Reife. Jed hatte es vermieden, den Glanz der Metallgegenstände und den bedrohlichen Charakter ihrer Formen hervorzuheben, stattdessen hatte er eine neutrale, nicht sehr kontrastreiche Beleuchtung gewählt und die Artikel des Eisenwarenhandels auf einem Hintergrund von mittelgrauem Samt fotografiert. Schrauben, Muttern und Rollgabelschlüssel wirkten so geradezu wie Juwelen mit diskretem Schimmer.
Dagegen hatte er große Mühe gehabt (und diese Schwierigkeit sollte ihn sein ganzes Leben begleiten), eine schriftliche Präsentation seiner Fotos zu verfassen. Nach diversen Versuchen, die Wahl seines Themas zu rechtfertigen, nahm er schließlich zu einer Darstellung reiner Fakten Zuflucht und begnügte sich damit zu unterstreichen, dass die einfachsten, aus Stahl hergestellten Gegenstände aus dem Eisenwarenhandel bereits eine Fertigungspräzision von 1 /10 Millimeter besaßen. Die für einen hochwertigen Fotoapparat oder einen Formel-1-Motor erforderlichen Bauteile fielen schon fast in den Bereich der Präzisionsmechanik; sie wurden im Allgemeinen aus Aluminium oder einer Leichtmetalllegierung gefertigt, und ihr Präzisionsgrad wurde in 1 /100 Millimetern bemessen. Die Hochpräzisionsmechanik schließlich, die zum Beispiel in der Uhrenindustrie oder in der Zahnchirurgie zur Anwendung kam, griff auf Titan zurück, die Toleranzgrenze der Werkstücke wurde in diesem Fall in Mikrometer-Einheiten gemessen. Zusammenfassend ließ sich, wie Jed die Argumentation etwas abrupt und verkürzend auf den Punkt brachte, bis zu einem gewissen Grad eine Parallele zwischen der Geschichte der Menschheit und der Geschichte der Metallverarbeitung herstellen – das erst seit kurzem angebrochene Zeitalter der Polymere und Plastikerzeugnisse war ihm zufolge noch zu jung, um eine wirkliche geistige Veränderung herbeizuführen.
Kunsthistoriker, die gewandter im Umgang mit der Sprache waren, merkten später an, dass schon dieses erste von Jed realisierte Projekt wie alle seine späteren Projekte – unabhängig von den Medien, die er verwendet hatte – in gewisser Weise eine Würdigung der menschlichen Arbeit darstellte.
Und so begann Jed seine Künstlerlaufbahn mit dem ausschließlichen Ziel – dessen illusorischer Charakter ihm nur selten bewusst wurde –, eine objektive Beschreibung der Welt zu liefern. Trotz seiner klassischen Bildung war er – im Gegensatz zu dem, was später oft über ihn geschrieben wurde – keineswegs von religiöser Ehrfurcht vor den alten Meistern beseelt; schon zu jener Zeit zog er Mondrian und Klee bei weitem Rembrandt und Velasquez vor.
In den ersten Monaten nach seinem Umzug ins 13. Arrondissement verbrachte er die meiste Zeit mit Nichtstun, außer wenn er sich den durchaus zahlreich eintreffenden Aufträgen für Objektfotografie widmete. Doch eines Tages, als er eine Festplatte von Western Digital auspackte, die ihm gerade von einem Kurierdienst gebracht worden war und von der er für den folgenden Tag Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln abliefern sollte, wurde ihm klar, dass er mit der Objektfotografie Schluss machen würde – zumindest auf dem Gebiet der Kunst. Es war, als habe die Tatsache, dass er diese Objekte inzwischen zu rein beruflichen, kommerziellen Zwecken fotografierte, für ihn jede Möglichkeit zunichte gemacht, sie im Rahmen eines schöpferischen Projekts zu verwenden.
Diese Gewissheit, die sich ihm ebenso plötzlich wie unerwartet aufdrängte, löste bei ihm eine milde Depression aus, in deren Verlauf seine tägliche Abwechslung im Wesentlichen darin bestand, sich Fragen an den Champion anzusehen, eine Sendung, die Julien Lepers moderierte. Durch seine Hartnäckigkeit und seine unglaubliche Arbeitswut war dieser anfangs ziemlich unbegabte, ein wenig dümmliche Fernsehmoderator mit den Gesichtszügen und der Gefräßigkeit eines Schafbocks, der zunächst eigentlich als Schlagersänger hatte Karriere machen wollen und vermutlich insgeheim immer noch von einer gewissen Sehnsucht danach erfüllt war, nach und nach zu einer der populärsten Gestalten der französischen Medienlandschaft geworden. Die Leute erkannten sich in ihm wieder, Studenten aus dem ersten Studienjahr der École Polytechnique wie auch pensionierte Grundschullehrerinnen aus dem Departement Pas-de-Calais, Motorradfahrer aus dem Landstrich Limousin wie auch Gastwirte aus dem Departement Var; er war weder beeindruckend noch distanziert, sondern vermittelte ein mittelmäßiges, fast sympathisches Bild, das genau in das Frankreich der Jahre um 2010 passte. Jed, der eigentlich ein Fan von Jean-Pierre Foucault war, seine Menschlichkeit und seine pfiffige Ungezwungenheit schätzte, musste dennoch zugeben, dass Julien Lepers ihn immer öfter faszinierte.
Anfang Oktober erhielt Jed einen Anruf von seinem Vater, der ihm mitteilte, dass Jeds Großmutter gestorben war. Er sprach mit langsamer Stimme und wirkte ein wenig niedergedrückt, aber kaum stärker als gewöhnlich. Jeds Großmutter hatte sich, wie er wusste, nie vom Tod ihres Mannes erholt, den sie zutiefst geliebt hatte, ja sogar mit einer Leidenschaft, die in ihrem ärmlichen, ländlichen Milieu, das sich im Allgemeinen nicht durch romantische Ergüsse auszeichnete, überraschend war. Nach seinem Tod hatte nichts und niemand, nicht einmal ihr Enkel, sie aus einer Spirale der Trauer herausreißen können, die sie nach und nach auf jede Tätigkeit verzichten ließ, von der Kaninchenzucht bis hin zum Einkochen von Marmelade; schließlich hatte sie sogar die Gartenarbeit aufgegeben.
Jeds Vater müsse schon am folgenden Tag in die Creuse fahren, um an der Beerdigung teilzunehmen und sich anschließend um das Haus und die Erbschaftsangelegenheiten zu kümmern; er sähe es gern, wenn sein Sohn ihn begleiten könne. Ehrlich gesagt wäre es ihm sogar lieb, wenn dieser etwas länger dort bleiben und sich um alle Formalitäten kümmern könne, denn er habe im Moment sehr viel Arbeit in der Firma. Jed sagte sofort zu.