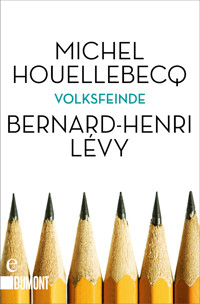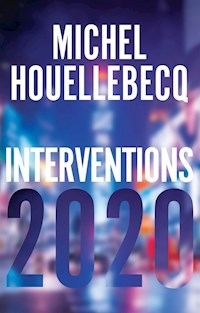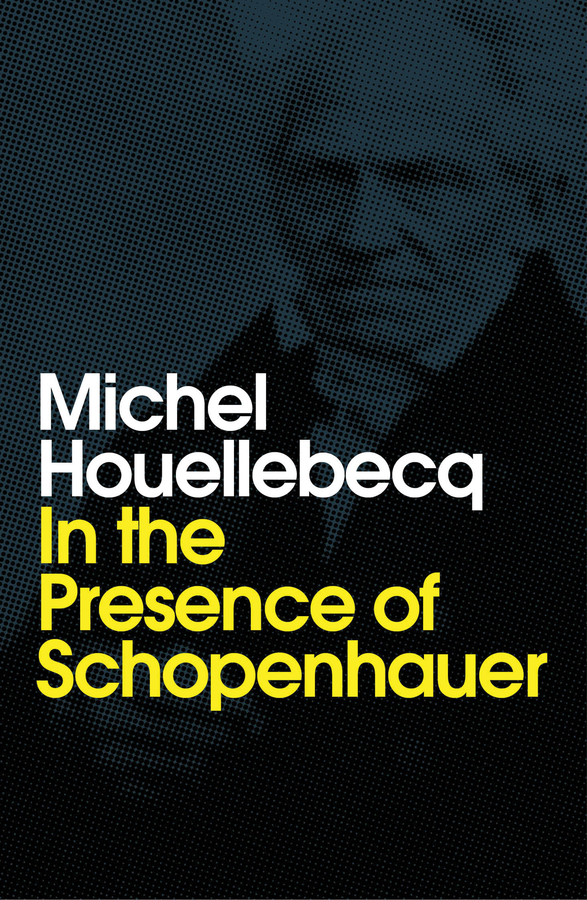9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der 46-jährige Protagonist von SEROTONIN, dem neuen Roman des Goncourt-Preisträgers Michel Houellebecq, Bilanz zieht, beschließt er, sich aus seinem Leben zu verabschieden – eine Entscheidung, an der auch das revolutionäre neue Antidepressivum Captorix nichts zu ändern vermag, das ihn in erster Linie seine Libido kostet. Alles löst er auf: Beziehung, Arbeitsverhältnis, Wohnung. Wann hat diese Gegenwart begonnen? In der Erinnerung an die Frauen seines Lebens und im Zusammentreffen mit einem alten Studienfreund, der als Landwirt in einem globalisierten Frankreich ums Überleben kämpft, erkennt er, wann und wo er sich selbst und andere verraten hat. Noch nie hat Michel Houellebecq so ernsthaft und voller Emotion über die Liebe geschrieben. Zugleich schildert er in SEROTONIN den Kampf und den drohenden Untergang eines klassischen Wirtschaftszweigs in unserer Zeit der Weltmärkte und der gesichtslosen EU-Bürokratie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Als der 46-jährige Protagonist von SEROTONIN, dem neuen Roman des Goncourt-Preisträgers Michel Houellebecq, Bilanz zieht, beschließt er, sich aus seinem Leben zu verabschieden – eine Entscheidung, an der auch das revolutionäre neue Antidepressivum Captorix nichts zu ändern vermag, das ihn in erster Linie seine Libido kostet. Alles löst er auf: Beziehung, Arbeitsverhältnis, Wohnung. Wann hat diese Gegenwart begonnen? In der Erinnerung an die Frauen seines Lebens und im Zusammentreffen mit einem alten Studienfreund, der als Landwirt in einem globalisierten Frankreich ums Überleben kämpft, erkennt er, wann und wo er sich selbst und andere verraten hat.
Noch nie hat Michel Houellebecq so ernsthaft und voller Emotion über die Liebe geschrieben. Zugleich schildert er in SEROTONIN den Kampf und den drohenden Untergang eines klassischen Wirtschaftszweigs in unserer Zeit der Weltmärkte und der gesichtslosen EU-Bürokratie.
© Philippe Matsas, Flammarion
MICHEL HOUELLEBECQ wurde 1958 geboren. Er gehört zu den wichtigsten Autoren der Gegenwart, seine Bücher werden in über vierzig Ländern veröffentlicht. Für den Roman KARTE UND GEBIET (2011) erhielt er den renommierten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt. Sein Roman UNTERWERFUNG (2015) stand wochenlang auf den Bestsellerlisten und wurde mit großem Erfolg für die Theaterbühne adaptiert und verfilmt. Zuletzt erschien IN SCHOPENHAUERS GEGENWART (2017).
STEPHAN KLEINER, geboren 1975, lebt als literarischer Übersetzer in München. Er übertrug u.a. Geoff Dyer, Chad Harbach, Tao Lin und Hanya Yanagihara ins Deutsche.
MICHEL HOUELLEBECQ
SEROTONIN
ROMAN
Aus dem Französischen
Die französische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel ›Sérotonine‹ bei Flammarion, Paris. © Michel Houellebecq and Flammarion, Paris 2019
eBook 2020 © 2019 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Übersetzung: Stephan Kleiner Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagmotiv: © plainpicture/Lohfink
Satz: Angelika Kudella, Köln eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck ISBN eBook 978-3-8321-8442-1
www.dumont-buchverlag.de
ES IST EINE KLEINE WEISSE, ovale, teilbare Tablette.
Gegen fünf Uhr morgens, manchmal auch gegen sechs wache ich auf, das Bedürfnis ist dann am größten, es ist der schmerzvollste Moment des Tages. Mit meinem ersten Handgriff schalte ich die elektrische Kaffeemaschine ein; am Vortag habe ich den Tank mit Wasser und den Filter mit gemahlenem Kaffee gefüllt (meist Malongo, beim Kaffee bin ich noch einigermaßen anspruchsvoll). Die Zigarette zünde ich mir nicht vor dem ersten Schluck an; das ist eine selbstauferlegte Beschränkung, ein täglicher Erfolg, der mich stolz macht wie nur noch wenige andere Dinge (wobei ich zugeben muss, dass elektrische Kaffeemaschinen ziemlich schnell arbeiten). Die Erleichterung, die mir der erste Zug verschafft, setzt augenblicklich und mit erstaunlicher Kraft ein. Nikotin ist eine perfekte Droge, eine simple und harte Droge, die keinerlei Freude auslöst, die ganz vom Mangel und dem Abstellen des Mangels bestimmt ist.
Ein paar Minuten später, nach zwei oder drei Zigaretten, schlucke ich eine Captorix-Tablette mit einem Viertelglas Mineralwasser – meist Volvic.
Ich bin sechsundvierzig Jahre alt, ich heiße Florent-Claude Labrouste, und ich hasse meinen Vornamen. Ich glaube, er geht auf zwei Familienmitglieder zurück, die mein Vater und meine Mutter jeweils ehren wollten; das ist umso bedauerlicher, als ich meinen Eltern darüber hinaus nichts vorzuwerfen habe, sie waren in jeder Hinsicht ausgezeichnete Eltern und haben ihr Bestes getan, mich mit den notwendigen Waffen für den Lebenskampf zu rüsten, und wenn ich letztlich versagt habe, wenn mein Leben in Trauer und Leiden endet, dann kann ich nicht sie dafür verantwortlich machen, sondern nur eine Verkettung von Umständen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde – ja die sogar den eigentlichen Gegenstand dieses Buches darstellen –, jedenfalls habe ich meinen Eltern nichts vorzuwerfen außer dieser geringfügigen, dieser ärgerlichen, aber geringfügigen Namensgeschichte; nicht nur finde ich die Verbindung Florent-Claude lächerlich, sondern beide Teile für sich missfallen mir, und in der Gesamtheit finde ich meinen Vornamen völlig missraten. Florent ist zu lieblich, zu nah an dem weiblichen Florence und in gewissem Sinne geradezu androgyn. Der Name passt überhaupt nicht zu meinen markanten, je nach Blickwinkel sogar groben Gesichtszügen, die schon häufig (zumindest von gewissen Frauen) als besonders männlich betrachtet wurden, aber gar nicht, wirklich gar nicht als das Gesicht einer botticellihaften Schwuchtel. Von Claude gar nicht zu reden, der lässt mich sofort an die Claudettes denken, und sobald ich den Vornamen Claude auszusprechen versuche, kommt mir direkt wieder das entsetzliche Bild aus einem alten Video von Claude François in den Sinn, das auf irgendeiner Soirée alter Homos in Endlosschleife lief.
Seinen Vornamen zu ändern, ist nicht schwierig, wobei ich das nicht aus behördlicher Sicht meine, aus behördlicher Sicht ist so gut wie gar nichts möglich, das Ziel der Behörden ist eine maximale Beschränkung der Lebensmöglichkeiten, sofern es ihnen nicht gelingt, sie schlicht ganz zu vernichten, aus behördlicher Sicht ist ein guter Staatsbürger ein toter Staatsbürger, ich rede ganz einfach von der praktischen Anwendung: Es genügt, sich unter einem neuen Vornamen vorzustellen, und nach ein paar Monaten oder sogar Wochen haben sich alle daran gewöhnt, es kommt den Leuten gar nicht mehr in den Sinn, dass man einmal anders geheißen haben könnte. In meinem Fall wäre die Sache umso einfacher gewesen, als mein zweiter Vorname, Pierre, perfekt zu dem Eindruck der Entschiedenheit und Virilität gepasst hätte, den ich der Welt hätte vermitteln wollen. Aber ich habe nichts unternommen, ich habe mich weiter bei diesem abscheulichen Vornamen Florent-Claude nennen lassen, ich habe lediglich bei gewissen Frauen (bei Camille und Kate, um genau zu sein, aber ich komme darauf zurück, ich komme darauf zurück) erreicht, dass sie sich auf Florent beschränkten, bei der Gesellschaft als Ganzer habe ich gar nichts erreicht, in dieser Hinsicht habe ich mich wie in fast jeder anderen Situation auch zum Spielball der Umstände machen lassen, ich habe meine Unfähigkeit bewiesen, mein Leben wieder in die Hand zu nehmen, die Virilität, die mein quadratisches Gesicht mit seinen klaren Kanten, meine scharf geschnittenen Züge auszustrahlen schienen, war nichts weiter als eine Illusion, ein reiner Schwindel – für den ich allerdings nichts konnte, Gott hatte mich so geformt, aber ich war nichts anderes, war tatsächlich nichts anderes, war nie irgendetwas anderes gewesen als ein substanzloses Weichei, und nun bin ich schon sechsundvierzig Jahre alt, ich war nie in der Lage, über mein eigenes Leben zu bestimmen, kurzum erscheint es mir sehr wahrscheinlich, dass der zweite Teil meiner Existenz ähnlich wie der erste nur in einem schlaffen und schmerzvollen Zusammensacken bestehen wird.
Die ersten bekannten Antidepressiva (Seroplex, Prozac) erhöhten den Serotoninspiegel im Blut, indem sie die Serotoninwiederaufnahme durch die 5-HT1-Rezeptoren hemmten. Die Entdeckung von Capton D-L im Jahr 2017 ebnete einer neuen Generation von Antidepressiva mit einer letztlich einfacheren Verfahrensweise den Weg, bei der es darum geht, mittels Exozytose die Freisetzung des in der Magenschleimhaut gebildeten Serotonins zu befördern. Seit Ende des Jahres wird Capton D-L unter dem Produktnamen Captorix vermarktet. Es erwies sich auf Anhieb als erstaunlich wirksam und erlaubte den Patienten, mit einer neuen Leichtigkeit an den entscheidenden Riten eines normalen Lebens innerhalb einer hochentwickelten Gesellschaft teilzuhaben (Körperpflege, ein auf gute Nachbarschaftsverhältnisse beschränktes Sozialleben, simple Behördengänge), ohne dabei im Gegensatz zu Antidepressiva der vorherigen Generation den Hang zu Selbstmord oder Selbstverstümmelung zu verstärken.
Die bei Captorix am häufigsten beobachteten unerwünschten Nebenwirkungen waren Übelkeit, Libidoverlust, Impotenz.
Unter Übelkeit habe ich nie gelitten.
DIE GESCHICHTE BEGINNT in Spanien, in der Provinz Almería, genau fünf Kilometer nördlich von El Alquián an der N-340. Es war im Sommer, wahrscheinlich Mitte Juli, gegen Ende der 2010er-Jahre – ich meine mich zu erinnern, dass Emmanuel Macron Staatspräsident war. Die Sonne schien, und es war extrem heiß, wie immer zu dieser Jahreszeit in Südspanien. Der Nachmittag war gerade angebrochen, und mein Geländewagen, ein Mercedes G 350 TD, stand auf dem Parkplatz der Repsol-Tankstelle. Ich hatte ihn gerade mit Diesel vollgetankt und trank, an die Karosse gelehnt, langsam eine Coke Zero, von einer zunehmenden Niedergeschlagenheit befallen bei dem Gedanken, dass Yuzu am nächsten Tag ankommen würde, als ein VW Käfer gegenüber der Luftdruckstation hielt.
Zwei junge Frauen um die zwanzig stiegen aus, und selbst aus der Entfernung war zu erkennen, dass sie hinreißend aussahen; ich hatte in letzter Zeit vergessen, wie hinreißend Frauen sein konnten, es versetzte mir einen Schreck wie ein übertriebener Knalleffekt im Theater. Die Luft war so heiß, dass sie leicht zu flimmern schien, ebenso wie der Asphalt des Parkplatzes, es waren genau die richtigen Bedingungen für eine Fata Morgana. Doch die Mädchen waren echt, und ich wurde von einer leichten Panik befallen, als eine der beiden auf mich zukam. Sie hatte langes, ganz leicht gewelltes kastanienbraunes Haar und trug ein schmales, mit einem farbigen Muster verziertes Lederband um die Stirn. Ein weißes Schlauchtop aus Baumwolle bedeckte notdürftig ihre Brüste, und ihr kurzer, flatternder Rock, ebenfalls aus weißer Baumwolle, schien förmlich darauf zu warten, sich beim geringsten Luftzug zu heben – wobei es keinen Luftzug gab; Gott ist gnädig und barmherzig.
Sie wirkte gelassen und fröhlich und schien überhaupt keine Angst zu haben – die Angst, sagen wir es, wie es ist, war ganz auf meiner Seite. In ihrem Blick lagen Gutmütigkeit und Glückseligkeit – ich wusste vom ersten Augenblick an, dass ihr in ihrem Leben seitens Tieren, Menschen, ja selbst Arbeitgebern nur Gutes widerfahren war. Warum kam sie, die so jung und begehrenswert war, an diesem Sommernachmittag zu mir? Ihre Freundin und sie wollten ihren Reifendruck prüfen (das heißt den Reifendruck ihres Autos, ich habe mich falsch ausgedrückt). Das ist eine in fast allen zivilisierten und sogar einigen unzivilisierten Ländern von der Verkehrswacht empfohlene Vorsichtsmaßnahme, das junge Mädchen war also nicht nur begehrenswert und gutherzig, sondern auch noch umsichtig und vernünftig. Meine Bewunderung ihr gegenüber wuchs mit jeder Sekunde. Konnte ich ihr meine Hilfe verweigern? Ganz offensichtlich nicht.
Ihre Begleiterin entsprach eher dem, was man von einer Spanierin erwartet – tiefschwarzes Haar, dunkelbraune Augen, dunkler Teint. Sie sah etwas weniger nach coolem Hippie aus, das heißt, sie wirkte auch ziemlich cool, aber weniger hippiemäßig, mit einem kleinen Einschlag ins Schlampenhafte, im linken Nasenloch trug sie einen silbernen Ring, und das Schlauchtop, das ihre Brüste bedeckte, war bunt und in einem aggressiven Schrift-Design gestaltet, überzogen mit Slogans, die man dem Punk oder dem Rock hätte zuordnen können, ich hatte den Unterschied vergessen, sagen wir der Einfachheit halber Punk-Rock-Slogans. Anders als ihre Begleiterin trug sie Shorts, und das war noch schlimmer, ich weiß nicht, warum so eng anliegende Shorts überhaupt hergestellt werden, es war unmöglich, nicht von ihrem Arsch hypnotisiert zu werden. Es war unmöglich, ich schaffte es nicht, konnte mich aber recht bald wieder auf die bestehende Situation konzentrieren. Zuerst einmal, erklärte ich, müsse man den für das entsprechende Automodell empfohlenen Reifendruck ermitteln: Er stehe normalerweise auf einer unterhalb der linken Vordertür angeschweißten kleinen Metallplakette.
Die Plakette war tatsächlich an der angegebenen Stelle zu finden, und ich fühlte ihre Achtung vor meiner männlichen Kompetenz wachsen. Ihr Auto war nicht sehr stark beladen – sie hatten sogar erstaunlich wenig Gepäck dabei, zwei leichte Taschen, die wohl ein paar Tangas und die üblichen Schönheitsprodukte enthielten – ein Druck von 2,2 bar wäre völlig ausreichend.
Blieb noch das eigentliche Befüllen der Reifen. Der Druck auf dem linken Vorderreifen, konstatierte ich sofort, lag nicht über 1,0bar. Ich wandte mich voller Ernst an sie, um nicht zu sagen mit der leichten Strenge, zu der mich mein Alter befugte. Sie hätten gut daran getan, sich an mich zu wenden, es sei allerhöchste Zeit gewesen, ohne sich dessen bewusst zu sein, hätten sie in ernsthafter Gefahr geschwebt. Zu niedriger Reifendruck könne zu mangelnder Bodenhaftung und schwammiger Lenkung führen, irgendwann würde es fast zwangsläufig zu einem Unfall kommen. Sie zeigten sich erschüttert und arglos, und die Brünette legte mir eine Hand auf den Unterarm.
Zugegebenermaßen sind diese Geräte verdammt schwer zu bedienen, man muss auf das Zischen der Vorrichtung horchen und sie dabei immer wieder neu ausrichten, bevor man die Tülle auf das Ventil aufsetzt, da ist vögeln einfacher, es ist intuitiver, ich war mir sicher, dass sie darin mit mir übereingestimmt hätten, aber ich wusste nicht, wie ich das Thema hätte anschneiden sollen, kurz gesagt, ich füllte den linken Vorderreifen und im Anschluss den linken Hinterreifen auf, sie hockten links und rechts von mir, verfolgten meine Handbewegungen mit äußerster Aufmerksamkeit, murmelten in ihrer Sprache »Chulo« und »Claro que sí«, und dann übergab ich an sie und ließ sie unter meiner väterlichen Aufsicht die übrigen Reifen übernehmen.
Die Dunkle, die, wie ich merkte, die spontanere von beiden war, machte sich gleich an den rechten Vorderreifen, und dann wurde es richtig hart, als sie sich hingekniet hatte und sich ihr perfekt gerundeter, in die hautengen Minishorts eingegossener Hintern bewegte, während sie die Tülle zu kontrollieren versuchte, ich glaube, die Brünette hatte Mitleid mit mir in meiner Verstörung, sie legte mir sogar kurz einen Arm um die Taille, einen schwesterlichen Arm.
Schließlich kam der rechte Hinterreifen an die Reihe, um den sich die Brünette kümmerte. Die erotische Spannung ließ etwas nach, wurde jedoch sanft von einer amourösen Spannung überlagert, denn wir wussten alle drei, dass es der letzte Reifen war und dass ihnen nun nichts anderes übrig blieb, als ihre Fahrt fortzusetzen.
Sie blieben trotzdem noch ein paar Minuten bei mir, verwoben Dankesbekundungen und freundliche Gesten ineinander, und sie meinten es aufrichtig, zumindest sage ich mir das jetzt, mit mehreren Jahren Abstand, während ich mir in Erinnerung rufe, dass ich irgendwann einmal ein erotisches Leben hatte. Sie erkundigten sich nach meiner Nationalität – ich bin Franzose, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt –, nach den Vergnügungsmöglichkeiten in der Gegend, vor allem wollten sie wissen, ob ich irgendwelche netten Orte kannte. Ja, gewissermaßen, es gab da eine Tapas-Bar, in der auch ein reichhaltiges Frühstück serviert wurde, genau gegenüber meiner Ferienwohnung. Ein Stück weiter gab es einen Nachtclub, den man im weitesten Sinne als »nett« bezeichnen konnte. Ich hatte meine eigenen vier Wände, ich hätte sie bei mir unterbringen können, wenigstens für eine Nacht, und das, scheint mir (aber im Rückblick mache ich mir da wohl etwas vor), hätte wirklich nett werden können. Aber ich erzählte nichts von alldem, ich begnügte mich mit einem groben Überblick und erklärte, die Gegend sei insgesamt recht angenehm (was stimmte) und ich verlebte hier eine glückliche Zeit (was nicht stimmte, und die baldige Ankunft von Yuzu würde die Sache nicht besser machen).
Schließlich verabschiedeten sie sich winkend, der Käfer drehte auf dem Parkplatz und fuhr dann auf den Zubringer zur Nationalstraße auf.
An diesem Punkt hätte Verschiedenes passieren können. Hätten wir uns in einer romantischen Komödie befunden, dann wäre ich nach ein paar Sekunden dramatischen Zögerns (hier wäre die Kunst des Schauspielers gefragt gewesen, ich denke, Kev Adams hätte es gut hinbekommen) hinters Steuer meines Mercedes-Geländewagens gesprungen, hätte den Käfer auf der Autobahn rasch eingeholt und wäre mit wilden, leicht dümmlich wirkenden Gesten (wie in romantischen Komödien üblich) an ihm vorbeigezogen, sie hätte auf dem Standstreifen angehalten (in einer klassischen romantischen Komödie wäre es wohl nur ein Mädchen gewesen, höchstwahrscheinlich die Brünette), und inmitten der Abgase der mit wenigen Metern Abstand vorbeifahrenden Lkw hätten sich anrührende menschliche Handlungen vollzogen. Der Dialogautor hätte gut daran getan, sich mit dem Text für diese Szene richtig Mühe zu geben.
Hätten wir uns in einem Pornofilm befunden, wäre die weitere Handlung noch vorhersehbarer, der Dialog aber weniger wichtig gewesen. Alle Männer sehnen sich nach unverbrauchten, umweltbewussten, einem Dreier gegenüber aufgeschlossenen Mädchen – oder zumindest fast alle Männer, ich in jedem Fall.
Wir befanden uns in der Realität, und darum fuhr ich nach Hause. Ich wurde von einer Erektion befallen, was angesichts des Verlaufs, den der Nachmittag genommen hatte, nicht überraschend war. Ich rückte ihr mit den üblichen Mitteln zu Leibe.
DIESE JUNGEN MÄDCHEN, und ganz besonders die Brünette, hätten meinem Aufenthalt in Spanien einen Sinn geben können, und das enttäuschende und banale Ende meines Nachmittags verdeutlichte nur auf grausame Weise, was offensichtlich war: Ich hatte nicht den geringsten Grund, hier zu sein. Ich hatte diese Wohnung mit Camille und für Camille gekauft. Das war in der Zeit gewesen, da wir uns als Paar gemeinsame Projekte überlegt hatten, wie die Schaffung eines familiären Ankerplatzes, den Kauf einer romantischen Mühle in der Creuse oder was weiß ich, das Zeugen von Kindern war vielleicht das Einzige, was wir nicht in Erwägung zogen – und selbst das war eine knappe Sache. Es war mein erster Immobilienkauf, und es ist übrigens auch bei diesem einen geblieben.
Der Ort hatte ihr auf Anhieb gefallen. Es war eine kleine Nudistenkolonie, ruhig, weitab der riesigen, sich von Andalusien bis zur Levante erstreckenden Touristenkomplexe, deren Bewohner vor allem nordeuropäische Rentner waren – Deutsche, Holländer, auch einige Skandinavier, natürlich die unvermeidlichen Engländer, wohingegen es seltsamerweise keinerlei Belgier gab, obwohl die gesamte Kolonie – die Architektur der Pavillons, die Anordnung der Einkaufszentren, die Einrichtung der Bars – ihre Anwesenheit einzufordern schien, es war, kurzum, wirklich ein belgisches Nest. Die meisten der Bewohner hatten ihre berufliche Laufbahn im Bildungswesen absolviert, Beamtentum im weiteren Sinne, Positionen auf mittlerer Ebene. Jetzt beendeten sie ihr Leben in friedlicher Manier, kamen zur Happy Hour nie als Letzte und trugen ihre hängenden Hintern, ihre überflüssigen Brüste und ihre untätigen Schwänze fröhlich von der Bar zum Strand und vom Strand zur Bar. Sie machten keine Probleme, zettelten keinen Nachbarschaftsstreit an, sie breiteten pflichtschuldig ein Handtuch auf den Plastikstühlen des Lokals No problemo aus, bevor sie sich mit übertriebener Aufmerksamkeit in das Studium der doch sehr übersichtlichen Karte vertieften (innerhalb der Kolonie galt es als höflich, durch Auflegen eines Handtuchs den Kontakt zwischen dem gemeinschaftlich genutzten Mobiliar und den möglicherweise feuchten intimen Körperteilen der Gäste zu vermeiden).
Eine weitere, weniger große, aber aktivere Gruppe bildeten spanische Hippies (angemessen vertreten, so wurde mir schmerzlich bewusst, durch die beiden jungen Mädchen, die mich wegen der Befüllung ihrer Reifen angesprochen hatten). Ein kleiner Exkurs in die jüngere Geschichte Spaniens könnte hier zweckdienlich sein. Nach dem Tod General Francos im Jahr 1975 sah sich Spanien mit zwei gegenläufigen Strömungen konfrontiert. Die erste, eine unmittelbare Folge der 1960er-Jahre, legte großen Wert auf freie Liebe, Nacktheit, die Emanzipation der Arbeiterklasse und dergleichen. Die zweite, die sich im Laufe der 1980er-Jahre endgültig durchsetzte, honorierte dagegen Wettbewerb, Hardcore-Porno, Zynismus und Aktienoptionen, gut, ich vereinfache, aber ohne Vereinfachungen kommt man nicht weiter. Die Vertreter der ersten Strömung, deren Niederlage vorprogrammiert war, zogen sich nach und nach zurück in Schutzräume wie die bescheidene Nudistenkolonie, in der ich eine Wohnung gekauft hatte. Hatte sich diese vorprogrammierte Niederlage also endlich vollzogen? Gewisse deutlich nach dem Tod General Francos auftretende Phänomene wie die Bewegung der indignados ließen das Gegenteil vermuten. Und dann vor noch kürzerer Zeit das Auftauchen dieser beiden jungen Mädchen an der Repsol-Tankstelle bei El Alquián an diesem beunruhigenden und unheilvollen Nachmittag – war die weibliche Version des indignado wohl eine indignada? War ich also zwei hinreißenden indignadas begegnet? Ich würde es nie erfahren, es war mir nicht gelungen, mein Leben mit dem ihren zu verknüpfen, ich hätte ihnen doch vorschlagen können, mich in meiner Nudistenkolonie zu besuchen, dort wären sie in ihrem natürlichen Habitat gewesen, die Dunkle wäre vielleicht weitergefahren, aber ich wäre mit der Brünetten glücklich gewesen, wobei die Glücksverheißungen in meinem Alter ein bisschen vage wurden, aber nach dieser Begegnung träumte ich mehrere Nächte hintereinander, dass die Brünette an meiner Tür klingelte. Sie war zu mir zurückgekommen, mein Umherirren auf dieser Welt hatte ein Ende gefunden, sie war zurückgekehrt, um in einem Handstreich meinen Schwanz, mein Dasein und meine Seele zu retten. »Und in mein Haus, frei und verwegen, trete ein, meine Gebieterin.« In einigen dieser Träume erklärte sie, ihre dunkle Freundin warte im Auto und wolle wissen, ob sie zu uns herauskommen könne, doch diese Version des Traums wurde immer seltener, das Szenario vereinfachte sich, und schließlich gab es gar kein Szenario mehr, gleich nachdem ich die Tür geöffnet hatte, traten wir in einen erleuchteten, mit Worten nicht zu beschreibenden Raum ein. Diese Fantastereien dauerten etwas über zwei Jahre lang an – aber greifen wir nicht vor.
Im Hier und Jetzt würde ich am darauffolgenden Nachmittag Yuzu am Flughafen von Almería abholen müssen. Sie war noch nie hergekommen, aber ich war mir sicher, dass sie den Ort hassen würde. Für die nordischen Rentner empfand sie nichts als Abscheu, für die spanischen Hippies nichts als Verachtung, keine dieser beiden Kategorien (die hier ohne große Schwierigkeiten zusammenlebten) konnte ihrer elitären Vision des Gesellschaftslebens und der Welt an sich gerecht werden, all diese Leute hatten eindeutig keine Klasse, und im Übrigen hatte auch ich keine Klasse, ich hatte nur Geld, gar nicht mal wenig Geld, aufgrund von Umständen, die ich vielleicht noch schildern werde, wenn ich dazu komme, und damit ist eigentlich alles gesagt, was es über meine Beziehung mit Yuzu zu sagen gibt, ich musste sie natürlich verlassen, das war offensichtlich, ja, wir hätten gar nicht erst zusammenkommen dürfen, nur brauchte ich lange, sehr lange, um mein Leben wieder in die Hand zu nehmen, wie bereits gesagt, und die meiste Zeit über schaffte ich es überhaupt nicht.
Am Flughafen fand ich problemlos eine Parklücke, der Parkplatz war überdimensioniert, überhaupt war in dieser Gegend alles überdimensioniert, für einen touristischen Ansturm kolossalen Ausmaßes vorgesehen, der nie eingetreten war.
Es war Monate her, dass ich zum letzten Mal mit Yuzu geschlafen hatte, und vor allem zog ich aus anderen Gründen, die ich sicherlich noch erläutern werde, nie in Betracht, wieder damit anzufangen, im Grunde begriff ich überhaupt nicht, warum ich diesen Urlaub organisiert hatte, und während ich auf einer Plastikbank im Ankunftsbereich wartete, überlegte ich schon, den Aufenthalt zu verkürzen – ich hatte zwei Wochen eingeplant, eine Woche wäre mehr als ausreichend, ich würde lügen, was meine beruflichen Verpflichtungen anging, dagegen könnte sie nichts sagen, die Schlampe, sie war komplett von meiner Kohle abhängig, das verschaffte mir immerhin gewisse Rechte.
Der von Paris-Orly kommende Flug war pünktlich, der Ankunftsbereich angenehm klimatisiert und fast menschenleer – der Tourismus in der Provinz Almería ließ wirklich immer weiter nach. Als die elektronische Anzeigetafel die Landung vermeldete, wäre ich beinahe aufgestanden und zum Parkplatz gegangen – sie kannte die Adresse nicht, sie hätte mich niemals gefunden. Ich rief mich schnell zur Vernunft – es könnte gut sein, dass ich an einem der nächsten Tage nach Paris zurückkehren müsste, und sei es nur aus beruflichen Gründen, meine Arbeit im Landwirtschaftsministerium widerte mich, nebenbei bemerkt, genauso an wie meine japanische Partnerin, ich machte wirklich eine schwere Zeit durch, manche bringen sich wegen weniger um.
Sie war wie immer völlig übertrieben geschminkt, förmlich angemalt, der scharlachrote Lippenstift und der rötlich-violette Lidschatten betonten ihren blassen Teint, ihre »Porzellanhaut«, wie es in den Romanen von Yves Simon heißt, in diesem Moment erinnerte ich mich daran, dass sie sich niemals der Sonne aussetzte, denn eine bleiche Haut (beziehungsweise Porzellanhaut, um es mit Yves Simon zu sagen) wurde von den Japanern als der Gipfel der Vornehmheit betrachtet; was aber sollte man in einem spanischen Badeort machen, wenn man sich nicht der Sonne aussetzen wollte, dieser geplante Urlaub war wirklich absurd, ich würde noch am selben Abend die Hotelreservierungen für die Rückreise ändern, eine Woche war schon zu viel, warum nicht ein paar Tage für die Kirschblüte in Kyoto im Frühling aufsparen?
Mit der Brünetten wäre alles anders gewesen, sie hätte sich am Strand ohne Groll und ohne Geringschätzung ausgezogen, solch eine gehorsame Tochter Israels, sie hätte sich nicht an den Wülsten der fetten deutschen Rentnerinnen gestört (sie wusste, dies war das Schicksal der Frauen bis zur glorreichen Wiederkunft Christi), sie hätte der Sonne (und den deutschen Rentnern, die sich das keine Sekunde lang hätten entgehen lassen) das gloriose Spektakel ihres perfekt gerundeten Hinterns, ihrer arglosen, aber nichtsdestoweniger epilierten Muschi (denn Gott hat den Putz erlaubt) dargeboten, und ich wäre wieder steif gewesen, ich hätte einen Ständer gehabt wie ein Tier, aber sie hätte mir nicht gleich am Strand einen geblasen, es war eine familientaugliche Nudistenkolonie, sie hätte die deutschen Rentnerinnen nicht schockieren wollen, die bei Sonnenaufgang am Strand ihre Hatha-Yoga-Übungen machten, trotzdem hätte ich gespürt, dass sie Lust dazu hatte, und meine Manneskraft wäre dadurch wiederhergestellt gewesen, doch sie hätte gewartet, bis wir im Wasser gewesen wären, vielleicht fünfzig Meter vom Ufer entfernt (der Strand fiel ganz sanft ab), bevor sie meinem triumphalen Phallus ihre feuchten Weichteile dargeboten hätte, und später hätten wir uns in einem Restaurant in Garrucha einen Teller arroz con bogavante geteilt, Romantik und Pornografie wären nicht länger zwei unterschiedliche Dinge gewesen, die Barmherzigkeit des Schöpfers hätte sich mit Wucht offenbart, meine Gedanken waren kurz hin und her gesprungen, aber ich schaffte es trotzdem, andeutungsweise einen zufriedenen Gesichtsausdruck nachzuahmen, als ich Yuzu erblickte, die inmitten einer dicht gedrängten Horde australischer Backpacker den Ankunftsbereich betrat.
Wir gaben uns ein flüchtiges Begrüßungsküsschen, zumindest berührten sich unsere Wangen leicht, aber das war wohl schon zu viel, sie setzte sich gleich hin, öffnete ihr Beauty-Case (dessen Inhalt streng den gemeinsamen Vorschriften der Fluggesellschaften für das Handgepäck entsprach) und frischte ihren Puder auf, ohne dem Gepäckförderband irgendeine Beachtung zu schenken – offensichtlich würde ich das Gepäck schleppen müssen.
Ich kannte ihr Gepäck gut, zwangsläufig, es war von einem renommierten Hersteller, den ich vergessen habe, Zadig & Voltaire oder vielleicht auch Pascal & Blaise, das Konzept war in jedem Fall, eine dieser Landkarten aus der Renaissance, auf denen die Erde in sehr schematischer Form dargestellt war, aber begleitet von alten Bildlegenden wie »Hier muessen Tyger leben«, auf den Stoff zu drucken. Jedenfalls waren es schicke Gepäckstücke, ihre Exklusivität wurde dadurch unterstrichen, dass sie nicht mit Rollen ausgestattet waren, im Gegensatz zu vulgären Samsonites für mittlere Angestellte musste man sie tatsächlich schleppen, ganz genau so wie die Überseekoffer eleganter Damen aus viktorianischer Zeit.
Wie alle Länder des abendländischen Europas hatte sich das in einen tödlichen Prozess der Produktivitätssteigerung verstrickte Spanien Stück für Stück aller nicht qualifizierten Tätigkeiten entledigt, die einst dazu beigetragen hatten, das Leben etwas weniger unerfreulich zu gestalten, und im gleichen Zug den Großteil seiner Bevölkerung zur Massenerwerbslosigkeit verurteilt. Gepäck wie dieses, ob nun Zadig & Voltaire oder eben Pascal & Blaise daraufstand, hatte nur in einer Gesellschaft Sinn, in der noch der Beruf des Trägers existierte.
Das war offenbar nicht mehr so, das heißt, eigentlich doch, dachte ich, während ich die beiden Gepäckstücke (einen Koffer und eine fast ebenso schwere Reisetasche, die zusammen um die vierzig Kilo auf die Waage bringen mussten) nacheinander vom Förderband hob: Der Träger war ich.
DAZU ÜBERNAHM ICH DIE FUNKTION des Chauffeurs. Kurz nachdem wir wieder auf die Autobahn A7 aufgefahren waren, schaltete sie ihr iPhone ein und schloss ihre Kopfhörer an, bevor sie sich eine mit abschwellender Aloe-vera-Lotion getränkte Maske auf die Augen legte. Die Strecke, die in Richtung Süden auf den Flughafen zuführte, war nicht ungefährlich, es kam nicht selten vor, dass ein lettischer oder bulgarischer Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Gegenrichtung hatten die Lastwagenflotten, die Nordeuropa mit in Gewächshäusern angebautem, von illegal aus Mali eingereisten Arbeitern geerntetem Gemüse versorgten, ihre Reise gerade erst angetreten, die Fahrer litten noch nicht an Schlafmangel, und ich konnte ohne Schwierigkeiten an etwa dreißig Lastern vorbeiziehen, bevor ich die Abfahrt 537 erreichte. Am Eingang der langen Kurve, die zu dem Viadukt führte, das die Rambla del Tesoro überragte, fehlte auf etwas mehr als fünf Metern die Leitplanke; um dem Ganzen ein Ende zu bereiten, hätte ich nur das Lenkrad loslassen müssen. Der Abhang war an dieser Stelle sehr steil, und angesichts der erreichten Geschwindigkeit war mit einer perfekten Durchfahrt zu rechnen, der Wagen würde nicht einmal den felsigen Abhang hinunterrasen, er würde einfach hundert Meter weiter unten zerschellen, ein Augenblick reinen Schreckens, und dann wäre es vorbei, ich würde dem Herrn meine unstete Seele übergeben.
Das Wetter war klar und windstill, und ich fuhr schnell auf den Eingang der Kurve zu: Ich schloss die Augen und umklammerte das Steuer, und es folgten einige Sekunden, gewiss weniger als fünf, eines paradoxen Gleichgewichts und absoluten Friedens, in deren Verlauf es mir vorkam, als wäre ich aus der Zeit herausgetreten.
In einer krampfhaften, ganz und gar unwillkürlichen Bewegung schlug ich das Lenkrad nach links ein. Es war höchste Zeit, der rechte Vorderreifen fraß sich kurz in den steinigen Straßenrand. Yuzu riss sich Maske und Kopfhörer herunter. »Was ist los? Was ist los?«, wiederholte sie wütend, aber auch ein wenig ängstlich, und ich spielte mit dieser Angst: »Alles gut«, sagte ich, so sanft ich konnte, im salbungsvollen Tonfall eines zivilisierten Serienmörders, Anthony Hopkins war mein Vorbild, hinreißend und nahezu unschlagbar, kurzum die Art von Mann, der man irgendwann im Leben einmal begegnen muss. Noch leiser, fast unhörbar wiederholte ich: »Alles gut.«
In Wirklichkeit war gar nichts gut; mein zweiter Befreiungsversuch war soeben fehlgeschlagen.
WIE ERWARTET, NAHM YUZU meine Entscheidung, unsere Urlaubszeit auf eine Woche zu verkürzen, gelassen auf und versuchte lediglich, nicht allzu erleichtert zu wirken; meine Begründung mit einer beruflichen Weisung schien sie sofort zu überzeugen, in Wirklichkeit war es ihr scheißegal.
Außerdem war es mehr als nur ein Vorwand, ich war nämlich tatsächlich abgereist, bevor ich meinen umfassenden Bericht über die Aprikosenerzeuger aus dem Roussillon eingereicht hatte, angewidert von der Nichtigkeit meiner Arbeit. Sobald die Freihandelsabkommen, über die gerade mit den Mercosur-Staaten verhandelt wurde, unterzeichnet wären, würde klar auf der Hand liegen, dass die Aprikosenerzeuger aus dem Roussillon keine Chance mehr hatten, der Schutz durch die Ursprungsbezeichnung »Rote Aprikose aus dem Roussillon« war bloß eine lächerliche Farce, der Vormarsch der argentinischen Aprikosen war unabwendbar, man konnte die Aprikosenerzeuger aus dem Roussillon im Grunde schon als tot betrachten, keiner, nicht ein einziger von ihnen würde übrig bleiben, nicht einmal ein Überlebender, um die Leichen zu zählen.
Ich war, ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, im Landwirtschaftsministerium angestellt, im Wesentlichen bestand meine Arbeit im Verfassen von Mitteilungen und Berichten für Verhandlungsberater, die meist innerhalb der europäischen Verwaltungen saßen, manchmal auch in größeren Handelsrunden mit der Aufgabe, »die Positionen der französischen Landwirtschaft zu bestimmen, zu stützen und zu vertreten«. Meine Mitarbeit auf Vertragsbasis brachte mir ein hohes Gehalt ein, das deutlich über dem lag, was laut der geltenden Vorschriften einem Beamten zugestanden hätte. Dieses Gehalt war in gewisser Weise gerechtfertigt, die französische Landwirtschaft ist komplex und vielschichtig, und es gibt nicht viele, die die Herausforderungen all der verschiedenen Zweige meistern können, und meine Berichte stießen im Allgemeinen auf Wertschätzung, man würdigte meine Fähigkeit, auf den Punkt zu kommen, mich nicht in allzu vielen Zahlen zu verlieren, sondern im Gegenteil gewisse Kernelemente herauszuarbeiten. Andererseits könnte ich eine beeindruckende Reihe von Fehlern in meiner Verteidigung der landwirtschaftlichen Positionen Frankreichs aufzählen, doch diese Fehler waren im Grunde nicht meine gewesen, es waren viel unmittelbarer die Fehler der Verhandlungsberater gewesen, jener seltenen und eitlen Spezies, deren Arroganz durch ihre ständigen Misserfolge nicht im Mindesten gebremst wird, ich hatte einige von ihnen getroffen (nicht allzu häufig, meist kommunizierten wir per E-Mail), und ich war angewidert aus diesen Treffen herausgekommen, meist handelte es sich nicht um Agraringenieure, sondern um ehemalige Handelsschulabsolventen. Ich hatte von Anfang an nichts als Abscheu vor dem Handel empfunden und vor allem, was damit zusammenhing, die Idee eines »handelsgewerblichen Hochschulstudiums« war in meinen Augen eine Schändung des Studienbegriffs als eines solchen, aber letzten Endes war es normal, dass man junge, aus einer Handelsschule hervorgegangene Menschen mit dem Amt des Verhandlungsberaters betraute, Verhandlungen sind immer gleich, ob nun über Aprikosen, Spitzenkonfekt aus der Provence, Mobiltelefone oder Ariane-Raketen verhandelt wird, die Verhandlung ist ein eigenständiges Universum, das seinen eigenen Gesetzen gehorcht, ein allen Nicht-Verhandelnden auf ewig unzugängliches Universum.
Ich hatte meinen Bericht über die Aprikosenerzeuger aus dem Roussillon trotzdem wieder aufgenommen und mich damit in das obere Zimmer zurückgezogen (es war eine Maisonettewohnung), und schließlich hatte ich Yuzu eine Woche lang kaum zu Gesicht bekommen, an den ersten beiden Tagen hatte ich mir noch die Mühe gemacht, wieder zu ihr hinunterzugehen, die Illusion eines Ehebetts aufrechtzuerhalten, danach hatte ich es bleiben lassen, ich hatte mir angewöhnt, allein zu essen, in dieser tatsächlich ganz netten Tapas-Bar, in der ich leider nicht mit der Brünetten von El Alquián zusammengesessen hatte, im Laufe der Tage hatte ich mich dann damit abgefunden, den ganzen Nachmittag dort zu verbringen, diese in geschäftlicher Hinsicht träge, aber in sozialer Hinsicht nicht zu komprimierende Zeitspanne, die in Europa das Mittagessen vom Abendessen scheidet. Die Atmosphäre war beruhigend, es gab dort Menschen, die waren wie ich, nur noch schlechter dran, in dem Maße, dass sie zwanzig oder dreißig Jahre älter waren als ich und das Urteil über sie schon gesprochen war, sie waren besiegt, nachmittags waren viele Verwitwete in dieser Tapas-Bar, auch die Nudisten kannten den Witwenstand, genauer gesagt, gab es jede Menge Witwen und nicht wenige homosexuelle Witwer, deren anfälligere Partner schon in den Homohimmel aufgefahren waren, außerdem schienen sich in dieser Tapas-Bar, die die Senioren ganz offensichtlich auserkoren hatten, um dort ihr Leben zu beschließen, die Unterscheidungsmerkmale der sexuellen Orientierungen verflüchtigt zu haben – zugunsten der banaleren nationalen Unterscheidungsmerkmale: Bei den Tischen auf der Terrasse ließ sich die englische Ecke problemlos von der deutschen Ecke abgrenzen; ich war der einzige Franzose; was die Holländer anging, das waren wirklich Schlampen, sie setzten sich, wohin sie wollten, sie sind ein Volk polyglotter Kaufmänner und Opportunisten, diese Holländer, man kann es gar nicht oft genug sagen. Und alle betäubten sie sich sanft mit cervezas und platos combinados, die Stimmung war insgesamt sehr ruhig, der Tonfall der Unterhaltungen gedämpft. Hin und wieder schwappte dennoch eine Welle jugendlicher indignados direkt vom Strand herein, die Haare der Mädchen waren noch feucht, und der Lautstärkepegel im Lokal stieg um eine Stufe an. Was Yuzu ihrerseits machte, weiß ich nicht, denn sie ging ja nicht in die Sonne, wahrscheinlich schaute sie im Netz japanische Serien; ich frage mich heute noch, ob sie überhaupt in der Lage war, die Situation zu begreifen. Ein einfacher gaijin wie ich, der nicht einmal aus einem gehobeneren Milieu stammte, der es gerade eben schaffte, ein anständiges, wenn auch nicht fantastisches Gehalt nach Hause zu bringen, hätte sich normalerweise unendlich geehrt fühlen müssen, sein Leben mit irgendeiner Japanerin teilen zu dürfen, und erst recht mit einer jungen, sexy Japanerin, die aus einer prominenten japanischen Familie kam und darüber hinaus mit den avanciertesten künstlerischen Milieus beider Hemisphären in Kontakt stand, die Theorie dahinter war unanfechtbar, ich war es kaum wert, ihr die Sandalen von den Füßen zu lösen, das verstand sich von selbst, nur legte ich ihrem und meinem Status gegenüber leider eine immer rüpelhaftere Gleichgültigkeit an den Tag; als ich eines Abends nach unten ging, um Bier aus dem Kühlschrank zu holen, stieß ich in der Küche mit ihr zusammen, und mir entfuhr ein »Aus dem Weg, fette Schlampe«, bevor ich mir den Bierträger San Miguel und eine angeschnittene Chorizo griff, kurz, ich brachte sie in dieser Woche wohl etwas aus der Fassung. An seinen prominenten Sozialstatus zu gemahnen, ist gar nicht so einfach, wenn einem das Gegenüber als Antwort ins Gesicht zu rülpsen oder einen Furz zu lassen droht, es gab sicherlich viele Leute, mit denen sie ihre Verstörung teilen konnte, nicht ihre Familie, die die Lage sofort zu ihrem eigenen Vorteil ausgeschlachtet und beschlossen hätte, es sei nun an der Zeit, dass sie nach Japan zurückkehrte, aber doch gewiss Freundinnen, Freundinnen oder Bekannte, und ich glaube, sie machte reichlich Gebrauch von Skype in diesen Tagen, während ich mich damit abfand, die Aprikosenerzeuger aus dem Roussillon ihrem Abstieg in die Vernichtung zu überlassen, meine damalige Gleichgültigkeit den Aprikosenerzeugern aus dem Roussillon gegenüber erscheint mir heute als Vorbote jener Gleichgültigkeit, die ich im entscheidenden Augenblick gegenüber den Milcherzeugern von Calvados und dem Ärmelkanal an den Tag gelegt habe, und zugleich jener tiefgreifenderen Gleichgültigkeit, die ich anschließend in Bezug auf mein eigenes Schicksal entwickeln sollte und die mich gegenwärtig begierig die Gesellschaft der Rentner suchen ließ, was paradoxerweise gar nicht so einfach war, enttarnten sie mich doch rasch als falschen Senior, insbesondere von den englischen Rentnern bekam ich mehrere Körbe (was nicht sehr schlimm war, vom Engländer wird man nie freundlich aufgenommen, der Engländer ist fast so ein Rassist wie der Japaner, von dem er eine Art Light-Version darstellt), aber auch von den Holländern, die mich offenbar nicht aus Fremdenfeindlichkeit zurückwiesen (wie sollte ein Holländer fremdenfeindlich sein? Es liegt da schon ein begrifflicher Widerspruch vor, Holland ist kein Land, es ist bestenfalls ein Unternehmen), sondern weil sie mir den Zugang zu ihrem Seniorenuniversum versagten, ich hatte die Bewährungsprobe nicht bestanden, sie konnten mit mir nicht offen und zwanglos über ihre Prostataprobleme und ihre Bypassoperationen reden, überraschenderweise fand ich viel leichter Zugang zu den indignados, mit ihrer Jugend ging eine effektive Naivität einher, und während dieser paar Tage hätte ich mich auf ihre Seite schlagen können, und ich hätte mich auf ihre Seite schlagen müssen, es war meine letzte Chance, und zugleich hätte ich ihnen viel beizubringen gehabt, ich kannte mich mit den Entgleisungen der Agrarindustrie bestens aus, in Verbindung mit mir hätte sich ihre militante Haltung verfestigt, zumal die spanische GVO-Politik mehr als fragwürdig war, Spanien war eines der liberalistischsten und verantwortungslosesten Länder, was den Umgang mit genetisch veränderten Organismen betraf, das galt für ganz Spanien, die Gesamtheit der spanischen campos, die sich von heute auf morgen in Genbomben zu verwandeln drohten, im Grunde hätte es nur eines Mädchens bedurft, es bedurfte immer nur eines Mädchens, aber es geschah nichts, was mich die Brünette von El Alquián hätte vergessen lassen, und im Rückblick gebe ich nicht einmal den anwesenden indignadas die Schuld, ich kann mich nicht einmal mehr richtig an ihre Einstellung zu mir erinnern, im Nachhinein erscheint sie mir als oberflächlich wohlwollend, aber ich war wohl selbst nur auf oberflächliche Weise zugänglich, ich war vernichtet durch Yuzus Rückkehr, durch die offensichtliche Tatsache, dass ich mir Yuzu vom Hals schaffen musste, und das so schnell wie möglich, ich war nicht mehr in der Lage, ihre Reize wirklich wahrzunehmen beziehungsweise sie, selbst wenn ich sie wahrgenommen hätte, für echt zu halten, sie waren wie eine Dokumentation über die Wasserfälle des Berner Oberlands, die ein somalischer Flüchtling im Internet sieht. Meine Tage verrannen zunehmend schmerzhaft in der Abwesenheit spürbarer Ereignisse und schlichter Gründe, weiterzuleben, letztlich hatte ich sogar die Aprikosenerzeuger aus dem Roussillon vollständig aufgegeben; ich ging nicht mehr sehr oft ins Café, aus Angst, mich einer indignada mit nackten Brüsten gegenüberzusehen. Ich betrachtete die Bewegungen der Sonne auf den Steinplatten, ich kippte flaschenweise Cardenal-Mendoza-Brandy hinunter, und das war so ziemlich alles.
DER UNERTRÄGLICHEN LEERE meiner Tage zum Trotz sah ich der Rückfahrt ängstlich entgegen, während der mehrtägigen Reise würde ich im selben Bett wie Yuzu schlafen müssen, schließlich könnten wir uns keine getrennten Zimmer nehmen, ich war außerstande, die Weltanschauung der Rezeptionisten und selbst der übrigen Hotelangestellten so brutal und in einem solchen Maß zu erschüttern, wir würden also dauerhaft aneinander gefesselt sein, vierundzwanzig Stunden am Tag, und dieses Martyrium würde vier ganze Tage dauern. Zu Camilles Zeiten hatte ich für den Weg nur zwei Tage gebraucht, zunächst einmal weil sie selbst Auto fuhr und mich jederzeit ablösen konnte, aber auch weil man sich in Spanien noch nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hielt, es gab noch kein Punktesystem, und die Koordination der europäischen Bürokratien war ohnehin noch nicht so perfekt organisiert, weswegen ein generell eher laxer Umgang mit kleineren Vergehen von Ausländern herrschte. Nicht nur ließ sich durch eine Geschwindigkeit von hundertfünfzig oder hundertsechzig Stundenkilometern anstelle dieser lächerlichen Beschränkung auf hundertzwanzig Stundenkilometer offensichtlich die Fahrtzeit reduzieren, sondern man konnte auch länger und unter besseren Sicherheitsbedingungen fahren. Auf diesen endlosen spanischen Autobahnen, ewig lange, so gut wie leere Geraden, die sich unter der erdrückenden Sonne durch eine Landschaft von absoluter Eintönigkeit ziehen, vor allem zwischen Valencia und Barcelona, aber durchs Landesinnere zu fahren, änderte auch nicht viel, der Streckenabschnitt zwischen Albacete und Madrid war ebenfalls völlig deprimierend, auf diesen spanischen Autobahnen ließ sich das Einschlafen selbst durch das Trinken eines café solo bei jeder Gelegenheit, selbst in Anbetracht der Tatsache, dass man eine Zigarette nach der anderen rauchte, nur sehr schwer verhindern. Nach zwei oder drei Stunden dieser langatmigen Fahrstrecke schlossen sich die Augen unwillkürlich, man wäre nur durch die geschwindigkeitsbedingte Adrenalinausschüttung wach gehalten worden, dem Wiederanstieg tödlicher Unfälle auf den spanischen Autobahnen lag in Wahrheit diese absurde Geschwindigkeitsbegrenzung zugrunde, und wollte ich keinen tödlichen Unfall riskieren – was allerdings eine Lösung gewesen wäre –, musste ich mich darauf beschränken, fünfhundert bis sechshundert Kilometer am Tag zurückzulegen.
Schon zu Camilles Zeiten war es schwierig gewesen, unterwegs Hotels zu finden, in denen das Rauchen erlaubt war, aber aus genannten Gründen hatten wir nur einen Tag gebraucht, um Spanien zu durchqueren, und einen weiteren, um wieder nach Paris zu gelangen, und wir hatten ein paar abtrünnige Hotelbetriebe ausfindig gemacht, einen an der baskischen Küste, einen anderen an der Côte Vermeille, einen dritten ebenfalls im Departement Pyrénées-Orientales, aber tiefer im Landesinneren, in Bagnères-de-Luchon, um genau zu sein, schon in den Bergen, und es ist vielleicht dieser dritte, das Château de Riell, an den ich die märchenhaftesten Erinnerungen habe, was an der kitschigen, pseudo-exotischen, unwahrscheinlichen Einrichtung sämtlicher Zimmer lag.
Die Unterdrückung durch das Gesetz war damals weniger perfekt, es gab noch Schlupflöcher, aber ich war auch noch jünger, ich hatte noch die Hoffnung, innerhalb der gesetzlichen Schranken bleiben zu können, ich glaubte noch an die Gerechtigkeit meines Landes, ich vertraute auf den im Ganzen nutzbringenden Charakter seiner Gesetze, ich hatte mir noch nicht das Guerilla-Know-how angeeignet, das mir später erlauben würde, die Rauchmelder mit Nichtachtung zu strafen: Ist die Abdeckung des Apparats erst einmal geöffnet, muss man nur zweimal ordentlich mit dem Seitenschneider zukneifen, um den Stromkreis des Alarms zu unterbrechen, und das war’s. Schwieriger ist es, die Putzfrauen für sich zu gewinnen, deren auf das Wittern von Tabakduft übertrainiertem Geruchssinn normalerweise nichts entgeht, was sie angeht, ist die einzige Lösung, sie zu schmieren, mit großzügig verteilten Trinkgeldern lässt sich ihr Schweigen zuverlässig erkaufen, aber unter diesen Bedingungen wird es natürlich ein teurer Aufenthalt, und gegen Verrat ist man trotzdem niemals gefeit.
Für die erste Station unserer Reise hatte ich das Parador in Chinchón vorgesehen, dagegen gab es kaum etwas einzuwenden, gegen Parador-Hotels im Allgemeinen gibt es wenig einzuwenden, aber dieses war besonders charmant, es befand sich in einem Kloster aus dem 16.Jahrhundert, die Zimmer gingen auf einen gefliesten Innenhof hinaus, wo ein Springbrunnen sprudelte, überall auf den Fluren und auch schon in der Hotelhalle konnte man sich in prächtige spanische Sessel aus dunklem Holz setzen. Dort ließ sie sich nieder, überschlug die Beine mit der ihr eigenen Arroganz und schaltete, ohne der Umgebung die geringste Beachtung zu schenken, sofort ihr Smartphone ein, schon im Voraus bereit, sich zu beschweren, falls es kein Netz gäbe. Gab es aber, was eine ziemlich gute Nachricht war, das würde sie den Abend über beschäftigen. Sie musste trotzdem noch einmal aufstehen, nicht ohne eine gewisse Gereiztheit an den Tag zu legen, um ihren Ausweis sowie ihre Aufenthaltsgenehmigung für Frankreich vorzuzeigen und die verschiedenen Formulare, die ihr der Hotelier hinlegte, an den gekennzeichneten Stellen, drei insgesamt, zu unterschreiben, die Verwaltung der Parador-Hotels hatte sich eine seltsam bürokratische und pedantische Seite bewahrt, die gar nicht mit der Vorstellung abendländischer Touristen von einem charmanten Boutique-Hotel zusammenging, Begrüßungscocktails waren nicht ihr Gebiet, das Fotokopieren von Ausweisen schon, wahrscheinlich hatte sich seit Franco nicht viel geändert, und doch waren die Paradors charmante Boutique-Hotels, sie waren nahezu ihr perfektes Urbild, alles, was in Spanien noch an mittelalterlichen Festungen oder Renaissance-Klöstern erhalten war, hatte man zu einem Parador umgebaut. Diese seit 1928 angewandte visionäre Politik hatte ihr volles Ausmaß erst etwas später erreicht, nach der Machtübernahme eines Mannes. Unabhängig von anderen, teils fragwürdigen Aspekten seines politischen Handelns konnte Francisco Franco als der wahre Erfinder des Wohlfühltourismus auf Weltniveau gelten, doch sein Lebenswerk erschöpfte sich nicht darin, dieser weltumspannende Geist sollte später die Grundlagen für einen authentischen Massentourismus schaffen (man denke nur an Benidorm! Man denke an Torremolinos! Gab es in den 1960er-Jahren irgendwo auf der Welt etwas Vergleichbares?), in Wirklichkeit war Francisco Franco ein echter Tourismusgigant gewesen, und anhand dieses Maßstabs würde man ihn letztlich neu bewerten, in manchen Schweizerischen Hotelfachschulen tat man das übrigens bereits, und auf allgemeinerer volkswirtschaftlicher Ebene war das Franco-Regime jüngst zum Gegenstand interessanter Arbeiten in Harvard oder Yale geworden, die aufzeigten, wie der Caudillo, der vorausahnte, dass Spanien niemals wieder Anschluss an den Zug der industriellen Revolution finden würde, dass es ihn, man muss es wirklich so sagen, komplett verpasst hatte, den kühnen Entschluss traf, durch Investitionen in die dritte und finale Phase der europäischen Wirtschaft, die des tertiären Tourismus- und Dienstleistungssektors, Strecke zu machen, wodurch er seinem Land einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffte, zu einer Zeit, da die Arbeitnehmer in den neuen Industrieländern, die zu einer erhöhten Kaufkraft gelangt waren, diese innerhalb Europas einsetzen wollten, je nach ihrem gesellschaftlichen Status entweder per Wohlfühltourismus oder per Massentourismus, wobei es zum Beispiel im Parador von Chinchón momentan nicht einen Chinesen gab, hinter uns wartete ein stinkgewöhnliches englisches Akademikerpaar, aber die Chinesen würden kommen, ganz bestimmt würden sie kommen, ich hatte keinen Zweifel, dass sie kommen würden, man müsste nur vielleicht doch die Aufnahmeformalitäten vereinfachen, bei allem Respekt, den man vor dem touristischen Erbe des Caudillo haben konnte und sollte, hatten sich die Dinge doch geändert, es war jetzt kaum mehr wahrscheinlich, dass Spione aus der Kälte kamen, um sich in die unschuldige Schar gewöhnlicher Touristen einzuschleichen, die Spione, die aus der Kälte kamen, waren selbst zu gewöhnlichen Touristen geworden, dem Beispiel ihres Oberhaupts Wladimir Putin, des Ersten unter Gleichen, folgend.
Als die Formalitäten erledigt, die Unterlagen des Hotels allesamt unterzeichnet waren, überkam mich noch einmal kurz ein masochistischer Jubel, als ich den ironischen, ja verächtlichen Blick sah, den Yuzu mir zuwarf, als ich dem Rezeptionisten meine Amigos-de-Paradores