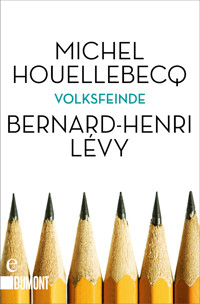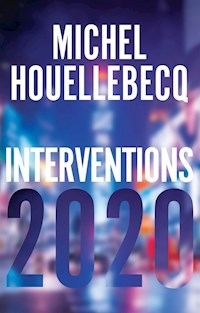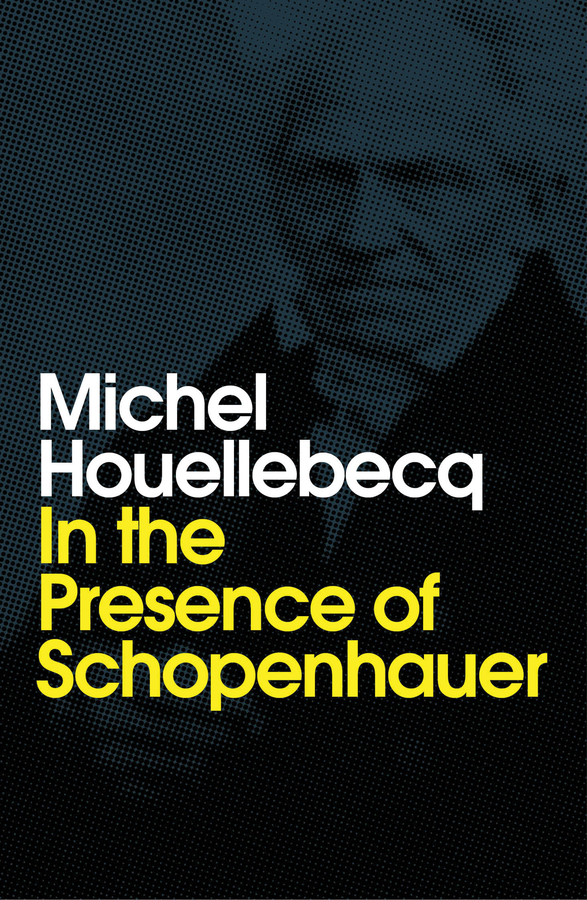9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Erzähler Michel ist Beamter im Kultusministerium und nach Dienstschluss einsamer Peep-Show-Erotomane. Die Urlaubspauschalreise ins Traumland Thailand verspricht diesem »ziemlich mittelmäßigen Individuum« paradiesisches Glück und sexuelle Erlösung. Zusammen mit seiner Mitreisenden Valérie, in die er sich verliebt, erfindet er ein rettendes Programm für die Reisebranche: Wenn mehrere Hundert Millionen alles haben, bloß kein sexuelles Glück, und mehrere Milliarden nichts haben als ihren Körper, dann ist das »eine Situation des idealen Tauschs«. Doch das Glück, nach dem Houellebecqs Erzähler Michel verzweifelt sucht, wird bei einem islamistischen Terroranschlag jäh zerstört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Der Erzähler Michel ist Beamter im Kultusministerium und nach Dienstschluss einsamer Peep-Show-Erotomane. Die Urlaubspauschalreise ins Traumland Thailand verspricht diesem »ziemlich mittelmäßigen Individuum« paradiesisches Glück und sexuelle Erlösung. Zusammen mit seiner Mitreisenden Valérie, in die er sich verliebt, erfindet er ein rettendes Programm für die Reisebranche: Wenn mehrere Hundert Millionen alles haben, bloß keine erfüllende Sexualität, und mehrere Milliarden nichts haben als ihren Körper, dann ist das »eine Situation des idealen Tauschs«. Doch das Glück, nach dem Houellebecqs Erzähler Michel verzweifelt sucht, wird bei einem islamistischen Terroranschlag jäh zerstört. Michel Houellebecq
Michel Houellebecq
Plattform
aus dem Französischen von Uli Wittmann
Vollständige eBook-Ausgabe der im DuMont Buchverlag erschienenen Taschenbuchausgabe
März 2015
Alle Rechte vorbehalten
Die französische Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel ›Plateforme‹ bei Flammarion, Paris.
© 2001 Michel Houellebecq und Flammarion, Paris
© 2002 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Übersetzung: Uli Wittmann
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © plainpicture/Johner
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8863-4
www.dumont-buchverlag.de
Je elender das Leben ist, desto stärker klammert sich der Mensch daran; dann wird es zu einem Protest, zu einer Rache an allem.
Honoré de Balzac
Erster Teil
1
Mein Vater ist vor einem Jahr gestorben. Ich glaube nicht an die Theorie, wonach man beim Tod seiner Eltern richtig erwachsen wird; man wird nie richtig erwachsen.
Vor dem Sarg des alten Mannes gingen mir unangenehme Gedanken durch den Kopf. Er hatte vom Dasein profitiert, dieser alte Sack; er hatte sich verdammt gut durchs Leben geschlagen. »Du hast Kinder gehabt, du Sau …«, sagte ich beschwingt zu mir. »Du hast deinen dicken Pimmel in die Möse meiner Mutter geschoben.« Na ja, ich war ein bißchen angespannt, das stimmt schon; man hat eben nicht jeden Tag einen Todesfall in der Familie. Ich hatte mich geweigert, den Leichnam zu sehen. Ich bin vierzig und hatte bereits Gelegenheit, Leichen zu sehen; jetzt vermeide ich es lieber. Das hat mich immer davon abgehalten, mir ein Haustier anzuschaffen.
Ich habe auch nicht geheiratet. Gelegenheit dazu bot sich mir mehrfach; aber ich habe jedesmal abgelehnt. Dabei mag ich Frauen sehr. Daß ich ledig geblieben bin, ist eines der Dinge im Leben, die ich ein wenig bedaure. Vor allem im Urlaub wirkt sich das störend aus. Im Urlaub bringen die Leute unverheirateten Männern ab einem gewissen Alter ziemliches Mißtrauen entgegen: Sie vermuten bei ihnen einen starken Egoismus und wohl auch einen gewissen Hang zum Laster; ich kann ihnen nur recht geben.
Nach der Beerdigung bin ich in das Haus gegangen, in dem mein Vater seine letzten Jahre verbracht hat. Die Leiche war eine Woche zuvor gefunden worden. Auf den Möbeln und in den Ecken hatte sich bereits ein wenig Staub angesammelt; in einer Fensternische bemerkte ich eine Spinnwebe. Die Zeit, die Entropie und all diese Dinge nahmen also dieses Haus allmählich schon in Besitz. Die Gefriertruhe war leer. In den Küchenschränken lagen vor allem Einzelportionen von Weight Watchers-Gerichten, Dosen mit aromatisierten Proteinen und kraftspendende Müsliriegel. Ich ging durch die Zimmer im Erdgeschoß und knabberte dabei mit Magnesium angereichertes Sandgebäck. Im Heizungskeller setzte ich mich auf das Trimmrad und trat in die Pedale. Mit über siebzig Jahren war mein Vater in viel besserer körperlicher Verfassung gewesen, als ich es bin. Er trieb jeden Tag eine Stunde intensiv Gymnastik und drehte zweimal in der Woche im Schwimmbad seine Runden. Am Wochenende spielte er Tennis und fuhr mit Gleichaltrigen Rad; ich hatte einige von ihnen im Krematorium getroffen. »Er hat uns alle auf Trab gebracht!« hatte ein Gynäkologe zu mir gesagt. »Er war zehn Jahre älter als wir, aber auf einer zwei Kilometer langen Steigung hat er uns mit einem Vorsprung von einer Minute abgehängt.« Vater, Vater, sagte ich zu mir, wie verdammt eitel du doch warst! Im linken Winkel meines Blickfelds entdeckte ich einen Hometrainer und Hanteln. Für den Bruchteil einer Sekunde sah ich einen Idioten in Shorts vor mir – mit einem Gesicht voller Falten, das ansonsten aber dem meinen sehr glich –, der mit verzweifelter Energie die Brustmuskeln spannte. Vater, sagte ich zu mir, Vater, du hast dein Haus auf Sand gebaut. Ich trat immer noch in die Pedale, aber allmählich ging mir die Puste aus und die Schenkel taten mir weh, dabei war ich erst auf Stufe eins. Ich dachte an die Begräbnisfeier zurück und war mir sicher, daß ich einen ausgezeichneten Gesamteindruck hinterlassen hatte. Ich bin immer glattrasiert, habe schmale Schultern, und da ich mit Anfang dreißig den Ansatz einer Glatze entwickelt habe, bin ich dazu übergegangen, mir das Haar kurz schneiden zu lassen. Ich trage im allgemeinen graue Anzüge, unauffällige Krawatten, und ich mache keinen sonderlich fröhlichen Eindruck. Mit meinem kurzgeschorenen Haar, meiner dünnrandigen Brille und meinem mürrischen Gesicht, den Kopf leicht gesenkt, um einem Sampler mit christlicher Trauermusik zu lauschen, hatte ich mich in dieser Situation sehr wohl gefühlt – sehr viel wohler als auf einer Hochzeit zum Beispiel. Beerdigungen sind eben mein Ding. Ich hörte auf, in die Pedale zu steigen, und hustete leicht. Die Dunkelheit legte sich über die Weiden ringsumher. In der Nähe der Betonkonstruktion, in die der Heizkessel eingelassen war, konnte man einen bräunlichen, unzureichend gereinigten Fleck erkennen. Dort hatte man meinen Vater in Shorts und einem Sweatshirt mit dem Aufdruck »I love New York« mit zerschmettertem Schädel aufgefunden. Dem Gerichtsmediziner zufolge war der Tod drei Tage zuvor eingetreten. Man hätte es, wenn man unbedingt wollte, für einen Unfall halten können, er hätte auf einer Ölpfütze oder was weiß ich ausrutschen können. Der Fußboden des Raums war jedoch vollkommen trocken; und der Schädel war an mehreren Stellen geplatzt, etwas Gehirnmasse war sogar auf den Boden gespritzt; es handelte sich also mit größerer Wahrscheinlichkeit um einen Mord. Hauptmann Chaumont von der Gendarmerie in Cherbourg würde im Laufe des Abends vorbeikommen.
Als ich wieder im Wohnzimmer war, stellte ich den Fernseher an, einen Sony 16:9 mit einem 82cm Bildschirm, dolby surround-Klang und integriertem DVD-Player. Im ersten Programm lief eine Episode aus Xena, die Kriegerin, eine meiner Lieblingsserien; zwei ausgesprochen muskulöse Frauen, die Mieder aus Metall und Miniröcke aus Wildleder trugen, gingen mit Säbeln aufeinander los. »Deine Herrschaft hat schon viel zu lange gedauert, Tagrathâ!« schrie die Blonde. »Ich bin Xena, die Kriegerin der Ebenen des Westens!« Es klopfte an die Tür; ich stellte den Ton leiser.
Draußen war es inzwischen dunkel geworden. Der Wind bewegte sanft die regennassen Zweige hin und her. Eine junge Frau nordafrikanischen Typs von etwa fünfundzwanzig Jahren stand im Eingang. »Ich heiße Aïcha«, sagte sie. »Ich habe bei Monsieur Renault zweimal in der Woche geputzt. Ich komme, um meine Sachen abzuholen.«
»Ach so …«, sagte ich, »ach so …« Ich machte eine Geste, die einladend aussehen sollte, irgendeine Geste. Sie kam herein und warf einen kurzen Blick auf den Bildschirm: Die beiden Kriegerinnen kämpften jetzt mit bloßen Fäusten in unmittelbarer Nähe eines Vulkans; ich nehme an, daß dieser Anblick für manche Lesbierinnen eine gewisse aufreizende Wirkung hat. »Ich will Sie nicht stören«, sagte Aïcha, »es dauert nur ein paar Minuten.«
»Sie stören mich nicht«, sagte ich, »nichts kann mich im Grunde stören.« Sie nickte, als könne sie das verstehen, ihre Augen blieben einen Moment auf meinem Gesicht ruhen; sie versuchte vermutlich die äußerliche Ähnlichkeit mit meinem Vater zu erkennen, schloß vielleicht daraus auf eine gewisse moralische Ähnlichkeit. Nachdem sie mich ein paar Sekunden gemustert hatte, wandte sie sich um und ging die Treppe hinauf, die zu den Schlafzimmern führt. »Lassen Sie sich Zeit«, sagte ich mit erstickter Stimme, »lassen Sie sich ruhig Zeit …« Sie erwiderte nichts, verlangsamte nicht einmal den Schritt; wahrscheinlich hatte sie es nicht gehört. Erschöpft von der Begegnung, setzte ich mich wieder aufs Sofa. Ich hätte sie auffordern sollen, ihren Mantel abzulegen; normalerweise tut man das, fordert die Leute auf, ihren Mantel abzulegen. Da wurde mir bewußt, wie lausig kalt es in dem Raum war – eine feuchte, durchdringende Kälte, eine Grabeskälte. Ich wußte nicht, wie man die Heizung anstellt, hatte keine Lust, es auszuprobieren. Jetzt war mein Vater tot, und ich hätte sofort wieder wegfahren sollen. Ich wechselte gerade rechtzeitig zum dritten Programm, um die letzte Runde von Fragen an den Champion zu verfolgen. In dem Augenblick, als Nadège aus Le Val-Fourré zu Julien Lepers sagte, daß sie bereit sei, ihren Titel zum drittenmal aufs Spiel zu setzen, kam Aïcha mit einer leichten Reisetasche über der Schulter die Treppe hinunter. Ich stellte den Fernseher ab und ging schnell auf sie zu. »Ich habe Julien Lepers schon immer sehr bewundert«, sagte ich zu ihr. »Selbst wenn er die Stadt oder das Dorf, aus dem der Kandidat stammt, nicht direkt kennt, gelingt es ihm immer, ein paar Worte über das Departement oder die Gegend zu sagen; er besitzt eine zumindest ungefähre Kenntnis vom Klima und den Sehenswürdigkeiten der näheren Umgebung. Und vor allem kennt er das Leben: Die Kandidaten sind für ihn menschliche Wesen, er kennt ihre Schwierigkeiten und er kennt ihre Freuden. Nichts von dem, was die menschliche Wirklichkeit der Kandidaten ausmacht, ist ihm wirklich fremd oder stößt ihn ab. Ganz gleich, wer der Kandidat ist, es gelingt ihm immer, ihn etwas über seinen Beruf, seine Familie oder seine Leidenschaften erzählen zu lassen, also alles, was in seinen Augen ein Leben ausmacht. Ziemlich oft spielen die Kandidaten in einer Blaskapelle mit oder singen in einem Chor; sie opfern ihre Zeit für die Veranstaltung eines lokalen Festes oder stellen sich in den Dienst einer humanitären Sache. Ihre Kinder sitzen häufig unter den Zuschauern im Saal. Die Sendung vermittelt im allgemeinen den Eindruck, daß die Leute glücklich sind, und man selbst fühlt sich glücklicher und besser. Finden Sie nicht?«
Sie betrachtete mich, ohne zu lächeln. Ihr Haar war zu einem Knoten hochgesteckt, ihr Gesicht kaum geschminkt, ihre Kleidung eher nüchtern; eine seriöse junge Frau. Sie zögerte ein paar Sekunden, ehe sie mit leiser, durch die Schüchternheit etwas heiserer Stimme sagte: »Ich habe Ihren Vater sehr gemocht.« Ich wußte nicht, was ich ihr darauf erwidern sollte; das erschien mir zwar seltsam, aber durchaus möglich. Der alte Mann hatte sicher eine ganze Menge zu erzählen gehabt: Er war nach Kolumbien, nach Kenia oder was weiß ich wohin gereist; er hatte Gelegenheit gehabt, Nashörner mit dem Fernglas zu beobachten. Jedesmal wenn wir uns trafen, hatte er sich darauf beschränkt, ironische Bemerkungen über meinen Status als Beamter und über die Sicherheit, die damit verbunden war, zu machen. »Du hast den richtigen Job gewählt, um eine ruhige Kugel zu schieben …«, sagte er immer, ohne seine Verachtung zu verbergen; in einer Familie gibt es eben oft ein paar Schwierigkeiten. »Ich lasse mich zur Krankenschwester ausbilden«, fuhr Aïcha fort, »aber da ich von zu Hause weggegangen bin, bin ich gezwungen, als Putzfrau zu arbeiten.« Ich zermarterte mir das Hirn, um eine passende Antwort zu finden: Hätte ich sie über die Höhe der Mieten in Cherbourg befragen sollen? Ich entschloß mich schließlich für ein »Ja, ja …«, in das ich eine gewisse Lebenserfahrung hineinzulegen versuchte. Das schien ihr zu genügen, sie schritt zur Tür. Ich drückte das Gesicht an die Scheibe, um ihren VW Polo zu beobachten, der auf dem schlammigen Weg wendete. Im dritten Programm wurde ein Fernsehfilm gezeigt, der sich wohl im 19.Jahrhundert auf dem Land abspielte, mit Tchéky Karyo in der Rolle eines Landarbeiters. Zwischen zwei Klavierstunden gewährte die Tochter des Gutsherrn, der von Jean-Pierre Marielle dargestellt wurde, dem verführerischen Burschen vom Land gewisse Freiheiten. Ihre Liebesspiele fanden in einer Scheune statt; ich nickte in dem Augenblick ein, als Tchéky Karyo ihr energisch das Höschen aus Organza vom Leibe riß. Die letzte Einstellung, an die ich mich noch erinnerte, war ein Zwischenschnitt, eine kleine Gruppe von Schweinen.
Ich wurde vom Schmerz und der Kälte geweckt; ich muß wohl in einer verkehrten Stellung eingeschlafen sein, meine Halswirbel waren wie gelähmt. Ich hustete schwer, als ich aufstand; mein Atem erfüllte die eisige Atmosphäre des Raums mit feuchtem Dunst. Seltsamerweise lief im Fernsehen Ein toller Hecht, eine Sendung des ersten Programms; ich mußte wohl zwischendurch aufgewacht sein oder wenigstens soweit das Bewußtsein wiedergefunden haben, daß ich in der Lage gewesen war, die Fernbedienung zu betätigen; ich konnte mich absolut nicht daran erinnern. Die Nachtsendung war den Welsen gewidmet, riesigen Fischen ohne Schuppen, die in den französischen Flüssen aufgrund der Klimaerwärmung immer zahlreicher geworden sind; die Nähe von Atomkraftwerken mögen sie ganz besonders. Die Reportage bemühte sich, gewisse Mythen zu erhellen: Ausgewachsene Welse erreichen tatsächlich eine Länge von drei oder vier Metern; in der Drôme habe man sogar Exemplare gemeldet, die fünf Meter überstiegen; daran war nichts unwahrscheinlich. Dagegen sei es völlig ausgeschlossen, daß diese Fische das Verhalten von Fleischfressern zeigten oder badende Menschen angriffen. Der volkstümliche Argwohn, der die Welse umgab, schien sich in gewisser Weise auf jene auszudehnen, die es sich in den Kopf gesetzt hatten, sie zu angeln; die kleine Bruderschaft der Welsangler war in dem größeren Kreis der Angler scheel angesehen. Sie litten darunter und hatten offensichtlich den Wunsch, diese Sendung zu benutzen, um ihr negatives Image aufzubessern. Zugegeben, gastronomische Motive könnten sie keine geltend machen: Das Fleisch des Welses sei völlig ungenießbar. Aber es handele sich dabei um ein schönes Angelvergnügen, das sowohl Intelligenz wie Sportsgeist erfordere und durchaus mit dem Angeln von Hechten vergleichbar sei, und es verdiene, eine größere Anhängerschaft zu finden. Ich machte ein paar Schritte durch den Raum, ohne daß es mir gelang, mich aufzuwärmen; ich ertrug nicht den Gedanken, im Bett meines Vaters zu schlafen. Schließlich ging ich nach oben, um mir Kopfkissen und Decken zu holen, und versuchte, es mir so gut es ging auf dem Sofa bequem zu machen. Ich stellte den Fernseher kurz nach dem Abspann vom Ende des Mythos der Welse ab. Die Nacht war undurchdringlich, die Stille ebenfalls.
2
Alles geht irgendwann zu Ende, sogar die Nacht. Ich wurde durch Hauptmann Chaumonts klare, sonore Stimme aus einer echsenhaften Lethargie gerissen. Er entschuldigte sich, er habe keine Zeit gehabt, am Abend zuvor vorbeizukommen. Ich bot ihm einen Kaffe an. Während ich das Wasser aufsetzte, stellte er seinen Laptop auf den Küchentisch und schloß den Drucker an. Auf diese Weise könne ich meine Aussage noch einmal durchlesen und unterzeichnen, ehe er fortgehe; ich gab ein zustimmendes Murmeln von mir. Die Gendarmerie sei zu sehr mit Verwaltungsangelegenheiten eingedeckt, leide darunter, daß sie ihrer eigentlichen Aufgabe, der Ermittlung, nicht genügend Zeit widmen könne, sagte ich, das hätte ich verschiedenen Fernsehberichten entnommen. Diesmal stimmte er mir warmherzig zu. Das war mal eine Vernehmung, die unter guten Voraussetzungen begann und sich in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens abspielte. Windows setzte sich mit einem leisen, fröhlichen Geräusch in Gang.
Der Tod meines Vaters war am Abend oder in der Nacht des 14.November eingetreten. Ich hatte an jenem Tag gearbeitet; am 15. ebenfalls. Selbstverständlich hätte ich meinen Wagen nehmen, meinen Vater umbringen und in der Nacht wieder zurückfahren können. Was ich am Abend oder in der Nacht des 14.November getan hätte. Soweit ich weiß, nichts; nichts Besonderes. Auf jeden Fall konnte ich mich an nichts erinnern; dabei war das noch nicht einmal eine Woche her. Ich hatte weder einen festen Sexualpartner noch einen wirklich engen Freund; wie sollte ich mich unter diesen Bedingungen schon erinnern? Die Tage vergingen, das war alles. Ich warf Hauptmann Chaumont einen Blick des Bedauerns zu; ich hätte ihm gern geholfen, ihm irgendeinen Anhaltspunkt gegeben, der ihn weiterbrachte. »Ich sehe mal in meinem Terminkalender nach…«, sagte ich. Ich versprach mir nichts davon; seltsamerweise aber stand neben dem Datum des 14. eine Handynummer und darunter ein Vorname: »Coralie.« Was für eine Coralie? Dieser Terminkalender war wirklich das letzte.
»Ich habe ein Gehirn wie ein Haufen Scheiße…«, sagte ich mit einem enttäuschten Lächeln. »Ich weiß nicht, aber vielleicht war ich auf einer Vernissage.«
»Einer Vernissage?« Er wartete geduldig, wobei seine Finger ein paar Zentimeter über der Tastatur verharrten.
»Ja, ich arbeite im Kulturministerium. Ich stelle Dossiers zur Finanzierung von Ausstellungen oder Veranstaltungen zusammen.«
»Veranstaltungen?«
»Ja … zeitgenössischer Tanz oder ähnliches…« Mich überkam ein Gefühl der Verzweiflung, ich schämte mich zutiefst.
»Also kurz gesagt, Sie sind in der Kulturszene tätig.«
»Ja, so ist es … So kann man das sagen.« Er blickte mich mit einer Mischung aus Sympathie und Ernst an. Er wußte, daß es einen kulturellen Sektor gab, hatte davon eine reale, wenn auch undeutliche Vorstellung. Er hatte in seinem Beruf sicherlich mit allen möglichen Leuten zu tun; kein gesellschaftliches Milieu dürfte ihm völlig fremd sein. Die Gendarmerie ist ein Humanismus.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!