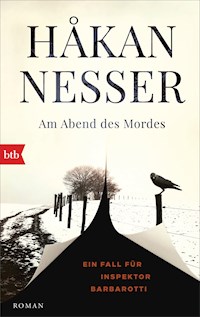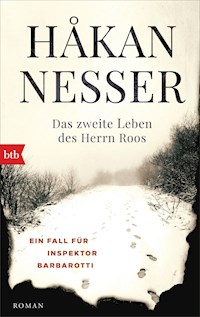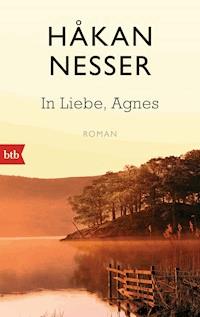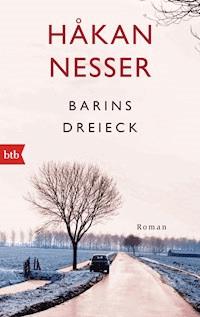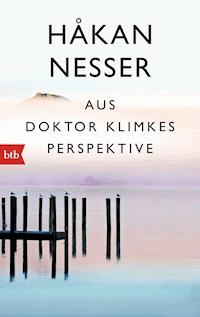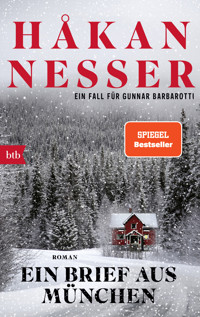
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gunnar Barbarotti
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Fall für Gunnar Barbarotti
Schweden, Weihnachten 2020: der bekannte Künstler Ludvig Rute lädt – den Einschränkungen der Coronapandemie zum Trotz – seine drei Geschwister samt Anhang über die Feiertage in ein abgelegenes Anwesen in der Nähe eines Waldes ein. Obwohl sie nicht wissen, was sie dort erwartet, sind sie von weit her angereist. Sie haben sich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen, die Atmosphäre ist angespannt. Es wird nicht besser, als der Gastgeber am Morgen des 25. Dezembers tot aufgefunden wird. Bei starkem Schneefall nehmen Gunnar Barbarotti und seine Kollegin und Ehefrau Eva Backman den Fall auf, der an einen alten englischen Kriminalroman erinnert. War es ein Bilderdieb, der in das Haus eingedrungen ist, oder kommt der Täter aus der Familie?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
Schweden, Weihnachten 2020: der bekannte Künstler Ludvig Rute lädt – den Einschränkungen der Coronapandemie zum Trotz – seine drei Geschwister samt Anhang über die Feiertage in ein abgelegenes Gehöft am Waldrand ein. Obwohl sie nicht wissen, was sie dort erwartet, sind sie von weit her angereist. Sie haben sich viele Jahre lang nicht gesehen, die Atmosphäre ist angespannt. Es wird nicht besser, als der Gastgeber am Morgen des 25. Dezembers tot aufgefunden wird. Bei starkem Schneefall nehmen Gunnar Barbarotti und seine Ehefrau Eva Backman den Fall auf, der an einen alten englischen Kriminalroman erinnert. War es ein Bilderdieb, der in das Haus eingedrungen ist, oder kommt der Täter aus der Familie?
Zum Autor
Håkan Nesser, geboren 1950, ist einer der beliebtesten Schriftsteller Schwedens. Für seine Kriminalromane erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, sie sind in über zwanzig Sprachen übersetzt und mehrmals erfolgreich verfilmt worden. Håkan Nesser lebt abwechselnd in Stockholm und auf Gotland.
Håkan Nesser
Ein Brief aus München
Roman
Aus dem Schwedischen von Paul Berf
Die schwedische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Det kom ett brev från München« im Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2023 by Håkan Nesser
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagmotiv: Wald: © jon-flobrant / unsplash und Haus: © tupungato / Depositphotos
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30485-0V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Einleitende Bemerkung
Die Stadt Kymlinge existiert nicht auf der Landkarte, ebenso wenig wie Sillingbo und die eine oder andere Straße in Oskarshamn. Casa Sotterhill wurde Ende 2012 bei einem Brand zerstört, an ihrem Standort befindet sich heute eine Anlage zur Gewinnung von Biokraftstoff aus Schlachtabfällen.
I
22. – 25. Dezember
1
Lars
Als Lars Rute zwei Tage vor Heiligabend im Jahr des Herrn 2020 an einer Tankstelle stand und den Tank füllte, erkannte er – in einem Augenblick kurzzeitiger Einsicht –, dass er auf praktisch alles wütend war.
Zwar nur diskret und insgeheim, im Einklang mit seinem zurückhaltenden Charakter. Aber trotzdem, wütend war er.
Auf seinen ältesten Bruder Ludvig, diesen egozentrischen und selbstverliebten Scheißkerl, der die Ursache dafür war, dass er bei Wind und Wetter an dem widerspenstigen Tankdeckel herumfummelte und zu vergessen versuchte, dass er pinkeln musste.
Auf seine Frau Ellen, die mit frisch lackierten Fingernägeln und einem Hörbuch auf den Ohren auf dem Beifahrersitz im Warmen saß und ihn zu dieser Fahrt quer durch das Land überredet hatte. Obwohl sich das Coronavirus wie ein Lauffeuer ausbreitete und alle aufgefordert worden waren, daheimzubleiben und Weihnachten mit den Topfpflanzen und der Katze und niemandem sonst zu feiern.
Auf das Virus selbst, Covid-19, das nun seit knapp einem Jahr wütete und ihn veranlasst hatte, mit der Faust auf den Tisch zu hauen und seine beiden Restaurants, die er lange Jahre erfolgreich betrieben hatte, deutlich unter Wert zu verkaufen.
Auf die staatliche Gesundheitsbehörde, diesen inkompetenten Haufen von zähen Onkeln und Tanten, der auf achtzehn Sendern täglich live eine Menge Kurven und Zahlen präsentierte, sich jedoch nicht dafür zu interessieren schien, dass die Leute draußen im richtigen Leben wie die Fliegen starben – in Seniorenheimen, auf überfüllten Intensivstationen und andernorts –, oder dass das Pflegepersonal Blut kotzte und am laufenden Band kündigte.
Und darüber hinaus, nachdem der Tankdeckel seinen Widerstand aufgegeben hatte und das schweineteure Benzin floss: auf eine Regierung, die nicht einmal fähig wäre, ein paar Mietshäuser zu verwalten, die mal zu diesem und mal zu jenem tendierte und sinnlose Ermahnungen furzte, die man nicht befolgen musste, wenn man keine Lust dazu hatte, wodurch Schweden zu den Ländern gehörte, die weltweit die meisten Coronatoten pro hunderttausend Einwohnern zu beklagen hatten.
Auf eine Masse Syrer, die in Södertälje und Umgebung riesige Feste mit großem Gedränge feierten und denen es vollkommen egal zu sein schien, dass sie das Virus wie Löwenzahnpollen auf das ganze Land verteilten.
Auf das Eishockeyteam von Oskarshamn, das er mit seinem teuer erarbeiteten Geld aus den Restaurants gesponsert hatte, als es ihnen tatsächlich gelungen war, sich in der Ersten Liga zu halten, das nun aber nicht weniger als dreizehn Spiele hintereinander verloren hatte. Glücklicherweise war es verboten, zu den Partien zu gehen, sodass es ihm wenigstens erspart blieb, auf der Ehrentribüne zu sitzen und gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Und nicht zuletzt: auf den Mundschutz, den Ellen besorgt hatte und den er nun aufzog, ehe er in den Laden ging, um zu pinkeln, das Benzin zu bezahlen und Kaffee zu kaufen. Im Toilettenspiegel erblickte er sich selbst und stellte fest, dass er aussah, als hätte er eine Kinderunterhose im Gesicht. Hellblau mit kleinen roten Walderdbeeren oder irgendeiner anderen verfluchten Sorte Beeren.
Ich habe es so satt, dachte Lars Rute und knöpfte den Hosenstall zu. Ich habe dieses Spektakel, das ein Leben sein soll, so verflucht satt.
»Hat alles geklappt?«, fragte Ellen, als er sich wieder auf den Fahrersitz gesetzt hatte.
»Sicher«, antwortete Lars. »Wie viele von diesen Masken hast du gekauft?«
»Zweihundert«, sagte Ellen. »Sie waren superbillig.«
»Das kann ich mir denken«, erwiderte Lars.
»Gestern hat sich das Blatt gewendet.«
»Hä?«, sagte Lars.
»Gestern war der dunkelste Tag des Jahres. Wir gehen helleren Zeiten entgegen.«
»Toll«, meinte Lars, verbrannte sich die Zunge am Kaffee und ließ den Wagen an.
Anschließend sagten sie viele Kilometer lang nichts. Aber die Dunkelheit legte sich um sie und ihren müden, alten Škoda, obwohl es gerade einmal drei, halb vier Uhr nachmittags war. Aus irgendeinem Grund musste Lars an ein anderes Weihnachtsfest denken, vor zehn Jahren oder so, als sie mit farbenfrohen Drinks in der Hand in Liegestühlen auf einem sonnigen Strand in Thailand gesessen hatten. Keine Sorgen, so weit das Auge und das Denken reichten. Ausgerechnet diese verdammte Erinnerung musste jetzt natürlich auftauchen.
»Ich finde wirklich, dass es interessant sein wird, ihn kennenzulernen«, verkündete Ellen, als in ihrem Hörbuch offenbar eine Pause entstanden war.
Das verkündete sie nun bereits zum vierten oder fünften Mal, seitdem das Ganze am Vortag aktuell geworden war, und Lars entgegnete nichts.
»Ich meine, er ist ja trotz allem dein Bruder, und ich bin ihm noch nie begegnet.«
Das stimmte. Lars und Ellen hatten sich 1996 kennengelernt, und im selben Jahr hatte Ludvig sich endgültig an der Côte d’Azur niedergelassen, und in den vierundzwanzig Jahren, die seither vergangen waren, hatten die Brüder keinen Kontakt mehr zueinander gehabt. Doch, ein paar Weihnachtskarten, der eine oder andere Gruß per Mail, aber nicht mehr.
Das hatte seine Gründe, so wie fast alles welche hatte.
Der Kontakt zu Lars’ anderen Geschwistern war ein wenig, aber nicht viel, besser gewesen. Ellen war ihnen jeweils zwei Mal begegnet. Flüchtig und ähnlich ungeplant, wie Zahnschmerzen eben kommen oder gehen; von so etwas wie einem Familienzusammenhalt konnte keine Rede sein.
Auch das hatte seine Gründe. Möglicherweise die gleichen.
»Schade nur, dass er so krank sein soll.«
Lars konnte sich ein Schnauben nicht verkneifen.
»Wir werden ja sehen, wie es sich damit verhält.«
»Wie meinst du das?«
»Ich meine nur, was ich sage. Dass wir es ja sehen werden.«
»Du denkst also, dass es nicht stimmt. Warum sollte sie behaupten, dass er krank ist, wenn er es gar nicht ist?«
Lars seufzte und machte Anstalten, einen Sattelschlepper zu überholen. Ellen schwieg, was sie immer tat, wenn er überholte. Als würde sie ein stilles Gebet sprechen, dass sie es vorbeischafften, bevor sie frontal mit einem anderen Sattelschlepper kollidierten. Ihm war aufgefallen, dass sie in diesen kritischen Sekunden manchmal auch die Augen schloss, so wie sie es sonst tat, wenn in einem Fernsehfilm oder im Kino eine grausige Szene begann.
Aber im Kino waren sie … er versuchte nachzurechnen … seit mindestens fünfzehn Jahren nicht mehr gewesen. Das Letzte, was sie seiner Erinnerung nach in einem richtigen Kinosaal gesehen hatten, war ein schwedischer Krimi mit Sven Wollter in der Hauptrolle gewesen, und das könnte sogar noch vor der Jahrtausendwende gewesen sein. Aber warum sollte man auch ins Kino gehen, wenn man es daheim bequemer hatte? Wo einem noch dazu der eklige Geruch von Popcorn erspart blieb.
Das Überholmanöver gelang, und Ellen öffnete wieder den Mund.
»Wir sind doch nur zu viert, also halten wir uns an die Empfehlungen der Gesundheitsbehörde.«
»Diese Empfehlungen«, sagte Lars.
»Außerdem passt es doch ganz gut, weil Lisa und Malcolm nicht zu uns kommen können, oder?«
Lars erkannte, dass es noch etwas gab, worauf er wütend war. Großbritannien. Ihre Tochter Lisa studierte seit zwei Jahren an der London University und war fast genauso lange mit einem gewissen Malcolm Innings zusammen. Das junge Paar hatte geplant, zu ihnen zu kommen und Weihnachten in Oskarshamn zu feiern. Doch die Pandemie hatte diesem Unterfangen natürlich ein paar Knüppel zwischen die Beine geworfen; wenn es ein Land auf der Welt gab, das noch schlechter darin war, mit dem Virus umzugehen, dann war dies England. Bis vor wenigen Tagen hatte es wenigstens noch Hoffnung gegeben, aber dann hatte man in der Grafschaft Kent eine neue Mutation gefunden, oder wo auch immer, und praktisch alle Länder in Europa hatten Einreisen aus dem Inselreich gestoppt. Sogar Schweden.
Außerdem hatte der größte Clown aller Zeiten, dieser Premierminister Johnson, auch bekannt als die gelbe Gummiente, die Absicht, das Land in einer guten Woche aus der EU zu stürzen. Mit Komplikationen, die so unüberschaubar waren wie die Rückseite des Mondes. Ja, verdammt, dachte Lars Rute und kleckerte Kaffee auf seinen Pullover, man sollte nach Tonga ziehen.
»Warum sagst du nichts? Wir sind immerhin auf dem Weg zu deinem Bruder?«
Lars dachte einen Moment nach.
»Was hat diese Frau, mit der du geredet hast, gesagt, wie sie heißt?«
»Sie heißt Catherine, das weißt du doch. Schließlich hast du den Brief gelesen.«
»Catherine, genau. Was meinst du, wie alt sie ist?«
»Welche Rolle spielt denn ihr Alter bei der Sache?«
»Keine Ahnung. Ludvig ist jedenfalls knapp sechzig.«
»Du meinst, dass sie um einiges jünger sein könnte?«
»Sie dürfte jedenfalls nicht älter sein als er.«
»Und?«
Jetzt war sie gereizt. Dass sie sich auf kurze Erwiderungen wie »Und?« beschränkte, war ein deutliches Zeichen. Er überlegte, ob er versuchen sollte, die Stimmung ein wenig aufzulockern, oder sie in der Schwebe hängen zu lassen, und entschied sich für eine etwas warmherzigere Linie. Zwei Feinde während der bevorstehenden Weihnachtstage – Ludvig und seine junge Lebensgefährtin – reichten ihm völlig. So hatte es tatsächlich in ihrem Brief gestanden: Ich bin seine Lebensgefährtin. Allein schon, dass sie offenbar Schwedisch sprach, erschien merkwürdig.
Aber, wie gesagt, sich mit diesen Widersachern herumschlagen zu müssen und es sich außerdem mit seiner Frau zu verderben, empfand er als … als so unnötig wie ein saures Sahnehäubchen auf dem Kuchen.
»Hatte sie wirklich keinen Akzent?«, fragte er.
Ellen beschloss, gnädig mit ihm zu sein.
»Einen kleinen vielleicht. Und dann natürlich einen französischen … aber wie alt sie ist, konnte ich nicht heraushören.«
»Nun ja, das wird sich zeigen«, erwiderte Lars. »Und du hast recht, es spielt natürlich keine Rolle. Hast du Hunger? Wollen wir irgendwo anhalten und ein Würstchen essen oder fahren wir durch? Es sind bestimmt noch drei Stunden … jedenfalls fast.«
»Du hättest dir doch eins kaufen können, als du getankt hast.«
»Ich habe keinen Hunger«, sagte Lars. »Ich habe gefragt, ob du hungrig bist.«
»Ich brauche im Moment auch nichts«, erklärte Ellen. »Wir haben ja die Brote gegessen. Wir haben auch noch Äpfel, möchtest du einen?«
Kaffee mit Apfel, dachte Lars Rute und lehnte das Angebot freundlich dankend ab.
»In Ordnung«, sagte Ellen und schaltete ihr Hörbuch wieder ein. »Ich finde es jedenfalls spannend, die beiden zu treffen. Ein Weihnachtsfest, das in Erinnerung bleiben wird, was immer passiert.«
Vielleicht ein wahres Wort, dachte Lars Rute.
Während der folgenden dunklen Kilometer in westliche Richtung dachte er tatsächlich an seinen ältesten Bruder, was auch sonst. Fünf Jahre lagen zwischen ihm und Ludvig, aber es war nicht der Altersunterschied, der von Bedeutung war. Es ging um die Menschenwürde. Das hatte er gedacht, seit er erwachsen genug war, um gewisse verborgene Mechanismen zu durchschauen. Zum Beispiel, wie groß oder klein der Raum war, auf den man ein Anrecht in dieser Welt hatte.
Der einem zugeteilt worden war. Maßgeschneidert, könnte man sagen.
So war es von Anfang an gewesen. Ludvig war der älteste Sohn, den die Eltern (will sagen Vater Leopold, für den ein wesentlich größeres Stück maßgeschneidert worden war als für Mutter Sylvi) als das Juwel in der Krone betrachteten.
Der Erbe. Lars hatte gelegentlich gehört, wie das Wort im Vertrauen benutzt worden war. Gott allein wusste, um welche Art von Erbe es dabei ging, aber das spielte auch keine Rolle. Aus Ludvig würde etwas Großes werden. Unklar was, aber groß.
Und wenn Ludvig der Kronprinz war, dann war sein Bruder Leif die Nummer zwei in der Thronfolge, das stand außer Frage. Vater Leopold hatte sich niemals Mühe gegeben, den Stand der Dinge abzumildern oder zu bemänteln, und Lars hatte seinen abgeschiedenen Platz in der Familie gefunden, noch ehe er richtig sprechen gelernt hatte. Im Nachhinein konnte er sich nicht erinnern, dass er jemals eigene Kleider besessen hatte, bis er in die Pubertät kam; sämtliche Hosen, Hemden, Jacken und Mützen waren von Ludvig und/oder Leif getragen worden, ehe sie bei ihm landeten. Gleiches galt für Unterwäsche und Schuhe. Nicht, weil die Familie sich keine Kleider leisten konnte, sondern weil es praktisch war.
Er hätte ein Mädchen sein sollen. So war es vorgesehen gewesen; nach zwei Prachtburschen wie Ludvig und Leif hatte man das Recht, das zu erwarten. Welchen Sinn sollte ein weiterer Junge in der Familie haben? Noch dazu ein schwächlicher, kleiner Typ, der quengelig und kränklich war und bis ins Alter von fünf Jahren ins Bett nässte. Was Robustheit und Umtriebigkeit anging, kam er nicht einmal ansatzweise in die Nähe seiner großen Brüder.
Und dann kam schließlich sie. Eine knappe Woche, nachdem er drei geworden war, ein Geburtstag, der sich in Luft auflöste, weil seine Mutter bereits auf der Entbindungsstation lag, um das ersehnte Engelskind zur Welt zu bringen. Ab dem darauffolgenden Jahr feierte man die beiden Geburtstage, seinen und den seiner Schwester, immer auf einen Schlag. Auch das war praktisch, und wer konnte daran herummäkeln, dass Louise stets mehr Geschenke bekam als er? War sie nicht sowohl ein Mädchen als auch die Jüngste? Abweichende Standpunkte hätten Kleinlichkeit bedeutet. In Familie Rute war man nicht kleinlich.
Also Louise. Sie kam am Tag der Morgenröte zur Welt, dem dritten Juli, und erhielt Aurora als zweiten Vornamen. Man schrieb das Jahr 1968, was bedeutete, dass das gesamte Geschwisterquartett in dasselbe Jahrzehnt eingeklemmt lag. Ludvig 1961, Leif 1963, Lars 1966, Louise 1969. Eine Glanztat von Mutter Sylvi und ihm selbst, wie Leopold Rute bei Essensgesellschaften und ähnlichen Zusammenkünften gern unterstrich.
In den Sechzigerjahren haben wir Kinder produziert. Verdammt, was haben wir uns ins Zeug gelegt. Ein Rute liegt nicht auf der faulen Haut, haha.
Der Nachname stammte aus einem Kirchspiel im Norden Gotlands, wo Leopold geboren und aufgewachsen war. Während des Ersten Weltkriegs, der Spanischen Grippe, Arbeit im Steinbruch und so weiter und so fort. Dinge, die den, der sie überlebt, abhärten.
Zum Teufel, dachte Lars Rute und überholte einen Traktor. Was hatte ein Traktor zwei Tage vor Heiligabend auf der Straße verloren? Außerdem Schneeregen und null Grad; laut Routenplaner sollte die Fahrt von Oskarshamn nach Sillingbo zirka sechs Stunden dauern, aber bei diesen Straßenverhältnissen musste man wohl eine Stunde drauflegen, wenn man mit heiler Haut ankommen wollte. Aber das war natürlich völlig egal, wenn man ohnehin nicht darauf erpicht war, überhaupt anzukommen.
Er kehrte zu seiner familiären Vergangenheit zurück. Es gab eine Erinnerung, die ein defining moment war, wie es auf Englisch hieß. Ein erhellender Moment, oder wie immer man es in der Landessprache nennen wollte. Lars hatte an der Hochschule in Örebro zwei Semester Englisch studiert, sein einziger entsprechender Einsatz in der postgymnasialen Welt, aber dann hatte er zwei Prüfungen hintereinander verpasst und stattdessen angefangen zu arbeiten. Die Sprache glaubte er dennoch zu beherrschen, was deutlich geworden war, als Ellen und er Lisa in London besucht hatten.
Der fragliche Moment war etwas länger als ein Moment gewesen, aber nicht viel. Er ereignete sich im Mai 1980, als Leopold Rute in Örebro im Krankenhaus lag und auf den Tod wartete. Ein üppig gestreuter Lungenkrebs war damals der Bösewicht im Drama gewesen, aber nachdem er fast vierzig Jahre ein starker Raucher gewesen war, zeigte sich nicht einmal Leopold selbst überrascht. Alles hat seine Zeit, auch Fabrikanten (Damen- und Herrenschuhe mit Kreppsohlen) vom alten Schlag, und als er begriff, dass es keine Frage von Wochen oder Monaten, sondern von Tagen oder vielleicht bloß Stunden war, hatte er die Familie um sein Sterbebett geschart. Also seine vier Kinder sowie Sylvi, die sie alle geboren hatte und seit Februar am Weinen war, nachdem sie begriff, was sich anbahnte, und die nun keine Tränen mehr übrig hatte. Ein bisschen musste sie sich noch für die Beerdigung aufsparen, Lars war sicher nicht der Einzige, der fand, dass ihr Gesicht aussah wie eine ausgepresste Zitrone. Für alle Fälle mit einer dunklen Brille versehen.
Letzteres war natürlich nebensächlich, aber Lars konnte sie noch heute, vierzig Jahre später, wie auf einem Foto vor sich sehen. Ein Mensch, der dabei war, sich aus dem Leben zu schrumpfen. Tatsächlich hatte sie dann mehrere Jahre benötigt, um ins Ziel zu kommen; der Mensch denkt, Gott lenkt.
Als der Krebs entdeckt wurde, vielleicht auch schon früher, hatte Leopold eine gewisse Demenz entwickelt; konnte das eine nicht wirklich vom anderen unterscheiden, Menschen, Geschehnisse, Vorfälle und anderes in der Art. Doch als er nun von seiner ganzen lieben Familie umgeben war – der so geliebten und bedeutend jüngeren Ehefrau, den Nachkommen, angefangen beim neunzehnjährigen Ludvig, der bald Abitur machen würde und ein außerordentlich schöner Jüngling war, bis zu der goldlockigen Prinzessin Louise, knapp zwölf –, konnte sich der sterbende Patriarch eine letzte zusammenfassende Betrachtung nicht verkneifen und gab jedem von ihnen ein paar Worte mit auf den Weg.
Lars war damals ein pickeliger und verzagter Vierzehnjähriger gewesen, außerdem Pollenallergiker und mit Druck auf der Blase, und hatte sich selbst mit seinem eigenen, eng begrenzten Maßstab gemessen ungewöhnlich unwohl in der Situation gefühlt.
»Ähääm!«, intonierte der Vater vom Sterbebett aus. »Da wir uns nun alle an diesem funkelnd schönen Januartag versammelt haben …«
Hier verlor er den Faden. Verdammt, es ist Mai, dachte Lars, und die anderen taten das sicher auch. Leopold räusperte sich erneut, setzte zu seiner Rede an und begann, kurz und kernig zusammenzufassen, welches Schicksal zu erwarten war – nicht für ihn selbst, denn das stand in den Sternen, sondern der Reihe nach für die übrigen Anwesenden: Ehefrau Sylvi (langes Leben in Saus und Braus), Ludvig (ein Künstler, der die Welt mit seinen Gemälden zum Staunen bringen würde), Leif (höchstwahrscheinlich innerhalb eines Jahrzehnts Rektor an einer unserer Universitäten … nota bene, höchstens eines Jahrzehnts), und dann … hier verlor er erneut den Faden und wirkte verwirrt.
»Aber was bist du für einer?«
Er stierte Lars an, der inzwischen äußerst kurz davor war, sich zu bepinkeln. Er wollte gerade den Mund öffnen und erklären, wer er war und wie er hieß, aber es war schon zu spät. Der Vater wedelte ihn mit einer schweifenden Armbewegung fort und richtete seinen Blick auf die kleine Louise, die Mutter Sylvis Hand hielt und so sehr lächelte, dass ihr das Gesicht wehtun musste – und mit diesem hübschen Anblick vor Augen setzte Leopold Rute zu einem verschlungenen Exposé über das Wesen der Frau an (zu gleichen Teilen unbegreiflich, schön, rätselhaft und beseelt, die Quintessenz des Lebens, ihre Augen, ihr Haar, ihr Duft, ihre Mystik, ihre Brüste und der Po …). An diesem Punkt ereilte ihn ein Hustenanfall, der ihn um ein Haar endgültig zum Schweigen gebracht hätte, aber offenbar bis in den Flur hinaus zu hören gewesen war, denn eine Krankenschwester hastete mit einer zweiten auf den Fersen herein, und der magische Moment war vorbei.
Man zerstreute sich. Lars fand eine Toilette und konnte sich endlich von dem Druck befreien, und am nächsten Morgen war Leopold Rute tot.
Aber seine Worte waren nie gestorben.
Was bist du für einer?
Er dachte an sie, und er träumte von ihnen. In seinen Träumen konnte der weitere Gang der Ereignisse kräftig variieren. Es kam vor, dass er sich in die Hose machte, sodass sich eine große, peinliche Pfütze auf dem Fußboden des Krankenhauses bildete. Oder dass er vortrat und seinem Vater aufs Maul schlug. Manchmal starb sein Vater an dem Schlag, und Lars landete im Gefängnis, manchmal schlug er zurück – unerwartet kräftig, wenn man bedachte, dass er im Sterben lag. Es kam sogar vor, dass Lars Flügel bekam und zum Fenster hinausflog, aber unabhängig davon, welche Variante sich aus der großzügigen Vorratskammer der Träume offenbarte, wachte er jedes Mal völlig ausgelaugt auf, so als hätte er am Vasalauf teilgenommen oder mit einem Bären gekämpft.
Doch nun zu Ludvig. Lars und Ellen waren nicht unterwegs zu seinem seit Langem toten Vater, sondern zu dem weltberühmten Maler Ludvig Rute.
Denn so hatten sich die Dinge tatsächlich entwickelt. Der mittlere Bruder Leif war niemals Rektor einer Universität und ebenso wenig Premierminister geworden – nur promovierter Dozent, was sicher auch nicht zu verachten war. Im Hinblick auf den Ältesten unter den Geschwistern hatte sich die Vorhersage des Vaters dagegen mit staunenswerter Treffsicherheit bewahrheitet. Zwar hatte Ludvig bereits früh künstlerische Neigungen und Ambitionen gezeigt, aber als er Abitur gemacht hatte und stehenden Fußes an einer privaten Malschule in Kopenhagen angenommen wurde – auf Grund von zwei eingeschickten Arbeitsproben, einem kleinen Ölgemälde mit Meeresmotiv und einem Aquarell von einem Waldsaum in der Gegend von Fjugesta –, gelangte sein Talent zu voller Blüte. Er malte Landschaften, Sonnenglitzer auf Wasser und verlassene Häuser, und er verkaufte. Stellte in Schweden und im Ausland aus, bekam Stipendien und öffentliche Aufträge und konnte schon als Fünfundzwanzigjähriger gut von seiner Kunst leben. Zehn Jahre nach dem Tod des Vaters war er so etabliert, dass er in drei Ländern lebte: Italien, Frankreich und Schweden (in seinem Heimatland allerdings nur zwei Monate, am liebsten in den Stockholmer Schären, das reichte völlig), und als Lars ihn das letzte Mal traf – Mittsommer 1995 –, waren die Preise für seine Gemälde derart in die Höhe geschossen, dass er vermutlich für den Rest seines Lebens von denen hätte leben können, die er zu diesem Zeitpunkt bereits gemalt hatte. Wenn ihm der Sinn danach gestanden hätte. Was natürlich nicht der Fall war, er malte weiter und wurde immer vermögender. Vor einigen Jahren hatte Lars in der Zeitung gelesen, dass ein Bild seines Bruders mit dem Titel Steine, Bäume für eine Million Kronen verkauft worden war.
Und wer würde sich unter diesen Umständen nicht an der Côte d’Azur niederlassen? Das Problem, dachte Lars in dem Moment, als ihn ein Straßenschild darüber informierte, dass es noch fünfunddreißig Kilometer bis Kymlinge waren, das Problem war nur, dass Ludvig ein selbstverliebter Scheißkerl war. Ein … er überlegte ein paar Kilometer, während die richtigen Worte zu ihm kamen … ein elitärer Drecksack mit einem klinischen Mangel an Empathie und Verständnis für die Lebensbedingungen anderer Menschen. Wem es nicht gelang, sich in dieser Welt zu behaupten, war schwachsinnig. Die meisten Menschen waren ohnehin Idioten. Die Demokratie war Opium fürs Volk. Hatte man vor seinem dreißigsten Geburtstag nicht ein paar Millionen gescheffelt, war man wahrscheinlich geistig minderbemittelt. Mitleid war identisch mit Schwäche. Künstler, die nicht von ihrer Kunst leben konnten, sollten lieber Fahrradboten oder Kommunalpolitiker werden.
Und so weiter in diesem Stil. Lars dachte häufig, selbst wenn das, was an jenem Abend und in der Nacht in Brevens bruk geschah, niemals geschehen wäre, hätte er dennoch das gleiche Verhältnis zu Ludvig gehabt. Mit ihm zusammen zu sein war wie Gonorrhö in der Seele. Lars hatte niemals Gonorrhö gehabt, weder in der Seele noch sonst wo, es war nur eine Redewendung, die er irgendwann aufgeschnappt hatte und in seinen Augen gut zu den Gefühlen passte, die sein berühmter Bruder in ihm auslöste. Und jetzt waren sie unterwegs, um in der Gesellschaft dieses unausstehlichen Narzissten Weihnachten zu feiern.
Krank?
Steckt in einer Art Krise?
So hatte es in dem Brief der Lebensgefährtin Catherine gestanden. Ludvig sei krank und schwermütig und wolle nach all den Jahren unbedingt seinen Bruder wiedersehen. Das Künstlerpaar hatte sich für den Winter ein altes Haus von einem Kollegen geliehen. In Sillingbo, einem kleinen Dorf im Nirgendwo, westlich in den schwedischen Fichtenwäldern; Ludvig hatte Sehnsucht nach seinem Heimatland zum Ausdruck gebracht. Wenn man auf der Suche nach einer sicheren Quarantänebehausung in Zeiten der Pest war, konnte man sich kaum etwas Geeigneteres vorstellen. Fernab der großen Straße, so sagte man wohl, hatte Catherine bemerkt. Und vier Personen konnten ja gemeinsam Weihnachten feiern, nicht wahr? Damit verstießen sie gegen keine der Empfehlungen. Nehmt deshalb bitte euer Auto und schaut bei uns vorbei! Vielleicht ist es die letzte Chance, sich noch einmal zu sehen, und Ludvig liegt wirklich viel daran. Wir sorgen für Essen und Trinken, ihr braucht nur eure Zahnbürsten und einen offenen Geist mitzubringen.
Einen offenen Geist?, hatte Lars gedacht. Was zum Teufel sollte das bedeuten? Vorbeischauen? Es waren mehr als fünfhundert Kilometer. Der Brief war am Freitag gekommen. Dem achtzehnten. Ellen hatte die angegebene Telefonnummer angerufen, als endgültig klar war, dass Lisa und Malcolm in London bleiben würden. Sie hatte ein paar Minuten mit dieser Catherine gesprochen, und so war es dann entschieden worden. Lars hatte damit nichts zu tun gehabt. Nicht das Geringste. Ging das Ganze zum Teufel, traf ihn keine Schuld.
»Wie weit ist es noch hinter Kymlinge?«, fragte Ellen plötzlich.
»Sechzig Kilometer«, antwortete Lars. »Ungefähr eine Stunde … in nordwestliche Richtung direkt in den Wald. Wenn wir noch eine Stunde weiterfahren, sind wir in Norwegen.«
»Die würden uns mit Sicherheit nicht ins Land lassen«, sagte Ellen. »Wegen der Pandemie, meine ich.«
»Wir probieren es erst gar nicht«, erwiderte Lars. »Ein Burger in Kymlinge?«
Ellen schüttelte den Kopf. »Uns erwartet bestimmt ein üppiges Essen, wenn wir ankommen.«
»Hat sie das gesagt, diese Catherine?«
»Ja, hat sie. Es wäre unhöflich, vollgestopft mit Junkfood bei ihnen anzukommen.«
»Na dann«, sagte Lars. »Sieh mal, jetzt fängt es richtig an zu schneien. Die letzten Kilometer müssen wir noch langsamer fahren.«
»Ich vertraue dir«, sagte Ellen und platzierte eine freundschaftliche Hand auf seinem Knie. »Ich möchte Weihnachten nicht im Straßengraben verbringen.«
»Heiligabend ist erst übermorgen«, rief Lars ihr in Erinnerung. »Sollte es so weit kommen, schaffen wir es noch rechtzeitig wieder aus ihm heraus.«
Sillingbo lag an einem Hang, der zu einem Wasserlauf abfiel – der sich in der Dunkelheit zwar nur erahnen ließ, aber mit Sicherheit da war –, und schien hauptsächlich aus einer Ansammlung vergessener Häuser zu bestehen, gleichmäßig und spärlich zu beiden Seiten der Durchgangsstraße verteilt. Außer einzelner Alibilampen herrschte in allen Wohnhäusern Dunkelheit, mit einer Ausnahme, es handelte sich um das letzte zur Rechten: ein größeres Holzgebäude mit zwei Stockwerken, etwa fünfzig Meter zum Wald hinauf gelegen. Darin brannte in allen Fenstern Licht, und eine Allee aus Wachsleuchten warf einen schwachen, flackernden Schein auf den Weg zu der Einfahrt zwischen zwei massigen Torpfosten.
»Da sind wir«, sagte Lars und bog ein. »Sieht aus wie eine alte Dorfschule.«
»Stimmt«, erwiderte Ellen. »Als wir telefoniert haben, hat sie so etwas erwähnt. Stell dir vor, dass es früher Kinder gegeben hat, die an diesem Ort Lesen und Rechnen gelernt haben. Das muss lange her sein.«
»Und die Schläge mit dem Rohrstock bekommen haben«, ergänzte Lars. »Der Schulbesuch war schon im neunzehnten Jahrhundert obligatorisch, da konnte es von zu Hause auch mal eine Stunde dauern, bis man ankam … und genauso lange zurück.«
»Warst du damals schon dabei?«, erkundigte sich Ellen.
Lars sparte sich eine Antwort, fuhr auf den unebenen, schneebedeckten Hof und parkte neben einem Auto, das schätzungsweise ein Jaguar war.
Und warum auch nicht?, dachte er mit einem überwältigenden Anflug von Ärger. Wahrscheinlich muss man schon dankbar sein, dass es kein Rolls Royce ist.
Die Haustür wurde aufgeschlagen, und eine Frau trat auf die beleuchtete Steintreppe hinaus. Sie trug ein langes rotes Kleid und eine ebenso rote Baskenmütze auf ihren dunklen Haaren und schien Mitte zwanzig zu sein. Deplatziert wie ein Mähdrescher in einer Kirche. Aber hübscher.
Zweifellos Catherine.
2
Linn
Ich bereute es ungefähr eine Sekunde, nachdem ich Ja gesagt hatte. Ich ließ mich Mutter zuliebe darauf ein, aber manchmal sollte sie mir wirklich etwas weniger leidtun. Als hätte ich keine eigenen Probleme.
Aber es ist natürlich ein Jahr gewesen, in dem alle den Halt verloren zu haben scheinen. Mehr oder weniger jedenfalls, und wenn dieser Impfstoff nicht ordentlich wirkt, weiß ich nicht, wie das alles enden soll. Vielleicht ist es tatsächlich ein Trost in all dem Elend, dass es nicht nur einem selbst schlecht geht, sondern auch die meisten anderen in einer Krise sind. Irgendwie ist man weniger einsam, wenn alle einsam sind.
Jedenfalls sind wir unterwegs. Bis vorgestern gingen Mutter und ich davon aus, dass wir Weihnachten zusammen feiern würden, nur sie und ich in ihrer Wohnung in der Verkstadsgatan, in der wir seit August zusammenleben. Aber dann kam der Anruf von Onkel Ludvig … oder von seiner Sekretärin oder was immer sie ist, keine Ahnung, Mutter hat mit ihr geredet.
Er wollte, dass wir für die Weihnachtstage zu ihnen kommen, der große Ludvig, darum ging es in dem Gespräch. Mutter zufolge war ihm viel daran gelegen, aber gleichzeitig war sie in dem Punkt ein wenig wortkarg und wollte auch hinterher nicht mehr erzählen. Ich habe es mir gespart, sie zu bedrängen, ich weiß, dass ich in einer seltsamen Familie gelandet bin.
Sie ließen also letzten Montag von sich hören. Heute ist Mittwoch, morgen Heiligabend. Das Auto, in dem wir sitzen, gehört einem Kollegen von Mutter. Wir haben es uns geliehen, denn ihren alten Toyota hat sie im Frühling verkauft, als der Geldmangel ungewöhnlich akut geworden war; als die Theater schlossen und sie begriff, dass sie ziemlich lange keinen Job bekommen würde. Und im Grunde braucht man ja auch kein Auto, wenn man in Stockholm lebt, ich selbst habe nicht einmal den Führerschein gemacht.
Aber jetzt sitze ich also mit ihr in diesem ziemlich schicken Auto (ich glaube, es ist ein Subaru), fahre durch ein dunkelgraues Schweden, das sich unter der Pandemie zusammenkauert, und kann es nicht lassen, an mein Leben zu denken. Ich glaube, es hat mit der Jahreszeit zu tun, nicht nur mit dem Virus, denn um Weihnachten und Neujahr herum wird von einem erwartet zu analysieren. Wie es gewesen ist und wohin man unterwegs ist und so. Wir haben einige Kilometer über alles Mögliche geredet, aber nachdem wir in Västerås getankt hatten, sind wir stumm geblieben. Wir kennen uns ja gut und sehen uns täglich, sodass es nicht viel Neues zu bereden gibt. Abgesehen von diesem unerwarteten Weihnachtsfest natürlich, das vor uns liegt, aber Mutter hat kein großes Interesse daran, darüber zu sprechen. Aus irgendeinem Grund. Aber ich bin wie gesagt nicht überrascht; die liebe Verwandtschaft ist irgendwie suspekt. Gelinde gesagt.
Also stecke ich mir Solomon Byrd in die Ohren und denke stattdessen über mich nach. Es ist ein Thema, das ich ziemlich leid bin, um nicht zu sagen total satthabe, aber es fällt mir dennoch schwer, nicht ständig darauf zurückzukommen. In zwei Monaten werde ich fünfundzwanzig, und das ist vielleicht eine Art Meilenstein. Ich weiß noch, was ich dachte, als ich fünfzehn war, in die Mittelstufe ging und fand, dass so ziemlich alles total nervig war. In zehn Jahren geht es mir gut. Ich werde meine Nerven und meine Grübeleien in den Griff bekommen und kapiert haben, wie man durchs Leben kommt. Vielleicht bin ich mit einem gut aussehenden und zuverlässigen Typen zusammen und möchte Kinder bekommen. Oder habe schon welche.
Sure. Wenn ich zurückblicke, muss ich zwar zugeben, dass es damals schlimmer war, aber zu behaupten, dass ich in diesem Jahrzehnt klug und vernünftig geworden bin, wäre eine Übertreibung. Manchmal denke ich, dass ich mich mein Leben lang mit dem Gehirn einer Fünfzehnjährigen herumschlagen muss. Und wenn das stimmt, ist es wohl das Beste, den Stand der Dinge zu akzeptieren und etwas daraus zu machen.
Meine beiden sogenannten Beziehungen waren jedenfalls Reinfälle. Erst die mit Klas, mit dem ich direkt nach dem Gymnasium zusammenzog, in eine verdammte Hütte, die er von seinem Großvater geerbt hatte. Meine Freunde zogen mit Rucksäcken durch die Gegend und entdeckten die Welt, ich landete in einem Wald in Södermanland. Wir hielten es acht, neun Wochen aus, in erster Linie, weil es Sommer war, dann machte ich Schluss und sah, wie schön Klas es fand, dass er nicht selbst den Schritt hatte tun müssen. Keiner von uns hatte einen Job, wir besaßen kein Auto, nur zwei alte Fahrräder ohne Gangschaltung, und wollten beide im Herbst an der Hochschule Södertörn studieren. Weil wir jung waren, hatten wir täglich Sex und radelten alle zwei Tage nach Gnesta und gingen einkaufen (vor allem Bier, Chips und Zigaretten), und das Konzept war so naiv, dass ich nur den Kopf schütteln kann, wenn ich heute daran zurückdenke.
Vielleicht lernte ich trotzdem etwas in dem Sommer und wurde immerhin nicht schwanger. Ungefähr drei Jahre später zog ich mit einem anderen Typen zusammen, Dieter, einem Kommilitonen im Fach Psychologie, und wir sind tatsächlich bis Juni zusammen gewesen, dann war das Semester vorbei und er zog nach Deutschland zurück, zu seinem Vater, der nach einem Autounfall gelähmt ist. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass Dieter und ich wieder zusammenkommen, aber ich bezweifle es. Wir haben uns immer noch gern, obwohl wir recht unterschiedlich sind, und wir waren beide supertraurig, als wir uns an einem regnerischen Nachmittag am Flughafen Arlanda trennten. Aber es vergeht immer mehr Zeit, ohne dass wir uns sprechen, und wenn ich seine Posts auf Insta lese, ahne ich inzwischen, dass er da unten in München etwas mit einer neuen Frau hat.
Im August habe ich das Psychologiestudium abgebrochen (oder mir zumindest eine Auszeit genommen). Möglicherweise hing es mit Dieter zusammen, aber auch damit, dass ich mir das Virus einfing. Es passierte schon Anfang Juli, als sonst kaum jemand krank wurde und manche glaubten, die Gefahr wäre vorbei. Trotz meines jungen Alters ging es mir ziemlich schlecht. Vielleicht habe ich die falsche Blutgruppe oder so, aber das wurde niemals richtig untersucht. Ich kam nicht ins Krankenhaus, aber mitten im Sommer bin ich einen Monat lang kaum aus dem Haus gegangen. Ich wohnte noch in der Wohnung auf Liljeholmen, die Dieter und ich zur Untermiete hatten, und hatte mir überlegt, mich im Herbst nach etwas Kleinerem und Billigerem umzuschauen, aber dann ergab es sich so, dass ich stattdessen bei Mutter einzog. Zum Glück nicht in mein altes Mädchenzimmer, weil Mutter ihre Wohnung in Alvik gegen eine in der Nähe von Hornstull getauscht hatte, als ich damals mit Klas in den Wäldern von Södermanland verschwand.
Aber der Juli im letzten Sommer war wirklich ein Elend. Mir ging es abwechselnd ziemlich oder total schlecht; Fieber, Gliederschmerzen, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, und sobald ich mich nur ein bisschen anstrengte, wurde ich müde. Nach einer Woche kam eine in Plastik gehüllte Krankenschwester zu mir nach Hause und testete mich, woraufhin zwei Tage später feststand, was ich längst wusste. Covid-19. Eine Freundin und Mutter gingen abwechselnd für mich einkaufen, ließen die Tüten vor der Tür stehen und riefen mich an. Sagten Hallo und Pass auf dich auf, wirkönnen ja nicht hereinkommen und dich umarmen, aber du wirst sehen, es geht bestimmt bald vorbei.
Es dauerte wie gesagt einen Monat, ich habe Antikörper, die hoffentlich für den Rest meines Lebens reichen, werde mich aber trotzdem impfen lassen, sobald ich die Chance dazu bekomme.
Es war Mutter, die mir vorschlug, eine Zeitlang bei ihr zu wohnen. Sie ist Schauspielerin ohne ein festes Engagement und hat seit Februar nicht mehr gearbeitet. Die Theater sind ja geschlossen. Genau wie Kinos und Konzertsäle, im Großen und Ganzen alles, was mit Kultur zu tun hat. Nach acht Uhr abends darf man in den Restaurants keinen Alkohol mehr bestellen, und treffen darf man sich höchstens zu acht, und so weiter und so fort, 2020 dürfte als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem fast alles zusammenbrach. Und gestern habe ich im Fernsehen gesehen, dass der Premierminister alle Schweden auffordert, Weihnachten nicht wie üblich zu feiern. Bleiben Sie zu Hause. Reisen Sie nicht zum Skilaufen in die Berge oder woandershin. Gehen Sie nicht in die Stadt, wenn Sie es nicht unbedingt müssen, kommunale Einrichtungen wie Hallenbäder und Sporthallen bleiben geschlossen, ja, mein Gott, es kommt einem fast vor wie eine Art Kriegszustand.
Und mitten in dem Ganzen sollen wir also quer durch Schweden fahren, um Weihnachten mit meinem Onkel Ludvig zu feiern, dem weltberühmten Maler, dem ich noch nie begegnet bin. Er wohnt eigentlich an der Côte d’Azur, hat für den Winter aber ein Haus in Schweden gemietet, weil er Heimweh hat.
Das waren Mutters Worte, als ich sie um eine Erklärung bat.
Er hat Heimweh, das kann auch berühmten Menschen passieren.
Sie mag ihn nicht, und ich frage mich, ob sie sich auf dieses bescheuerte Abenteuer nur eingelassen hat, weil es um Geld gehen könnte. Onkel Ludvig ist steinreich, und da er jetzt außerdem krank zu sein scheint, liegt es ja im Bereich des Möglichen, dass er warmherzige Gefühle für seine nicht so gut bemittelten Geschwister entwickelt hat. Zum Beispiel für Mutter. Ich habe noch zwei Onkel, denen ich auch nie begegnet bin, Leif und Lars, aber nur Mutter und ich sollen für ein paar Tage in Sillingbo zu Besuch kommen.
Ja, es heißt so – Sillingbo – das kleine Dorf ein, zwei Stunden von der norwegischen Grenze entfernt, in dem sich Ludvig und seine Sekretärin aufhalten. Weit weg von allem, ich habe auf Google Maps nachgesehen und es schien dort in jede Richtung nur kilometerweit Wald zu geben. Die Sekretärin, die möglicherweise eine Geliebte oder sogar Ehefrau ist, heißt übrigens Catherine. Eine Französin, aber sie spricht anscheinend Schwedisch, Mutter behauptet, sie habe fast keinen Akzent.
Ich kann es mir nicht verkneifen, auch ein wenig an meinen Vater zu denken, während wir durch die Winterdämmerung fahren. Oder eher über ihn zu spekulieren, denn ich weiß ja nicht, wer er ist. Oder war, was wahrscheinlicher sein dürfte. Zumindest, wenn ich Mutter Glauben schenke, aber genau das ist das Problem. Sie weigert sich, mir seine Identität zu enthüllen. Gesagt hat sie mir nur, dass er ein ziemlich unbekannter amerikanischer Schauspieler war, den sie kennenlernte, als sie drüben war und ihren einzigen Hollywoodfilm drehte. Ein paar Monate im Jahr 1995, im Frühjahr und Vorsommer, würde ich schätzen, wenn man bedenkt, dass ich im Februar des nächsten Jahres geboren wurde. Sie versuchte damals durchaus, weitere Rollen zu bekommen, vielleicht drehte sie auch ein paar Werbefilme, aber mehr als ein richtiger Spielfilm wurde nicht daraus. Er heißt Mrs Murphy agonizes, Mutter hat eine große Rolle, aber der Film ist nichts Besonderes und in Schweden nie gezeigt worden. Ich habe ihn dreimal gesehen, aber Mutter hat mir klipp und klar gesagt, dass es keinen Sinn hat, darin nach meinem Vater zu suchen. Er spielt nicht mit, die beiden lernten sich auf einer Party bei einem reichen Produzenten in Beverly Hills kennen und waren dann eine Weile zusammen. Dass sie ein Kind von ihm erwartete, begriff sie erst, als sie schon wieder in Schweden war.
Von Zeit zu Zeit bin ich natürlich sauer auf sie, weil sie mir nicht erzählt hat, wer er ist – oder, wie gesagt, war –, aber sie meint, sie hätten einen Deal, und man müsse zu seinem Wort stehen. Soweit ich weiß, lief dieser Deal darauf hinaus, dass er einmalig eine recht große Summe dafür überwies, dass sie im Gegenzug niemals seinen Namen verriete. Ich deute es so, dass er schon eine Familie hatte und in dieser Richtung weitermachen wollte.
Vielleicht wäre es möglich, ihn zu finden, aber ich habe beschlossen, es nicht zu versuchen. Auch ihren Deal zu respektieren. Zumindest vorerst, ich glaube nicht, dass er besonders reich war, sodass ich etwas von ihm erben könnte. Wenn er tot ist oder es in naher Zukunft sein wird.
Im Übrigen hatte ich für ein paar Jahre einen Stiefvater, ungefähr zwischen meinem fünften und zehnten Lebensjahr, aber Mutter und er kamen auf Dauer nicht miteinander aus, sodass er wieder von der Bildfläche verschwand.
Sie hat seither einige Typen ausprobiert, aber mit keinem von ihnen zusammengelebt, und keiner ist die Mühe wert gewesen. So beschreibt sie das Phänomen Beziehung gern. Sie bestehe im Allgemeinen aus zwei Bestandteilen: Vergnügen und Mühe. Das Vergnügen müsse größer sein, sonst könne man es vergessen.
Als sie fünfzig wurde, hielt sie eine Rede, in der sie erklärte, sie sei ledig, aber zu jeder Schandtat bereit, und wolle es auch in den nächsten vierzig Jahren bleiben. Alle, wir waren eine große Gruppe in einem Lokal auf Söder, lachten schallend und applaudierten natürlich, aber ich weiß, dass der Scherz voller Ernst und Tränen war. Ich liebe meine Mutter wirklich, und in diesem elenden Jahr, in dem sie so viele berufliche Rückschläge hinnehmen musste, hat sie mir wahnsinnig leidgetan. Ich hoffe, ich kann sie wenigstens ein bisschen trösten. Wie viel ist eine Schauspielerin wert, die nicht auf der Bühne oder vor einer Kamera stehen darf?
Wie viel ist ihre Tochter wert, die ihr Studium abgebrochen hat und nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anstellen soll?
Gute Fragen, wie man so sagt.
Man kann ja nicht ewig stumm herumsitzen, deshalb öffne ich irgendwo in der Gegend von Skövde den Mund.
»Aber was glaubst du eigentlich?«, sage ich. »Du und ich, ein Maler und seine Geliebte? ›O du fröhliche‹ und um den Weihnachtsbaum tanzen oder …?«
Mutter lacht auf.
»Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe Ludvig ja gar nicht richtig gekannt, als wir Kinder waren, das weißt du doch. Er ist acht Jahre älter als ich, er hätte genauso gut ein Onkel oder so sein können. Meine erste Erinnerung an ihn ist, dass er sauer auf mich ist, weil ich Eis auf sein Hemd geschmiert habe, da bin ich vier oder fünf gewesen. Ich habe geweint, und Mutter musste mich trösten.«
Die Geschichte höre ich nicht zum ersten Mal, lasse mir aber nichts anmerken.
»Also schon damals ein Miststück?«
»Jedenfalls egozentrisch«, antwortet Mutter. »Aber er war ja Vaters Kronprinz, und Menschen, die so behandelt werden, sind später selten sympathisch.«
»Bist du deshalb immer so gemein zu mir?«, sage ich. »Damit ich sympathisch werde und nicht glaube, dass ich wer bin?«
»Exakt«, sagt Mutter. »Du hast mir viel zu verdanken.«
»Im Grunde alles«, erwidere ich, und dann lachen wir eine Weile.
»Aber mal im Ernst«, sage ich anschließend und öffne eine Tüte Ahlgrens Bilar. »Ich begreife nicht, warum wir Onkel Hochnäsig ausgerechnet jetzt treffen sollen. Urplötzlich, mitten in der Pandemie und mit nur zwei Tagen Vorankündigung.«
»Ich auch nicht, das habe ich dir doch gesagt«, erwidert Mutter und nimmt sich eine Handvoll Schaumzuckerautos.
»Könnte es sein, dass er im Sterben liegt und uns sein ganzes Geld vermachen will?«
»Dream on, baby«, sagt Mutter und wirft sich die Autos in den Mund. »Immerhin müssen wir uns ein paar Tage nicht ums Essen kümmern. Aber wir sollten hier lieber keine Luftschlösser errichten.«
»Und diese Catherine?«, fahre ich fort. »Sag jetzt nicht, dass du keine Ahnung hast.«
Mutter kaut und denkt einen Moment nach.
»Ich nehme an, dass sie eine Art Partnerin ist. Sie sind jedenfalls nicht verheiratet. Ich habe ihn gestern gegoogelt, er ist nie verheiratet gewesen und hat keine Kinder. Aber der Öffentlichkeit geht er möglichst aus dem Weg. Wenn er überhaupt einmal auf einer Vernissage auftaucht, bleibt er meistens nur eine halbe Stunde. Was stand da noch … ja, genau, bei einer Retrospektive in Nizza letztes Jahr hat man seine Bilder für sechs Millionen Euro versichert. Es ging um achtzehn Gemälde.«
»Tja«, sage ich. »Ich könnte mir durchaus vorstellen, eins davon als Weihnachtsgeschenk anzunehmen. Das würde viele Probleme lösen.«
»Als ich Abitur gemacht habe, hat er mir eine Flasche Sekt und eine Tafel Schokolade geschenkt«, sagt Mutter. »Wir sollten also nicht zu viel erwarten.«
»Dann habt ihr euch damals gesehen?«
»Nein, er hat mir ein Paket geschickt.«
Ich schaue eine Weile in die Dunkelheit hinaus. Es ist erst drei, und es hat angefangen zu regnen. Oder ist das Schnee? Zwischendurch sieht es danach aus; vielleicht gibt es ja weiße Weihnachten, der Wetterbericht geht in die Richtung.
»Man kann sich seine Familie nicht aussuchen«, sage ich.
»Aber man kann sich von ihr abwenden«, sagt Mutter. »Das Recht kann einem keiner nehmen. Wir haben zumindest keine hochgeschraubten Erwartungen, das ist gut.«
»Das ist leider vollkommen richtig«, sage ich und seufze. »Es ist sicherer, ein Pessimist zu sein, dann wird man wenigstens nicht enttäuscht. Wie weit ist es noch?«
Mutter schaut auf das Navi.
»Eine Stunde und siebenundfünfzig Minuten. Mach ein Nickerchen.«
»Okay, aber du darfst nicht am Steuer einschlafen.«
»Ich bin hellwach wie ein Adler. Bin ich jemals am Steuer eingeschlafen?«
Ich antworte, dass dies etwas ist, was man nur einmal im Leben macht. Mutter tätschelt mein Knie, und ich klappe die Rückenlehne so weit nach hinten, wie es geht. Als ich die Augen schließe, merke ich jedoch, dass ich viel zu aufgedreht bin, um ein Auge zuzumachen.
Ich verstehe nicht ganz, wieso. Vielleicht hat es mit Mutter zu tun, sie ist nicht wie sonst. Aber das liegt natürlich an der Situation. Warum sollte sie wie sonst sein? Ist diese Reise für sie nicht genauso seltsam wie für mich?
Ich entscheide mich für diese letzte Schlussfolgerung. Werfe eine alte Playlist aus dem Gymnasium an und stelle mich schlafend.
Zwei Stunden später – ein paar Minuten nach fünf, es ist immer noch der Tag vor dem Tag, der dreiundzwanzigste Dezember – parken wir vor einem großen Holzhaus im Nirgendwo. In den meisten Fenstern brennt Licht, aber um uns herum steht der Wald dunkel und brütet vor sich hin. Die Kälte der Mittwinternacht ist streng, denke ich, und das passt ganz gut zur Wirklichkeit. Einzelne Schneeflocken schweben herab, und eine dünne Schicht bedeckt die Erde.
»Typisch«, sagt Mutter und macht den Motor aus.
»Was denn?«, sage ich.
»Dass sie zwei Autos haben müssen? Eins hätte ja wohl gereicht … vor allem, wo das eine ein Jaguar zu sein scheint. Ich hoffe nicht, dass sie außer uns noch andere eingeladen haben?«
»Aber haben sie nicht gesagt, dass wir nur zu viert sein werden?«
Mutter antwortet nicht. Stattdessen beißt sie sich auf die Lippe und starrt den Mann an, der soeben auf die Eingangstreppe herausgetreten ist. Er steht im trübgelben Lichtschein einer Wandlampe und sieht in meinen Augen aus wie eine Kreuzung aus unserem Premierminister und Graf Dracula.
3
Louise
Was tun wir hier?
Das war eine sehr berechtigte Frage, aber innerlich kollidierte sie mit diversen voreingenommenen Gedanken, die sich im Kreis drehten und zu nichts führten, und um sich die Kabbeleien zu ersparen, versuchte sie, sich auf den Ort zu konzentrieren, an dem sie gelandet war. Die ehemalige Schule von Sillingbo.
Sie war vermutlich zu Anfang des vorigen Jahrhunderts erbaut worden. Oder auch gegen Ende des vorletzten, aber sie hatte während der Stunden, die sie nun hier waren, keine Dokumentation gefunden. Das Einzige in dieser Art waren die beiden gerahmten Schwarz-Weiß-Fotos, die sie gerade entdeckt hatte. Sie hingen in dem großen, rustikal möblierten Eingangsflur an der Wand und zeigten zwei Gruppen von Schulkindern nebst Lehrerin. Das erste war laut Angabe 1926 entstanden, und Louise zählte sechzehn Kinder. In variierendem Alter zwischen sieben und zwölf, wie es aussah, sodass es sich vermutlich um sämtliche Schüler handelte. Ihre Namen wurden nicht genannt, aber die strenge Lehrerin mit gemusterter Haube und Schürze hieß Ester Hagsjö.
Die zweite Aufnahme war von 1958, umfasste eine Gruppe von nur sechs Kindern, wieder unterschiedlichen Alters, vier Jungen, zwei Mädchen. Dem Text am unteren Rand zufolge der letzte Jahrgang. Noch im selben Jahr hatte man die Schule geschlossen.
Der Name der Lehrerin: Ester Hagsjö.
Louise schauderte. Zweiunddreißig Jahre – wenigstens – in derselben kleinen Dorfschule. Ein Lebenswerk? Die strenge Frau war sich auf den beiden Bildern eigentümlich ähnlich, auf dem zweiten fehlten zwar Haube und Schürze, aber die Zeit hatte ihr offensichtlich wenig anhaben können. Als spielte es keine Rolle, ob der Zweite Weltkrieg vorbei war oder ein paar Jahre in der Zukunft lag. Kinder waren Kinder, sie mussten unterrichtet und erzogen werden, um zu anständigen Staatsbürgern heranzuwachsen. Wahrscheinlich waren einige auf dem späteren Foto noch am Leben. Dann waren sie heute zwischen siebzig und achtzig Jahre alt. Vielleicht wohnte noch jemand in der Gegend. Die Lehrerin war mit Sicherheit tot, da sie vor mehr als hundert Jahren auf die Welt gekommen sein musste.
In diesem grün gestrichenen Flur stand sie jetzt also. Es war zehn vor acht Uhr abends, nach wie vor der Tag vor dem Tag. Das Abendessen sollte um Punkt acht serviert werden, die anderen, auch Linn, die sich nach dem Duschen gern viel Zeit ließ, waren offensichtlich noch auf ihren Zimmern in der oberen Etage. Ausgenommen Catherine, die man in der Küche hantieren und vor sich hin singen hörte. Die Doppeltüren zu dem, was als Esszimmer bezeichnet wurde, waren geschlossen, aber von dort drang leise Klaviermusik an ihr Ohr.
Die Schulkinder hätten ihren Sinnen nicht getraut, wären sie heute vor Ort, dachte Louise.
Doch seit der segensreichen Zeit des Kreidestaubs und der Tintenfässer war ja auch mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen. Das gesamte Hausinnere hatte zweifellos eine radikale Veränderung durchlaufen. Heute gab es im Erdgeschoss: Esszimmer, Küche, den geräumigen Flur, in dem sie sich gerade aufhielt, sowie eine Galerie, was immer das bedeutete. Kostbare Gemälde, durfte man wohl annehmen. In der oberen Etage: ein von Bücherregalen gesäumter Korridor und ganze sechs Schlafzimmer. Alles war geschmackvoll eingerichtet und in einem guten Zustand; wenn sie nicht gewusst hätte, dass es eine alte Schule war, hätte sie auf einen Gasthof getippt.
Als die erste Verärgerung über Ludvigs dreiste Lüge verebbt war – dass sie also sieben Personen sein würden, die in diesem Kaff Weihnachten feiern sollten –, hatten Louise und Linn sich darauf geeinigt, das Beste aus der Situation zu machen. Zumindest fürs Erste. Es schien jedenfalls kein Problem zu sein, Abstand zu halten, falls jemand das verfluchte Virus in sich haben sollte. Sie und ihre Tochter teilten sich in der oberen Etage ein Giebelzimmer, ihr Bruder Lars war mit seiner Frau Ellen bereits am Vortag eingetroffen und bewohnte das andere. Ludvig und Catherine hatten, wenn sie recht sah, jeder eins der Zimmer dazwischen. Zwei Zimmer standen vorerst leer, aber ihr Bruder Leif war auf dem Weg. Gemeinsam nutzten sie zwei große Badezimmer und zwei separate Toiletten.
Ob es eine Verbindungstür zwischen dem großen Künstler und seiner Lebensgefährtin gab, war noch nicht untersucht worden. Es gab generell vieles, was nicht untersucht worden war; bei ihrer Ankunft hatte Ludvig sie in Empfang genommen, kurz erklärt, er sei dankbar, dass sie seinem Wunsch entsprochen hätten, und während des Essens werde er den eigentlichen Zweck des Ganzen näher erläutern. Er hatte außerdem bedauert, dass er gezwungen gewesen war, bei seiner Einladung die Unwahrheit zu sagen. Sie würden nicht nur ein Quartett, sondern ein Septett sein, da ein Bruder bereits am Vortag mit seiner Frau angekommen sei und auch der vierte im Bunde im Laufe des Abends erwartet werde. Allerdings ohne Begleitung. So sah es aus.
Er hatte ihnen Catherine vorgestellt, eine schöne, dunkelhaarige Frau um die dreißig, an der Louise, fast gegen ihren Willen, einen gewissen Gefallen gefunden hatte. Sie war zwar eine Spur theatralisch in Rot und Schwarz gekleidet, machte aber einen warmherzigen und freundlichen Eindruck. Sie hatte sich Linn auf der Stelle angenommen, was vielleicht ganz natürlich war, wenn man bedachte, dass kaum mehr als ein paar Jahre zwischen den beiden liegen konnten. Es stellte sich zudem heraus, dass das Haus Catherines Vater gehörte; er hatte es Ende der Achtzigerjahre gekauft, und da lag die Verbindung. Rickard Fryxell war Kunsthändler und Galerist und kannte Ludvig schon seit der Zeit, als dieser mit seinen Gemälden erste Erfolge in seinem Heimatland gefeiert hatte. Sie waren gleichalt, und Rickard hatte eine wichtige Rolle bei Ludvigs internationalen Erfolgen gespielt. Seit vielen Jahren verteilte er sein Leben und seine Aktivitäten auf Aix-en-Provence und Sillingbo. Ungefähr drei Monate Sillingbo, neun Monate in Aix. Catherine war in Schweden geboren worden, hatte ab dem Schulalter allerdings fast ausschließlich in Frankreich gelebt.
Louise hatte diese rudimentären Informationen von Linn und Ellen, der Frau von Lars, bekommen, mit der sie ein kurzes und kurz angebundenes Gespräch geführt hatte, ehe sie ihr Zimmer bezogen. Sie meinte sich zu erinnern, dass sie dieser Ellen zum zweiten Mal begegnete, und so wenig wie bei der vermuteten ersten Gelegenheit hatte sie sich diesmal ein Bild von Ellen machen können. Ein bisschen verschlossen vielleicht, möglicherweise schüchtern oder einfach von Natur aus zum Sicheren und Bodenständigen neigend. Ein Glas Wasser, wenn man gemein sein wollte. Oder vielleicht eine andere Art von Wasser, schoss es ihr durch den Kopf: das unergründliche, ein kleiner Waldsee, in dem unter der dunklen Oberfläche nichts sichtbar war. Aber diese Metapher stammte ehrlich gesagt aus einem ziemlich tristen Theaterstück, in dem sie vor vielen Jahren mitgewirkt hatte, als in diesem Land noch Theater gespielt wurde.
Apropos dunkle Oberflächen, es war natürlich vor allem Ludvig, der durchschaut werden musste. Du großer, sonderbarer Mistkerl, hatte sie gedacht, während sie in der Dusche stand und versuchte, eine neutrale Haltung einzunehmen, was zum Teufel ist der Sinn des Ganzen? Was hast du vor?
Aber wie sollte man etwas über einen Bruder wissen, der einem noch nie nahegestanden hatte und den man seit fünfundzwanzig Jahren nicht mehr gesehen hatte? War er zum Beispiel wirklich so schlecht dran, wie es aussah und Catherine es am Telefon angedeutet hatte?
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nach seinen kurzen Willkommensworten hatte er sich zurückgezogen, und auch wenn Louise ihn natürlich erkannt hatte, als er auf die Treppe hinausgetreten war und ihnen bei ihrer Ankunft ein wenig linkisch zugewunken hatte, hatte er doch wesentlich älter gewirkt, als er eigentlich war. Eher zwischen siebzig und achtzig als knapp sechzig.
Krank? Sterbenskrank?
Hauptsache, es geht nicht um Sotterhill, dachte sie. Nur das nicht. Sie schüttelte den Kopf und betrachtete die ernsten Schulkinder aus einer noch länger zurückliegenden Zeit. Keines von ihnen lächelte auch nur ansatzweise; vielleicht waren sie von Frau Hagsjö angewiesen worden, möglichst auszusehen, als ginge es um eine Beerdigung.
Aber dieses Weihnachten ist keine Beerdigung, hielt sie fest. Es ist eine Filmprobe, ein Vorsprechen, vor dem man nur einen kurzen Ausschnitt aus dem Drehbuch hatte lesen dürfen.
Und als sie gerade diese berufsbedingte Reflexion angestellt hatte, hörte sie Schritte auf der Treppe, und die Türen zum Esszimmer wurden von einer lächelnden Catherine aufgeschlagen.
Der Lebensgefährtin, dachte Louise. Stand das Wort noch im Wörterbuch? Alt und dehnbar war es jedenfalls.