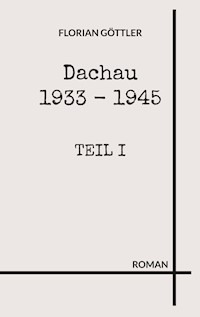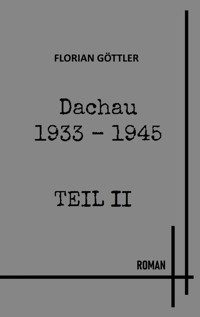4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Umweltzerstörung, Missbrauch, Gier, Erpressung. Mord. Mit diesem furiosen Thriller räumt Florian Göttler radikal auf mit der Vorstellung vom beschaulichen Landleben. Ein brutaler, realistischer und gesellschaftskritischer Roman, der die Grenze zwischen Gut und Böse verwischt und in dem es kaum jemanden gibt, der sich nicht schuldig macht. Ein Polizist, der die Schnauze voll hat von der Großstadt und aufs Land zieht. Eine Killerin, die aussteigen will und nach ihrem finalen Coup in einem kleinen Dorf strandet. Eine Bürgermeisterstochter, die bereit ist, mit allen Mitteln die Zerstörung eines Waldes zu verhindern. Im Dorf Himmelreich kreuzen sich ihre Wege mit katastrophalen Folgen. Kriminalkommissar Jonas Hofmann zieht nach einem traumatisierenden Erlebnis aufs Land, um der Gleichgültigkeit und Anonymität der Großstadt zu entfliehen. Entsetzt muss er feststellen, dass die brutalsten Facetten der menschlichen Natur dort längst auf ihn warten. Hat jeder, der ein Verbrechen begeht, Strafe verdient? Darf man das Recht in die eigene Hand nehmen, wenn das Ziel edel genug ist? Heiligt der Zweck, wenn er gut genug ist, jedes noch so abscheuliche Mittel? Natürlich nicht! Oder doch? Wie weit sind Menschen bereit zu gehen, wenn sich ihnen plötzlich die Gelegenheit bietet, für die Gerechtigkeit extreme Methoden einzusetzen ohne entdeckt zu werden? Wie weit würden Sie gehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Kriminalkommissar Jonas Hofmann zieht nach einem traumatisierenden Erlebnis aufs Land, um der Gleichgültigkeit und Anonymität der Großstadt zu entfliehen. Entsetzt muss er feststellen, dass die brutalsten Facetten der menschlichen Natur dort längst auf ihn warten.
Hat jeder, der ein Verbrechen begeht, Strafe verdient? Darf man das Recht in die eigene Hand nehmen, wenn das Ziel edel genug ist? Heiligt der Zweck, wenn er gut genug ist, jedes noch so abscheuliche Mittel? Natürlich nicht! Oder doch?
Wie weit sind Menschen bereit zu gehen, wenn sich ihnen plötzlich die Gelegenheit bietet, für die Gerechtigkeit extreme Methoden einzusetzen ohne entdeckt zu werden?
Wie weit würden Sie gehen?
Autor
Florian Göttler, 1977 in Dachau geboren, beschäftigte sich als Student der Politologie und Soziologie vor allem mit der Frage: Wie sind Recht und Gerechtigkeit in Einklang zu bringen? Als ehemaligem Gerichtsreporter an einem kleinen Amtsgericht auf dem Land ist ihm nichts Menschliches fremd. 2018 veröffentlichte er sein Erstlingswerk ‚Voll aufs Maul’, eine Satire, die mehr als ein Geheimtipp ist. Nun richtet der Autor den Fokus auf die brennenden Themen unserer Zeit: Umweltzerstörung, Wachstumswahn, Geldgier und falsche Heimatliebe – und blickt tief hinein in die dunklen Abgründe des menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns.
Für Marie-Theres
Inhaltsverzeichnis
Intro
Erste Strophe
Zweite Strophe
Zwischenspiel/Solo
Dritte Strophe
Klimax
Outro
Dank
Intro
Ein Tag Anfang Juli
Ein BMW rast über die Himmelreicher Hauptstraße und biegt mit quietschenden Reifen auf einen Schotterweg ab. Der Mann hinterm Lenkrad hat Mühe, das Auto auf der schmalen Piste zu halten. Er hält sein Handy ans Ohr und brüllt: „Wir brauchen Blut. AB negativ.“ Er steuert den Wagen in eine enge Kurve und gibt wieder Gas. Kies und Schotter spritzen in das Maisfeld neben dem Weg. „Ich bin Arzt. Ich weiß, dass AB negativ selten ist. Aber wir brauchen es. Sonst stirbt mein Freund. Also schaffen Sie es ran. Und zwar schnell.“ Er wirft das Handy auf den Beifahrersitz und jagt den BMW weiter über die Schotterpiste. „Arschloch“, zischt er und drückt noch fester aufs Gaspedal.
Oben auf dem Hügel stehen zwei Autos. Der Arzt hält an, greift nach seiner Medizintasche im Fußraum des Beifahrersitzes und springt aus dem Wagen. Er läuft an einem geparkten Auto vorbei. Vor der Kühlerhaube liegt eine Frau im Schotter. Blut quillt aus ihrem Mund. Ihre Arme und Beine zucken. Sie ist ihm egal. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt dem Mann, der einen Meter weiter auf dem Feldweg liegt und verzweifelt an zwei Gürteln zerrt, die er sich um sein linkes Bein geschlungen hat. Aus einer Wunde am Oberschenkel quillt hellrotes Blut. Der Arzt läuft zu ihm und drückt seine Hand fest auf die Wunde.
Der Mann stöhnt auf vor Schmerz. Er nuschelt: „Wurde auch Zeit, dass du kommst. Wie sieht es aus?“
„Bist bisschen blass um die Nase. Aber wir kriegen dich schon wieder hin. Das Blut ist unterwegs.“
Die Augenlider des Verletzten beginnen zu flattern. „Ich kann nicht mehr wach bleiben“, flüstert er.
„Du wirst mir hier nicht unter den Händen verrecken. Nicht in diesem Dreckskaff“, brüllt ihn der Arzt an.
Der Verletzte lächelt sanft: „Wäre doch ein krasses Ende für dein Bühnenprogramm.“ Von der Hauptstraße nähert sich der Lärm mehrerer Sirenen. Der Verletzte hört sie nicht mehr. Er schließt die Augen.
Der Arzt prüft den Puls seines Freundes. Er ist schwach und unregelmäßig. Aber noch da. Noch.
„Verdammte Scheiße, wo bist du da nur hingezogen?“, flucht der Arzt.
Erste Strophe
April
Bei zwanzigfacher Vergrößerung wirkte es als stünde der Rehbock keine fünf Meter vor ihr. Anna Kammergruber betrachtete das Gehörn des Tiers. Sie schätzte es auf gut 25 Zentimeter. Die Vordersprosse am linken Horn war abgebrochen. Trotzdem war der Bock ein Prachtkerl. Etwa 80 Zentimeter Schulterhöhe. Könnte knapp 30 Kilo wiegen. Der Bock äste an den Zweigen einer jungen Fichte. Langsam wanderte das Fadenkreuz nach unten. Über wache Augen. Über das in der Abendsonne rotbraun glänzende Fell am Hals. Über starke Vorderläufe. Links auf der Brust entdeckte Anna eine Narbe. Sie zeugte vielleicht von einem aus dem Ruder gelaufenen Kampf mit einem Artgenossen. Einen so großen und starken Bock hatte sie noch nie im Visier gehabt. Anna konzentrierte sich, beruhigte ihre Atmung und berührte mit dem Zeigefinger den Abzug. Mit dem rechten Daumen löste sie die Sicherung des Gewehrs. Sie erhöhte den Druck auf den Abzug. Atmete ein und langsam aus.
Der Rehbock hörte den Knall nicht. Die Kugel war schneller als der Schall. Er war tot, bevor er auf den Boden stürzte.
Als Anna die morschen Stufen des Hochsitzes hinabstieg, stemmte sich Johann Kammergruber aus seinem Sessel im Wohnzimmer und ging den unvermeidlichen Gang zur Hausbar. Wie oft hatte er sich vorgenommen endlich mit dem Trinken aufzuhören? Seine Akten ohne Drink zu studieren. Die von seiner Vorzimmerdame feinsäuberlich in Unterschriftsmappen einsortierten Dokumente nicht betrunken, sondern nüchtern zu unterschreiben. Oder einfach fernzusehen ohne sich mit Hochprozentigem zu besaufen? Aber so oft er sich vornahm nicht zu trinken, soff er über seinen Vorsatz hinweg. Jeden Abend setzte sich Johann Kammergruber in seinen Sessel. Und jeden Abend sprang er keine fünf Minuten später auf, um sich einen Drink einzugießen. Jeden verfluchten Abend seit 13 gottverdammten Jahren.
Vielleicht würde es helfen das Foto von der Wand zu nehmen. Aber da war er sich nicht sicher. Er bevorzugte die Ungewissheit. Lieber weiter trinken und das Foto an der Wand hängen lassen. Das war immer noch besser als das Foto abzunehmen und festzustellen, dass er trotzdem weiter trank.
Johann Kammergruber öffnete den kleinen Kühlschrank der Hausbar, dann das Eisfach und entnahm ihm eine Flasche Linie Aquavit und eine Plastikschale mit Eiswürfeln. Er drückte vier Eiswürfel in ein Glas und goss fünf Finger Aquavit hinein. Er nahm das Glas, setzte sich in den Sessel, trank einen Schluck und schlug eine Dokumentenmappe auf: Bebauungsplan für die Gemarkung 3/142, genannt Kiemer Holz. Es handelte sich um die Niederschrift dessen, was sie gestern Abend drei Stunden lang in der Gemeinderatssitzung diskutiert und beschlossen hatten. Die Protokollantin hatte gut und schnell gearbeitet. Sie hatte die wesentlichen Argumente zusammengefasst, den Beschluss wörtlich protokolliert und ihm nun zur Unterschrift mitgegeben. Johann Kammergruber zog den Füllfederhalter, den die Protokollantin an die Klappe der Dokumentenmappe geheftet hatte. Er gab sich Mühe, seine Signatur möglichst schwungvoll zu hinterlassen. Immerhin handelte es sich um die bedeutendste Unterschrift, die er in seinem Leben leisten würde. Diese Unterschrift würde die Gemeinde Himmelreich für immer verändern. Es war ihm egal. Viele Jahre lang war es ihm nicht egal gewesen aber jetzt schon. Sollen sie doch endlich bekommen, was sie schon so lange wollen, sagte er sich. Mir fehlt die Kraft, mich gegen sie zu stellen. Ich habe keine Kraft mehr. Nur noch Durst. Aber wenn sie jetzt bekamen, wonach sie so lange gierten, dann würde er seinen Schnitt machen. Nicht für sich. Für Anna. Umsonst ist nur der Tod. Und tot bin ich noch nicht.
Die Unterschrift galt nicht dem Wohl der Gemeinde. Sie galt allein Anna. Johann Kammergruber nahm einen Schluck Aquavit, räusperte sich und unterzeichnete. Er klappte die Mappe zu und legte sie auf den Beistelltisch. Dann hob er sein Glas. „Du hast gerade deine Heimat verkauft.“ Er blickte auf das Foto seiner verstorbenen Frau. Hielt ihrem Blick nicht stand. Sah aus dem Fenster. Die Spiegelung im Glas prostete ihm zu. „Gut gemacht“, flüsterte sie. „Du machst einen guten Schnitt dabei. Du hast es verdient. Anna hat es verdient.“
„Grüß dich Papa, du wirst nicht glauben, was ich heute erlegt habe.“
Johann Kammergruber erschrak. Er überlegte, ob er Zeit hatte, den Drink vor seiner Tochter zu verstecken. Aber Anna stand schon in der Tür. Sie trat ein und drückte ihrem Vater einen Kuss auf die Stirn. Dann setzte sie sich neben ihn auf die gepolsterte Lehne des Sessels.
„Was ist denn das schon wieder? Du arbeitest zu viel.“ Anna deutete auf die Akten.
„Das ist doch keine Arbeit. Nur ein paar Unterschriften. Jetzt erzähl. Was hast du erlebt?“
„Nicht erlebt. Erlegt! Einen Bock mit 30 Kilo. Aus gut 70 Metern. Droben im Kiemer Holz. Da ist der Wildverbiss gerade so arg, dass sich der Seidlbauer schon beim Jagdverband über mich beschwert hat. Ich muss wohl noch ein paar Rehe rausnehmen, sonst beißen die da oben tatsächlich noch alle Jungfichten zusammen.“
„Gratulation. Ich bin stolz auf dich.“ Kammergruber drückte seiner Tochter einen Kuss auf die Stirn. „Ganz die Mama“, sagte er wehmütig.
„Der Bock war so schwer, dass ich den Boris gebeten hab, ihn runter zu bringen. Er kommt nachher vorbei.“
„Kraft genug hat der Lackl ja. Aber vielleicht verläuft er sich im Wald.“
Anna gab ihrem Vater einen Klaps auf die Schulter. „Ach Papa, der Boris ist nicht dumm. Er ist pragmatisch.“
„Nicht dumm? Er ist bei der Gesellenprüfung durchgefallen. Zweimal. Als Gartenbauer.“
„Mir doch egal. Ich mag ihn.“ Anna stand auf und stellte sich mit verschränkten Armen vor ihren Vater. Sie wusste, was nun kommen würde und wappnete sich. Mit ihren knapp 160 Zentimetern überragte sie ihren sitzenden Vater nur um wenige Zentimeter. „Na schön, Papa. Leg los.“
„Anna, der Junge ist nichts für dich. Er ist dumm. Und vorbestraft. Du hast einen Besseren verdient.“
„Das ist erstens arrogant und zweitens will ich ihn ja auch nicht heiraten. Das weißt du. Ich habe es dir schon hundertmal gesagt. Und Boris weiß das auch. Ich habe es ihm gesagt.“
„Wie hat er reagiert?“
„Ich weiß nicht, ob er es richtig verstanden hat.“
Johann Kammergruber verdrehte resignierend die Augen.
Anna musste schmunzeln. Sie gab ihre konfrontative Haltung auf und hockte sich vor ihren Vater auf den Teppich. Anna legte ihre rechte Hand auf Kammergrubers linke Hand, die leicht zitternd auf der Sessellehne lag. Sie blickte ihm in die Augen. Es waren müde Augen. Traurige Augen. Rotgeädert und mit großen Tränensäcken darunter. In seinem linken Auge musste vor kurzem ein Äderchen geplatzt sein. Die untere Hälfte des Augapfels war blutunterlaufen.
‚Die Augen eines alten Mannes’, dachte Anna. Dabei war ihr Vater erst 55. „Du musst weniger trinken“, sagte sie und streichelte seine Hand.
„Ich kann nicht. Wenn ich nicht trinke, tut es zu sehr weh.“
Anna streichelte weiter die Hand ihres Vaters. „Mir tut es auch weh. Aber es ist jetzt 13 Jahre her.“
„Aber mich schmerzt nicht nur, dass sie nicht mehr da ist.“ Johann Kammergruber blickte auf das Foto seiner Frau. „Mich schmerzt auch, was danach aus mir geworden ist. Ich bin ein gebrochener und schwacher alter Mann.“
Anna erschrak bei diesen Worten. Sie drückte die Hand ihres Vaters. „Aber das stimmt doch nicht. Du bist Bürgermeister. Der Beste weit und breit.“
„Ach ja?“, seufzte Johann Kammergruber.
„Ganz bestimmt. Du weißt genau, was ich meine. Schau dir die anderen Dörfer hier in der Gegend an mit ihren Gewerbeparks und riesigen Neubaugebieten. Sie alle haben ihre Seele verkauft. Und wofür? Nur damit ein paar reiche Bauern noch reicher werden. Aber du hast das hier in Himmelreich nicht zugelassen. Du bist anders, Papa. Du bist besser.“
„Es freut mich, dass du mich so siehst, meine liebe Anna.“ Johann Kammergruber stand auf und ging zur Bar. Nicht nur um seine Lust auf einen weiteren Drink zu stillen, sondern weil er plötzlich das Bedürfnis nach Distanz zu seiner Tochter hatte. Er brauchte die Distanz, um auszusprechen, was er ihr sagen musste. Er goss sich einen Drink ein, nahm einen Schluck und wandte sich zu Anna. Sie saß auf dem Teppich und schaute ihren Vater liebevoll an.
Johann Kammergruber atmete tief ein und sagte: „Wir werden das Kiemer Holz bebauen.“
Anna sagte nichts. Sie blickte ihren Vater verständnislos an. So als hätte er in einer fremden Sprache zu ihr gesprochen.
Kammergruber nahm einen weiteren Schluck. „Verstehst du nicht, was ich dir sage? Wir werden den Wald abholzen und bebauen. Ich habe den Gemeinderatsbeschluss gerade unterschrieben.“ Er deutete auf die Dokumentenmappe auf dem Beistelltisch. „Da drin liegt er.“
Anna sah ihren Vater ausdruckslos an. Allmählich veränderten sich ihre Gesichtszüge. Liebe, Mitgefühl und Milde wichen einer stählernen Härte, die Johann Kammergruber bisher erst einmal im Leben im Gesicht seiner jungen Tochter gesehen hatte.
Damals am 23.11.2006 im Audacher Amtsgericht, Sitzungssaal II. Andreas Hassler war gerade vom Verdacht der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Hassler war dem Gutachten der Sachverständigen zufolge am frühen Abend des 16. April 2006 in seinem Mercedes AMG mit etwa 140 Stundenkilometern über die Himmelreicher Landstraße gerast und hatte eine grün gekleidete Jägerin frontal erfasst. Andreas Hassler war der Mann, der Rosi Kammergruber 121 Knochenbrüche beigebracht hatte, die multiplen Schädelfrakturen nicht mitgezählt. Er war der Mann, der einfach weitergefahren war, als wäre nichts passiert. Als ob sich die Welt für Johann und Anna Kammergruber nicht von einer Sekunde auf die andere komplett verändert hätte. Damals im Sitzungssaal II des Audacher Amtsgerichts, als Andreas Hassler freigesprochen wurde, weil der Richter nicht zweifelsfrei feststellen wollte oder konnte, ob Hassler tatsächlich hinterm Steuer des Mordwagens gesessen hatte oder doch ein unbekannter Anderer, damals hatte Anna, dieses bis vor einem halben Jahr noch so fröhliche und glückliche Mädchen von neun Jahren, das neben seinem Vater gebückt auf der für die Nebenkläger vorgesehenen Holzbank saß, so eiskalt und hasserfüllt dreingeblickt, wie sie es jetzt tat.
„Du hast das Kiemer Holz zur Bebauung freigegeben?“, fragte Anna ungläubig, als hätte ihr Vater das gerade nicht bereits zweimal gesagt.
„Ja, das habe ich“, nickte ihr Vater und trank sein Glas aus.
„Du verkaufst unsere Heimat? Du verscherbelst sie an irgendwelche gierigen Investoren?“
Kammergruber hob beschwichtigend die Hände. „Nicht ich verkaufe das Kiemer Holz, sondern Christian Seidlbauer. Es ist sein Wald. Es ist sein Grund und Boden. Ich als Bürgermeister gebe das Gebiet nur zur Bebauung frei. Der Gemeinderat hat es so entschieden.“
„Das ist ja wohl scheißegal“, rief Anna. „Das Kiemer Holz gehört uns allen. Der Wald ist hundertmal älter als jeder von euch alten Säcken. Und ihr wollt ihn einfach plattmachen und zubetonieren? Das kann doch nicht euer Ernst sein.“
„Liebe Anna, du musst verstehen.“
„Nix da. Ich muss gar nichts verstehen.“ Anna sprang auf. Sie ging einen Schritt auf ihren Vater zu, stellte sich vor ihn und schrie ihm ins Gesicht: „Das ist unser Revier! Das war Mamas Revier! Und du verscherbelst es!“
Johann Kammergruber wandte sich ab, schenkte sich nach und sagte ruhig: „Wenn du dich beruhigst, kann ich es dir erklären. Setz dich bitte. Beruhige dich. Ich erkläre es dir.“
Anna blickte ihren Vater hasserfüllt an. „Du kannst mir das nicht erklären. Was du da tust, das ist Verrat. Es ist Verrat an der Gemeinde, es ist Verrat an der Natur. Es ist Verrat an mir. Und es ist Verrat an Mama.“ Anna wandte sich um und ging zur Tür. „Ich will keine Erklärung. Ihr Politiker findet immer wieder Gründe, warum wir hier im Audacher Land unsere Natur und unsere Heimat zerstören müssen. Und bei den nächsten Wahlen klebt ihr wieder Plakate mit dummen Sprüchen wie ‚Aus Liebe zur Heimat’ und schwadroniert von der Bewahrung unserer Natur. Ich kann gar nicht so viel fressen wie ich kotzen möchte.“
Anna war schon im Flur, als Johann Kammergruber rief: „Ich habe es für dich getan.“
Anna blieb stehen. Rührte sich nicht. Als hätte jemand auf einer Kindergeburtstagsfeier beim Stopptanz auf Pause gedrückt. Johann Kammergruber kannte Stopptanz vom jährlichen Himmelreicher Pfarrfasching im Gemeindesaal, den er als Bürgermeister seit 17 Jahren mit seiner Anwesenheit beehrte.
Seine Tochter drehte sich um. Sie blieb im Flur stehen und schaute ihrem Vater zu wie er sich im Wohnzimmer an der Hausbar festhielt und trotzdem schwankte.
Johann Kammergruber sah, dass sich die Atmung seiner Tochter allmählich beruhigte. Er wankte zurück zu seinem Sessel und setzte sich.
Anna ging zurück ins Wohnzimmer, setzte sich auf den Teppich und drehte ihrem Vater den Rücken zu. „Warum für mich?“ Ihre Stimme klang eiskalt.
„Hör mir bitte ganz ruhig zu. Ich kann es dir erklären, wenn du mir nur geduldig zuhörst.“
Anna nickte stumm.
„Kannst du dich an meine Wahlkampfrede bei meiner Nominierung zur Wiederwahl vor knapp sechs Jahren erinnern?“
Anna nickte.
„Der Saal im Alten Wirt war proppenvoll. Du weißt sicher noch, dass die Unionisten damals überlegt haben, Bertram Patzelt aufzustellen. Der hätte so viel Kohle in den Wahlkampf gesteckt, dass mir Hören und Sehen vergangen wäre. Ich hatte eine Scheißangst abgewählt zu werden. Die Parteigänger vom Patzelt streuten Gerüchte über mich. Dass ich nicht mehr bei der Sache wäre seit Mamas Tod. Dass ich ein Trinker sei, dem es egal ist, was aus Himmelreich wird. Du weißt, dass ich kein guter Redner bin. Aber damals habe ich mir zwei Tage Zeit genommen, um meine Rede vorzubereiten und zu üben.“
„Du erzählst mir eine Geschichte, die ich längst kenne. Ich musste mir deine Rede fünf- oder sechsmal anhören.“
„Stimmt. Ich erinnere mich. Und das hast du gut gemacht. Hast mir als sechzehnjähriger Grünschnabel sogar ein paar gute Tipps gegeben. Und die eine oder andere Idee von dir habe ich tatsächlich übernommen. Den Bauwagen für den Burschenverein zu erneuern, das war deine Idee.“
„Komm zur Sache, Papa.“ Annas Stimme klang immer noch schroff.
„Ich habe den Leuten damals versprochen, dass wir in Himmelreich nicht den Fehler machen werden, uns dem Wachstum in der Region zu beugen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich den Charakter der Gemeinde erhalten werde. Ich habe gesagt, dass wir keine Baugebiete ausweisen werden und keine hässlichen Gewerbeparks.“
„Blablabla“, schnaufte Anna.
„Hör mir bitte weiter zu, Anna. Als ich damals auf der Versammlung gesagt habe, dass ich keinen einzigen Baum abholzen werde, um Häuser für irgendwelche dahergelaufenen BMW-Manager und Microsoft-Fuzzis zu bauen, da haben sie mir alle applaudiert.“
„Das mit dem Microsoft-Fuzzi war von mir“, erinnerte sich Anna. Sie streckte sich auf den Teppich aus und starrte zur Zimmerdecke.
„Ja, das war von dir“, sagte Kammergruber und schmunzelte. „Der Applaus und die Begeisterung waren so überwältigend, dass Patzelt noch am selben Abend zu mir kam und gesagt hat, dass er nicht gegen mich kandidieren wird. ‚Ich bin ja kein Depp’, hat er zu mir gesagt. ‚Ich ziehe doch nicht in eine Schlacht, von der ich weiß, dass ich sie verlieren werde.’ Und dann hat er mir zugezwinkert und geflüstert: ‚Ich bekomme trotzdem, was ich will.’“
„Und jetzt gibst du es ihm“, schnaubte Anna.
„Ja, jetzt gebe ich es ihm. Ich werde mein Wahlkampfversprechen brechen. Wegen dir.“
Anna lag ruhig auf dem Teppich. Äußerlich ruhig. Ihr Papa war ein guter Vater. Er hatte sich als Bürgermeister trotz seiner vielen Verpflichtungen immer Zeit für Anna genommen. Sie erinnerte sich daran, wie sie Hand in Hand zur Grundschule schlenderten. Wie sie im Sommer Nacktschnecken vom Bürgersteig ins Gras trugen, bevor sie in der aufkommenden Hitze vertrockneten. Wie er ihrer strengen Lehrerin zuzwinkerte, weil er Anna wegen der Schnecken zehn Minuten zu spät ins Klassenzimmer brachte, und zu ihr sagte: „Tut mir leid, Frau Hampel“, obwohl sie Himpel hieß, „es ging um Leben und Tod. Da muss ein Bürgermeister Prioritäten setzen.“ Aber jetzt lag sie hier auf dem Teppich seines Wohnzimmers und musste sich anhören, dass ihr Vater ihr geliebtes Kiemer Holz den Gierschlünden zum Fraß vorwarf. Und noch dazu behauptete, er würde es wegen ihr tun. Am liebsten wäre sie vom Teppich aufgestanden, zu seiner Hausbar gegangen und hätte jede einzelne Flasche auf ihren Vater geworfen. Anna nahm all ihre Kraft zusammen, um ruhig zu bleiben. Ihre Lippen zitterten. Ihre Augen füllten sich mit Tränen der Wut. „Warum wegen mir?“
„Weil ich will, dass du gehst“, sagte Johann Kammergruber. Er hievte sich aus dem Sessel, um sich nachzugießen. Nach einem kräftigen Schluck fuhr er fort. „Du bist zu gut für Himmelreich. Dieses Dorf wird dich kaputt machen. Du bist zart und einfühlsam. Noch schlimmer: Du bist klug und hast Ideale. Du weißt, was richtig oder falsch ist, was gerecht oder ungerecht ist. Du wirst mit jedem Jahr, das du länger hierbleibst, immer mehr daran verzweifeln, dass es hier in Himmelreich egal ist, was richtig oder falsch ist und was gerecht oder ungerecht ist. Hier in Himmelreich wird getan, was getan werden muss, egal ob es gut oder schlecht ist. Ich kann und will dem nicht mehr länger standhalten. Mir fehlt die Kraft. Geh weg, meine geliebte Anna. Geh in die Stadt. Tu es für mich und tu es um deiner selbst willen. Du wirst hier nicht glücklich. Glaub mir. Ich weiß es.“
„Aber ich bin glücklich“, insistierte Anna.
„Pah“, schnaubte Kammergruber. „Du verkaufst dich unter Wert.“ Der Alkohol gewann immer größere Macht über seine Aussprache und Wortwahl. „Du fickst einen Grenzdebilen. Du gefällst dir als Chefin des Burschen- und Madl-Vereins. Tagsüber studierst du in München. Dort diskutierst du über Moral und Kants kategorischen Imperativ und was weiß ich noch was, von dem wir hier nicht den blassesten Schimmer haben. Und abends gehst du mit den Himmelreicher Dorfdeppen saufen, spielst Kartenblasen und fühlst dich gut, weil du ihnen überlegen bist und sie dich alle bewundern. Anna, geh nach München und messe dich mit deinesgleichen. Geh nach München, lerne und lebe.“
„Was will ich in München?“ Anna setzte sich auf und blickte ihrem Vater ins versoffene Gesicht. „Was zur Hölle soll ich dort? Meine Freunde sind hier und nicht in München. Meine Heimat ist hier und nicht in München. Unsere Jagd ist hier. Unser Hof ist hier. Mamas Grab ist hier.“
Kammergruber zuckte bei der Erwähnung des Hofs und des Grabs zusammen. Den Hof hatte er vor einigen Jahren aufgelöst und seine Felder und die Apfelplantage verpachtet. Das Grab hatte er jahrelang selbst gepflegt. Jeden Freitag. Er hatte die von den ringsum stehenden Bäumen herabgefallenen Blätter herausgezupft, das Grablicht ausgetauscht und frische Blumen auf die Stelle gelegt, unter der er das Herz seiner geliebten Rosi vermutete. Irgendwann, vor sechs oder sieben Jahren, hatte er schließlich einen Mitarbeiter des Gemeindebauhofs mit der Grabpflege beauftragt. Der Schmerz, den er jedes Mal empfand, wenn er sich Rosis Grab näherte, war einfach zu groß und ließ auch nach Jahren nicht nach. Fortan ging er nur noch an Allerheiligen an ihr Grab. Selbst das schaffte er nur, wenn er sich vorher mit einer halben Flasche Schnaps betäubte.
„Du kannst jederzeit zurückkommen. Du kannst deine Wohnung im ersten Stock behalten. Ich werde sie nie vermieten. Dort bleibt alles, wie es ist. Versprochen. Anna, du bist nicht gemacht für deine Heimat. Du bist nicht gemacht für Himmelreich. Du bist besser als Himmelreich. Lass es hinter dir. Lass den Burschen- und Madlverein sein. Du überforderst die jungen Leute doch nur. Die wollen feiern und saufen und ficken. Die interessieren sich nicht für Politik und auch nicht für die Vereinsgeschichte. Und lass dein Engagement für die Flüchtlinge. Das kriegen wir auch ohne dich hin.“
Anna sah ihren Vater entsetzt an. „Du zerstörst den Wald, weil du meinst, dass ich dann nach München gehe? Und lass den Verein aus dem Spiel. Das ist endlich ein Verein, der sich nützlich macht. Und was soll das Gerede von den Flüchtlingen, Papa? Wir haben hier in Himmelreich nur einen einzigen Flüchtling. Und ja, um den kümmern wir uns. Weil sich sonst keine Sau um ihn kümmern würde. Glaubst du, die Maria Häfner hätte Medhi eingestellt, wenn wir uns nicht seiner angenommen hätten? Und du uns nicht geholfen und mit ihr geredet hättest? Es gibt hier in Himmelreich genug für mich zu tun. Ich muss nicht nach München ziehen, um etwas zu bewegen in dieser Welt.“
Anna stand auf, ging zur Bar und schenkte je drei Finger Aquavit in zwei Gläser. Sie ging zu ihrem Vater, reichte ihm eines der Gläser und setzte sich wieder auf die Sessellehne. Sie stießen an und tranken. Anna umarmte ihren Vater und schmiegte ihren Kopf an seine Schulter.
„Papa, du bist der liebste Mensch, den ich kenne. Wenn ich dir sage, dass ich niemals von hier weggehen werde, auch dann nicht, wenn ihr Mamas Jagdrevier zerstört, wenn ich dir das klipp und klar sage, machst du deine Entscheidung dann rückgängig?“
Kammergruber strich seiner Tochter liebevoll übers Gesicht. Dann nahm er sie in den Arm. „Ach, mein Mädchen. Was willst du denn mit dem Kiemer Holz? Sieh dich doch an. Du bist nicht Mama. Du trägst ihre Jagdkleidung. Du musst die Hosenbeine doppelt einschlagen, damit du nicht über sie stolperst. Du trägst ihre Jagdstiefel, obwohl sie dir vier Nummern zu groß sind. Du schießt einen Bock, den du nicht zum Auto tragen kannst, weil er fast genauso viel wiegt wie du. Liebe Anna, du bist nicht deine Mutter. Und das sollst du auch nicht sein. Anna, sei das, was du selbst bist.“
Anna löste sich abrupt aus der Umarmung. Sie sprang auf und warf ihr Glas auf den Boden. Der Schnaps hinterließ einen nassen Fleck auf dem Teppich. Schnaps war nichts Neues für den Teppich in Johann Kammergrubers Wohnzimmer. Unzählige Male hatte er Linie Aquavit anstandslos in sich eingesogen. Das Glas kullerte über den Teppich und kam geräuschlos zum Stillstand. Umso lauter brüllte Anna ihren Vater an. „Ich bin das, was ich bin. Und ich bin es genau hier. Hier in Himmelreich und nicht in München. Und ich frage dich noch einmal: Kannst du die Vernichtung von Mamas Revier rückgängig machen?“
Johann Kammergruber schüttelte den Kopf. „Ich kann es nicht ungeschehen machen. Wir haben es im Gemeinderat beschlossen und daran muss ich mich als Bürgermeister halten.“
Verwundert bemerkte Anna, dass ihrem Vater eine Träne über die Wange lief. Anna ging zu ihm, strich mit ihrem Daumen die Träne weg und sagte: „Du weißt, ich werde mich dagegen wehren.“ Sie hielt kurz inne und blickte in seine traurigen Augen. Dann küsste sie ihren Vater auf die Wange und ging.
Johann Kammergruber saß noch zwei Stunden im Sessel. Hin und wieder wankte er zur Hausbar und schenkte sich nach. Die hölzerne Standuhr an der Wohnzimmerwand zeigte halb zwölf an, als sein Smartphone auf dem Beistelltisch piepte. Kammergruber griff nach dem Handy. Eine neue Nachricht. Von Bertram Patzelt: „Stoße auf dich an. Gut gemacht. Grüße auch von Seidlbauer. Wir feiern gerade.“ Mit einem Fingerstrich wischte er die Nachricht weg. Johann Kammergruber stemmte beide Hände gegen die Lehnen des Sessels und versuchte aufzustehen. Es gelang ihm nicht. Hilflos plumpste er zurück in den Sessel. Im Obergeschoss hörte er seine Tochter und Boris stöhnen. Bevor er einschlief, bemerkte er, dass ihm wieder eine Träne über die Wange lief. Irgendwann später in der Nacht, kurz bevor die Sonne aufging und einen weiteren schrecklichen Tag brachte, pisste er sich in die Hosen. Aber das bemerkte Johann Kammergruber nicht.
Anna stürmte nach draußen und setzte sich auf die Stiege vor der Haustür. Für Anfang April war der Tag angenehm warm gewesen, aber jetzt, nach Sonnenuntergang, pfiff der Wind eiskalt über den Kammergruber Hof. Sie fror. Anna kauerte sich zusammen. Ihr Blick fiel auf ihre Stiefel. Tatsächlich sahen sie grotesk groß an ihr aus. Anna kramte Tabak und Papier aus der Jackentasche. Als sie sich eine Zigarette drehte, zitterten ihre Finger so stark, dass die Hälfte des Tabaks auf den Boden fiel. Wütend warf sie die Tabaktüte in den Kies.
Nun war es also passiert. Entgegen aller Versprechen ihres Vaters. Und dann erdreistete er sich auch noch, seine Verantwortung auf sie abzuschieben. „Ich habe es wegen dir getan“, äffte sie ihn nach. „Aber nicht mit mir“, murmelte Anna. Sie sprang auf, rannte auf den Hof zwischen dem Wohnhaus und dem verwaisten Stall, in dem einst die Kühe standen, und brüllte in die Nacht: „Da hast du dich geschnitten. Nicht mit mir!“
Der Kies spritzte auf, als Boris mit seinem Golf Pick-up von der Straße in die Hofeinfahrt abbog. Er sprang aus dem Wagen, lief zu Anna und umarmte sie fröhlich. „Da hast du ja einen Prachtkerl erlegt. Bin ganz schön ins Schwitzen gekommen wie ich ihn durch den Wald geschleppt hab.“
Anna löste sich aus der Umarmung und sagte: „Trag ihn schnell ins Kühlhaus. Ich will nur seine Hörner und sein Fell. Der Rest kann morgen zu Maria Häfner in die Metzgerei. Was sie zahlt, kannst du behalten.“
Boris ging zur Ladefläche, hob den Bock heraus und trug ihn zum Kühlhaus. Anna hielt ihm die Tür auf. Boris legte das Tier auf einen großen Stahltisch in der Mitte des Vorraums. „Wirklich ein Prachtkerl“, murmelte er vor sich hin.
An der Wand neben der Tür zum Kühlraum hingen allerlei Messer verschiedener Größe sowie eine Knochensäge. Anna nahm die Knochensäge und ein langes stählernes Messer. Die Säge reichte sie Boris. Aus einer Kartonbox zog sie zwei Einweghandschuhe aus Plastik und streifte sie sich über. Schweigend schnitt sie das Fell des Bocks auf. Boris machte sich mit der Säge an den Hörnern zu schaffen. Es dauerte keine zwei Minuten, bis er beide abgesägt hatte. Er legte sie in eine Schale. Dann packte er den Bock, hob ihn hoch und hängte ihn an einen Stahlhaken an der Decke. Anna machte sich daran, dem Tier das Fell abzuziehen. Sie griff mit beiden Händen in die von ihr getätigten Schnitte und begann kräftig am Fell zu ziehen.
„Wart, ich helf dir, dann haben wir das gleich“, sagte Boris und griff nach dem Bock.
„Fass ihn nicht an“, fauchte Anna. „Fass ihn ja nicht an. Ich habe ihn erlegt, dann ziehe ich ihm auch das Fell ab.“
Erschrocken wich Boris zurück. „Ich will dir doch nur helfen“, sagte er.
„Ich will deine Hilfe nicht. Ich schaffe das allein.“
„Ist ja gut. Entschuldigung.“ Annas Wut schüchterte Boris ein. Er setzte sich auf einen Holzstuhl in der Ecke und zündete sich eine Zigarette an.
Es dauerte über eine Stunde, bis Anna keuchend und immer wieder von Weinkrämpfen geschüttelt dem Bock das Fell abgezogen hatte. Mit blutverschmiertem Gesicht sank sie auf die Kacheln und hielt das Fell in ihren Händen, als handle es sich um ein aus seltener Seide gewobenes, sündhaft teures Kleid. „Geschafft“, wisperte sie und rang nach Luft.
Boris ging zu ihr und nahm sie in den Arm. Sie ließ es zu. „Ich versteh dich nicht, aber ich hab dich lieb“, sagte er.
„Bring mich ins Haus“, flüsterte Anna.
Boris hob Anna hoch und trug sie über den Hof zum Wohnhaus. Er stemmte die Haustür auf und hievte Anna die Treppen hinauf zu ihrer Wohnung. Die Holzstufen knarzten unter seinen kräftigen Schritten. Oben legte er Anna auf die Couch im Wohnzimmer und ließ ihr ein Bad ein. Er setzte sich auf den Rand der Wanne und prüfte mit seiner Hand immer wieder die Temperatur des Wassers. Hin und wieder stellte er den Wasserhahn auf kälter oder wärmer. Als die Wanne halbvoll war, stellte er das Wasser ab und ging zurück ins Wohnzimmer. Anna hatte die Augen geschlossen. Boris zog ihr sanft die viel zu großen blutbefleckten Jagdklamotten aus. Ihr Top und den Slip ließ er ihr an. Dann trug er sie zur Wanne und legte sie vorsichtig ins Wasser.
Anna öffnete die Augen. „Perfekte Temperatur“, lächelte sie und strich Boris mit der Hand durchs kurze Haar.
Boris bückte sich zu Anna hinunter und gab ihr einen Kuss auf die Wange. „Ich geh nochmal rüber ins Kühlhaus und mach alles fertig.“
„Ach Boris, was würde ich ohne dich tun?“
Boris strahlte vor Stolz. Er liebte diesen Satz.
Er brauchte nicht lange. Mit sicheren Handgriffen kümmerte Boris sich um die Konservierung der Hörner und des Fells. Der nackte Kadaver des Rehbocks glänzte dunkelrot im kalten Licht der Deckenlampe. Boris öffnete die Tür zum Kühlraum, nahm das Tier vom Haken und trug es hinein. Mit Desinfektionsmittel und einem Handtuch reinigte er den Tisch und den blutverschmierten Boden des Vorraums. Zwanzig Minuten später war er zurück im Haus. Auf der Treppe nach oben hörte er das Rauschen von Wasser durch alte Rohre. Offenbar ließ Anna warmes Wasser ein.
Als er die Badtür in der Wohnung im ersten Stock öffnete, saß Anna grinsend in der Wanne und stellte den Hahn aus. „Du hast den Badeschaum vergessen.“
„Entschuldigung“, sagte Boris. „An den hab ich nicht gedacht.“
Anna tauchte im vom Blut des Rehbocks hellrotgefärbten Wasser unter. Einige Sekunden später tauchte sie wieder auf, wandte ihr Gesicht zu Boris und spritzte mit dem Mund einen Schwall Wasser auf seine Hose. Boris wich einen Schritt zurück. Das Wasser rann warm an seinem rechten Hosenbein herunter. Hätte Anna etwas weiter oben getroffen, dann hätte es so ausgesehen, als hätte sich Boris in die Hosen gemacht. Anna musste laut lachen. „Ich zieh dich doch nur auf. Du hast alles super gemacht. Ich danke dir.“
Die Gesichtszüge des jungen Mannes entspannten sich. Boris lehnte sich an den Türrahmen und betrachtete Anna. Sie hatte ihre Unterwäsche nicht ausgezogen. Die Nippel ihrer kleinen Brüste drückten spitz gegen den Stoff des engen schwarzen Tops. Auch ihr Slip war schwarz. Boris sah die Finger von Annas rechter Hand in ihm verschwinden. Er hörte, wie sie dabei kurz aufstöhnte. Binnen Sekunden bekam er eine harte Erektion. Anna drehte sich auf den Bauch und legte ihren Kopf auf den Wannenrand. Sie ging in die Hocke und reckte ihren Hintern aus dem Wasser. Sie streichelte den engen Spalt zwischen ihren Pobacken und drückte einen Finger in ihre Vagina. Sie stöhnte laut und sah Boris an. „Was glaubst du?“, fragte sie.
„Was soll ich glauben?“, fragte Boris unsicher.
„Was glaubst du, wie lange du brauchst, bis du endlich in mir bist?“
Boris brauchte keine fünfzehn Sekunden. Ohne sich auszuziehen, nicht einmal seine Stiefel, stieg er hinter Anna in die Badewanne.
Später in der Nacht lagen Anna und Boris eng umschlungen im Bett. Anna hatte sich mit Rücken und Hintern an Boris geschmiegt. Während seine Finger sanft die kleinen Nippel ihrer Brüste streichelten, erzählte Anna mit ruhiger Stimme von dem Gespräch mit ihrem Vater. Boris hörte schweigend zu. Irgendwann hatte Anna sich alles von der Seele geredet. Weil Boris hinter ihr ruhig atmete und nicht antwortete, dachte Anna, er wäre eingeschlafen. Sie küsste den Zeigefinger ihrer rechten Hand und berührte mit ihm das Portraitfoto ihrer Mutter, das in einem schwarzen Rahmen auf dem Nachtkästchen stand. Dann schaltete sie die Nachttischlampe aus. Anna schloss die Augen, drückte sich noch enger an Boris und freute sich auf den Schlaf.
Plötzlich fragte Boris: „Darf ich dich was fragen?“
„Natürlich darfst du. Schieß los.“
„Du willst wirklich nicht weggehen? Du sagst das nicht einfach so?“
„Nein, ich sage das nicht einfach so. Ich werde ganz sicher nicht von hier weggehen.“
„Versprich es.“
Anna fühlte sich geschmeichelt und drückte ihren nackten Hintern gegen seinen Schoß. „Ich verspreche es dir hoch und heilig.“ Sie fühlte, wie Boris Penis hart wurde und sich zwischen ihre Pobacken drückte. Sie begann sich rhythmisch zu bewegen und hörte Boris vor Lust leise stöhnen. „Nimm mich nochmal. Nimm mich jetzt ganz langsam.“
Anna saß nackt auf dem lederbezogenen Hocker vor dem großen Spiegel im Schlafzimmer. Mit einer Bürste kämmte sie ihre langen, kastanienbraunen und vom Bad noch feuchten Haare. Der Wecker auf dem kleinen Holztisch vor dem Spiegel zeigte halb ein Uhr. Im Spiegel sah sie Boris nackt auf dem Bett hinter ihr liegen. Sie konnte ihn gut leiden, aber vor allem liebte sie seinen Körper. Sie und Boris schliefen miteinander seit Anna 15 und Boris 18 Jahre alt waren. Aber sie waren nie ein Paar geworden. Zumindest nicht aus Annas Sicht.
Anna und Boris konnten unterschiedlicher nicht sein. Boris war fast zwei Meter groß. Er hatte breite Schultern, war muskulös ohne trainieren zu müssen und schor sich sein Haar auf Zentimeterlänge, weil er keinerlei Wert auf sein Äußeres legte. Da er wusste, und weil es ihm die Menschen in Himmelreich immer wieder genüsslich aufs Brot schmierten, dass er dumm war, litt er an Minderwertigkeitskomplexen. Nach der Sonderschule in Audach, beziehungsweise dem Sonderpädagogischen Förderzentrum, wie man die Schule seit ein paar Jahren nannte, hatte er eine Lehre bei einem Gartenbauer in Himmelreich gemacht. Durch die schriftlichen Prüfungen war er mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Boris wiederholte das letzte Ausbildungsjahr, scheiterte erneut an den Prüfungen und wurde gekündigt. Der Gartenbauer stellte einen neuen Lehrling von der Sonderschule ein. Auch dieser fiel zweimal durch und wurde gekündigt. Der aktuelle Lehrling war ebenfalls vom Sonderpädagogischen Förderzentrum, und jeder in Himmelreich wusste, dass auch dieser nicht übernommen werden würde, selbst wenn er die Prüfungen bestand. „Der Hofberger Horst hat noch nie einen Lehrling übernommen“, erzählten sich die Himmelreicher im Alten Wirt. „Der nimmt immer wieder einen neuen Deppen als Lehrling, weil die schuften können wie die Ochsen und billiger sind als Gesellen.“ Seitdem Boris nicht mehr bei Gartenbau Hofberger arbeitete, verdingte er sich als selbständiger Gärtner-Hiwi. Er schnitt Hecken, mähte Rasen, grub Beete um und schnitt Obstbäume. Weil er mit der Buchführung überfordert war, übernahm Anna sie für ihn. Nach Steuern blieben Boris etwa 1.500 Euro im Monat. Im Winter weniger bis gar nichts. Trotzdem schien er auf seine Weise glücklich zu sein. Anna bewunderte ihn insgeheim für seine schlichte Bescheidenheit. Boris wusste nicht viel von dieser Welt und er brauchte nicht viel von ihr. Damit schien er gut zurecht zu kommen.
Anna war das komplette Gegenteil von Boris. Sie maß nur knapp 1,60 Meter und wog kaum 45 Kilo. Sie hatte zwar nicht die beeindruckende Körpergröße aber die seltene Schönheit ihrer Mutter geerbt, und wenn sie nicht im Revier unterwegs war und Mamas Jagdklamotten trug, legte sie allergrößten Wert auf ihr Erscheinungsbild. Sie wusste, dass sie mit einer natürlichen Schönheit gesegnet war. Sie wusste um ihre Wirkung auf Männer, und sie wusste, wie sie diese maximieren konnte. Obwohl ihr Vater sie immer wieder gebeten hatte, um des Geredes im Dorf willen doch endlich einen Büstenhalter zu tragen, tat sie es nicht. Der Sohn von Maria Häfner, bei der Medhi als Metzgersgehilfe arbeitete, gab ihm immer frei, wenn Anna in der Metzgerei auftauchte und fragte, ob Medhi heute früher Schluss machen könne, um an der Chronik des Burschen- und Madlvereins zu arbeiten. Anna wusste, dass der junge Häfner das nur tat, weil sie wunderschön und schlank und begehrenswert war und sich ihre Nippel unter ihren engen Tops abzeichneten wie zwei süße Versprechen. Und sie wusste, dass ihr Körper ihr auch in der Uni Vorteile bescherte. Zwar behaupteten die Dozenten, für sie zähle ausschließlich die intellektuelle und wissenschaftliche Leistung der Studierenden. Vielleicht glaubten sie das sogar selbst. Aber Anna bekam auch für miserable Seminararbeiten Bestnoten. Dabei kam es selten vor, dass Anna schlechte Arbeiten abgab. Denn sie besaß einen brillanten Verstand. Platons Politeia hatte sie in drei Tagen gelesen und verstanden und konnte ab der zweiten Semesterwoche auf höchstem Niveau mit dem Dozenten diskutieren, während ihre Kommilitonen sich selbst gegen Semesterende auf auswendig Gelerntes aus der Sekundärliteratur stützen mussten oder stupide wiedergaben, was der Dozent kurz zuvor gesagt hatte. Rousseau brachte sie große Verehrung entgegen und konnte den revolutionären Gehalt seiner Schriften stichhaltig gegen die Spitzfindigkeiten ihres reaktionären Professors verteidigen. Wenn sie und ihre mehrheitlich männlichen Kommilitonen im Sommer in den langen Stunden zwischen den wenigen wirklich interessanten Vorlesungen und Seminaren auf den Bierbänken im Freibereich der Cafeteria des Geschwister-Scholl-Instituts saßen, gaben sich die Männer – wenn man bei den ebenso eitlen wie pickligen Milchgesichtern überhaupt von Männern sprechen konnte – allergrößte Mühe, Anna mit Intellekt und Männlichkeit für sich zu gewinnen. Und wo immer picklige Politikstudenten Intellekt und Männlichkeit zu vereinen suchten, war Nietzsche nicht weit. In Annas Augen war Friedrich Nietzsche die Pest für alle modernen und selbstbewussten Frauen. Allein schon deshalb, weil es nie lang dauerte, bis bei diesen grauenhaften Diskussionen mit ihren Kommilitonen irgendjemand der balzenden Männer glaubte, Anna mit dem Zitat ‚Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht’ beeindrucken zu können. Anna verwies dann sanft lächelnd darauf, dass Nietzsche das so nie geschrieben hatte. Auch sonst blieb sie unbeeindruckt von solchen und anderen Chauvinismen, die ihr Tag für Tag an der Uni in München begegneten. Fast unmerklich drückte sie ihren Rücken ein wenig durch, wohlwissend, dass sich ihre kleinen Brüste nun etwas deutlicher unter ihrem Top abzeichneten. Dann sagte sie etwas Unverbindliches, und manchmal tat sie so, als würde ihr der entgegengebrachte Machismo schmeicheln. Und dann zerlegte sie Nietzsches Thesen mit einem Scharfsinn, dem keiner der gerade noch so selbstbewussten Prahlhansel intellektuell auch nur das Geringste entgegenzusetzen in der Lage war.
Irgendwann, es war kurz nach ihrem Bachelor, den sie mit einer glatten Eins abgeschlossen hatte, schlug das Verhalten ihrer Kommilitonen ins Gegenteil um. Während die Mehrzahl ihrer Mitstudentinnen Anna seit jeher Neid und Missgunst entgegengebracht hatten, da es ja wohl einfach nicht sein konnte, dass jemand so bestechend klug und gleichzeitig so wunderschön war, mieden allmählich auch viele der männlichen Kommilitonen den Kontakt mit ihr. Sie war die einzige Studierende ihres Jahrgangs mit einer 1,0. Dass sich Annas intellektuelle Überlegenheit mit dieser Note nun schwarz auf weiß manifestierte, war schon Grund genug für eine Ächtung. Hinzu kam noch der Frust darüber, dass keiner der Studenten Anna je ins Bett bekommen hatte. Anna war das Maß der Dinge am Geschwister-Scholl-Institut, geistig und körperlich. Und wer weder die Intelligenz besaß sich intellektuell mit ihr zu messen noch die realistische Chance sah, dass seine feuchten Träume von ihr jemals real wurden, der zeigte ihr fortan die kalte Schulter. Von Semester zu Semester wurde Anna immer einsamer in der Uni. Also reduzierte sie ihre Zeit in der Uni auf das Notwendigste. Das hieß, dass sie hin und wieder in die Sprechstunden der Dozenten ging, um ihre Seminararbeiten abzugeben oder diese zu besprechen. In die Anwesenheitslisten der besuchspflichtigen Veranstaltungen ließ sie sich von Antje eintragen, der einzigen Freundin, die sie während ihres Studiums gefunden hatte. Mit Antje hatte Anna einen Deal vereinbart: „Ich schreibe dir zwei Seminararbeiten pro Semester, die besser sein werden als meine eigenen, und du trägst mich dafür in die Listen ein.“ In der Tat gab sich Anna größere Mühe bei den Arbeiten, die sie für Antje anfertigte, als bei ihren eigenen. Trotzdem wurden Antjes Arbeiten schlechter bewertet als die manchmal lieblos dahingeschluderten Werke, die Anna für sich selbst verfasste. Irgendwann bekam das auch Antje mit, deren 40 Kilo Übergewicht und eine unvorteilhaft schiefe Nase offenbar doch das Urteilsvermögen der Dozenten beeinflussten. Da die dicke Schiefnase obendrein erstaunlich dumm für eine Studentin war, blieb sie auf Annas Hilfe angewiesen. Aber immerhin war Antje clever genug, im nächsten Semester vier Seminararbeiten zu fordern. Anna willigte ein, sprach aber nie wieder ein Wort mit ihr. Außerhalb Himmelreichs hatte Anna, das gestand sie sich offen ein, nicht eine einzige Freundin.
In die Uni ging Anna seit gut einem Jahr kaum noch. Damit ihrem Vater das nicht auffiel, stand sie drei- oder viermal in der Woche um sieben Uhr auf, um mit ihm eine Tasse Kaffee zu trinken und sich dann mit ihrem Rucksack auf dem Rücken in den Bus zum S-Bahn-hof in Röhrmoos zu setzen. Es gab ein paar andere Himmelreicher, die ebenfalls den Bus und die Bahn nutzten, um nach München in die Arbeit zu fahren. Schließlich konnte es sich nicht jeder Himmelreicher leisten, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Für die vielen Verkäuferinnen in den großen Warenhäusern der Münchner Fußgängerzone gab es nun mal keine kostenlosen Parkplätze in der Innenstadt. Auch nicht für die beiden rumänischen Zwillingsschwestern, die in der ehemaligen Hausmeisterwohnung auf Bertram Patzelts Gewerbehof wohnten und in einem Schwabinger Hospiz als Pflegerinnen arbeiteten. Anna unterhielt sich auf den Fahrten in Bus und S-Bahn gerne mit den anderen Himmelreichern, die mit ihr unterwegs in die Stadt waren.
Sie machte diese unnützen Fahrten nach München, um zu vermeiden, dass irgendwann jemand zu ihrem Papa sagte: „Ich habe Ihre Tochter schon lange nicht mehr im Bus gesehen. Ist sie krank? Dann wünschen Sie ihr bitte gute Besserung, Herr Bürgermeister.“ Also fuhr Anna, obwohl sie die Uni kaum mehr besuchte, regelmäßig in die Stadt. Hin und wieder fuhr sie gleich wieder zurück nach Himmelreich, nachdem sie sich im U-Bahnhof Universität von den Zwillingen verabschiedet hatte, die noch eine Station weiterfahren mussten.
Zurück in Himmelreich schlich sie sich ins Haus und vergewisserte sich vorsichtig, dass ihr Papa ins Rathaus gefahren war statt mit einem Aquavit in der Hand im Wohnzimmer umherzugehen und zu telefonieren. Nach dem Tod von Annas Mutter hatte sich der Bürgermeister die Freiheit genommen, ein- bis zweimal in der Woche von zuhause aus zu arbeiten, um nebenbei den Haushalt zu machen und sich um seine Tochter zu kümmern. Seinem Ergebnis bei der nächsten Wahl zufolge hatte ihm diese Prioritätensetzung nicht geschadet. Im Gegenteil, er wurde mit 98 Prozent wiedergewählt. Jetzt war Anna längst erwachsen und brauchte ihren Papa nicht mehr zuhause. Und dass seit einigen Jahren eine kroatische Zugehfrau Johann Kammergrubers Wohnung putzte und für ihn kochte, führte das Beharren des Bürgermeisters auf einen oder zwei Tage Homeoffice längst ad absurdum. Dennoch blieb Kammergruber jede Woche an einen oder zwei Vormittagen zuhause. Nicht mehr, um sich um seine Tochter oder den Haushalt oder den aufgelassenen Hof zu kümmern, sondern nur noch, um seine Trunksucht zu kaschieren. Nach Abenden, an denen ihn die Erinnerungen an Rosi und den fröhlichen Mann, der er einst gewesen war, besonders plagten und er keine andere Möglichkeit sah, als sie mit eineinhalb Flaschen Aquavit zu betäuben, blieb Kammergruber vormittags zuhause, regelte das Allernötigste per Telefon, steckte sich irgendwann den Mittelfinger in den Hals, kotzte sich leer und stellte sich eine halbe Stunde lang unter die Dusche. Gegen Mittag erschien er im Rathaus und ließ sich von seiner Vorzimmerdame einen dreifachen Espresso bringen. Den Rest des Arbeitstags brachte er einigermaßen nüchtern zu Ende, nur um sich nach seiner Rückkehr aus dem Rathaus wieder in seinen Wohnzimmersessel zu setzen und Aquavit zu trinken.
Wenn Anna wieder nach Hause kam von ihrer angeblichen Fahrt in die Uni, schlich sie sich zur Tür hinein und weiter zum Wohnzimmer ihres Vaters und schaute, ob er da war. Wenn das nicht der Fall war, ging sie hinauf in ihre Wohnung und zog sich Mamas Jagdklamotten an. Dann ging sie in den Keller, sperrte den Waffenschrank auf und nahm eine der Jagdflinten. Anschließend schritt sie über den Hof, überquerte die Landstraße und ging den Trampelpfad hinauf zum Kiemer Holz. Wenn ihr Vater zuhause war, schlich sie sich leise zur Haustür hinaus, lief zu Fuß zum Bauwagen des Burschen- und Madlvereins am Höllberger Forst und machte dort Klarschiff. Oder stieg langsam und vorsichtig, damit die hölzernen Treppenstufen nicht knarrten, nach oben, legte sich in ihr Bett und las oder setzte sich vor ihren Laptop und studierte von zuhause aus.
„Kann ich dich noch was fragen?“
Gedankenverloren kämmte Anna weiterhin ihr Haar. Sie legte die Bürste zur Seite und trug Creme auf ihr Gesicht auf. Sie war so tief in ihre Gedanken versunken, dass sie Boris Frage nicht wahrnahm.
Er fragte ein zweites Mal.
Anna drehte sich zu ihm um und lächelte ihn an. „Natürlich. Du kannst mich doch alles fragen.“
„Wenn das Kiemer Holz Baugebiet wird, glaubst du, dass ich dann ein bisschen mehr Arbeit kriege? Gärten anlegen und pflegen, Hecken schneiden, Bäume zuschneiden und so.“
Annas Lächeln gefror. „Hast du mir vorhin nicht zugehört? Das Kiemer Holz wird nicht bebaut. Nicht mit mir.“
„Scheiße“, fluchte Jonas Hofmann, als er nach acht Wochen Urlaub in der Bretagne sein Büro im Kriminalkommissariat München Nord betrat. Neben den Schreibtisch hatte jemand einen Rollwagen gestellt, auf dem sich unbearbeitete Akten türmten. Er blätterte einige davon durch. Dann verpasste er dem Rollwagen einen Tritt. Einige der Akten purzelten auf den Boden. Der Rollwagen knallte scheppernd gegen die Wand. Hofmann griff sich den Wasserkocher auf dem Fensterbrett und schlurfte zur Etagentoilette. Am Wasserhahn füllte er den Kocher auf und ging noch langsamer zurück ins Büro. Dort stellte er fest, dass er damals, als er sein Büro zum letzten Mal verlassen hatte, vergessen hatte, seinen Kaffeebecher auszukippen und zu spülen. Was hieß vergessen? Er hatte es einfach nicht getan. Wollte nur noch raus und weg. Was hieß wollte? Musste.
Während seiner Abwesenheit hatte sich der Kaffeerest in der Tasse in eine harte, schwarze Kruste verwandelt, umkränzt von einem stattlichen Ring grünen Schimmels. Hofmann nahm den Becher, ging wieder zur Toilette und warf ihn in den Mülleimer. Er zog mehrere Papierhandtücher aus dem Spender und drapierte sie darüber, bis der stinkende Becher nicht mehr zu sehen war. Dann ging er die Treppe hinauf in den zweiten Stock zum Sekretariat von Kripoleiter Gallert. Er öffnete die Tür ohne anzuklopfen.
Helen, die Vorzimmerdame, saß an ihrem Schreibtisch und erschrak. Schnell klickte sie auf ihrem Computer die Ebay-Seite weg und lächelte Hofmann an. „Grüß dich, Jonas. Schön, dass du wieder da bist.“ Sie stand auf und nahm Hofmann in den Arm. „Du hast dich so lang nicht gemeldet. Wir haben uns Sorgen gemacht.“
„Ich auch. Aber jetzt ist alles gut“, antwortete Hofmann und versuchte Helen ein Lächeln zu schenken.
Helen setzte sich wieder auf ihren Bürostuhl. Sie wischte sich eine Träne von der Wange. „Weißt du, dass das eben das erste Mal in 20 Jahren war, dass wir uns umarmt haben?“
Hofmann trat unsicher von einem Bein aufs andere. „Das wusste ich nicht. Aber es hat sich angefühlt als wäre es längst überfällig gewesen.“
„Schön, dass du zurückgekommen bist. Wir haben schon befürchtet, dass du hinschmeißt.“
„Ich auch“, sagte Hofmann. Ihm war die rührselige Stimmung unangenehm. „Aber wenn ich hinschmeiße, dann arbeiten außer dir, Gallert und den beiden Irren von der Spurensicherung ja nur noch Deppen hier. Das kann ich euch einfach nicht antun.“
Helen lächelte. „Du weißt, dass du so lange im Gartenhaus bleiben kannst, wie du willst.“
Hofmann schaute betreten auf den Boden. „Danke dir. Ich danke euch für alles. Ich suche mir so schnell es geht eine neue Wohnung.“
„Lass dir Zeit“, sagte Helen. „Wir haben das Gartenhaus seit zehn Jahren. Und weißt du, wie oft wir es genutzt haben? Drei Tage. Der Chef hat einfach zu viel Arbeit. Uns reicht es, wenn du in drei Jahren ausziehst, wenn wir in Rente gehen.“
„Drei Jahre. Ich beneide euch. Ich hab noch 20 vor mir.“
Helen lächelte Hofmann spöttisch an: „Ich bemitleide dich für deine Jugend. Ich habe dir einen Wagen mit Akten ins Büro gestellt. Es ist ein bisschen was zusammengekommen, während du gemütlich am Meer gesessen und Wein getrunken hast. Der Chef meint, du sollst sie dir ansehen. Ist nichts Besonderes dabei. Sachbeschädigungen und Kneipenschlägereien und so. Er meint, du sollst schnell machen. Aber ich finde, du kannst dir ruhig Zeit lassen. Komm erst mal wieder an. Finde dich erst mal wieder ein.“
„Ihr müsst mich nicht mit Samthandschuhen anfassen“, sagte Hofmann unwirsch.
„Ist ja gut, du knallharter Bulle“, murmelte Helen und widmete sich wieder dem Onlineshopping.
Hofmann setzte sich auf die speckige Vorzimmercouch.
„Kann ich sonst noch was für dich tun, Mister Obercool?“, fragte Helen.
Hofmann setzte seinen Dackelblick auf, der ihm immer besser gelang, seitdem die Jahre, der Stress und der Alkohol seine Gesichtshaut erschlafften. „Ein Kaffee wäre eine Sensation. Ich habe meinen Becher verschimmeln lassen.“
Helen schmunzelte. „Hab ich schon gesehen, als ich dir die Akten runtergebracht habe. Ihr Männer seid echt dermaßene Saubären, dass der Sau und dem Bären gleichzeitig graust.“
Hofmann hob mit schuldbewusstem Blick die Hände. „Kann nicht widersprechen.“
Helen ging zur Kaffeemaschine und goss Hofmann einen großen Becher schwarzen Kaffee ein.
„Habe ich gerade Saubär gehört?“ Gallert stand in der Tür seines Büros und grinste Hofmann an. „Da ist er ja wieder, unser guter Hofmann. Willkommen zurück, Jonas.“
Hofmann stand auf. Sie umarmten sich herzlich.
„Bist wieder da. Freut mich“, sagte der Kripoleiter.
„Mich auch.“
„Kannst im Gartenhaus bleiben, so lang du willst.“
„Danke dir. Hat mir Helen schon gesagt.“ Hofmann löste die Umarmung. Helen reichte ihm den Kaffeebecher.
„Wie geht’s dir?“, fragte Gallert.
„Wie ich vorgestern geschrieben habe: Ich bin fit und einsatzbereit.“
„Gut. Denn ich hab dir schon ein paar Fälle runtergeschickt. Also ran an die Arbeit, Herr Kollege.“
„Darüber wollte ich mit dir reden, Chef.“
Der Kripoleiter sah Hofmann verwundert an. „Hast du gedacht, dass wir dich hier in Watte packen, bloß weil du einen knackigen Fall hattest, der dir ein bisschen an die Nieren gegangen ist? Da bist du aber falsch gewickelt. Da kann ja jeder kommen und sagen, dass er traumatisiert ist und Dienst auf halber Backe schieben will.“ Gallert suchte Helens Blick.
Die Sekretärin nickte bestätigend und sagte: „Ja, da könnte wirklich jeder kommen.“
„Verdammt, Chef, deswegen bin ich ja hier. Ihr wollt mich hier mit beschissenen Sachbeschädigungen, Fahrraddiebstählen und Einbruchsversuchen beschäftigen. Den ganzen Mist, den ihr mir nach unten gebracht habt, den kann doch jeder Depp ermitteln. Gebt mir einen gescheiten Fall!“
Gallert hatte mit Hofmanns Reaktion gerechnet. „Jetzt mal langsam, Hofmann. Eigentumsdelikte sind schwere Vergehen. Der Bürger erwartet zu Recht, dass wir uns da personell nicht schonen.“ Gallert zeigte auf Helen. „Außerdem sollten wir das in meinem Büro besprechen und nicht hier draußen.“ Helen blickte teilnahmslos auf ihren Bildschirm.
„Mir doch egal, wo wir das besprechen. Ihr steckt ja eh unter einer Decke. Ich kenne euch. Gebt doch zu, dass das auf eurem gemeinsamen Mist gewachsen ist. Ihr wollt mich schonen. Ihr habt euch gedacht, wenn der Hofmann wiederkommt, dann machen wir ihm das Leben erst mal leicht. Geben ihm die belanglosen Fälle. Bloß nichts, was ihm an die Nieren gehen könnte.“
Helen blickte aus dem Fenster, als ginge sie das Gespräch nichts an.
Gallert sah auf die Uhr. „Jessas, ich muss los. Muss ja gleich zum Jour fixe mit der Gleichstellungsbeauftragten.“
„Fick die Gleichstellungsbeauftragte“, schnaubte Hofmann. „Gib mir einen gescheiten Fall oder ich mache krank.“ Er stürmte er aus dem Vorzimmer. Dabei gab er sich große Mühe die Tür möglichst laut zuzuschlagen, ohne dabei Helens Kaffee zu verschütten.
„Gut gemacht, Chef“, sagte Helen.
„War doch deine Idee“, schmunzelte Gallert. „Haben wir einen gescheiten Fall für ihn?“
„Noch nicht“, sagte Helen. „Aber es wird schon was reinkommen. Die Leute hören ja nicht auf, sich umzubringen, bloß weil der Jonas wieder da ist.“
„Da hast du mal wieder recht“, sagte Gallert und gab seiner Lebensgefährtin einen Kuss. „Ich liebe dich. Und jetzt gib dieser geschissenen Gleichstellungstussi Bescheid, dass ich komme.“
Hofmann ließ sich auf seinen zerschlissenen Bürostuhl nieder und fuhr den Rechner hoch. Der Computer installierte Aktualisierungen. Hofmann sah aus dem schmutzigen Fenster auf die Bushaltestelle. Im Mülleimer kramte ein Penner nach Pfandflaschen. Er zog drei Flaschen aus dem Eimer und warf sie in seinen Einkaufswagen. Eine Flasche zerbrach. Der Penner bückte sich, hob die größten Scherben auf und warf sie in den Mülleimer. Dann schlurfte er den Einkaufswagen hinter sich herziehend weiter. Nach einer halben Ewigkeit piepte der Rechner. Aktualisierungen abgeschlossen. Hofmann setzte sich und öffnete Office. Eingegangene und ungeöffnete E-Mails: 749. Hofmann griff zum Telefonhörer und wählte die 834. Jemand nahm ab und legte gleich wieder auf. Das war die übliche Praxis im Kommissariat, wenn jemand nicht mit einem sprechen wollte. Hofmann war seit 22 Jahren hier, fast sein halbes Leben. Erst als Streifenhörnchen, dann als Kommissar, später als Oberkommissar und seit acht Jahren als Hauptkommissar. Er kannte das Spielchen. Man musste nur oft genug anrufen. Es war ein Machtspiel, aber Hofmann wusste, dass er es gewinnen würde. Also wählte er immer wieder die 834, bis Oberkommissar Mölders beim achten Mal nicht mehr auflegte.
„Hallo Hofmann, schön dass du wieder da bist.“
„Fick dich, du Arschloch. Du warst meine Vertretung und jetzt komme ich hier rein und sehe, dass du keine einzige meiner Mails geöffnet hast. Was ist denn das für eine Scheiße?“
„Sorry, da weiß ich jetzt auch nicht, was schiefgegangen ist. Bei mir sind deine Mails jedenfalls nicht angekommen. Muss wohl irgend so ein EDV-Problem sein.“
„Ich sag dir, was das Problem ist, du Arschloch. Du hast dich einfach nicht drum gekümmert. Kollegenschwein“, brüllte Hofmann in den Hörer.
„Jetzt bleib mal ganz ruhig, werter Kollege. Das kann man so nicht sagen. Und wenn du dich bei Gallert beschwerst, dann bin ich ganz schnell beim Personalrat. Du kennst ja die Dienstvereinbarung gegen Mobbing. Also pass auf, was du über mich sagst.“ Mölders sprach ganz ruhig, was Hofmann noch weiter auf die Palme trieb.
„Jetzt hör mir mal zu, du beschissene Nullnummer. Wenn du zum Personalrat gehst, dann kannst du denen auch gleich erzählen, dass du von mir eine aufs Maul bekommst, wenn so etwas nochmal passiert. Und jetzt mach, was du am besten kannst.“
„Was?“, fragte Mölders.
„Nichts“, sagte Hofmann und legte auf. „Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Kannst ja eh nichts machen. Also bleib ruhig“, murmelte Hofmann. Er lehnte sich zurück und trank einen Schluck aus Helens Kaffeetasse. Etwas zu mild. Eigentlich nur Wasser mit bisschen schwarzer Farbe drin. Hofmann öffnete den Ordner mit den internen Mails. Die Erste war von der Abteilung Ausstattung und bewegliche Vermögenswerte:
„Sehr geehrter Herr Hofmann, lieber Jonas. Es tut mir sehr leid, aber wir müssen deinen Antrag auf einen neuen Bürostuhl vor-übergehend negativ bescheiden. Dein Stuhl ist erst zwölf Jahre alt und kann laut Abteilungsleitung bei pfleglicher Behandlung noch drei Jahre lang genutzt werden. Was deinen Antrag auf einen weiteren Aktenschrank betrifft, müssen wir diesen ebenfalls ablehnen. Die Abteilungsleitung rät zu einer zügigeren Abarbeitung der Fälle. Dann können deine Akten schneller in die Asservatenkammer gebracht werden und stapeln sich nicht in deinem Büro. Ich persönlich rate dir, dass wir das alles mal wieder privat besprechen. War schön letztes Mal. Aber ist schon sooo lange her. LG Andrea.“
Hofmann konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Insoweit war es doch ganz gut, dass Mölders seine Mails ignoriert hatte. Hofmann klickte die nächste Nachricht an. Sie stammte von der Abteilung Personal- und Materialsicherheit: „Sehr geehrter Herr Hofmann, werter Kollege, Ihre jährliche Schießübung ist seit drei Jahren überfällig. Deswegen fordern wir Sie letztmalig und dringend auf, baldmöglichst die Schießübung abzuleisten. Bitte denken Sie daran, Ihre Dienstwaffe mitzunehmen. Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, dass unsere Abteilung befugt ist, dienst-rechtliche Schritte bis hin zum Verbot von Außeneinsätzen zu erwirken. Die regelmäßige Überprüfung der waffentechnischen Tauglichkeit unserer Kolleginnen und Kollegen dient deren Eigenschutz und sollte mit Recht ernst genommen werden. Des Weiteren ist Ihre Berechtigung zur Nutzung von Dienstwagen abgelaufen. Bringen Sie deshalb bitte auch Ihren amtlichen Führerschein zur Einsichtnahme mit. Erst danach können wir Sie wieder für die Nutzung von Fahrzeugen der Dienstflotte freischalten. Freundliche Grüße, Kollege Höfenmeier.
„Die Woche fängt ja gut an“, knurrte Hofmann, sprang auf und klopfte sich auf die Tasche seiner Jeans, um zu überprüfen, ob Zigarettenschachtel und Feuerzeug am Mann waren. Dann marschierte er aus dem Büro.
Hofmann ging in den Keller und öffnete die Tür zum Heizungsraum. Seitdem vor 15 Jahren das Rauchen am Arbeitsplatz verboten und dienstrechtlich geahndet wurde, war der Heizungsraum der letzte Zufluchtsort der Raucher. Denn es war verboten, zum Rauchen vor die Tür zu gehen. Schließlich verließ man dabei den Dienstort zur Ausübung nichtdienstlicher Tätigkeiten. Außerdem biete man der Bevölkerung ein ‚Erscheinungsbild, das dem exzellenten Ruf der bayerischen Polizei nicht zuträglich ist’, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums hieß.
Hofmann konnte es drehen und wenden, wie er wollte. Er kam um die Schießübung nicht mehr länger herum. Die Drohung mit dem Verbot von Außeneinsätzen tat bei ihm die von der Sicherheitsabteilung erhoffte Wirkung. Hofmann beschloss, das sofort zu erledigen. Er schaute in seiner Geldbörse nach, ob er seinen Führerschein dabeihatte. Der Zugriff auf Autos des Fuhrparks war für ihn von nahezu existenzieller Bedeutung. Er besaß kein eigenes Auto und war deshalb auf einen Dienstwagen angewiesen. Wenn man es nicht zu sehr übertrieb, durfte man ihn auch privat nutzen. Schließlich war man als Polizist ja irgendwie immer im Dienst. Hofmann drückte seine Zigarette in dem übervollen Aschenbecher aus und wandte sich zum Gehen, als sich die Tür öffnete. Es war Dr. Jens.
Die beiden sahen sich ein paar Sekunden lang unsicher an. Dann fielen sie sich in die Arme. Dr. Jens klopfte Hofmann fest auf den Rücken. „Echt schön, dass du wieder da bist.“
„Find ich auch“, antwortete Hofmann.
Dr. Jens löste die Umarmung und steckte sich eine Zigarette an. Hofmann erkundigte sich, was es Neues gab.
„Nicht das Geringste“, sagte Dr. Jens, blies Rauch aus und hustete. „Und bei dir?“
Hofmann blickte auf den staubigen Boden des Heizungsraums. „Naja, dass ich halt wieder da bin.“
„Das ist keine Neuigkeit für mich. Irgendwie habe ich immer gewusst, dass es das noch nicht war.“
„Ich hab viel drüber nachgedacht. Über uns und was wir so machen. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es gut ist.“
Dr. Jens blickte seinem Freund in die Augen und nickte. „Das ist es tatsächlich.“ Sie umarmten sich noch einmal.
Plötzlich ging die Tür auf und Mölders stand vor ihnen. „Na, wen haben wir denn da?“, grinste er und kratzte sich seinen fetten Bauch. „Der Herr Doktor und sein Lieblingskommissar. Börne und Thiel sind wieder vereint.“