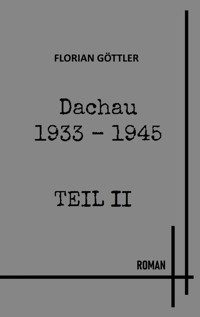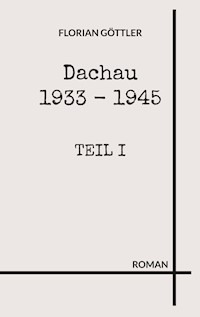
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
März 1933. Heinrich Bürgers zieht in den Künstlerort Dachau, um dort wie sein Onkel ein erfolgreicher Maler zu werden. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten interessiert ihn kaum. Unterdessen kann Bäckermeister Teufelhart, ein stolzer Nazi, sein Glück kaum fassen. Bürgermeister Seufert wechselt eilig die Partei, um im Amt zu bleiben. Pfarrer Pfanzelt hält Gottesdienste in Uniform. Der für seine kritischen Werke bekannte Künstler Kallert malt nur noch Landschaftsbilder. Wenige Wochen nach der Machtübernahme feiern der Pfarrer und Dachauer Bürger gemeinsam mit SA und SS einen Gottesdienst und marschieren durch die Straßen. Auch die Dachauer Künstler marschieren mit. "Das einst rote Dachau, es hat sich gehäutet", stellt Heinrichs Onkel entsetzt fest. Die Folgen der Häutung bekommt vor allem die junge, talentierte Künstlerin Nelly zu spüren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch
März 1933. Heinrich Bürgers zieht in den Künstlerort Dachau, um dort wie sein Onkel ein erfolgreicher Maler zu werden. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten interessiert ihn kaum. Unterdessen kann Bäckermeister Teufelhart, ein stolzer Nazi, sein Glück kaum fassen. Bürgermeister Seufert wechselt eilig die Partei, um im Amt zu bleiben. Pfarrer Pfanzelt hält Gottesdienste in Uniform. Der für seine kritischen Werke bekannte Künstler Kallert malt nur noch Landschaftsbilder. Wenige Wochen nach der Machtübernahme feiern der Pfarrer und Dachauer Bürger gemeinsam mit SA und SS einen Gottesdienst und marschieren durch die Straßen. Auch die Dachauer Künstler marschieren mit. „Das einst rote Dachau, es hat sich gehäutet“, stellt Heinrichs Onkel entsetzt fest. Die Folgen der Häutung bekommt vor allem die junge, talentierte Künstlerin Nelly zu spüren.
Autor
Florian Göttler, 1977 in Dachau geboren, beschäftigt sich in seinem fünften Roman mit den dunkelsten Jahren der deutschen Geschichte und seiner Heimatstadt.
Bisher von ihm erschienen:
Voll aufs Maul, satirischer Roman (2018)
Ein Heimatlied von Gier und Grausamkeit, Thriller (2020)
Der Friedhof der Dinge, Roman (2021)
Jahrhundertweltmeisterschaft, Sportsatire (2022)
Für Marie-Theres, meine Tochter, sowie Rosmarie und Kurt Göttler, meine Eltern
An einem entzückend warmen Spätnachmittag im März des Jahres 1933 stieg Heinrich Bürgers aus dem Personenwaggon des Zugs und tat seinen ersten Schritt hinein in den biederen Vorhof zur Hölle. Die Zugfahrt hatte ihn fröhlich gestimmt. Ihm gegenüber hatte ein adrettes junges Fräulein gesessen, erst knapp den Lehrjahren entflogen. Blondgelockt und prall wie man es gern skizzierte und malte, sofern der Anriss gelang und der Realität zumindest im Ansatz gerecht zu werden versprach. Kurz vor Dachau hatte sie einen kitschgelben Taschenspiegel und einen Lippenstift aus ihrer abgenutzten Handtasche gekramt und sich die dicken Lippen mit stechendem Rot bemalt. Heinrich fand, die Prozedur fügte dem Erscheinungsbild des Mädchens mehr Schaden zu, als sie ihm zuträglich war.
Heinrich stand auf dem Bahnsteig seiner neuen Heimat. Heimat, welch gewaltiges Wort. Er hatte in den Zwanzigerjahren, die auch Heinrichs Zwanzigerjahre gewesen waren, zu viele Heimaten gesehen, verlassen und vergessen. War achtlos von dannen gezogen und hatte die Erinnerungen an sie hinter sich weggefegt mit seeleninnigster Konsequenz, dass es nichts weniger als unanständig gewesen wäre, jeden neuen Ort und sämtliche, die diesem noch folgen mochten, Heimat zu nennen.
Heinrich folgte dem Fräulein gemächlichen Schritts über den Bahnübergang hinüber auf den Bahnhofsplatz. Dort fiel es wonnevoll kreischend einem stämmigen Mannsbild in die Arme, küsste ihn derb auf Mund und Stirn, wo der Lippenstift rotschimmernde Kleckse hinterließ. Der Angeschmierte, Kleidung, Aussehen und Auftreten zu schließen unverkennbar ein Arbeiter, revanchierte sich mit einem ungenierten Griff an die Brust des Mädels. Allzu scheinbar entrüstet klopfte das Mädel ihrem Freund auf die Finger und rief: „Dir muss ich wohl noch Benimm beibringen, bevor ich dich heirat.“ Arm in Arm schlenderten sie der Bahnhofsrestauration auf der anderen Straßenseite zu. Oben am Gleis pfiff der Schaffner zur Weiterfahrt.
Der Bahnhofsplatz leerte sich. Nun, da das Mädel sich mit ihrem Zukünftigen verzogen hatte, und es nichts mehr gab, das sich nachzublicken lohnte, bemerkte Heinrich, wie dreckstrotzend der Platz war. Überall lag Papier herum, nasse Handzettel, abgerissene und zerfetzte Plakate, dazwischen die Trümmer eines Waschbeckens, in der Platzmitte eine abgebrochene Straßenlaterne.
An der kaum noch ihren Putz haltenden Front des Bahnhofsgebäudes mühte sich eine Alte, mit Wasser und einem grauen Lappenfetzen, eine mit roter Farbe aufgetragene Schmiererei abzuwaschen. „…t den Führer!“, war in kindlich hingeschmierten Großbuchstaben zu erkennen.
Heinrich ging zu ihr. „Gute Frau, wo finde ich das Meldeamt?“
Die Frau drehte sich zu ihm um. Von vorn sah sie noch älter aus, als sie von hinten wirkte. Tiefe Furchen, wie von einem trunkenen Bauern gezogene Pflugscharen, durchrissen ihr mageres Gesicht. Das Kopftuch war weit nach hinten gerutscht. Hie und da besaß ihre ledrige Kopfhaut noch ein Quäntchen Kraft, dünne, weiße Haarsträhnen an der Flucht vor dem Verfall ihres Körpers zu hindern. Die Frau bleckte ihre wenigen verbliebenen, angefaulten Zähne. „Meldeamt? Kenn ich.“
„Können Sie mir sagen, wie ich dort hinkomme?“
Die alte Frau warf den Putzlumpen in den Eimer. Rotgraues Wasser spritzte gegen die schäbige Mauer. Aus dem Ärmel ihrer grauen Strickjacke rupfte sie ein Stofftaschentuch. Sie schnäuzte sich, wischte sich den Schweiß von der blassen Stirn und verstaute das Tuch wieder in ihrem Ärmel. „Wie spät ist es?“
Heinrich zog an der Kette seiner silbernen Taschenuhr und schnippte den Deckel auf. „Zehn vor fünf.“
„Feierabend“, sagte die Frau und trat den Eimer um. Rotes Wasser ergoss sich über das graue Pflaster. Heinrich trat einen Schritt zurück, seiner neuen Schuhe wegen.
„Für ein Fuchzgerl bring ich Sie hin. Wenn Sie den Eimer und die Lappen tragen.“ Sie hob den Blecheimer auf und stopfte ein knappes Dutzend Lumpen hinein, die sie während des Tages zu einem kleinen, emsig triefenden Haufen zusammengeworfen hatte. Dann reichte sie Heinrich den Eimer.
Die Alte war nicht gut zu Fuß. Schwer atmend zog sie ihr linkes Bein nach. Vor drei Jahren sei ein Automobil drübergefahren. „Der Doktor im Krankenhaus hat es schon abschneiden wollen. Aber sie hatten kein Narkosezeug, also haben sie es drangelassen.“ Die Frau blieb stehen und bekreuzigte sich. „Gott sei Dank hat der Herrgott das Narkosemittel ausgehen lassen. Jetzt hab ich’s noch, das Bein. Weiß nur der Herrgott, was aus mir und meinem lieben Josef geworden wäre, wenn sie’s abgenommen hätten. So kann ich wenigstens noch putzen. Mein guter Josef ist Kriegszitterer, mit einem Arm weniger. Kann nicht arbeiten, der gute Josef.“
„Glauben Sie, dass wir es noch rechtzeitig ins Meldeamt schaffen?“, fragte Heinrich.
Die Frau schleppte sich weiter. „Nicht wenn Sie so trödeln.“
Sie kamen zu einer Brücke über einem Fluss. Dahinter erhob sich ein Hügel, vielleicht vierzig Meter hoch. Oben thronte ein Gebäude, das man als Schloss bezeichnen konnte, weiter rechts drängten sich stolze Fassaden in bunten Farben aneinander, ehe sie im Osten hinter spärlich grünenden Bäumen verschwanden. Noch weiter östlich trieben Schornsteine grauen Rauch in den Himmel. Unter den Häusern auf dem Hügel streckten sich Gärten hangabwärts zu einem Bach hin.
„Da oben wohnen die Großkopferten“, sagte die alte Frau. „Ich muss jetzt hier links, ins Armenviertel. Mein Josef und ich, wir haben auch mal da droben gewohnt. Jetzt sind wir in der Armensiedlung. Ist noch ein Kilometer bis zur Armensiedlung. Der Eimer mit den Lumpen ist schon recht schwer.“
Heinrich zog an der Kette seiner Uhr. „Es ist schon weit nach fünf. Sie sagten, um halb sechs schließen die Ämter.“
Die Alte deutete in Richtung einer Straße, die nach der Brücke links von der Hauptstraße abging. „Den Karlsberg rauf. Rechts ist das Rathaus. Aber da ist schon zu. Gehen sie links runter zur Druckerei Zauner. Beim Zauner können Sie sich noch in einer Stunde melden, so gutmütig wie der ist. Er hat meinem Josef und mir die Armenwohnung besorgt. Kann man immer hingehen, zum Zauner, wenn man was muss. Sie haben also genug Zeit, meinen Kübel heimzutragen. Danach gehen Sie zum Zauner und richten ihm einen schönen Gruß aus vom Reserl Kurbinjak.“
Heinrich blickte auf seine Uhr. Es würde spät werden, ehe er bei seinem Onkel klopfen konnte. Er wollte seinen Gastgeber nicht mit einer mehrstündigen Verspätung vor den Kopf stoßen. Andererseits kannte er den Onkel kaum. Der Onkel hatte sich vor dreißig Jahren aus dem Familienkreis verabschiedet und sich seitdem nur zu den wichtigsten Familienanlässen gezeigt. Nun bot sich Heinrich die Gelegenheit, endlich mit eigenen Augen ein Armenviertel zu beschauen. Es dämmerte bereits schwer. Dennoch würde es sicherlich einiges zu sehen geben. „Frau Kurbinjak“, sagte er, „ich trage Ihnen den Eimer nach Hause. Dann gehe ich zu Zauner.“
Frau Kurbinjak humpelte mit Heinrich ins Armenviertel, wo das alte Weib von einer Horde Kinder empfangen wurde wie ein Pharao. Schmutzige Kinder stoben aus den Hauseingängen und Hinterhöfen und umringten sie. „Hast uns was vom Bahnhof mitgebracht?“ „Hast du einen Pfefferminz?“ „Ist der Mann mit dem Eimer dein neuer Geselle?“
Die Alte winkte ab und hinkte weiter. „Gar nichts hab ich für euch heute. Lasst mich in Ruhe, ich bin todmüde.“
Ein Mädchen, vielleicht sechs Jahre alt, das Alter von Kindern schätzen, darin war Heinrich nicht kompetent, zupfte am Ärmel der Alten. „Nimmst du mich morgen mit zum Putzen? Für zwanzig Pfenning geh ich mit.“
Die Alte wischte dem Kind unwirsch durchs Haar, eine grobe Zärtlichkeit, die mehr einem Versuch glich, der Kleinen ein Büschel Haare auszureißen als es zärtlich zu streicheln. „Du gehst morgen in die Schule und nirgendwo anders hin. Punkt.“ Dann deutete sie auf Heinrich. „Aber mein neuer Geselle zahlt jedem von euch ein Zehnerl dafür, dass er meine Lumpen heimtragen durfte.“
Augenblicklich umringten die Kinder Heinrich, streckten ihm die Händchen entgegen und zupften mit ungewaschenen Fingern an seinem Anzug.
„Wollt ihr wohl weg von mir“, rief Heinrich.
Die Kinder wichen zurück, aber liefen nicht davon. Zwei Armlängen entfernt reckten sie ihm weiterhin die Hände entgegen. Heinrich mochte nicht in ihre Gesichter sehen. Er griff in seine rechte Hosentasche, in der er stets ein paar Münzen bei sich trug, und gab jedem Kind ein Geldstück. Ein jedes lief nach der Gabe sofort nach Hause.
Zehn Meter weiter sah Heinrich die alte Kurbinjak auf den Stufen eines völlig heruntergekommenen Hauses sitzen. Die Alte nickte ihm zu und rief: „Jetzt aber schnell zum Zauner.“
Heinrich winke ihr, sah wieder auf seine Uhr und wandte sich zum Gehen. Dann hielt er inne, drehte um und setzte sich zu der Alten auf die Holztreppe. Er reichte ihr ein Markstück.
„Das ist mehr, als wir ausgemacht haben. Und zum Meldeamt hab ich Sie auch nicht gebracht. Sie sind mir keinen Pfennig schuldig“, sagte die Alte.
„Nehmen Sie es trotzdem. Doch verraten Sie mir, was stand an der Mauer am Bahnhof geschrieben?“
Die Alte blickte ins schlammige Nichts der Straße. Sie sagte: „Was wünschen Sie sich denn, dass dort gestanden hat?“
Heinrich folgte dem Blick der Alten in den Schlamm. „Ich wünsche mir nichts. Ich bin unpolitisch.“
Die Alte hievte sich hoch, zog die Eingangstür auf, und ehe sie die Tür hinter sich schloss, konnte Heinrich noch hören: „Reich und unpolitisch. Das sind mir die Schlimmsten.“
Heinrich blieb noch eine Weile in der Armensiedlung und sah sich um. Über den Kaminen der verwitterten und windschiefen Häuschen machten sich schwarze Rauchschwaden davon. Der Weg zwischen den Häusern glich mehr einem matschigen Trampelpfad als einer tatsächlichen Straße. Heinrich bemitleidete seine Lederschuhe. Aus einem Haus drang rasselnd Husten, aus dem nächsten die ungeniert gebrüllte Drohung eines Mannes, dass gleich der Watschenbaum umfalle, wenn nicht sofort Ordnung geschaffen wurde. In der Küche sehe es aus wie hinterm Zigeunerwagen. Zwischen den Häusern standen hölzerne Klohäuschen, aus denen ein gottserbärmlicher Gestank wehte. Am Ende des Wegs saß ein Buckliger vor einer Holzhütte auf einem Hocker, dessen drei Holzbeine sich tief in den Morast gebohrt hatten, und schärfte mit einem Schleifstein eine rostige Sense. Als Heinrich sich näherte, blickte der Bucklige auf und grinste ihn mit fauligen Zähnen an. „Hast dich wohl verlaufen, Bürscherl.“
Heinrich zog höflich seinen Hut und sagte, er sehe sich nur ein wenig um.
„Hier geht’s nicht weiter. Hier ist Ende“, sagte der Bucklige und widmete sich wieder dem Schleifen der Sense.
Heinrich wünschte einen guten Abend und machte kehrt. „Am Ende, da sitzt der Schnitter. Merk dir das, Bürscherl, merk dir das fürs Leben. Am Ende, da sitzt der Schnitter mit der Sense.“ Heinrich klang das spöttische Lachen noch in den Ohren, als er die Armensiedlung längst hinter sich gelassen hatte.
Als Heinrich Bürgers endlich den alten Markt auf dem Hügel erreichte, war die Sonne längst untergegangen. Hier und dort warf eine Straßenlaterne gilbgelbes Licht auf die Pflastersteine. Die Wärme des Tages hatte sich verkrochen und der Kälte der Nacht kampflos das Feld überlassen. Ein eisiger Wind pfiff durch die Gassen und trieb die Bewohner in ihre Stuben. Die Fensterläden der meisten Häuser waren verrammelt. Nachts geizte der alte Künstlerort mit seinen Reizen. Heinrich kannte den Markt Dachau von einigen Skizzen und Büchern, die sein Onkel ihm geschickt hatte. Keines der Werke zeigte Dachau bei Nacht. Nun kannte Heinrich den Grund.
Oben am Karlsberg huschte eine Ratte über die Straße und verschwand durch ein Mauerloch in einem Haus. Über dem Eingang des Gebäudes stand in verwitterten Buchstaben: Bezirksamt. Heinrich ließ es links liegen, ebenso eine Gastwirtschaft, deren miserablen Zustand der Fassade selbst die dunkle Dachauer Nacht nicht zu verbergen in der Lage war. Dann stand er vor dem Eisentor der Druckerei Zauner. In der Werkstatt brannte Licht. Heinrich öffnete das Tor. Überrascht stellte er fest, dass es nicht in seinen Angeln quietschte. Er ging in den Hof und klopfte mit den Fingerknöcheln vorsichtig gegen die Tür neben dem erleuchteten Fenster.
Zauner sah nicht aus wie ein Drucker. Er trug einen Anzug, der sich in Schnitt, Stoff und gewiss auch im Preis mit Heinrichs zu messen vermochte. Zauner trug die Haare akkurat gescheitelt, der Schnurrbart erfreute sich kräftigen Wuchses und erkennbarer Pflege. Heinrich schätzte ihn auf fünfzig Jahre und wohlhabend. Für jemanden, der gegen acht Uhr nachts von einem Fremden aufgesucht wurde, erwies sich Zauner als freundlich, ja angenehm überrascht. „Soso, das Lumpenreserl hat Ihnen also gesagt, dass Sie zu mir kommen sollen. Hat es Sie auch in die Armensiedlung verschleppt?“
Heinrich nickte.
„Welches Bein hat sie denn heute nachgezogen?“
„Ich verstehe nicht.“
„Das Reserl wurde wahlweise von einem Automobil überrollt, von der Eisenbahn angefahren oder von einem Ochsen getreten. Mal links, mal rechts, ganz nach Laune.“ Zauner lachte und schüttelte den Kopf. „Kommen S’ rein. Ist ja wieder eiskalt heut Nacht.“
Die Druckerei wirkte gut ausgestattet und geradezu penibel aufgeräumt und sauber. Entweder wurde hier überhaupt nicht gearbeitet oder ausgesprochen gewissenhaft. Dass zweites der Fall war, verriet der angenehme Geruch von Druckerschwärze. Heinrich liebte diesen Geruch und versäumte es nicht, dies seinem Gastgeber mitzuteilen.
„Sind Sie vom Fach?“, fragte Zauner. „Sie sehen mir nicht aus wie ein Drucker.“
„Ich habe das Schriftsetzerhandwerk erlernt. Es ist bereits eine Weile her.“
„Und was sind Sie nun?“
„Ich bin Kunstmaler.“
Zauner klopfte sich mit der flachen Hand auf den Oberschenkel und stieß ein herzliches Lachen aus. „Das passt ja wunderbar. Bis gerade eben hat es in Dachau nämlich exakt einen Kunstmaler zu wenig gegeben. Auf Armenhilfe brauchen Sie gar nicht erst spekulieren, so viel ist sicher. Wir haben schon genügend eigene Arbeitslose und Hungerlöhner.“
„Das habe ich heute mit eigenen Augen gesehen und mit meiner Nase gerochen. Ich habe mein eigenes Auskommen, Herr Stadtrat.“
„Zu viel der Ehre. Ich bin Gemeinderat. Dachau ist keine Stadt, wir sind ein Markt. Noch. Aber schön zu hören, dass Sie uns nicht auf dem Stadtsäckel liegen werden. Sonst bleibt am Ende nichts mehr über für das Lumpenreserl und ihren versoffenen Gatten.“
„Hätte ich das Kriegszittern und nur noch einen Arm, würde ich auch saufen“, sagte Heinrich.
„Gut gesprochen, junger Mann. Wenn’s nur wahr wäre, dass der alte Kurbinjak das Kriegszittern hat. Der zittert nur, wenn er nichts zum Saufen bekommt. Von seinen Armen hat er auch noch beide. Wie viel hat ihnen das Reserl denn abgeluchst?“
Heinrich winkte ab. „Nur ein Markl.“
„Und die Kinderhorde?“
„Vielleicht zwei oder drei Mark. Sie sollen es haben. Es bringt mich nicht um.“
Zauners Miene verfinsterte sich. „Trotzdem geht es nicht, dass das Lumpenreserl alle Neuankömmlinge in die Armensiedlung verschleppt und ausnimmt. Was macht denn das für einen ersten Eindruck!“
„Immerhin hat sie mir den Rat gegeben, zu Ihnen zu kommen.“
Zauner fand zu seiner guten Laune zurück. „Da haben Sie auch wieder recht. Schreiben Sie mir doch ihre Meldedaten auf, damit ist das Behördliche geregelt. Dann müssen Sie auf dem Amt nur noch ihre Papiere vorzeigen. Die haben eh anderes zu tun gerade. Sie müssen wissen, unser Rathaus bröckelt allmählich zusammen.“ Zauner reichte Heinrich einen Zettel und einen Bleistift. Er hielt inne und legte beides wieder weg. „Ich habe eine bessere Idee. Ich hole uns jedem ein Bier, und dann setzen Sie mir Ihre Meldung selbst.“
Heinrich brauchte ein paar Minuten, um sich in der Systematik des Setzkastens zurechtzufinden. Aber mit jedem Wort, das er setzte, gelang es ihm besser. Immer wieder musste er innehalten, weil Zauner ihn zum Prosten aufforderte. Der Druckereibesitzer hatte seine helle Freude an der Aufgabe, die er dem Neuankömmling gestellt hatte. Sie hatten ihre Bierflaschen noch nicht ganz ausgetrunken, als Heinrich dem Gemeinderat das Ergebnis seiner Setzarbeit überreichte.
Zauner verstand sein Metier offenbar bestens. Das spiegelverkehrte Lesen der Meldung fiel im kinderleicht. „Name: Heinrich Bürgers, Kaufmannssohn. Geboren am 13.02.1900 zu Köln. Beruf: Kunstmaler. Stand: Ledig. Letzte Meldestelle: Worpswede im Freistaat Preußen. Meldeadresse: Bürgers-Anwesen, Herzog-Albrecht-Straße 1.“ Zauner klopfte sich wieder auf den Schenkel. „Ja sagen Sie das doch gleich, dass Sie ein Bürgers sind. Herrgott, wie ich mich freue, dass ich der Erste bin in Dachau, der mit Ihnen Gesellschaft hat.“
„Abgesehen von Frau Kurbinjak.“
„Die wollen wir jetzt einfach mal vergessen. Herzlich willkommen in Dachau. Darf ich fragen, in welchem Verhältnis Sie zum Herrn Professor stehen?“
„Ich bin sein Neffe.“
„Dann grüßen Sie mir den werten Herrn Onkel, unseren hochgeschätzten Felix, doch bitte recht herzlich von mir. Ich habe einen Bürgers oben in der Stube hängen, einen ganz ausgezeichneten.“ Zauner stieß noch einmal mit Heinrich an und trank seine Flasche leer. „Wenn Sie nur ein Quartl des Talents ihres Onkels im Blut haben, werden Sie hier sicherlich ein prächtiges Auskommen haben. Herrlich ist’s in Dachau für Leute von Ihrem Schlag, das kann ich Ihnen in die Hand versprechen.“
Es dauerte noch eine Weile, bis Zauner sich ausgeredet hatte, und Heinrich sich mit dem Hinweis, nicht erst in tiefster Nacht beim Onkel erscheinen zu wollen, sich von ihm verabschieden konnte. Im aus dem Fenster dringenden Licht der Werkstatt sah Heinrich auf seine Taschenuhr. Es war schon neun. Die Glocke des gegenüber des Zaunerschen Anwesens hochaufragenden Kirchturms begann zu schlagen. Es war eiskalt. Heinrich ärgerte sich, seinen Mantel in der Truhe verschickt zu haben. Er nahm eine Zigarette aus seinem versilberten Zigarettenetui, duckte sich in den windgeschützten Winkel zwischen Tor und Mauer und strich ein Zündholz an.
Das traurige Quietschen eines elenden Keilriemens kündigte das Nahen eines Motorfahrzeugs an. Das Geräusch kam von rechts, wohl eben von dort, wo Heinrich vor einer Stunde den Berg hinaufgeschritten war. Ein lautes Knirschen ließ vermuten, dass entweder das Getriebe des Fahrzeugs sehr alt oder der Lenker desselben sehr jung war. Irgendwann hatten der Wagen und der Fahrer ihr Ziel erreicht. Keilriemen, Getriebe und Motor verstummten. Stiefel prasselten auf Stein. Laute Rufe gellten durch die Nacht. „Ihr zum Bezirksamt, der Rest zum Rathaus.“ „Die Fahnen nicht vergessen.“ „Wer sich entgegenstellt, wird festgesetzt.“ „Meldung sobald Bereich gesichert und Fahnen gehisst.“ Nun auch klopfende Stiefel von links. Heinrich duckte sich in die Ecke und drückte mit der Schuhsohle seine Zigarette aus. Braunhemden eilten am Tor vorbei den Berg zum Rathaus hinauf. Keiner von ihnen nahm ihn war. „Jetzt geht’s endlich los“, rief einer und lief bergauf, sein Gewehr im Anschlag. „Wenn die nur wüssten, dass unsere Schießprügel leer sind“, flüsterte ein anderer. „Maul halten und weiter“, befahl ein Dritter.
Heinrich schlich zurück in den Hinterhof und klopfte vorsichtig an die Tür der Druckwerkstatt. Zauner öffnete.
Heinrich wartete nicht darauf, hineingebeten zu werden, schob Zauner beiseite, trat ein und schloss eilig die Tür. „Bewaffnete. Draußen. Da geht was vor.“
Zauner führte Heinrich zum Stuhl am Setzkasten. „Ich hole uns noch einen Trunk.“ Dann verschwand er durch eine Tür, die offenbar ins Wohnhaus führte. Wenig später erschien er mit zwei Bierflaschen der Schlossbergbrauerei. Er zog sich einen Stuhl heran und setzte sich. „Dann geschieht es also gerade.“
„Was geschieht?“, fragte Heinrich.
„Sie nehmen sich das Land“, sagte Zauner. „Wo haben Sie in den letzten Wochen gelebt? Es geschieht überall.“
Heinrich trank hastig einen Schluck und fragte, ob er ausnahmsweise in einer Druckerei rauchen dürfe.
Zauner nickte generös und bat um eine Zigarette.
Heinrich reichte ihm eine Zigarette und riss ein Streichholz an. „Wenn ich richtig gesehen habe, waren es SA-Männer.“
Zauner nickte wieder. „Wer soll es sonst sein? Sie lassen es sich eben nicht gefallen, dass man uns den Reichstag mir nichts dir nichts abgefackelt hat.“
„Ich bin unpolitisch. Ich will nur wissen, ob ich ungeschoren zum Haus meines Onkels komme.“
Zauner lächelte milde. „Wenn Sie aufgehalten werden, sagen Sie einfach, dass Sie beim Gemeinderat Zauner waren.“
Auf der Straße herrschte hektisches Treiben. Braunhemden stoben hin und her und brüllten sich Befehle und Meldungen in die Gesichter. Am Fahnenmast vor dem Bezirksamt werkelten drei SA-Männer und zerrten an einem Seil, bis eine riesige rotweiße Flagge in den Nachthimmel emporstieg. Oben am Fahnenmast angekommen blies eine kräftige Bö in das Tuch und entfaltete es zu voller Größe. Das Hakenkreuz wehte über Dachau, und unter ihm jubelten die Braunhemden. Einer von ihnen deutete plötzlich auf das Rathaus, das sich dunkel über den Platz auf der anderen Seite der Karlsbergstraße erhob. Dort stand im zweiten Stockwert ein SA-Mann in einem Fenster und jubelte. Anschließend machte er sich daran, ein Hakenkreuzbanner aus dem Fenster zu hängen und am Fenstersims zu befestigen. Unten auf dem Platz sammelten sich die Braunhemden. Auch ein paar Schwarze waren zu sehen, SS. Alle reckten den Arm zum Deutschen Gruß und intonierten das Deutschlandlied. Einige trugen Gewehre und sangen besonders laut. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite versammelten sich Schaulustige und beobachteten stoischen Blicks das Schauspiel, als wäre es nicht der erste Aufruhr, den sie zu sehen bekamen. „So lang sie nichts zerschlagen“, sagte einer. Auf dem Rathausplatz klapperten die Stiefelsohlen. Der Trupp marschierte den Karlsberg hinunter und verschwand in der Nacht. Vor dem Rathaus blieben zwei SA-Männer zurück. Sie hatten ihre Gewehre an die Fassade gelehnt und rauchten. Auch am Fahnenmast vor dem Bezirksamt standen zwei Männer mit Gewehren. Als Heinrich sie passierte, sagte er vorsichtshalber: „Ich komme vom Gemeinderat Zauner.“
„Uns doch egal, von wem du kommst“, schnaubte einer.
Heinrich ging den Karlsberg hinunter, langsam, obwohl der Wind ihm eiskalt ins Gesicht blies. Er wollte auf keinen Fall den SA-Trupp einholen.1
Professor Felix Bürgers und sein Bruder Otto Bürgers, Heinrichs Vater, standen seit Jahrzehnten in regelmäßigem Briefkontakt. Seit Felix Bürgers vor über dreißig Jahren der Familie und der väterlichen Tabakfabrikation den Rücken gekehrt und sich für ein Künstlerleben entschieden hatte, sahen sich die Brüder nur selten. Otto Bürgers schrieb mindestens zweimal im Jahr, um den Bruder Felix über die Fabrikation auf dem Laufenden zu halten und über die Rendite seiner Anteile zu informieren. Es hatte bittere Jahre gegeben, besonders während des Weltkriegs und in den darauffolgenden Jahren, aber geraucht wurde immer. So war es Felix Bürgers von Abstammung und Schicksal vergönnt, zusammen mit seiner innig geliebten Gattin Gertrud ein recht sorgenfreies Leben zu führen. Felix Bürgers war wirtschaftlich nicht auf den Verkauf seiner Bilder angewiesen. Vielleicht gerade deshalb verkauften sie sich seit vielen Jahren ganz hervorragend. In Dachau war er längst eine Berühmtheit, an Wertschätzung und Verehrung, die ihm hier die Bürger entgegenbrachten, allenfalls übertroffen von Stockmann und von Ruckteschell. Auch über Dachau hinaus genoss Felix Bürgers erfreuliche und einträgliche Bekanntheit. Seine Bilder hingen in Galerien und Museen allerorten im Reich. Nachdem sich vor zwei Jahren eine stattliche Feuersbrunst im Münchner Glaspalast auch an einer Anzahl seiner Gemälde gütlich getan hatte und von seiner grandiosen Kunst nur Asche übriglies, hob Bürgers ob der Zerstörungskraft der Elemente nur demütig die Schultern und ließ lakonisch verlauten: „Welch Hybris zu glauben, meine Werke taugten für die Ewigkeit.“ Er malte einfach weiter.
Südlich der Amper, einige hundert Meter entfernt vom Hügel des Marktes Dachau und abseits des regen Treibens und Verkehrs auf der Münchner Straße, hatten Felix Bürgers und seine Gattin ein stattliches Haus errichten lassen, mit einem großen Atelier darin für sie beide, denn auch Gertrud war eine talentierte Kunstmalerin. Obwohl sie sich an Wertschätzung und Verkäufen nicht mit ihrem Gatten messen konnte, hielt der Professor sie für die Begabtere. Immer noch ertappte er sich hin und wieder dabei, seiner Gertrud bei der Schattierung und Farbwahl etwas abzuspicken. Dann lachte er ebenso gnädig wie diebisch über seine Unzulänglichkeit und freute sich des glücklichen Lebens und Schaffens, das der Herrgott ihm und seiner Gertrud vergönnte.
Nun, da ihr Sprössling, ein wohlgeratener, eifriger und wissbegieriger Sohn längst das elterliche Haus verlassen und in die Fremde gegangen war, führten der Professor und seine Gattin ein ruhiges und doch nicht einsames Leben. Im Hause der Bürgers spielten sich herrliche Abendgesellschaften ab. Nicht herrlich, weil sie etwa zu allzu ausschweifenden Belustigungen ausarteten, sondern da sie dank der ansteckenden Beredsamkeit und der bescheidenen Klugheit der Gastgeber das für einen gelungenen Zeitvertreib notwendige Niveau garantierten und jedermann, der daran teilhaben durfte, ein wohliges Gefühl von Bedeutsamkeit verschafften. Zu den Bürgers ging man gern. Stolz war, wer eine Einladung erhielt.
Im Februar hatte sich der geschäftsmäßige Ton in den Briefen seines Bruders Otto verändert. Nach seiner nüchternen Darlegung der Geschäftszahlen – sie waren gut mit Aussicht auf weitere Besserung – schrieb Otto: „Geliebter Bruder, es lastet mir schwer auf dem Herzen, dich um einen Gefallen zu bitten. Mein Sohn Heinrich, du erinnerst dich vielleicht an ihn von deinen seltenen Besuchen in unserem schönen Rheinland, bereitet mir schwere Sorgen. Der goldene Löffel, mit dem ihn meine Gemahlin, Gott habe sie selig, aufzuziehen pflegte, ist ihm nicht gut bekommen. Schon als Kind war sein Naturell nicht leicht zu bändigen. Erinnerst du dich an die Geburtstagsfeier unseres Vaters im Jahre 1908, als Heinrich mit Kreide den Rhein und den Kölner Dom an die Wand des Kinderzimmers kritzelte, um dich, den für ihn so mysteriösen Maleronkel, zu beeindrucken? Nach seinem Schulabschluss verweigerte Heinrich sich einer kaufmännischen Ausbildung, sperrte sich tagelang in seinem Zimmer ein. Schließlich gewährte ich ihm eine Lehre zum Schriftsetzer, um des lieben Friedens willen, und weil ich mir doch letzten Endes eingestehen musste, einen Sohn gezeugt zu haben, der in der Tabakfabrikation mehr Schaden anrichten würde als Nutzen. Nach der Lehre verschwand Heinrich auf nahezu Nimmerwiedersehen. Eine von mir beauftragte Detektei fand ihn im Industriegebiet an der Ruhr auf, aber er verweigerte eine Rückkehr. Mit den Jahren haben Agathe und ich uns damit abgefunden, dass unser Sohn schmerzlich mehr nach dir schlägt als nach uns, und wir ihn vielleicht nie mehr sehen werden. Im Februar des Jahres 1927 stand er unverhofft vor unserer Tür. Wir hießen ihn willkommen und nahmen ihn auf, herzensfroh ihn wohlauf wiederzuhaben. Heinrich aber verlangte nur sein Erbe. Du siehst, die Kirchenschule hat ihm nicht geschadet. Er hat sein Lukas-Evangelium gut gelesen. Agathe und ich gewähren es ihm. Heinrich ging nach Schwaan. Er wollte Künstler werden. Später bekamen wir eine Postkarte aus dem niederländischen Volendam und einen Brief aus Barbizon in Frankreich. Dann wieder hörten wir jahrelang nichts. Nun erreichte uns eine beängstigende Nachricht aus dem preußischen Worpswede. Man habe ihn drei Tage lang in Schutzhaft genommen, den Grund wollte er nicht verraten. Er könne nicht weiter dortbleiben, wolle aber auch nicht zurück zu uns. Deswegen ersuche ich dich, mein lieber Bruder, willst du ihn aufnehmen? Er ist Künstler wie du, vielleicht findet er bei dir sein Glück. Er wird dir nicht zur Last fallen. Sein Erbe ist stattlich. Vielleicht gelingt es dir, ihm zu einem stetigeren und reelleren Leben zu verhelfen. Um baldige Antwort bittet dein dich innig liebender Bruder.“
Felix Bürgers saß im Salon seines Hauses und las in einem Pflanzenlexikon. Der Gletscher-Mannsschild und die Herzblättrige Kugelblume in seinem Alpinum bereiteten ihm seit Jahren Sorgen. Im letzten Jahr war die Ansaat nicht aufgegangen, und die zugekauften Pflänzchen, die er mit zärtlicher Hand zwischen Enzianen und Kuhschellen in die Erde gesetzt hatte, als gelte es ein mildes Abendrot in Öl zu malen, spotteten jeglicher Fürsorge und Pflege und gingen nach wenigen Tagen ein. Dabei war Felix Bürgers ein begabter Gärtner und belesener Florist. Der Garten der Bürgers war einer der prächtigsten im ganzen Markt. Das Alpinum bildete das Herzstück des Gartens. Felix Bürgers widmete sich ihm mit einer Liebe, die jene zu seiner Gattin beinahe übertraf, wie Gertrud hin und wieder behauptete. Der Professor pflegte daraufhin zu antworten, sie liege in dieser Angelegenheit durchaus richtig, woraufhin er ihr mit einem Kuss auf ihre Wange das Gegenteil bewies.
Bürgers blätterte im Lexikon. Es wollte ihm nicht helfen. Der triviale Hinweis, die Aufzucht der Herzblättrigen Kugelblume erfordere besondere Erfahrung und Pflege, ärgerte ihn. Es war das zweite Mal, dass er sich heute ärgern musste. Ein seltenes Vorkommnis. Am Vormittag hatte ein Transporteur mit einem kleinen Lastkraftwagen eine schwere Reisetruhe angeliefert und eine Nachricht des Besitzers übermittelt, dessen Ankunft seit spätestens am frühen Abend zu erwarten. Inzwischen war es schon nach zehn Uhr. Felix Bürgers befürchtete, morgen seinem Bruder Otto telegrafieren zu müssen, dass Heinrich nicht eingetroffen war, als jemand die Salontür öffnete. Es war Gertrud. „Genug studiert, Felix. Ich möchte dir deinen Neffen vorstellen.“
Professor Bürgers hatte seine Staffelei weit draußen im Moor aufgestellt. Die Silhouette des alten Dachauer Marktes glänzte in der Frühlingssonne. „Das Herrlichste am Malen im Dachauer Moos ist, dass einem die Sonne den Rücken wärmt.“
Heinrich, der sein Quartier wenige Meter neben Felix’ Staffelei aufgeschlagen hatte, zündete sich eine Zigarette an. Während Felix mit schwarzer Kohle eifrig eine Skizze anzeichnete, gähnte Heinrichs Leinwand leer in der Sonne.
„Steht dir heute nicht der Sinn nach Kunst?“, fragte der Professor ohne den Blick von seiner Leinwand abzuwenden.
Heinrich warf seine Zeichenkohle fort. Zehn Meter vor seiner Staffelei plumpste sie in eine grünbraune Pfütze.
Felix seufzte ohne seine Arbeit zu unterbrechen. „Frösche zeichnen nicht. Malermaterial ist rar in diesen Tagen.“
Heinrich zog an seiner Zigarette und deutete auf die Landschaft vor ihm. „Es spielt doch keinerlei Rolle, ob ich dieses Nichts male oder gar nichts male.“
„Na hör sich das einer an. Zu mir kannst du so etwas sagen, ohne eine Tracht Prügel befürchten zu müssen. Aber erzähl das bloß nicht den Leuten von der Künstlervereinigung. Im Übrigen lebe ich ganz gut davon, das Nichts zu malen.“
„Ich male eben anderes.“
„Das weiß ich. Ich habe mir deinen Katalog angesehen. Dein Vater hat ihn mir vor deiner Ankunft geschickt. Du bist gut.“
Heinrich fühlte Stolz. „Nicht halb so gut wie du, Onkel.“
„Ich bin auch dreißig Jahre älter und mache das schon eine Weile länger als du. Es wäre traurig, wenn ich nicht besser wäre.“
„Aber warum malst du diese Landschaft? Sie wird auch noch in hundert Jahren dastehen. Warum malst du nicht, was jetzt ist?“
Felix hörte auf zu skizzieren. „Ich male durchaus, was jetzt ist. Genau jetzt. Ich rate dir, mit den Umrissen zu beginnen. Die Farben und Schatten werden erst am späten Nachmittag interessant, der Himmel abends. Farben und Himmel male ich oft im Atelier. Ich habe schon viele Nachmittagsfarben und Abendhimmel kommen und gehen sehen.“
„Ich will auch nicht Landschaften malen, wie sie sich jetzt oder später oder am Abend darstellen.“ Heinrich klang wie ein renitentes Kind.
Felix breitete die Arme aus und lachte. „Dann ist das weite Moos wahrlich der falsche Ort für dich.“
Heinrich warf seine Zigarette ins Gras. „Ich will malen wie Kallert. Seine Elendsbilder sind famos. Stell mich ihm vor.“
Der Onkel seufzte. „Das kann ich gerne für dich arrangieren. Ich lade ihn für Samstagabend ein. Ohnehin gibt es viel zu besprechen.“
Heinrich bedankte sich und begann seine Leinwand und die Staffelei abzubauen. „Mein Vater hat dir also meinen Katalog geschickt. Ich wusste gar nicht, dass er ihn gekauft hat.“
Felix Bürgers lächelte mild. „So etwas tun Väter nun mal für ihre Söhne. Auch für die Verlorenen.“
Heinrich Bürgers fand nicht in den Schlaf. Es war schon zwei Uhr morgens. Durch das Fenster des Zimmers, das ihm seine Tante Gertrud im Bürgersanwesen zugewiesen hatte, strahlte der Mond. Seine Tante hatte ihn gebeten, die Fensterläden bis Mai nachts zu schließen, der Wärme wegen. Heinrich ließ sie dennoch offen. Dunkelheit war ihm ein Graus. Normalerweise hatte er kein Problem mit dem Einschlafen, vor allem, wenn er am Abend reichlich getrunken hatte. Während der Gesellschaft, zu der sein Onkel geladen hatte, hatte er sogar überreichlich getrunken, aber der Schlaf, Schopenhauers kleiner Bruder des Todes, weigerte sich beharrlich, ihn zu übermannen und ihn hinab in die ersehnte Leere des Nichtfühlens und Nichtwollens zu stürzen.
Die Begegnung mit Kallert war enttäuschend verlaufen. Der Onkel hatte nicht nur Kallert mitsamt Gattin eingeladen, sondern noch weitere Gäste. Eine hieß Paula Wimmer, eine wortgewandte Frau, schön aber alt. Außerdem erschien ein skandinavischer Maler namens Petersen mit Gemahlin, beide ebenfalls klug, und ein etwa sechzig Jahre zählender Mann, Karl Schröder, der sich Heinrich als „Schröder-Tapiau“ vorstellte. So wolle er genannt werden und nicht anders. Das affektierte Auftreten des Schröder-Tapiau und die Anwesenheit der anderen Gäste waren für Heinrich nicht das größte Ärgernis, sondern Kallert selbst, der ihm nach höflicher Begrüßung und Vorstellung keinerlei Beachtung mehr schenkte. „Ich selbst bin ebenfalls glücklicher Onkel“, hatte Kallert gesagt, als er Heinrichs Hand kurz schüttelte, sich mit seinen Worten aber nicht an Heinrich, sondern an den Onkel wandte. Noch dazu hatten sie in den folgenden Stunden nahezu ausschließlich über Politik gesprochen. Onkel Felix hatte den ganzen Abend lang keinen einzigen Versuch unternommen, Heinrich als Künstler vorzustellen.
Nachdem alle im Salon zusammengekommen waren, leitete Felix Bürgers den Abend ein. „Meine geliebte Gattin besitzt beharrlich meinen Wünschen trotzend nur zwei Beine und zwei Arme. Sie hat den ganzen Tag gewirkt, um uns einen bekömmlichen Abend zu bereiten. Wessen Glas bald leer ist, den bitte ich, sich selbst zu bedienen. Wem der Magen knurrt, dem hat Gertrud Brot und Wurst und auch ein wenig Käse zurechtgeschnitten. Man greife nach Belieben zu.“ Nach seiner Begrüßung setzte sich Felix Bürgers in seinen Sessel, verschränkte die Finger seiner Hände und blickte ins Kaminfeuer.
Kallert stand auf und hob das Glas: „Lieber Felix, es ist mir immer wieder aufs Neue eine Ehre bei dir und deiner Gertrud zu Gast zu sein. Ich bin stolz, dich Freund nennen zu dürfen.“
„Das heißt jetzt Volksgenosse“, sagte Paula Wimmer. Die zarten Gesichtszüge der Frau verrieten nicht, ob sie ihren Einwurf ernst meinte oder als Scherz verstanden wissen wollte.
Damit war die Abendgesellschaft bei der Politik angekommen. „Hör gut zu, Heinrich“, mahnte Felix Bürgers seinen Neffen, der dem Wein allzu offenkundig mehr Aufmerksamkeit schenkte als dem Gespräch. „Wer die Menschen und nicht die Landschaft malen will, der muss wissen, was sie tun.“
Heinrich vermochte seine aufsteigende Wut über die belehrende Äußerung des Onkels kaum zu verbergen. Er blickte kurz zur Tür, blieb aber sitzen.
Jeder wusste etwas zu berichten. Paula Wimmer war offenbar am besten informiert über die Ereignisse der vergangenen Wochen. Bürgermeister Seufert von der Bayerischen Volkspartei und sein Stellvertreter Böck von den Sozialdemokraten hatten gleich am Morgen nach dem Sturm der SA auf das Dachauer Rathaus und das Bezirksamt gegen das Hissen der Hakenkreuzfahnen protestiert. SA und SS ließen die Flaggen einfach hängen. Wieder einen Tag später beschwerten sich der Bezirksparteiführer der BVP und ein Vertreter der christlichen Gewerkschaften im Bezirksamt über Übergriffe von Seiten der SA und SS gegenüber Dachauer Bürgern und verwahrten sich energisch gegen die herrschenden Zustände. Die Behörde versprach eine Überprüfung der geschilderten Vorkommnisse. Wiederum einen Tag später, es war ein Sonntag, marschierten SS-Männer zum Amper-Boten und besetzten die Redaktion. Ein bewaffneter SS-Mann stand Wache vor dem Gebäude. Drinnen hielt man Telefonwache. Am Montagabend marschierte ein Fackelzug zum Bahnhof. Jener Mann, der vor einigen Tagen den Schneid besessen hatte, die dort gehisste Hakenkreuzfahne herunterzureißen, hängte sie nun artig wieder auf. Am Dienstagnachmittag endete die Besetzung des Amper-Boten. „Aber seitdem liest man in der Zeitung kein kritisches Wort mehr“, sagte Wimmer. Bekannte politische Persönlichkeiten seien in Schutzhaft genommen worden, darunter Andorfer, der Führer des Reichsbanners, und der Kommunistenführer Moosrainer. Dann hieß es, man habe Böck seines Amtes als Zweiter Bürgermeister enthoben. Der Amper-Bote habe daraufhin klargestellt, dass Böck keinesfalls amtsenthoben wurde, sondern ihm wie allen anderen Bürgermeistern sozialistischer Gesinnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit lediglich die Ausübung des Amtes verboten wurde, wogegen er keinen Einspruch einlegte. In der Gemeinderatssitzung Ende März trat Böck schließlich freiwillig von allen Ämtern zurück. Vor der Sitzung war im Rathaus ein Antrag der örtlichen NSDAP eingegangen, dem Führer und Reichskanzler Adolf Hitler das Ehrenbürgerrecht der Marktgemeinde Dachau zu verleihen und als sichtbares Zeichen der Verbundenheit des Marktes mit dem Führer die Frühlingstraße fürderhin Adolf-Hitler-Straße zu nennen. Da der Antrag formal zu spät für eine Behandlung in öffentlicher Sitzung eingegangen war, sollte er in der anschließenden geheimen Sitzung behandelt werden. Der Initiative des Gemeinderates Zauner war es zu verdanken, dass der für die Zukunft und das Ansehen des Martkes so wichtige Antrag doch noch in öffentlicher Sitzung behandelt wurde. So war es den nur zwanzig zugelassenen Zuhörern aus der Bürgerschaft vergönnt mitzuerleben, wie die Gemeinderäte den Führer einstimmig zum Ehrenbürger ernannten und ihm die Straße vor dem Bahnhof widmeten. Gemeinderat Höfler schlug vor, auch den ehrenwerten Reichspräsidenten von Hindenburg zum Dachauer Ehrenbürger zu machen, immerhin sei Hindenburg ein Kriegsheld, ungeschlagen im Felde, und wie man seit seiner weisen Entscheidung, den Führer zum Reichskanzler zu ernennen, wisse, auch ein Visionär. Höflers Antrag wurde zugestimmt.
Wenige Tage später enthob der Dachauer Sonderkommissar der NSDAP – „ein gruseliger Mann namens Friedrichs, aber friedlich ist an ihm nicht das Geringste, es heißt, er ziehe gern seine Pistole“, wusste Wimmer zu berichten – die Gemeinderäte Hardwig, Lerchenberger und Teufelhart von der BVP sowie die Sozialdemokraten Lobenstock, Ernst, Gampenrieder, Schauer, Schütze, Wenninger und Hammer ihres Amtes. Hammer verlor zudem seine Anstellung als Oberlehrer. Gemeinderat Schmid wurde freilich auch enthoben. Er konnte den Aufgaben seines Amtes ohnehin nicht nachkommen, da er sich in Schutzhaft befand.
Vor ein paar Tagen wurde der Schutzhäftling und Kommunist Moosrainer in die Freiheit entlassen. Gerüchte machten die Runde. Aus der Backstube der Bäckerei Teufelhart, im Volksmund Nazibäck genannt und nicht zu verwechseln mit dem Teufelhart der BVP, waberte wie Mehlstaub das Gerücht, Moosrainer habe seine Freilassung mittels Singens beschleunigt und Kameraden ans Messer geliefert. Der Sonderkommissar der Partei sah sich genötigt, das Gerücht öffentlich zu dementieren. Dass weitere Volksschädlinge in Schutzhaft genommen wurden, sei nicht Moosrainer zu verdanken, sondern der akribischen Aufklärungsarbeit der Parteiorganisationen.
Mitte April organisierte die Partei anlässlich des bevorstehenden Geburtstags des Führers eine Sammlung. „An Hitlers Geburtstag braucht kein Mensch in Dachau hungern“, lautete die Parole, mit der die Sammler durch die Straßen zogen und an Türen klopften. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk könne man dem Führer nicht machen, als seine Volksgenossen mit dem Nötigsten zu unterstützen. Die Dachauer opferten zwei Zentner Fleisch und Wurst, 1.200 Laib Brot, sieben Zentner Mehl, dreizehn Zentner Reis, 900 Eier, 100 Zentner Kartoffeln und mehrere Zentner Nudeln, Zucker und Fett. Die Pakete wurden an Hitlers Geburtstag an die Bedürftigen ausgeteilt.
Am 29. April trat der neu besetzte Gemeinderat zusammen. Die Sitzung verlief in einer Einmütigkeit und Harmonie, wie sich Bürgermeister Seufert das auch in den langen und quälenden Jahren des sinnlosen und volksschädlichen Parteigezänks immer gewünscht hatte. Selbst SPD-Fraktionsführer Gampenrieder bekräftigte seinen Willen zur Mitarbeit.
Während Heinrich sich die Gespräche des Abends in Erinnerung rief, fand er schließlich doch noch in den Schlaf.2
Die Feierlichkeiten zum Tag der Nationalen Arbeit am 1. Mai begannen mit einem festlichen Zug durch den alten Markt zur stattlichen Pfarrkirche des heiligen Jakobus hin. Hitlerjungen marschierten voraus, es folgten Formationen von SA und SS, Männer des Freiwilligen Arbeitsdienstes, Kirchgänger schlossen sich an, Schaulustige und Neugierige hinterdrein. Das weiträumige Schiff der Kirche konnte die Menschen kaum fassen. Hochwürden Pfarrer Pfanzelt stieg in die Kanzel. Er trug die Uniform eines Feldgeistlichen und hob zur Predigt an: „Jahrelang wurde unser Volk unter der Geißel der Arbeitslosigkeit geknechtet. Dabei ist die Arbeit uns von Gott gegeben, sie ist ein freudiges Erschöpfen dessen, was der Schöpfer in den Menschen hineingelegt hat mit dem Zweck, nicht dem Einzelnen zu dienen, sondern die Arbeit muss im Interesse des ganzen Volkes geleistet werden. Für das deutsche Vaterland ist eine Zeit großer Hoffnung angebrochen. Gesegnet seien alle, die unserem Volke das Wiederauferstehen bringen. Für jeden einzelnen von uns heißt es: Nicht für mich, sondern für mein ganzes deutsches Volk. Es ist die vom Herrgott uns gegebene Arbeit, mit der ein einziges treues Volk aufgebaut werden kann. Brecht ab, was hemmend uns im Wege steht. Ich kenne keinen Feind, keinen Gegner, ich kenne einzig mein Vaterland, dem meine Arbeit gilt. Nun heißt es, ein ganzer Christ zu sein. Halblinge können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. Der Ansturm der Gottlosigkeit ist gebrochen, eine Woge christlichen Lebens geht durchs Volk. Da gilt es, nicht abseits zu stehen, wenn die Parole lautet: Für Volk und Gott. Mit dem Stolz eines alten Veteranen will ich einmal behaupten können: Ich bin dabei gewesen.“3
Am frühen Nachmittag versammelten sich in der Freisinger Straße Tausende zu einem Festzug. Bauern zu Pferde und auf Erntewagen, Handwerker in ihrem Handwerkszeug, Gefolgschaften Dachauer Firmen, Beamte der Behörden, Post und Bahn, Werkarbeiter, Mitglieder der Kriegervereine, Sportvereine, Schützenvereine, Stadtkapelle und Arbeitervereinskapelle kamen zusammen, um sich mit SA und SS, Hitlerjugend, Stahlhelm und Polizei auf einen prächtigen Marsch durch den Markt hin zum Speisehaus der Deutschen Werke nahe dem Konzentrationslager zu machen. Für Kriegsversehrte standen liebevoll geschmückte Automobile zum Transport bereit. Künstler der örtlichen Künstlervereinigung trugen ihren Ehrenvorsitzenden, den Professor Stockmann, auf einer Chaise durch die Stadt. Menschenmassen säumten die Straßen, beklatschten den Aufmarsch und steckten Arbeitern, Künstlern und SA-Männern Blumen ans Revers. Vor Erreichen des Speisehauses ergoss sich ein Regenschauer über den Festzug und tränkte die Festkleider und Anzüge, die Handwerkerhemden, die Bauerntrachten und Uniformen mit kühlem Frühjahrsregen. Die Teilnehmer des größten Festzugs, der je durch den Markt Dachau gezogen war, mussten sich die schneidigen Militärmärsche der Stadtkapelle und die Reden der Parteiführer beim Festakt im Speisehaus in pudelnassem Gewand anhören.
Der Hauptredner, ein Parteigenosse namens Pfahler, betonte, dass das Fest der Nationalen Arbeit einzig und allein dem Willen und der Schaffenskraft des Reichskanzlers zu verdanken sei, der das deutsche Volk in vierzehnjährigem Kampfe aus den Irrungen und Wirrungen des Parteienstaates emporgeführt habe. Der Redner erwähnte, dass der Markt Dachau für den Nationalsozialismus ein schwieriges Pflaster gewesen war. Aber die anfängliche Widerspenstigkeit sei nicht die Schuld der Dachauer, sondern allein die der Weimarer Verfassung, die dem deutschen Volke Frieden und Freiheit verhieß, ihm aber nichts als Verderben und Niedergang brachte.
Als der Redner das Deutschlandlied und anschließend das Horst-Wessel-Lied intonierte und die Stadtkapelle beschwingt einsetzte, klang alsbald aus tausend Kehlen: „Es schau’n aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen, der Tag für Freiheit und für Brot bricht an.“
Bis zum späten Abend harrten die Festzugsteilnehmer in klammer Bekleidung gemeinsam im Speisehaus aus, um miteinander die Rundfunkübertragung der Rede des Führers in Berlin anzuhören.4
Felix Bürgers zog seinen Neffen am Ärmel. „Komm, wir gehen.“
„Ich habe versprochen zu helfen, nachher Stockmanns Chaise zurückzutragen“, sagte Heinrich.
„Das schaffen sie auch ohne dich“, sagte Felix Bürgers.
Es hatte aufgehört zu regnen. Die Wolken hatten sich vom Nachthimmel verzogen. Tausende Sterne strahlten über ihnen. Der regennasse Morast unter ihnen schmatzte bei jedem Schritt. Aus dem Speisehaus hinter ihnen schallte fröhlich „Heil, Heil, Heil!“
Felix Bürgers steckte die Fäuste in seine Manteltaschen und murmelte, mehr zu sich als zu Heinrich: „Wenn reelle Geschäftsleute und Fabrikanten ihre Gefolgschaften mit der SA marschieren lassen, wenn die größten Bauern ganz vorn mitreiten, und selbst der Pfarrer ihre Worte spricht, dann haben sie gewonnen. Unsere Künstlervereinigung rennt fleißig mit, und unser Ehrenvorsitzender winkt fröhlich auf der Sänfte.“
„Worauf willst du hinaus?“, fragte Heinrich.
„Das einst rote Dachau, es hat sich gehäutet.“
Der Nebel war dem Markt Dachau seit jeher ein treuer Kamerad. Es gab Tage, vor allem im heraufziehenden Frühjahr und im Herbst, an denen er sich überhaupt nicht aus der moorigen Senke zwischen Dachau und dem nahen München verziehen mochte. Manch einem drückte der Dauernebel schwer aufs Gemüt, vor allem dem einen oder anderen unter den Moosbauern, denen es nicht vergönnt war, die fruchtbaren Böden der sich nördlich von Dachau bis zum Himmel erstreckenden sanften Hügel zu bewirtschaften. Nicht genug, dass sie ihre kümmerlichen Erträge nur mit harter, an Lebenskraft zehrender Schufterei dem nassschmatzenden Boden abtrotzen konnten, sie hatten ihr Tagwerk inmitten des aus dem Moor aufsteigenden Nebels verrichten, der den Blick kurz und die Nächte unendlich lang zu machen vermochte. Es gab Nebelmorgen, da verschwanden die Bäuerin und ihr Karren, den sie mit Kartoffeln vollgeladen hatte und zum Dachauer Markt zog, bereits nach zwanzig Metern im Nichts, um des Abends mit hoffentlich leerem Karren und ein paar Mark mehr im Säckel an selbiger Stelle wieder aus demselben Nebel aufzutauchen. Das Dachauer Moos war ein unwirklicher und widriger Ort für jene, die Tag für Tag und Jahr für Jahr in ihm zu leben hatten.
Für jene aber, die nur dorthin gingen, um es zu malen, war das Dachauer Moos ein Paradies. Vor Jahrzehnten strömten aus dem ganzen Reich und aller Herren Länder Landschaftsmaler in den Markt Dachau, um im angrenzenden Moos ihre Werke zu schaffen, des besonderen Lichtes wegen, obschon oder wohl gerade deshalb, weil es sich im Moos rarmachte. Gelang es einem Sonnenstrahl, ein kleines Loch in der Wolkendecke zu erhaschen, den dichten Nebel zu durchdringen und seine Kraft hinein ins Moor zu stoßen und es strahlend zu erhellen, dann war des Dachauer Malers höchste Zeit angebrochen. Bilder des Dachauer Mooses verkauften sich gut. Manch einer unter den Dachauer Kunstmalern gelangte zu Berühmtheit und Wohlstand, sobald er im Ruf stand, die Kraft des Lichtes im nebligen Nichts des Mooses besonders trefflich auf Leinwand festhalten zu können. Freilich lebten die Künstler selbst nicht im Moos, sondern im heimeligen Dachau, dessen Hügel, auf dem es erstanden war, oft über den Nebel hinausragte und den warmen Sonnenschein genoss, der den Moosbauern drunten in der Ebene missgönnt war.
Am Rande des Mooses östlich des Marktes waren Handwerker und hinzubefohlene Arbeitsdienstmänner eifrig beschäftigt, eine stattliche Anzahl von Holzschuppen zu errichten und die heruntergekommenen Gebäude einer einstigen Fabrik instand zu setzen. SA-Männer aus München zogen Stacheldraht um das Gelände.
Ein SS-Mann in Uniform schritt auf eine Gruppe von Zimmermännern zu. Er trug einen Sack über der linken Schuler, blieb vor den Arbeitern stehen, stieß die Hacken seiner Stiefel zusammen, dass es krachte, und hob die Rechte zum Deutschen Gruße. Drei Arbeiter ließen ihr Werklen sein und grüßten zurück. Zwei andere, die damit beschäftigt waren, eine Tür ihn ihre Angeln zu hängen, ignorierten den SS-Mann. Der SS-Mann kramte in seinem Sack und überreichte den Grüßenden je drei Zigaretten und eine Flasche Bier. „Habe Nachricht bekommen, dass ich Vater wurde. Strammer Junge. Grund zu feiern.“ Die mit dem Einhängen der Tür Beschäftigten ignorierte er. Der SS-Mann inspizierte die Baracke. „Wird der Verhau bis morgen fertig?“
„Wenn wir endlich die Nägel bekommen, die wir letzte Woche geordert haben.“
„Kümmere mich drum“, versprach der SS-Mann und schritt weiter zur nächsten Baustelle. „Übrigens, morgen kommt die erste Kundschaft.“
Im März gab die neue Regierung auf einer Pressekonferenz bekannt, bei Dachau das erste Konzentrationslager in Bayern zu eröffnen. Errichtet werde es auf dem Gelände einer einstigen Pulverfabrik, Fassungsvermögen fünftausend Personen.
An einem trüben Mittwoch, es war der 22. März, kamen die ersten fünf Dutzend Häftlinge. Kommunisten, der eine oder andere Reichsbannerführer und sonstige marxistische Elemente, allesamt Schutzhäftlinge, mit denen man die staatlichen Gefängnisse nicht belasten wollte, deren Freilassung aber ebenso wenig infrage kam, weil sie in Freiheit sofort wieder mit ihrer Hetze und Wühlarbeit beginnen würden.
Die Ankunft der ersten Gäste, so nannte die örtliche Tageszeitung Amper-Bote die Inhaftierten, und manch einer lachte sich beim Lesen am Küchentisch ins Fäustchen ob der Gewitztheit des Schreibers, geschah keineswegs diskret oder gar heimlich, sondern unter den neugierigen Blicken der Männer des Freiwilligen Arbeitsdienstes, die mit der Errichtung des Lagers beschäftigt waren. Auch zahlreiche Dachauer Handwerksmeister, Gesellen und Hilfsarbeiter, die zur Instandsetzung der benötigten Gebäude der alten Pulverfabrik herangezogen wurden, bekamen die Gefangenen zu Gesicht. Der Wachdienst bestünde aus Landespolizei sowie Männern von SA und SS und gebe keinerlei Anlass zu etwaigen Befürchtungen, wussten einige Handwerker beim Feierabendbier in den Dachauer Gaststätten zu berichten. Die Wachen stünden unter Waffen, hätten ihr Klientel bestens unter der Fuchtel und würden nicht die kleinste Lausbuberei zulassen.
Positives wusste auch Gemeinderat Zauner zu berichten. Die SS- und SA-Männer, die derzeit im Zieglerhaus untergebracht waren, würden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht mehr gebraucht und zögen zur Grenzwache nach Bayrischzell ab. In den Räumen werde nun ein Büro eingerichtet, in dem die Aufträge und Lieferungen der örtlichen Betriebe für das Konzentrationslager koordiniert werden.
Mitte April nahmen all jene Dachauer, die dem neuen Lager im Osten des Marktes mit Skepsis gegenüberstanden, da sie sich vor Ausbrechern fürchteten, mit Beruhigung zur Kenntnis, dass die Wachmannschaften des Lagers tatsächlich alles unter Kontrolle hatten. Die Münchner Polizei teilte mit, dass vier Kommunisten ihrer Unterbringung in Dachau entfliehen wollten. Nach erfolglosen Haltrufen hätten die Posten das Feuer eröffnet und drei von ihnen getötet. Der Vierte wurde ebenfalls getroffen und schwer verletzt an der Fortsetzung seines Fluchtversuchs gehindert.
Am Tag des 44. Geburtstags des Führers mussten auch die Schutzhäftlinge im Lager nicht darben. Sie durften sich über Sonderkost, Rauchzeug und Musik freuen. Die Kapelle Moosrainer spielte fröhlich auf. Durch das immer stattlicher hergerichtete Lager, über dem eine neue, prächtige Hakenkreuzfahne im Wind flatterte, klang das Horst-Wessel-Lied, und unten traten die Schutzhäftlinge an zum Ehrungsakt.
Ende April verbreitete sich erneut frohe Kunde aus dem Lager. Der ehemalige Reichstags- und Landtagsabgeordnete und berüchtigte Kommunist Beimler sei nun ebenfalls zu Gast in Dachau. Unter den Dachauer Parteigenossen erzählte man sich anlässlich dieser Neuigkeit recht gern, dass nun tatsächlich eingetreten war, was der Kommunist Beimler noch vor kurzem im Wahlkampf im Münchner Zirkus Krone angekündigt hatte: „Bei Dachau seh’n wir uns wieder!“ Auch aus Franken wurden neue Gäste einquartiert. Ein Insasse habe sich erhängt.
In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai zeigte sich, dass der berüchtigte Kommunist Beimler sich sein Wiedersehen mit Dachau ganz offenkundig anders vorgestellt hatte. Beimler war die Flucht gelungen und untergetaucht. Die Lagerverwaltung setzte für Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen, eine Belohnung von hundert Reichsmark aus.5
Die Blockwarte im Markt Dachau zeigten sich in den folgenden Tagen besonders beflissen. Blockwart Schweif, ein knieversteifter Kriegsversehrter und seinen Pflichten ansonsten eher lax nachkommend, klopfte jeden Tag an Felix Bürgers Tür und fragte, ob man denn den Beimler gesehen habe, glattrasiert, abartig große, abstehende Ohren, Knickerbockerhose und braune Joppe. Bei Hinweisen zur Wiederergreifung des Elements mache er halbe-halbe.
Während dieser Tage wurde auch vermeldet, der einstige Kommunistenführer im Bayerischen Landtag Dressel habe sich in der Nacht vor Beimlers Flucht selbst gerichtet, aller Wahrscheinlichkeit nach von Schwermut getrieben. Am Stammtisch des Unterbräu6 auf halber Höhe des Altstadtbergs wusste man es freilich besser.
Robert Teufelhart7, Parteimitglied früher Stunde, feist im Gesicht und fett am ganzen Leib, schüttete ein Glas Bier in seine Kehle. „Wenn ihr mich fragt, hat der Beimler was damit zu tun. Vielleicht war es gar kein Selbstmord. Vielleicht hat der Beimler gewartet, bis der Dressel schläft, und dann hat er ihm die Pulsadern zerschnitten. Den Kommunisten muss man alles zutrauen. Die morden mir nichts dir nichts auch untereinander, wenn es dem eigenen Vorwärtskommen dient.“
Teufelharts Parteigenossen klopften zustimmend auf den biernassen Holztisch. Teufelhart blickte glücklich in die Runde und schnaufte schwer. Tränen sammelten sich in seinen Augen, und beinahe wäre eine über die dicke Wulst unter seinem rechten Auge geschwappt, um sich mit dem Bier auf dem Tisch zu vereinigen. Robert Teufelharts Tränen und das Bier waren in den vergangenen Jahren eine innige Beziehung eingegangen. Teufelhart war einer der Ersten gewesen, die der nationalsozialistischen Idee und Lebensweise in Dachau zum Aufstieg zu verhelfen trachteten. Er war seinen Mann gestanden bei der SA, als diese noch geringgeschätzt wurde, verlacht und manchmal auch verprügelt. So manchen Abend hatte er allein beim Bier verbracht, verzweifelnd ob der elendigen Widerspenstigkeit seiner Volksgenossen. Sie wollten und wollten einfach nicht begreifen, dass einzig der Führer das deutsche Volk vom Knebel des Versailler Vertrags zu befreien in der Lage war, um es zu Freiheit und Frieden zu führen. Nazibäck hatten sie ihn hinter vorgehaltener Hand genannt, doch seine Brezen kauften sie gerne, da sie die besten waren. Er war stolz auf seine Brezen – niemandes Brezen weit und breit waren rescher, es mangelte ihnen auch nicht an Salz, wer mit Brezensalz knauserte, war ein Narr – und er war stolz auf seine Überzeugung, dass es keiner Diskussion bedurfte, wenn es darum ging, was gut für die Zukunft des deutschen Volkes war. Wie viele Tränen hatte er hineingeweint in seinen Bierkrug, als sie ihn vor Jahren im Wahlkampf verspotteten als dämlichen Brezensalzer im Braunhemd? Nun zählte er zu den Ersten. War einer, der schon immer dabei gewesen war. Endlich war er jemand, dem man zuhörte, um dazuzugehören.
Teufelhart wischte sich die Tränen aus den Augen und rief der Bedienung zu, ein weiteres Bier zu bringen. Die Kellnerin war gerade an einem anderen Tisch beschäftigt, machte aber sogleich Zeichen, dass sie verstanden hatte. Es kam Teufelhart vor, dass er seit ein paar Wochen sein Bier schneller vorgesetzt bekam als vorher. Er meinte auch, dass ihm die Stammtischgäste plötzlich mehr Gehör schenkten. Er stand auf und hob zu einer kurzen Rede an. „Wisst ihr noch, Volksgenossen, wie wir damals von der Regierung verboten wurden? Wie sie glaubten, sie könnten uns einfach verbieten, und dann wären wir weg? Sie haben sich getäuscht. Wisst ihr noch, wie es damals draußen genau vor der Tür zum Unterbräu zugegangen ist, als die Volksverräter des Reichsbanners durch den Markt marschierten und sich über uns hergemacht haben? Wie sie uns zur Feuerprobe zwangen, drei von uns übel zurichteten, und wir nichts und niemanden schonend, schon gar nicht uns selbst, hineinstürmten in den Aufruhr, um die Kameraden in den Unterbräu hinein zu retten? Wisst ihr noch, wie wir diese Feuerprobe gemeinsam bestanden haben? Draußen die irren Massen, immer wieder die Tür aufreißend, drinnen eine Handvoll eisern Entschlossene, das Eindringen und die Niedermachung verhindernd, mit blanker Faust durch den Türspalt schlagend, niemals zurückweichend und den Irregeführten keinen Spaltbreit Platz gewährend? Nein, das wissen die meisten von euch nicht, denn ihr wart nicht dabei, ihr habt zugeschaut und mich verlacht, mich ausgerichtet als Nazibäck. Aber ich sage euch eins. Nämlich, dass ich diesen Namen mit Stolz über mich ergehen lasse, ihn mit Stolz und als Schild für alles, was da kommen wird, vor mich hintrage. Ich bin Robert Teufelhart, der Nazibäck, und ich bin stolz auf alles, was ich bin.“