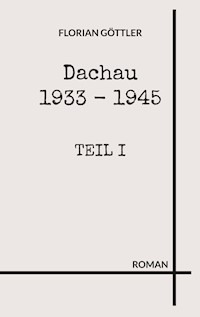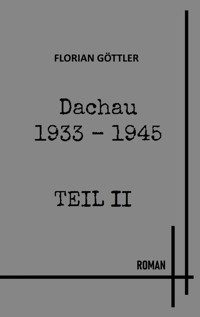
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dachau 1933 - 1945
- Sprache: Deutsch
Teil II von Florian Göttlers Romantrilogie über das Leben im nationalsozialistischen Dachau. Dachau im Jahr 1938. Der junge Schriftsetzer Johann Bauer wird bei der örtlichen Tageszeitung Amper-Bote zum Journalisten befördert. Fortan berichtet er über die vielen Alltäglichkeiten und seltenen Außergewöhnlichkeiten des Lebens in der beschaulichen Kleinstadt. Biederer und belangloser Lokaljournalismus, oder steckt mehr dahinter? Johann jedenfalls macht sich darüber keine Gedanken. Er genießt sein Glück. Doch dann bricht Krieg aus - und Johanns bester Freund Simon muss an die Front. Johann bleibt in Dachau zurück und fristet ein Dasein zwischen Hoffnung und Angst, Stolz und Verzweiflung. Und über allem die Propaganda, deren willfähriges Werkzeug er längst geworden ist. "Die Vermischung von Fiktion und Fakten kann fruchtbar sein. Sie kann den Leser nachhaltig erschüttern, so wie im Roman Dachau 1933 - 1945, Teil I. Satz für Satz entsteht ein auf wahren Begebenheiten basierendes Porträt einer Kleinstadt und ihrer Einwohner, die sich dem Nationalsozialismus hingeben." Thomas Radlmaier, Süddeutsche Zeitung, über Teil I von Göttlers Romantrilogie "Was den Roman ausmacht, ist, dass die NS-Geschichte am Ottonormalverbraucher erzählt wird. Die Ängste und Sorgen der Bevölkerung werden ebenso fühlbar wie ihre Großmäuligkeit und Hybris." Michael Berwanger, LiteraturSeiten München, über Teil I "Der Autor zeichnet gekonnt ein realistisches Porträt einer Stadt, die Schritt für Schritt, dem Nationalsozialismus verfällt, und trifft dabei den Nagel mit fürchterlich-faszinierender Präzision an jedem Punkt auf den Kopf. (...) Die Kunst von Florian Göttler ist dabei, dass er vollkommen ohne moralischen Zeigefinger auskommt. Mit meisterhaftem Blick schaut er mal hier, mal da hin, sein literarischer nüchterner Realismus lässt einen dabei jedoch an keiner Stelle kalt." Tabatha Portejoie, Schriftstellerin (Die Alchemie der Magie) , über Teil I
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch
Dachau im Jahr 1938. Der junge Schriftsetzer Johann Bauer wird bei der örtlichen Tageszeitung Amper-Bote zum Journalisten befördert. Fortan berichtet er über die vielen Alltäglichkeiten und seltenen Außergewöhnlichkeiten des Lebens in der beschaulichen Kleinstadt. Biederer und belangloser Lokaljournalismus, oder steckt mehr dahinter? Johann jedenfalls macht sich darüber keine Gedanken. Er genießt sein Glück. Doch dann bricht Krieg aus – und Johanns bester Freund Simon muss an die Front. Johann bleibt in Dachau zurück und fristet ein Dasein zwischen Hoffnung und Angst, Stolz und Verzweiflung. Und über allem die Propaganda, deren willfähriges Werkzeug er längst geworden ist.
Autor
Florian Göttler, 1977 in Dachau geboren, beschäftigt sich in der Trilogie Dachau 1933 - 1945 mit den dunkelsten Jahren der deutschen Geschichte und mit seiner Heimatstadt, deren Name Synonym geworden ist für die Gräuel der Nationalsozialisten. Er liebt seine Heimatstadt und die Literatur. Und findet es erstaunlich, dass es über 75 Jahre lang keinen Roman über das Leben in Dachau in der Zeit des Nationalsozialismus gegeben hat. Mit seiner Trilogie, deren zweiter Teil dies ist, setzt er dem ein Ende.
Bisher von Florian Göttler erschienen:
Voll aufs Maul, satirischer Roman (2018)
Ein Heimatlied von Gier und Grausamkeit, Thriller (2020)
Der Friedhof der Dinge, Roman (2021)
Jahrhundertweltmeisterschaft, Sportsatire (2022)
Dachau 1933 – 1945, Teil I, Roman (2022)
Für Marie-Theres, meine Tochter.
Und Rosmarie und Kurt Göttler, meine Eltern.
INHALTSVERZEICHNIS
PROLOG
DAS JAHR 1938
WINTER 1939 BIS SOMMER 1939
HERBST 1939 BIS FRÜHSOMMER 1941
SOMMER 1941 BIS ENDE 1941
ANMERKUNGEN / QUELLEN
HINWEISE
Wie Dachau 1933 – 1945, Teil I orientiert sich der vorliegende Roman an Berichten und Mitteilungen, die zu besagter Zeit in der Tageszeitung Amper-Bote erschienen sind. Das Personal des Romans besteht zum Teil aus damals lebenden realen Personen und wichtigeren Teils aus fiktiven Figuren. Nummerierungen verweisen auf Quellenangaben, Belege und weitere Informationen in den Anmerkungen ab Seite →.
Dieser Roman handelt von Ereignissen in der Stadt Dachau und nicht vom Terror und Massenmord im Konzentrationslager Dachau. Über die Struktur, die menschlichen Widerwärtigkeiten und den von den Nationalsozialisten begangenen zehntausendfachen Massenmord im Konzentrationslager Dachau lese man Stanislav Zámečníks Standardwerk Das war Dachau. Über die Vertreibung, Inhaftierung und Ermordung in Dachau lebender jüdischer Mitbürger lese man Hans Holzhaiders Vor Sonnenaufgang. Über die Verbindungen zwischen der Stadt Dachau und dem Konzentrationslager sei Sybille Steinbachers Dachau – Die Stadt und das Konzentrationslager in der NS-Zeit empfohlen.
Die Handlung des Romans beruht lose auf tatsächlichen Begebenheiten, ist jedoch fiktiv. Kenntnisse über den ersten Teil der Trilogie erleichtern an wenigen Stellen das Verständnis, sind jedoch nicht notwendig für die Lektüre des Romans.
PROLOG
+++
Unter der Herrschaft der ganz großen Menschen ist die Feder mächtiger als das Schwert.1
Indes wann herrschten je ganz große Menschen? Unter der Herrschaft der Gewöhnlichen mochte die Feder bisweilen geduldet, selten gar ermutigt und gefördert werden. Geriet die Feder jedoch allzu spitz, dann Weh der Feder und Heil dem Schwert.
An wessen glückselige Ohren ist je die herrliche Kunde einer von den Herrschenden feierlich ausgerufenen Schwerteinschmelzung gedrungen, auf dass fürderhin Frieden und Wohlergehen für alle Völker, Klassen und Religionen erstehe? Wer wollte je auch nur einen einzigen Pfennig auf die Feder wetten, sobald das Schwert gegen sie rüstete und ins Feld zu ziehen sann?
Jene Zeiten, zu denen die Herrschenden der Feder gnädiglich Obhut vor dem Schwert gewährten, statt ihr mit dessen kalten, scharfen Klingen zu drohen, nannten und nennen wir diese Zeiten nicht immerzu die seligsten Epochen der Menschheitsgeschichte?
Welch Unglück will sein, wenn die Feder dem Schwert zur Herrschaft verhilft, und das Schwert fortan befielt, und die Feder still und klaglos gehorcht? Welch Unrecht mag geschehen, so es keine großen Menschen mehr gibt, die eine Feder zu führen wagen, sondern nurmehr willfährige Büttel? Und welch Höllensturm wird losbrechen, wenn das Schwert und die Feder auf dasselbe Ziel hin sinnen?
Wehe bald dem, der anderes denkt.
Gnade allen, die anders sind.
Wer will da andres denken?
Wer will da anders sein?
Wer will da noch gerecht sein können und reell?
Ach, wozu dem allem überhaupt noch nachsinnieren?
Wenn es doch schlichtweg ist, wie es geworden ist.
Die Welt, war sie nicht alle Zeit zu klein für alle?
Die Welt, war sie nicht immerdar ein Ort, von dem es andere hinweg zu wünschen galt zum Wohle des eigenen Wollens und Werdens?
Ob dies wirklich der Fall sein mag, ist dabei von keinerlei Bewandtnis. Tatsächlich von unerhörter Bedeutsamkeit und Tragweite ist ganz lediglich die unumstößliche Gegebenheit, dass es immerzu Menschen gibt, die dies glauben mögen.
Gestern.
Heute.
Immerfort.
Indes viel wichtiger mag vielen sein: das Wetter.
+++
Am 29. Dezember des Jahres 1941, es war ein gewöhnlicher Montag, jedoch ein besonders frostiger Tag in einem besonders kalten Winter, die Glocke der Jakobskirche schlug gerade dreiviertel zehn, da stürzten in einem beschaulichen Städtchen mit dem Namen Dachau vor einer Metzgerei in der Augsburger Straße sechs Weißwürste und drei Flaschen Bier auf den Bürgersteig. Selbiger war überreichlich mit Schnee bedeckt – weichem, erst in der vergangenen Nacht vom Himmel hingeschneitem Schnee –, und so stürzten die Würste ohne sich die Därme aufzureißen, und auch die Bierflaschen blieben unversehrt vom Fallen, und alles Hingestürzte wurde binnen einer Minute aufgelesen von Vorüberkommenden, denen frische Weißwürste und kühles Bier im Neuschnee nur recht und billig waren.
Doch aus welchem Grunde lagen die Würste und das Flaschenbier zum erwähnten Zeitpunkt am genannten Ort? Dies in Erfahrung zu bringen und zu ergründen will das Ziel der folgenden Erzählung sein. Deren Leser wie auch ihr Erzähler, wir können nun Beobachtende sein, darüber Nachsinnende, gewiss auch Meinende und Urteilende, ja selbst Kläger, Richter und Vollstrecker in Person. Denn die Gedanken, sie sind frei. Und die Urteile oft schnell gesprochen.
DAS JAHR
1938
NACH CHRISTI GEBURT
+++
Johann Bauer saß auf seinem Drehstuhl in der Schriftsetzerei des Amper-Boten und fluchte gleichermaßen leise wie inniglich ein „Herrgott, Sakrament“. Schlimmeres zu fluchen, etwa ein den Heiland schmähendes „Kruzifix“ oder gar ein fürchterliches „Kruziteufel“, hatte ihm der gottesfürchtige Vater einst energisch und geflissentlich mit dem Gürtel aus dem Sinn gedroschen. Der Anlass für Johanns stillen Fluch war die eigentliche Belanglosigkeit, dass ihm aufs Erneute eine Brotschriftletter aus den Fingern geglitten war. Die winzige Letter grüßte mit einem flüchtigen Klacken, als sie sich zu ihren Kameradinnen auf den Fußboden gesellte. Johann blickte sich um. Auf dem Boden rings um seinen Arbeitsplatz sah es aus, als hätte ein missgünstiger Kollege, so es denn einen solchen überhaupt gab, mutwillig die Hälfte seines Setzkastens ausgekippt. Johann griff rasch nach dem Kehrzeug unter seinem Arbeitstisch und fegte mit dem Handbesen eilig die herabgefallenen Lettern ins Kehrblech, ehe der Meister das angerichtete Letternmassaker entdeckte.
Letternmassaker, so pflegte es der Meister zu bezeichnen, wenn Johann oder einer der anderen Gesellen wieder einmal allzu unkonzentriert zu Werke ging, und – klack, klack, klack – eine Letter nach der anderen auf dem staubigen Holzboden landete anstatt an der für sie vorgesehenen Stelle im Winkelhaken. Seit einigen Monaten hatte der Meister im Besonderen Johann auf dem Kieker. Erst letzte Woche hatte er Johann vor versammelter Gefolgschaft in den Senkel gestellt und gewettert, der höchst geschätzte Herr Verleger hätte doch besser einen elendigen Kriegszitterer eingestellt statt eines dergestalt nutzlosen Taugenichtses vom Schlage eines Johann.
Dabei war Johann Bauer, und dies wusste freilich auch der Meister, ganz ohne jeden Zweifel der mit Abstand talentierteste, tauglichste und gewissenhafteste Schriftsetzer, der je beim Amper-Boten in Lohn und Brot gestanden hatte, zumindest an gut vieren seiner sechs Wochenarbeitstage. An seinen vielen guten Tagen setzte Johann leichterhand und ohne jedwede Mühe schneller und fehlerfreier als alle anderen in der Setzstube. Seine rechte Hand flog flink wie ein Kolibri hin und her zwischen Setzkasten und Winkelhaken, und nicht eine Letter getraute sich dabei, Johanns feinfühlenden Fingern zu entgleiten, ganz so als hätte der Herrgott in Johanns Fingerspitzen, und einzig und alleiniglich auf der Welt nur in eben Johanns Fingerspitzen, winzige Magnete hineinerschaffen. Hinzu zu seiner über alle Maßen außergewöhnlichen Fingerfertigkeit gesellte sich das von den Kollegen recht rasch und durchaus mit staunender Anerkennung erkannte Faktum, dass Johann für einen Bengel seines Alters und seines Herkommens – das eine lag bei Anfang zwanzig, das andere nahe Rosenheim – eine ganz hervorragend belesene Menschensperson darstellte, weitaus literaturkundiger und klüger als es die Maulhelden in der warmen Schreibstube drüben im Vorderhaus waren, die sich den Schriftsetzern im zugigen Hinterhaus zu aller Zeit und in sämtlichen Belangen der Bildung und des Wissens überlegen wähnten und keine Gelegenheit ausließen, dies großmäulig kundzutun. Es war Johann ein spielerisch Leichtes, den vorwitzigen Schreiberlingen aus dem Vorderhaus das eine oder andere peinlich verrutschte Komma an die richtige Stelle zu korrigieren. Auch wollte es den siebengescheiten Schreiberlingen aus unergründlicher Ursache immer wieder einfallen, ein Eigenschaftswort oder ein Umstandswort mit großer Anfangsletter zu versehen, vielleicht weil sie es für besonders vortrefflich gewählt hielten. Johann pflegte solcherlei Wörter zielsicher auszumachen und diesen ohne jedes schlechte Gewissen die ihnen gebührende Erniedrigung der Kleinschreibung angedeihen zu lassen. Solcherlei Fähigkeiten waren freilich Spezialitäten, die fraglos kein anderer in der Schriftsetzerei des Amper-Boten sein Eigen nennen konnte, gewiss auch nicht der Meister.
Johann hatte so viele Namen, Begrifflichkeiten und Phrasen auf Stehsatz liegen wie kein anderer in der Schriftsetzerei. Dabei befand er sich erst seit zwei Jahren beim Amper-Boten in braver Anstellung. Überhaupt war Johann erst seit zwei Jahren in Dachau ansässig. Er stammte ganz eigentlich aus einem winzigen Dorf nahe dem bereits erwähnten Rosenheim, in welcher Stadt er seine Lehrjahre bei einer Zeitung verbracht, die solchen mit Auszeichnung beendet und sich danach in keiner Handvoll an Jahren als Geselle in seinem Handwerk geradezu perfektioniert hatte.
Jedoch wo einer gelernt hat, dort vermag selbst der Allerbeste nichts wert zu sein, und so hielt man Johann in der Rosenheimer Schriftsetzerei klein, bis er endlich das Weite suchte und jenseits des gewaltig großen München im beschaulichen Dachau beim Amper-Boten Anstellung fand. In dessen Setzstube setzte er von seinem ersten Arbeitstag an mit einer Geschwindigkeit, die es ihm erlaubte, in der Zeit nach dem Setzen der ihm zugewiesenen Seite bis zum Dienstschluss hin einen umfangreichen Stehsatz anzulegen. Für dessen Aufbewahrung und einer übersichtlichen Ordnung halber hatte Johann sich einen zweiten Setzkasten angeschafft, freilich aus eigener Tasche bezahlt, und diesen rechterhand seines eigentlichen Setzkastens aufgestellt. In diesem zweiten Setzkasten stapelten sich feinsäuberlich und in alphabetischer Reihenfolge aufgereiht die verschiedentlichsten Stehsätze.
Ganz unten in seinem zweiten Setzkasten und damit am einfachsten zu greifen, hatte er über zwei Jahre hinweg einen Sonderbereich eingerichtet, in welchem sich die am öftesten benötigten Stehsätze aufhielten. Dort fanden sich in der Hauptsache häufig zu verwendende Namen, Floskeln und Redewendungen, allesamt Buchstabenfolgen, deren Aneinanderreihung den Schreibern in der Schreibstube zu schreiben, den Schriftsetzern in der Setzstube zu setzen und den Lesern in der heimischen Stube zu lesen längst zu einer nahezu alltäglichen Gewohnheit geworden war.
Erst gestern hatte Johann gut drei Dutzend seiner Stehsätze in praktische Verwendung zu bringen vermocht. Johann konnte nicht begreifen, dass es in der Setzstube immer noch Kollegen gab, die den Namen des Führers Tag für Tag und Letter für Letter aufs Neue setzten. Er hielt solcherlei Kollegen freilich nicht für schlechte Deutsche, jedoch ganz gewiss für schlechte Schriftsetzer und tumbe Zeitverschwender. Schon während seiner Lehrzeit in Rosenheim hatte Johann die Erfahrung gemacht, dass es den Namen des Führers nahezu täglich zu setzen galt, also empfand Johann es schlichtweg als eine kluge Konsequenz arbeitsamer Gewissenhaftigkeit, den Namen des Führers jederzeit auf Stehsatz einsatzbereit zu wissen. Adolf Hitler, dies zumindest war Johanns Meinung und Überzeugung, hatte man als Schriftsetzer einfach auf Stehsatz zu haben. Johann hatte den Führer gleich in zehnfacher Ausfertigung in seinem Stehsatz liegen. Auch andere Namen und Begrifflichkeiten kamen in den zahlreichen Berichten, die ihnen Tag für Tag aus der Schreibstube zugereicht wurden – wobei Zureichen wohl das falsche Wort sein mag, es glich mehr einem achtlosen und bisweilen arroganten Hineinklatschen der Schreibmaschinenseiten in den Eingangskasten – in einer Häufigkeit vor, dass es für Johann geradezu eine Frage der Ehre geworden war, nach Möglichkeit sämtliche in seinem Stehsatz vorrätig zu wissen.
+
Stehsatz des Schriftsetzergesellen Johann Bauer (Auszug):
Adolf Hitler…; Beigeordneter Hans Zauner…; Bürgermeister Cramer…; Café Ludwig Thoma…; Dachauer Film-Ecke…; Der Führer hat es uns zur gefälligen Aufgabe gemacht…; Der Kunstmaler und Vorsitzende der KVD Kallert…; Der Vorschlag des Bürgermeisters fand bei den Ratsherren einhellig Zustimmung…; Die Ergebnisse der Fußballspiele vom Wochenende…; Drunten im Lager…; Es ist die Pflicht eines jeden Volksgenossen…; Es ist ein Gebot der Höflichkeit…; Es kann und darf doch nicht sein, dass…; Es trafen sich im Gasthof Unterbräu…; Gauleiter Wagner teilt mit…; Hoch steht das Korn schon in den Feldern…; H. Seemüller, Dachau2…; In den schrecklichen Tagen der Systemzeit…; In unserem schönen Dachau…; Im Lichtspielhaus zu sehen ist das erbauliche Filmwerk…; Kreisleiter Eder…; Niemand wird die Notwendigkeit bezweifeln, dass…; Omnibuslinie Dachau – KZ, Abfahrtszeiten…; Regierungspräsident, Parteigenosse Gareis…; Unser Führer und Dachauer Ehrenbürger Adolf Hitler…; Viel zu früh von uns gegangen ist…; Volksgenossen, seid gewahr…; Volksgenossen, aufgepasst!...; Vor dem Schloss droben auf dem Berg wehen wieder einmal stolz die Fahnen…; Wie Bürgermeister Cramer gestern bekanntgab…; Wie Gauleiter Wagner bekanntgab…; Wie Kreisleiter Eder bekanntgab…; Wie aus der Wochenschau zu erfahren war…; Wie wir bereits berichtet haben…; Wie wir den Juden kennen, ist er…; Winterhilfswerk, es gilt zu opfern…; Wochenmarkt: Die festgesetzten Preise…; Zu einem schrecklichen Unglück kam es…; Zu Zuchthaus verurteilt und sogleich in selbiges verbracht wurde…;
+
Johann Bauers Arbeit am Setzkasten glich einem Rad, das sich wie von selbst immer schneller drehte. Je flinker er setzte, umso mehr Zeit verblieb ihm bis zum Feierabend hin, seinen Stehsatz auszubauen. Und je umfangreicher sein Stehsatz geriet, desto schneller war er in der Lage zu setzen. Johanns Kollegen waren dem Neuen aus Rosenheim anfangs mit einigermaßenem Argwohn begegnet, kein Wunder, waren sie doch allesamt gebürtige oder in langen Jahren tüchtig geübte Dachauer und somit von einem gewissen Menschenschlage, dem man nachzusagen pflegte, einem Fremden nicht ohne weiteres und unbesehen über den Weg zu trauen – vor allem dann, wenn dieser Anstalten machte, für längere Zeit in der Stadt zu bleiben, oder gar meinte, hier sesshaft zu werden. Doch da der talentierte Johann ganz gewiss nicht zur Großspurigkeit und Prahlerei neigte und noch dazu seinen beneidenswert umfangreichen Fundus an Stehsätzen jedermann zur Verfügung stellte, der feierlich beschwor, die Leihstücke nach ihrer Verwendung wieder geflissentlich im Setzkasten einzureihen, und da er jederzeit und ohne Murren bereit war, Mehrarbeit beim lästigen Setzen kurzfristig eingereichter Inserate zu leisten, war er längst gut gelitten im Kollegenkreis, in welchem er inzwischen ehrfürchtig der Letternkönig genannt wurde.
Der Meister schlurfte nun gemächlich von Untergebenem zu Untergebenem und krümelte, während er dies tat, mit seinem Daumen und Zeigefinger getrocknete Reste von Bratensoße aus dem Dickicht seines Bartes auf den Boden hinab, die ihm beim vorherigen Vertilgen seines Mittagsmahls droben im Kochwirt in dasselbe hineingetröpfelt war. Er hieß Johanns Nebenmann, den Stift, einen elendigen Stümper, der sich am Zeilenende nach Strich und Faden um jegliche Worttrennung herumschummle. „Irgendwann werden die Spatzen“ – so pflegte der Meister die Spatien zu nennen, die man als Abstände zwischen die einzelnen Wörter einsetzte und mit Hilfe derer man sich um missliebige Worttrennungen drücken konnte, indem man so viele von ihnen zwischen zwei Wörtern aneinanderreihte, wie es brauchte, um das zu trennende Wort einfach in Gänze in die folgende Zeile zu verbannen – irgendwann würden also, um endlich zur Wortwahl des Meisters zurückzukehren, „die Spatzen über dich herfallen und dich mit Haut und Haaren auffressen. Glaub mir, es ist schon mancher Lehrbub von seinen eigenen Spatzen gefressen worden, auch hier in der unsrigen Stube. Ganz gemächlich picken die Spatzen an dir herum, aber irgendwann, wenn du so weitermachst, wirst du Vogelfutter, und dann will ich nicht dabei gewesen sein. Vogelfutter hab ich immer schon vorher und rechtzeitig rausgeschmissen. Ich will doch nicht mit eigenen Augen zusehen, wie einer von seinen eigenen Spatzen höchstpersönlich zerfleischt wird.“ Der Meister klopfte dem Stift mit einem hölzernen Lineal leicht auf den Kopf. Wenn dem Stift nun wieder die Tränen auskamen, wie es ihm oft passierte, wenn ihn der Meister ausschimpfte, und eine davon auf die Lettern im Winkelhaken tropfte, dann würde an dieser Stelle die Druckerschwärze nicht ansetzen und ein Schriftloch in die Zeitungsseite schießen. Johann nickte dem Stift still zu, was bedeuten sollte: Brauchst nicht wieder weinen, ich geh dir nachher zur Hand.
Der Meister schritt weiter und stellte sich nun hinter Johann. „Fertig mit der Seite?“
Johann schüttelte den Kopf. „Der Bericht über den Rühmann-Film im Lichtspielhaus muss noch rein.“
Der Meister fing unversehens an zu singen. „Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frau’n, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin.“ Zu seinem leidlich wohlklingenden Singsang schwang er mit Begeisterung sein Lineal durch die Luft, als wäre er ein Dirigent oder Kapellmeister und sein Holzlineal ein Taktstock. Dann herrschte er Johann an: „Hernach hilfst du noch bei den Kleinanzeigen. Der Apotheker droben auf dem Berg hat eine neue Schrundensalbe zusammengemanscht. Er wünscht sich eine Schrifttype mit besonders ruhigen und weichen Lettern.“ Nach seinem Rundgang verschwand der Meister in seinem von der Setzstube abgetrennten Kabuff. Der Lehrling begann sogleich zu schniefen und wischte sich mit dem Handrücken über die Wangen.
Johann Bauer blickte auf seine Hände. Heute zitterten sie besonders stark. Das Zittern, dieses elendigliche, vermaledeite Zittern! Johann wünschte es zum Teufel. Das Zittern, es kam von dem verdammten Bericht über den Verkehrsunfall in der Hindenburgstraße, den er am Vormittag zu setzen gehabt hatte. Der Unfall war seines ganz offenkundig spektakulären Hergangs zum Trotze glücklicherweise glimpflich ausgegangen, es war lediglich ein Fahrrad in recht arge Mitleidenschaft gezogen worden, dessen Fahrer gerade noch rechtzeitig hatte abspringen können, ehe sein Vehikel mit dem ungleich mächtigeren Gefährt eines Lastwagenfahrers kollidierte. Jedoch immer, wenn Johann einen Verkehrsunfall zu setzen hatte, begannen seine Hände zu zittern. Denn dann kehrte unaufhaltsam und gänzlich gegen seinen Willen die Erinnerung zurück an die junge Frau in dem Automobil.
Vor einigen Monaten, an einem besonders finsteren und nebligen Abend Ende November des Jahres 1937, war Johann spazieren gegangen. Gerade als er in der Mittermayerstraße an der dortigen Gastwirtschaft vorüberging, kam ein Automobil herangebraust, dessen Bremsen mit Plötzlichkeit zu quietschen begannen. Der Wagen kam direkt neben Johann zum Stehen und sogleich aus dem Fahrzeuginnern ein Mann auf die Straße herausgesprungen, der zu Johann auf den Gehsteig lief und diesen an den Schultern packte, als hätte Johann etwas gestohlen oder etwas anderes angestellt. Jedoch der Anlass für das laute Bremsen, eilige Herausspringen und unerhörte Schulterpacken, er war schlimmer. Der Mann deutete zum Auto hin, das mit laufendem Motor mitten auf der Straße stand und dort mit seinem Auspuffrohr keuchend Abgas ausspie, als galt es, den dichten Nebel noch zusätzlich mit seinen Gasen zu nähren. Der Autofahrer rief so laut, als stünden er und Johann nicht Gesicht an Gesicht, sondern gut hundert Meter weit voneinander entfernt: „Auf dem Rücksitz liegt eine Frau. Sie stirbt, wenn wir sie nicht schnell ins Krankenhaus bringen. Fahr mit und hilf mir, sie ins Krankenhaus zu tragen.“ Seine Stimme zitterte und gellte geradezu vor Aufregung.
Johann gehorchte dem Fremden und stieg ein. Als er sich vom Soziussitz zur Rückbank wandte, starrten ihn von dort hinten im Wagen zwei weit aufgerissene Augen an. Die Lippen der Frau, die mit merkwürdig verkrümmten Gliedern auf der Rückbank lag, bewegten sich. Beim Knattern des Motors konnte Johann nicht hören, was die Frau sagte. Er beugte sich zwischen dem Fahrer- und dem Beifahrersitz zu ihr nach hinten, hielt sein Ohr ganz nah an ihre Lippen und hörte: „Hilf mir, Heinrich. Hilf mir, Heinrich. Hilf mir, Heinrich.“
„Sie irren sich. Ich bin nicht Heinrich“, hatte Johann geantwortet, und ihm war, als hörte die Frau, nachdem sie seine Worte vernommen hatte, augenblicklich auf zu atmen. Beim Krankenhaus angekommen trugen Johann und der fremde Autofahrer die Frau eilig in den Sanitätsraum. Dort nahm der dienstschiebende Arzt die Verunglückte sogleich in kurzen Augenschein. Johann konnte sich noch gut an dessen Worte erinnern. Es waren nur wenige. „Warum schleppt ihr mir eine Leiche ins Haus? Ich bin Arzt, kein Zauberer“, hatte der Diensthabende gesagt und der Gestorbenen die Augenlieder geschlossen.
Johann vermochte sich nicht mehr in jedem Detail an das Gesicht der Frau zu erinnern. Er wusste nur: Sie war jung, sie war schön, sie war tot. Und sie suchte ihn seither in seinen Träumen heim.
+++
Die Unterkunft des Schriftsetzergesellen Johann Bauer lag nicht weit entfernt vom Anwesen des Amper-Boten. Johann hielt diesen angenehmen Umstand ein kleinwenig für das verdiente Glück eines tüchtigen Gesellen, der vor und nach einem langen und harten Arbeitstag nicht noch eine Stunde mit dem Zug oder dem Fahrrad fahren musste, um zur Arbeit oder von dieser nach Hause zu gelangen, wie dies einige seiner Mitbewohner im Gesellenhaus auf sich zu nehmen hatten. Johann dagegen brauchte lediglich über die Straße zu gehen, denn das kleine Wohnheim, in dem er Unterkunft gefunden hatte, befand sich im rückwärtigen Hause des Gehöfts direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Es handelte sich um ein Mietshaus für junge und freilich ledig zu seiende Gesellen, in welchem er sich im ersten Stockwerk ein Zimmer mit einem Schreiner aus Oberstdorf teilte. Das Mobiliar des Zimmers bestand aus zwei schmalen Betten links und rechts an den Wänden zwischen Tür- und Fensterseite, einem Holztisch vor dem Fenster, zwei Stühlen, zwei Nachtkästchen und einem Schrank, den es sich zu teilen galt. Am Boden auf Johanns Seite des Zimmers stapelten sich allerlei Bücher, die meisten davon abgegriffen und zerlesen, da bereits durch vieler Männer Hände gegangen und von ebenso vielen Augen gelesen. Karl Mays Winnetou, Defoes Robinson Crusoe, Dumas’ Der Graf von Monte Christo, Coopers Der letzte Mohikaner, Vernes Reise um die Erde in 80 Tagen, Stevensons Die Schatzinsel, Melvilles Moby Dick, dieser freilich in einer gekürzten und verständlichen Fassung, Twains Tom Sawyer und einige weitere Abenteuerromane. Johann konnte nicht genug bekommen von den spektakulären Abenteuern, den gemeingefährlichen Erlebnissen und erschütternden Fährnissen seiner Romanhelden, ihren Entdeckungsreisen und Überlebenskämpfen, den irrwitzigen Schelmenstücken und Schatzsuchen, den Rettungsmissionen und Rachefeldzügen. Johann liebte seine Bücher und das, was er in ihnen zu erkunden und erleben vermochte, wohl vor allem aus jenem Grunde, dass sich die Tage seines eigenen Lebens in zäher Ereignislosigkeit aneinanderreihten.
Dabei war es keineswegs der Fall, dass Johann in den einundzwanzig Jahren, die er nun schon unter diesem Himmel währte, noch nichts erlebt hatte. Jedoch das eigene Erlebte empfand Johann als zutiefst ungeeignet, es aus freien Stücken und wachen Geistes zu ergründen, pflegte es sich doch ohnehin mit absolutester Gewissenlosigkeit und mitleidlosester Unbarmherzigkeit in seine Träume zu drängen. Und davor hegte Johann eine Heidenangst.
Johann fürchtete sich nicht vor den Menschen, er ängstigte sich nicht vor ihnen im Allgemeinen, er fürchtete nur einen einzigen von ihnen, und dieser war längst und endlich tot. Doch die Furcht vor dem verhassten Vater war nicht mit diesem gestorben und nicht mit dessen Seele, so der Vater überhaupt eine solche besessen hatte, zur Hölle gefahren. Noch immer gab es Nächte, es waren viel zu viele, da schreckte Johann schweißnass und angstschreiend hoch, und es bedurfte einer langen Umarmung seines Zimmerkameraden, endlich wieder zur Ruhe zu finden. Manchmal schoben sie nach Johanns Träumen ihre beiden schmalen Betten zu einer größeren Bettstatt zusammen, wie kleine Kinder dies taten. Kleine Brüder. Es mag wohl nun an der Zeit sein, endlich den Namen von Johanns redlichem Zimmerkameraden zu nennen, auf dass er uns fortan kein Anonymus bleibt, dessen sich zu erinnern oder ihn zu vergessen uns einerlei sein könnte. Johanns Zimmerkamerad, er trug den Namen Simon.
+
Johann Bauer hatte in seinem Leben zwei Menschen umgebracht. Beide hatte er zuvor noch nie gesehen. Nun saß er auf seinem Bett und blickte wieder auf seine Hände. Sie zitterten jetzt endlich weniger stark, aber das hieß freilich nicht, dass die Chose für heute überstanden war. Er musste wohl damit rechnen, dass sie heute Nacht wieder zu ihm kamen. Seit dem Unfall waren sie zu zweit. Der Alte, er hatte Unterstützung bekommen.
Johanns Zimmerkamerad Simon saß am Tisch vor dem Fenster und schnitzte an einem kleinen Stück Lindenholz. In dem Sägewerk, in dem er arbeitete, schuftete er an einer mächtigen Kreissäge, mit der er gewaltige Baumstämme zu Balken schnitt. Indes Simons Leidenschaft war insgeheim die filigrane Schnitzerei von Hand. Am liebsten fertigte er kleine Krippenfiguren aus Ahorn an, die er an allerlei Haustürhändler verkaufte. Außerdem machte sich Simon einen herrlichen Spaß daraus, winzigste Führerfigürchen zu schnitzen und diese anschließend heimlich an den unmöglichsten Orten zu platzieren. Einmal hatte die Hauswirtin in der Küche einen kleinen Holz-Hitler im Gläserschrank entdeckt, wo dieser wild entschlossen eine Kompanie Schnapsgläser grüßte. Ein andermal saß Simon auf der Holzbank neben der Haustür und fragte jeden, der über den Hof zum Haus ging oder aus der Tür in den Hof trat, ob er denn nicht zu grüßen geruhe, wie es sich gehörte. Freilich blickten die Gefragten sogleich recht irritiert drein, da Simon selbst ja ebenfalls nicht gegrüßt hatte. Daraufhin deutete Simon auf einen kleinen Holzführer, den er auf das Fensterbrett hinter der Sitzbank gestellt hatte, und der eifrig den Arm zum Gruße streckte.
Die Hauswirtin ließ Simon derlei Unsinn gnädig durchgehen, solang er es nicht übertrieb wie vor drei Wochen, als Simon in der Nacht auf dem Küchentisch nicht weniger als ein Dutzend Holzführer im Kreis aufgestellt hatte, die einer dem nächsten in den Rücken grüßten, und in die Mitte des grüßenden Führerkreises einen kleinen Papierzettel gelegt hatte, auf dem geschrieben stand: „Führer befiehl, wir folgen.“ Die Hauswirtin hatte die kleine Installation natürlich sofort weggeräumt, ehe die ersten Mieter zum Frühstück in der Küche erschienen. Danach war sie ohne jegliches Anklopfen ins Zimmer gestürmt und hatte Simon den Kopf gewaschen, freilich erst nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte.
Gehässig gebrüllte Kopfwäsche kannte Johann zur Genüge von seinem Meister in der Schriftsetzerei und zuvor von seinem Vater, aber je leiser die Kopfwäsche vorgetragen, umso eindringlicher spürte und ernstgemeinter empfand er sie. Die erboste Vermieterin hatte Simon mit einem Griff an dessen Schulter wachgerüttelt, und als der schlaftrunkene Geweckte endlich seine Sinne beisammenhatte, flüsterte sie diesem so leise zu, dass Johann es kaum hören konnte: „Wenn du sowas nochmal anstellst, dann schmeiß ich dich hochkant raus, Verwandtschaft hin oder her. Hast du verstanden?“
Simon rieb sich daraufhin träge den Schlaf aus den Augen, nickte stumm und wirkte augenscheinlich bekümmert.
Nun wandte sich die Hauswirtin an beide vor ihr Liegenden und zischte leise: „Und sperrt gefälligst ab, wenn ihr auf die schwachköpfige Idee kommt eure Betten zusammenzustellen. Man könnte ja fast denken, ihr zwei seid ihr wisst schon was. Ihr bringt uns alle noch in Teufels Küche.“
Während der eiligen Prozedur des Ankleidens berichtete der gescholtene Simon wieder einmal, dass er weitschichtig mit der Hauswirtin verwandt war. Johann kannte die Geschichte freilich schon lang, jedoch war er keiner von der Sorte jener Zuhörer, die sich daran störten, Geschichten immer wieder zu hören. Und weiß Gott, Simon war seinerseits gewiss der Letzte, dem es leichtfiel zu schweigen und eine Geschichte nicht aufs Abermalige und Wiederholte zu erzählen, bloß weil er diese schon des Öfteren zum Besten gegeben hatte. Also fuhr Simon, während er sich seine graue, speckige und von winzigen Holzsplittern gespickte Weste zuknöpfte, eifrig fort zu verkünden, dass sein alter Herr und der verstorbene Gatte der Hauswirtin Vettern und einst gemeinsam bei der SPD gewesen waren, als es die SPD und den Hauswirtinsgatten noch gegeben hatte. „Nach der Machtübernahme ist ihr Mann bald gestorben und mein alter Herr schleunigst rüber zu den Nazis.“
Es mag hier nun angebracht sein, die Geschichte, die Simon seinem Zimmerkameraden wortreich weitererzählte, während er sich ausführlich kämmte und im Anschluss seine immer noch widerborstig in sämtliche Richtungen vom Kopf abstehenden Haare mit dem Aufsetzen einer Schiebermütze zur Bändigung brachte, in aller Kürze selbst zu Ende zu erzählen – denn sie lässt sich durchaus knapper halten, als Simon sie vorzutragen pflegte, und, wie erwähnt, Johann kannte sie ja bereits in aller Ausführlichkeit und stand längst fertig angekleidet und zum Aufbruch bereit im Türrahmen. Etwa zwei Monate nach der Naziwerdung seines Vaters hatte Simon also das Elternhaus verlassen und das Weite gesucht, denn die liebe Mutter, derer es sich zu bleiben gehört und gelohnt hätte, war alsbald an der Grippe gestorben. Simon kam bei seinem Meister unter, bei dem er mehr schlecht als recht seine Schreinerlehre beendete, leistete im Anschluss Dienst bei der Wehrmacht und geriet schließlich in einem Sägewerk bei Allach in Anstellung.
Die geflüsterte Kopfwäsche der Hauswirtin ging Simon, so unbeeindruckt er auch tat, ganz offenbar zu Herzen. Fortan werde er keinerlei Führerfiguren mehr aufstellen, dieselben gar nicht erst schnitzen, sondern sich einzig und allein auf die Anfertigung von Krippenvieh konzentrieren. „Immer in schöner Abwechslung einen Ochsen und einen Esel. Zwei Ochsen oder zwei Esel hintereinander sind mir geradezu eine künstlerische und emotionale Unmöglichkeit. Ochs und Esel in steter Abwechslung erscheinen mir gerade noch erträglich“, hatte Simon an jenem Morgen der Kopfwäsche gesagt.
+
Doch nun zurück zum Abend jenes Tages, an dessen Vormittage Johann den erwähnten kurzen Zeitungsbericht über den harmlosen Verkehrsunfall zu setzen gehabt hatte. Obwohl Simon mit seinem Schnitzwerk beschäftigt war, entging diesem freilich nicht, dass Johann wieder einmal verstohlen auf seine Hände blickte. Simon legte sogleich sein Schnitzzeug beiseite und blickte seinen Zimmerkameraden an. „Mensch Johann, du kannst doch nichts dafür.“
Johann hob den Blick von seinen Händen und steckte diese in seine Hosentaschen, jedoch Simon in die Augen zu sehen getraute er sich nicht. Also besah er sich nun in aller Ausführlichkeit seine Hausschuhe, als wären diese in dem sich nun anbahnenden Gespräch von ganz besonderer Relevanz. „Du redest dich leicht“, sagte er, „du hast niemanden umgebracht. Doch ich, ich bin schuld. Weil ich ihr gesagt habe, dass ich nicht ihr Heinrich bin. Daran ist sie gestorben.“
Johann begann also wieder mit seiner selbstmitleidigen Litanei. Simon hatte sie seit dem Unfall im November gewiss hundertmal gehört. Sie zu kritisieren war ihm in letzter Zeit immer wieder in den Sinn geraten, indes hatte er es bisher doch bei seiner eingeübten Verfahrensweise belassen, nichts dergleichen zu äußern und stattdessen sein Bett an das seines Zimmerkameraden zu rücken. Jedoch heute nicht. Simon hatte sich fest vorgenommen, Johann endlich einen wehleidigen Egoisten zu heißen, sobald dieser aufs Neue zu seiner Trübsalblaserei und Weinerlichkeit anzuheben geruhte. Simon klopfte sich auf die Schenkel und schnaufte tief durch, um sich zu rüsten für seine Ansprache wider das kaum mehr zu ertragende Selbstmitleid seines Zimmerkameraden. „Jetzt halt den Mund und hör mir genau zu“, wollte Simon gerade rufen und hinzusetzen, „du glaubst wohl, dass nur dir allein auf der ganzen Welt etwas zugestoßen ist, und alle anderen nichts zu erleiden haben. Glaubst du, du bist der Einzige in diesem Haus, der schon einmal einen Toten gesehen hat? Ich habe auch schon Tote sehen müssen, meine eigene Mutter tot im Bett, wo sie doch schon auf dem Weg der Besserung war, und bei der Bergwacht drunten in Oberstdorf, da sind auch Leute verreckt, denen wir helfen wollten. Und die Hauswirtin hat ihren eigenen Mann im Speicher am Balken hängen gesehen. Also reiß dich endlich am Riemen, Johann. Reiß dich zusammen, wie wir anderen es auch tun.“ Dies alles und noch ein wenig mehr endlich und tatsächlich zur Sprache zu bringen, hatte Simon sich nach langen Stunden des Nachsinnens mit unumstößlicher Entschlossenheit vorgenommen. Jedoch es nun wahrhaftig auszusprechen, dazu blieb ihm keine Zeit.
Denn es pochte nun zweimal heftig an der Tür. Ohne ein Herein von Johann oder Simon abzuwarten, standen sogleich die Gebrüder Eberhart im Zimmer. Der jüngere Eberhart, ein Maurergeselle von drahtiger Figur und gerade einmal knapp zwanzig Jahren, jedoch mit einer vorlauten Klappe ausgestattet, wie sie sonst am Bau nur dem Polier zustand, rief sogleich freudestrahlend: „Österreich ist heim ins Reich!“ Er habe es, fuhr er rotbackig und schnaufend vor Erregung fort, gerade mit eigenen Ohren gehört, unten aus dem Volksempfänger in der Küche. Allerorten seien die Volksgenossen aufgerufen, sich sogleich auf den Plätzen zu versammeln. Der jüngere Eberhart forderte seinen älteren Bruder auf, nun auch an den Türen der weiteren Mitbewohner zu klopfen und die lang ersehnte Kunde zu verbreiten. Man treffe sich in zehn Minuten im Hof.
Der ältere Eberhart nickte viermal und stapfte tumben Schrittes aus dem Zimmer. Der Verstand des älteren Eberhart, dies gilt es zu wissen und nicht vorenthalten zu werden, so gern man ihn bald auch mögen mag, war nah am Schwachsinn. Aber auf dem Bau war der ältere Eberhart ein gefragter Mann, da er schleppen konnte wie ein Ochse und, mit vollkommener Schwindelfreiheit gesegnet, die stärksten und längsten Dachbalken über ungesicherte Stiegen nach oben trug, als käme ihm die allgegenwärtige Gefahr des Hinabstürzens und Zerschellens nicht im Geringsten in den Sinn.
Nachdem der ältere Eberhart davongetrottet war, klopfte der jüngere Eberhart Simon kräftig auf die Schulter. „Endlich sind die Österreicher heim ins Reich. Jetzt ist es geschehen, endlich, endlich.“
Simon umarmte den jüngeren Eberhart, klopfte ihm mit der flachen Hand mehrmals auf den Rücken und versprach, man werde in zehn Minuten pünktlich im Hof eintreffen. Wenn jemand wie Österreich endlich heimkehre in ein Reich, in dem es noch nie gewesen war, gelte es dieses Ereignis freilich gebührend und ausgelassen zu feiern.
Der jüngere Eberhart wusste nicht recht, was er von den Worten seines Zimmernachbarn zu halten hatte, konnte aber nicht weiterhin darüber nachsinnen, da nun wieder der ältere Eberhart im Türrahmen erschienen war und zu seinem Bruder sagte: „Du hast vor einer Minute gesagt, ich soll zehn Minuten sagen. Soll ich trotzdem noch zehn Minuten sagen? Weil dann kommen die Leute, denen ich jetzt zehn Minuten sage, doch eine Minute zu spät.“
+
Der Frage, ob sich die Bewohner des Gesellenhauses denn nun pünktlich im Hofe einfanden, braucht hier freilich nicht in aller Ausführlichkeit auf den Grund gegangen zu werden, genügt uns doch zu wissen, dass im Verlauf der folgenden Viertelstunde nach und nach zahlreiche junge Handwerker aus dem Haus traten, allesamt zum Aufbruch bereit. Die träge Märzsonne war längst untergegangen. Eisiger Wind blies über den gekiesten Hof, eine weitere Frostnacht kündend. Sie waren zu acht, Johann und Simon, die beiden Eberharts und vier Arbeiter der nahen Papierfabrik. Die Hauswirtin selber hatte nicht mitkommen wollen. Sie begänne bereits in kaum einem Meter Entfernung vom Ofen in der Küche mit dem Frösteln, da werde sie heute gewiss keinen Schritt mehr vor die Tür tun, komme heim ins Reich, wer wolle. Ganz offenbar brüte sie gerade eine stattliche Erkältung aus oder mindestens einen sauberen Katarrh, vielleicht drohe gar eine üble Grippe, da das Fieberthermometer bereits haarscharf an einer achtunddreißig rangiere, hatte sie gesagt, ihren wuchtigen Körper in eine Wolldecke gewickelt und ihren Rücken in voller Breite gegen die wohlig warmen Fliesen des Kachelofens gelehnt. Ebenso wenig wie die kränkelnde Hauswirtin wollten die zwei Bäckergesellen aus dem Zimmer unterm Dach von der erfreulichen Neuigkeit der Wiederkehr Österreichs wissen. Sie mussten in aller Herrgottsfrüh raus und gingen lieber zeitig zu Bett, statt wieder einmal anderen Leuten beim Marschieren zuzusehen. „Die werden sich ohne uns schon nicht verlaufen“, hatte einer der Bäcker gesagt und dem älteren Eberhart die Tür vor der Nase zugeknallt.
+
Die acht Neugierigen stoben über die feuchten Stufen der Martin-Huber-Treppe den Altstadtberg hinunter zur Schulwiese hin, von der bereits Trommelschläge heraufklangen und vom baldigen Beginn des Aufmarsches kündeten. Unten am Ende des Treppenwegs, wo sich ein altes, brüchiges Brückerl über den Mühlbach quälte, blieb einer der Papiermacher stehen, zog mit breitem Grinsen im Gesicht ein Schnapsfläschchen aus der Innentasche seiner Winterweste und nahm einen kräftigen Schluck. Sodann ließ er das Fläschchen herumgehen. Ein jeder trank gern einen Schluck. Es war ein Obstler. Der Schnaps brannte im Hals und tat sogleich seine wärmende Wirkung. Nachdem alle getrunken hatten, traten sie hinaus aus dem Schutz der Sträucher und Bäume und liefen über die Ludwig-Thoma-Straße der Schulwiese entgegen.
Ein praller Mond und ein nahezu wolkenloser Sternenhimmel tauchten die Wiese in graues, nicht allzu finsteres Dunkel, als ängstigte sich die Nacht, die Szenerie gänzlich schwarz zu tünchen, denn mächtig schlugen die Trommeln, und schrill gellten die Pfeifen, und prächtig streckten sich die Fahnen und Banner in den Himmel, in welche der eiskalte Wind kaum hineinzublasen wagte.
Von allen Seiten prasselten Stiefelsohlen im Formationsschritt heran. Die Hitlerjugend marschierte von der Schleißheimer Straße kommend über die Amperbrücke, alle paar Meter eilfertig und fröhlich „Heil Hitler“ rufend. Die stattlichen Mauern des Schulgebäudes nahe der Wiese riefen gehorsam zurück. Vom Oberlauf des Mühlbachs her nahten in Dreierreihen die jungen Männer des Arbeitsdienstes, und von Richtung der Papierfabrik kamen die Formationen des Luftschutzes und der Sanitätsabteilung herangeschritten. Männer der SA und SS formierten sich, stolz die dampfenden Nasen in die Nacht gereckt, bereits auf der Wiese.
Am Rand derselben stand ein Lastwagen geparkt, von dessen Ladefläche SS-Männer eifrig Fackeln herunterreichten. Kameraden stapelten sie auf hölzernen Klapptischen. Vor jedem Tisch loderte Feuer in gusseisernen Kelchen. Über die Wiese waberte der Gestank von brennendem Petroleum. Von überallher strömten Schaulustige heran. Als endlich alles aufmarschiert war, machte ein Sturmbannführer dem Versammlungsleiter lauthals Meldung.
Die Bewohner des Gesellenhauses schauten dem dienstfertigen und geschäftigen Treiben auf der Schulwiese frohgemut und heiter schnatternd zu. Ein fast jeder wusste etwas zu sagen. „Schaut her, da drüben steht der windige Lehmann von der Papiermaschine eins“, raunte einer der schnapslaunigen Papiermacher. „Im Kittel ist er ein Krischperl und ausgewachsener Blödian, aber schaut ihn euch an, wie er jetzt dasteht in seiner prächtigen Uniform. Als hätt’ er irgendwas zu wollen oder sagen.“
„Dem gerade Meldung gemacht wurde, das muss der Kreisleiter der Partei sein“, raunte ein anderer Papiermacher und deutete auf den Versammlungsleiter. „Die Leute sagen, er ist ein ganz scharfer Hund. Eder heißt er mit Namen.“
Der jüngere Eberhart lächelte und meinte, dann wäre dieser Eder jemand ganz nach seinem Geschmack.
Simon neigte den Kopf und besah sich den Kreisleiter. „Der Kerl ist ja kaum zwei Stunden älter als wir.“
„Mitte dreißig soll er sein, hab ich gehört. Angeblich bereits seit sechsundzwanzig bei der Partei“, sagte der Papiermacher.
Simon stieß den jungen Eberhart in die Seite. „Dann stehen die Chancen ja nicht schlecht, dass du spätestens neunzehnhundertfünfzig ebenfalls Kreisleiter bist, so stramm wie du stehst.“
Der junge Eberhart stieß Simon zurück. „Besser zur rechten Zeit strammstehen als ein Leben lang katzbuckeln. Noch dazu, wenn es für eine ehrbare Sache ist.“
Nachdem Kreisleiter Eder die Meldung des Sturmbannführers abgenommen hatte, schritt er zu einer in der Mitte der Wiese aufgestellten Mikrofonanlage und begann unverzüglich zu sprechen. „Volksgenossen, es gibt eine Parole, die an diesem Tage alle Deutschen eint, hüben und drüben, eine Parole, die aus Linz tausendfach zu uns herüberschallte und die unsere Jahrtausende alte Sehnsucht ganz eindringlich zum Ausdruck bringt: Ein Volk – ein Reich – ein Führer!“
„Mir war gar nicht recht bewusst, dass wir uns schon seit Jahrtausenden danach gesehnt haben, uns ein Reich mit den Österreichern zu teilen“, flüsterte Simon.
Der junge Eberhart feixte leise: „Du bist einfach nur grantig, weil dein kleines Oberstdorf jetzt nicht mehr das südlichste Kaff im Reich ist.“
Die SS-Männer hatten nun endlich sämtliche Fackeln vom Lastwagen abgeladen und begannen diese zu entflammen, indem sie die Spitzen der Fackeln in das brennende Petroleum streckten. Die lodernden Fackeln reichten sie eine nach der anderen den angetretenen Fackelträgern.
Der Kreisleiter sprach weiter. „Freude und Dank bewegt und eint uns in diesen Stunden. Die österreichische Frage, die eine ständige Gefahr für den Frieden Europas darstellte, ist durch die Ereignisse der letzten Stunden gelöst worden. Im Bruderlande jubeln die befreiten Volksgenossen dem Führer und seinen Truppen zu. Ein volksfremdes System, das mit brutaler Gewalt, mit Terror und Unterdrückung das österreichische Volk geknebelt hat, ist durch den Zorn des Volkes hinweggefegt worden.“
Die SS-Männer entzündeten rasch Fackel um Fackel. Immer heller glomm die Schulwiese rotgelb in der Nacht. Licht und Schatten hetzten über stolze Antlitze, Uniformen und Parteiabzeichen.
Der Redner blickte in den Nachthimmel. „Mehr denn je gedenken und danken wir in dieser feierlichen Stunde unserem Führer. Sieg Heil!“3 Aus hunderten Kehlen schallte sogleich die Antwort und brauste den Sternen zu.
Der ältere Eberhart rief am lautesten und längsten, gleich vier- oder fünfmal. Sein Stumpfsinn schien sich geradezu an der Wiederholung zu ergötzen, bis der jüngere Eberhart ihn am Arm packte und ihm mit einem leichten Klaps auf den Hinterkopf zu verstehen gab, dass es irgendwann auch mal genug war.
Der Sturmbannführer gab Befehl zum Abmarsch. Der Zug setzte sich in Bewegung. Einer der Papiermacher drängte zum Aufbruch. Denn wenn sie nicht vor dem Fackelzug an der Mühlbachbrücke ankamen, müssten sie warten, bis das ganze Trara vorübergezogen war. Die acht Gesellen liefen los und gelangten rechtzeitig vor dem Fackelzug über die Straße. Während die Papiermacher und die beiden Eberharts die Treppe hinauf in die Altstadt stiegen, blickte sich Johann nach seinem Zimmerkameraden um, der sich von den anderen unbemerkt ein wenig zurückfallen lassen hatte. Johanns suchender Blick fand Simon auf der Ludwig-Thoma-Straße stehend, wo dieser eine seiner kleinen Schnitzfiguren aus der Hosentasche zog und auf die Straße stellte. Danach lief Simon zu Johann und grinste.
„Ochs oder Esel?“, fragte Johann.
Simon lachte und legte Johann den Arm auf die Schulter. „Heute ein Esel.“
Während Johann und Simon einträchtig die Stufen hinauf zum Gesellenhaus gingen, trat unten auf der Thoma-Straße ein Stiefel, ohne dass dessen Besitzer das von Simon platzierte Figürchen auch nur im Geringsten wahrgenommen hätte, hinab auf den Esel. Vielleicht verspürten er und sämtliche, die ihm im Marschtritt folgten, eine kleine Unebenheit unter der Stiefelsohle, die man womöglich für einen Tannenzapfen oder einen abgenagten Apfelbutzen hielt oder für eine von einem Bauernkarren gekullerte Kartoffel, jedenfalls für etwas zu Vernachlässigendes, dem Aufmerksamkeit zu schenken sich gewiss in keiner Weise lohnte. Nachdem der Fackelzug vorübermarschiert war, lag der Esel zur Unkenntlichkeit zermalmt im schwindenden Lichtschein der Fackeln in einer Pfütze, zu ein paar Holzsplittern geworden, nass und plattgetreten und zerrieben, als wäre er niemals Figur gewesen, sondern immer nur bedeutungslose Masse.
+
Anderntags in der Schriftsetzerei setzte Johann den Artikel über die Kundgebung auf die Titelseite des Amper-Boten. Der Kollege in der Schreibstube hatte klangvolle und pathetische Worte gefunden. „Die Lieder des Volkes klingen auf, feierlich, inbrünstig. Dann setzt sich der stolze Zug in Bewegung, das leuchtende Band zieht durch die Straßen, die roten Fahnen leuchten auf, wenn sie in den Schein der Fackeln geraten. Zum Marktplatz herauf kommen sie im sicheren Schritt geeinter Kraft und Disziplin. Das famose Lichtwunder dieser geschichtlichen Nacht verlischt. Gesang und Marschtritt verklingen. Wieder glänzen nur die ewigen Sterne über der stillen, nächtlichen Stadt. In allen Herzen aber leuchtet der Sieg, und was an persönlicher Sorge im Leben des Einzelnen ist, wird klein und belanglos.“4
Johanns Nacht indes war keineswegs belanglos vonstattengegangen. Sein Vater hatte wieder, und wie zu erwarten gewesen war, neben Johanns Bett gestanden, breitbeinig und riesig und bedrohlich, brüllend und Geifer speiend und sogleich zur Tat schreitend. Er drosch mit seinem Ledergürtel auf Johann ein. „Du hast die Mutter umgebracht, du hast sie verbluten gemacht, sie elendig verrecken lassen“, plärrte er bald schwer schnaufend, denn zu schlagen, wie der Vater es zu tun pflegte, war eine gehörige Anstrengung, ehe er sich auf einen Stuhl fallen ließ und den Gürtel an die junge Frau mit den toten Augen weiterreichte. Die junge Frau griff nach dem Gürtel und schlug auf der Stelle zu. Leder klatschte auf nackte Haut und hinterließ rotdunkle Striemen, die metallene Gürtelschnalle schlug gegen Rippen, die knirschten und ächzten wie morsches Astwerk. Die junge Frau stierte Johann mit ihren toten Augen an und schalt ihn, „du hast mich umgebracht, weil du nicht der Heinrich bist, weil du nicht der Heinrich bist, weil du nicht der Heinrich bist“, und jeder ihrer Schläge geriet härter, bis die Haut nachgab und riss, und die Rippen nicht mehr knirschten, sondern knackten, ehe Johann schließlich schrie, „ich hab das nicht gewollt, ich hab doch nicht sagen wollen, dass ich es nicht bin.“ In diesem Augenblicke hatte Simon seinen Zimmerkameraden Johann schließlich aus dem Schlaf gerissen und in den Arm genommen, bis dieser endlich aufhörte zu zittern und zu weinen. Es dauerte bis zum Morgengrauen.
+++
Gegen Mittag des 11. April 1938 schlurfte der Meister durch die Schriftsetzerei und legte ein Geheft auf Johanns Tisch, freilich nicht ohne zuvor den Lehrling neben Johann getriezt zu haben, indem er so tat, als wollte er ihm mit dem Heft auf den Kopf schlagen. „Wenn ich mich mal ausstrecken will, dann lege ich mich in deine Abstände zwischen den Wörtern, elendiger Nichtsnutz.“ Der Stift begann sogleich zu schluchzen. Im Kreise der Kollegen schloss man bereits heimlich Wetten darüber ab, wann der arme Bursche endlich hinschmeißen würde, um sein Glück fürderhin in einem anderen Handwerk zu suchen, das weniger filigraner Hände bedurfte als die Schriftsetzerei, vielleicht in einer Hufschmiede oder noch besser in einem Steinbruch.
Der Meister tippte mit dem Zeigefinger auf das Heft und wies Johann an: „Die Ergebnisse der Reichstagswahl von gestern brauchen setzen. Ein gewaltiger Haufen Zahlen, da können wir uns keine Schlamperei leisten. Kriegst du das hin?“ Johann nickte. Der Meister strich ihm unwirsch über den Haarschopf. „Wenn du mit dem Setzen fertig bist, gehst du augenblicklich zum Haareschneiden. Wir sind hier nicht bei den Hottentotten.“
Johann machte sich ans Setzen: Ergebnis der Reichstagswahl vom 10. April 1938. Gesamtergebnis Großdeutschlands: 99,03 Prozent stimmten mit Ja. Ergebnis Dachau: Eine Nein-Stimme in Dachau (Wahllokal Kirchenschule), ein Nein in Augustenfeld, drei ungültige Stimmen in Etzenhausen.
Johann stutzte. Mit den ihm gereichten Zahlen konnte etwas nicht stimmen. Er selbst hatte in der Kirchenschule mit dicken Lettern Nein auf den Wahlzettel geschrieben. Eigentlich hatte er mit Ja stimmen wollen, doch Simon hatte ihn tagelang und freilich flüsternd bekniet, ebenso wie er mit Nein abzustimmen. Also log jemand, und Johann schwor sogleich Stein und Bein, dass dies gewiss nicht Simon war. Ach, lügen, schalt sich Johann nach einer Minute des stillen und insgeheimen Nachsinnens für seine argen Gedanken. Wahrscheinlich hatten sie sich in der Hektik des Auszählens einfach nur verzählt oder einen Stimmzettel übersehen. Mechanisch setzte er die weiteren Zahlen aus dem Dachauer Land. Gemäß der offiziellen Mitteilung waren Simon und er nicht die einzigen gewesen, die sich am Wahltag die lustige Schelmerei erlaubt hatten, heimlich gegen den Führer zu stimmen. Im weiten Umkreise der Stadt Dachau mit all seinen Gemeinden, Dörfern und Gehöften gab es noch sechs andere solcher Frechdachse. Lustlos aber mit flinken Fingern, die heute nicht zitterten, da es seit Tagen keinen Verkehrsunfall zu setzen galt, fuhr Johann mit seiner Arbeit fort und setzte ohne groß darüber nachzudenken Letter für Letter. Bald gingen ihm die Einsen und Nullen aus, so dass er sich am Setzkasten des Stifts bedienen musste, denn in einer Vielzahl von Ortschaften hatten glatt einhundert Prozent der Wähler für den Führer gestimmt.
Nachdem alle Ergebnisse gesetzt waren, machte sich Johann an den Bericht über die Wahl: „Es wehen die Siegesfahnen! Geeint und gefestigt steht unser deutsches Volk in der Welt. Die Bande des Blutes haben sich als stark erwiesen. Wie im Reiche so wehen auch in Dachau von allen Häusern drei Tage lang die Fahnen des neuen Großdeutschlands. Wahr geworden ist, was einst in prophetischer Weise unser unsterblicher Horst Wessel in seinem Lied der deutschen Nation geschenkt hat: Bald flattern Hitlerfahnen über allen Straßen.
Ja, nun flattern die Fahnen über allen Straßen, die Knechtschaft ist gebrochen, und die einst geschmähte und gehasste Fahne des Hakenkreuzes ist zum Symbol des Sieges unseres Großdeutschlands geworden.
Die Dachauer Bevölkerung in Stadt und Land hat ihre vaterländische Pflicht vorbildlich erfüllt. Es ist unter uns nur eine verschwindend geringe Zahl von Unbelehrbaren, die sich mit ihrer Stimme außerhalb der deutschen Volksgemeinschaft hingestellt haben. Diesen Kreaturen soll angesichts des überwältigenden Ergebnisses die Schamesröte ins Gesicht steigen und dort für immer bleiben, als sichtbares Kennzeichen ihres Verrates am deutschen Reich. Nullkommanulldrei Prozent sind es im ganzen Kreisgebiet, und dieser Prozentsatz ist so gering, dass er den geschlossenen Ausdruck des Bekenntnisses der Dachauer Bevölkerung zu einem Reich, einem Volk und einem Führer in keiner Weise abschwächen kann.
Und darum wollen wir auch die Fahnen des Sieges stolz im Winde wehen lassen, wollen uns freuen über den erkämpften Sieg. Wir im Dachauer Land, das einst so schwer für den Nationalsozialismus zu gewinnen war, können das Ergebnis des Bekenntnisses unseres Kreises stolz mit denjenigen anderer Kreise vergleichen. Dachau marschiert auch hier mit an der Spitze, und dass dies auch weiterhin auf allen Gebieten so sein soll, das sei unser Gelöbnis, mit welchem wir aus dem erfochtenen Sieg hervorgehen.“5
+++
Die Künstlerinnen Lissa Kallert und Paula Wimmer6 standen am Rand der Schleißheimer Straße, die Häupter gesenkt, eine jede die Finger ihrer Hände ineinander verschränkt, und flüsterten selbst verfasste Fürbitten. Hin und wieder, nicht allzu häufig, trampelte eines der Automobile einer Wehrmachtskolonne mit seinen Rädern krachend in ein Schlagloch oder schmatzend in eine Pfütze, so dass Lissa und Paula nicht jedes Wort hörten, das die andere wisperte, jedoch der Herrgott, der Allmächtige, würde ganz gewiss verstehen.
„Lass ihr in deinem Himmelreich Respekt und Anerkennung zuteilwerden, wie sie dies verdient hat, ihr jedoch auf Erden versagt geblieben ist“, sagte Lissa Kallert.
„Wir bitten dich, erhöre uns“, nuschelte Paula Wimmer. „Und entlohne sie fürstlich für ihre Großherzigkeit, ihre Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe.“
„Wir bitten dich, erhöre uns“, antwortete Lissa Kallert nun ihrerseits auf Paula Wimmers Fürbitte hin, löste kurz die gottgefällige Verschränkung ihrer Finger, und wischte sich mit der Rechten eine bittere – nein dieses Wort will und vermag es nicht gänzlich und zufriedenstellend treffen, denn die winzige Träne auf Lissa Kallerts Wange ätzte wie Säure auf ihrer Haut und fraß sich geradezu heißbrennend hinein diese, jedoch um nicht weiter Zeit zu verlieren, wollen wir es bei dem hingeschriebenen Worte belassen –, also wischte sie sich mit dem Finger eine bitter vergossene Träne von der Wange. Nachdem sie dies getan hatte, sprach sie die nächste Fürbitte. „Lass unsre gute Nelly edelmütig und gnädig hinunterblicken auf uns Dagebliebene, die wir nicht den Mut aufbringen, ihr würdig zu gedenken.“
„Wir bitten dich, Herrgott im Himmel, erhöre uns.“ Paula Wimmer wischte sich nun ihrerseits mit den Ärmeln ihres grauen Jankers über ihre nahezu ebenso graugewordenen Wangen. „Und lass verdammt nochmal den Heinrich, den die Nelly so sehr geliebt hat, es mit ihren Werken sicher über die Grenze geschafft haben.“
Lissa legte ihren Arm auf Paulas Schulter. „Wir bitten dich, erhöre uns“, sagten sie nun gemeinsam und sahen einander kurz an, ehe sie hinabblickten auf die winzige Flamme, die am Docht einer neben dem Stamm einer kümmerlichen Birke ins nasse Moos gedrückten Kerze glomm. Die Flamme flackerte sogleich nahezu unmerklich im weidwunden Licht der sich zum Untergang senkenden Sonne, als zwinkerte diese, einer klammheimlichen Mitwisserin gleich, den beiden trauernden Frauen zu. Die Frauen bekreuzigten sich schnell, dann gingen sie eine jede die andere untergehakt in Richtung des Bahnübergangs zur Stadtmitte hin. Die lärmende Wehrmachtskolonne auf der Schleißheimer Straße war längst an den Schreitenden vorübergefahren. Nun schnaufte nur noch hin und wieder ein einzelnes Automobil an ihnen vorbei, es waren allerhöchstens drei in zehn Minuten. Paula Wimmer schüttelte den Kopf. „Wie viel an Pech und Unbill müssen denn überhaupt zusammengeraten, damit ausgerechnet in dem Augenblick, als unsre Nelly mitten in der Nacht auf die Straße rennt, ein Automobil daherkommt?“
„Hör endlich auf damit, Paula“, sagte Lissa Kallert. Ihre Stimme klang nun müde und ein klein wenig gereizt. Lissa, dies sollten wir wissen, ehe wir sie voreilig und ungerecht für gefühllos halten, besaß schlechterdings keine Kraft mehr, aufs Neuerliche und ewig Wiederholte über die Unfassbarkeit und Grauenhaftigkeit des Vorgefallenen zu sprechen. Schroffer als sie wollte, sagte sie: „Das Auto, es ist nun mal dahergekommen.“
„Wo Heinrich wohl sein mag?“, sagte Paula Wimmer. „Ob er es geschafft hat? Es ist nun genau ein halbes Jahr vergangen, und er hat sich noch immer nicht gemeldet.“
Auch in Lissa Kallert war von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, und als die Wochen sich schließlich zu Monaten vereinten, die Befürchtung gewachsen, dass Heinrich bei seinem Grenzübertritt erwischt worden war. Ihr Gatte August Kallert, Paula Wimmer und Lissa selbst waren abgesehen von Heinrich die Einzigen, die Nellys letzte Werke je zu Gesicht bekommen hatten. Die Gemälde und Zeichnungen waren auf dem Dachboden des Bürgersanwesens versteckt gewesen. Heinrich hatte ihnen die Werke gezeigt, in der Nacht nach der Beisetzung seiner Verlobten. Es waren Meisterwerke, allesamt geeignet jeden, der sie in Besitz hatte oder gar wagte, sie heimlich über die Reichsgrenzen hinweg ins Ausland zu schaffen, gewiss für lange Zeit ins Gefängnis oder ins Lager zu bringen. Gemeinsam hatten sie in jener Nacht Nellys und Heinrichs Gemälde aus den Spannrahmen gelöst, die Leinwände vorsichtig gerollt und zusammen mit den Zeichnungen und Skizzen in einem großen Koffer verstaut – und Abschied genommen voneinander. Heinrich hatte erst August, dann Paula und Lissa die Hand gedrückt, ehe er sich mit dem Koffer in der Rechten zum Bahnhof aufmachte, um den ersten Zug des nahenden Morgens nach München zu nehmen. Über welche Grenze er zu gehen plante, hatte er niemandem verraten. „Macht euch keine Sorgen um mich“, waren seine letzten Worte gewesen, dann war er hinaus auf die Straße getreten und dem Bahnhof zu geschritten, hatte sich nicht ein Mal umgedreht und war im Nebel des heraufziehenden Morgengrauens verschwunden.
„Ich weiß auch nicht, warum Heinrich sich nicht meldet. Ich bin mir sicher, dass er es über die Grenze geschafft hat“, sagte Lissa und erschrak über die Unsicherheit in ihrer Stimme. Sie klang fast so, als glaubte sie selbst nicht, was sie da sprach. Um ihre bitteren Gedanken zu vertreiben, legte sie Paula Wimmer einen Arm auf die Schulter und sagte: „Du bist verdammt nochmal die Einzige, die ich kenne, der es einfallen will, ihre an den Herrgott gerichteten Fürbitten mit einem stattlichen Fluch zu würzen.“
Lissa und Paula versuchten ein Lächeln. Es wollte ihnen nur leidlich gelingen.
+
August Kallert hatte keine Zeit gehabt, seine Gattin Lissa zu der heimlichen Gedenkstunde zu begleiten. Er saß mit seinen Künstlerkollegen Karl Prühäußer, Wilhelm Neuhäuser, Hugo Hatzler, Maria Langer-Schöller, Karl Schröder-Tapiau und Karl Thiemann7 in seinem Atelier und besprach die Werkliste der kommenden Sommerausstellung der Dachauer Künstlervereinigung. Die sieben Künstler bildeten heuer die Ausstellungsleitung8, und nun, da die Eröffnung Anfang Juli bereits bedrohlich nahte, galt es Nägel mit Köpfen zu machen. Heute hieß es nicht immer nur zu diskutieren, sondern es war endlich eine Entscheidung darüber zu treffen, welche der vielen von ihren Kollegen eingereichten Kunstwerke ihrer Ausstellung tatsächlich würdig waren.
Kallert bat seinen Schriftführer Hugo Hatzler ein letztes Mal die provisorische Werkliste zur Verlesung zu bringen, ehe man abschließend über die Auswahl abstimme.
Hatzler begann mit monotoner Stimme vorzutragen: „Im Vestibül die Gedächtnisausstellung zu Ehren unserer verstorbenen Künstler. Bürgers, Buttersack, von Haug, Hölzel, Langhammer, Strützel, Taschner.“
„Besteht hier Einverständnis?“, fragte Kallert. Die Kollegen nickten. Kallert bat Hatzler fortzufahren.
Hatzler leckte exaltiert an seinem linken Zeigefinger, ehe er umblätterte. „Am Einlass zur Ausstellung freilich die Führerbüste des geschätzten Kollegen Neuhäuser.“
Kallert blickte in die Runde. Allseits Kopfnicken. Auch Neuhäuser nickte kurz, als hätte er nichts anderes erwartet und eine Zurückweisung seines Ansinnens, die herrliche Büste aufs Neue zur Ausstellung zu bringen, als nichts weniger denn einen persönlichen Affront empfunden, der gewiss einzig und allein auf den gehässigen Neid seiner Kollegen zurückzuführen wäre.
Hatzler blätterte erneut um und trug mit schwerlich zu übertreffender Lustlosigkeit vor: „In den Ausstellungsräumen im ersten Stockwerk in alphabetischer Reihenfolge Max Bergmann mit Mooslandschaft und Am Brunnen, Tony Binder mit Vorfrühling in Dachau, Blick ins Moos, Altes Rathaus Dachau, vier Amperlandschaften, Brücke bei Etzenhausen, Landschaft bei Etzenhausen, Kücheninterieur, Dachau, Bleistiftzeichnungen Mädchenköpfe, Alte Dachauerin, Besucher, Mittagssonne, Am Karlsberg, Kirche von Dachau, Bäume an der Amper.“
Kallert unterbrach seinen Schriftführer mit einem Handzeichen und sagte: „Schön, dass der Tony seine schwere Krankheit überwunden hat. Er wird ja heuer ein Siebziger und hat sich die stattliche Anzahl der ausgewählten Werke sicherlich verdient wie keiner.“