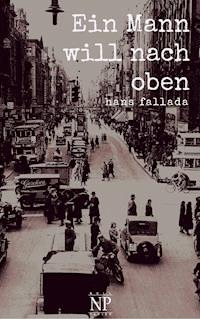
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hans Fallada bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Ungekürzte und kommentierte Ausgabe Die Berliner Variante des "großen Gatsby" – mit weniger Glamour, aber mit mehr Berliner Schnauze. Der 16jährige Waisenjunge Karl Siebrecht kommt nach Berlin, um die Stadt zu erobern. Er will als selbstständiger Unternehmer seinen Zipfel von der Wurst. Um sich zu finanzieren, nimmt er zunächst auch illegale Aufträge an. So lernt er auch die Schattenwelt Berlins, jenseits wilhelminischer Prüderie und preußischem Zackzack kennen. Das Buch bietet ein buntes Gemenge aus zwanzig Jahren deutscher Geschichte. Karl trifft auf Bonzen, Politiker, korrupte Polizisten, kleine Gauner und Huren mit großem Herz. Der Leser erlebt, wie sich Karl nach jedem Scheitern wieder aufrafft. Er ist unerschütterlich. Der Stoff wurde Ende der 70er sehr erfolgreich als TV-Mehrteiler verfilmt. In den Hauptrollen: Mathieu Carrière, Ursela Monn und Rainer Hunold Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1149
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hans Fallada
Ein Mann will nach oben
Ungekürzte und kommentierte Ausgabe
Hans Fallada
Ein Mann will nach oben
Ungekürzte und kommentierte Ausgabe
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Südverlag, München, 1953 (646 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962813-26-0
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Verfassers
Erstes Buch – Der Jüngling
Vorspiel – Die kleine Stadt
Erster Teil – Rieke Busch
Zweiter Teil – Kalli Flau
Dritter Teil – Franz Wagenseil
Zwischenspiel: In der fremden Heimat
Zweites Buch – Der Mann
Vierter Teil – Friederike Siebrecht
Fünfter Teil – Hertha Siebrecht
Sechster Teil – Ilse Gollmer
Nachspiel – Der Sohn
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Hans Fallada bei Null Papier
Jeder stirbt für sich allein
Der Trinker
Wer einmal aus dem Blechnapf frisst
Ein Mann will nach oben
Kleiner Mann – was nun?
Der eiserne Gustav
Bauern, Bonzen und Bomben
Wolf unter Wölfen
Anton und Gerda
Der Alpdruck
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Vorwort des Verfassers
In diesem Buch ist alles erfunden; es ist ein Roman, also ein Werk der Fantasie.
Das möchte der Verfasser, wie bei manchem seiner früheren Werke, einleitend feststellen. Diese Feststellung gilt nicht nur für die Personen und Ereignisse, sondern auch ganz besonders für die Gründung und das Werden jenes in diesem Roman geschilderten Berliner Unternehmens, das die Gepäckbeförderung zur Aufgabe hat.
Der Verfasser vermied es mit Absicht, über die Geschichte eines tatsächlich bestehenden derartigen Unternehmens auch nur das Geringste in Erfahrung zu bringen; er wollte frei erfinden können, und das hat er dann auch getan.
Trotzdem hofft der Verfasser, ein getreues Bild verschiedener Zeitepochen seit 1910 in der Hauptstadt Berlin gegeben zu haben.
H. F.
Erstes Buch – Der Jüngling
Vorspiel – Die kleine Stadt
1. Staub zu Staub
Asche zu Asche! Erde zu Erde! Staub zu Staub!«, rief der Pastor, und bei jeder Anrufung menschlicher Vergänglichkeit warf er mit einer kleinen Kinderschippe Erde hinab in die Gruft. Unerträglich hart polterten die gefrorenen Brocken auf das Holz des Sarges.
Den jungen Menschen, der hinter dem Geistlichen stand, schüttelten Grauen und Kälte. Er meinte, der Pastor hätte dem Vater die Erde sanfter ins Grab geben können. Doch als er nun selbst die Erde auf den toten Vater hinabwarf, schien sie ihm noch lauter zu poltern. Ein Schluchzen packte ihn. Aber er wollte nicht weinen, er wollte nicht hier weinen vor all diesen Trauergästen, er wollte sich stark zeigen. Fast hilfeflehend richtete er den Blick auf den Grabstein von rötlichem Syenit, der senkrecht zu Häupten des Grabes stand. »Klara Siebrecht, geboren am 16. Oktober 1867, gestorben am 21. Juli 1893« war darauf zu lesen. Von diesem Stein konnte keine Hilfe kommen. Die goldene Schrift war vom Alter schwärzlich angelaufen, das Sterbedatum der Mutter war zugleich sein Geburtstag; er hatte die Mutter nie gekannt. Und nun würde bald auch der Name des Vaters auf diesem Stein zu lesen sein mit dem Todestag: 11. November 1909.
Asche zu Asche! Erde zu Erde! Staub zu Staub! dachte er. Nun bin ich ganz allein auf der Welt, dachte er, und wieder schüttelte ihn ein Schluchzen.
»Gib mir die Schippe, Karl«, flüsterte der Onkel Ernst Studier und nahm sie ihm schon aus der Hand.
Karl Siebrecht trat verwirrt zurück neben Pastor Wedekind. Der gab ihm fest die Hand, sah ihm ernst ins Auge. »Ein schwerer Verlust für dich, Karl«, sagte er. »Du wirst es nicht leicht haben. Aber halte die Ohren steif und vergiss nicht, dass Gott im Himmel keine Waise verlässt!«
Und nun kamen sie alle, der Reihe nach, schüttelten ihm die Hand und sagten ein paar Worte, meist ermahnenden Inhalts, stark zu sein; sie alle, von dem gelblichen Onkel Studier an bis zu dem dicken Hotelier Fritz Adam. Und keiner von ihnen allen sagte auch nur ein nettes Wort über Vater, der ihnen doch immer gefällig und hilfreich gewesen war, viel zu gefällig und viel zu hilfreich, dachte der Sechzehnjährige mit Erbitterung. Aber ich will nicht so gutmütig sein wie Vater, dachte er. Ich werde in meinem Leben stark und hart sein!
Sein Herz wurde gleich wieder weich, als nun nach all den Männern als einzige Frau die alte Minna am Grabe stand, Minna mit ihrem wie aus Holz geschnittenen Gesicht, die schon bei seiner Mutter gedient und ihn großgezogen, die jahraus, jahrein den heranwachsenden Sohn betreut hatte. Ein sanftes Gefühl machte ihn beben, als er sie so starr und tränenlos am Grabe stehen sah. Arme alte Minna, dachte er. Was wird nun aus dir? Sie umfasste seine Hand mit einem Griff. »Mach schnell, dass du nach Hause kommst, Karl –«, flüsterte sie. »Du siehst schon ganz blau aus. Ich setze gleich was Warmes für dich auf!«
Nun gingen alle. Karl Siebrecht sah das Barett des Geistlichen schon nahe der Kirchhofspforte, ihm folgte in kleinem Abstande der Tross der Trauergäste. Alle hatten es eilig, aus dem eisigen Novemberwind zu kommen. »Nun mach schon zu, Karl!«, drängte der Onkel Ernst Studier. »Deinem Vater ist auch nicht damit geholfen, dass wir hier stehen und frieren.«
»Recht hast du, Ernst!«, stimmte der Hotelier Adam zu und setzte sich auf der anderen Seite Karl Siebrechts in Marsch. »Wir wollen sehen, dass wir rasch ins Warme kommen!«
Aber der Junge achtete gar nicht auf die lieblosen Worte der beiden. Ihm war es, als habe er hinter einem Grabstein etwas huschen sehen, nach dem Grabe des Vaters zu. Wirklich, es war Erika, seine kleine Nachbarin, die vierzehnjährige Tochter des Pastors Wedekind. Sie hatte sich heimlich zum Begräbnis geschlichen, und sie hätte doch in dieser Nachmittagsstunde im Handarbeitsunterricht sein müssen! Gute, kleine Erika – jetzt warf sie Blumen in das Grab …
»Was hast du denn, Karl?«, rief der Onkel und hielt den Stolpernden. »Wo hast du denn deine Augen?«
»Süh mal süh«, sagte der Hotelier, und seine Augen waren vor heimlichem Vergnügen ganz klein geworden. »Ist das nicht Wedekinds Erika? Das sollte Pastor Wedekind wissen! Um deinen Vater ist die auch nicht hierhergekommen, Karl!«
»Das finde ich nicht hübsch von dir, Karl!« Onkel Ernst Studier führte den Jungen fast gewaltsam aus der Kirchhofspforte. »Am Begräbnistag deines lieben Vaters solltest du andere Dinge im Kopf haben! Und überhaupt: Du bist erst sechzehn, und sie kann kaum vierzehn sein …!«
»Was ihr auch immer gleich denkt!«, rief der Junge zornig. »Wir sind nicht so, wie ihr – denkt!«
»Wir denken schon das Richtige – leider!«, antwortete der Onkel streng. »Überhaupt, eine Pastorentochter steht viel zu hoch für dich«, erklärte er. »Du kannst froh sein, wenn dich irgendwer in die Lehre nimmt!«
»Das kannst du!«, stimmte Adam zu. »Für einen Lehrling bist du mit deinen Sechzehn zu alt, und für die Schule ist kein Geld da!«
Aber Karl Siebrecht achtete nicht mehr auf ihr Geschwätz, er war nur froh, dass sie nicht mehr von Erika Wedekind sprachen. Mit Abneigung sah er auf die nüchternen Backsteinfassaden der märkischen Kleinstadt, auf die dürftigen Ladenauslagen der kleinen Krämer, wie der Onkel Ernst Studier einer war. Dreimal war er mit dem Vater in Berlin gewesen, immer nur auf ein paar Tage, aber doch hatte ihn die Großstadt bezaubert. Der Vater hätte gar nicht erst zu sagen brauchen: »Mach es nicht wie ich, Karl, setz dich nicht in einem solchen Nest fest. Alles wird klein und eng dort. Hier hat man Platz, hier kann man sich rühren.« Oh, er wollte sich rühren, die sollten ihn nicht halten können!
Vor dem Hotel »Hohenzollern« stand wartend ein ganzer Trupp der Leidtragenden. »Das hab’ ich mir doch gedacht!«, rief Fritz Adam. »Ja, kommt nur alle ’rein, meine Alte hat das Grogwasser schon heiß! Das wird uns guttun! – Du darfst auch mitkommen, Karl! Heute darfst du ausnahmsweise ein Glas Grog trinken!«
»Nein, danke!«, sagte Karl Siebrecht. »Ich geh schon nach Haus!«
»Wie du willst!«, sagte der Hotelier etwas beleidigt. »Viel Grog wird dir in den nächsten Jahren bestimmt nicht angeboten!«
Und der Onkel Studier: »Um fünf sind wir dann alle bei dir und besprechen deine Zukunft. Sage der Minna, sie soll uns einen guten Kaffee kochen.«
Hinter der nächsten Hausecke wartete Karl Siebrecht, bis sie alle in Adams Hotel verschwunden waren. Dann lief er im Trab zum Friedhof zurück. Aber sosehr er sich dort auch umsah, es war alles leer und still. Seine kleine Freundin war schon gegangen. So schlich er leise an das Grab. Es lag, wie er es verlassen, die Totengräber waren noch nicht dagewesen. Er sah hinab auf den Sarg. Über der hinabgeworfenen Erde lagen drei Blumen, die sie gebracht, drei weiße späte Astern. Zwischen Schauder und Verlangen kniete er an des Vaters Grab nieder, beugte sich tief in die Gruft und nahm sich eine Blume vom Sarg.
2. Die Zukunft in der Küche
In der Stube redeten sie immer lauter; sie wurden wohl über seine Zukunft nicht einig. Der Junge starrte aus dem Küchenfenster in die vom Wind durchpfiffene nasse Novembernacht. Hinter seinem Rücken wirtschaftete die alte Minna mit ihren Töpfen am Herde. Jetzt schraubte sie den Docht der Petroleumlampe niedriger, dass die Küche fast im Dämmer lag. Sie sagte: »Es ist bald Abendessenszeit, soll ich dir Stullen machen, Karl?«
»Ich kann nicht essen – wenigstens so lange nicht, bis über meine Zukunft entschieden ist!«
»Da wird nicht viel zu entscheiden sein! Du wirst Verkäufer werden müssen bei deinem Onkel Ernst!«
»Nie, Minna! Das nie! Hast du wirklich gedacht, ich würde bei Onkel Ernst unterkriechen und in seinem Kramladen grüne Seife verkaufen? Nie – nie – nie!«
»Aber was dann, Karl? Du weißt, es ist kein Pfennig da. Wenn alles verkauft ist, reicht es vielleicht gerade für die Schulden. Was willst du denn anfangen?«
»Ich gehe fort, Minna. Minna, verrat mich nicht, ich gehe nach Berlin!«
»Das werden die nie erlauben!«
»Ich gehe, ohne sie zu fragen!«
»Aber was willst du denn in Berlin anfangen? Du hast nichts gelernt, du bist nur ein Schüler gewesen, du bist körperliche Arbeit nicht gewohnt!«
»Ich bin stark, ich bin stärker als alle, Minna. Ich will raus hier aus der Enge! – Ich hasse hier jeden Stein, jedes Haus, jedes Gesicht – nur dein gutes, altes Gesicht nicht, Minna! Ich will fort von dem allen, es hat den Vater kaputtgemacht, ich will nicht, dass es mir ebenso geht!«
»Du weißt nicht, Karl, wie schwer ein Leben ist, in dem man ganz auf sich allein gestellt ist!«
Karl Siebrecht rief mit heller Stimme: »Es soll ja schwer sein, Minna! Ich will gar kein leichtes Leben haben. Ich will viel werden, ich fühle dazu die Kraft in mir!«
Unbeirrt fuhr das alte Mädchen fort: »Und dann das Leben in der großen Stadt! Du, der nie ruhig sitzen kann, der jede freie Stunde draußen war – du willst immer in solchen hohen Steinhäusern hocken, ohne Licht und Sonne – du wirst todunglücklich dabei, Karl!«
»Und wenn ich dort unglücklich werde, Minna, so weiß ich, es hat sich gelohnt. Hier wäre ich auch jeden Tag unglücklich, und wofür, Minna, wofür? Was kann ich denn hier werden –?!«
»Man kann überall etwas Rechtes werden, Karl!«
»Das ist so ein Spruch, wie ihn der Pastor Wedekind sagt. Ich kann mit solchen Sprüchen nichts anfangen. Ich hab’s hier in der Brust, Minna, ich muss fort von hier, wo mich jedes Gesicht, jeder Baum an den Vater erinnert, wo sie alle in meinem Rücken flüstern: Das ist der Junge vom Maurermeister Siebrecht, der Bankrott gemacht hat!«
Sie hatte die Hände auf seine Schulter gelegt, sie sagte: »Also geh, mein Junge, geh! Ich halte dich gewiss nicht, wenn du musst!«
»Ja, ich muss, Minna, weil ich etwas werden will – ein wirklicher Mann! Die hier werden schon nachgeben, der Onkel Studier, mein Vormund, und der dicke Fritz Adam, Vaters Freund. Ich werde ihnen nie lästig fallen, ich werde sie nie um etwas bitten! Ich komme nicht eher zurück, bis ich etwas geworden bin, etwas Richtiges! Und dann besuche ich dich, Minna, dann hole ich dich zu mir nach Berlin, vielleicht in einem Automobil …!«
Minna sah in seine leuchtenden Augen. Plötzlich – sie wusste selbst nicht, wie das gekommen war –, plötzlich hatte sie ihn umfasst, sie hatte ihn gegen ihre Brust gedrückt, sie presste ihn fest an sich. »Ach, du Kind, du«, flüsterte sie und war froh, dass er die ungewohnten Tränen in ihren Augen nicht sehen konnte. »Ach, du großer, kleiner Junge, du! Willst du mir jetzt aus dem Nest fliegen?! Pass nur auf, es gibt so viele große, böse Vögel, und es kommen Stürme, für die deine Flügel zu schwach sind …! Aber fliege nur fort, du hast ja recht; besser fliegen als kriechen!«
3. Abschied von der Jugend
Der Tag war grau, es wollte nicht hell werden. Am Fenster der Schlafstube stand Karl Siebrecht, sah hinaus in den kleinen Garten, dessen kahle Bäume von immer neuen Stößen des Novemberwindes erzitterten, sah über den Garten fort, zu der Rückseite des Wedekindschen Hauses … Hinter ihm packte Minna Anzüge und Wäsche in einen Reisekorb. Sie hielt eine Hose aus gelblichem geripptem Samt in die Höhe und sagte: »Dann ist da noch Vaters Manchesterhose, die ist noch ganz gut. Wenn du ein bisschen wächst, wird sie dir passen!«
»Pack bloß nicht zu viel ein, Minna!«, rief, ohne sich umzuwenden, der Junge ungeduldig. »Was soll ich mit all dem Zeug?«
»Es ist schon nicht zu viel Zeug da, Karl!«, antwortete Minna trübe und legte die Hose in den Korb. Sie griff nach einem Stoß Wäsche.
Der Junge hielt in der Handfläche verborgen einen kleinen runden Taschenspiegel. Von der kahlen, leeren Rückwand des Pastorenhauses sah er ungeduldig empor zum vorwinterlichen Himmel, auf dem sich graue, lockere Wolken jagten. Er flehte um eine, um eine halbe Minute Sonnenschein …
An seinem Stehpult, mit der Ausarbeitung der Sonntagspredigt beschäftigt, stand der Pastor Wedekind – ihm fuhr der im Spiegel gefangene Sonnenstrahl zuerst blitzend ins Auge. »Da ist doch wieder dieser infame Bengel mit seinem Taschenspiegel zugange!«, rief er, empört auffahrend. »Und so was am Tage, nachdem wir seinen Vater zur Ruhe geleitet haben!«
Der Sonnenfleck war schon über die Stubendecke fortgetanzt, er glitt, von dem missbilligenden Blick des Geistlichen verfolgt, am Kachelofen hinab und blieb einen Augenblick auf der Stirn der Frau Pastor ruhen. Sie schlug nach ihm, als sei er eine lästige Fliege. »Erika!«, rief der Geistliche entrüstet. »Erika! Sofort gehst du – –«
Den Geistlichen, der zwischen Fenster und Tisch getreten war, traf ein zweites Mal das Licht des Novembertages, diesmal bestrahlte es die fleischige Backe. Er fuhr mit dem Kopf zurück, und der goldene Fleck ließ sich auf der Tischplatte nieder, gerade vor Erikas häkelnden Händen. Er zitterte ein wenig hin und her, schob sich nahe an die Hände heran, berührte, vergoldete, umspielte die Finger – – »Sofort gehst du in das Siebrechtsche Haus und sagst dem infamen Bengel, dass ich mir diesen Unfug verbitte – ein für alle Mal! Ich sei empört, dass er heute, an einem solchen Tage – ich meine, nach einem solchen Tage – –«.
»Jawohl, Papa!«, sagte Erika und löste mit einem leichten Bedauern ihre Hände aus dem Lichtgruß. Sie ging zur Tür.
»Aber in zwei Minuten bist du wieder hier!«, befahl die nicht ganz so ahnungslose Mutter.
»Jawohl, Mama!«
»Ach nein, lass mich lieber selbst gehen!«
Doch war Erika schon aus der Stube. Leise und eilig lief sie die Treppen hinunter, trat in den winderfüllten Garten, schwang sich, ihre langen Röcke rücksichtslos raffend, über das Mäuerchen, das die beiden Gärten trennte, und lief durch den Siebrechtschen auf den Schuppen zu, in dem sowohl spärliches Gartengerät verwahrt wurde, als auch den Hühnern mit Stangen und Nestern eine Stätte des Verweilens bereitet war.
Nicht nur den Hühnern. Denn als sie in das halbe Dunkel hineinfragte »Karl?«, antwortete er sofort: »Ria!«, und der Freund zog sie an der Hand zu einer Karre. »Setz dich, Ria! Ich habe direkt zu Gott gebetet, um einen Moment Sonne! Ich glaube ja sonst nicht an Gott, aber diesmal –«
»Diesmal hast du Vater schön wütend gemacht! Ich soll dir sagen …«
»Lass ihn! Es war das letzte Mal, Ria!« Mit einer gewissen Feierlichkeit wiederholte der Junge: »Es war das letzte Mal. Ich gehe fort, Ria! Ganz fort!«
»Du, Karl? Warum denn – –? Wer soll mir dann meine Schularbeiten machen?! Ich bleibe bestimmt zu Ostern kleben! Bleib doch hier, Karl, bitte!«
»Ich muss fort, Ria! Ich gehe nach Berlin!«
»Ach, Karl, warum denn? Hier ist es doch auch ganz schön – manchmal –!«
»Ich will was werden, Ria!«
»Und wenn ich dich bitte, Karl?! Bleib hier, Karl! Ich bitte dich!«
»Es geht nicht, Ria, es muss sein!«
Einen Augenblick schwieg sie, auf ihrer Karre hockend. Er, vor ihr stehend, zu ihr niedergebeugt, sah gespannt in ihr dämmriges, doch helles Gesicht. Dann stampfte sie mit dem Fuß auf. »Also geh, geh doch in dein olles Berlin!«, rief sie zornig. »Warum gehst du denn nicht? Ich bin froh, wenn du gehst! Du bist genauso ein ekliger Junge wie alle anderen!«
»Aber, Ria!«, rief er ganz bestürzt. »Sei doch nicht so! Versteh doch, dass ich fort muss! Hier kann ich nie etwas werden!«
»Ich muss gar nichts verstehen! Du willst wohl bloß weg, weil du uns alle über hast, mich auch – und ich habe gedacht, du möchtest mich ein bisschen gern …« Bei den letzten Worten versagte ihr fast die Stimme. Sie sprang von ihrer Karre auf und zog sich tiefer in das Dunkel des Schuppens zurück, damit er nicht ihre Tränen sehen sollte. Sie scheuchte eine Henne von ihrem Nest auf, die mit lautem Protest gackernd aus der Tür flüchtete.
Karl Siebrecht hatte ihre Hand gefasst und streichelte sie ungeschickt. »Ach, Ria, Ria«, bat er. »Nimm es doch nicht so! Ich muss doch wirklich fort. Hier sollte ich Hausdiener im Hotel Hohenzollern werden.«
»Das tust du nicht, Karl, unter keinen Umständen!«
»Und ich will doch viel werden, und dann komme ich wieder.«
»Dauert es lange, bis zu wiederkommst?«
»Es dauert wohl seine Zeit, Ria – ziemlich lange!«
»Und dann, Karl –?«
»Dann frage ich dich vielleicht etwas, Ria …!«
Pause. Dann sagte das Mädchen leise: »Was willst du mich denn fragen, Karl?«
Er wagte es nicht. »Es ist noch so lange hin, Ria! Erst muss ich etwas geworden sein.«
Und sie, ganz leise flüsternd: »Frag es doch schon jetzt, Karl. Bitte!«
Er zögerte. Dann zog er vorsichtig etwas aus der Innentasche seines Jacketts. »Weißt du, was das ist?«
»Was soll das sein?«
»Das ist eine von den Blumen, Ria«, sagte er feierlich, »die du in Vaters Grab geworfen hast. Ich nehme sie mit nach Berlin und werde sie immer bei mir tragen!«
Der Wind jagte mit Schnee vermischten Regen zur Türöffnung herein. Sie drängte sich enger an ihn, sie flüsterte angstvoll: »Das ist doch eine Totenblume, Karl!«
»Aber ich habe sie von dir, Ria, sie bringt mir bestimmt Glück! Und hier habe ich einen kleinen Ring von meiner Mutter – willst du den nicht tragen, Ria, damit du immer an mich denkst?!«
»Ich darf doch keinen Ring von dir tragen. Vater würde es nie erlauben!«
»Du kannst ihn tragen, wo dein Vater ihn nicht sieht. Ich trage deine Blume auch auf dem Herzen!«
Sie schwiegen eine Weile. Dann flüsterte sie: »Ich danke dir für den Ring, Karl. Ich will ihn immer tragen.«
Und wieder Schweigen. Nahe sahen sie sich in die blassen Gesichter, ihre Herzen klopften sehr. Nach einer Weile flüsterte Siebrecht: »Möchtest du mir wohl einen Kuss zum Abschied geben, Ria?«
Sie sah ihn an. Dann hob sie langsam die Arme und legte sie sachte um seinen Hals. »Ja …« flüsterte sie.
Krachend warf der Wind die Tür des Schuppens ins Schloss, gerade vor dem nahenden Pastor Wedekind, der in Sturm, Regen und Schnee seine Tochter suchte. Er rüttelte an der Tür. Mit Mühe öffnete er sie gegen den Winddruck und rief in den dunklen Schuppen. »Bist du hier, Erika?«, rief er.
Der Junge, im Dunkeln das Mädchen im Arm, trat mit dem Fuß nach den Nestern. Laut gackernd flatterte eine Henne auf und torkelte gegen den geistlichen Herrn. Eine andere Antwort gab der Schuppen nicht.
Erster Teil – Rieke Busch
4. Fahrt mit der Kleinbahn
Das letzte Winken von Minna war entschwunden – Karl Siebrecht konnte sich in einer Ecke des geräumigen Wagens hinsetzen und seine Tränen trocknen. Ja, er hatte nun doch geweint, wie auch die alte Minna beim Abschied geweint hatte. So leicht, wie er geglaubt hatte, war ihm die Trennung von der kleinen Stadt nicht geworden.
Er fuhr hoch und sah aus dem Fenster. Aber der Ausblick auf das Städtchen mit seinem roten spitzen Kirchturm war schon durch Wald versperrt, nun fuhr er wirklich in die Welt hinaus, hatte alles dahinten gelassen, was bisher sein Leben bedeutet hatte. Er musste schon wieder nach dem Taschentuch suchen, fand es aber nicht gleich, sondern statt seiner ein Päckchen, das ihm Minna im letzten Augenblick noch in den Zug gereicht hatte. Er knotete das rote Wäscheband darum auf und fand, in einem Schächtelchen, Vaters dicke silberne Uhr und darunter, unter einer Schicht Watte, zehn große Goldfüchse!
Zweihundert Mark! Er starrte ungläubig darauf – aber sie waren da, auf dem Schachtelboden, und es sah der Minna so recht ähnlich, ihm ihre Ersparnisse so zuzustecken, dass er weder die Annahme verweigern noch ihr danken konnte! Wie lange musste das alte Mädchen an diesen zweihundert Mark gespart haben! Denn sie hatte nur wenig verdient, und auch mit dem Auszahlen dieses Wenigen hatte es bei Vater in den letzten Jahren gar nicht mehr klappen wollen! Sobald ich in Berlin bin, schicke ich ihr das Geld zurück, dachte der Junge. Aber damit würde er sie nur kränken, fiel ihm gleich ein. Ich werde ihr das Geld schicken, sobald ich feste Arbeit und ein bisschen was gespart habe, dann freut sie sich umso mehr! Sorgfältig legte er das Geld in das Schächtelchen zurück. Alles in allem besaß er jetzt zweihundertsechzig Mark, er kam als reicher Mann nach Berlin! Vaters Uhr aber steckte er sorgfältig in die Westentasche – er würde sie gleich auf der nächsten Station stellen. Zum ersten Mal in seinem Leben besaß er eine Uhr!
Der Zug fing kräftig zu bimmeln an, und eilig nahm Karl Siebrecht die Uhr wieder aus der Tasche. Sie fuhren jetzt über die Wegkreuzung kurz vor dem Dorfe Priestitz, gleich würden sie in Priestitz halten, und er konnte die Uhr stellen. Er war so beschäftigt damit, dass ihn erst eine scheltende, helle Stimme an eine andere Pflicht erinnern musste.
»Na, du langer Laban!«, schalt die helle Stimme unter einem kaputzenförmigen Hut hervor. »Siehste nich, det ick mir mit die Reisekörbe eenen Bruch heben tue?! Kiek nich und fass lieber an!«
Rasch griff Karl zu und zog den schweren Korb in den Wagen. »Entschuldigen Sie nur«, sagte er eilig. »Ich dachte …«
»Dachte sind keene Lichte! Hier, fass noch mal an – hau ruck! Siehste, den hätten wa … So, un nu nimmste Tilda’n hoch!« Und zu dem plärrenden Kind: »Weene nich, Tilda! Der Mann tut dir nischt – er is ja gar keen Mann, er is bloß dusslig, und dusslig is er, weil er nie aus seinem Kuhkaff rausjekommen is! Na, und nu jib mir ooch mal die Hand, du Kavalier – Hau ruck! Diese verfluchten Kleedagen!«
Als Karl Siebrecht diese energische Dame in den Wagen zog – sie hatte dabei die Röcke ungeniert hochgenommen und zwischen die Knie geklemmt –, sah er zum ersten Mal ihr Gesicht. Nach der Stimme hatte er gemeint, es müsse eine junge Frau sein, eine sehr junge vielleicht. Nun sah er mit Staunen, dass es ein Kind war, ein Mädchen von dreizehn oder vierzehn Jahren, schätzte er, in den viel zu weiten Kleidern einer alten Frau, aber mit dem ein bisschen frechen, vergnügten Gesicht einer Spitzmaus! Ganz hell – mit einer langen dünnen Nase, hellen flinken Augen und mit einem schmalen, sehr beweglichen Mund. »Na, wat grinste?«, fragte das Mädchen gleich. »Ach, du dachtest, ick wär deine Jroßmutta! Nee, is nich! Wetten, du rätst nich, wie alt ick bin? Na, wie alt bin ick?« Und gleich weiter, ohne eine Antwort abzuwarten: »Warum halten wir denn noch immer in disset Kaff?! Wejen mir kanns weiterjehn! Wär ick nich gewesen und die Tilda, hätt’ er übahaupt nich halten brauchen! Er soll man machen, det wa weiterkommen, sonst vapassen wa in Prenzlau noch den Anschluss!«
»Sie müssen erst die Milchkannen einladen«, erklärte Karl. »Die sollen auch mit nach Berlin.«
»Ach, so is det! Du weest hier woll Bescheid? Biste von hier? Aber ick habe dir hier nie jesehen! Ick bin schon drei Tage hier, ick kenne jeden Schwanz in det Kaff!«
»Nein, ich bin eine Station weiter her. Aber ich weiß hier Bescheid, mein Vater hat hier mal den Bahnhof gebaut. Bei wem waren Sie – warst du denn hier?«
»Ach nee, den Bahnhof? So wat nennt ihr hier Bahnhof?! So wat nenn ick ne Sommerbluse – vorne offen und hinten ooch nich ville. Die kann dein Vater sich an den Hut stecken!«
Unwillkürlich sagte Karl Siebrecht: »Mein Vater ist am Montag gestorben.«
»Ach nee, det tut mir aba leid! Desterwegen biste so schwarz, ick habe jedacht, du bist beim Paster in de Lehre. Na ja, wa müssen alle mal abhauen, det is nicht anders! Bei uns is die Mutta verstorben – seitdem spiel ick die Ziehmutter zu det Jör. – Tilda, wenn du den Nuckel noch eenmal hinschmeißt, ballre ick dir eine! Siehste, wie die pariert?! Respekt muss sind – die jehorcht mir, als wär ick nich die Schwester, als wär ick die Mutta. Mutta haste noch?«
»Nein, meine Mutter ist schon lange tot.«
»Ach, du bist Vollwaise? Det kann janz jut sind, vastehste, wir haben Vata’n noch, aber manchmal denk ick, ohne Vata jings bessa. Er is Maurer, aber meistens macht er blau! Sonst een tüchtjer Maurer, allens, wat recht is, ooch jutmütig, bloß, det der Mann so wasserscheu is –. Na ja, wa haben alle unsre Fehler …«
Der Zug fuhr wieder eifrig bimmelnd durch die Felder. Die kleine energische Person hatte sich auf ihren Reisekorb gesetzt, hatte aus der Tasche ihres Unterrockes einen Apfel geholt und biss eifrig davon ab. Darüber vergaß sie ihre Schwester nicht, die auch abbeißen durfte, während die flinken Augen der Großen bald zum Fenster hinaus, bald zum Jungen hinüber gingen. Nun musterte sie wieder sein Gepäck. Karl Siebrecht hatte den Eindruck, dass diesem Mädchen auch nicht das geringste entging: er hatte noch nie ein so waches, lebendiges Menschenkind gesehen. Und ein so redseliges! »Die Äpfel sind jut«, sagte sie jetzt. »Willste ooch eenen? Ick habe den halben Korb voll! Nee, nich? Na, lass man, nötigen tu ick dir nich, wer Hunger hat, frisst von alleene! Da staunste woll, wat ick in deinem Kaff jemacht habe? Det haste wohl jemerkt, det ick nich vom Lande bin? Nee, ick bin mit Spreewasser jetauft, det heeßt, et wird woll Pankewasser jewesen sein, ick bin mehr aus dem Wedding, bei de Pankstraße her! Weeßte, wo det is?«
»Ja, dass du aus Berlin bist, habe ich auch schon gemerkt!«, lachte Karl Siebrecht vergnügt. Er wusste nicht, wie es ihm erging, aber diese kleine Person ließ ihn all seinen Kummer und sein Abschiedsweh vergessen. Sie war eine so unglaubliche Mischung von Kind und Erwachsenem! Lebensklug – und doch kindlich!
Jetzt lachte sie auch. »Ach, du meinst, von wejen meine Sprache? Na, lass man, wa können nich alle uff dieselbe Tonart piepen! Det wäre zu langweilig! Übrijens, Friederike Busch is mein Name!«
»Karl Siebrecht«, stellte sich der Junge vor.
»Sehr anjenehm, Karl!« Und sie gab ihm ihre kleine, graue, schon sehr verarbeitete Kinderhand. »Karl heeßt auch mein Vetter, in dem Kaff da, von dem ick komme, in Priestitz. Aber er is man doof uff beede Backen, mit dem kann ick keen Wort reden, mit dir kann ick jut reden, Karl –!«
»Ich mit dir auch!«
»Na, siehste! Und warum ick in Priestitz war? Da is doch Muttas Schwesta, Tante Bertha! Solange Mutta noch lebte, und ooch det Jahr nach ihrem Wegscheiden hat se uns imma von’s Schlachtefest Pakete jeschickt. Aber letztet Jahr: Neese! Da ha’ ick disset Jahr zu Vata’n jesagt: det gibt et ja nu nich, wenn so wat erst inreißt, denn kucken wa det janze Leben in den Mond! Ick fahre hin! Na, der Olla hat ja jenuschelt, aba da mach ick ma nischt draus. Ick ihm einfach ’nen Zettel hinjelegt, die Tilda uffjepackt und losjeschoben!«
»Und was hat die Tante gesagt, als du da so einfach ankamst? Du hattest dich doch nicht angemeldet, Friederike?«
»Rieke heeß ick, Friederike is bloß fors Amt, und wenn ick Schläje kriege, aber ick krieje keene mehr, jejen mir hebt keener mehr die Hand! – Die Frau hat Oojen jemacht, det kann ick dir flüstern, wie Mantelknöppe! Wat willste denn hier? fragt mir die Frau. Und denn noch mit det Balg?! – Erlobe mal, Tante Bertha, sare ick zu die Frau, der Balg is deine fleischliche Nichte und dir wie aus’t Jesichte jeschnitten, und denn wollt ick mir man bloß die kleene Anfrage erlauben, ob hier unter deine Schweine Keuchhusten ausjebrochen is? – Na, da musste se doch lachen, und denn war se janz ordentlich. Det von’t vorje Jahr, hat se wieder jutgemacht und mehr wie det. Und det nächste Jahr soll ick wiederkommen, mit det Schicken is et ihr zu umständlich. Na, lass se, die is schlecht mit die Feder, vastehste? Adresseschreiben und so! – Det Kleed is ooch von ihr! Schöne Wolle, er jing nich mehr in’n Korb, aba dalassen, keene Ahnung! Hab ick’s über die andre Kleedage jezogen, haste det jemerkt?«
Aber ehe Karl Siebrecht noch antworten konnte, fing die Lokomotive wild zu klingeln an, die Bremsen schrien, es gab einen gewaltigen Ruck, und der Zug hielt ganz plötzlich: sie wankten auf ihren Sitzen, Tilda fiel schreiend von der Bank – »Det is die Höhe!«, schrie Rieke Busch. »Mir mein Kind von de Bank zu schubsen! Die Bande mach ick haftbar!«
Karl Siebrecht hatte zum Fenster hinausgesehen: der Zug, aber eigentlich war es nur ein Zügle, hielt auf freier Strecke. Ein Schaffner lief an ihm entlang, ein langer, schwarzer, jetzt sehr aufgeregter Mensch, der in jeden Wagen stürzte … »Da ist was passiert«, sagte Karl Siebrecht zu Rieke Busch, die das weinende Kind zu beruhigen suchte.
Sofort ergoss sich die Schale ihres Zorns über ihn. »Wat soll den passiert sind? Hier passiert doch nie nischt! Hier saren sich bloß die Hühner jute Nacht – und denn passieren! Det ist ja lachhaft! Und mir schmeißen se det Kind von de Bank – so wat is doch rücksichtslos! Det Kind kann sich doch eenen Leibesschaden tun! – Hören Se, Männecken«, wandte sie sich ohne Weiteres an den aufgeregten Schaffner, der jetzt in ihr Abteil für Reisende mit Traglasten gestürzt kam, »hören Se, Männecken, wat is denn mit Ihre Klingelbahn los? Ihr Lokomotivführer hat woll eenen zu ville jekippt! Sie schubsen mir det Kind von de Bank –!«
Aber ohne das empörte Mädchen zu beachten, hatte sich der Schaffner an die Untersuchung der rotweiß bemalten Notbremse gemacht. Nun wandte er sich an die beiden. »Ihr habt die Notbremse gezogen!«, schrie er. »Wer von euch beiden hat die Notbremse gezogen? Das kost’ Strafe – das kost’ zehn Taler Strafe!« Er fing an, den Boden abzusuchen. »Da liegt ja der Draht! Und da ist die Plombe! Das sieht ja jeder, dass ihr die abgerissen habt! Das kost’ zehn Taler, und wenn ihr die nicht zahlen könnt, kommt ihr ins Loch!«
»Entschuldigen Sie«, sagte Karl Siebrecht, »wir haben bestimmt nicht an der Notbremse gezogen! Wir haben uns hier ganz ruhig unterhalten –«
Aber seine Gefährtin war nicht für höfliche Erklärungen. »Sie sind ja komisch!«, schrie sie im schrillsten Ton. »Sie sind ja ’n komischer Vertreta! Erst schmeißen Se det Kind von de Bank, und denn kommen Sie noch mit so ’ne Redensarten! Saren Se mal, haben Se keene Oogen im Koppe nich! Sehen Se vielleicht, wat für ’ne Jröße ick habe? Ick bin nich so’n langer Laban wie jewisse andere, ick reiche jar nich an Ihre dusslige Notbremse! Ja, kieken Se mir mit Ihre schwarzen Kralloojen ruhig an, ooch nich, wenn ick uff den Reisekorb klettre …«
»Aber der Junge –«, wollte der Schaffner anfangen.
»Der Herr! meenen Se! Det is een jebildeter Herr, der is nich wie andere, der rennt nich ’rum und brüllt die Leute an, det er se ins Loch steckt. Der hat ’nen Todesfall in die Familie jehabt, dem is nich nach Notbremse, und da kommen Se hier reinjestürzt!«
»Aber man sieht doch deutlich, einer hat den Draht durchgerissen«, fing der Schaffner wieder an.
»So, det sehen Se? Wat Sie allet sehen, an so ’nem Stücksken Draht! Woran sehen Se denn det, det eener den abjerissen hat? Kann denn Draht nich von selber reißen? Ich weeß det nich, aber Sie wissen’t: Draht reißt nie, der wird jerissen! Na ja, wer hier wohl jerissen is, Sie nich, Männecken, Sie nich!«
Sie stand in ihrer grotesken Frauentracht, funkelnd vor Zorn, mit ihrem ganz hellen, völlig furchtlosen Gesicht vor dem Mann, der sie mit einem einzigen Schlage hätte niederschmettern können. Aber er dachte gar nicht daran, sie hatte ihn wirklich in Verwirrung gebracht. Er probierte noch immer an Draht und Plombe herum, aber nicht mehr mit der richtigen Überzeugung. »Das melde ich aber in Prenzlau auf dem Bahnhof!«, sagte er noch drohend, aber seine Drohung klang nur schwach. »Euch werde ich das besorgen! Hier einfach die Notbremse ziehen!« Damit stolperte er aus dem Wagen. Sie sahen ihn am Zug entlanggehen, immer noch Draht und Plombe in der Hand. Dann stand er neben der Lokomotive, verhandelte mit dem Führer. Sie meinten, ihn sagen zu hören: »Den hat doch einer durchgerissen, das sieht man doch!« Dann setzte sich der Zug keuchend wieder in Bewegung, klingelte aufgeregt.
»Du kannst die Leute aber ausschelten!«, sagte Karl Siebrecht nicht ohne Bewunderung zu Rieke Busch. »Hast du denn keine Angst gehabt, er haut dir einfach eine runter?«
»Ick hab so ville Dresche in meinem Leben bezogen, früher, davor ha’ ick keene Angst mehr! Und denn det Schimpfen, det lernt man, wo wir wohnen. Wenn de dir da nich wehrst, biste glatt erschossen. Na, du hast det nich nötig jehabt, for dir is immer jesorgt worden, det sieht man.«
»Aber vielleicht habe ich es jetzt auch nötig. Ich fahre nach Berlin, für immer.«
»Na, und –? Da haste doch sicher ’nen Onkel oder jehst uff ’ne bessere Schule?«
»Nein. Ich habe niemanden dort. Und ich muss mir selber mein Geld verdienen.«
»Wat du nich sagst! Aber du hast schon ’ne Stellung ausjemacht, wat? Du bist Koofmich oder so wat, mit deinem tipptopp jestärkten Halsabschneider –!«
Karl Siebrecht fasste unwillkürlich zu seinem hohen steifen Stehkragen, der ihm wirklich die Kehle fast abschnitt. Minna hatte verlangt, dass er das mörderische Ding umband: er solle in Berlin doch einen guten Eindruck machen! Aber ehe er noch Rieke Busch über seine gänzliche Unversorgtheit hatte aufklären können, fing die Lokomotive ein zweites Mal aufgeregt zu bimmeln an. Wieder gab es einen Ruck, aber nicht mehr ganz so schlimm wie den ersten – Tilda blieb auf der Bank –, und wieder hielt der Zug.
»Na, wat sagste nu?«, rief Rieke Busch empört. »So wat jibt’s nu in Berlin nich! Pass mal uff, jleich haben wa den schwarzen Affen wieder hier!«
Und wirklich, schon wurde die Tür wieder aufgerissen, der Schaffner sprang herein, stürzte auf die Notbremse los, ohne die beiden auch nur eines Blickes zu würdigen, untersuchte sie, schob den Griff in die Höhe … Bis hierher hatte Rieke Busch schweigen können, nun sagte sie in höchst vernehmlichem Flüsterton: »Det is bloß det eenzije Jlück, det keen Draht mehr dran is! Ohne Draht können se uns nämlich nischt beweisen, Karl! da muss erst wat jerissen sind, denn kommen wa ins Loch –!«
Der Schaffner warf der Sprecherin einen wütenden Blick zu, zog einen Draht aus der Tasche und band mit ihm die Notbremse wieder fest.
»Na also!«, sagte Rieke Busch höchst befriedigt. »Nu muss noch ’ne Plombe ran! Ich bin scharf uff Plombe – ohne Plombe is det man der halbe Spaß!« – Der Schaffner machte einen Schritt auf sie zu, überlegte sich dann den Fall und verließ überstürzt das Abteil. – »Haste det jesehen?«, lachte Rieke Busch. »Ebend hätte ick beinahe eene jeschallert jekriegt! Da hätte ick mir aber ’nen Ast jelacht. Wat so Leute komisch sind, die immer jleich wütend werden. Det macht mir Laune, so eenen zu kitzeln.«
»Und wirst du nie wütend?«
»Aber feste! Ick kann mir jiften, sare ick dir! Wenn se mir so for dumm koofen wollen, und ick soll beim Jrünkrämer immer det Verfaulte kriegen, oder bei die Presskohlen jehen bei mir achtzig uff den Zentner, bei andere aber vierundneunzig, oder Vata hat wieda mal blau jemacht, wo keen Jeld im Hause is – denn jifte ick mir! Denn merk ick ordentlich, wie ick anloofe wie ’n Löffel mit Jrünspan. Aber merken lassen, det die Leute merken lassen – nich in den nackten Arm. Denn wer’ ick immer feiner, denn wer’ ick so fein, fast wie der Paster in de Kirche. Nee, meine Dame! sare ick. Ick nich! Nich, wie Se denken, meine Dame! Mein Jeld stinkt nich anders wie det von andere Leute – wozu soll da mein Kohl stinken –?« Soweit war Rieke Busch mit ihrer Charakterbeschreibung gekommen, als die Lokomotive zum dritten Mal aufschrie, der Zug zum dritten Mal plötzlich bremste und anhielt. »Det wird ja eintönig!«, rief Rieke Busch. Und mit einem raschen Blick zur Notbremse: »Siehste, da is der Draht wieder jerissen! Nu werden se uns bestimmt inspunnen!«
Sie lehnte sich aus dem Fenster. Sie rief dem Schaffner entgegen: »Wat saren Se nu? Der Draht is wieder jerissen!«
Diesmal brachte der Schaffner den Lokomotivführer mit. Aber er beachtete Rieke Busch gar nicht. Der Lokomotivführer sagte: »Wir müssen einfach die Luft abstellen, Franz!« Und sie machten sich daran, die Pressluftschläuche am Waggon zu lösen. Die beiden – und viele andere lachende, spöttische und empörte Gesichter – sahen dem Werk interessiert zu.
Als die Männer aber wieder zur Lokomotive gehen wollten, rief Rieke Busch: »Du, Franz, hör mal her!« Unwillkürlich blieb der Schaffner stehen, wütend starrte er das Mädchen an. »Wenn ick du wäre«, sagte sie mit ehrlichem Nachdruck, »ick täte mir entschuldigen – wat meenste?«
Auf dem Gesicht des schwärzlichen Schaffners kämpfte Zorn mit Lachen. Aber das Lachen gewann doch die Oberhand. »Du Aas, du!«, sagte er. »Du kleines Berliner Aas mit so ’ner süßen Schnauze! Wenn du meine Tochter wärst!«
»Und du mein Vata!«, lachte sie mit Überzeugung. »Du tätest was erleben!«
»Na, gib mir ’nen Süßen«, sagte der Schaffner, »bist ja noch ein Kind!«
Sie gab ihm ungeniert aus dem Abteilfenster einen Kuss. »Und nu mach een bisschen Dampf, Franz«, sagte sie. »Det wa noch rechtzeitig nach Prenzlau kommen! Und da hilfste mir bei die Körbe, vastanden? Det biste mir schuldig, Franz!«
Der Zug fuhr schon wieder, da sagte sie zu Karl Siebrecht: »Du, der sollte mein Mann sind! Der sollte aber een richtijer Mann werden, nich so’n Teekessel! Aber die meisten Frauen sind dumm. Nich so dumm wie die Männer, aber anders dumm, eben mit die Männer! – Und wat fängste nu in Berlin an, Karl?«
5. Auf der Reise
Sie hatten wirklich ihren Anschluss in Prenzlau nicht mehr erreicht, was niemand mehr bedauert hatte als der so freundlich gewordene Schaffner Franz. Aber tu etwas gegen eine wild gewordene Notbremse!
Trotzdem sie nun drei Stunden in Prenzlau auf dem Bahnhof sitzen mussten und trotzdem Tilda den beiden das Leben durch ewiges Plärren nicht leichter machte, wurde Karl Siebrecht die Zeit nicht lang. Und was die Rieke Busch anging, so schien es bei diesem Mädchen keine leeren Minuten zu geben, immer war sie quicklebendig, voller Interesse für alles. Immer flitzten ihre hellen Augen umher, mit jedem wusste sie gleich auf du und du zu kommen. Im kleinen Heimatstädtchen hätte sich Karl Siebrecht nur ungern mit einem so grotesk angezogenen, derart schnellzüngigen Mädchen öffentlich sehen lassen. In der großen Stadt Prenzlau saß er bei ihr im Wartesaal zweimal Zweiter, als gehörte er dazu, half ihr die Tilda beruhigen und lauschte mit unermüdeter Aufmerksamkeit ihrem Gerede. Aber Rieke Busch konnte nicht nur reden, sie konnte auch fragen, und nur schwer war ihren bohrenden Fragen zu widerstehen. Und Karl Siebrecht wollte gar nicht widerstehen, gerne erzählte er diesem – er hatte es nun erfahren – fast vierzehnjährigen Dingelchen von der abgeschlossenen Vergangenheit und von seinen großen Plänen für die Zukunft. Niemand schien ihm fähiger, zu raten, als dieses Kind mit seinem Mutterwitz, seinem nüchternen Lebensverstand, seiner Tüchtigkeit. Was er erst erreichen wollte, sich selbst ernähren, das hatte Rieke schon geschafft. Und sie ernährte nicht nur sich selbst, sondern die Schwester Tilda dazu und fütterte auch oft noch den blaumachenden Vater. Waren Karls Hoffnungen für die Zukunft aber noch reichlich vage, so hatte sie da ganz bestimmte Pläne, und sie war die Person dazu, sie durchzusetzen.
»Ick muss nur wachsen«, sagte Rieke Busch. »Noch zwanzig Zentimeter, denn kann ick mit Waschbalje und Waschbrett hantieren, ohne ’ne Kiste unterzusetzen, und denn nehm ick Waschstellen an. Da vadien ick mehr Geld, jetz mach ick bloß Halbtagsmädchen – von wejen Schule –, det klappert nich so! Aba Wäsche kann ick, alle Tage ’nen Taler und denn die Stullen, da mach ick uns dreie von satt. Und denn spar ick! Uff wat spar ick? Uff ’ne Nähmaschine, und denn leg ich mir uff die Schneiderei, damit wird Jeld vadient. Arbeet? Arbeet jenug, det wirste selba bald sehen, bloß genieren musste dir nich, aussuchen is nich. Und deine feinen Hände – na, det weeßte selba, die werden wohl nich lange fein bleiben!«
»Ich hätte gerne was mit Autos zu tun«, sagte Karl Siebrecht.
»Siehste!«, antwortete sie, und ihre Augen funkelten vor Spott. »Det lieb ick! Schon willste dir die Arbeet aussuchen! Erst nimm, wat de kriegst! Und wenn’s Kinderwagenschieben is – Auto kommt denn von alleene! Und überhaupt Auto – det sind doch allet Schlosser und Mechaniker, jloobste denn, det kannste von alleene, wat die sich in vier Jahren Lehre beijebogen haben?! So mach man weiter, denn brauchste jar nich erst anzufangen, denn fahr man jleich bei deine Minna!«
Verdammt noch mal, die nahm kein Blatt vor den Mund, diese kleine Nüchterne! Ganz im Geheimen hatte ja Karl Siebrecht wohl einen Traum in der Brust gehegt von einem sagenhaft reichen, edlen Mann, dem er irgendwie helfen konnte – manchmal rettete er ihm sogar das Leben! –, und dieser edle Einsame erkannte sofort die außerordentlichen Fähigkeiten des jungen Karl Siebrecht und ließ ihn aufrücken, bis er in ganz kurzer Zeit sein Nachfolger und Erbe wurde. Solchen Traum hatte er gehegt, manchmal. Aber Rieke Busch hatte nie geträumt, oder wenn sie geträumt hatte, war es um Waschfass und Nähmaschine gegangen. Sie hatte eine außerordentlich feine Nase für verstiegene Erwartungen.
»Wenn de denkst, dir schenkt wer was«, sagte sie, und Karl Siebrecht hatte doch kein Wörtchen von seinem Traum verlauten lassen, »denn biste doof! Dir schenkt keener nischt, wat de dir nich nimmst, det kriegste nich. Und wat de jenommen hast, halt feste, sonst biste et jleich wieda los! Det is ’nen Haufen Jeld, wat de da hast, ick hab noch nie so ’ne Masse Jeld jesehen, aber wenn du’s nich festhälst, bistet los, ehe de Piep jesagt hast. Und übahaupt – du kannst nich schnell jenug Arbeeter werden und wie ’n Arbeeter aussehen. Wat denkste, wat se dir mit deinem Stehkragen und deine feine Tolle vaäppeln werden. Mach deinen Korb mal uff, ick will sehen, ob de vanünftije Klamotten hast, die de anziehen kannst bei de Arbeet. Sonst vascheuern wa morjen deinen Schraps, und du kaufst dir wat Richtijet. Röllchen – haste Töne! Aba die manchesterne Hose is jut. Wat, zu lang ist die? Da näh ick dir ’nen Einschlag rin, wat denkste, wat du aussehen wirst, wenn de erst richtig arbeetest. Ick werde mit meinen Ollen reden, valleicht jeht er jrade uff den Bau, und valleicht brauchen se da ’nen Handlanger.«
Ja, sie waren noch nicht in den Berliner Zug gestiegen, da war es schon ausgemacht – übrigens ohne dass Karl Siebrecht gefragt worden wäre –, dass Rieke zu Schwester und Vater auch noch diesen Jüngling unter ihre schützenden Fittiche nehmen würde. Sie wusste auch schon eine Schlafstelle für ihn (»Zimmer is nich, det mach dir man ab – wat denkste, wat du zu Anfang vadienen wirst?!«), und sein Geld brachte er morgen noch auf die Sparkasse! Karl Siebrecht war mit all diesen Verfügungen über seine Person ganz einverstanden, nicht etwa, weil er aus Schlappheit oder Feigheit gewillt war, sich gleich wieder unter ein neues Kommando zu begeben, sondern weil er das Gefühl hatte, in den ersten Wochen seines Berliner Aufenthaltes tue ihm eine Führung recht gut. Später würde er dann schon selber sehen … Und außerdem gefiel ihm diese Rieke Busch sehr, sie kommandierte nicht etwa aus Herrschsucht, sondern aus gesundem Menschenverstand. Sie wusste Bescheid, und er hatte keine Ahnung.
Der Berliner Zug war proppenvoll. Sie mussten ihre Körbe übereinander stapeln, aber sie fanden dank Riekes Schlagfertigkeit doch Sitzplätze, und keine drei Minuten, so erheiterte Rieke den ganzen Wagen mit der Schilderung ihrer Kleinbahnfahrt. Karl Siebrecht vergaß den toten Vater, er musste Tränen lachen, wie Rieke Busch in ihrer Frauentracht den langen Laban von Schaffner nachmachte. Sie hielt ein imaginäres Stück Draht zwischen spitzen Fingern und sagte immer wieder: »Der is doch jerissen, det sieht man doch! Der is doch nich jeplatzt, i wo!«
Und kaum war diese Vorstellung vorüber, so war Rieke Busch schon zu Karl Siebrechts Überraschung in einer sehr offenherzigen Erörterung seiner vergangenen und zukünftigen Lebensumstände. Irgendwelche Geheimnisse schien es bei ihr nicht zu geben. Da im Wagen viele Berliner saßen, war bald die lebhafteste Besprechung im Gange. Siebrecht wurde viele Male prüfend von der Seite angesehen, musste Auskunft geben über seine Schulkenntnisse, die Rechenkünste, die Schönheit seiner Schrift, ja er musste das Jackett ausziehen und die Oberarmmuskeln spannen. Er tat das alles gutwillig und lachend. Es waren wohl alles kleine Leute, die da mit ihnen im Wagen saßen, aber sie dachten wirklich darüber nach, ob sie was für ihn wüssten, sie wollten ihm gerne behilflich sein.
Leider stellte sich bald heraus, dass bei solchen Berufen, von denen die Mitfahrer Kenntnis hatten, mehr Kräfte verlangt wurden, als dem Karl Siebrecht zuzutrauen waren. »Ick habe jedacht«, sagte ein biederer Schnauzbart, »du könntest vielleicht bei uns in den Stall, Junge. Ick bin bei die städtischen Omnibusse, vastehste? Mit ’nem Lackpott hoch vom Bock, vastehste? Unsa Futtameista braucht mal wieder ’nen Jehilfen. Mit dem Putzen und dem Futterschütten, det jinge ja noch, aba all die Säcke vom Boden, jeder anderthalb Zentner, det kannste nich, da machste bei schlapp.«
»Ich habe schon anderthalb Zentner getragen«, sagte Karl Siebrecht.
»Ja, eenmal! Aba det weeßte doch, eenmal is keenmal. Und wenn de denn nacheinander zwanzig Säcke runterbuckeln musst, da wirste weich! Denn wat biste? Du bist weich! Det is keen Fleesch von ’nem Arbeeter, wat du auf dem Leibe hast, det ist so nüchterenet Kalbfleesch, vastehste? Allens Zadder, so is det.«
»Er wird schon ander Fleesch kriejen!«, rief Rieke Busch. »Der is nich schlapp!«
»Nee, vielleicht nich, aba für uns is er nischt. Unsa Futtameesta, der is nich jut, der haut jleich.«
»Vielleicht wüsste ich etwas für Sie«, ließ sich jetzt ein blasser, langer junger Mensch vernehmen, mit vielen Pickeln im Gesicht. »Wenn Sie fleißig sind, können Sie bei mir gutes Geld verdienen.«
»Bei Sie –?!«, antwortete Rieke Busch schnell, ehe noch Karl Siebrecht den Mund hatte auftun können. Karl kannte nun schon den etwas gedehnten, schrillen Ton in ihrer Stimme – er kam immer, wenn sich ein Sturm bei ihr zusammenbraute. »Bei Sie kann er jutet Jeld vadienen?« Sie musterte den Jüngling. »Von wat vadienen Sie denn erst mal Jeld?«
»Ich habe«, sagte der Jüngling bereitwillig, »die Generalvertretung für Berlin und die Mark Brandenburg des Pfiffikus-Sparbrenners. Spart bis zu sechzig Prozent des Petroleumverbrauchs …«
»Ach, den Dreck kenn ick«, sagte Rieke rasch. »Wenn man so ’n Ding uff de Lampe setzt, is’t duster, wie wenn Neumond scheint, oder blakt, als wenn Ruß schneit. Det is doch Mist, Sie!«
»Na, erlauben Sie mal«, protestierte der Jüngling. »Ich komme soeben aus Prenzlau und Umgegend, ich habe dreiundsechzig Stück von dem Pfiffikus verkauft.«
»Det wollen wa dahinjestellt sein lassen! Valleicht sind se in Prenzlau so helle, det se’t jern een bisschen duster haben wollen. Wat vadienen Se denn nu an so een Stück?«
»Zwanzig Pfennige!«
»Det is achtbar! – Det is nich schlecht! – Zwölf Mark sechzig – det hat unsereener die ganze Woche nur! – Na, aba die Bahnfahrt jeht ab! – Wat denn, die Bahn ist doch nich teuer!« So ging es hin und her im Abteil.
»Ick frage mir nur«, ließ sich Rieke Busch wieder vernehmen, »wenn Se uff Kundschaft jehn, wollen Sie ja doch ’nen juten Eindruck machen, wat?«
»Selbstredend!«
»Ick frage mir nur, warum Se sich da so ’ne olle Kluft anpellen? In der Jacke da haben Se direkt een Loch! Det ist wohl vom Pfiffikus? Bei zwölf Mark den Tag müssen Se doch Klamotten haben wie Jraf Kooks!«
»Aber, meine Dame«, sagte der Jüngling und fiel vor lauter Patzigkeit in das schönste Berlinisch, »Sie haben sich bei det Wetta ooch nich jrade fein injepuppt! Denken Sie, ick lasse mir mein bestet Zeug einweechen?«
»Da haben Se recht!«, rief Rieke Busch. »Und weil’s so nass is, haben Se Schuhe mit Wasserlöcher anjezogen, det et nich so lange dauert, bis de Füße nass werden, wat?«
»Mit Ihnen spreche ich überhaupt nicht«, sagte der Jüngling wieder sehr fein. »Ich spreche nur mit dem Herrn. – Ich würde Sie anlernen«, sagte er überredend, »es ist ganz leicht, der Artikel geht reißend. Ich will sowieso mehrere Untervertreter anstellen. Ich lasse Ihnen den Pfiffikus mit neunzig Pfennig, wenn Sie fünfzig Stück abnehmen, Verkaufspreis ist eine Mark. Da ist überhaupt kein Risiko dabei!«
»Nein, danke wirklich!«
»Und Sie kost’ er achtzig!«, rief Rieke Busch wieder. »Det is een Jeschäft ohne Risiko, det jloob ick – aber für Sie! – Nee, Karl, lass man. Uff so ’ne musste nie hören. Wenn schon eener und erzählt dir, du kannst zwölf Mark am Tag vadienen, und ohne Arbeet, und sieht aus, als hätte sein Magen seit sieben Wochen keene Schrippe nich jesehen – denn sag bloß: hau ab, dir kenn ick!«
»Na, erlauben Sie mal, meine Dame! Ich kann Ihnen beweisen –«
»Det können Se mir aba nich beweisen, det det Loch in Ihre Jacke keen Loch is und det Ihre Schuhe keen Wassa ziehen. Und det jenügt mir! – Nee, Karl, wir reden erst mal mit Vata’n. Wenn Vata seinen hellen Tag hat, is es ooch helle. Bloß, mir schwant, er ist mal wieda blau!«
6. Ankunft in der Wiesenstraße
Es war schon dunkle Nacht gewesen, als der Zug im Stettiner Bahnhof einlief. Mit unglaublicher Zungenfertigkeit hatte Rieke Busch einem Dienstmann, der Feierabend machen wollte, seine Karre abgeschwatzt. Das alte Gesicht unter der roten Mütze wurde immer verwirrter, dann stets vergnügter. »Na, Männecken, Sie sind doch ooch müde?«, hatte Rieke gefragt und ihre Hand ganz sachte neben die altersfleckige, ausgemergelte Hand auf den einen Holm des Handwagens gelegt. »Wat wollen Se da mit de Karre nach Haus zuckeln? Alleene jeht sich det doch ville besser?«
»Du bringst mir die Karre ja nich wieda, du freche Kröte, du!«, jammerte der alte Mann.
»Wo wohnen Se denn? In de Müllerstraße? Ooch ’ne feine Jejend! Und ick wohne in de Wiesenstraße – kennste de Wiesenstraße, Opa?«
»Det hab ick doch jleich jemorken, det du vom Wedding bist, du Aas du!«, strahlte der Alte.
»Na, siehste«, lachte Rieke, »da weeßte schon, wie ick heiße! Aas heiße ick! Und wie heißt du, Opa?«
»Küraß heiß ich. Nummer siebenundachtzig. Müllerstraße, vergiss nicht!«
»Küraß –?« Rieke sprach den Namen wie Kieraß. »Kieraß, ick hab jedacht, so heeßen nur die Hunde. Na jut, Opa, det wer’ ick schon nich verjessen, siebenundachtzig, Müllerstraße, Kieraß. – Schieb ab, Opa! Huste dir man sachte in den Schlaf!«
»So ein frechet Aas!«, hatte der Alte wieder gesagt und war ganz gehorsam abgeschoben, ohne Rieke auch nur nach ihrem richtigen Namen zu fragen. Aas aus der Wiesenstraße schien ihm als Pfand für seinen Handwagen völlig zu genügen.
Vereint hatten Karl und Rieke nun die Körbe aufgeladen, die fast schlafende Tilda wurde so dazwischengestopft, dass sie nicht herunterfallen konnte, und nun waren die beiden losmarschiert. Karl zwischen den Holmen des Wagens, Rieke bald nachschiebend, bald neben ihm, um ihm den Weg zu zeigen. Ihre überlangen Röcke hatte sie mit einem Strick wulstartig um die Hüften gebunden. Die Gaslaternen flackerten in einem böigen Wind, stumm, verschlossen sahen die dunklen Häuser auf sie herab. Ab und zu wusch ein plötzlicher Schauer die Gesichter der Kinder. Wenn Karl Siebrecht daheim in der kleinen Stadt sich je seinen Einzug in die große Kaiserstadt Berlin ausgemalt hatte, dann nie so! Nie hatte er daran gedacht, vor einem Handwagen, Körbe ziehend, durch dunkle Straßen zu schieben, als einzige Freundin und Bekannte eine echte Berliner kesse Nummer, als einzige Aussicht eine Schlafstelle, die er mit einem Bäcker teilen sollte: »Janz ordentlich, der Junge! Säuft nich, arbeetet, nur schwach uff de Beene mit de Mächens, da fällt er zu leicht um«, hatte Rieke seinen Schlafgenossen charakterisiert. Vormittags noch daheim, von der Minna betreut, in den altvertrauten Wänden, zwischen den Möbeln, die sein ganzes Leben um ihn gewesen waren – ach, fühlte er nicht noch Rias frischen Kuss auf den Lippen? –, und nun ganz draußen, für immer draußen, und seine Lippen schmeckten nichts als den faden Regengeschmack, der doch nicht rein nach Regen wie da draußen schmeckte, sondern nach Rauch, nach Ruß …
»Wie heißt diese Straße?«, sagte er zu Rieke und sah fast scheu zu den dunklen Häusern hoch.
»Det is die Ackerstraße! Wenn wa die hoch sind, haben wa’s nich mehr weit!«
»Ackerstraße? Wo ist denn hier ein Acker?« Er empfand wirklich schon Sehnsucht nach einem wirklichen Acker, über den der Herbstwind weht.
»Acker? Ach, du meenst Feld, wo se Kartoffeln druff bauen? Det jibt’s hier nich. Det war valleicht mal früha. Wir wohnen ja ooch Wiesenstraße, aba Wiese is nich, dafür haben wa de Palme!«
»Die Palme? Was ist denn das? Ein botanischer Garten?«
»Mensch! De Palme, det weeßte nich? Det is de Herberje zur Heimat, die haben wir jrade vis-à-vis! Wo die Penna und die Stroma schlafen, wenn se sonst keene Bleibe haben! So wat haben wa, aba Wiese haben wa nich. Und Acker ooch nich. Na, lass man«, sagte sie fast tröstend. »Wenn wa imma Kartoffeln satt haben, broochen wa keen Acker nich!«
Sie schoben stumm weiter. In so vielen Fenstern brannte Licht, rötliches vom Gas, schwach gelbliches vom Petroleum, manchmal auch strahlend weißes elektrisches – hinter den Fenstern bewegten sich Schatten, auf der Straße glitten Schatten eilig vorüber, in der Eckdestille grölte und schrie es. Ein Schutzmann in Pickelhaube mit herabhängendem grauen Schnauzbart trat nahe an die Karre heran, musterte stumm die kleine Fuhre – unwillkürlich sagte Karl Siebrecht »guten Abend«, und der Schutzmann drehte sich wortlos um und ging weiter. Niemand wusste von Karl Siebrecht, keiner nahm Notiz von ihm, jeder hatte seinen Arbeitsplatz, sein Heim, etwas Verwandtes, selbst die kleine Rieke. Er nur schob alleine dahin, ohne Rieke wäre auch für ihn die Palme dagewesen, die Heimat der Heimatlosen. Ein beklemmendes Gefühl schnürte ihm die Kehle zusammen, noch nie, selbst damals nicht, als er am Bett des Vaters begriffen hatte, dass der Vater tot war, dass er nicht mehr atmete – noch nie hatte er sich so einsam und verlassen gefühlt. Dieses verfluchte sentimentale Lied kam ihm nun auch noch ins Gedächtnis: »Verlassen bin i«, musste er summen, »wie der Stein auf der Straßen …« Er fühlte die Steine, Hunderte, Tausende unter seinen Füßen, sie wuchsen ihm zur Seite zu himmelausschließenden Mauern empor, Steine, nur Steine, nichts Lebendiges mehr … Und er allein darunter, etwas Lebendiges, etwas Atmendes, mit Blut in den Adern, mit einem Herzen, etwas Gefühl – und doch nur ein Stein unter Steinen, verlassen, wertlos. Niemand wusste von ihm, wie niemand von den Steinen wusste, über die sein Fuß eben gegangen war!
»Da links um de Ecke!«, kommandierte Rieke Busch. »Rin in de Hussiten! Wie is dir denn, Karl? Du klapperst ja! Keene fünf Minuten, denn sind wa zu Hause, da koch ick dir wat Warmet!«
»Es ist nur, Rieke«, sagte der Junge, »es ist alles so viel, alle diese Häuser, und alles Stein, und keiner weiß von uns …«
»Musste eben machen, det se bald von dir wissen! Det is deine Sache! Und det mit de villen Häuser, det muss dir nich imponieren, ob det fünfstöckige wie hier oder kleene Häuserkens wie bei euch sind, mit Wassa kochen se hier wie da, und wenn de dir nich unterkriejen lässt, denn stehste, hier wie da! – So, und det is nu de Wiesenstraße. Wie Blume riecht det hier nich, aber komisch, wenn ick hier komme, is mir det imma wie zu Hause. Der Jeruch is mir direkt sympathisch. – Halt, Karl! Bleib da bei de Karre, ick mach ruff bei Vata’n, wenigstens de Körbe kann der Mann anfassen. Und lass dir nicht listen und locken, die klauen hier alle wie die Raben, namentlich was de Penner sind! – Jib mir die Tilda, ick wer’ ihr schon schleppen – det Kind muss in de Betten! Is ja ganz nass vom Regen! Komm, meine Tilda, jetz jeht’s in de Heia!«
Damit verschwand die kleine groteske Gestalt in einem dunklen Torweg, und Karl Siebrecht stand allein auf der Straße. Er setzte sich auf die Karre, ihn fror. Er bohrte die Hände in die Taschen und malte sich aus, wie schön es sein würde, nach diesem langen Tag endlich behaglich im Bett zu liegen. Freilich, wie würde sein Bett aussehen? Und was für ein Mensch würde der Bäcker sein, der so leicht umfiel, wenn Mädchen in Frage kamen? Dieses Kind Rieke Busch schien über alles im Leben Bescheid zu wissen, wie eine Alte. Sie sollte nur machen und schnell kommen – ihn fror jetzt sehr. Eine Gestalt hatte sich aus dem Häuserschatten gelöst und hatte schon eine Weile vor Karl Siebrecht gestanden. Nun sagte der junge, geisterhaft blasse Bursche: »Na, Mensch?«
»Ja?«, fragte Karl Siebrecht, aus seinen Gedanken hochfahrend.
»Na –?«, fragte der andere wieder.
»Guten Abend!«, sagte Karl Siebrecht, der nicht wusste, welche Antwort von ihm erwartet wurde.
»Sore –?«, fragte der, trat noch einen Schritt näher und legte eine Hand auf den Korb.
»Hände weg!«, rief Karl Siebrecht scharf. Und als die Hand sofort zurückgezogen wurde, fragte er milder: »Was ist Sore?«
»Det weeßte nich? Na, Mensch! Jibste mir een Stäbchen, wenn ick dir sare, wat eene Sore ist?«
»Nein!«, erklärte Karl Siebrecht entschieden. »Was ist denn ein Stäbchen?«
»So grün!«, grinste der Bursche jetzt. »So grün und denn im November! Du kommst wohl grade vons Land?«
»Wirklich! Ich bin noch keine Stunde in Berlin!«
»Mensch!«, sagte der Bengel fast fieberhaft, drängte sich dicht an Karl Siebrecht und flüsterte ihm ins Gesicht: »Sei helle, hau wieda ab. Hier is nischt los, nur Kohldampf und Frieren! Det wird een Winter, sare ick dir!«
»Keine Arbeit?«, fragte Karl.
»Arbeet? Nich so ville hab ick letzte Woche vadient, wie ick Schwarzet unterm Daumennagel habe! Du rennst dir die Sohlen ab – aber nischt! Mensch!«, sagte der Bursche und drängte sich noch näher. »Mach und schenk mir ’nen Jroschen! Ick habe nich mal so ville, det ick in de Palme nächtigen kann. Weeßte, wat de Palme is?«
»Ja, es ist mir erzählt worden.«
»Det letzte Nacht ha’ ick in ’ne Sandkiste im Tiergarten jeschlafen. Mensch, und es is so kalt! Ick bin janz verklammt uff dem nassen Sande, ich war krumm wie ’n Affe. Eenen Jroschen nur, det ick eenmal wieder warm schlafen kann!«





























