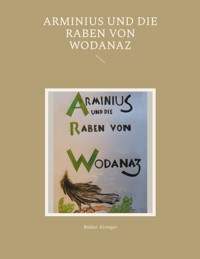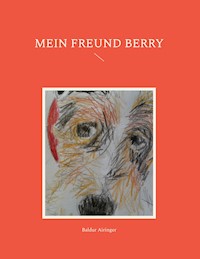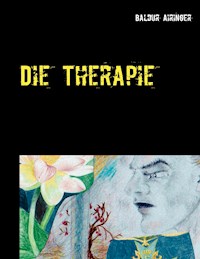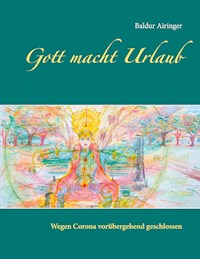Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ruhm erntet Kaspar Hauser für sein mysteriöses Leben und mehr noch für seinen geheimnisvollen Tod. Wer ist er? Warum sind wir von seiner abenteuerlichen Reise so ergriffen? Mutig stellt er sich der Herausforderung, sein eigenes Geheimnis zu ergründen! Wie und warum er lebte und starb - begegnen Sie hautnah Kaspar und treten Sie ein in seine Welt! Lassen Sie sich begeistern!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine Mutter nimmt ihr Smartphone und macht ein Foto von mir und meinem neuen Buch.
„Genau da haben wir draußen gesessen und Pfifferlinge gegessen!“, erklärt sie mir und nickt. Meine Mama ist über 80 Jahre jung und hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis!
„Draußen in einem Restaurant, genau auf dem Platz!“, ruft sie, als ich ihr mein neu erstandenes Büchlein über Kaspar Hauser vorstelle.
Das Umschlagfoto zeigt einen Platz in der Altstadt von Ansbach und den jungen Kaspar Hauser davor.
Historischer Roman - Frei erzählt nach einer realen Begebenheit
„Werde, der DU bist!“
Menschliche Freiheit.
Bildbearbeitung Umschlagfoto: © Thomas Lindsay
Bilder: © Baldur Airinger
Inhalt
J. WITT – Goldener Reiter
Der goldene Reiter
Literaturstunde
Königliches Instrument in der Stille der Nacht
Ein ausgefallenes Jagdrevier
Seine Wurzeln kennen
Zimmer mit Aussicht
Der leere Briefkasten
Mein Lied für Euch
Vor der Reise
Mein Pferd findet seinen Weg allein
Wenn wir träumen
Sehen in der Dunkelheit
Abraham und der Dolch
Herbstlaub in Långbro
Niemand kann für mich atmen
Osterzeit
Wir Menschenseelen
Dank an meine Eltern – die Schnitzeljagd
SEAL – Crazy
Songtext | Goldener Reiter
„An der Umgehungsstraße
Kurz vor den Mauern unserer Stadt
Steht eine Nervenklinik
Wie sie noch keiner gesehen hat
Sie hat das Fassungsvermögen
Sämtlicher Einkaufszentren der Stadt
Gehen dir die Nerven durch
Wirst du noch verrückter gemacht
Hey, hey, hey, ich war der goldene Reiter
Hey, hey, hey, ich bin ein Kind dieser Stadt
Hey, hey, hey, ich war so hoch auf der Leiter
Doch dann fiel ich ab, ja, dann fiel ich ab
Auf meiner Fahrt in die Klinik
Sah ich noch einmal die Lichter der Stadt
Sie brannten wie Feuer in meinen Augen
Ich fühlte mich einsam und unendlich schlapp
Hey, hey, hey, ich war der goldene Reiter
Hey, hey, hey, ich bin ein Kind dieser Stadt
Hey, hey, hey, ich war so hoch auf der Leiter
Doch dann fiel ich ab, ja, dann fiel ich ab
Hey, hey, hey, ich war der goldene Reiter
Hey, hey, hey, ich bin ein Kind dieser Stadt
Hey, hey, hey, ich war so hoch auf der Leiter
Doch dann fiel ich ab, ja, dann fiel ich ab
Sicherheitsnotsignale – Lebensbedrohliche Schizophrenie
Neue Behandlungszentren – bekämpfen die wirklichen Ursachen nie
Hey, hey, hey, ich war der goldene Reiter
Hey, hey, hey, ich bin ein Kind dieser Stadt
Hey, hey, hey, ich war so hoch auf der Leiter
Doch dann fiel ich ab, ja, dann fiel ich ab“.
|© Joachim Witt
Der goldene Reiter
„Wie würden Sie das Wesen der Psychologie beschreiben?“, fragte der Wissenschaftsbeauftragte einer großen Zeitungsfirma den Therapeuten.
„Mir ist einmal etwas passiert“, erklärte der berühmte Psychologe Dr. Milton H. Erickson dem Journalisten, der ihm gegenüber saß.
„Ja, bitte, erzählen Sie“, ermunterte ihn der Interviewer und Erickson schmunzelte.
„Also ich ging spazieren, ich kam gerade von der Arbeit und wollte ein Wenig Distanz gewinnen von den Dingen, die ich erlebt hatte.
Auf einmal sah ich auf einer Wiese, nicht weit entfernt von meinem Weg, ein Pferd. Es trug Sattel und Zaumzeug, doch ein Reiter war nirgends zu finden. Ich blieb in der Nähe des Pferdes und beobachtete, ob jemand käme, dem die Stute gehöre. Doch niemand kam.
So hatte ich etwa eine halbe Stunde dort gewartet.
Schließlich erkannte ich, dass am Sattel weder Satteltaschen waren, noch sonst irgend ein Monogramm auf der Satteldecke oder dem Sattel oder etwas anderes, das auf den Besitzer dieses Tieres hin deutete.
Tja, überlegte ich, sie hat vielleicht ihren Reiter abgeworfen, ist noch etwas weiter gelaufen und hat sich nun verirrt.
Die Gegend hatte ich schon abgesucht. Nirgends war eine Person, verletzt oder unverletzt, zu finden, der dieses Tier gehören konnte.
Und so beschloss ich, mich selbst auf das Pferd zu setzen. Das war kein Problem für mich, ich war noch jung damals und in meiner Gegend lernten wir Reiten, bevor wir Laufen konnten und so begann ich zuerst, freundlich das Pferd anzusprechen.
Ich nahm Kontakt mit ihm auf. Und das klappte ganz gut, also beschloss ich, das Tier zu reiten. Mühelos legten wir eine Weile schweigend den Weg zurück, den das Pferd selbst wählte.
Manchmal jedoch, da blieb es stehen, begann, etwas Gras vom Boden zu rupfen, da ließ ich es eine Weile fressen, doch anschließend sprach ich zu ihm, dass wir nun weiter müssten, trieb es sanft an und die Reise wurde fortgesetzt.
Nach einer Zeit gelangten wir dann schließlich an eine Ranch, einen Gutshof, auf dem Pferde gehalten wurden. Diese Ranch kannte ich nicht.
Ein Mädchen, das uns sah, lief rufend ins Haus und brachte einen älteren Herrn mit hinaus.
Ich erkannte, dass wir nun am Ziel angelangt waren, stieg vom Pferd und strich ihm freundlich über die Nase. Gut gemacht, sagte ich.
Ja, guten Tag, da ist Bonnie ja, sagen Sie, woher haben Sie denn gewusst, dass sie zu unserem Stall gehört, begrüßte mich der Mann.
Ich habe es nicht gewusst. Aber Bonnie hat es gewusst.
Ich überreichte dem Herrn die Zügel und sagte:
Sie hat ihren Weg allein nach Haus gefunden. Ich habe das Pferd nur am Laufen gehalten.“
Literaturstunde
„Was will ich wirklich?“
Ganz ergriffen von meinen tiefen Gedanken schiebe ich die Lernkarten für Französisch, für Spanisch, für Englisch, Ungarisch und Russisch und natürlich auch für die deutsche Sprache beiseite und falte meine Hände vor mir auf dem Tisch.
Mein Lehrer, der Gymnasialprofessor Georg Friedrich Daumer, ist immer seltener während meiner Studien hier in seiner wohnlichen Hausbibliothek mit Kamin bei mir.
Warm ist es hier, ich habe soeben gemeinsam mit ihm gefrühstückt, da hat er sich auch schon wieder verabschiedet, sein Brot hastig gegessen, die Ledermappe gegriffen und gesagt, sein Sekretär käme und die beiden hätten etwas Wichtiges zu erledigen.
Die Köchin nickte, ich tupfte mir mit meiner Serviette den Mund und als sich unsere Blicke trafen, hob sie die Augenbrauen und begann, den Tisch aufzuräumen.
„Nimm’s ihm ned bös,“ sagte sie mit ihrem herzhaften fränkischen Dialekt, den ich nie heraus bringe.
Sie hat genau gesehn, dass ich gern gehabt hätte, wenn er da geblieben wäre, bei mir, seinem Zögling und seinem Studienobjekt.
„Ja, Marie, Sie haben Recht,“ entgegne ich. Marie heißt die Köchin.
Nun sitze ich in der Bibliothek allein.
Schön ist es hier. Die Wände sind rot. Die Stühle sind aus lackiertem, geschwungenen Holz mit tannengrünen Samtpolstern, die Tischlein fein gearbeitet aus edlem Wurzelholz, farblos lackiert, damit man die interessante Wurzelstruktur des Holzes an der Oberseite der kleinen Tischplatte sehen kann. Bewundern kann.
Sich darin verlieren kann.
Ich verliere mich immer darin und komme ins Nachdenken. Ins Grübeln.
Das Wurzelholz hat weder Symmetrie, noch Anfang, Ende oder irgendeine Richtung. Es ist nur magisch, mysteriös, wirkt verwunschen und verworren auf mich. Undurchdringlich ist es und voller Fragen. Orientierungslos.
Richtungslos.
Wie mein Leben.
Verwirrt und erschöpft vom vielen Lernen, Konjugieren, Deklinieren, Schönschreiben, an das sich meine Hand noch nicht so recht gewöhnen will – mit Rechts geht es eine Weile, mit Links habe ich es auch probiert und zunächst kläglich versagt – gönne ich mir einen Blick aus dem Fenster.
Sommer ist jetzt und die Wolken werden vom Wind getrieben ebenso wie ich hier von den Menschen und deren Lüsten, Gelüsten und Gier, Grausamkeiten und Gönnertum, Gewalt und Gnade getrieben werde.
Doch was will ich? Ich, der Findling Nürnbergs, wohl der Einzige, denn erdgeschichtlich hat noch kein Gletscher hier an der Pegnitz einen Findling hinterlassen. Jedenfalls keinen, den ich kenne.
Dafür kenne ich die Pegnitz. Sie ist mein Fluss, meine einzige Freundin, die mir treu ist, die mich nie verlässt.
Professor Daumer verlässt mich immer öfter. Zunächst war es ihm wohl lieb, die Achtung des Rates von Nürnberg zu bekommen, Aufmerksamkeit, Ehren und all dies.
Nun bemerkt er wohl, dass ich ihm zur Last werde, er sieht mich oft seltsam an und sein Blick weicht mir aus.
Ich kann nicht an mich halten, wenn seine Stimme unsicher wird.
„Wollen auch Sie mich wieder loswerden?“, will es aus mir heraus brüllen, doch, bevor ich ihn nachher verliere, weil ich selbst unartig gewesen bin, bin ich still, greife nur zur Teekanne, deren Goldverzierung in der Sonne blinkt und frage ihn meinerseits lächelnd und mit sicherer Stimme:
„Möchten Sie noch etwas Tee?“
Er wird mich abschieben. Auch er. Er wird einen Grund finden. Erfinden.
Ich sehe es in seinem Gesicht, da steht es nämlich in deutlichen Lettern geschrieben und die kann ich allemal lesen, das konnte ich schon ausgezeichnet, bevor ich Deutsch, Englisch oder Französisch lesen oder gar schreiben kann.
Studieren tun sie mich bloß alle.
Wie ein seltenes, unbekanntes Tier, das Einer von einer Reise aus Übersee mitbringt.
Sie vermessen mich, biologisch wie auch geodätisch, wer ich bin, wie meine Zähne sind, wie meine Physiognomie ist und wo die her kommen mag, woher ich stamme, genealogisch, auch meine Mundart hören sie genau an, Worte muss ich aussprechen immer wieder, langsam, dann schneller und immer gibt’s Notizen dazu in kleinen Heftchen, Augenbrauen heben, stummes Nicken, dann ein dümmliches Grinsen auf dem gierigen Gesicht. Sie bestimmen überhaupt alles an mir wie Botaniker, wie Zoologen, bestimmen Alter, Größe, Geschlecht, Hautfarbe, Augenfarbe.
Herrgott, i bin a selten’s G’wächs!
Sie grapschen meine Arme und Beine, messen das Ebenmaß meiner Gliedmaßen. Ärzte, Forscher und andere Leute, die ihre Übergriffigkeiten mit ihren Ämtern und Absichten zu rechtfertigen versuchen, betatschen meinen Rücken, ob ich denn einen Buckel hätte, eine Skoliose, ein Hohlkreuz gar?
Manche sprechen sogar mit mir, aber für sie bin und bleibe ich der Gaudi, das Kuriosum. Fehlt noch, dass sie mich ausstellen und Eintritt nehmen oder auf dem Plärrer feilbieten. An dem Zustand sind wir nah dran.
Keiner kümmert sich um mein Wesen.
Wie ein Gürteltier wollen sie mich erfühlen, erforschen, wiegen, doch anhand der vielen Oberflächlichkeiten dringt keiner durch zu seinem Wesen, dem Wesen des Gürteltiers.
Was ist das Wesen des Gürteltiers?
Zunächst einmal ist es ein Tier, von dem der Herr Professor ein hellbraun gerahmtes Bild in seinem Studienzimmer hängen hat.
Noch so viele Sprachversuche, Mundartstudien, Schriftanalysen können sie von mir kriegen, was sie dabei nicht zu fassen bekommen ist mein Wesen, das Wesen des Caspar Hauser.
Was ist mein Wesen?
Nun, wo Daumer nicht da ist und ich wieder allein in seiner Bibliothek sitze, da könnte ich natürlich auch die Gunst der Stunde nutzen und meine eigenen Studien anstellen, Studien über eine geheime Schrift, die ich in Daumers Schrank gefunden habe, über einen kleinen Aufsatz, der in einem unscheinbaren Heftchen steht. Friedrich Feuerbach hat es geschrieben. Er interessiert sich persönlich für Sanskrit, die älteste heilige Schrift. Sagt Daumer.
Einmal, als ich ihn fragte, ob ich in seiner Abwesenheit auch in andere Bücher, als unsere Studienwerke, schauen dürfe, da strahlte er und rief:
„Oh, ja! Schau’ nur ruhig hinein! Betrachte alle diese Bücher als deine Studienwerke!“, das war vor einigen Wochen, als ich noch neu bei ihm war. Speziell diesen kleinen Aufsatz von Friedrich Feuerbach hat er nun nicht gemeint aber da er alles von mir weiß, warum soll ich seine Worte über die Bücher dann nicht wörtlich nehmen? Ein Heft ist schließlich auch ein kleines Buch. Und ich verstehe mich gut mit Friedrich. Er ist sechs Jahre älter als ich, wir haben uns schon einige Male über diese Schrift unterhalten. Du kannst es lesen. Frag mich ruhig, wenn etwas unklar ist.
Das hatte Friedrich mir gesagt.
Daumer kommt zurück. Soll ich das Heft schnell zurück stecken?
An den Ort im Regal, wo ich es her genommen habe?
Nein. Ich bin mutig und bleibe ruhig sitzen. Zu Beginn meiner Ankunft hier bin ich stets aufgesprungen, habe ihn bedienen wollen, wenn er rein kam.
Das sei nicht nötig, hatte er nur kalt erklärt.
Vielleicht weiß er gar nicht, dass ich in ihm so etwas wie einen Vater und in seiner Bekannten, Frau Rose, so etwas wie eine Mutter suche.
Immer beneide ich Kinder, wenn sie an der Hand ihrer Eltern durch Nürnberg ziehen. Solch eine Kindheit hätte ich auch gern gehabt. An der Hand meiner Eltern. Zu wissen, wo ich hin gehöre. Zu wissen, woher ich komme, das könnt’ ich gern.
„Na, fleißig?“, begrüßt mich der Herr Professor und hängt das Jackett an einen Kleiderhaken. Dann schaut er auf das Heft.
„Freili!“, ruf ich.
„Ah, das hast du! Aha!“, entfährt es ihm und ich erkenne eine Art Erschrockenheit in seinem Antlitz, die nur einen Sekundenbruchteil dauert, die mir jedoch nicht entgangen ist.
„Ja! Übrigens: Sanskrit – das erinnert mich an „Samskrit“ – „Zusammenschrift“ – und an das Wort „Schrift“ und an écrire für französisch „Schreiben“ oder an „la escritura“, spanisch für „die Schrift“, aber auch an sainte écriture – heilige Schrift und mir ist, als hätte ich das schon mal früher gesehen, ich meine, viel früher, vor vielen hundert Jahren.
Wie oft kommen wir eigentlich diese Erde besuchen, Herr Professor?
Ich meine, wenn es wirklich nur ein einziges Mal ist, dann bin i echt ang’schissen, ja, is’ doch so, alle ha’m oan Heim, alle Familie mit an festn Wohnung und so, bloß i bin der Dammische, der immer nur so lang geduldet is, bis die Leut merken, dass in dem Wunder noch ein Mensch drin steckt. Und wenn der Mensch ihnen dann lästig wird, dann werde ich weiter gereicht. Manchmal auf mehr, manchmal auf weniger freundliche Art.
Ich müsst mein eigenes Geld und eigene Wohnung ham, was meinen Sie, Herr Professor?
Herr Professor Daumer ist leicht irritiert, er sagt, ich wechsele zu schnell die Themen.
Dann deute ich auf das Schriftstück vor uns auf dem Tisch.
Es liegt aufgeschlagen da und übersetzt sind manche Worte mit Bleistift notiert am Rand eines ansonsten mit Tinte geschrieben Textes.
„Das da. Hinter dem Wort Samadhi. Da steht „Erlösung“. Erlösung. Aha,“ überlege ich laut.
„Und dahinter, bitte helfen Sie mir, das kann ich nicht entziffern – Kaival – Kaivaly – ach, sand’s a Saupreiß!!“, ärgere ich mich laut, als ich das Wort nicht hinkriege, den Spruch hab ich mal irgendwo aufgeschnappt.
Erst lachen wir gemeinsam, ich mein derbes Lachen, dann wird Daumer ernst. Er mag meine deftige Ausdrucksweise, manchmal, aber ich glaube in Wahrheit fürchtet er sich vor mir.
Königliches Instrument in der Stille der Nacht
Feldlazarett | Freiburg im Winter 1914.
Meine Schmerzen bringen mich um den Verstand.
Kühlende Wickel sollen helfen. Ich friere. Fiebere. Es ist zum Verrücktwerden.
Meine Gelenke brennen wie Feuer. Meist ist die Witterung feucht, klamm und kühl. Nässe und Kälte kriechen mir in die Knochen.
Ende 1914 neigt sich das Jahr bald zum Winter und wenn ich ab und zu eine Zigarette geschenkt bekomme und die Gelegenheit habe, zum Eingang des Lazaretts zu humpeln und den freien Himmel zu sehen, bin ich doch immer wieder erstaunt, welche Vielfalt an Grautönen unser Herrgott erschaffen hat, die sich in Nebel, in Luft und Himmel, im unendlichen Formenreichtum der Wolken manifestiert und sogleich wieder auflöst.
Der letzte Glimmstängel, den ich geschenkt bekam, war eine französische Marke, auch sie schmeckte gut und verbindet mich im bewussteren Atmen und dem aufsteigenden Qualm mit dem Himmel, der allen Seiten gehört, der Deutschen, Belgischen und der Französischen.
Heute ist er grau – silbern und die Sonne scheint wie eine Silbermünze hinter den Wolken vor, ohne sich direkt zu zeigen und ich liebe diesen grau – silbernen Himmel.
Über dem Feld, den Schützengräben, die bestimmt auf beiden Seiten gleich aussehen, war der Himmel grau, schwarze, schlammige Wolkenfetzen hingen schwer über schwarzen, schlammigen Soldaten, voller Staub, Morast und Elend, die Gesichter verzerrt, nur noch das Visier am Auge.
Das Gewehr stets am Körper, als sei es angewachsen.
Der Gurt des Maschinengewehrs klemmt und wieder fallen reihenweise Kameraden.
An diesem Ort fühle ich mich dennoch irgendwie nicht richtig, weil ich in das Lazarett hier in Freiburg nicht durch den Krieg, sondern durch meinen Körper, der nicht richtig funktionieren will, der mir nicht gehorcht, gekommen bin.
Panik hatte mich erfasst, als ich im Schützengraben steckte, tief im Matsch und Schlamm, im vom ständigen Regen aufgeweichten Boden, der mein Vorwärtskommen unmöglich macht.
Mühsam kämpfe ich mich durch die weiche Erde, Sisyphos – Arbeit.
Erde, kalt, nass, moderiger Boden haftet an Haut und Haar, wo immer du stehst, kniest oder liegst, im Schützengraben wirst du zur Erde, die deinen Körper mit einer dicken Schicht bedeckt und du ahnst bald, wenn du die Illusion deines Heldendaseins aufgegeben hast, dass du niemals weit entfernt bist von dem Tod, der hier allgegenwärtig ist.
Im Regen bleibt von der Erde eine feine Schicht auf deiner Haut, heftet sich an Arme, Hände, Gesicht und Haare, Augen, kriecht dir in deine Nase, gelangt auf vielen Wegen in deine Ohren, Schlamm, den du nicht abbekommst, der an dir haftet wie ein Stigma und der dir die Botschaft des Schreckens mit sanfter Gewalt in dein Bewusstsein massiert, dass du niemals wirklich geboren bist, denn aus der Erde kommen wir, denn wir ernähren uns von ihr, zur Erde gehen wir, Erde sind wir, von der Erde leben und in der Erde sterben wir.
Das lerne ich im Krieg, dass ich Gott von Gott, Licht von Licht, Staub von Staub und Erde von Erde bin!
Mit dem wenigen Wasser, das uns hier zugeteilt wird, kannst du dich waschen, so oft du willst, der Matsch, Sand, Körnchen aus Humus, Bodenwerk, Staub, Erdreich, Blut, Schweiß, Tränen und Regen will nicht von dir weichen.
So nehmen meine Kameraden ihr Dasein hier wahr.
Ich jedoch empfinde das Bad in Mutter Erde als ein Segen, als eine heilige Weihe.
So oft wurde für diesen Boden gekämpft, wurde er mit Blut getränkt, er ist Mutterboden und alles Blut, das Mütter für ihre Kinder, für das Leben geblutet haben, geben wir der Erde nun zurück.
Dennoch ist es eine Qual und wir müssen bessere Wege finden, Mutter Erde zu ehren, als uns Menschen gegenseitig zu zerfleischen und sie mit unserem Blut zu tränken.
Hier haben Bismarck schon gestritten und Napoleon, hier schlugen sich einst Franken und Sachsen, doch es gibt wertvollere, es existieren würdevollere, heilsamere Wege, eine Nation mit unseren Gaben zu beschenken, als ihr Söhne, Brüder, Väter, Kinder, Schwestern und Mütter zu opfern, denn das Leid der Kinder der Erde ist überall gleich.
Der Feind rückt vor, Franzosen, Freunde einst mir als Napoleon und Karl, doch als Napoleon, als Junge, hasste ich auch die Franzosen und nun konzentriere ich mich auf den Hass, der mich anstachelt, unsere Frontlinie zu verteidigen, wenn jetzt nur einer das MG betätigte.
Dieser Eine will ich sein.
Im MG – Nest Totenstille, niemand rührt sich, um diese Orgel des Teufels zu bedienen, die in Windeseile aus Menschen Geister, zerfetzte, durchlöcherte, zersiebte, zerteilte, fallende, flehende, zerbrochene Monster macht.
Wenn sie heim kommen ins Lazarett, nennt man sie bei den Franzosen die Gölle Kassee, ja, wie man das schreibt, werde ich später vielleicht erfahren.
Es sind die zerrissenen Fressen, Menschen, die keinen Mund, keine Nase, kein Kinn, keine Ohren oder Augen mehr haben. Alles durch den Krieg. Durch Granatsplitter, Kugeln, MG – Salven, Gewehrfeuer und alles getrieben und erfunden durch den Hass und die Angst auf-, über- und voreinander.
Ich bin in die Grube gekrochen und erkenne: Alle Kameraden hier sind tot.
Das MG 08 nur noch knapp einen halben Meter von mir entfernt.
Bald kann ich die Griffe fassen, muss mich nur noch wieder aufrichten, um die Front, unsere Soldaten, zu verteidigen, da fährt mit Wucht mir der Schlag in die Glieder, stechender Schmerz in den Gelenken, Tränen schießen in meine Augen, ich schreie vor Wut, wo ich es doch war, der schießen wollte.
Ich kann nicht, stelle ich mit tränenverquollenen Augen fest, ich kann nicht so auf meine französischen Kameraden schießen, die ich einst in Ägypten einfach zurück ließ. Allein. Verloren. Sinnlos.
Für mich waren sie bis hier her marschiert und waren mir, ihrem „kleinen Corporal“, wie sie mich nannten, absolut treu ergeben.
Durch die Luft dröhnt der Ruf zum Rückzug durch das Zischen von Gefechtssalven und deren Einschlagen irgendwo.
Auf beiden Seiten Chaos, nie waren die Frontlinien so nah, beinahe konnte ich die Augenfarbe meines Gegners erkennen, seinen Angstschweiß riechen, der sich in Nichts von dem Unseren unterscheidet. Angst riecht überall gleich.
Nicht allein deshalb, weil Franzosen und Preußen vor langer Zeit, knapp mehr als tausend Jahren, alle Franken hießen, wir Menschen leiden alle gleich, wir hoffen gleich, sehnen gleich, unsere Furcht ist mehr ähnlich, als dass sie sich unterscheidet.
Sprachen sind nur Wind und Hauch, Blut ist überall rot, Tränen glitzern stets silbern im Licht des grauen Himmels und der Erde und dem Matsch, dem Schlamm, in dem wir waten, ist es gleich, ob er Frankreich, Belgien oder Deutschland heißt.
Eine Schlacht sieht der Soldat nicht, er hört sie, du riechst sie, denn überall ist Rauch und Feuer. Wirklich sind nur die Kriegssignale, ein wenig Orientierung gibt dir die Weiterleitung von Befehlen im Gefecht, die von Trommeln, wie einst, von Signalhörnern, Signaltrompeten ertönen oder gerufen werden.
Es gibt auch den Feldtelegraphen und der hat uns soeben den Befehl zum Rückzug durchgegeben, meine Kameraden mussten mich aus dem MG – Nest fort tragen, ich habe seine hölzernen Griffe nicht zu fassen gekriegt, konnte meine Glieder nicht bewegen, Arme und Beine waren steif wie ein Baumstamm.
Ich wollte doch ans Maschinengewehr und meine Leute, die Frontlinie verteidigen, da versagte meine Kraft.
Halb schlafend, schwer atmend dämmere ich nun dahin auf meinem schmalen Lazarettbett. Einige der Verletzten stöhnen laut. Manchen wurde ein Arm oder ein Bein amputiert. Mit den einfachsten Methoden. Sie erleiden höllische Qualen.
Es gibt Forscher, die behaupten, die Schlunde der Hölle in den Vulkanen der Erde gefunden zu haben. Oder in irgendwelchen Höhlen.
Ich glaube, die Schlunde der Hölle sind unsere Sinne und das Denken der Menschen, schlicht unsere menschlichen Tore zur Außenwelt, mit denen wir alles ablehnen, mit denen wir alles haben und alles verteufeln wollen.
Wenn es aber einen Ort gibt auf der Erde, an dem die Hölle zu finden sei, so ist es hier in diesem Feldlazarett in Freiburg. Auch Leben werden hier gerettet. Ich frage mich nur, ob es eine Gnade ist oder Verdammnis, noch länger hier verweilen zu können.
Mit halb geöffneten Augen erblicke ich in einem Wachtraum Schwester Monika in weißer Schürze. Manche von uns nennen sie Monique, weil sie ab und zu auch französische, belgische Wunden gereinigt und verbunden haben soll.
Mir ist es gleich.
Für mich ist der Krieg eine Mutprobe, eine Prüfung auf Manneskraft, Härte und Furchtlosigkeit und die gilt für alle Seiten, für alle am Krieg beteiligten gleichermaßen. Im Grunde ist es also egal, auf welcher Seite du dich bewährst, Ängste überwindest, deinen Kameraden Hoffnung gibst, ihre Leben beschützt und dein Eigenes nicht schonst.
An dieser Prüfung nehmen wir alle nun teil, Belgier, Preußen wie Franzosen, wir sind Brüder in unserem gemeinsamen Schicksal, das traurig ist und völlig verrückt, da wir uns gegenseitig zerfetzen und zerstückeln, versehren und verstümmeln, wir grinsen sogar noch, wenn uns beide Beine und Arme amputiert wurden und wollen das Gewehr mit den Zähnen bedienen.
Was ist das, dieses Monster, das Krieg heißt und wohl allzu menschlich ist? Allzu beliebt?
Was peitscht uns an, zu solchen und immer neuen Gräueltaten?
Was haben, was empfinden wir daran, denen von gleicher Art, allen, dir und mir, also uns selbst, so viel Leid anzutun?
Was ist da in uns, das da raus muss, das sich befreien will und Leichen, Leid und Kummer schafft, Wahnsinn, Chaos und Zerstörung?
Geht es uns gut damit?
Es ist ein Schein, ein Trugbild, ein Sog des Elends, des Hasses, der Gewalt und der Zerstörung, des Mordens und Vernichtens, dem wir alle gleichsam verfallen sind und ziehen alle an einem Strang: Preußen und Franzosen am Strang der Bestie, die in uns allen wohnt, von uns allen Männern, wie wir da sind, Besitz ergriffen hat. Nationen spielen hier in Wahrheit keine Rolle.
Wir glauben, wir müssten uns anstrengen, müssten kämpfen, sind davon überzeugt, dass wir uns selbst nicht schonen dürfen.
Auch ich will mich nicht schonen. Hasse mein Dasein hier im Bett, will nicht zu Tatenlosigkeit verurteilt sein.
Was soll das, wieso gehorcht mir mein Körper nicht?
Still blicke ich mich um im Lazarett. Es ist eine Halle, vielleicht ein alter Bahnhof oder ein Krankenhaus, ein Rathaus, ich weis nicht, auf jeden Fall ist es kein Zelt, es ist aus Stein, mit weiß gefliesten Wänden, hell gelben Mauersteinen, bogenförmigen Fenstern, Metallbetten, die nebeneinander stehen und hier und da einige, die mit einem Laken voneinander getrennt sind.
Durch den großen Raum, der weiter hinten eine Öffnung hat, größer, als eine Türe, wodurch der Wind bis zu mir hin weht, ich liege am anderen Ende des Raumes, durch diesen Raum schallen die Schmerzensschreie der Männer und wenn ich nicht irgend eine Art von Schmerzmittel bekommen hätte, das mir meine Sinne nimmt, so nähme auch ich Teil an diesem Chor der Gequälten, diesem Engelschor der Hölle, derer, die wir uns selbst gequält, geschunden und dahin gerafft haben in diesem Krieg.
Schwester Monika pflegt einen Verletzten, der einige Betten weiter liegt und eine schwere Schusswunde hat, die eitert. Die Lazarettschwester gibt uns Krüppeln Lebensmut.
Ist sie daher Engel oder Teufel?
Himmel und Hölle sind hier ganz nahe beieinander wie die Grenzen der einzelnen Länder in dieser Gegend, wo wir alle nun im Kampfe miteinander stehen und manchmal verschwimmen sie in meinem Geiste und sind Eins.
Kaum kann ich einen klaren Gedanken fassen.
Eben blicke ich mich um, sehe Beine oder Arme, die noch fest an den Menschenkörpern sind, die hoch gebunden wurden an ein Metallgestell, wo der Fuß fehlt oder die Hand.
Vorsichtig blicke ich auf meine Hände und Füße. Ich will sie bewegen. Ich fühle Schmerz. Ich weiß, dass viele Männer, denen das Bein fehlt, doch den Schmerz noch fühlen, als sei ihr Bein noch da, fest an ihrem Körper und ganz heil.
Ich schaue hin, wobei mir das Herz pochte vor Angst, als ich vor einigen Tagen das erste Mal hier zu Bewusstsein kam.
Alles noch da.
Ich atme heftig aus, atme heftig durch, dankbar vergieße ich zum Herrgott meine Tränen, dass er mir meine Hände und Füße, Arme und Beine gelassen hat.
Angestrengt bin ich und müde.
Morpheus kommt mich holen und ich gleite ab in eine andere Zeit: Frühjahr 1905.
Ich schreibe in mein Tagebuch:
Carolinum. 1. März 1905.
Habe eine Karte von Mama erhalten.
„Mein lieber Sohn, da du ja leider auf dem Gymnasium in Ansbach derzeit bist, kannst du ja an Alberts Geburtstag nicht teilnehmen. Schicke ihm aber eine Karte, er würde sich freuen. Trotzdem alles Gute und lerne anständig.
Deine Mutter.“
Wie gebannt starre ich auf das kleine Stück Papier in meinen Händen.
Meine Augen füllen sich mit Tränen des Zorns und der Verbitterung.
Sie hat mich ausgeladen.
Keine Worte wie: „Wir sorgen dafür, dass Du über Alberts Geburtstag von der Schule befreit wirst, Onkel schickt Dir Geld für die Zugfahrt bis Nürnberg und Otto holt Dich dort vom Bahnhof ab.“
Nichts.
Es ist Alberts erster „runder“ Geburtstag und ich bin da nicht erwünscht.
Mama kann noch nicht einmal die Anrede im Brief groß schreiben, wenn sie schriftlich mit mir kommuniziert. Von mir verlangt sie Respekt, mich behandelt sie wie Dreck.
Warum?
Mein kleiner Bruder Albert ist jetzt ihr neuer Liebling. Karl, mein älterer Bruder, ist ihr Held.
Vielleicht ist das so, wenn man der mittlere Sohn ist, dass bei den Jungen die Eltern dem Ältesten ihr Haus überlassen, dem Jüngsten ihr Herz, dem Mittleren ihren Hass.
Im Chinesischen I Ging, dem alten „Buch der Wandlungen“, werden die Kräfte, die von den Eltern auf die Kinder verteilt werden, bei sechs Geschwistern, ähnlich angesiedelt.
Bevor mein kleiner Bruder am 09. März 1895 geboren wurde, musste ich bereits um Mutters Aufmerksamkeit kämpfen wie ein spätmittelalterlicher König, der sich die Gunst seiner Fürsten erstreiten muss.
Er muss darum buhlen, Bündnisse flechten, sich Gehör verschaffen und ihren Respekt erfechten.
So kämpfte ich um Mutters Liebe. Nun aber, seit Albert da ist, schlägt ihr Herz nur noch für ihn. Vater scheint mich ebenso vergessen zu haben.
Keine Post mehr von Onkel Herry.
Offenbar nimmt ihre Arbeit mal wieder ihre ganze Aufmerksamkeit ein, wobei ich mich frage, worin die Arbeit meiner Mutter besteht und warum Vater nicht in Preußen eine Anstellung findet oder am besten gleich hier in meiner Nähe, in Ansbach, in der Gegend des Carolinums, da könnten wir an den Wochenenden, die hier im Internat oft sehr lange sind, gemeinsame Ausflüge unternehmen.
Ich werde ihnen genau das schreiben.
Salziges Augenwasser klebt feucht an meinen Wangen, mein Atem stockt und nachdem ich noch etwas darauf gestarrt habe, falte ich den tränenverschmierten Fetzen Papier in das kleine Couvert, kann meinen Zorn zügeln, dass ich es nicht zerknülle oder gar zerreiße und begebe mich zu Bett.
Wir sind zu Viert auf der Stube, ich liege lange wach, kann als Einziger nicht schlafen. Wenn die anderen Jungen sich abends gewaschen haben und noch kurz unterhalten, sind sie müde und legen sich hin.
Ich auch.
Ich schließe meine Augen.
Seit einiger Zeit jagen mich aber seltsame Träume.
Mein Geist wandelt ab ins Gestern, in die Literaturausleihe.
Ich wanderte mit meinem dicken und branntneuen „F. W. Putzgers Historischer Schul – Atlas“ von jetzt, dem Jahre 1905, den ich mir für einen Vortrag über die Wege der verschiedenen Stämme durch die Zeit ausgeliehen hatte, in die Musikausleihe, und verlangte einen Klavierauszug zu Bachs Toccata und Fuge BWV Nr. 565.
Aber da war am Tresen nicht mehr Ulrich, der mir gestern noch Chopin gegeben hatte, sondern Heinrich, ein eingebildeter Obersekundaner.
Die Oberaufsicht über die Musikliteratur hat er nur nebenamtlich. Hauptamtlich ist er einer der fiesesten und arrogantesten Jungen der Oberstufe und offiziell dafür zuständig, Jungs aus der Unterstufe, wie mich, zu drangsalieren und als Ablagefläche seines Unwohlseins zu benutzen.
Versucht er jedenfalls.
Den muss ich manchmal echt umgehen, sonst verleidet er mir die Lust am Lernen und am Leben. Wie macht er das bloß?
Im Grunde hab ich nichts mit ihm zu schaffen. Ich darf einfach seine Meckereien nicht persönlich nehmen. Vielleicht verachten ihn seine Eltern ja noch mehr, als meine mich, wobei ich mich im Grunde nicht beklagen darf, mein Onkel hat mir schon oft das Paradies auf Erden verschafft und zur Schule müssen wir ja schließlich alle.
Muss tatsächlich lachen bei dem Gedanken, dass ich zu meiner Zeit als Karl der Große faktisch den Grundstein für die Bildung aller im Reich, sogar aller Kinder, selbst gelegt hab.
Heinrich schaut mich schief an und bemerkt spöttisch, Herr von Eggenfelden, unser Musiklehrer, sei erkrankt, ich könne mir das Gewünschte nicht ausleihen, da ich zur Zeit keinen Musikunterricht hätte.
„Ich möchte die Noten nur lesen,“ sage ich.
„Pha, nix da! Kannst du denn überhaupt Noten lesen? Was bist du? Quintaner? Nun leg’ die Noten mal wieder schnell zurück für einen, der sie wirklich braucht.“
Und bevor er sich überlegt, den Klavierauszug selbst wieder ins Fach zurück zu räumen, drehe ich mich auf dem Absatz um und tue so, als ob ich in Richtung der Regale für Partituren und Klavierauszüge bei den Oratorienwerken ginge.
Von dem Klavierauszug von Bachs 565 haben wir so viele, da werde ich mir schon einen ausleihen können, ohne jemandem zu schaden, Heinrich soll sich nicht anstellen.
Zwischen den Regalen kann Heinrich mich nicht sehen. Ich lege das Heftchen mit den Noten in den „Putzger“ und so wandern Bachs Noten inkognito in meinen Schrank und anschließend in eine kleine graue Mappe unter mein Kopfkissen.
Zu Haus habe ich eine eigene Ausgabe von Bachs 565, es ist eine einfachere Fassung ohne den Satz für Pedale.
Natürlich hätte ich mir die von daheim schicken lassen können, aber auch von dort vermute ich nur lästige Fragen und will keine schlafenden Hunde wecken, indem ich denen zu Haus erzähle, was ich hier in Ansbach in Wahrheit treibe: Meine Seele heilen.
„Lauter Unfug“, wird Mama und wahrscheinlich auch Papa sagen. Meine Idee von der heilen Seele habe ich ihnen früher einmal versucht, darzulegen, hab’ aber kläglich versagt.
Daheim hatte ich versucht, mir die Leitmelodie der Toccata in D – Moll von J. S. Bach selbst beizubringen und es ging einigermaßen an Onkels Flügel. Wie schade, dass mir diese Töne nicht leichter von der Hand gehen, es würde diesem herrlichen Instrument gerecht.
Auch hier im Carolinum gibt’s Klavierunterricht und ich mag den alten Herrn Eggenfelden, doch wir verharren trostlos in ständigen Etüden.
Mein Herz sehnt sich nach der Göttlichen Melodie, die Du, Bach, mir geschaffen. Ich danke Dir von Herzen, will Deine Toccata, will Deine Kantaten, will „Tochter Zion“ spielen, singen, hören, tanzen, lauschen, feiern, will in Deiner Musik, Deiner Himmelskunst und Himmelsbotschaft mich verlieren.
Und auch Camille Saint – Saens und Smetana, Beethoven, Mozart und Puccini, ich sehne mich nach Euren Melodien!
Zum Eintritt in mein Gymnasium hat mir Onkel Harry ein eigenes Grammophon geschenkt, aber der Rektor Helmreich hat mir verboten, dass ich es hier habe.
„Musik sollt ihr hier nicht hören, ihr sollt sie lesen und spielen lernen,“ hatte er mir persönlich gesagt, mit ruhiger Stimme in einer eigentlich freundlichen Art, gütig, als ich vor ihm stand, beinahe liebevoll, doch ich war nicht fähig, ihm dies auf eben die gleiche Weise zu erwidern, denn Musik zu lauschen, sie wahrzunehmen und von einem Grammophon zu hören ist höchster Genuss mir, ist Vereinigung mit Gott, ist Heilung meines Herzens, der Wundmale an meinem feinstofflichen Körper und ich, der ich derartige Qual empfinde, dass ich nicht die liebliche Stimme Gottes in meinem Herzen hören darf, brauche die Musik, die mir köstlicher Quell in den Künsten ist, um meinen Weg zu finden, um auf meine eigene Hallig zu gelangen, meine kleine Scholle, auf der ich Ruhe, Frieden und Glück empfinden kann.
Nur dies zu formulieren gegenüber diesem milden Herrn, der nicht die Schärfe meiner Worte verdient hat, der ja nur ein ordentliches Gymnasium sorgsam leiten will, auf dass vielleicht auch andere Knaben die Gelegenheit erhielten, einst wie Bach, Beethoven oder Smetana zu werden, wie Mozart oder Charles Gounod, der starb, in dem Jahr, als ich geboren wurde und sein heiliges „Dominus non sum dignus“ in das AGNUS DEI seiner Messe solennelle de Sainte – Cecile einfügte, welches mir im Originalton aus dem Herzen spricht.
So brachte ich nur drohende Blicke und Töne heraus, stürmte flugs aus dem Rektorat und ließ ihn allein, den armen Herrn Rektor Professor Georg Helmreich, der mit seinen mannigfaltigen Studien und bedeutenden Schriften, mit der Leitung unseres Gymnasiums schon genug zu tun hatte, da konnte er nicht auch noch der Seelenarzt der Alumni sein, der Beichtvater oder Psychopompos seiner Schüler.
Und so teile ich ihm nicht mit, was mir so sehr auf dem Herzen liegt, dass ich der Jüdische Messias bin und außerdem einst ein Knabe war, den die Menschen in Onoltzbach Kaspar Hauser nannten.
Erst dachte ich auch, ich sei von fremder Hand getötet worden, doch dann hatte ich einen Traum im Halbschlaf, quasi eine Vision, in der ich von einem Menschen, von dessen Hand mit einer Art Messer, einem Messer oder einem Dolch, erstochen wurde. Es schneite, es war Januar. Auf dem Pfad bei einem Feld, ich kam von einem Friedhof oder Park, in dem Statuen standen, in der Gegend hier in Ansbach, da kam ich auf dem kalten, verschneiten Boden zu liegen.
Ich war hingefallen und blutete stark.
In dem Augenblick, als der Dolch in meinen Körper eindringt, wandele ich mich selbst vom Erstochenen, vom Opfer sozusagen, in den eigenen Täter. Ich hatte mich selbst erstochen. Ich hatte mich selbst verletzt. Ich wollte Beachtung finden. Ich hatte mich von meiner Seele als Napoleon Bonaparte abgespalten um sein Erbe zu werden, der Erbe Frankreichs.
Von Frankreich, meinem einstigen großen Reichsteil Karls des Großen, konnte ich nicht loslassen. Nein, das vermochte ich nicht. Ich fertigte eine Flaschenpost an, in der ich in verschlüsselter Weise niederschrieb, dass ich der Erbe Frankreichs sei.
Aber ich wollte Aufmerksamkeit und die durch Leiden, nicht durch die Wahrheit, die vermochte ich nicht zu sagen.
Zu sehr schmerzte in mir die Erkenntnis, dass mein Sohn, Napoleon II. bei den Menschen nicht als mein offizieller Nachfolger anerkannt wurde.
Was ist ein Herrscher, und ist er noch so mächtig, wenn er keinen fähigen Erben hat, der das Reich in seiner ganzen Kraft und Größe aufrecht erhält?
Es ging mir wie mir, also wie Karl, der seinen einzigen überlebenden Sohn Ludwig zum Nachfolger bestellen musste, in dem tiefen Wissen, dass dieser mehr von Zweifeln als von Zuversicht, mehr von Fragen, als von Führungskraft, mehr von Zögern als von Zutrauen erfüllt war.
Und auch ich, Napoleon, die Wiedergeburt Karls des Großen und Gaius Julius Cäsars und Jesu Christi und des Arminius, ich spürte schon lange, dass vielerorts so manches gegen mich im Anzug war.
Allen voran General Malet, überzeugter Republikaner, der seine Schergen um sich scharte. Schon ab 1808. Ja. Gewarnt war ich worden. Gespürt hatte ich diese Bedrohung sehr wohl, sie war mir nicht entgangen. Doch wie ich, wie der arme Cäsar, konnte ich es nicht fassen, konnte nicht damit umgehen. Als Cäsar hätte ich die, von denen ich hörte, schon Zeiten vorher töten lassen können. Doch wer sollte mir dann noch Liebe entgegen bringen, wer Vertrauen? Ich hätte doch all den Hass meiner Mitmenschen auf mich gezogen!
Also spaltete ich einen Teil meiner Seele ab, es war schon einige Zeit vor dem Russlandfeldzug, um mein eigener Nachfolger zu werden sozusagen.
Doch Schockstarre überfällt mich, wenn ich an Cäsars Ende denke. Dann fällt mir nichts mehr ein, mein Geist ist blockiert, mein Blut gefriert in meinen Adern, Hass umfängt mich, Hass und ewige Kälte und nur Angst und Panik, Panik und der Tod.
Mein Tod.
Weder den Menschen damals in Nürnberg, weder den Menschen im alten Ansbach, in Onoltzbach, dem Lehrer, der auch Georg mit Vornamen hieß, wie mein Schuldirektor hier im Carolinum, getraute ich mich zu offenbaren, noch den anderen Menschen heute, weder meiner Mutter oder meinem Vater, die ja nur für mich da waren, wenn es etwas zu rügen gab, noch meinem Onkel, dem ich schon so oft erzählte, dass ich Karl der Große, Otto von Bismarck und Napoleon sei und er nickte immer nur, den wollte ich mir als Freund und mir zugewandten Menschen nicht verderben.
Und auch meinen Direktor nicht. Und von Jesus sagte ich auch nichts, von König David und Jakob. Das war wohl besser so.
Es ist wohl besser so, denn auch ich muss, will nun allein sein, kann meine Begegnungen mit göttlichen Wesen, mit meinen Inkarnationen und allem voran mit meinem Versagen kaum in Worte fassen, die andere Leut verstehn.
Auch für mich ist das alles ziemlich viel. Aber es ist die Wahrheit.
Und was mir hilft, diese Wahrheit zu ertragen, ist oft die Musik, das göttliche Spiel.
Ob ich heute Nacht in den Musiksaal gelangen könnte?
Unbemerkt?
Wut packt mich und Verzweiflung und Trauer darüber, daheim derart unerwünscht zu sein am Geburtstag meines kleinen Bruders.
Ich will an den Flügel und mir mein Leid von der Seele spielen. Ich will in der Musik Gott in meinem Herzen begegnen.
Wütend bin ich auf Mama. Will sie mich strafen?
Wofür?
Aufrecht sitze ich in meinem Bett und lausche in die Stille in unserer kleinen Kammer. Ernst, Jacob und Ben, meine Zimmergenossen, schlafen fest. Keiner wird mich hören, wenn ich barfuß in die unteren Etagen mit den Klassenzimmern schleiche, dort die schwere, etwa vier Meter hohe, weiß gestrichene Doppeltüre zum Musiksaal öffne, die nie richtig schließt.
Das Holz hat sich verzogen.
Wir lehnen den einen Flügel der Türe meist nur an und dann kommt ein schweres Bügeleisen davor, ein, wie der Bug eines Schiffes geformtes Eisengewicht mit Holzgriff. Unser Hausmeister benutzt es dafür, damit der offene Flügel nachts bei Luftzug nicht weiter aufschlägt.